
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
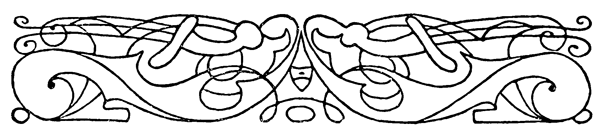
Es giebt bekanntlich Zeiten wo Katzen sich im Mondschein auf den Dächern tummeln und aus allen Gassen und Winkeln ihr verliebtes Heulen und Flöten tönt. Für die junge Welt der Römerstadt hatte diese Zeit zwei Höhepunkte: einen natürlichen in den beiden ersten warmen Frühlingsmonaten und einen künstlichen während des Faschings, wo an Stelle der Sonne und der lockenden Mailuft Wein und überheiße Säle voll Tanzmusik die Früchte des Herzens reiften. Um das Herz handelte es sich zwar eigentlich im Fasching wenig: es war vielmehr ein Rausch, in dem das Elend des Winters sich betäuben wollte, wo der beißende Wind in die kalten Zimmer blies, die voll von arbeitslosen nach Schnaps riechenden Männern, abgehärmten Frauen und neugeborenen in ihren Tüchern wimmernden Kindern waren. Zuweilen kamen um diese Jahreszeit einige sonnige, warme Tage wie schöne Fremdlinge auf eine öde Insel verschlagen, die man bekränzt und anbetet und mit ausgelassenen Freudenreigen umtanzt, und dann war der Taumel um so hinreißender. An einem solchen Tage kam die arme, kleine Anetta zur Farfalla und bat sie um ein paar bunte seidene Tücher, wie sie Nannis Mann der Schiffsheizer, von seinen weiten Reisen mitzubringen pflegte, und von denen die haushälterische Farfalla seit langem einige verwahrte; sie wollte am Abend einen Maskenball besuchen und sich aus dem Tand einen Putz machen. Die Farfalla wunderte sich nicht nur darüber, daß Anetta, die noch nicht ein Jahr lang Witwe war und ihren Mann so heftig beweint hatte, tanzen gehen wollte, sondern auch, daß sie sich ein paar armselige Tüchlein zur Kleidung erbetteln mußte, noch dazu von einer notleidenden Frau wie sie war; denn man wußte, daß Anetta vom Pfarrer Jurewitsch immer unterstützt wurde, so daß sie nicht einmal zur Arbeit hätte gehen müssen, wenn ihr das nicht der Kurzweil wegen ein Bedürfnis gewesen wäre. Aber für die arme, kleine Anetta war das wenig, womit sich die Farfalla steinreich gedünkt hätte. Sie wußte sich nicht verständig einzurichten, bezahlte eine Nachbarin dafür, daß sie ihr die Kinder ein wenig beaufsichtigte und ihnen zu essen gab, kaufte dies und das für die Kinder ein, was sie, sich selbst überlassen, gleich verdarben, anstatt daß sie zu Hause geblieben wäre und mit dem gewirtschaftet hätte, was der Pfarrer ihr gab.
In der Altstadt wußten alle, daß der Jurewitsch der Anetta Geld gab und sie noch dazu häufig besuchte und lange bei ihr blieb. Seiner Angabe nach war das Geld der Ertrag einer Sammlung, die er für sie veranlaßt haben wollte, doch niemand glaubte daran; denn es waren öfters Männer gestorben und hatten Witwen und Waisen hinterlassen, ohne daß er sich in solcher Weise bethätigt hatte. Da Anetta außerdem zwar für den derben Volksgeschmack zu zart und blaß, denn nur bei großer Freude oder Erregung wurde sie rosenrot, aber doch unverkennbar lieblich in ihrer hilflosen Kindlichkeit war, lag der Verdacht, die Beflissenheit des Pfarrers auf ein Liebesverhältnis zurückzuführen, nahe. Anetta versicherte indessen bei jeder Gelegenheit nachdrücklich, von dergleichen sei nicht die Rede und der Jurewitsch sei der edelste, uneigennützigste, heiligste Mensch, was ihr auch namentlich von den Frauen bereitwillig geglaubt wurde. Ihr selbst traten oft die Thränen in die Augen, wenn sie so heftig seine Ehre verteidigte, weil sie im Herzen halb unbewußten Kummer unterdrücken mußte, daß es so und nicht anders war. Seelsorgerisches Wirken wurde dem Jurewitsch nicht leicht, und seine Bemühungen, an dem äußeren und inneren Leben der kleinen Anetta teilzunehmen, fielen ungeschickt aus, würden aber in jedem Falle zu nichts Gutem geführt haben; wenn er sprach, hing sie mit weit offenen Augen und offenem Munde an seinem schönen Gesicht, nichts ging ihr ein und nichts war in ihr als die Erwartung, ob er sagen würde: ich liebe dich, sei mein. Ohne einen Augenblick zu zögern würde sie sich in seine Arme geworfen haben, und da er ihrer Hingebung nur beim Kommen und Gehen mit einer flüchtigen Berührung seiner langen schmalen Hand begegnete, die immer kühl war und sich im Druck anfühlte wie ein ausgestopfter Handschuh, wurde ihre Sehnsucht und Zärtlichkeit allmählich unbezähmbar und einem krankhaften Bedürfnis ähnlich.
»Was willst du auf den Maskenball gehen?« sagte die Farfalla gutmütig; »ich bin fünfundfünfzig Jahre alt geworden ohne je einen mitgemacht zu haben. Am anderen Morgen ist dir der Kopf zu schwer zur Arbeit.« Die kleine Anetta setzte sich auf den Küchentisch, denn die Farfalla war eben am Herde beschäftigt, starrte in das sprühende Kohlenfeuer und sagte: »Ich muß einmal wieder lustig sein.« »Aber das bist du ja den ganzen Tag«, entgegnete die Farfalla, »mit den Kindern sowohl wie bei der Arbeit.« »Das meine ich nicht«, sagte Anetta, »ich meine etwas ganz anderes, etwas Tolles, Rauschendes, wobei man den Kopf verliert und sich selber und alle Welt vergißt.« »Das giebt es nicht«, sagte die Farfalla und lachte. »Es giebt es«, behauptete die kleine Anetta, wobei ihre großen blauen Augen schwarz wurden vom innerlichen Feuer, ohne aber zu erklären wo es sich fände und woher sie es kennte.
Was denn der Pfarrer dazu sagen würde, meinte die Farfalla, der so gut gegen sie wäre und sie jedenfalls sehr lieb hätte. Im Anfang, sagte Anetta mit einem Seufzer, hätte sie das auch geglaubt und sie müßte es ja auch noch glauben, warum sollte er ihr sonst so viel Geld geben? Aber vielleicht weil er geistlich wäre, wollte er es nicht sagen, sondern ginge immer fort, wie er gekommen wäre, und bekümmerte sich mehr um die Kinder als um sie. Ueberhaupt, so schön er wäre, toll, wie sie meinte, als ob man Wein im Kopfe hätte, könnte man mit ihm nicht sein.
Am Tage nach dem Maskenballe begegnete die Farfalla der Anetta, die verträumt und übernächtig, wirklich wie nach einem Rausche aussah. »Bist du zufrieden?« fragte sie; Anetta nickte und lächelte und huschte vorüber. Ein paar Wochen später kam sie blaß und schmal und kläglich zur Farfalla, setzte sich in eine Ecke und weinte und konnte nur durch langes, freundliches Zureden zum Sprechen und Erzählen gebracht werden. Am Brunnen beim Wasserholen hatten Frauen und Mädchen von einem Manne gesprochen, mit dem sie beim Maskenballe getanzt hatte, und von dem sie so gut wie nichts wußte als den Namen. »Es ist das fünfte«, hatte eine der Frauen gesagt und damit ein neugeborenes Kind gemeint, »nämlich das fünfte, das er von seiner Frau hat, die übrigen zählt er nicht.« Auf diese Weise erfuhr Anetta, was sie bis dahin nicht von ferne vermutet hatte, daß der Mann verheiratet war, eine für sie deshalb bis ins Herz erschreckende Thatsache, weil sie selber auf ihn gerechnet hatte. Ob er ihr Versprechungen gemacht hätte? fragte die Farfalla. Nein, keine Versprechungen er kannte nicht einmal ihren Namen und sie hatte nur durch Zufall den seinigen erfahren; aber ein Kind hatte sie von ihm, den sie außer an jenem Maskenballe weder vorher noch nachher gesehen hatte.
»Und du hattest geglaubt, er würde dich heiraten?« fragte die Farfalla voll Erstaunen. Anetta nickte; »geglaubt nicht, aber gehofft«, sagte sie leise.
Die Farfalla lachte Anetta aus und schalt sie, hatte aber gleichwohl den Wunsch, ihr in irgend welcher Weise beizustehen, und schlug ihr vor, ob sie den Pfarrer nicht könnte glauben machen, das Kind des Maskenballs sei das seine. Dies aber lehnte Anetta als unmöglich ab, da überhaupt niemals auch nur die allerkleinste Liebesannäherung zwischen ihnen stattgefunden habe.
»Und Sie geben einem schwachen Geschöpfe so abgefeimte, niederträchtige Ratschläge?« sagte ich entrüstet; »leiten sie an, ihren Wohlthäter aufs unverschämteste zu hintergehen, vielleicht ihn fürs Leben unglücklich zu machen?« Die Farfalla lachte hell auf und sagte: »Und was für Sünde wäre denn dabei? Wenn er ein Kind von ihr haben könnte, geschähe ihm nicht recht, wenn man ihm weismachte, es wäre da?« Daß sie den Jurewitsch in falschem Verdacht gehabt hatte, beschämte sie nicht im mindesten.
Indessen wurde Vittoria aus dem Krankenhause entlassen und bei ihrer Schwester Nanni, deren Mann fast immer auf Reisen war, zu beider Zufriedenheit untergebracht. Vom Spital aus war ihr empfohlen worden, zunächst noch keine anstrengende Arbeit zu übernehmen, übrigens aber versichert, sie sei so gesund wie zuvor und würde es auch bleiben vorausgesetzt, daß sie keine Kinder mehr bekäme. Hierüber war sie, sowie ihre ganze Familie ruhig, denn von ihrem Mann, der ohnehin spurlos verschwunden war, wollte sie natürlicherweise nichts mehr wissen, hatte aber zum Ueberfluß der Farfalla, der Nanni, ihrer Schwiegermutter und namentlich dem Kapitän in die Hand versprochen, sich nie mehr, was er auch beteuern und wie er sich auch entschuldigen möchte, mit ihm einzulassen. Wiederverheiraten konnte sie sich nicht, überhaupt aber sagte sie, daß sie der Männer überdrüssig wäre und auch mit Kindern wünschte sie keine neuen Erfahrungen zu machen. Die Farfalla, die immer das Bestreben hatte, sich mit dem Geschehenen auszusöhnen, war mit dieser Sachlage sehr zufrieden und setzte außerordentliche Hoffnungen auf Carmelo und Vittoria, die arbeiteten und verdienten, aber wenig verbrauchten, und wenn sie sehr alt und zur Arbeit nicht mehr fähig sei, für sie sorgen würden. In der ersten Zeit wußte sie nicht genug von Vittorias wiedererblühter Schönheit, ihrer Ausgelassenheit und wie gut und friedlich sie mit der Schwester lebte, zu erzählen, allmählich wurde sie stiller darüber, und als ich mich im Anfange des Sommers einmal nach Vittoria erkundigte, zuckte sie die Schultern und sagte: »Die lebt schon seit ein paar Wochen wieder mit ihrem Manne.« Ich hatte die Farfalla noch nie vorher beschämt gesehen, sie schlug die Augen nieder und wünschte augenscheinlich das Gespräch nicht fortzusetzen; es fiel mir nun auch auf, daß sie schon seit einiger Zeit graubleich im Gesicht und weniger munter und reich an Einfällen war als sonst. Wie sie das hätte zugeben können? fragte ich; warum der Kapitän es nicht verhindert hätte? Man hätte sie lieber einsperren sollen; ob er etwa gar Gewalt gebraucht hätte? Nein Vittoria selber hatte es gewollt und durchgesetzt, kein Widerstand hatte genützt. Pasquale war auf einmal wieder dagewesen, wo er sich inzwischen aufgehalten, erfuhr man nicht, hatte Vittoria aufgespürt, ihr geschrieben, sie getroffen und wie es scheint mit Leichtigkeit überredet, wieder zu ihm zu ziehen. Alle Geschwister hatten nun, wie sie es vorher angekündigt hatten, den Verkehr mit ihr endgültig abgebrochen, auch der Kapitän zürnte unversöhnlich; sie selber sähe sie zuweilen, sagte sie kurz; was würde es auch nützen, wenn sie bös sein wollte? Schon war auch wieder ein Kind in Aussicht.
Carmelo war jetzt die einzige Hoffnung der armen Frau, die nicht wußte, daß auch dieser der Absicht nach sie bereits verlassen hatte. Von Riccardo erfuhr ich, daß er, der nie etwas von den Weibern hatte wissen wollen, sich maßlos und tollköpfig verliebt hatte, und noch dazu in ein Mädchen, vor dem er früher ausgespuckt hätte, wenn er ihr auf der Straße begegnet wäre, nämlich in Galanta. Die Eifersucht auf Riccardo, der Groll, daß er ihr gleichgültig war, die ganz veränderte Lage, in die er sich selbst gegenüber geraten war, alles zusammen hatte ihn völlig aus dem alten Geleise geworfen, so daß er denen, die nichts davon wußten, nicht anders als krank im Geiste oder Gemüte erscheinen konnte, was er ja eigentlich auch war. Zur Arbeit ging er fast nie mehr, kam aber auch nicht nach Hause, sondern strich planlos in der Umgegend umher oder saß sogar in den Wirtshäusern und trank, bis er in einem Zustande von Erhitzung war, daß man ihn nicht ohne Gefahr anreden konnte. Die Farfalla litt darunter, verschwieg es mir aber nicht nur, sondern suchte es vor mir zu verbergen, obgleich durch den Ausfall seines Verdienstes die Not, an die sie gewöhnt war, anfing, unerträglich zu werden.
Mit Galanta ging unterdessen etwas Merkwürdiges vor. Schon als Torquato den Anschlag auf Riccardo vorhatte, war sie ihm entgegengetreten, seit sie aber wußte, daß er den kleinen Berengar umgebracht hatte, denn daß er der Mörder war, konnte sie sich ohne Mühe zusammenreimen, empörte sie sich innerlich gegen ihn. Ich will nicht sagen, daß sie ihn haßte, weil er etwas Schlechtes begangen hatte, im Gegenteil liebte sie ihn im Grunde nach wie vorher, nur ein verzweifeltes Gemisch von Grauen und Ekel fühlte sie, verkroch sich wie ein Tier, das sterben will, vor den Menschen und überließ sich in der Einsamkeit wildem Schmerz. Vor Gericht verweigerte sie jede Aussage über etwaige Beziehungen ihres Bruders zu der Unthat, sowohl zu seinen Gunsten wie zu seinem Schaden und beharrte dabei, daß er sie vor vielen Wochen verlassen und nichts mehr von sich hätte hören lassen Da ihr Leumund kein guter war und sie bisher ein einmütiges Zusammenleben mit Torquato geführt hatte, mußte sie als stark verdächtig tagelang in Untersuchungshaft bleiben, während welcher Zeit sie sich durch eine rasche und wilde That die Zuneigung der Altstadt, wo man ihr stets übelgewollt hatte, gewann.
Es schwebte nämlich damals der Prozeß gegen eine Gräfin die angeklagt war, ihre vierjährige Stieftochter ermordet, vielmehr ihren Tod absichtlich herbeigeführt zu haben. Beide, die Gräfin und das Kind, waren in der Altstadt wohlbekannt; denn sie bewohnten einen alten dort gelegenen Familienpalast des Grafen ihres Mannes, und waren mit wenigen anderen die einzigen vornehmen und reichen oder wenigstens üppigen Leute der Gegend. Wären sie wirklich vornehm und vermögend gewesen, würden sie die Armen ohne Zweifel geliebt und verehrt haben, aber es hieß, daß sie weniger als das elendeste Gesindel in der Heidenstadt besäßen und ihren Aufwand vermittels Schuldenmachen bestritten, und die Gräfin war von geringer Herkunft, was man ihr trotz aller Schönheit, um deretwillen der Graf sie geheiratet hatte, wohl ansah. Sie war eine Frau von vollen Formen roter Gesichtsfarbe und blitzenden dunklen Augen, hätte aber alle diese Vorzüge, die sie genau kannte und auf die sie pochte, mit Freuden für den unbeschreiblichen Duft von Feinheit und Anmut hingegeben, der das vierjährige Stiefkind umgab und der ihr fehlte.
Wahrscheinlich war dieser Neid der erste, unbewußte Grund des Hasses gewesen, den die Gräfin gegen die Kleine hatte, und das kleine Erbe, was sie von ihrer verstorbenen Mutter zu erwarten hatte, und der Umstand, daß die Gräfin selbst keine Kinder bekam, fielen weit weniger ins Gewicht. Das kleine Mädchen schmächtig und fein und ohne Arg seines vornehmen Standes, war der Liebling der Altstadt. So armselig und häßlich seine Stiefmutter es auch kleidete, hatte es doch etwas Auserlesenes und Liebreizendes an sich, sowohl wenn es sprach, wie wenn es ging und, bevor es den schmutzigen Fahrweg überschritt, mehrmals den Fuß hob, schüttelte und abspritzte wie eine reinliche Katze und dann behutsam und flink hinüberlief. Seit es bekannt würde, daß die Gräfin ihre Stieftochter mißhandelte, liebten sie das arme Kind noch mehr in demselben Grade, wie der Haß und die Verachtung der Frau zunahm. Wunderbarerweise sammelte sich aller Haß auf sie, während mir der Graf noch viel verabscheuenswerter erscheinen wollte. Dieser Mensch war in seine zweite Frau so niederträchtig verliebt, daß er, als er bald nach der Verheiratung herausfühlte, wie jede Zärtlichkeitsäußerung seinerseits gegen die Kleine sie ärgerte und reizte, alles derartige unterdrückte und sein Kind fallen ließ; er fragte nicht mehr nach ihr, wo sie sei und was sie treibe, ja nicht einmal im Geheimen sah er sich nach ihr um, geschweige denn, daß er sie beschützt hätte. So war das arme kleine Mädchen der rohen Stiefmutter preisgegeben, die von Vernachlässigung zu Härte und Mißhandlung vorschritt und mit Hunger und Kälte, Leiden und Entbehrungen jeder Art gegen das zarte Leben wütete. In der Dämmerung kam das gemarterte kleine Wesen häufig in den nahegelegenen Laden eines Bäckers und flehte mehr mit den Augen als mit Worten um ein Stückchen Brot, was ihm auch bereitwillig gereicht wurde. Wie ein zahmer Vogel, der die Stunde genau weiß, wo ihm Futter gestreut wird, kam es täglich um dieselbe Zeit, sich seine Bröckchen zu holen, so daß es den Leuten sehr auffiel, als sie mehrere Tage hintereinander ausblieb. Man vermutete, daß die Stiefmutter auf ihre Spur gekommen war und sie zurückhielt, erging sich in allerlei Befürchtungen und schließlich fanden sich einige, die die Sache zur Anzeige brachten Die Behörde ließ wirklich den Zustand des unglücklichen Kindes untersuchen, das schon sterbend war und nicht mehr gerettet werden konnte; der Augenschein bewies aber, daß es langsam zu Tode gemartert war, und infolge einer Menge von Verdachtsgründen wurde die Gräfin in Anklagezustand versetzt.
Während ihres Aufenthaltes im Gefängnis hatte die Gräfin Bekanntschaft mit zwei verworfenen Personen angeknüpft; eine war ein rothaariges bleiches Mädchen die nach vorangegangener Verabredung mit ihrem Geliebten einen reichen Liebhaber auf ihr Zimmer gelockt und ihm mit einem Rasiermesser den Hals abgeschnitten hatte; die andere ein Dienstmädchen mit hübschem, frechem Gesicht, die ihre Herrschaften in geriebenster Weise bestohlen hatte. Sie war überzeugt, daß sie allen Männern durch ihre Schönheit die Köpfe verdrehe, und erzählte gern von den verliebten Richtern, die sie stets zu den gelindesten Strafen verurteilten oder gar freisprächen. Diese beiden Geschöpfe bedienten die Gräfin und behandelten sie mit schlauer Unterwürfigkeit, wofür sie an den Bequemlichkeiten, mit denen der Graf seine Frau versorgte, namentlich an den Leckerbissen, Weinen und Speisen, die er ihr schickte, teilnehmen durften. In dem Zimmer der Gräfin feierten sie ausgelassene Gelage, wobei sie und das Dienstmädchen es darauf ablegten, die rothaarige Mörderin zu berauschen, die, wenn sie etwas angetrunken war, das Halsabschneiden auf eine schaudererregende und zugleich drollige Art vorzumachen wußte. Anfangs, als Galanta in das Gefängnis kam, versuchten sie es, sie in ihre Gesellschaft hineinzuziehen, da diese aber jeden Annäherungsversuch ablehnte und gegen die Gräfin sogar grimmigen Haß offen äußerte, fingen sie an, sie mit Hohn und Beschimpfungen zu verfolgen und schwelgten in dem für sie seltenen Vergnügen, auf eine noch gemeinere und schmachvollere Person herabzusehen; denn so betrachteten sie jetzt Galanta. Das trug noch dazu bei, Galanta zu reizen, die von Beginn an gewissermaßen auf dem Sprunge gewesen war, die Kindermörderin anzufallen und zu zertreten, zu zerquetschen, zu zerreißen oder was immer wütende Entrüstung mit dem Verabscheuten vornimmt. Bei Gelegenheit eines Wortwechsels stürzte sie sich plötzlich auf die Gräfin und würgte ihr den Hals, so daß sie verloren gewesen wäre, wenn nicht auf das Geschrei der beiden anderen Wächter gekommen wären und sie befreit hätten. So verhaßt war die Gräfin, daß die Wächter, wie wenigstens insgeheim gesagt wurde, sich nicht sonderlich beeilten, sie zu retten, und es weniger ihretwegen thaten, als um Galanta vor den Folgen eines Totschlages zu bewahren. Bald darauf wurde, wie ich beiläufig bemerken will, die Gräfin zu achtzehnjähriger Zwangsarbeit im Klostergefängnis verurteilt, woran ihr Mann die Scheidungsklage gegen sie einreichte, mit der er aber abgewiesen wurde. Er trieb sich noch einige Jahre als Schwindler im Auslande umher und starb arm und verlassen wie ein kranker Hund, so daß zur Genugthuung der Menschen sich hier einmal das Böse recht sichtbar und treffend auf Erden bestraft hatte.
Als Galanta, aus der Haft entlassen, wieder in die Altstadt zurückkehrte, nahm sie ihren früheren Lebenswandel nicht wieder auf, sondern ging arbeiten, einige Leute sagten, weil die Männer die Lust auf die mordsüchtige Kreatur verloren hätten und weil ihr im Gefängnis die Schönheit abhanden gekommen wäre. Letzteres war keineswegs der Fall, nur ihre Kleidung war farbloser und weniger auffallend als früher, weil etwas anderes sie ganz beschäftigte; ihr sonst offenes und leicht lesbares Gesicht war von einem stummen starken Verlangen umhüllt. Ich äußerte gegen Riccardo die Vermutung, sie hätte sich vielleicht ernstlich verliebt und wohl gar in Carmelo, dessen wieder verändertes, aufgeregt-lustiges Betragen diese Meinung unterstützte. Ein Zufall bestätigte sie mir vollends, als ich eines Abends, da eben die Dämmerung einbrechen wollte, in den baumreichen Anlagen unweit der Stadt spazieren ging. Hier pflegten sich im Frühling die Kinder der Wohlhabenden mit ihren Wärterinnen aufzuhalten in zierlichen flatternden Kleidern von allen Farben, die bunt durch das maigrüne Laub leuchteten, mit hellen Stimmen lachend beim Federballspiel oder Reifenschlagen. Tiefer im Gehölz auf Bänken saßen wartende Mädchen mit einem Buche oder einer Stickerei in der Hand, oder Liebespaare, die in ihrem Geflüster innehielten und sich losließen, wenn die geputzten Kinderfrauen mit Säuglingen auf dem Arm oder schwangere Frauen mit müdem Gang und blassem Gesicht, Kinder an der Hand führend, langsam an ihnen vorübergingen. Ich hatte mich, um ungestört zu lesen, dorthin begeben und wäre an einem Liebespaar, das weltvergessen und kosend auf einer steinernen Einfassung des Weges saß, achtlos als an etwas Alltäglichem vorbeigegangen, wenn ich nicht Galanta an ihrer Haltung erkannt hätte. Keine andere Frau habe ich je so schilfgerade und zugleich so unsäglich biegsam gesehen, wie meine Schwertlilie, die dunkle und wilde, mit den sanften hingerissenen Bewegungen, als ob der wehende Wind sie verursache. Carmelo war halb knieend vor ihr und sie sah mit den Augen über ihn weg, während sie ihn fest und doch gleichgültig, wie ein Raubtier seine Beute, die ihm nicht entrissen werden kann, an sich drückte. Ich dachte, indem ich ruhig weiterging, sie hätte wohl angefangen, sich nach einem ehrlichen Namen, einigermaßen geordnetem Haushalt und männlichem Schutz zu sehnen und deshalb die Bewerbung des anfänglich Verschmähten angenommen Thatsächlich kamen aber diese Dinge für Galanta durchaus nicht in Betracht, und was sie wollte, war etwas ganz anderes, nämlich ein Kind. Wer mag genau wissen, wie ihr dieser Wunsch zu Sinne gekommen war? Er packte sie mit solcher Leidenschaft, daß sie selbst nicht zweifelte, Gott würde um ihretwillen ein Wunder thun und im Notfall einen Heiligen oder Engel zum Vater des Ersehnten schicken, was ihr am liebsten gewesen wäre, da ein solcher, wenn sie seiner nicht mehr bedurft hätte, ohne weiteres in den Himmel zurückgekehrt wäre. Carmelo ließ sich nicht so leicht abschütteln, um so weniger, da er unfähig war, zu begreifen warum sie ihn plötzlich, ohne vorhergegangenen Streit oder Wortwechsel, verabschiedete. Wenn er sie mit Fragen und Bitten bestürmte, entgegnete sie mit einer Kälte, die nur die äußerste Gleichgültigkeit aufbringt: »Habe ich dir jemals etwas versprochen? Habe ich dir jemals gesagt, ich liebte dich? Ich bin dir nichts schuldig, wie du mir nichts bist. Wenn ein blinder Hund vor meiner Thür heulte, würde ich das Brot mit ihm teilen, das ich hätte; was du von mir willst, habe ich nicht, und schlage sie zu vor dir.«
Carmelos Verzweiflung war so groß, daß die Farfalla sich entschloß, zu Galanta zu gehen und für ihn zu bitten oder wenigstens eine Erklärung zu fordern, die das Mädchen der alten Frau denn auch nicht vorenthielt. Anfangs wollte es der Farfalla nicht einleuchten, warum es nicht besser sein sollte, einen Vater für sein Kind zu haben, der für es arbeitete, aber das Verständnis für Galantas Auffassung fehlte ihr doch nicht. Galanta stellte nicht in Abrede, daß Carmelo leidlich brav und häuslich sei, trotzdem er gelegentlich von einem Trinkfieber ergriffen würde, das in Strömen von Wein gelöscht werden mußte, um ihn dann wieder für lange Zeit in Ruhe zu lassen. Aber auch der Bravste, sagte Galanta, wäre noch schlechter als gar keiner; ihr Kind könne sie wohl allein erhalten, mit dem Kinde hätte sie lauter Liebe und Frieden, der große, grobe Mann säße im besten Falle überflüssig dabei, wenn er nicht, was häufiger vorkäme, wie ein schweres, schmutziges Tier die Ruhe und Sauberkeit und den Wohlstand des Hauses unter den Füßen zerträte. Der Farfalla kamen Erinnerungen an ihre eigene Jugend und ihren Ehestand, und bedenkend, wie anders ihr Leben hätte sein können, wenn ihr Mann sie nach der Geburt des ersten Kindes anstatt nach sieben verlassen hätte, fing sie an, Galanta zu begreifen, ja zu bewundern Sie war nicht wie Pepi, die mit einem wüsten Trunkenbold lebte, welcher anstatt für seine Familie zu arbeiten, der Frau das wenige, was sie mühselig verdiente, wegnahm oder stahl, um es zu vertrinken und sie nachher etwa noch zu mißhandeln; vor vier Jahren hatte die Farfalla sie gefragt, warum sie bei dem Manne bleibe, mit dem sie nicht einmal verheiratet war, und die Pepi hatte geantwortet, wenn der kränkliche Knabe, den sie von ihm hatte, stürbe, würde sie wieder zu ihren Eltern gehen und einen Dienst oder sonst Arbeit suchen. Ein halbes Jahr darauf war das Kind gestorben, aber sie war noch immer bei dem Manne und hatte ihm seitdem noch zwei Mädchen geboren. Die Farfalla hatte im allgemeinen weder besondere Achtung noch Mitgefühl für Frauen, aber Galanta, die mit ihren festen braunen Händen die Gräfin gewürgt und dann Carmelo, ihren eigenen Sohn, einen stattlichen Mann, beiseite geworfen hatte, machte Eindruck auf sie, und lebhaft und schnell wie sie war, gab sie ihr Herz im Augenblick ohne Bedenken hin. Carmelo, meinte Galanta, würde sich bald beruhigen und ein braver Sohn werden wie zuvor, sollte er aber fortfahren, sich verzweifelt zu geberden und die Arbeit zu vernachlässigen, wollte sie mit allen ihren Kräften, die sie sehr hoch anschlug, der Farfalla zu Hilfe kommen Die alte Frau vertraute blindlings auf ein unbeschränktes Gelingen von allem, was Galanta unternehmen würde, und mit völliger Hintansetzung Carmelos half sie von nun an den Empfang des ungeduldig erwarteten Kindes vorbereiten. Das Kind war der unerschöpfliche Gegenstand ihrer Gespräche mit Riccardo, der, seinen sterbenden Körper auf Augenblicke ganz vergessend, es im Geiste schon im Kahn übers Meer ruderte, auf die Insel und alle Lieblingsplätze führte, die er nie gesehen hatte und nie sehen sollte.
Als ich einmal bei einer solchen Unterhaltung über das Kind zugegen war, drängte sich's mir auf die Zunge, zu sagen: Ihr wahnwitzigen und blinden Leute! Das vaterlose Kind einer Dirne! Wißt ihr nicht so gut wie ich, daß es mit den rosigen Füßen, die es auf die Welt bringt, über spitze Steine laufen und durch Schlamm waten muß, bis sie schwielig und kotig und totmüde sind wie eure? – Aber wie sich von selbst versteht, sprach ich das nicht aus, sondern rückte in die dunkelste Ecke, damit mir Riccardo meine grausamen Gedanken nicht vom Gesicht abläse, während jene über die Frage beratschlagten ob das Kind Grübchen haben würde.
»Carmelo hat auch Grübchen«, sagte die Farfalla, und weiter, indem sie sich zu Galanta wendete: »Du hast sie nur nie gesehen, weil er selten lacht. Das kommt, weil er ein Mann ist; wenn es ein Mädchen wird, werden wir es genug lachen sehen«
»Wenn ich Harmonika spiele, wird es lachen und in die Hände klatschen und tanzen«, sagte Riccardo mit glänzenden Augen, und Galanta meinte: »Es soll nur die Grübchen bringen, für das Lachen werde ich sorgen.«