
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
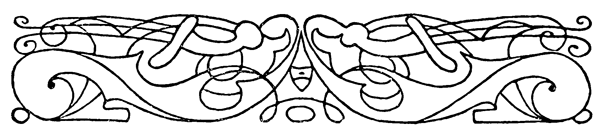
Es gab Augenblicke, wo mir die Farfalla wie eine abgefeimte Schelmin und ich selbst mir wie ein Esel vorkam. So erwähnte sie eines Tages im Gespräche, daß ich sie an einen Herrn erinnerte, der Direktor einer großen Oelfabrik gewesen war, in der sie vor Jahren gearbeitet hatte. Er war außerordentlich gut gegen die Arbeiter gewesen und deshalb auch nach kurzer Zeit von dem Besitzer der Fabrik an einen anderen Posten gestellt und durch einen strengen, unzugänglichen Mann ersetzt worden. Regelmäßig wenn die Mittagspause kam, ging eine von den Weibern zu ihm und bat um die Erlaubnis, sich ein wenig Oel zur Bereitung des Essens zu holen, was er unter der Bedingung bewilligte, daß sie nicht mehr nähme, als sie für sich bedürfte. Die Betreffende pflegte dann für die anderen eine Anzahl von Flaschen zu füllen und unter dem Rocke zu verbergen, eine kleine dagegen behielt sie in der Hand und zeigte sie im Vorübergehen dem Herrn, der ihr auf die Schulter klopfte und sagte: offen und ehrlich, so hab ich's gern! Die Farfalla erzählte diese Geschichte herzlich lachend und schien eine Art von mitleidigem Wohlwollen für den Mann ohne Scharfsinn zu empfinden, der mir vermutlich in diesem Punkte gleichen sollte. Etwas empfindlich und erstaunt sagte ich: »Ihr seht, daß der liebe Gott recht hat, wenn er hart gegen Euch ist, wäre er milde und nachsichtig, würdet Ihr es mit ihm machen, wie mit jenem allzu gutmütigen Herrn, ihn an allen Ecken beschwindeln und seine Gebote in den Wind schlagen.« Die Farfalla stimmte mir lachend bei; immerhin, fügte sie hinzu, gäbe es doch viele Leute, die Gottes Geboten ebensowenig nachlebten wie die Armen, und die er doch mit Gnaden überschüttete. Ich antwortete kurz, die Armen hielten leider den Reichtum für die einzige dankenswerte Gnade Gottes, man müßte sich aber den Herrn nicht vorstellen, wie einen dicken Zauberer mit unerschöpflichem Säckel, aus dem er goldene Almosen an seine Lieblinge verteilte; sondern, daß das blanke Geld oft wie die hübschen Aepfel einen häßlichen Wurm inwendig hätte, daß dagegen Krankheit, Armut und ähnliche Leiden jenen unscheinbaren verrunzelten glichen, die inwendig voll von Saft und gutem Geschmack wären.
Was mich noch mehr an ihr irremachte, war folgendes: Im Erdgeschoß meines Hauses wohnte ein Barbier, ein äußerst gutmütiger, redlicher, wenn auch geschwätziger Mensch, der von seiner scharfen Zunge in verletzender Weise Gebrauch machen konnte. Seine Frau, eine starke, gesunde und schöne Person, hatte in früherer Zeit ein Verhältnis mit einem treulosen Taugenichts gehabt, aus dem ein Kind hervorgegangen war, ein liebes, hübsches Bürschchen, das die Eheleute bei sich hatten. Der Barbier hatte es nämlich, trotz seiner Herkunft, von Herzen lieb, so daß er es sogar ungern zuließ, daß der Vater monatlich eine Summe zu seiner Erhaltung bezahlte. Die Frau indessen bestand darauf. »Warum sollten wir dem Nichtsnutz etwas schenken?« sagte sie, und schickte den Kleinen allmonatlich selbst hin, um das Geld in Empfang zu nehmen.
Die Farfalla hatte mit diesen Leuten im besten Einvernehmen gestanden, bis plötzlich ein um das Unbedeutendste sich drehender Zank allem ein Ende machte. Ein paar Neckereien des Barbiers, die er nicht bös gemeint zu haben behauptete, erbitterten sie so, daß sie nichts Geringeres von mir verlangte, als daß ich dieser harmlosen Familie, der ich nichts vorzuwerfen hatte, die Wohnung kündigte. Es half nichts, daß ich ihr die Schlechtigkeit ihres rachsüchtigen Benehmens, die Ungerechtigkeit, zu der sie mich veranlassen wollte, vorhielt, sie nahm keine Vernunft an und erklärte rundweg, im Falle, daß ich jene behielte, selbst ausziehen zu wollen. Herzlich gern hätte ich sie ziehen lassen, so empörte mich die kleinliche, gehässige Vergeltungssucht der alten Frau; aber meine Liebe zu Riccardo lähmte mich. Voll Unmut entschloß ich mich, die guten Barbiersleute wegzuschicken, die meine Handlungsweise mit feinstem Takte des Herzens richtig beurteilten und mir durch gutmütiges Entgegenkommen das unliebsame Geschäft erleichterten. That nun das Geschehene der Farfalla auch leid, nachdem es nicht mehr zu ändern war, so hatte es mich doch zu gründlich verstimmt, als daß ich es sogleich hätte vergessen können und es gab auch immer wieder neues, das mich stutzig machte.
Mehrmals kam es vor, daß einige von meinen Zinsleuten, ganz wie es mein Verwalter geweissagt hatte, aus meiner Gutmütigkeit Vorteil ziehen und wenig oder gar nichts bezahlen wollten. In diesen Fällen stellte sich die Farfalla auf meine Seite und erbot sich aus eigenem Antriebe, den Leuten ins Gewissen zu reden, hielt ihnen aber nicht etwa vor, daß es unrecht wäre, einem guten Hausherrn das Wenige, was er beanspruche, vorzuenthalten, während sie dem schlimmen gegenüber pünktlich und bescheiden wären, sondern ihr Vernunft- und Moralpredigen bestand in Redensarten wie: der Klügere giebt nach; oder: der Reiche behält dem Armen gegenüber doch recht. Als ich das einmal zufällig hörte und sie deswegen zur Rede stellte, war sie keineswegs beschämt, sondern sagte leichthin, als ob es kaum der Mühe wert wäre, Worte darüber zu verlieren: »Ist es denn nicht so? Sie haben recht und behalten recht. Ich muß mit den Leuten reden, wie sie es verstehen, Sie sehen, daß es gewirkt hat, denn gezahlt haben sie.«
Ich dachte: wozu befasse ich mich mit Leuten, die wie ein anderes Volk mit eigenem Glauben und eigenen Gesetzen von uns geschieden sind? Freundschaft und Verständnis kann zwischen ihnen und uns nicht sein. Es haben schon Leute, die auf dem Meere verschlagen oder zwischen Eisbergen oder in einer Wüste ohne Mittel und Hilfe waren, ihre Kameraden getötet und verzehrt, und man hat sie nicht strafbar gefunden; wer halb verhungert um sein Leben kämpft, ist nicht nach der Moral der Menschen, sondern nach der der wilden Tiere zu beurteilen. Solche kann man nur töten oder, wenn man sie nicht ihrem Schicksal überlassen will, ihnen von Grund aus helfen, übrigens sich mit ihnen einzulassen, ist Narrheit.
Schrecklicher als dies alles war dies: in einer Geschäftsauslage sah ich eines Tages einen geschliffenen Topas, sehr groß und so fein gefaßt, daß er frei auf der Nadel zu schweben schien. Augenblicklich versetzte meine Phantasie den Stein in Lisabellas dickes, weiches, blondrotes Haar, und die Lust, ihn in Wirklichkeit hineinzustecken, wurde so groß, daß ich, ohne mich lange zu besinnen, den Thürgriff faßte, um einzutreten und zu kaufen. Da fiel mir, ich weiß nicht wie, Riccardo ein und ich ließ meine Hand sinken und ging meiner Wege weiter.
Ich malte mir aus, was er sagen würde, wenn ich ihm die Geldsumme, die der Topas wert war, auf das Bett legte; es kam mir in den Sinn, daß ich ihm einen hübschen Anzug für das Geld kaufen könnte, daß er noch nie einen neuen besessen hatte und daß er so gern sauber und nett gekleidet war. Dann wieder sah ich das leuchtende Haupt Lisabellas, hörte den Jubelruf beim Anblick des Steines und sah, wie sie ihn in die Locken grub und rosig vor den Spiegel trat. Wie ein großer, schwerer Tropfen süßen Griechenweins lag er ruhig in dem weichen, roten, braunen, goldenen Sonnenhaar und funkelte. Warum darf ich dir dein Spielzeug nicht geben? dachte ich. Fast wäre ich zu ihr gegangen, hätte mich ihr zu Füßen geworfen und sie gebeten, zu entscheiden, ob ich ihr den Topas oder Riccardo das Geld geben sollte; aber ich unterließ es, weil ich wußte, daß sie lachen und sagen würde: kaufe mir den Topas und gieb Riccardo das Geld. Inzwischen war ich, durch viele Straßen laufend, ohne es zu wollen, zu dem Goldschmiedsladen zurückgekehrt, trat ein und kaufte. Ein häßliches Gefühl, als hätte ich etwas gestohlen, saß mir in der Kehle und schnitt mir den Atem ab; dazu fiel mir plötzlich ein, ich wollte zu Riccardo gehen, ihm den Topas zeigen und sagen, daß er für Lisabella wäre. Hundertmal sagte ich mir, daß das häßlich, zwecklos, widerwärtig wäre, dennoch blieb mir das Gefühl, als müßte ich es thun, und ich that es auch. Riccardo hatte gerade einen bösen Tag und lag grau und hager zwischen seinen groben Leinentüchern, auf denen das tiefe Glühen des Steines sich traurig und wunderbar ausnahm. Anfangs beachtete er ihn kaum und fragte nur gleichgültig, ob das Bernstein wäre; als ich ihm aber erzählte, es wäre ein Topas und er wäre für Lisabella bestimmt, wurde er lebhafter, nahm ihn in die Hand, fragte nach dem Preise, und als ich die für seine Verhältnisse große Summe genannt hatte, wuchs seine Bewunderung sowohl für den Stein wie für mich und für Lisabella, die ihn tragen sollte. »Ich wollte, ich könnte sie sehen«, sagte er, ehe er vor großer Abspannung den Kopf wieder aufs Kissen legte und die Augen schloß.
Lange Zeit kam mir beinahe täglich das Qualgefühl wieder, mit dem ich Riccardo den Stein gezeigt hatte, und trieb mir das Blut heiß ins Gesicht; ich weiß nicht, ob es Scham über den Einkauf war oder über mein erbärmliches Mitleiden.
Mehr als je zuvor atmete ich auf, als der Sommer kam und ich die Koffer zur Reise packen konnte; aber das Pech aus der Altstadt-Hölle klebte mir nun schon einmal an und war nicht so leicht loszulösen. Es kam vor, daß ich auf einem kühlen, würzigen Waldwege oder auf der breiten, hellen Straße einer fremden Stadt, unter lachendem Himmel, lauter goldene Ferientage vor mir, die mich wie ein Reigen schöner Nymphen umgaukelten, plötzlich die Triumphgasse vor mir sah, wie sie krumm gebückt und schmutzig die Anhöhe hinaufkroch, heiß, schweißige Dünste und Geruch von Schnaps und Oel und Zwiebeln mit sich schleppend.
Dann war meine Freude für eine Weile hin; ich litt an solch einem Bilde wie an einer Speise, die man nicht verdauen kann, und war für ein paar Tage mißmutig und schwerfällig. Riccardo hatte mir einmal von seinem einzigen Ausfluge in die Welt erzählt; als er aus dem Spital, wo er zehn Jahre gewesen war, ohne Heilung gefunden zu haben, zu seiner Mutter zurückkehrte, erklärte er, nun seine Vaterstadt sehen zu wollen, und ging trotz aller Warnungen allein auf seiner Krücke aus. Er ging aus der Stadt hinaus, weil ihn die Berge lockten, die näher erscheinen als sie sind, fühlte sich aber schon nach kurzer Zeit ohnmächtig werden, da er noch nie so lange Zeit gegangen war und die Luft im Freien empfunden hatte. Als er in ein Haus eintrat, um sich ein Glas Wasser auszubitten schlug eine Frau rasch die innere Thür vor ihm zu, wahrscheinlich weil sie sich nicht sicher vor Wegelagerern glaubte; denn das Haus lag ziemlich einsam an der Landstraße. So endete der einzige Spaziergang seines Lebens; seitdem ging er nur in der Altstadt umher oder an das Meer hinunter.
Im Anfange meiner Reise kam mir dies hundertmal in den Sinn und vergällte mir jeden Genuß, so daß gerade das schönste am bittersten wurde. Ich dachte mir, jetzt steht er vielleicht auf der Höhe des Triumphgäßchens, bleich, müde von der Anstrengung an eine Mauer gelehnt und an die Krücke geklammert, und schaut auf das große, bebende Meer, den Schiffen nach, von denen keins ihn mitnimmt in die wundervolle Ferne. Dann wieder sagte ich mir, dies wäre vielleicht nur die Anschauungsweise eines Geldmenschen, Sklaven der Materie, Verehrers des goldenen Kalbes, und Riccardo hätte vielleicht, wenn er ein blasses Streifchen des Meeres und einen kahlen Bergrücken darüber oder in der Heidenkirche ein geschmackloses Marienbild ansehe, mehr innerliches Entzücken und Schwelgen in Schönheit, als ich inmitten der prächtigsten Landschaften Museen und Theater der Welt.
Dieses Knäuel von Fragen, das ich nicht entwirren konnte, belastete und verdroß mich, und ich hätte es gern in einen Teich oder Sumpf geworfen, woraus es nicht wieder auftauchte. Allmählich, unter zahlreichen neuen Eindrücken gelang es mir denn auch, meine Gedanken von diesem peinlichen Stoff zu befreien und nach der Rückkehr kam es mir nicht in den Sinn, meine Bekannten in der Römerstadt aufzusuchen. Als ich mich wegen des kleinen Berengar zum Toni begab, vermied ich durch einen Umweg die Triumphgasse und ging schnell und geradeausblickend meines Weges, traf auch wirklich weder mit der Farfalla noch einem ihrer Angehörigen zusammen.
Es wollte schon Winter werden, als ich Vittoria auf der Straße begegnete, die ich aber nicht erkannt haben würde, wenn sie nicht den Blick zum Gruß auf mich gerichtet hätte. Da kam es mir zu Sinne, daß das die Augen waren, die in jener Mondnacht triumphierend über das Meer hinaus in den Glanz der Zukunft geblickt hatten; freilich wüßte ich kaum zu sagen, wodurch sie jetzt noch daran erinnerten. Sie hatten etwas fieberhaft Grelles, die ganze Erscheinung mit dem schleppenden Gange etwas Hoffnungsloses. Allerdings bemerkte ich gleich, daß sie in Erwartung eines Kindes war, woraus allenfalls die ganze Veränderung zu erklären war und was wenigstens darauf schließen ließ, daß der schöne Geliebte sie allem Widerstande zum Trotz heimgeführt hatte. Ich ließ mir nicht merken, welchen kläglichen Eindruck sie auf mich machte, und beglückwünschte sie, daß sie, wie ich vermutete, ihren Willen durchgesetzt und den Gegenstand ihrer Wünsche erlangt hätte. Ja, das hätte sie, sagte sie kurz und sah mich an, als besänne sie sich auf die weit entlegene Zeit, wo ihr das, was sie jetzt hatte, wünschenswert erschienen war. Am Antoniustage, als sie und ihre kleine Schwester das Bild des Heiligen mit Lilien schmückten, hatten sie folgende Gegenleistung von ihm verlangt: daß die Nanni ohne Kind bliebe, da es sonst mit dem Tugendpreise vorbei wäre; daß die Vittoria hingegen mit einem gesegnet würde, damit ihrer Mutter nichts übrig bliebe, als in die Heirat mit Pasquale einzuwilligen. Der Heilige verlieh in Bausch und Bogen Kindersegen zu anfänglichem großen Schrecken der Nanni; es glückte ihr aber, ihre listige kleine Person durch alle Gefahren hindurchzuschlängeln und den Tugendpreis trotz allem zu erbeuten, während Vittoria, die erhört worden war, eine Ehe ohne Segen führte und schnell eine abgearbeitete, verschwiegen leidende Frau wurde. Sie übte übrigens keine Kritik an dem heiligen Antonius, vielmehr erheiterte sie sich, indem sie mir den Sachverhalt in ihrer drolligen Art erzählte, so daß ihr Gesicht sich etwas rötete und sie ihrer früheren Schönheit wieder ähnlich wurde. Ich sagte, da sie hinter meinem Rücken geheiratet hätte, wäre ich ihr das Hochzeitsgeschenk noch schuldig, wenn es ihr recht wäre, wollte ich es in ein Patengeschenk umwandeln und lüde mich hiermit zur Taufe ihres Kindes ein. Das erwartete sollte zu Ehren des Heiligen der es beschert hatte, Antonio oder Antonia heißen und ich würde deshalb, sagte mir Vittoria, eine Mitgevatterin Namens Antonietta bekommen, die ihre liebe Freundin wäre. Die Freude, die ihr mein Anerbieten machte, beschämte mich, denn, sagte ich mir, mit höchst geringen Unbequemlichkeiten und Kosten meinerseits konnte ich sie hervorrufen, hatte mich aber künstlich zugeknöpft und verschanzt, um kein Tröpfchen Wohlwollen mehr in dieser Richtung fließen zu lassen, aus Furcht, das bischen Freude dieser elenden Geschöpfe zu teuer zu bezahlen. Mit einigen Seufzern ergab ich mich also wieder in den Bann der Triumphgasse und suchte die Farfalla auf, die mir denn gleich was ich wissen wollte von Vittorias Verhältnissen erzählte. Ihre Prophezeiungen alle, aber auch alle, waren schon bald nach der Hochzeit in Erfüllung gegangen; es fehlte der jungen Frau an allem außer an Hunger, Frost, Schlägen und Demütigungen jeder Art. Vittoria selbst klagte zwar nie und würde sich eher die Zunge herausreißen, als ihr Elend bekennen; aber alles konnte sie doch nicht verbergen, und von den Nachbarn erfuhr man das übrige. Pasquale arbeitete nur selten, so daß sie in eine Fabrik gehen mußte, um das tägliche Brot auf den Tisch zu schaffen; er lungerte indessen in der Stadt oder am Hafen herum und saß abends in den Wirtshäusern. Anfangs hatte sie versucht, ihn von dort wegzuholen, dadurch aber nur seinen Zorn gegen sich gereizt, den er auf die niederträchtigste Weise an ihr ausließ; so mußte sie halbe Nächte lang vor dem Hause kauern und seine Heimkehr erwarten, da er den Hausschlüssel zu sich gesteckt hatte und ihn sich nicht abfordern ließ.
Voller Entrüstung fragte ich die Farfalla, warum sie ihrer Tochter nicht zu Hilfe käme oder, wenn sie selbst sich mit Pasquale einzulassen nicht wagte, warum nicht Carmelo, der doch kräftig genug wäre, ihn zur Rede stellte. »Wenn sie zu mir käme«, sagte die Farfalla, »würde ich das wenige, was ich habe, mit ihr teilen: aber sie ist viel zu stolz, ihren Jammer einzugestehen und außerdem noch in den Lumpen verliebt.« Carmelo dagegen hätte ihr vorher angedroht, wenn sie dieses Mannes Frau würde, ihr Bruder nicht mehr sein zu wollen, und dabei bleibe es; wenn er wüßte, daß sie in ihrem Bette läge und Hungers stürbe, würde er ihre Schwelle nicht überschreiten, um ihr einen Bissen Brot zu geben. Wie um ihn zu entschuldigen setzte die Farfalla hinzu: »Es ist wahr, daß sie manchen ordentlichen Mann ausgeschlagen hat, bei dem sie ein schönes Leben hätte führen können. Die Bravheit vermochte nichts über sie, keinen andern als diesen Teufel hat sie haben wollen, also muß es wohl ihre Bestimmung gewesen sein, schon auf Erden die Hölle zu erleiden, und wir würden uns ganz vergeblich bemühen, sie herauszuziehen.«
In den ersten Märztagen kam Vittoria mit einem Mädchen nieder, für das ich schon geraume Zeit vorher eine reichliche Aussteuer besorgt hatte, und zwar unter Beihilfe der geliebten Frau, die mir alles in der Art anschaffen mußte, wie es in vermögenden Familien gehalten zu werden pflegt. Damit hatte ich das Rechte getroffen: Vittoria wußte sich vor Freude nicht zu lassen und spielte jeden freien Augenblick mit dem winzigen Zeug, und auf ihren Mann hatte die Gediegenheit des Geschenkes einen solchen Eindruck gemacht, daß er sie rücksichtsvoller behandelte. Die Aussicht, diesen berüchtigten Menschen kennen zu lernen versöhnte mich etwas mit dem Taufessen, das ich mir voreilig eingebrockt hatte; denn nachdem ich mich einmal dazu eingeladen hatte, konnte ich mein Versprechen ohne große Kränkung nicht wohl zurückziehen. Wie mochte dieser Pasquale aussehen, den ein aufgewecktes, von den Männern ihrer Lebenskreise gesuchtes Mädchen für den schönsten auf Erden ansah und der von gutmütigen jungen Leuten und einer nachsichtigen alten Frau so leidenschaftlich verabscheut wurde? Ich hatte ihn mir ungefähr so gedacht, wie man auf unseren Bühnen den Vampyr und ähnliche dämonische Helden darzustellen pflegt: schwarz, bleich, mit brennenden Augen voll Geheimnis und Melancholie; wovon wenigstens der schwarze Typus zutraf. Man konnte sich kein schwärzeres Schwarz denken als die Haare, die in unzähligen weichen, auffallend anmutigen Löckchen prangten, und den dichten Schnurrbart; dazu lag auf seinen Wangen der bläuliche Bartschatten, der für Weiberaugen so bestechend sein soll. Auch seine Augen waren brandschwarz und glänzten wie geschliffene Kohlen was dem gemeinen Geschmack schön vorkommen mag; mir sind die mit stumpferem Licht, in die man hineinschauen kann, lieber. Melancholisch waren sie indessen nicht, nur für gewöhnlich träge und gelangweilt; ebenso wenig war er bleich, sondern im Gegenteil von bräunlichroter, blühender Gesichtsfarbe. Der Mund war vom Schnurrbart fast verdeckt; dennoch ging von dieser Gegend des Gesichtes das Abstoßende aus, das mich sofort gegen ihn eingenommen hätte, auch wenn mir sein Charakter ganz unbekannt gewesen wäre. In seinem Lächeln, das nicht häufig erschien, war etwas grausam Hyänenhaftes, und wenn die blendenden Zähne sichtbar wurden, mußte ich immer denken, er fletsche sie; er hatte dann etwas von einem plötzlich menschgewordenen Raubtier, das kein rohes, rauchendes Fleisch mehr frißt, aber seine kannibalische Seele behalten hat und sie mit Gedanken der Zerfleischung weidet. Ich denke mir, daß so die Plebs des kaiserlichen Rom aussah, die den Cirkus füllte und über blutige Gladiatorenspiele und Marter der Christen jauchzte, selbst faul und weichlich und sklavisch zu den Füßen eines Tyrannen geduckt.
Die Familie dieses Menschen gehörte nicht in die Römerstadt: der Vater war ein kleiner Beamter gewesen, die Mutter lebte von einer Witwenpension und ein älterer Bruder führte ein Schiff in die nächste Umgegend, weswegen er mit großer Ehrerbietung behandelt und Herr Kapitän genannt wurde. Sie hielten Vittoria trotz ihrer Armut hoch in Ehren, ja sie zeigten sich ihr und der Farfalla gegenüber verlegen, denn sie waren gerecht genug, einzusehen, daß sie bei dieser Heirat den Kürzeren gezogen hatte. Sie würden sogar die Verbindung um des Mädchens willen gar nicht zugegeben haben, wenn sie nicht gehofft hätten, Vittoria könne den nichtsnutzigen Mann auf bessere Wege bringen: man hatte ja Beispiele genug, daß schwache Frauen Macht über die unbändigsten Männer gewannen. Diese Hoffnung, die sich anfänglich nicht erfüllte, lebte bei der Geburt des Kindes neu auf; denn es schien ihnen nicht anders möglich, als daß die Vaterliebe ihn an Arbeit und Häuslichkeit würden Geschmack finden lassen. Sie überhäuften die junge Mutter mit Geschenken, die für ihre Verhältnisse großartig waren, und der Kapitän versprach ein Taufessen zu besorgen, an dem man sich auf acht Tage hinaus sollte sättigen können. Daß Vittoria selbst nicht unbedenklich krank im Bette lag, erschien nicht als ein Hindernis der Fröhlichkeit und Schwelgerei.
Bei der kirchlichen Handlung, die diesmal nicht vom Jurewitsch vollzogen wurde, herrschte ein steifes, feierliches Wesen, besonders der kleine, dicke, braungebrannte Kapitän hielt sich stramm und ernst, im Gefühl der unsichtbaren Gegenwart Gottes, und übertraf den etwas geschäftsmäßigen Priester weit an geziemender Würde des Benehmens. Einen trübseligen Anstrich gab dem Vorgange der Zustand des Täuflings, dem auch der Unkundige ansehen mußte, daß er nicht lebensfähig war. Es war ein winziges, runzliges Ding, das für ein Neugeborenes hübsch genug sein mochte, wenigstens sprach sich der Kapitän mit solcher Entschiedenheit in diesem Sinne aus, daß ich keinen Widerspruch wagte, obwohl es mir wie ein pelz- und schwanzloses Aeffchen vorkam. Allerdings konnten dem dürftigen Geschöpf die seidenglänzenden schwarzen Löckchen wohl als Schönheit angerechnet werden, die den mißförmigen Kopf bedeckten. Höchst peinlich war es, daß das Würmchen unaufhörlich hintereinander kleine weinende Jammerlaute von sich gab, etwa wie das Glucksen des Meeres, wenn es ganz still liegt und nur leise, beinahe unmerklich an das Ufer anbrandet; ein unleidliches Geräusch, und doch, möchte ich sagen das traurigste, unvergeßlichste Lied, das ich je in meinem Leben gehört habe. Keiner sagte etwas darüber, obwohl es selbst den Priester zu bedrücken und zur Beschleunigung der Handlung anzutreiben schien; der Kapitän dessen Würde und Andacht, je länger sie anhielt, sich bis zur Melancholie steigerte, sah das jammernde Bündel unverwandt mit durchdringendem Blick an, ohne dadurch eine Besserung herbeizuführen. Nun ereignete sich ein anmutiger kleiner Vorfall: als nämlich das Kind seiner neben mir stehenden Patin Antonietta, der Freundin Vittorias auf die Arme gelegt wurde, schwieg es plötzlich, atmete tief, tief auf wie erleichtert, sperrte die kleinen Augen ein wenig auf und blinzelte in das freundliche Gesicht des jungen Mädchens, das sich herüberneigte. Die Wirkung war um so stärker, als Antonietta eine äußerst einnehmende Erscheinung war, groß und schlank, heiter, gut und weich, von der man sich wohl vorstellen konnte, daß sie eine beschwichtigende, heilende Kraft ausströmte. Alle Umstehenden fühlten sichtlich eine Erleichterung und atmeten mit dem Kinde auf, auch der Kapitän lächelte, ohne deswegen die Haltung eines Erzvaters aufzugeben. Die Erholung war allerdings nur von kurzer Dauer, denn der kleine Unstern fing sogleich wieder zu wimmern an, als er von Antoniettas Armen genommen wurde, was andererseits den kleinen Zwischenfall um so besser abrundete. Kaum hatten wir die Kirche verlassen, als Antonietta von allen Seiten mit Neckereien umdrängt wurde, an denen besonders der Kapitän herzhaft teilnahm, dessen Späße außerordentlich einfach und zuweilen derb, aber niemals unanständig waren und über die man lachen mußte, selbst wenn nichts Witziges oder überhaupt Lächerliches an ihnen war. Antonietta lachte denn auch, sowie er nur das erste Wort eines Satzes ausgesprochen hatte, aber es war nicht das blöde und widerliche Lachen, womit viele Weiber dem Manne entgegenwiehern, sondern etwas, was um seiner selbst willen da war: nicht laut und nicht leise rieselte es hin und plätscherte wie eine sonnige Quelle, und jeder ließ sich gern von diesem kühlen Tau besprengen. In der Römerstadt war sie unter dem Namen Lachtaube bekannt, so drängte sich allen das eigentümlich Reizende ihres Gelächters auf. Sie wiegte sich in der Fröhlichkeit wie in ihrem Elemente; dabei war merkwürdigerweise ihr Gesicht, wenn es in Ruhe war, eher schwermütig zu nennen; erst die Bewegung überzog es mit einem Schleier von Sonnenschein. In dem Qualm, der Hitze und dem Lärm des Taufessens gereichte mir ihre Anwesenheit zur Erquickung: sowie ich sie ansah und ihr Lachen hörte, war es mir, als hätte ich mit beiden Händen Wasser aus einem Brunnen geschöpft und mich damit benetzt. Von ihren Lebensverhältnissen brachte ich so viel in Erfahrung, daß sie sich durch Weißnähen ernährte und außergewöhnlich ordentlich und sparsam war. Sie hatte ihr Patenkind mit einem schönen goldenen Kettlein und Anhänger beschenkt, worauf sie schon, seit Vittoria in Hoffnung war, gespart hatte. Wie sie selbst erzählte, hatte sie monatelang einen Tag um den andern nichts als trockenes Brot gegessen, ja zuweilen sogar einen Tag durchgehungert, um die erforderliche Summe zurücklegen zu können; was übrigens von den Anwesenden außer mir nicht als etwas Besonderes angesehen zu werden schien. Sie war mit einem jungen Angestellten verlobt, in den sie, nach den Neckereien der übrigen zu urteilen, wohl sehr verliebt sein mochte; aber die Unbefangenheit und herzliche Freude, mit der sie darauf einging, eine gewisse Friedlichkeit ihres Aussehens und Wesens stachen in auffallender Weise von der hitzigen Natur ab, die bei den meisten Mädchen und Frauen, die ich kennen gelernt hatte, durchblickte. Für Pasquale zeigte sie damals weder Zuneigung noch das Gegenteil, und ebenso gleichgültig verhielt er sich gegen sie, wie übrigens auch gegen die ganze Gesellschaft. Er beteiligte sich fast gar nicht am Gespräch und am Gelächter, augenscheinlich weil das nicht die Art der Unterhaltung war, die ihm zusagte. Unglaublich war es, wieviel er trank, ohne dadurch innerlich oder äußerlich verändert zu werden; weder bleicher noch röter wurde er, und die schwarzen Augen behielten denselben Ausdruck von Traurigkeit oder Langweile. Nur einmal, als die Gesundheit des Kindes getrunken wurde und er an Antoniettas Glas anstieß, heftete er einen Blick auf sie, der etwas Lechzendes und Züngelndes hatte, als müßte er sie verbrennen. Sie bemerkte es aber nicht und offenbar hatte er auch nichts Besonderes damit sagen wollen, wenigstens beobachtete ich nachher, daß er überhaupt die Eigenheit hatte, plötzlich wie aus dunklem Hinterhalt solche Blitze über diesen und jenen zucken zu lassen.
Man konnte sich nicht genug wundern, daß Pasquale und der Kapitän Brüder waren. Die Warmherzigkeit, Gemütlichkeit und Redlichkeit des Kapitäns hatten nicht nur etwas Gewinnendes, sondern für mich wenigstens Bezauberndes; er war so voll davon, daß es fortwährend überquoll und eine wohlige Atmosphäre um ihn herum verbreitete. Trotzdem er sich herrlich unterhielt, versäumte er nicht, alle Augenblicke an Vittorias Bett zu springen und ihr die Leckerbissen des Mahles, die sie natürlich nicht essen durfte, anzubieten und anzupreisen. Jedesmal kam er mit dem Kinde auf dem Arm zurück, wobei er sich nicht, wie gewöhnlich ältere Junggesellen täppisch und ängstlich gebärdete, sondern er hielt es so geschickt, wie es nur die geübteste Wärterin hätte thun können. Das jämmerliche Aussehen des kleinen Wesens, dessen zuckende Hände wie dünne, weiße Spinnen aussahen, schien er nicht zu bemerken, und es hatte etwas Rührendes, wie er dem dämmernden Stückchen Leben, das sichtlich schon wieder am Erlöschen war, die Herrlichkeiten der Zukunft ausmalte, womit er es überschütten wollte. Es hatte ganz den Anschein, als wäre nicht Pasquale, sondern er der Vater, und als wir zusammen nach Hause gingen, sprach ich ihm mein Bedauern aus, daß es sich nicht in Wirklichkeit so verhielte. »Nein«, sagte er, »heiraten werde ich nicht; denn obschon ich sonst kein Menschenfeind bin, so hasse ich doch die Weiber.« Ich sagte, sehr erstaunt, ich hätte doch gesehen daß er sich so freundlich um Vittoria bemüht hätte, und ihr Kind, auch ein kleines Mädchen schiene er sogar herzlich zu lieben. »Kinder«, sagte er bestimmt, »sind keine Weiber, sondern Engel vom Paradiese, kleine Gottesdinger. Was Vittoria betrifft, so müßte man von Stein und Eisen sein, wenn man kein Mitleid mit ihr hätte, die einen solchen Schlingel wie meinen Bruder zum Mann hat. Und hier schon sehen Sie, warum ich die Weiber hasse; es ist thöricht genug, wenn sich Männer in die Affen von Mädchen verlieben; aber warum verlieben sich die Mädchen in uns Männer? Soll man sich nicht ärgern über diese Narrheit, in der sie so hartnäckig sind?« Ich sagte, wenn sich ein Mädchen in ihn, den Kapitän, verliebte, würde ich das keineswegs dumm und unbegreiflich finden, sondern denken, daß sie sehr wohl daran thäte. Er sagte: »Meine erste Regung, wenn ich das merkte, würde sein sie durchzuprügeln.« Dabei blieb er stehen und sah mich voll an, so daß ich das ganze braune, strahlende, zutrauliche Gesicht dicht vor mir hatte. Da er selbst mit überzeugtem Ernste sprach, lachte ich nicht, sondern äußerte mein Bedauern über seine Ehelosigkeit, da er die Kinder augenscheinlich gern hätte und man doch ohne Frau keines bekommen könnte. »Ja«, sagte er nachdenklich, »die Kinder sind von Gott, aber die Weiber sind vom Teufel.«
»Und die Männer?« fragte ich. »Wir Männer sind Erde, ganz gemeine Erde«, sagte er, indem er seinen Kopf, der wie der seines Bruders voll glänzender schwarzer Löckchen war, mißbilligend schüttelte; »bald Sand, bald Lehm, bald Dreck; aber es giebt ja auch edleres Gestein zwischen dem Kiesel«, setzte er lächelnd und mit einem wohlwollenden Blick auf mich hinzu; obgleich er mehrere Jahre jünger als ich war, behandelte er mich gutmütig belehrend wie einen noch nicht ausgereiften Jüngling. Ich hätte ihm gern gesagt, daß ich ihn für eitel Gold hielte, sprach es aber doch nicht aus in dem Gefühl, daß ich ihn damit verlegen machen würde.
Und doch hätten sich vielleicht alle Mädchen in der Altstadt leichter in seinen Bruder, als in ihn verliebt. Ja, wunderbar und entsetzlich, ich konnte mir vorstellen daß Lisabella in einem Augenblick des Taumels den grausamen Mund Pasquales küßte, aber nicht, daß sie die flüchtigste, oberflächlichste verliebte Neigung für den Kapitän haben, geschweige denn ihn heiraten könnte. Was ist das nun? Ist es Narrheit, wie der Kapitän sagte? Ist es Tücke oder Weisheit der Natur, die die Weiber regiert, daß sie keinen guten Gärtner will, der pflegt und wartet, sondern Peiniger und Gottesgeißeln? Was sich aber bald darauf mit Antonietta ereignete, hat wohl einen anderen wenn auch gleichfalls rätselhaften Zusammenhang.