
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
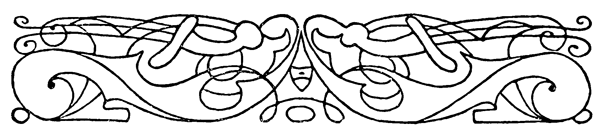
Die Farfalla hatte mit siebzehn Jahren einen Uhrmacher geheiratet, der ein schöner Mann war und eine gute Einnahme hatte, so daß sie anfangs in Verhältnissen lebte, die für ihre Lebensgewohnheiten bequem genug waren. Sehr bald aber, als ein Kind nach dem andern geboren wurde und die Ausgaben sich mehrten, wurde der Mann, der nie besonders häuslich gewesen war, liederlich, verschleuderte sein Geld im Wirtshause mit Frauen und Kameraden und brachte infolgedessen immer weniger nach Hause, während doch mehr als früher benötigt wurde. Er faßte sogar gegen seine Frau, die seiner Ansicht nach an den vielen überlästigen Kindern schuld war, eine Abneigung, vernachlässigte sie mehr und mehr und verließ sie schließlich zu einer Zeit, als ihr wieder die Geburt eines Kindes bevorstand. Nicht nur ganz mittellos blieb sie zurück, sondern sie sollte auch noch die Schulden bezahlen, die ihr Mann gemacht hatte; und es ist für mich ein nicht ganz aufgeklärtes Wunder geblieben, daß sie sich in solcher Lage mitsamt ihren sieben Kindern am Leben erhalten hat. Noch eins stand ihr, wie sie mir erzählte, im Wege: daß sie nicht verstand, das Mitleid der Leute zu erregen. Wenn auch zuweilen reiche Damen, etwa durch den Arzt aufmerksam gemacht, die beklagenswerte, mutige Frau aufsuchten, so schien es diesen, wenn sie sich bei ihr umsahen, als sei sie nicht so bedürftig wie andere. Das Zimmer, das sie bewohnte, war, schon weil er fast leer war, immer ordentlich und, trotzdem sieben Kinder darin hausten, sauber; ein buntes Madonnenbild, das sie aus besserer Zeit behalten hatte, war im Sommer häufig mit Blumen geschmückt, die ihr eine Marktfrau oder ein Gärtner oder glückliche Kinder in blühenden Gärten gegeben hatten. »Denn«, sagte sie, »ich wäre lieber mit meinen Kindern zusammen vor Hunger gestorben, als daß ich gebettelt hätte. Nur um Blumen zu betteln, habe ich mich nie geschämt. Ich habe meinen Kindern kein Spielzeug schenken können, ausgenommen, was ich selbst aus Holz, Pappe oder altem Zeug anfertigen konnte, aber sie waren auch mit Blumen zufrieden, und deshalb sollten sie Blumen haben, selbst wenn ich sie hätte stehlen müssen. Aber«, setzte sie lächelnd hinzu, »so schlecht sind die Menschen nicht; ich habe immer solche gefunden, die mir Blumen gaben!«
Wenn nun die Menschenfreunde, die – wie ich selber – immer eifrig bedacht waren, ihre Wohlthaten nicht zu vergeuden, das reine Zimmer mit Blumensträußen darin sahen und vollends, wenn sie mit der Farfalla ins Gespräch kamen, über deren Gesicht immer ein Glanz von Heiterkeit lag und die immer ein Scherzwort im Munde führte, glaubten sie nicht recht an ihr Elend.
»Ich bemerkte das wohl«, sagte sie zu mir, »aber ich konnte nun einmal durchaus nicht wehleidig thun. Mochte mir auch die Not bis an den Hals gehen, in dem Augenblick, wo ich freundliche Menschengesichter sah und sprechen konnte, hellte sich alles auf und schien mir erträglicher; ohne daß ich sie gerufen hätte, sprangen mir dann lauter lustige Einfälle von der Zunge, die mich selber hellauf lachen machten.« Deshalb, sagte sie, hätten die Männer sie auch gern gehabt und ihr nachgestellt, sowohl die aus ihrem Stande wie die vornehmen; aber, obwohl sie damals noch jung war, verspürte sie nie eine Neigung, diesen Anträgen nachzugeben. Es kam zuweilen vor, daß einer besonders erpicht auf sie war und ihr eine Summe Geld bot, die ihr für geraume Zeit das ärgste Elend vom Leibe hätte halten können; dann führte sie den Bewerber in ihr Zimmer, stellte ihre sieben Kinder der Größe nach nebeneinander vor ihm auf und sagte: »Glauben Sie nicht, daß ich an diesen genug habe?« Worauf der lachen mußte, ihr herzlich die Hand schüttelte und sie künftig in Frieden ließ. Auch wenn sie wieder hätte heiraten können, sagte sie, würde sie es nicht gethan haben: ihre Erfahrungen hatten ihr die Meinung beigebracht, daß, wo die Armut groß ist, die Ehen selten glücklich sind, und vollends, daß ein Mann für sieben fremde Kinder arbeiten sollte, würde sie niemals für möglich gehalten haben.
Daß das männliche Geschlecht wirklich nicht viel Macht über sie gehabt hatte, sah man ihrem Gesichte an, das etwas Kräftiges, Klares und Keusches vor den meisten Frauen aus dem Volke auszeichnete. Wieviel Elend, Arbeit, Not und verhaltene Schmerzen mußten vorangegangen und durchgelitten sein, bis es so zerstört war! Denn verrunzelter, farbloser, eingefallener hätte kaum eine Siebzigjährige aussehen können, und sie war noch nicht über fünfzig Jahre alt. Nur ihre Gestalt war verschont geblieben, die, wenn sie auch nicht eben jugendlich war, doch den Eindruck des Flinken, Rüstigen, Ungebeugten machte. Alle ihre Bewegungen waren schnell und kräftig und geschickt und sie führte sie mit einer gewissen Lust aus: sie mochte sich noch so viel bücken oder Schweres heben und tragen, es schien ihr nie Mühe zu machen, ja sie that es nicht ohne Anmut. Aber auch die Blüte ihres Gesichts war nicht ganz verwelkt: wie man von einigen Heiligen erzählt, daß das Antlitz Jesu durch ihre Züge hindurchgeleuchtet hätte, sah ich ihr Jugendgesicht wenigstens in manchen Augenblicken zwischen dem alten verfallenen hervorschimmern mit großen, freien, ruhigen Augen und schmalen Lippen, die nichts Verführerisches hatten, aber das wärmste, gütigste, freundlichste Lächeln, in dem sich jeder gerne sonnen mag. Es hatte im Allgemeinen etwas Tröstliches für mich, so deutlich zu sehen, daß das Allerfeinste, Alleredelste dieser verwüsteten Jugendlieblichkeit dennoch fortdauerte, nicht eigentlich sichtbar, aber geheimnisvoll fühlbar, gegenwärtig vielleicht in jener himmlischen Körperlichkeit, die nach den Worten der Bibel im Reiche der Ewigkeit unsere Seele gestalten soll. Nur wenig angetastet durch die Zahnlosigkeit des Mundes waren die schönen, regelmäßigen Verhältnisse ihres Gesichtes, die ihm Ruhe, Harmonie und Größe gaben, auch das freilich nur dem erkennbar, der mit liebevoll forschendem Blick lange darauf verweilte.
Ich fragte, ob sie von ihrem Manne nie mehr etwas gehört hätte. Doch, sie hatte seinen Aufenthaltsort in Amerika durch Zufall erfahren; ihre Tochter Nanni, ein Siebenmonatskind, das immer seine feinen Puppenglieder behalten hatte, war damals zehn Jahre alt und hatte nicht geruht mit Bitten, bis sie ihr erlaubte, dem Vater, mit dem sich ihre Phantasie immer beschäftigte, einen Brief und ihr Bild zu schicken. »Wie haben wir sparen und darben müssen, damit sie sich photographieren lassen konnte«, sagte die Farfalla; »und als keine Antwort kam und sie wochenlang des Nachts in ihre Kissen hineinschluchzte, habe ich kaum die Kraft gehabt, ihr Herz zu trösten, denn sie hatte mich auch angesteckt mit ihren Hoffnungsträumen.« »Aber dieser Mensch war schlimmer als ein Tier«, fuhr es mir heraus, »daß er seine Kinder nicht lieb hatte. Wie konnten Sie denn einen solchen Teufel heiraten?«
Mit derselben unbewußten Ueberlegenheit, die ich schon früher an ihr bewundert hatte, als spräche sie von einem Fremden, sagte sie: »Er war nicht so schlecht, wie Sie denken, nur zu lustig war er, das ist die Ursache von allem. Es sollte immer hoch hergehen bei ihm, ein stilles, friedliches Vergnügtsein mit mir und den Kindern zu Hause genügte ihm nicht. Lärm und lautes Gelächter mußte um ihn herum sein, viele Menschen mußten dabei sein, und womöglich mußte auch der Wein fließen, am liebsten auf seine Kosten; denn er gab gerne Geld aus, nur nicht im Stillen für seine Familie, sondern klingen und klirren sollte es. Auch mit den Kindern spielte er gern, wenn etwa ein Festtag war, und er konnte als heiliger Nikolaus oder Weihnachtsmann auftreten, oder es war sonst ein rechter Trubel; Sie hätten ihn sehen sollen, wie dann sein Gesicht strahlte und sein Lachen schmetterte, fast zu sehr für unsere kleine Wohnung. Aber Kinder, wie Sie wohl wissen, ertragen nicht viel von solchen ausgelassenen Freuden, ihre kleinen Herzen werden leicht zu voll und fließen über, so daß die lauten Feste meistens mit Thränen enden. Weinen und Schreien konnte er aber durchaus nicht hören, und noch viel weniger vertrug er den Anblick von Krankheit und Mangel und sorgenvollen Mienen; wenn er dergleichen sah, kehrte er an der Schwelle wieder um, ging ins Wirtshaus und trank Wein, bis er die Traurigkeit völlig vergessen hatte. Dann ging es hernach doppelt lustig zu, er blieb Tage und Nächte fort, und je länger es dauerte, desto schwerer entschloß er sich, nach Hause zurückzukehren. Da nun die Not bei uns immer wuchs und unsere Gesellschaft ihm immer kläglicher vorkam, kam er immer seltener nach Hause und schließlich blieb er ganz aus; so hatte es nicht einmal etwas besonders Auffälliges für mich.«
Ich sagte: »Diese Lustigkeit ist des Teufels. Er kommt mir vor wie ein boshafter Bube, der ein Kind zum Vergnügen schlägt und, wenn es dann zu heulen anfängt, wütend wird und fester zuschlägt. Hätte er besser für seine Familie gesorgt, hätte es nicht so elendiglich zu Hause ausgesehen und er hätte daheim bleiben können.« Die Farfalla lachte, ohne sich aber von meinen Worten überzeugen zu lassen. »Es war auch meine Schuld«, sagte sie. »Als er anfing, mit anderen Frauen zu gehen, warnten mich die Freunde und redeten mir zu, ich möchte ihn zur Rede stellen. Aber ich gewann es nicht über mich; im Gegenteil bemühte ich mich, ihn nicht merken zu lassen, daß ich etwas davon wußte, wie ich ihn überhaupt nie gefragt habe, wo er gewesen sei und was er getrieben habe. Vielleicht wäre er anders gewesen, wenn er sich vor meinen Klagen oder Vorwürfen gefürchtet hätte. Das allerdings hätte ich nicht ändern können, was ihm am meisten zuwider war, daß ich beinahe jedes Jahr ein Kind zur Welt brachte. Ich pflegte es ihm so lange wie möglich zu verheimlichen, teils um sein Schelten und Fluchen nicht hören zu müssen, teils weil ich mich schämte; denn ich schämte mich, als ob ich etwas Schlechtes begangen hätte, und es ist mir nie in den Sinn gekommen, daß es eigentlich nicht meine Schuld war.« Sie lachte, indem sie dies sagte, nicht etwa bitter, sondern gutmütig, wie jemand, der sich nachträglich über die unschuldige Thorheit seiner Jugend belustigt.
Ich wußte nicht, ob ich mich über ihre Gemütsart ärgern oder sie bewundern sollte und betrachtete zweifelnd ihr mildes, keineswegs kraftloses Gesicht. »Waren Sie denn niemals empfindlich?« fragte ich, »empört? entrüstet? wütend? Hatten Sie denn niemals Lust, zu sagen: ich hasse dich, du Scheusal? meinetwegen ihn zu schlagen? zu erwürgen?« »Was für Lust ich hatte, weiß ich nicht mehr«, sagte sie und lachte; »gethan habe ich nichts dergleichen, weder gescholten noch geschlagen. Mein ganzes Bemühen ging dahin, es nicht zum Streit kommen zu lassen; denn ich bin so geartet, daß ich Unfrieden und Gezänk nicht ertragen kann. Nur wenn er auf die Kinder schalt oder mit dem Fuße nach ihnen stieß, habe ich sie verteidigt und ihn gebeten, lieber fortzugehen und sich die üble Laune draußen, wo er wolle, zu vertreiben.«
Sie hatte niemand gehabt, der sie gegen diesen Unmenschen in Schutz genommen oder wenigstens ihr zur Seite gestanden hätte; nicht einmal die Personen, die ihr am nächsten standen, hatten sich ihrer angenommen. Ihre Mutter, die von Rechtlichkeit, Gottesfurcht, Anständigkeit und vielen ähnlichen Tugenden und Grundsätzen strotzte, konnte es ihrer Tochter nie verzeihen, daß sie die von ihr gemißbilligte Heirat begangen hatte, und sah griesgrämig triumphierend zu, wie sich ihre Prophezeiungen erfüllten. Hätte die Farfalla etwas Erhebliches aufgewendet, um ihn zu seiner Pflicht anzuhalten, ihre Lage bejammert und das Rechthaben der Mutter häufig und ausdrücklich betont, würde sie das vielleicht etwas besänftigt haben; für den schweigenden Stolz und die Tapferkeit ihres Kindes war sie ohne Verständnis. Wenn die Farfalla einmal bescheiden klagte, warum sie ihre Schwester besuche, sie aber nicht, antwortete die Mutter, die Schwester hätte nur zwei Kinder, sie aber sieben, denen etwas mitzubringen sie zu teuer kommen würde – ohne zu bedenken, daß die sieben es weitaus nötiger hatten als jene und, da sie nie satt zu essen bekamen, schon mit einem tüchtigen Stück Brot zu beglücken gewesen wären. Die Wahrheit war, daß die Schwester sich in guter Vermögenslage befand, woraus die Mutter manchen Vorteil zog, während sie von der unglücklichen Farfalla natürlicherweise nichts erwarten konnte.
Die Schwester der Farfalla war mit einem Kameraden ihres Mannes verheiratet, der sich anfänglich um sie selber beworben hatte, von ihr aber als ein unansehnlicher, trockener und schon etwas ältlicher Mann abgewiesen worden war. Er begnügte sich darauf mit ihrer Schwester und erwies sich als ein außerordentlich arbeitsamer und sparsamer Mensch, der mit der Zeit ein nettes Vermögen aufhäufte. Diese Leute hätten der Farfalla leicht helfen können, aber die Schwester bewahrte es grollend im Gemüte, daß ihres Mannes Neigung eigentlich jener gegolten hatte, aus welchem Grunde wieder der Mann sich scheute, dadurch, daß er zu lebhaft für sie eintrat, die Eifersucht seiner Frau zu reizen. Immerhin liebten sie es, die Farfalla um sich zu haben und ihr anschauungsweise vorzuführen, wie sich Fleiß und Ordnung und Bescheidenheit lohnen und wie Leichtsinn ins Verderben führt. Deshalb und weil niemand so leistungsfähig, geschickt, bereitwillig und praktisch war wie die Farfalla, ließen sie sie eine Zeitlang alle Hausarbeit bei sich thun, wofür sie als Entgelt das Essen und die abgetragenen Kleider, zerbrochenes Spielzeug, kurz alles, was nicht mehr brauchbar war, erhielt. Es kam ihr lange nicht in den Sinn, darüber nachzudenken, wer dabei der Gewinnende war; aber es kränkte sie, daß ihre Schwester ihren Bekannten die nahe Verwandtschaft verheimlichte und sie ihnen gegenüber als Dienstmagd bezeichnete, und als sie erfuhr, daß Schwager und Schwester einmal darüber geklagt hatten, die schlecht gekleidete Schwester könne ihnen Schande machen, zog sie sich von ihnen zurück und suchte andere Arbeit. Nun machte ihr die Schwester heftige Vorwürfe, daß sie sich unter die gemeinen Arbeiterinnen mischte, die auf der Kirchentreppe saßen und warteten, bis jemand kam, um sie auf Tagelohn zu dingen, und sie befahl ihren Kindern, die sehr an der Tante gehangen hatten, den Kopf wegzuwenden, wenn sie ihr auf der Straße begegneten, um sie nicht zu grüßen.
Bis dahin hatte die Farfalla mit gutmütigem Lächeln von ihrer Mutter und Schwester gesprochen, als wären es arme, unter der Dummheit und Schwachheit der Welt leidende Thörinnen; nur als sie mir dies letzte erzählte, schlich sich ein wehmütiger Zug um ihren Mund und die Falten in ihrem Gesicht schienen sich gramvoller zu senken. »Ich bin seitdem die Straße nicht mehr gegangen, wo die Kinder zur Schule gingen«, sagte sie.
O du, dachte ich, die Engel werden sich vor dir verneigen, werden dich tragen und dir einen goldenen Sonnenschein über dein liebes, altes, müdes Haupt halten. Und ist es nicht jetzt schon so? Haben dich nicht in allen deinen Nöten deine Kinder umringt und dir zugelächelt, und werden dir nicht wieder die Engelsaugen der Kinder deiner Kinder strahlen?
Drei von ihren Kindern waren in der Fremde und vorerst nicht in der Lage, sie zu besuchen, wenn es ihnen auch nicht gerade schlecht ging. Ich wunderte mich, wie sie als alleinstehende junge Frau, die genötigt war, außer dem Hause zu arbeiten, ihre Kinder zu braven Menschen hätte erziehen können, und erkundigte mich, ob sie große Strenge dazu habe anwenden müssen. Geschlagen, sagte sie, hätte sie nur eines ein einziges Mal, nämlich Carmelo, den ältesten, der mehr als alle von den guten Tagen genossen hatte, dem hernach aber auch die härteste Aufgabe zufiel. Er mußte, während seine Mutter fort war, die jüngeren Kinder beaufsichtigen, ihnen ihre Flaschen und Suppen zubereiten, sie füttern, waschen und trocknen, sie herumtragen, kurz in jeder Hinsicht für sie sorgen. Obgleich er natürlicherweise lieber draußen mit anderen Knaben seines Alters sich getummelt hätte, beklagte er sich doch nie, da er die Notwendigkeit der Sache begriff und da er außerdem, gesund, kräftig und gutmütig, wie er war, die Neigung hatte, das Schwache und Hilflose, Kinder und Tiere, zu beschützen und mit ihnen zu spielen. Um so mehr war die Farfalla erstaunt und bestürzt, als er eines Tages verschwunden war, ohne irgend eine Nachricht über seinen Aufenthalt zurückzulassen. Sie brachte einen Tag und eine Nacht unter unaufhörlichem Suchen und mit immer wachsender Angst zu, bis schließlich ein Weib, das von den Bergen her Milch in die Stadt trug, ihn zurückbrachte. Diesem war der halbverhungerte hübsche Junge aufgefallen; sie hatte ihn gefragt, wohin er gehe, und als sie die Antwort erhalten hatte, er wolle in den Wald, um Räuber zu werden, sogleich den richtigen Zusammenhang geahnt und nicht geruht, bis sie ihn bewogen hatte, mit ihr umzukehren. »Damals habe ich ihn trotz meiner Freude, ihn wiederzusehen, geschlagen«, sagte die Farfalla; »denn es war mir wie der Blitz in die Seele geschlagen, daß er vielleicht in Wirklichkeit ein Räuber oder noch Schlimmeres werden könnte, wie es manche Mutter in der Altstadt mit ihren Söhnen erlebt hat, die weniger arm und verlassen war als ich.« Uebrigens hatten ihr die Kinder, von natürlicher Kinderwildheit und -Ungezogenheit abgesehen, keinerlei Kummer bereitet. Die Töchter, von denen die älteren jetzt im Auslande verheiratet waren, hatten reiche Damen in Klöstern zur Erziehung untergebracht, wo sie zwar außer Handarbeiten nicht viel Ersprießliches erlernt, aber doch gute Sitten und ein nettes Benehmen sich angewöhnt hatten. Von der kleinen Nanni wurde sogar erwartet, daß sie den Tugendpreis erhalten würde: so nannte man die Stiftung eines verstorbenen Stadtvaters, wonach jedes Jahr einem armen Mädchen, das nachweisbar brav und makellos war, einige hundert Gulden zur Aussteuer ausgezahlt wurden. Diese Bravheit war in der Altstadt, wo die meisten Mädchen mit sechzehn Jahren schon einen Liebhaber und ein Kind haben, nicht leicht aufzutreiben, und wie es mir schien, hatten die älteren Töchter keinen Anspruch auf den Tugendpreis erheben können. Die unermüdliche Farfalla war bereits bei allen maßgebenden Persönlichkeiten gewesen, um ihnen ihre Tochter zu empfehlen und mit Wohlwollen und Versprechungen entlassen worden, so daß mit ziemlicher Gewißheit auf die Erfüllung des Wunsches gerechnet werden konnte. Der Verlobte war als Heizer auf einem großen Indiendampfer angestellt, ein guter, stiller Mensch, der sich immer nur wenige Tage in der Stadt aufhalten konnte. Zum Ueberfluß, sagte die Farfalla, würde sie jetzt noch auf den heiligen Berg gehen und der Mutter Gottes die Sache ans Herz legen; bekäme die Nanni den Tugendpreis, könne sie heiraten, sich ordentlich einrichten, und wäre dann, da der Mann genug verdiente und sparsam wäre, gut versorgt.
Ich knüpfte hieran die Bemerkung, daß Gott doch die treue Pflichterfüllung lohne und sie gewiß am Ende die Früchte ihrer Mühen genießen lassen würde. Sie sah mich ernstlächelnd an und sagte: »Nein, Gott hat die Armen nicht lieb. Ich werde mein Leben lang hart und aufs äußerste arbeiten müssen, doch nie genug haben, und schließlich, wenn ich nichts mehr thun kann, im Armenhaus sterben. Und doch habe ich mit Wissen nie etwas Böses gethan oder wenigstens nicht mehr als Tausende, die zeitlebens im Glücke schwelgen.«
Da ich nun einmal damit angefangen hatte, Gottes Anwalt zu machen, predigte ich etwa folgendermaßen auf sie ein: »Auf Glück kommt es nicht an, wenigstens nicht auf das, was wir unter Glück verstehen. Es kommt darauf an, daß wir uns vervollkommnen, und das zu bewerkstelligen, sind Not und Kampf und Mühsal weit besser angethan als unser sogenanntes fades Glück. Wenn man Einsicht hat, müßte man deshalb begreifen, daß Gott die am liebsten hat, denen er recht viel Steinblöcke und Dornbüsche auf den Weg wirft, mit deren Beseitigung sie sich gehörig abarbeiten müssen.« Und ob sie selber, fragte ich, nie ein stolzes Gefühl des Glückes in der Brust gespürt hätte beim Anblick der Kinder, die sie allein, ohne Hilfe Gottes und der Menschen, ernährt und aufgezogen und gesund und brav erhalten hätte?
Sie hatte mich, während ich sprach, aufmerksam angesehen, und zum erstenmal, seit ich sie kannte, kam allmählich etwas Verschleiertes in ihren offenen trockenen Blick. »Ich habe niemals Zeit gehabt mich zu besinnen, ob ich glücklich oder unglücklich wäre«, sagte sie. »Seit ich ins Elend gekommen bin, hatte ich beständig soviel zu denken, wie ich täglich Brot für die Kinder bekäme, daß ich über mich nicht nachdenken konnte. Und das ist gut; wenn ich dazu Zeit gehabt hätte, würde ich vielleicht nicht mehr so heiter sein können, wie Sie mich jetzt sehen. Damit hängt es auch zusammen, daß ich nie, wie andere, in eine Kirche eintrete, um zu beten. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wie ich einmal in der Abenddämmerung auf dem Heimweg von der Arbeit in den Dom trat; es war März und die Luft war leicht und lau zum erstenmal seit dem Winter, so daß ich unwillkürlich langsamer ging, da hörte ich leises Orgelspielen durch das offenstehende Portal und trat ein. Beim Eintreten dachte ich noch: wird mir auch Zeit bleiben, Riccardos Wäsche zu waschen? Ob sie auch trocken wird bis morgen früh? Ob mir eine Nachbarin ein paar glühende Kohlen leihen wird, um Riccardo ein Ei zu kochen? Ob mir auch genug übrig bleibt, um dem Pfandleiher den Zins zu zahlen, wenn ich frische Eier kaufe? Denn in dieser Weise rechne und würfle ich mit Zeit und Geld in meinem Kopfe den ganzen Tag und manchmal noch Nachts im Schlafe. Als ich nun aber in einer halbdunklen Seitenkapelle vor der großen Madonna unter dem Kreuze niedergekniet war, stand dies Rad auf einmal still, ohne daß ich bemerkt hatte wie, und es war gerade, als hätte sich in meinem Innern eine Thür aufgethan, die ich sonst immer zugehalten hatte, und als drängten sich nun eine Menge Gedanken und Bilder und Figuren daraus hervor. Es waren Dinge, die ich gesehen und erlebt hatte, aber vor lauter Eile und Bedrängnis, in der ich immer war, eigentlich ohne es zu wissen. Ich sah mich, wie ich mein jüngstes Kind geboren hatte, halb ohnmächtig aufstehen, um es zu waschen und einzuwickeln; wie ich am andern Morgen erschöpft, hungrig und verlassen einen dicken Mehlbrei für mich und die Kinder kochte; wie die Gerichtsdiener kamen und mich pfänden wollten wegen der Schulden, die mein Mann hinterlassen hatte, und wie ich mich schämte, weil sie mich auf dem Bett liegend fanden inmitten der größten Unordnung; dann plötzlich wieder, wie ich bei der Gradella Geld borgen wollte und sie vor einem Teller guter dampfender Suppe sitzend fand und unaufhörlich dachte: wenn sie mir doch nur einen Löffel, einen einzigen Löffel voll anbieten möchte, denn es war mir übel vor Hunger; und wie sie den vollen Teller langsam vor meinen Augen leer schlürfte, ohne mich einzuladen. Riccardo sah ich als Kind, wie sein dickes bleiches Gesicht ein wenig röter wurde vor Freude, wenn ich nach Hause kam, wie er die Aermchen ausstreckte und, wenn er sah, daß ich ihm nichts mitgebracht hatte, wie ein paar dicke Thränen in seine Augen kamen und sein kleiner Mund zu zittern anfing, und wie er dann vor lauter Schwäche einschlief, wenn ich ihn an meine Brust legte, in der kein Tröpfchen Milch mehr war. Deutlich hörte ich den zarten, vor Vergnügen lallenden Ton, den er ausstieß, wenn ich ihn an die leere Brust legte, und sah den dankbaren Blick, mit dem er zu mir aufsah. Ich sah mich an einem wunderschönen Park vorbeigehen, wo eine junge Frau im losen weißen Kleide auf einem sonnigen Grasplatz lag, zwischen zwei oder drei kleinen Kindern in gestickten Hemdchen, die jauchzten und herumkugelten. Und jetzt nachdem das lange vorbei war, kamen mir auf einmal eine Menge von Gedanken, die mir damals nicht eingefallen waren: Warum habe ich nie meinen Kindern, so gut und schön sie waren, hübsche neue Kleider anziehen können? Warum habe ich nie mit ihnen lachen und spielen können? Warum habe ich nie einen einzigen Morgen ausschlafen und zwischen ihnen liegen bleiben können; warum mußte ich Tag für Tag vor Morgengrauen hinaus und konnte nicht dableiben, wenn sie aufwachten und die Arme ausstreckten und weinend riefen: bleib' da!? Alle diese Bilder und Gedanken kamen mit größter Schnelligkeit und es wurde mir dabei immer banger zu Mute, als ob eine große Gefahr in der Nähe wäre. Ich hätte weinen mögen, aber zugleich hatte ich das Gefühl, wenn ich anfinge zu weinen, könnte ich nicht mehr aufhören, bis ich mich totgeweint hätte, und als müßte ich hinaus ins Freie. Als ich draußen an der Turmuhr sah, wie spät es inzwischen geworden war; und daß vielleicht die Frau nicht mehr auf dem Platze sein würde, bei der ich die Eier zu kaufen pflegte, und daß ich vor Nacht die Wäsche kaum noch würde waschen können, waren alle die Bilder, die mich geängstigt hatten, mit einem Schlage weg und mir wurde besser.«
Ja, so völlig weggewischt war dieser Vorfall, daß auch er ihr nie wieder zum Bewußtsein aufgetaucht war bis zu dem Tage, wo sie durch mich daran erinnert wurde und mir davon erzählte. Namentlich seitdem konnte ich nicht mehr begreifen, daß ich beim ersten Anblick nichts anderes als eine unauffällige, häßliche alte Frau in ihr gesehen und in ihren Augen nichts anderes gelesen hatte, als dieselbe Offenheit und ruhige Heiterkeit, die ihr ganzes Gesicht ausdrückte. Betrachtete man diese Augen länger, so wahr es vielmehr, als blickten sie aus dem Gesicht wie aus einer umgebenden Maske hervor, als wären sie ein paar Wesen für sich, die ihre eigene Sprache redeten. Wir haben nie Zeit gehabt zu weinen, sagten sie, nie Zeit, zu schlafen! Wann werden wir uns einmal ausweinen können? Wann wirst du dich ins Grab legen, damit wir ausschlafen können? Man sah auf dem Grunde dieser ruhigen und klaren Augen, wenn man lange tief hineinblickte, einen immer unterdrückten, nie gesättigten Hunger nach Schlaf und Thränen.
Trotzdem lebte sie nicht ohne Vergnügen, und der unausgesprochene Hoffnungstraum, den sie vor sich selber verbarg, es könne sich doch noch auf irgend einem Wege, durch eines ihrer Kinder oder durch ihren verschollenen Mann, etwas Großes, Schönes ereignen, erleichterte ihr die alltägliche Plage. Besonders blickte sie auf einen Zeitpunkt hin wie der übermüde Wanderer auf die Anhöhe oder die Oase oder das Wirtshaus, wo er sein Ränzel abwerfen und ausruhen kann, das war, wenn Riccardo gestorben sein würde. Das war für sie die Endstelle ihres Denkens, jenseits deren sie nichts sah als einen Himmel voll Ruhe und Sorglosigkeit. Inzwischen that sie alles, ja ich möchte sagen mehr als ihr möglich war, um Riccardos krankes Leben zu stützen und zu verlängern.