
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
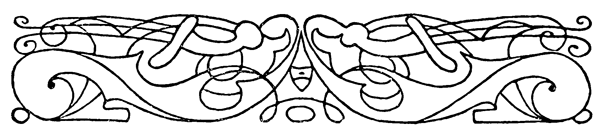
Ich kam zufällig am Tage des heiligen Antonius, der in den Juni fällt, in die Triumphgasse und fand eine ansehnliche Gesellschaft um den Brunnen vor meinem Hause versammelt. Da auch die Farfalla darunter war, setzte ich mich zu ihr, obwohl Riccardo fehlte: er hatte einen bösen Tag und lag, wie sie mir sagte, lang ausgestreckt gerade auf dem Rücken in seinem Bette und starrte über sich gegen die niedrige Decke; es wäre das beste, ihn, wenn er so wäre, allein zu lassen.
Es war jene Sommerabenddämmerung, die so leicht und kühl auf den Gegenständen liegt, wie ein grauer Schmelz auf bunten Schmetterlingsflügeln. Sie wurde in meiner Vorstellung eins mit dem Lilienduft, der die schmale Gasse ganz erfüllte, von dicken Lilienbüschen ausgehend, die die Nische schmückten, in der das Heiligenbild stand. Der blasse, süße Rauch, den man nicht sah und doch spürte, schwebte in matten Wellen und Wölkchen um den Triumphbogen, um die schmutzigen, verkrüppelten Häuser und den muskelstrotzenden Herkules oben auf dem Brunnen. Aus einem Dachfenster über der Nische bogen sich Nanni und Vittoria, die beiden Töchter der Farfalla, und befestigten ein paar lange Lilienstengel voll Knospen in der Hand des Heiligen neben der blechernen, die er immer hielt; gleich darauf erschienen sie leise lachend und flüsternd auf der Straße und setzten sich nebeneinander auf die Treppe meines Hauses. Ich rief ihnen neckend zu: »Das habt ihr nicht umsonst gethan, gesteht, was wollt ihr von dem heiligen Manne?« »Er soll uns die Sommersprossen wegschaffen«, rief die kleine Nanni schnell und brach in ein helles Gelächter aus, in das Vittoria mit etwas weicherer, schwererer Stimme einfiel. Die Kleine hatte wirklich das puppenhafte Gesicht über und über mit Sommersprossen bedeckt, was aber, da sie ohnehin nicht schön war, durchaus nicht störte, sondern eher den lustigen Eindruck, den die runden, glänzenden Beerenaugen und die blanken Zähne machten, noch unterstützte.
Die andere erschien mir beinahe noch schöner als an jenem Abend; trotzdem die mächtigen Augen Glück und Jugendstolz ausstrahlten und ihr Lachen rund, voll, warm, innig und wahr klang, war eine zarte Decke sinnlicher Schwermut um sie verbreitet – was mich auf die Vermutung brachte, der schöne Liebhaber hätte unterdessen trotz des Widerspruchs der Mutter Erhörung gefunden. Diese schien die Veränderung, die mir auffiel, nicht zu bemerken, im Gegenteil, als die beiden Mädchen sich verabschiedeten und Hand in Hand die Gasse herunterliefen, um am Hafen Nannis Verlobten zu treffen, blickte sie ihnen zufrieden aus ihren klaren Augen nach und erzählte mir, daß die Kleine nun bald Hochzeit halten und daß Vittoria vielleicht einmal ebenso gut oder noch vorteilhafter heiraten würde, wenigstens hätte sie Pasquale aufgegeben, sie erwähne ihn nicht mehr und er ließe sich nicht mehr in der Gasse blicken.
Während dieser ganzen Zeit gingen unaufhörlich Leute die Gasse herauf und herunter, von denen einige, nachdem sie einen Augenblick vor dem heiligen Antonius niedergekniet waren und gebetet hatten, sich zu uns auf den Rand des Brunnens oder auf die Treppe oder geradezu auf das holperige Straßenpflaster setzten. Als die Dämmerung dichter geworden war, schlich aus dem gegenüberliegenden Hause der Schuster Bonalma und setzte sich auf den Brunnen neben eine bleiche Frau mit ruhigem, großartigem, aber sehr leidendem Gesicht, die ein Kind auf dem Arm hatte, während zwei größere zu ihren Füßen saßen und schüchtern miteinander plauderten. Wie ich von der Farfalla erfuhr, war dieses seine Frau, die inzwischen wirklich aus dem Irrenhause zurückgekehrt war und, da die Geliebte ihres Mannes durchaus nicht hatte von der Stelle weichen wollen, eine Dachkammer in der Nähe bezogen hatte und sich und ihre Kinder durch ihre Arbeit armselig ernährte. Bonalma hatte ihr anfangs etwas Geld zur Unterstützung gebracht, wagte aber wegen der Zänkerei seiner Geliebten, der nichts entging, diese bescheidene Hilfe nicht zu erneuern, doch stahl er sich so oft es gehen wollte, zu seiner Frau hin, was durch den Umstand erleichtert wurde, daß die andere von Zeit zu Zeit ihre kranke Mutter besuchen mußte, die in einer nahegelegenen Ortschaft wohnte. Mir war die gedrückte Gestalt des Mannes mit den verstohlenen Bewegungen fast widerwärtig, und doch hatte es etwas Rührendes, wie beim Anblick der Frau, die ihm zunickte, ein schwaches Lächeln über sein graues, stieres Gesicht flog, wie er sich dicht neben sie setzte, die beiden Kinder, die vor ihr spielten, auf seine Kniee hob und fest an sich preßte, und schweigend bald die Kleinen, bald sie anstarrte, die leise zu ihm sprach. Sie mischten sich nicht in die lebhaften Gespräche der übrigen, die auch sie wiederum in Ruhe ließen, was ich ihnen, da es meistens ältere, überaus redselige Weiber waren, hoch anrechnete. Unter ihnen erkannte ich die Schwindsüchtige und die fette Alte von der Wallfahrt wieder, von denen die erstere mit Riccardo gewettet hatte, wer von ihnen zuerst sterben würde. Sie blickte auch jetzt aus ihren hohlen Augen mit unruhiger Lebhaftigkeit suchend umher, und da sie Riccardo nicht sah, rief sie nach dem offenstehenden Fenster mehrmals seinen Namen hinauf. Als sie von der Farfalla hörte, daß er einen schlechten Tag habe, nickte sie nervös mit dem Kopfe und rief: »Ich gewinne meine Wette!« so laut und dazu lachend, daß ihre schwache Stimme in Husten überging, dessen sie durchaus nicht wieder Meister werden konnte. Von oben kam keine Antwort. »Ich habe diese Nacht vom Pfarrer Jurewitsch geträumt«, sagte sie, nachdem sie ausgehustet hatte; »er trug zwei große Flügel an den Schultern und kam an mein Bett und segnete mich; ich fühlte den Luftzug, der von seinen Flügeln herrührte, so deutlich, daß ich davon aufwachte.« Die fette Alte, die mit übereinandergelegten Beinen auf dem Pflaster saß, sagte: »Von Geistlichen träumen, bedeutet gewissen Tod, wenigstens wenn sie lebendig sind. Ein toter Geistlicher bedeutet hohes Alter. Die Nummer ist 47, Flügel 60 und Wind 9.« Die Schwindsüchtige wiederholte die drei Zahlen mehrmals hintereinander, um sie sich einzuprägen und am folgenden Tage in der Lotterie zu spielen. Die Farfalla erzählte, ihr hätte von dem Buckligen geträumt, nämlich, daß er auf Riccardos Bett gesessen und daß sein Buckel immer dicker und dicker angeschwollen wäre, so daß sie gefürchtet hätte, er würde die Decke einstoßen. »Das ist ein glücklicher Traum«, sagte das Kirchenweib billigend, »Buckliger 17, Buckel 33, Angst 52.« Als die Farfalla sagte, sie spiele nicht in der Lotterie, legte ein anderes Weib auf die Nummern Beschlag, da man ganz sicher sei, auf einen Buckligen zu gewinnen. Ich betrachtete mit Verwunderung die Alte, welche die jeweiligen Nummern, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, gleichsam wie Pfeile, ohne zu zielen und doch des Treffens sicher, hinschleuderte, und fragte sie, ob sie denn von allen Dingen zwischen Himmel und Erde die Lotterienummer, die darunter zu verstehen wäre, wüßte. »Von allen«, sagte sie ruhig und sandte aus dem kleinen Spalt ihrer Augen einen überlegenen Blick auf mich. »Ob denn auf diese Weise immer gewonnen würde?« fragte ich weiter. »Natürlich nicht«, sagte sie ebenso ruhig, »denn es ist eine Kunst, sowohl die Träume richtig zu deuten, wie auch sie richtig zu erzählen, indem man oft das Unwichtige anführt und das Wichtige ausläßt. Eine Frau, die schielt, hat eine andere Bedeutung als eine mit geradem Blick, ein Schwein, das frißt, ist ein anderes als ein Schwein, das grunzt oder sich im feuchten Schmutze wälzt, und so ist es mit allen Träumen.« Infolge dieser Schwierigkeit in der Ausübung der Kunst hatte denn auch von allen anwesenden Frauen nur eine einmal zwei Gulden gewonnen, obwohl die meisten allwöchentlich spielten. Einzig die Farfalla spielte nicht, weil sie keinen Kreuzer zu verlieren hätte und, wie sie lachend hinzusetzte, weil sie auf einen größeren Glücksgewinn rechnete, nämlich auf einen Schatz, der in meinem Hause verborgen sein sollte. Sie wandte sich an mich mit der Frage, ob ich, als Hausbesitzer, falls einer gefunden würde, Anspruch darauf erheben würde, was ich mit Ueberzeugung verneinte; er solle ganz und gar dem Finder gehören. »Man hätte ihn auch teilen können«, sagte die sachkundige Alte, »aber da der Herr reich ist und wir arm sind, ist es besser so.«
Es wurde mir nun erzählt, daß mein Haus ein außerordentlich wunderbares und gedenkreiches sei, erstlich durch den Knochensepp, der es vor etwa dreihundert Jahren bewohnt und der die Gabe besessen hatte, zu merken, wo etwas in der Erde verborgen sei, Gold und andere edle Metalle oder auch Leichen. Er fing, wenn er sich über einer solchen Stelle befand, so zu zittern an, daß man, seine Hände hin und her fahren sah und seine Zähne aufeinanderschlagen hörte, woraus auch die Beistehenden schließen konnten, wo etwas war. Hunderte von Leuten kamen zu ihm und boten ihm Geld, wenn er ihnen eine Stelle zeigte, wo Gold vergraben wäre, was er auch stets willig war zu thun, nur freilich unter der Bedingung, daß sie selbst nachgraben und ihm nicht zürnen müßten, wenn sie statt Gold menschliche Gebeine fänden, da er über den Ausgang nicht Herr sei. Schließlich, da niemand etwas anderes fand als Knochen oder auch wohl scheußliche, unverweste Leichname, wurden sie rasend und schlugen den Knochensepp tot, bei dem sie verstecktes Gold in Haufen zu finden dachten. Es fand sich aber nichts als ein seltsames Drachenbild aus purem Golde, das sie wegnahmen und durch die Figur des heiligen Antonius, der jetzt in der Nische steht, ersetzten, nur daß es damals reich geschmückt und bei weitem prächtiger war als heute.
Alle hörten der Farfalla, die erzählte, ernst und aufmerksam zu, sogar der Schuster Bonalma hatte sich vorgebeugt und seine leeren Augen füllten sich mit gieriger, beinahe quälender Spannung. Nur die fette Alte schien keinen anderen Anteil zu haben, als die Geschichte auf ihre Richtigkeit zu begutachten, und der Bucklige wiegte sich die ganze Zeit über ungeduldig hin und her, rieb sich die Hände und rief, sowie die Farfalla geendet hatte, ob sie denn nicht wisse, daß die Leute damals aus Furcht, es möge ihnen etwas entgehen, das Haus ganz und gar niedergebrannt hatten. »Glaubt ihr, der Knochensepp habe seine Schätze in einem Hause versteckt, das erst nach seinem Tode erbaut wurde?« rief er und lachte dabei so herzlich, daß ihm die Thränen über die Backen liefen.
Die Farfalla lachte gutmütig mit und entgegnete, das Haus wäre jedenfalls von Stein gewesen, da es in der Umgegend mehr Steine als Holz gäbe, würde also wohl nicht so ganz und gar abgebrannt sein. Wenn das aber auch der Fall sei, könnte man doch auf den Schatz des Falschmünzers rechnen, welcher hundert Jahre später dort gewohnt habe und aller Wahrscheinlichkeit nach viel reicher gewesen sei als der Knochensepp. Auch der Einwand des Buckligen, daß das Geld, das dieser etwa hinterlassen hätte, vermutlich falsches sei, beirrte sie nicht; denn, sagte sie, er sei so überaus geschickt gewesen, daß niemand im stande gewesen sei, sein Geld vom echten zu unterscheiden. Wenn er vor Gericht gestanden hätte, wären die Richter in Verlegenheit gewesen, weil sie auf keine Weise seine Münzen hätten erkennen können; er selbst hingegen fand unter einem Haufen von Tausenden die seinigen mit einem einzigen Blick heraus. Da er nun sein Geheimnis nicht offenbar machen und anderseits auch nicht versprechen wollte, vom Falschmünzen abzulassen, wurde er am Triumphbogen aufgehängt, wie man es ja, fügte die Farfalla hinzu, auch mit Jesus Christus und allen denen gemacht hätte, die sich der armen Leute annähmen.
Diese Bemerkung bezog sich darauf, daß der Falschmünzer seine Kunst nur ausgeübt hatte, um den armen Leuten zu helfen, was ihn auch ins Unglück gebracht hatte. Er hatte nämlich einer armen Frau, die von einem hartherzigen Hausherrn auf die Straße gesetzt werden sollte, dreihundert Thaler gegeben, und sie, befragt, wie sie plötzlich zu solchem Reichtum komme, hatte in der Verwirrung ihren Wohlthäter verraten.
Aus den Gesprächen, die sich daran schlossen, merkte ich, daß alle einmütig überzeugt waren, es würde keine Not mehr auf Erden geben, wenn sich einige Männer hinsetzten, fleißig falsches Geld prägten und nach dem Beispiel jenes sagenhaften Menschenfreundes unter die Armen verteilten. Der Bucklige erkundigte sich, ob er denn wirklich das Geheimnis seiner Kunst niemandem anvertraut habe, was das Kirchenweib mit Bestimmtheit verneinte: viele hätten versucht, es wieder herauszubekommen, bis jetzt aber alle vergeblich. »Es giebt einen hier herum«, sagte sie, »der daran arbeitet; aber er wird es zu nichts bringen.« Offenbar hatte niemand den Mut, die Alte wegen dieser geheimnisvollen Andeutung weiter auszuholen, dagegen wandte man sich an die Farfalla mit Fragen, ob sie wirklich hoffe, einen Schatz zu finden, oder vielleicht schon etwas davon zu sehen bekommen habe. »Daß etwas im Hause umgeht«, sagte die Farfalla, »ist sicher. Wir haben schon allerlei gehört, und erst vor einigen Nächten hat sich auch Carmelo davon überzeugt, der nie von dergleichen wissen wollte. Es klopfte nämlich mitten in der Nacht an die Thür, so daß wir davon aufwachten, und Carmelo richtete sich mit halbem Leibe im Bette auf und rief: »Wer klopft?« Darauf blieb alles still, aber nach einer Pause klopfte es wieder, dreimal hintereinander, ganz so, als wenn es an der Thür gewesen wäre. Carmelo rief noch einmal und es ging wie das erstemal; als es aber noch einmal klopfte, sprang er aus dem Bett, riß die Thür auf und rief mit lauter Stimme auf den Flur hinaus: »Wer klopft?« Draußen war nichts als Dunkelheit und Totenstille, daß jeder von uns sein eigenes Herz schlagen hörte; denn Carmelo war so erschrocken, daß er rasch die Thür zumachte und noch eine halbe Stunde hernach bebte wie ein welkes Blatt im Winde.
Als ich am anderen Morgen Riccardo fragte, ob er nichts gehört hätte, sagte er, freilich hätte er es gehört, und nicht das erstemal; wir möchten aber künftig, wenn das Klopfen sich wiederhole, nicht anrufen und auch nicht nachschauen, woher es käme. Sie erzählte weiter, daß Riccardo, so gesprächig er sonst sei, sich über diese Dinge wenig ausließe, daß er aber auch schon Aeußerungen gemacht hätte, wie er hoffte, in ihrem Hause einmal einen Schatz zu finden und wie auf solche Weise nicht selten arme Leute reich und glücklich geworden seien. Sie gab dann einige Beispiele davon, die sie von ihrer Großmutter wußte, und erzählte auch noch geisterhafte und heimliche Erlebnisse aus Riccardos Kindheit, wo er den Unterschied zwischen Lebendigem und Gespenstischem noch nicht kannte und voll Unschuld alles mitteilte, was er wahrnahm.
Der Bucklige, für den Riccardo ein unerschöpflicher Gesprächsstoff war, hockte sich währenddessen dicht neben mich und erzählte mir flüsternd, wie er vor Jahren Riccardos Bekanntschaft gemacht habe; Riccardo, der mehrere Jahre jünger war als er selbst, hatte von seiner Mutter gehört, man dürfe die Buckligen nicht auslachen, denn sie hätten ein unschuldiges Herz, weshalb auf der Straße auch immer ein weißes Pferd einem Buckligen voraufgehe. Dies hatte solchen Eindruck auf Riccardo gemacht, daß er seitdem, wenn er mit seiner Mutter ausging, beständig nach Schimmeln und Buckligen ausspähte. Als es sich eines Tages so traf, daß er erst einem Wagen begegnete, dem zwei weiße Pferde vorgespannt waren, und gleich darauf einem Buckligen, nämlich ihm selber, riß er sich von der Hand seiner Mutter los, lief auf ihn zu, küßte ihn und sagte auf dessen verwunderte Frage, warum er das thue: »Weil du ein unschuldiges Herz hast.« »Einsam und betrübt war ich an jenem Tage ausgegangen«, sagte der kleine Krüppel, »und als ich nach Hause kam, sprang mir das Herz vor Vergnügen über den Freund, den ich gefunden hatte«. Seitdem sei er in jeder Bedrängnis zu Riccardo gegangen, der, obwohl krank und blutarm wie er selber, ihn niemals ungetröstet hätte weggehen lassen.
Die Geistergeschichten der Farfalla murmelten immer leiser, wie ein verdecktes, kleines Wasser, durch die Nacht, und unwillkürlich hatte auch der Bucklige seine Stimme in meinem Ohr zu einem Geflüster sinken lassen. Es klang alles zusammen, wenn ich einen Augenblick nicht zuhörte, wie ein fernes, eintöniges Rauschen oder Trommeln, und ich werde nie den Eindruck vergessen, den es mir machte, als in diese dumpfe Musik plötzlich ein paar klingende Akkorde und dann eine leise singende Stimme hineindrang. Es war, wie wenn unter dem Raunen von Zaubersprüchen etwas Totes lebendig geworden wäre und süß zu tönen anfinge, so fremd und unerhört klang in diesem Augenblick Riccardos Harmonika und sein schwacher, aber reiner Gesang. Von dem langen Liede, das er sang, erinnere ich mich nur noch der ersten Zeilen, die lauteten: Sterben so jung, o mein Gott! Lebend nur Schmerzen gelitten! denn später hörte ich zwar noch zu, achtete aber nicht mehr auf die Worte. Alle Verse gingen über dieselbe Melodie, wodurch das Lied im ganzen wirkte wie eine gleichmäßige Musik in der Natur, das Fallen von Blättern oder der ewig wiederholte Sturz eines Wasserfalls in der Ferne oder wie das unermüdliche, immer von neuem beginnende Weinen eines kleinen Kindes.
Mir hatte sich sogleich das Bild vor die Augen gestellt, wie er dalag auf dem harten Bett und auf die graue Decke starrte, die so dicht über ihm war, und ich fragte mich, welches seine Gedanken gewesen sein mochten, während wir unten plauderten, bis zu dem Augenblick, wo er die Harmonika nahm und das traurige Lied sang. Ich wühlte in seinen Erinnerungen nach, soweit sie mir bekannt waren, und fand nichts als Entbehrung, Hunger, lange Jahre im Krankenhause, Wunden, Schmerzen und Einsamkeit, alle diese Vorstellungen drangen wie höhnende Larven auf mich ein, als hätten sie etwas von mir zu fordern oder eine Rache an mir zu nehmen, und es war mir merkwürdigerweise auch so zu Mute, als müßte ich ihnen meine nackte Brust bieten und sagen: nehmt, saugt mir das Blut aus, sättigt euch an mir. Die übrigen waren bei den ersten Tönen des Gesanges verstummt; man hörte nur noch die leisen Atemzüge der Schusterkinder, die eingeschlafen waren. Die großen Augen des Buckligen waren feucht und glänzten wie ein mondbestrahltes dunkles Wasser in seinem häßlichen, mageren, früh verrunzelten Gesichte, die der Farfalla dagegen sahen mit dem eigentümlich trockenen und erschöpften Blick unverwandt in das offene Fenster, woher die Töne kamen. Die Schusterleute saßen mir im Rücken, so daß ich, ohne mich zu wenden, sie nicht sehen konnte. Die Dauer des Liedes kann nicht mehr als fünf oder zehn Minuten betragen haben, mir schien es aber damals und es ist mir auch jetzt in der Erinnerung so, als wären hundert Jahre darüber vergangen. Als es aus war, hörte ich ein paar tiefe Seufzer oder tiefes Atemholen, unbewußtes, wie bei Kindern, keiner sprach mehr, sondern langsam nacheinander standen alle auf und verabschiedeten sich stumm durch Kopfnicken und Winken.
Ich war im Begriff, der Farfalla gute Nacht zu sagen, als noch ein Weib mit müden, schleppenden Schritten die Gasse heraufkam, in der ich jene Frau wiedererkannte, deren Mann vor Jahren wegen eines seltsamen Diebstahls ins Gefängnis und dann ins Irrenhaus gebracht worden war. Sie blieb vor dem Bilde des heiligen Antonius stehen, faltete die Hände und murmelte etwas; dann bückte sie sich nach ein paar Lilien, die aus der Nische heruntergefallen und zertreten waren. Ihr scheuer Blick, mit dem sie sich dabei umsah, als wäre sie im Begriffe, eine Missethat zu begehen, fiel uns auf, und sie schrak unwillkürlich zusammen und machte eine Bewegung, um die zerquetschten Blumen zu verstecken oder fallen zu lassen. Die Farfalla, welche sie gut kannte, sagte gutmütig: »Der heilige Antonius wird dir den Abfall von seinem Reichtum wohl gönnen; aber was willst du mit den welken Blumen?« »Sie sollen Glück bringen«, erwiderte die andere, indem sie die Lilien an sich drückte und uns das verfallene Gesicht zukehrte. Dann ging sie mit denselben mühseligen Schritten weiter. Lächelnd sagte die Farfalla: »Sie beten alle zu Gott um Glück und Geld und bedenken nicht, daß Jesus in einer Krippe geboren wurde, auf einem Esel in Jerusalem eingeritten ist und nicht hatte, wo er sein Haupt betten konnte.«
Auf meinem Nachhausewege schwebte mir wie ein Sonnenfleck, den man nicht loswerden kann, das Gesicht des armen Weibes vor; so fürchterlich, weil man die Jugend und Lieblichkeit noch sah, die darin verschüttet war, ganz besonders aber die mageren Hände mit dem vergrämten Ausdruck, die sich krampfhaft wie ein verhungertes Tier um die zertretenen, schmutzigen Lilien klammerten. Hätte sie eine Klage ausgesprochen, würde mir der Anblick vielleicht nach flüchtigem Bedauern vorübergegangen sein, aber daß sie auf Glück wartete! Es war mir, als hätte ich jemand gesehen, der liefe und liefe in der Hoffnung, ein schönes, fernes Licht zu erreichen, während er thatsächlich in einem finsteren Dickicht endlos sich im Kreise drehte. Ohne Rettung im Elend versunken, raffte sie noch nach dem Schmutz von der Straße in einem blinden Wahne, sie müßte irgendwo das Glück finden. Ob sie sich etwas darunter vorstellte? Ob es nur ein dunkles, angeborenes Gefühl war, ein halbverstandener Drang aus der Schwere des Lebens weg? Oder etwas wie die Ahnung einer Melodie, die man einmal gehört hat und die man wieder hören möchte? Jammervolle Thorheit der Menschen, sinnlose Verblendung, die man nicht verlachen kann, weil sie einem das Herz zerreißen! Aus dem Staube ihrer Armut, ihrer Not und Niedertracht ringen sie die Hände nach den Heiligen, nach diesen Ueberirdischen mit den zermarterten Leibern, mit den ausgehöhlten Wangen und den gottsuchenden Augen, die die Welt überwunden haben; von ihnen, die das Leiden geliebt und nach Leiden gerungen haben, wollen sie Linderung ihrer Leiden und was die Summe alles Erdenglücks ist: Geld. Geld, Liebe, Rausch der Sinne; auf heißem, schwerem Atem stürmen solche Gebete den Himmel und hängen sich an die ätherischen Körper der Verklärten, die ihre seligen Häupter der Ewigkeit zuwenden von der Erde weg. Während sie nie aufhören, auf die himmlische Muttergüte zu bauen, die von oben sorgt und waltet und die Aermsten zuletzt mit gehäuftem Reichtum tröstet, fegen die Stürme des Elends: Hunger, Frost, Schande und Haß über ihre morschen Dächer, unter denen sie hilflos und gottverlassen hausen.
Was aber soll man erst von unserem Wahnsinn sagen, die wir Gott, dem Geiste, für unsere vollen Kasten, für unsere Siege, für unser sorgloses Kissen, für unser Wohlleben danken, als hätte er es uns zum Lohn unserer Güte oder aus Zärtlichkeit wie ein liebender Vater gegeben?
Wie lieblich ist die unschuldige Selbstsucht des Kindes, das sich Gott wie einen Zuckerbäcker vorstellt, der das brave Kind mit Süßigkeiten belohnt, gegen unsere Dummheit, Verlogenheit und Habgier, die wir zu dem Allgeist, dem Ur- und Endwesen, wie zu einem Allgeldsack beten: Zahle uns, die wir deinen Namen im Munde führen! Gieb uns Münzen und wir werden dein Bildnis darauf prägen!