
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
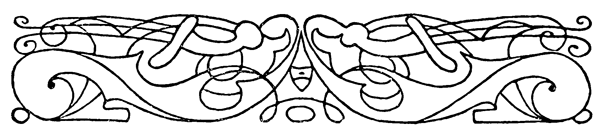
In einer warmen Mainacht erfolgte der Aufbruch zur Wallfahrt. Da während des Marsches nichts genossen werden durfte, nahmen die Pilger nebst der großen Bekanntschaft, die ihnen das Geleit gab, vorher einen Imbiß, zu welchem Zweck sie sich auf einem freien Platze lagerten, der teils mit allerlei Trümmerschutt bedeckt, teils mit wildem Grase bewachsen war. Auf einer Seite schloß ihn die Kastellmauer ab, nach der andern überflog der Blick das Meer, bis wo es in violetten Dünsten mit dem Himmel zusammenfloß.
Ich war den meisten Anwesenden von Ansehen schon bekannt und machte mich dazu noch schnell beliebt, indem ich etwas Fleisch, Obst und Leckereien als Beitrag zur gemeinsamen Mahlzeit mitbrachte. Zunächst hielt ich mich an der Seite der Farfalla, die auf ein paar Steinen im Schutze der Mauer Kaffee und Salat bereitete; denn niemand konnte mich so gut wie sie in die Geschichte der Gesellschaft einführen. Mitten im schnellen und geschickten Hantieren entwarf sie mir die Lebens- und Charakterbilder einiger Frauen, die sie bei der Arbeit beschäftigte und die sich ohne weiteres ihren Anordnungen fügten. Es waren da zwei Mitbewohnerinnen meines Hauses: eine Schwindsüchtige von erschreckender Magerkeit, die nicht nur die Hoffnung, sich Genesung von der Madonna zu erflehen, sondern ebenso sehr die Sehnsucht nach Menschen, Gespräch und Gelächter zur Teilnahme an der Wallfahrt bewogen hatte. Sie war eine besondere Freundin Riccardos, dem sie in unermüdlicher Lebhaftigkeit und in der Lust an Scherz und Neckereien glich. Sie pflegten sich in gegenseitigen Sticheleien auf ihr Kranksein und Hinsiechen zu überbieten, und die Schwindsüchtige hatte die Wette vorgeschlagen, daß Riccardo, der sich ihr gegenüber mit Gesundheit brüstete, vor ihr sterben würde. »Wie aber wirst du mich auszahlen, wenn ich gewinne?« sagte sie. Riccardo bat sie, ohne Sorge zu sein, da er, wenn das Unwahrscheinliche geschähe, um Mitternacht kommen und ihr den Betrag in Sternthalern auf das Bett legen würde.
Die andere Frau war eine fette Alte, die seit Jahren jeden Mai in Ausübung ihres Berufes mitging, obgleich sie sich sonst ungern bewegte und auch jetzt der Farfalla zusah, ohne sich zu rühren, außer daß sie einen sehr langen, sehr prächtigen Rosenkranz ununterbrochen durch die Finger laufen ließ, aber mit einem Ausdruck, als hinge von ihrer Beobachtung das Gelingen der Mahlzeit ab. Sie betrieb das Geschäft für wohlhabende Damen, die keine Zeit oder keine Lust zum Kirchenbesuch hatten, vertretungsweise in den Gotteshäusern zu sitzen, auch fromme Gelübde, wie Wallfahrten, Abbeten von Rosenkränzen, Absingen von Gebeten und dergleichen auszuführen. Sie trug am Gürtel einen Rosenkranz und eine immer mit Kaffee gefüllte Blechbüchse und wurde in der Altstadt kurzweg das Kirchenweib oder der Kirchenfrosch genannt, letzteres, weil sie runde, starre, froschartig hervortretende Augen hatte und, sobald sie unbeobachtet war, sich in großen Sprüngen hüpfend, so ging das Gerede, fortbewegte. Trotz dieser Späße genoß sie großes Ansehen, nicht nur weil sie viel Geld verdiente, sondern auch weil sie sich mit Majestät zu betragen wußte und von den heiligsten und allerheiligsten Dingen mit spielender Vertraulichkeit sprach.
Zwei Frauen wies mir die Farfalla als besonders beklagenswert, weil ihr Lebenslauf in einer Art von Wohlhabenheit begonnen hatte. Die eine, die Apollonia hieß, mußte ihrem Anzuge nach zu den allerärmsten gehören, wenn sie nicht die unordentlichste von allen war; sie ging buchstäblich in Lumpen. Sie hatte ein nicht schönes, aber auffallendes, sinnlich leidenschaftliches Gesicht mit niedriger Stirn und rastlosem, fast bewußtlosen Ausdruck, der auch ihren Bewegungen eigen war; anziehend war sie höchstens deshalb, weil sie einen so ungewöhnlich bejammernswerten Eindruck machte. Ihre Geschichte war so: Tochter eines Beamten hatte sie einen kleinen Finanzbeamten geheiratet, mit dem sie in guten Verhältnissen lebte; er hinterließ ihr, als er starb, kein Vermögen, aber von der Pension, die sie bezog, hätte sie, die ohne Kinder war, wohl leben können. Schon nach einem Jahr verheiratete sie sich zum zweiten Male und zwar mit einem Fleischer, der nicht bösartig, aber heftig und zur Trunksucht geneigt war; er trank, weil das Geschäft zurückging oder es mochte auch umgekehrt sein, kurz, bald stellten sich Sorgen und Widerwärtigkeiten ein, von denen die Frau bis dahin nichts geahnt hatte. Der Mann verfiel in Krankheit, die den Rest des vorhandenen Geldes aufzehrte; je schwächer er war, desto weniger Widerstandskraft hatte er seinem Hang zum Trinken entgegenzusetzen, und schließlich erhängte er sich in einem Augenblick des Nüchternwerdens nach sinnloser Trunkenheit. Der hilflosen Frau verschafften Bekannte aus der guten Zeit einen Verkaufsstand am Markte, womit sie sich leidlich weiterhalf, und sie wäre vielleicht auch wieder zu einer gewissen Ordnung gekommen, wenn sie sich nicht schleunig in einen Dienstmann verliebt hätte, der seinen Stand in der Nähe des ihrigen hatte. Mit diesem ging sie ein Verhältnis ein, ohne zu heiraten, und gebar nun, da sie in ihrem vierzigsten Jahre war, nacheinander fünf Kinder, wobei sich ihre Kräfte schnell aufzehrten. Der dritte Mann war der arbeitscheueste und ungutmütigste von allen; er wurde des mühseligen Haushalts bald überdrüssig, nahm sich ein junges Ding zur Geliebten und bezog mit ihr eine andere Wohnung, ohne sich um Apollonia und ihre Kinder weiter zu bekümmern. So war sie in die Römerstadt verschollen, wo die Farfalla dem ratlosen Geschöpf mit ihrem praktischen Sinn und ihrer Lebenserfahrung beigestanden und ihr geholfen hatte, Arbeit zu finden.
Die andere Frau mochte so alt sein wie die Apollonia, doch war in ihrem vergrämten Gesicht eine geheime Lieblichkeit, die sie viel jünger und anziehender erscheinen machte. Der Angabe der Farfalla nach wäre sie vor zehn Jahren noch jung und bildhübsch gewesen, verheiratet mit einem gleichfalls hübschen und überlustigen jungen Manne, der in einem Hutgeschäft arbeitete und sein gutes Auskommen hatte. Eines Tages war er während eines heftigen Gewitterregens in ein Juweliergeschäft getreten, hatte einen großen Kasten voll kostbarer Steine unter den Arm genommen und ihn nach Hause getragen, ohne daß es bemerkt worden wäre. Zu Hause hatte er die Steine aus dem Kasten geworfen, sein neugeborenes Kind hineingelegt und seiner überraschten Frau erklärt, darin sollte die Kleine künftig schlafen. Durch ein Mädchen, das zur offenen Thür hineingeblickt hatte, wurde die Sache offenkundig, und der unglückliche Mensch kam ins Gefängnis, da die Richter offenbar an seine plötzlich ausgebrochene Geisteskrankheit nicht glauben wollten. Dort wurde er nach anfänglichem Toben immer stumpfsinniger, zugleich aber nahm er körperlich zu und litt an einem unstillbaren, gierigen Hunger. Seine Frau, die sich mit ihren Kindern kaum zu erhalten vermochte, unterließ doch nie, ihren Mann zu besuchen und ihm Eßvorräte zu bringen, die sie sich selbst absparte, so daß sie in gleichem Maße hinwelkte, wie der Gefangene fetter und schwerfälliger wurde.
Ich sagte zur Farfalla, nachdem sie mir diese und ähnliche Geschichten erzählt hatte: Ihr Frauen wäret ohne Männer, wie es scheint, besser daran, und doch kriecht ihr ihnen immer nach. Was ist das? Ist es Dummheit? Tollheit? Liebe? »Es ist Schicksal«, sagte sie, ohne die Thatsache im mindesten zu leugnen; »›alles ist Bestimmung‹, pflegt Riccardo zu sagen, und ich glaube, daß er recht hat.«
Uebrigens, sagte sie, hätten es zuweilen auch die Männer zu büßen, und ließ mich zum Beweise dessen den Flickschuster Bonalma in Augenschein nehmen, der eben jetzt der Römerstadt Stoff zu endlosem Gespräch und Gelächter gab. Er hatte sich von den andern abgesondert; mehr gegen das Meer hingesetzt und stierte mit ausdruckslosem Blick geradeaus; er sah jung aus, aber bleich und mager, und hielt sich wie vor Angst in sich zusammengekrümmt, so daß ich ihn mir fröhlich und ansehnlich, wie er noch vor kurzem gewesen sein sollte, nicht vorstellen konnte. Er hatte sehr jung vor etwa zehn Jahren, geheiratet, mehrere Kinder bekommen und zufrieden gelebt, bis seine Frau anfing, in unbegreiflicher Weise den Haushalt verkommen zu lassen und das Geld zu verschleudern. Als Ursache der sonderbaren Veränderung wurde eine Geistesstörung nachgewiesen, derentwegen sie in eine Irrenanstalt gebracht werden mußte. Bonalma nahm sich zur Besorgung des Hauswesens und der Kinder ein junges, tüchtiges und sehr kräftiges Mädchen ins Haus, die mit der Zeit zwei Kinder von ihm bekam und sich völlig als seine Frau fühlte und gebärdete. Die Kranke hatte er deswegen durchaus nicht vergessen, sondern besuchte sie zuweilen oder schickte ihr doch Kleidungsstücke, etwas zu essen und was sie sonst brauchen konnte. Längere Zeit war er nicht in der Anstalt gewesen, als ihn um Ostern eine heftige Sehnsucht ergriff, sie wiederzusehen. Sie hatten nämlich zu dieser Jahreszeit Hochzeit gehalten und Primeln und Veilchen büschelweis im Gürtel und Knopfloch getragen; seitdem ergriff ihn jedes Frühjahr, wenn ihn irgendwo der Geruch dieser Blumen anwehte, eine Lust nach der kranken Frau, der er nachgeben mußte, wenn er nicht selber wirr im Kopfe werden wollte, und er machte sich auch diesmal auf, um sie zu besuchen. Der behandelnde Arzt empfing ihn mit der Nachricht, er habe wider Erwarten Hoffnung, seine Frau zu heilen, Bonalma möge in einigen Wochen wiederkommen und sie völlig wiederhergestellt nach Hause führen. Den Bonalma traf diese Nachricht wie ein Schlag auf den Kopf und er taumelte nach Hause, ohne zu wissen wie. In diesem Zustande, wie im Rausch oder Traume, hatte er den Mut, seiner Geliebten die Neuigkeit zu eröffnen und ihr zu sagen, daß sie ihn nunmehr verlassen und seiner rechtmäßigen Frau den Platz räumen müsse. Sie indessen sprach ohne Zaudern den festen Entschluß aus, nicht von der Stelle zu weichen, was insofern nicht unberechtigt war, als sie in einigen Monaten eine neue Entbindung erwartete. Gewalt zu gebrauchen war Bonalma nicht der Mann und am allerwenigsten in diesem Falle, wo er sein Gewissen belastet fühlte, wo sein Herz an den Kindern hing und außerdem das feste, rücksichtslose Weib, das sich nicht im mindesten darum bekümmerte, was werden sollte, ihn noch furchtsamer als gewöhnlich machte. Die Nachbarn erwarteten mit lebhafter Neugier, was sich begeben würde, wenn die Frau in ihr Heim zurückkehrte, was in den nächsten Tagen geschehen mußte. Keiner wußte einen Ausweg als den, welchen der Bucklige, ein Freund Riccardos, angeraten hatte, daß Bonalma die von seiner Frau verlassene Zelle im Irrenhaus bezöge.
Allerdings legte sein Aeußeres diesen Gedanken nahe. Sein Gesicht trug die Spur davon, daß ein und derselbe marternde Gedanke, vielmehr nur ein verworrenes Furchtgefühl, schwer und massenhaft in seiner Dumpfheit, in ihm umging. In seinem stieren, glimmernden Blick lag etwas Bedrohliches; er erschien mir wie ein grimmig leidendes Tier, äußerst harmlos von Natur, das, wenn die Todesnot ihm an die Kehle greift, blind um sich schnappen und mit verzweifelten Bissen töten kann, was ihm nahkommt.
Wie mir die Farfalla sagte, hatte er die Frau viel lieber als die Geliebte, obgleich diese jünger und üppiger war. Häuslich, anhänglich und gemütvoll, wie er war, hatte er sie, vielleicht ohne sein Wissen, immer im Herzen behalten; freilich war sie auch gut und schön gewesen, wie es nicht viele giebt. Die Farfalla in ihrem Bestreben, um jeden Preis die Traurigen zu erheitern, hatte ihm geraten, die Wallfahrt mitzumachen; was für ein Wunder die Madonna aber eigentlich für ihn thun sollte, wußten sie wohl beide nicht. Wie ich ihn aus der Ferne betrachtete, kam es mir in den Sinn, daß seine Geliebte besser thäte, nicht in seiner Nähe zu bleiben, so zart und verschüchtert er auch aussah, und dieser Gedanke, daß er ein Mörder war und es selbst noch nicht wußte, vielleicht nur als eine quälende Ahnung in sich spürte, wurde mir so lebhaft und peinlich, daß ich mich nicht überwinden konnte, ihn anzureden.
Viel erquicklicher waren zwei alte Eheleute anzusehen, kleine, lebhafte Personen mit munteren Augen; man hätte sie eher für Geschwister, als für verheiratet gehalten. Sie hatten zwei Töchter, die schön, gesund und lebenslustig waren, aber ebenso stürmisch und unbedacht, und sich mit reichen Herren in Liebesverhältnisse einließen. Die Eltern hatten anfänglich darüber gescholten, aber nur gelinde, weil sie die beiden prächtigen Mädchen zu lieb hatten, und schließlich bauten sie sich sogar waghalsige Luftschlösser, wie die Herren ihre Kinder heiraten und zu Glanz und Ehre bringen würden; denn in alten Zeiten war ja dergleichen oft vorgekommen. Anstatt dessen brachte die älteste nacheinander zwei Kinder ins Haus, die die alten Leute aufziehen mußten, und als der Liebhaber, der sich um die Kinder nicht kümmerte, sogar anfing, sie selbst zu vernachlässigen, ging sie in die weite Welt, um nicht zu erleben, daß sie ganz verabschiedet würde; denn wenn sie auch faul und leichtsinnig war, fehlte es ihr doch nicht an Stolz und Mut. Die beiden Kinder ließ sie den Eltern zurück mit dem Versprechen, Geld zu schicken, sobald sie welches verdient haben würde, hatte aber seitdem noch nichts von sich hören lassen, und die Alten hatten Gelegenheit, sich neue Luftschlösser zu bauen von der Rückkehr der Tochter in wunderbaren, glanzvollen Verhältnissen. Der zweiten Tochter war es unterdessen ähnlich gegangen wie ihrer Schwester, nur war sie anders geartet als jene und nahm sich die Folgen ihres Thuns weit mehr zu Herzen. Seit sie wußte, daß sie Mutter eines vaterlosen Kindes werden sollte, traute sie sich nicht mehr aus der Wohnung ihrer Eltern hinaus, und nachdem die Geburt vorüber war, verließ sie das Haus nur, um nicht wieder zurückzukehren. Ob sie wie ihre Schwester in die Welt gegangen war oder ob sie den Tod gesucht hatte, blieb zweifelhaft. Die kleinen alten Leute, die als Topfbinder nicht wenig Mühe hatten, ihre drei blühenden Pfleglinge großzufüttern, hörten nicht auf, zu hoffen, und trabten jährlich im Mai auf den heiligen Berg, um die Gnade der Mutter Gottes für ihre verlorenen Kinder zu erflehen.
Von den Kindern der Farfalla war nur ihre jüngste Tochter Vittoria anwesend, und diese beteiligte sich eigentlich wider den Willen ihrer Mutter an der Wallfahrt. Es handelte sich nämlich um einen Geliebten, von dem die Farfalla durchaus nichts wissen wollte, obgleich sie im ganzen dem Willen ihrer Kinder eher zu viel, als zu wenig nachgab. Daß das Mädchen, die wegen ihrer Schönheit und Fröhlichkeit allgemein beliebt war, mehrere ordentliche und gutgestellte Bewerber abgewiesen hatte, ließ sie hingehen; gegen eine Heirat mit dem einzigen, den Vittoria haben wollte, kämpfte sie aber mit ungewöhnlicher Entschiedenheit und wurde darin von Carmelo und Riccardo unterstützt. Carmelo hatte seine Schwester sogar einmal geschlagen aus Zorn, daß sie sich durch kein Bitten und Zureden von ihrer Wahl wollte abbringen lassen, und erklärt, daß sie, wenn sie die Frau jenes Mannes würde, ihn nicht mehr als ihren Bruder betrachten dürfe. Der Liebhaber hieß Pasquale und war aus guter Familie; als Grund ihrer Abneigung gab die Farfalla mir nichts anderes an, als daß er ihr überaus widerwärtig und daß er faul sei; ein fauler Mann sei des Teufels, und die Frau, die ihn heirate, komme in die Hölle.
Nachdem das Essen vorüber war und die Lebhaftigkeit allgemein wurde, wandte sich die Farfalla, die mir bis dahin auf das kurzweiligste alles dies erzählt hatte, was ich jetzt aus der Erinnerung wiedergegeben habe, an die ganze Gesellschaft, der sie als Geschichten- und Liederkundige bekannt zu sein schien. Wie sie bequem in der Mitte saß, die hellen, blauen Augen eindringlich, aber doch mit einer gewissen lächelnden Ueberlegenheit auf ihre Zuhörer geheftet, ihren Vortrag mit wenigen, aber lebhaften Handbewegungen begleitend, mußte ich an die wandernden Sänger denken, die in vergangenen Zeiten auf dem Platz unter den Linden das Volk um sich versammelten. Niemand unterbrach sie als höchstens durch beifälliges Lachen oder einen Ausruf des Erstaunens, und auch ich hatte das Gefühl, ich würde nicht müde, ihr zuzuhören, so anmutig rollte sie Bild um Bild aus der Dunkelheit und Armseligkeit ihres vergangenen Lebens auf. Zwischenhinein erzählte sie auch Märchen und Legenden, die als Beispiele für irgend eine Behauptung oder Erfahrung dienen sollten, ja sie sang auch Strophen von Liedern, die man ehemals gesungen hatte und von denen einige mir mit Wort und Melodie im Gedächtnis geblieben sind, obwohl sie sie fast ohne Stimme und Gehör vortrug. Der Ton, in dem sie erzählte, verriet deutlich, daß sie die Heiligen nicht sehr ernst nahm, auch von der Madonna sprach sie mit gutmütiger Ironie, obgleich sie jetzt zum dritten Male mit ihren Sorgen und Anliegen auf den heiligen Berg pilgerte.
Das erstemal war sie ein siebzehnjähriges Mädchen und bat die Himmlische, das Herz ihrer Mutter zu erweichen, die verlangte, daß sie nicht den schönen Uhrmacher, ihren zukünftigen Mann, in den sie damals verliebt war, sondern jenen älteren, arbeitsamen Freier heirate, mit dem später ihre Schwester eine behäbige Bürgersfrau wurde. Unterwegs hatte sie eine große Angst vor ihrer Mutter, die sie im Grunde für viel mächtiger hielt als die Madonna und ohne deren Wissen sie nun einen ganzen Tag lang ausgeblieben war. Zu ihrer großen Ueberraschung fand sie aber die sonst hartnäckige Frau umgestimmt; denn diese hatte gemeint, als ihre Tochter nicht heimkam, sie hätte sich entweder den Tod angethan oder wäre ihrem Liebsten zugelaufen, keines von beiden wollte sie aber als einen Schandfleck in ihrer Familie dulden. Deshalb beschloß sie, ihre Tochter solle nun ihren Willen haben, und sah mit Genugthuung den Folgen entgegen, die daraus erwachsen würden, leistete ihr auch später, als ihre Prophezeiungen eintrafen, keine Hilfe. »Also«, sagte die Farfalla, »habe ich der Mutter Gottes meinen Mann zu verdanken, der mich nach acht Jahren verließ und mich zur Bettlerin machte; sie muß ihn doch wohl nicht so gut gekannt haben als meine Mutter.«
Das zweitemal war die Farfalla nicht erhört worden. Es war kurze Zeit, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte, und zwei Monate vor der Geburt ihres jüngsten Kindes. In ihrer Not und gänzlichen Verlassenheit graute ihr davor, noch ein Kind mehr ernähren zu sollen, da sie kaum für die anderen Brot auftreiben konnte, und es war ihr, als müßte sie den Himmel zwingen, die noch ungeborene Seele in seinen Schoß zurückzunehmen. Mit ihrem schwerfälligen Körper und trostlosen Herzen schleppte sie sich den Berg hinauf, in der Sommerhitze fast verschmachtend, denn sie hatte sich auferlegt, unterwegs keinen Tropfen Wasser zu sich zu nehmen. Oben angekommen, war sie vor Schwäche und Uebelkeit unfähig, zusammenhängend zu denken, geschweige denn ihr Anliegen in Gebeten auszudrücken; mit dem hingebenden Gefühl, die Göttliche würde sie auch ohne Worte verstehen, warf sie sich vor dem Bilde der Madonna hin und weinte so, daß das Altartuch naß und schwer wurde und die Thränen auf den steinernen Boden flossen. Das Kind kam aber nichtsdestoweniger zur rechten Zeit auf die Welt und war, wie die Farfalla behauptete, blühender, kräftiger, schöner und lebhafter als die anderen, gerade als ob es ein doppeltes Leben hätte.
Vittoria war an einem Sonntage, als die Sonne am höchsten stand, unter den Klängen fröhlicher Musik geboren. Es war nämlich ein Trupp Soldaten durch die Straße, wo die Farfalla wohnte, gezogen, die, als sie den bekannten Marsch blasen hörte, ihre Arbeit ließ und an das Fenster lief, um zu schauen. Indem sie sich herausbog und gerade die goldgelben Trompeten in der Sonne blitzen sah, packte sie das erste Weh, worauf sich die Geburt mit solcher Schnelligkeit vollzog, daß sie, als alles vorüber war, noch ein paar schwache Töne der Musik aus der Ferne vernehmen konnte. »Wäre das Kind ein Knabe gewesen«, bemerkte die fette Alte, als die Farfalla diese Erzählung beendet hatte, »so wäre ein großer Feldherr daraus geworden.« »Ich dachte, auch das Mädchen würde mir Glück bringen«, sagte die Farfalla und richtete ihre hellen Augen auf Vittoria, die von ihr entfernt saß; »aber jetzt glaube ich es nicht mehr.«
Aussehen that das wundervolle Geschöpf, als ob es geboren wäre, den Purpur des Glückes zu tragen. Sie war so recht aus der Fülle der Natur heraus geschaffen, jeder Reiz von Farbe, Schmelz der Haut, Weichheit und Ueppigkeit der Formen schmückte ihr Gesicht und Gestalt, worin man die stumme Musik der Seele und des Geistes so wenig wie an einem Busch Rosen oder Tulpen vermißte. Ihre weit offenen, großen Augen strahlten einen warmen Glanz aus, von dem man sich hingerissen überfluten ließ wie von der Sonne, und dessen man vielleicht auch einmal, wie der Sonne, überdrüssig werden konnte; zu sagen hatte sie gewiß nichts und nichts mitzuteilen als Jugend, Fröhlichkeit und Liebesfeuer, was freilich viel und gewaltig ist. Sie hatte, während ihre Mutter erzählte, still zugehört, dabei aber über das Meer hinausgesehen und nie ein Wort eingemischt; auf die letzte Bemerkung der Farfalla drehte sie langsam den Kopf und sagte ruhig: »Ich bin gegen dich nicht schlechter, als du gegen deine Mutter warst«, wandte sich dann wieder um und richtete den großen Blick in die Ferne. Was sucht sie da? dachte ich, hört sie vielleicht einen Siegesmarsch, uns allen unvernehmbar, Pauken und Trompeten mit heroischem Schmettern und schmelzender Klage, die sie weg zu einem großen Schicksal locken? Ich flocht ihr im Geiste ein Diadem um die Stirne und stellte sie auf den Imperatorenwagen; weiße Pferde mit langen Mähnen und Schweifen zogen ihn den Berg hinan zum Kapitol, nein, auf den Gipfel des Lebens. Leoparden, Tiger, Elefanten und anderes fremdländisches Getier, an silbernen Ketten geführt, umdrängten brüllend und kreischend den Weg, und über allen Lärm und Pomp weg blickten ihre schwarzen Augen weit offen, stolz und sicher. Ich erzähle dies, um von der Herrlichkeit ihrer Schönheit einen Begriff zu geben; ich hatte dabei Besinnung genug, mir zu sagen, daß ihre Gedanken und Wünsche sich in Wirklichkeit um nichts Wichtigeres als ein braunes Männergesicht im Kreise drehten, und als ich mich zu ihr setzte und mit ihr plauderte, erhielt ich sogleich die Bestätigung meines Urteils über ihre geistige Beschaffenheit. Beim Sprechen bekam ihr Gesicht einen drollig munteren Ausdruck, der sie der Majestät fast ganz benahm und sie mehr ins alltägliche, glaubhafte Leben stellte. Dadurch verlor sie durchaus nicht etwa an Reiz, als höchstens für die Phantasie; herzlicher berührte sie mich, nachdem ich mit ihr gesprochen hatte. Warum sie denn alle die Bewerber, die ihrer Mutter genehm gewesen waren, ausgeschlagen hätte, fragte ich. »Sie waren mir nicht schön genug«, gab sie mir zur Antwort und strahlte mich dabei mit einem solchen Lächeln an, daß ich unwillkürlich errötete, als ob ich mich meiner etwas herbstlichen und in ihren Augen vielleicht überhaupt prunklosen Erscheinung zu schämen hätte. »Und Pasquale ist schön genug?« fragte ich weiter, worauf sie mir mit einem Nicken antwortete, noch sprechender aber mit einem schnellen Auflodern ihres Gesichtes, das keine Zweifel an der Pracht und Herrlichkeit des Geliebten übrig ließ.
Immerhin wünschte ich ein unparteiisches Urteil zu hören und ging zu Riccardo hinüber, von dem ich es am ersten zu bekommen erwartete. »Wie sieht der Geliebte deiner Schwester aus?« fragte ich ihn. »Wie die Bestie, die der ist«, sagte Riccardo wegwerfend und ohne sein Harmonikaspiel zu unterbrechen, das ihm augenscheinlich weit mehr am Herzen lag. »Sehen Sie«, fuhr er sogleich fort, »da wo Sie den weißlichen Streifen im Wasser sehen, ist eben ein großer Dampfer gefahren, der nach Indien geht, und unter den Maschinenheizern ist ein Freund von mir, den ich beerben werde.« Die Erbschaft bestand aus einem wohlriechenden Kästchen von Sandelholz und einem Papageien, der nach Riccardos Beschreibung das wundervollste war, was man sehen konnte, blau und grün wie ein Pfauenrad, dazwischen einige brennendrote Federn und das ganze Körperchen schimmernd, als ob man es mit Leim bestrichen und in Rauschgold getaucht hätte. Sprechen konnte er nichts anderes als ›Auf Wiedersehe‹ und ›Addio‹, aber ich werde ihn noch vieles lehren«, sagte Riccardo, »denn in vier Wochen ist er mein.« Ich fragte, wie das zusammenhänge, und Riccardo sagte ruhig: »Vielleicht stirbt mein Freund an der Pest, die jetzt in Indien ist; wiederkommen wird er jedenfalls nicht.« Er hatte Augen und einen Blick und eine Stimme, wenn er dergleichen sagte, daß es einen bis in die Knochen schaudern konnte, und doch hatte er selbst nicht das mindeste Gefühl von etwas Unheimlichem, ja nur Geheimnisvollem. Etwas Sichtbares wäre es nicht, sagte er, woran er zuweilen von Menschen wüßte, daß sie sterben müßten, er fühlte und wüßte es, wie man wohl im Traume wüßte, dies ist mein Vater, oder von einer Landschaft, dies ist Indien, wenn auch das Traumbild ganz verschieden von der Wirklichkeit wäre. Uebrigens wäre das so wenig etwas Besonderes, daß Tiere dasselbe Wissen hätten, wie denn seines Freundes Papagei beim Abschied durchaus nicht hätte »Auf Wiedersehen« sagen wollen, so viel sein Herr es ihm auch vorgerufen hätte, sondern unaufhörlich sein quäkendes »Addio«, so daß der Scheidende auf den Tod des armen Papageien geschlossen und sich von Riccardo hätte versprechen lassen, er wollte ihn ausstopfen, damit er doch das bunte, feurige Leibchen noch zu sehen bekäme. »Daß er selber sterben müßte, ist dem Dummen nicht in den Sinn gekommen«, sagte Riccardo lächelnd.
Warum er denn seinen Freund nicht gewarnt und von der Reise zurückgehalten hätte, fragte ich. »Wozu?« sagte er erstaunt. »Dann wäre er zu Hause an einem Reiskorn erstickt oder ohne alle Ursache gestorben. Es ist alles Bestimmung. Als kleines Kind hatte ich einmal eine gefährliche, sehr ansteckende Krankheit, und der Arzt gebot meiner Mutter, mich von den übrigen zu trennen, was, da wir nur ein Zimmer hatten, natürlich unausführbar war. Sie legte mich also mitten auf unser großes Bett, die andern dicht um mich herum und sich selbst zu Füßen, indem sie dachte, es würde nicht so übel sein, wenn wir alle miteinander stürben; doch wurde keines außer mir von der Krankheit ergriffen und ich selber wurde wiederhergestellt. An dem Tage, als ich zum Krüppel wurde, stürzte Carmelo von seiner hohen Mauer hinunter und wurde für tot nach Hause gebracht, kam aber bald wieder zu sich und tollte so lustig mit seinen Kameraden umher wie je. Ich dagegen, der schlafend von einer niedrigen Bettstelle heruntergerollt war, erholte mich nie mehr und werde bald an den Folgen eines an sich geringfügigen Falles sterben.«
Ohne mich auf die Richtigkeit dieser Darstellung und seiner Philosophie überhaupt einzulassen, versuchte ich nur, ihm auszureden, daß er bald sterben müsse: er sollte vielmehr, sagte ich, auf Besserung seines Zustandes hoffen, wenn er auch nicht ganz wiederhergestellt werden könnte. Er schüttelte den Kopf und sagte flüsternd: »Wissen Sie, warum meine Mutter auf den heiligen Berg geht? Glauben Sie, es wäre wegen des Tugendpreises der Nanni, den sie sowieso bekommt? Sie bittet um meinen Tod, denn der nützt ihr mehr, als das bißchen Geld zur Aussteuer für die Nanni.«
Ich suchte ihm diesen Gedanken, der mir aberwitzig und aus der Luft gegriffen schien, auszureden, machte ihm sogar ernstliche Vorwürfe, daß er solchen Verdacht gegen seine treueste, aufopfernde Freundin hegte, womit er sie übrigens nicht im mindesten antasten oder herabsetzen zu wollen schien. Er verstummte und sah sich in der Menge nach ihr um, und als er sie gefunden hatte, blickte er lächelnd und doch ein wenig grollend unverwandt nach ihr hin, als ob er meine Anwesenheit völlig vergessen hätte.
Im Scheine des Vollmondes, der mittlerweile, seine ganze Leuchtkraft gewonnen hatte, konnte man alles, was auf dem großen Platze vorging, deutlich erkennen, und ich erinnere mich, daß mir die graubleichen Gestalten, die über den trockenen, halbversandeten Schutt hin und her huschten, wie auferstandene Tote vorkamen, die ihre öden Grabgesichter in die warme Erdenluft tauchten und mit jähen, übertriebenen Gebärden das Leben nachzuahmen suchten. Wein war nicht getrunken worden, und doch wurde die Ausgelassenheit immer lärmender; gegenüber den verlorenen Tönen eines Gesanges oder einer Mandoline, die aus der Stadt unten hinaufdrangen, war es eine gellende, kreischende Lustigkeit. Der Mittelpunkt davon waren in diesem Augenblick drei verkrüppelte Geschöpfe, ein Buckliger, ein Einäugiger und ein schwachsinniges Mädchen von abstoßendem Aeußern, desto häßlicher noch dadurch, daß sie sich in auffallender, lotteriger Weise herausgeputzt hatte. Die beiden jungen Männer waren gute Freunde Riccardos, der aber den Buckligen der Treulosigkeit beschuldigte, seit dieser sich eines Abends, als alle am Brunnen standen und plauderten, mit der Schwachsinnigen verlobt hatte. Das klägliche Wesen nahm die Verlobung ernst und der groteske Anblick ihrer Zärtlichkeit erheiterte die übrigen, deren plumpe Neckereien, anstatt sie zu kränken, von ihrem blöden, kichernden Lachen begleitet wurden. In das Geschrei und Gelächter hinein rief die Farfalla: »Wenn der Bucklige und der Schrupper heiraten – denn so wurde die Schwachsinnige aus irgend einem Grunde genannt – braucht mein Riccardo auch nicht mehr zu warten, ich gebe ihm zwei Strohsäcke als Bett und ein Dutzend Steine, um den Herd zu bauen. Wer von euch Mädchen will ihn haben mit dieser Aussteuer?« Nun meldete sich eine ganze Schar lachender Mädchen, die erst die Farfalla umdrängten und riefen: »Ich will ihn, ich!« dann zu Riccardo liefen, ihn an seinen schwarzen Locken zupften und sich ihm unter mutwilligen Scherzen antrugen. Er erwiderte die Tollheit eine Weile, dann nahm er seine Harmonika und spielte eine Tanzweise, nach der die Mädchen sofort zu singen und zu tanzen anfingen, während einige Männer und alte Frauen mit halblautem, rhythmischem Brummen eine Art von Begleitung anstimmten. In den Tumult hinein that die tiefe, schütternde Glocke der Heidenkirche langsam die zwölf Mitternachtsschläge, womit nach der Verabredung das Zeichen zum Ausbruch gegeben war; es wurde augenblicklich still, die Abreisenden trennten sich kurz von denen, die zurückblieben, und ordneten sich zu zweien oder dreien in einen Zug. Indem sie sich in Bewegung setzten, stimmten sie einen Gesang an, der das Gepräge hohen Alters trug und schon von den ersten Pilgern, die vor Hunderten von Jahren auf den heiligen Berg wallfahrteten, gesungen sein mochte. Die Melodie der hohen Stimme hatte etwas geizig Verhaltenes, und ihre wenigen Töne irrten zwischen der tiefen, starren Begleitung wie zwischen einer quetschenden Mauer hin und her, verzweifelt einen Ausweg suchend und aus ihrer Dunkelheit nach Hilfe jammernd. Nachdem die Wandernden dem Blick schon verschwunden waren, hörte man noch lange das Klappern ihrer Schuhe auf den Steinen und die einförmige Schlußfigur am Ende jedes Verses, ähnlich dem Notschrei eines Ertrinkenden, der sich immer wieder emporringt, endlich aber mit schwächerer Stimme um Hilfe ruft, dann die Besinnung verliert und untergeht.