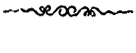|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Daß Herr von Tondern eine Wohnung hatte, versteht sich von selbst; auch war dieselbe seinen Verhältnissen angemessen, und bescheiden und bestand aus zwei Zimmern. Das eine war ein kleines Schlafgemach, von dem zwei Wände mit allerlei seltsamen Lithographieen verziert waren, während man an der dritten eine Anzahl vortrefflicher Jagdgewehre sah, und die vierte dieser gegenüber, wo sich die Thür befand, zeigte eine Sammlung Rehgewichte und Hirschgeweihe. Alles von selbst erlegtem Wilde.
Das andere Zimmer, der Salon, war dagegen sehr geräumig, und hier hatte sich die Kunstliebe des Herrn von Tondern bis zu Ansichten von Pferden, Reitern und Jagden aller Art verstiegen. Weiter war in diesem Gemache nichts Bemerkenswerthes, als drei Spieltische, eine etwas große Zahl für einen einzelnen Herrn. Und doch waren es ihrer nicht zu viel, denn die Freunde des Herrn von Tondern pflegten hier gern ihre Partieen zu machen, und an manchen Abenden sah es da aus wie in einem Spielklub. Wir wollen dadurch nicht ausdrücken, als seien hier Hazardspiele getrieben worden; meistens wurde Whist gespielt, und wenn man sich zuletzt auch hier und da pour la bonne bouchée zu einem Macao oder Landsknecht verstieg, so war das nicht der Rede werth.
Dabei war aber Herr von Tondern, was dieses Gemach anbelangte, von einer außerordentlichen Hospitalität. Auch wenn er nicht zu Hause war, öffnete die alte Aufwärterin genauen Freunden ihres Herrn das große Zimmer zu einem Spiele, und oft, wenn Letzterer heim kam, fand er unerwartet eine zahlreiche Gesellschaft. So revanchirte sich Herr von Tondern für die vielen Einladungen zu Dejeuners, Diners und Soireen aller Art, die er erhielt; aber es war auch die einzige Revanche, die er gab; denn außer einem Glase frischen Wassers wurde hier nichts angenommen, nicht einmal eine Cigarre, denn die, welche der Hausherr allenfalls für seine Freunde hatte«, waren von äußerst mittelmäßiger Qualität, und wenn er sich für seine Person zu einer verhalf, so schloß er ein kleines Schränkchen auf, zu welchem er den Schlüssel immer bei sich führte.
Wir ersuchen den geneigten Leser, diesen Salon an einem Vormittage mit uns zu betreten. Wir finden dort neben Herrn von Tondern den Baron Fremont; Ersterer war beschäftigt, einen Spieltisch aufzuschlagen, nachdem er denselben in die Mitte des Zimmers gerückt, während der Andere mit dem Rücken gegen das Fenster lehnte und mit über einander geschlagenen Armen zusah.
»Also wir spielen eine einzige Partie,« sagte Tondern, »Ecarté und wie gewöhnlich zu fünf Points. Und der Gewinner –«
»Hat gewonnen,« sprach ruhig der Andere. »Nur möchte ich mir erlauben, dir nochmals zu wiederholen, daß wir eigentlich nicht spielen sollten; denn nimm mir nicht übel, mein lieber Freund – du weißt, ich bin offenherzig – aber wenn du gewinnst, wirst du doch wahrscheinlicherweise verlieren Lassen wir also lieber die Ceremonie sein und verständigen uns so; das ist doch wahrhaftig weit gescheidter.«
Herr von Tondern hatte zwei neue Spiele Karten hervorgeholt, riß die Couverts ab und mischte die Blätter mit einer außerordentlichen Fertigkeit; auch nahm er Marken hervor, legte sie auf zwei Ecken des Tisches und schob alsdann ein paar Stühle herbei.
»Wahrhaftig, Tondern, lassen wir das Spiel sein; ich sehe es als einen Wahnsinn an und kann nicht unterlassen, dir das zu sagen. Eine friedliche Uebereinkunft wäre sicherlich besser.«
»Was nützt es mir,« entgegnete der Andere, »wenn ich anfange, mit dir auf eine friedliche Uebereinkunft zu unterhandeln? Der Punkt, von dem du ausgehst und auf welchen du wieder zurückkehrst, ist immer der gleiche: du hältst dich für unwiderstehlich und bist nun einmal der Ansicht, daß du auf jeden Fall reussiren werdest. Verzeihe deßhalb, wenn ich dasselbe auch von mir denke.«
Baron Fremont zuckte verdrießlich mit den Achseln. Es war selten, daß über sein offenes, stets lächelndes Gesicht ein finsterer Schatten flog; aber jetzt war dies der Fall, und es war sogar eine recht finstere Wolke, welche seine Stirn beschattete. Er biß die Lippen auf einander und schwieg absichtlich einen Augenblick, wahrscheinlich um das, was er alsdann sagte, mit um so größerer Ruhe vorbringen zu können.
»Ich habe,« meinte er alsdann, »an deiner Unwiderstehlichkeit nie gezweifelt und bin überzeugt, daß, wenn es sich einfach darum handelt, ein Herz zu erobern, du gewiß eher zum Ziele kommst als ich. Aber die bewußte Angelegenheit steht nicht ganz so, und ich halte es für meine Pflicht, sie dir nochmals darzulegen.«
»Zum hundertsten Mal.«
»Sei es darum, zum hundertsten Mal. – Wir erlangen also Kenntniß von einem Testament des Grafen Helfenberg; diese Kenntniß kostet mir, nebenbei gejagt, tausend Thaler. – Gut, es ist eine Waare, die wir gekauft haben, wir wollen sie nach besten Kräften wieder verwerthen.«
»Du stehst die Sache verflucht prosaisch an.«
»Ich spreche aus, was du denkst, lieber Tondern,« fuhr der Baron gleichmüthig fort. »Es ist also die Frage: wie können wir die erlangte Kenntniß am besten ausbeuten? Wir haben erfahren, daß da eine junge Dame ist, die, Gott mag wissen, aus welcher Ursache, in dem Testamente mit einem Legate von ungeheurem Werthe bedacht ist.«
»Und ein so schönes, liebenswürdiges Mädchen!« meinte Tondern nachdenkend, indem er ein Spiel Karten gewandt durch die Finger laufen ließ.
»Das ist dir früher nicht besonders aufgefallen,« erwiderte der Andere; »mag's aber sein, wie es will, du hast nun plötzlich diese Ansicht, und ich will sie dir nicht bestreiten. Bleiben wir aber bei der Hauptsache. Die junge Dame, ein, um deine Worte zu gebrauchen, in der That schönes und liebenswürdiges Mädchen, ist – mit einem Male eine reiche Erbin geworden.«
»Was wir Beide allein wissen,« sprach Tondern mit Beziehung.
»Weßhalb denn Einer von uns Beiden,« fuhr der Baron kopfnickend fort, »sie zu heirathen wünscht.«
»Allerdings, Einer von uns Beiden.«
»Und um zu entscheiden, wer das sein soll –«
»Schlage ich eine vernünftige Partie Ecarté vor.«
»Und ich Vernunft und ruhige Ueberlegung. – Eine gleichzeitige Bewerbung um das junge Mädchen haben wir Beide für unpassend gehalten. Wozu uns auch eine Concurrenz machen, die am Ende zu nichts führen kann? Es wurde also beschlossen: Einer bewirbt sich um sie, und der Andere unterstützt ihn, so viel es in seinen Kräften steht.«
»Das wurde allerdings beschlossen; der Glückliche erhält ihre Hand, der Andere wird angemessen entschädigt.«
»So ist es,« sprach ruhig Baron Fremont. »Der minder Glückliche erhält nach der Heirath des Andern ein Kapital von sechzigtausend Thalern. Nun entstand die Frage: wer soll sich um die Hand Eugeniens bewerben? Und da meine ich doch, es wäre selbstredend, daß der es sein sollte, der auch einige Chancen des Gelingens für sich hat. Und das bin ich, um ohne Umstände zu reden. – Wir stehen hier so bei einander, daß es bei dem wichtigen Geschäfte, welches wir vorhaben, durchaus nichts hilft, wenn wir uns Complimente machen.«
»Und das thust du auch in der That nicht,« sagte Tondern mit einem sarkastischen Lächeln.
»Der Sache zu Lieb,« versetzte Baron Fremont mit großer Ruhe. »Ich bin in einer unabhängigen Stellung, mein Name ist bekannt, so auch, daß ich ein ziemliches Vermögen besitze, und du selbst wirst mir zugeben müssen, daß, wenn ich, Baron Fremont, heute um die Hand des Fräuleins Eugenie von Branchen anhalte, alle Welt sagen wird: das Mädchen macht eine gute Partie. Nun, sei ehrlich und sprich dagegen. Wird man dasselbe von dir auch sagen können?«
Tondern zuckte die Achseln und entgegnete: »Du weißt, daß sich die Sachen geändert haben; allerdings wäre mir mit der Heirath, die ich mit einem armen Mädchen einginge, nicht gedient; aber wir wissen, daß Eugenie reich ist.«
»Wir wissen das allerdings, aber Niemand anders darf und soll das wissen,« sprach Baron Fremont und legte auf den letzten Satz eine starke Betonung. »Sei vernünftig, Tendern,« fuhr er nach einer Pause in wohlwollendem Tone fort; »du weißt, wie gut ich es stets mit dir gemeint, wie freundschaftlich ich dich in jeder Beziehung behandelt habe. Gib nach, laß deinen Eigensinn fahren, der uns alle Beide nur von dem gewünschten Ziele entfernen kann.«
»Spielen wir, spielen wir!« sagte der Andere unerschütterlich.
»Wenn du willst, die Partie um hundert Thaler, aber nicht um das Andere.«
»Jetzt bist du eigensinnig!« rief Herr von Tondern lachend. »Was Teufel! es ist das so ein bequemes Auskunftsmittel, um allem Streit ein Ende zu machen. Auch weißt du ja selbst, daß du im Ecarté ein unwandelbares Glück hast. Geh her.«
»Nein, ich mag nicht.«
»Du wirst doch: denn ich versichere dich fest und theuer, ich nehme keine andere Übereinkunft an. Wie kannst du auch verlangen, daß ich so leichtsinnigerweise mein Glück aus der Hand geben soll? Eine schöne Frau und dieses wunderbare Stromberg! Was sind sechzigtausend Thaler dagegen?«
Als Herr von Tondern dies sagte, war er scheinbar aufs emsigste mit den Karten beschäftigt, die er wie zu seinem Vergnügen ausgab und dann wieder einstrich; doch versäumte er dabei nicht, nach seinem Freunde hinüber zu schielen, der die Lippen zusammenbiß und mit düsterem Stirnrunzeln seine Nägel betrachtete.
Eine Zeit lang wurde weiter nichts gesprochen, und der Hausherr begann eine Melodie zu pfeifen, in der er sich aber auf einmal unterbrach, um den Andern zu fragen: »Also du willst nicht spielen?«
»Um den bewußten Gegenstand nicht.«
»So muß ich meine Karten wieder einpacken.«
Baron Fremont dachte einen Augenblick nach, fuhr dann mit der Hand über das Gesicht und versetzte mit einem leichten Seufzer: »So will ich dir eine andere Partie vorschlagen. Du überläsest mir die Bewerbung um Eugenie, unterstützest sie nach besten Kräften, und ich spiele dafür mit dir eine Partie, bei welcher ich baare tausend Thaler gegen dein Wort setze.«
»Und was gewinne ich dabei? meinte Tondern achselzuckend.
»Wahrscheinlich tausend Thaler, da ich – sehr zerstreut bin.«
Der Andere nahm die vorhin abgebrochene Melodie pfeifend wieder auf, stützte beide Hände aus den Tisch und schien zu überlegen. In Wahrheit aber war er im ersten Augenblick entschlossen, die angebotene Partie anzunehmen, denn seine ganze Weigerung lief auf ein ähnliches Manöver hinaus. Er wußte selbst zu genau, daß es im günstigsten Falle bei allen Freunden ein außerordentliches Gelächter erregen müßte, sobald es bekannt würde, Tondern habe sich um die Hand des Fräuleins von Brauchen beworben, selbst da man wußte, daß Eugenie durchaus kein Vermögen besitze. Wenn Fremont daher nicht von so weichem, nachgiebigem Charakter gewesen wäre und nicht die Hartnäckigkeit seines Freundes so genau' gekannt hätte, so würde er unbedingt in die Concurrenz gewilligt haben. Auch besaß der gute Baron eine Aengstlichkeit des Gemüthes, die ihn schon seit lange her vermocht hatte, sich bei. vielen Veranlassungen an den starren Charakter Tonderns zu lehnen und dessen Nach in Anspruch zu nehmen. Deßhalb schrak er auch jetzt vor dem Gedanken zurück, nicht nur allein handeln zu müssen, sondern auch obendrein seinen würdigen Freund zum Gegner zu haben.
Daran dachte er und proponirte deßhalb, mit den Verhältnissen Tonderns sehr genau bekannt, die Partie um tausend Thaler. Da ihn nun das Stillschweigen des Andern vermuthen ließ, dessen lange Ueberlegung laufe darauf hinaus, jenen Vorschlag anzunehmen, so näherte er sich jetzt dem Tische, zog seine Brieftasche heraus und entnahm derselben zwei Scheine von fünfhundert Thalern, die er nicht ohne einen leichten Seufzer auf den Spieltisch legte.
Tondern warf flüchtig einen Blick auf die Papiere, schaute dann lächelnd zu Fremont in die Höhe und sagte: »Du meinst also, ich acceptire? Du setzest wahrhaftig meine Freundschaft für dich auf eine harte Probe.«
»Darin magst du Recht haben,« entgegnete der Baron mit einem Anflug von Ironie in seiner Stimme; aber du weißt auch dagegen, daß ich dir schon oft ähnliche Proben von meiner Freundschaft gegeben.«
»Wir spielen also –?« fragte Tondern.
»Ja, unter den eben erwähnten Bedingungen.«
»Das Spiel betreffend oder die andere Angelegenheit?«
»Beides; doch wollen wir uns Eins nach dem Andern klar machen. In solchen Fällen schadet ein wenig Umständlichkeit nicht. Du überlässest mir nicht nur die Werbung um die Hand des Fräuleins von Braachen, sondern unterstützest diese Werbung noch, wie dies ja auch schon früher zwischen uns in allgemeinen Umrissen festgestellt war.
»Natürlich, ich chauffire!« lachte Tondern, indem er mit dem Kartenspiel, das er in der Hand hielt, eine kunstreiche Volte schlug. »Ich lasse mich zufällig da draußen auf dem alten Eulen- und Fledermaushofe sehen, gebe dem Baron eine Vase aus Pompeji oder dergleichen, bringe das Gespräch auf dich und entwickle alsdann, was du für ein ungeheuer famoser Kerl bist; ich schreibe dir Eigenschaften zu, von denen du nicht denkst, daß es möglich ist, wie ein Mensch sie vereint besitzen kann. Ich –«
»Ja, ja, wenn du dir fest vornimmst, etwas in dieser Geschichte zu thun,« fiel ihm der Baron Fremont ins Wort, »so bist du allerdings im Stande, mich zu poussiren. – Das. wäre also abgemacht. Nun kommt noch das Spiel, eine Partie Ecarté um tausend Thaler. Ein unvernünftiges Geld!« setzte er seufzend hinzu, während er einen Stuhl an den Tisch zog und sich darauf niederließ.
»Um dir zu beweisen,« versetzte Tondern, »wie eifrig ich in deinem Dienste bin, will ich mir dein Pferd satteln lassen und noch heute zu dem alten Braachen hinausreiten. Ich werde vorher zu unserem Freunde, dem ewig unruhigen Legationsrathe, gehen und ihm einen alten pompejanischen Scherben entwenden. Das wird mich famos empfehlen. Es wäre das also abgemacht. Spielen wir. – Wenn ich aber diese Partie verlöre?« fragte er darauf mit einem eigenthümlichen Lächeln.
»Bah, du wirst gewinnen,« antwortete der Andere achselzuckend.
Tondern zog ebenfalls einen Stuhl an den Tisch, setzte sich darauf hin, und während er seinem Freunde das Kartenspiel zum Abheben, der Bestimmung der Vorhand wegen, hinschob, sagte er mit etwas ernstem Tone: »mir scheint, lieber Freund, du hältst mich auch für eine Art von Czrabowski.« Worauf der Baron mit fast beleidigtem Tone ausrief: »Ah, Unsinn, Tondern! Ich muß mir dergleichen Bemerkungen alles Ernstes verbitten. Wir helfen einander, wo und wie wir können. Da – du hast die Vorhand.«
Darauf begann die Partie Ecarté, und wenn man zuschaute, so bemerkte man schon bei dem ersten Spiele wohl, daß Baron Fremont entweder zerstreut war oder absichtlich verlieren wollte; denn er spielte mit einem unverantwortlichen Leichtsinn, er nahm die Proposition seines Freundes in einer unbegreiflichen Ausdehnung an, selbst dann noch, als er ein festes Spiel in der Hand hatte; ja, er vergaß sogar einmal, den König zu maskiren, und so dauerte es keine Viertelstunde, bis er die Partie verloren hatte. Dann schob er das Geld gelassen seinem Freunde hin, der achselzuckend sagte:
»Wenn ich diesen Gewinnst nehme, lieber Fremont, so benutze ich ihn wahrhaftig nur als Mittel zu dem bekannten Zwecke und brauche ihn dazu sehr nothwendig, denn ich bin so furchtbar abgebrannt, so geld- und kreditlos, daß es mir wahrhaftig Mühe machen würde, einen anständigen Wagen aufzutreiben, um zu Braachens hinaus zu fahren. – Doch brauche ich das jetzt ja auch nicht, da ich dein Pferd haben kann.«
»Sei aber vorsichtig!« bat der Baron, indem er seinen Kassenscheinen, die der Andere gleichmüthig einsteckte, einen Blick des Bedauerns nachsandte. »Ihm kann man schon mit dem Hausthor winken, aber die Baronin ist eine feine Frau.«
Tondern zog die Augenbrauen in die Höhe, und sein Gesicht zeigte eine Miene des Mitleids, als er antwortete: »Nun, die Worte hättest du dir ersparen können; du solltest Tondern genugsam kennen, um zu wissen, daß er jeden Schritt, den er in einer so delikaten Angelegenheit thun wird, vorher aufs genaueste prüft und überlegt.«
»Nun ja, wir kennen uns freilich,« antwortete Baron Fremont begütigend. »Aber wo so viel auf dem Spiele steht, da hält man es nicht für überflüssig, sogar sich selbst, den man doch für am zuverläßigsten hält, eine gute Lehre zu geben. Warum also nicht auch einem Andern? – Doch sage mir jetzt,« sprach er in ganz anderem Tone, indem er sich gegen den Spiegel drehte, »sehe ich gut aus? Aber sei ehrlich.«
Tondern that ein paar Schritte gegen den Freund und versetzte, nachdem er denselben einen Augenblick von der Seite betrachtet: »Aha, du willst deinen Angriff heute noch beginnen? Ja, ja, du siehst ganz gut aus; nur sind die Knöpfe deiner Weste etwas auffallend, ich mag das für meine Person nicht leiden.«
»Es ist so Mode; mein Schneider hat es nicht anders gethan.«
»Wer wird sich von so einem Menschen was vorschreiben lasten!« versetzte Herr von Tondern wegwerfend. »Da muß man immer calmiren; ich für meine Person haste alles Bunte, alles Auffallende. Apropos, du willst also heute zu Breda's?«
Der Baron nickte mit dem Kopfe.
»Nimm einen Rath von mir an,« fuhr der Andere fort. »Mache nicht deine gewöhnliche, etwas auffallende Tournure, benimm dich außerordentlich ruhig und lache nicht zu viel; es thut nichts, wenn die junge Dame deine schönen Zähne auch ein paar Mal weniger sieht. Sie ist ein gescheidtes Mädchen, darauf kannst du dich verlassen, von einer gesunden Natürlichkeit, die alles gemachte Wesen scheut. – Noch Eins, wenn du mir es nicht übel nehmen willst.«
»Nur zu, nur zu!« lachte der Baron.
»Du hast eine verfluchte Gewohnheit,« sprach Tondern weiter, »wenn du einmal einen längeren Satz sprichst, mit dem Zeigefinger der rechten Hand die Kette deiner Uhr auf und ab zu wickeln; laß das bleiben, denn wenn man dich öfters darüber ertappt, so muß man das unbedingt lächerlich finden. Ferner –«
»Du benimmst mir meine ganze Sicherheit, Tondern, hör ans, hör auf!« rief der Baron.
»Ich kann dir das Ferner nicht erlassen,« fuhr der Andere mit großer Ruhe fort, »es ist das Wichtigste. Wirf dich anfangs, der jungen Dame gegenüber, nicht zu sehr ins Zeug; ein Mädchen ihrer Art kann das nicht leiden, und dann halte ich es auch für überflüssig, unseren guten George, der dich genau beobachten wird, zu früh au fait deiner Absichten zu setzen.«
Er sprach diese letzten Worte sehr langsam und von einem so sarkastischen Lächeln begleitet, daß der Andere darauf aufmerksam werden und seinen Freund wohl verstehen mußte, weßhalb er demselben denn auch zur Antwort gab: »Da kommt wieder dein alter Wahnsinn zu Tage, den du uns schon bei Graf Helfenberg Preis gegeben. Ich versichere dich, du thust George Unrecht.«
»Versichere du nichts,« entgegnete Tondern, »sondern mache deine Augen auf und beobachte.«
»Darauf kannst du dich verlassen,« versetzte Baron Fremont mit vieler Selbstgefälligkeit, worauf er noch einen Blick in den Spiegel warf und dann seinen Hut nahm und sich empfahl.
Herr von Tondern blieb zurück, öffnete sein Schränkchen und rauchte die beste Cigarre, die er besaß. – –
Wir haben den gleichen Weg mit dem Baron Fremont, halten es aber für angemessener, demselben voraus zu eilen, was uns um so leichter wird, da er sich mit unserer Schnelligkeit nicht messen kann, obendrein auch noch für einen Augenblick nach seiner Wohnung zurückkehrt.
In der kürzesten Zeit erreichen wir das Haus George's von Breda und befinden uns dort im Wintergarten, ohne daß eine Thür geknarrt, ohne daß Jemand dort von unserer Anwesenheit nur die geringste Ahnung hätte.
Die Jahreszeit war schon so weit vorgerückt, daß ein guter Gärtner in der Decoration seiner Glashäuser etwas zu leisten vermochte; und neben anderen minder lobenswerthen Eigenschaften konnte man Andreas nicht abstreiten, daß er wirklich ein guter Gärtner sei; auch kam ihm, wie vorhin schon angedeutet, die Jahreszeit zu Hülfe. Hatte doch die Sonne, wenn sie jetzt am wolkenlosen Himmel schien, schon Kraft genug, die Räume des Glashauses angenehm zu erwärmen, und war im Stande, im Verein mit der Wärme der unterirdischen Heizungsröhren, den Pflanzen und Blumen einen Frühling vor zu zaubern, der in Wahrheit noch nicht so ganz nahe war. Schon ließen auch die dicken Knospen der Camelien die Farbenpracht ihrer Blumen ahnen, Crocus und Hyacinthen dagegen erfreuten bereits das Auge, in dichten Gruppen zusammen stehend, leuchtend in Weiß, Violet, Rosa, Blau und einen süßen würzigen Duft ausströmend, der Gedanken und Träume in uns weckt von belaubten Wäldern, saftig grünen Wiesen, murmelndem Wasser, Nachtigallenschlag und einem ganz wunderbaren Blüthenmeere. Dabei war es hier in dem Glashause, als empfänden auch die anderen Bäume und Gesträuche, ja, sogar das springende Wasser den Einfluß der milderen Jahreszeit; überall zeigte sich schon frisches Laub, Orangen und Lorbeer trieben schon wie verstohlen kleine, zierliche, hellgrüne Blättchen; die Granaten waren mit röthlichem Flor überzogen, und wo das frische Wasser aus den Bassins auf die Moose und niederen Kräuter hinspritzte, da zeigten diese jetzt schon eine leuchtend grüne Farbe, statt daß sie sich im Winter bei ähnlicher Begegnung wie schaurig und frostig zusammenzogen.
Andreas war an seinen Kübeln beschäftigt, wo er die Erde auflockerte, auch hier und da dürre Blätter entfernte, und hätte diese Geschäfte, wie er sonst zu thun pflegte, gern mit dem Pfeifen irgend einer Melodie begleitet, machte auch zuweilen schon den Anfang dazu, indem er den Mund spitzte, ließ ihn aber gleich darauf wieder breit aus einander gehen, sich wohl erinnernd, daß er nicht allem in dem Wintergarten sei. Wenn er nämlich durch die Sträucher schielte, so sah er auf dem breiten Wege ganz genau Fräulein Eugenie stehen, welche ihre rechte Hand leicht auf die Zweige eines Citronenbaumes gelegt hatte und freundlich wie immer mit dem Jäger, Herrn Brenner, sprach, der sehr aufrecht in ehrerbietiger Haltung neben ihr stand.
Herr Brenner war in seiner kleinen Livree, dem grünen Jagdrock, leicht mit Silber besetzt, und schaute bei Weitem stattlicher aus als neulich, wo wir ihn zu Hause gesehen, noch halb in seiner schweren Jägerkleidung steckend.
Wie das junge Mädchen dastand mit der vollen und doch schlanken Gestalt, so anmuthig an einen Baum gelehnt, hätte sie ein wunderliebliches Bild gegeben; sie hielt das edle schöne Gesicht etwas erhoben, so daß ein Strahl der Sonne durch die Blätter des Citronenbaumes hindurch leicht auf ihrem blühenden Teint spielte und dort eigenthümliche prachtvolle Lichter erzeugte. Sie trug ein einfaches dunkelblaues Kleid ohne irgend welche farbige Verzierung; ein kleiner weißer Kragen umschloß ihren Hals, und das dicke dunkle Haar, leicht um ihre Schläfe gelegt, drängte sich um den ganzen Kopf widerspenstig hervor und schien bei jeder Bewegung durch die eigene Schwere niederfallen zu wollen.
»Damals war ich noch sehr klein, mein lieber Herr Brenner,« sagte sie mit ihrer angenehmen, hellklingenden Stimme.
»Klein gerade nicht, gnädiges Fräulein,« antwortete der Jäger, »aber nicht so – vollkommen ausgewachsen.« Er hatte eigentlich noch hinzusetzen wollen: nicht so gut und liebenswürdig, besann sich aber noch zur rechten Zeit, daß sich das doch wohl nicht schicken würde, und sagte deßhalb: »das gnädige Fräulein waren damals recht lebendig, so etwas – wie soll ich sagen?«
»Etwas ausgelassen,« fiel ihm Eugenie mit ihrem gewinnenden Lächeln in die Rede, wobei sie die frischen Lippen so schalkhaft öffnete. »Ja, ja, ich erinnere mich ganz genau, Sie haben damals mit mir gezankt, und ich hatte es gewiß verdient. Wissen Sie noch, wie ich alle Hunde losließ und, mein kleines Gewehr auf der Schulter, mit Ihnen in den Wald ging? Da haben wir mit einander gejagt, daß es eine Freude war. Das heißt, für mich, Herr Brenner, für Sie war es keine Freude; denn wie ich vorhin bemerkte, Sie zankten mich aus, als Sie mich nun endlich fanden, und verklagten mich bei Papa.«
»Habe ich das wirklich gethan?« fragte der Jäger fast erschrocken.
»Ja, das haben Sie gethan,« fuhr das junge Mädchen lachend fort, »und hatten vollkommen Recht, es zu thun. – Sehen Sie Klaus zuweilen?« fragte sie plötzlich und näherte dabei ihr Gesicht einem Blatte des Citronenbaumes, wie um den Duft desselben einzuathmen.
»Klaus sehe ich wenig, gnädiges Fräulein,« sagte Herr Brenner; »er kommt selten in die Stadt und ich des Winters nicht einmal aufs Revier hinaus, habe auch dort auf den Jagden Seiner Erlaucht des Herrn Grafen Helfenberg nichts zu thun.«
Andreas war von Kübel zu Kübel gegangen, hatte sich so dem breiten Wege genähert und schielte zuweilen durch die Zweige nach Fräulein Eugenie, öfter aber bei dem Jäger vorbei nach dem Eingange zum Eßsalon hinauf, wo der kleine Groom unbeweglich stand, eine Serviette auf dem linken Arm, mit starren Blicken in das Glashaus hinabschauend.
Ueber diese seltsamen Blicke des Reitknechts mußte der Gärtner lächeln; wenn er das aber that, bückte er sich tief hinab auf den Kübel, an dem er sich gerade befand, und spitzte dabei jedesmal den Mund, als wenn er sich etwas vorpfeifen wollte; doch blieb es aber auch jetzt bei diesem Entschlusse, und begreiflicherweise drang zwischen seinen Lippen kein Ton hervor.
Eugenie fuhr mit ihrer kleinen Hand über die Blüthen des Baumes und wehte sich so den Duft derselben zu.
»Ich denke gern an jene Zeit,« sagte sie alsdann ziemlich ernst, »und freue mich jedes Mal, wenn ich, sei es auch nur für wenige Stunden, hinaus komme. Jetzt ist es freilich nicht schön in den Wäldern,« setzte sie nach einer Pause nachsinnend hinzu, »aber jener dunstige Wind, der durch die Zweige fährt, erinnert mich an das Frühjahr, an Knospen, – an Blüthen.«
Das Letztere sagte sie sehr leise und fuhr abermals mit der Hand über die Blätter der Citrone.
Der Gärtner hatte sich jetzt gerade mit einem prachtvollen Orangenbaum beschäftigt und brach, ohne daß es Jemand bemerke, einige Blüthen ab, die er sich, obgleich etwas schüchtern, erlaubte, der jungen Dame anzubieten.
Eugenie sah ihn mit einem ernsten Blicke an und fragte, indem sie durch eine leichte Wendung einen halben Schritt zurücktrat: »Sie haben sie doch nicht abgebrochen? das würde mir leid thun.«
Worauf Andreas, der seine Mütze in der Hand hielt, antwortete: »O, gewiß nicht, Euer Gnaden, wie wird ein Gärtner Blüthen abbrechen! Sie sind abgefallen, und da wollte ich mir nur die Freiheit nehmen, sie dem gnädigen Fräulein zu geben.«
Es hatte ihn einigermaßen geärgert, daß die junge Dame so unbefangen mit dem Jäger plauderte, was sie mit ihm nie that, und er wollte mit seinen Blüthen einen Versuch machen, ob es ihm vielleicht nicht auch gelingen könne, irgend ein Wort anzubringen. Dabei war sein Nebenzweck, den kleinen Friedrich zu ärgern, der droben wie auf Kohlen stand und sein Gehirn vergeblich abmarterte, einen Vorwand zu finden, um von der Estrade herab in den Wintergarten treten zu können. Dies durfte nur geschehen, wenn er zu melden hatte, daß das Frühstück servirt sei. Und so oft er sich auch nach dem kleinen Eßsalon umsah, so wollte dort immer noch nichts erscheinen.
Der Gärtner blieb indessen mit seinen Orangenblüthen in der einen und der Mütze in der anderen Hand vor Eugenien stehen, und jetzt kam höchst unerwartet für den Groom ein herrlicher Augenblick.
»Die Tante mag diesen Duft so gern,« sagte Eugenie wobei sie ihre Augen nach der Estrade wandte und dann ziemlich laut hinzusetzte: »Friedrich kann sie auf den Frühstücktisch legen.«
Friedrich, der seine Ohren übermäßig anstrengte, hatte dieses Wort nicht sobald vernommen, als er in den Eßsalon stützte, einen Dessertteller nahm und dann mit großen Sprüngen in den Wintergarten hinab eilte.
»Das gnädige Fräulein haben befohlen?« sagte er fast athemlos; und als ihm hierauf Andreas die Orangenblüthen auf den Teller legte, zitterte seine Hand, und er mußte sich Gewalt anthun, den Blicken des Gärtners nicht zu begegnen, der mit einem Auge blinzelte und auf eine eigene Art lächelte, ehe er sich wieder an seine Kübel begab.
Herr Brenner war auf die Seite getreten, und Eugenie, nachdem sie freundlich den Kopf gegen ihn geneigt, schritt langsam auf dem breiten Wege dem Eßsalon zu.
Friedrich wollte alsbald folgen, doch streckte der Gärtner feine Hand zwischen den Gesträuchen hervor, faßte ihn leicht am Kragen und gab ihm durch einen Wink mit dem Kopfe zu verstehen, daß er einen Augenblick da bleiben solle.
Der Jäger hatte sich ebenfalls entfernt, und so konnte es Andreas schon wagen, wenn auch flüsternd, zu sagen: »Siehst du nun wohl, unverantwortlicher Kerl, daß ich Recht habe? Von mir nimmt man keine Blüthen an, ich darf sie auch nicht ins Eßzimmer hinauf tragen, nicht einmal der Jäger, der doch einen ungeheuren Stein im Brette hat; nein, da muß Herr Friedrich gerufen werden, und Herr Friedrich muß kommen zum gnädigen Fräulein und muß ihr die Blüthen nachtragen, damit sie dieselben von Niemand anders als von Herrn Friedrich empfängt, denn – paß nur auf! – ich will mich henken lassen, wenn sie droben nicht dran riecht. Aber das wirst du mir sagen, Kerlchen, das bitte ich mir aus. Und bei der ganzen Sache kannst du wieder einmal sehen, wie ich nur für dich denke. – Jetzt geh, du Schuft, du glücklicher!
Nach diesen Worten gab er dem Groom einen leichten Puff in den Nacken, und dieser, den die Worte seines guten Freundes doch etwas verwirrt gemacht hatten, eilte, so schnell er konnte, dem Hause zu.
Droben auf der Estrade war unterdessen Baron von Breda erschienen und blickte mit unverkennbarer Freude dem schönen Mädchen entgegen, das sich ihm rasch näherte, wobei sie das glänzende Auge fröhlich und leuchtend auf ihn heftete.
»Ah, Onkel George!« sagte sie, »du warst früh aus, Tante und ich haben dich lange erwartet.«
»Ich hatte ein Geschäft in der Stadt; aber du siehst, wie pünktlich ich bin. Es muß gleich elf Uhr schlagen, die Zeit unseres Frühstücks, worauf ich auch nicht eine Minute möchte warten lassen.«
Er beugte sich bei diesen Worten etwas vorüber, als wollte er Eugenien näher kommen, ohne ihr jedoch einen Schritt entgegen zu gehen, was auch kaum thunlich gewesen wäre: denn mit leichtem, elastischem Tritt sprang sie nun die Treppen hinauf, reichte dem Baron beide Hände hin und sagte mit einem recht innigen Tone: »Guten Morgen, Onkel George! Hast du gut geschlafen?«
»Ja, liebe Eugenie, gut geschlafen und süß geträumt.«
»Doch nicht von der schrecklichen Geschichte,« entgegnete sie lachend, »die uns Tante gestern Abends vorgelesen, von dem Phantom, das mich so erschreckt?«
»Allerdings war auch etwas von einem Phantom dabei,« gab er zur Antwort, »aber von keinem schrecklichen; es war ein schönes Phantom, ein liebes Gespenst, das mir erschienen ist.«
Er hatte die beiden Hände des Mädchens ergriffen und als nun in diesem Augenblicke Friedrich mit den Blüthen auf dem Teller an ihm vorüber ging und im Eßzimmer verschwand, hob er diese beiden kleinen Hände, die so warm, so weich, so zutraulich in den seinigen lagen, leicht in die Höhe und sagte lächelnd: »Warte, kleine Diebin! du hast Blüthen abgebrochen. Leugnen hilft da nichts, meine gute Eugenie, ich rieche den Duft der Orangen hier an deinen Fingern.«
Und dabei brachte der Baron ihre Hände nahe genug an seine Lippen, daß er den Duft hätte bemerken können, so nah, daß das junge Mädchen den Hauch seines Mundes empfand.
Es durchzuckte Eugenie in diesem Momente seltsam wie nie; sie fühlte ihr Herz zusammengepreßt, ja, es war ihr, als müßten ihr Thränen in die Augen schießen; ihre Brust hob sich schneller und tiefer athmend, Und ein Lächeln flog über ihre Züge. Dabei war es ihr, als wehe plötzlich ein kalter Wind über sie hin, denn sie schauderte leicht zusammen und mußte unwillkürlich ihre beiden Hände zudrücken, um sich zu halten, denn bei alle dem war es ihr einen Augenblick zu Muth, als bewegten sich die Steinplatten zu ihren Füßen auf und nieder.
Alle diese Gefühle dauerten freilich nicht länger als höchstens ein paar Sekunden, aber es war ihr, als sei eine lange, lange Zeit darüber hingegangen. Und als sie nun nach einem tiefen Athemzuge wieder frei um sich blickte, da wunderte sie sich, daß Onkel George noch vor ihr stand und noch immer ihre Hände in den seinigen hielt. Sie schaute zu ihm auf und fand einen seltsamen Ausdruck in seinen Blicken; sie sprachen mit ihr, es war, als wollten sie ihr etwas mittheilen, und doch verstand sie nichts davon; alles, was sie begriff und klar in sich fühlte, war der Gedanke, wie gut es sei, daß die Sprache der Augen sich durch Worte nicht verständlich machen könne, denn es war ihr, als müsse sie im anderen Falle etwas hören, was sie vielleicht beunruhigen könnte.
Sie schlug die Augen nieder; vielleicht hatte sie sich auch geirrt. Ja, es mußte so sein, denn als sie nun gleich darauf wieder in die Höhe sah, bemerkte sie den gewöhnlichen ruhigen Blick von Onkel George; auch hatte er ihre rechte Hand losgelassen; nur ihre Linke ruhte noch zwischen seinen Fingern, und nachdem er lächelnd gesagt: »Warte, ich werde dich bei der Tante verklagen,« führte er das junge, liebe und schöne Mädchen ins Eßzimmer.