
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
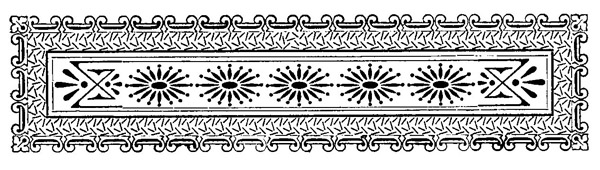
Lavendel, Myrt und Tymian, die blühen in dem Garten,
Wir lange bleibt der Freiersmann, ich kann es nicht erwarten!
Freischütz.
Als Graf Willibald allein in dem Coupé erster Klasse saß und Station um Station vorüberflog, ihm jedesmal von neuem kündend, daß er sich der Residenz in Sturmeseile nähere, überkam ihn plötzlich wieder das Gefühl tödlichster Beklommenheit und Angst, welches ihm stets die Kehle zugeschnürt hatte, wenn er an den entsetzlichen Moment eines Heiratsantrages dachte!
Er starrte bleich und verstört auf seine nagelneuen Glacéhandschuhe nieder und sein Atem ging so schwer, daß er einem Stöhnen glich.
Dennoch war diesmal der Grund seiner bangen Erregung ein völlig anderer wie ehedem.
Wenn er sich früher in die Situation eines Freiers versetzte, so überkam ihn das Entsetzen bei dem Gedanken: Was sollst du bei deiner tölpelhaften Verlegenheit sagen? was sollst du anfangen, wenn sie »ja« sagt und dir an die Brust sinkt? Wie sollst du dich im Verkehr mit einer Dame überhaupt benehmen, mit einer Dame, die dann deine Braut ist, die Zärtlichkeiten, Liebesworte und zarte Aufmerksamkeiten verlangt? –
Diese Vorstellung hatte ihm stets den Angstschweiß auf die Stirn getrieben, und weil er sich so sehr vor dem »ja« der künftigen Braut fürchtete, hatte er es nie über sich vermocht, die verhängnisvolle Frage an sie zu richten.
Heute lagen die Dinge völlig anders.
Das Blatt hatte sich gewendet.
Diesmal zitterte Graf Willibald vor der Möglichkeit, ein »nein« als Antwort zu erhalten.
Mit dem Fanatismus des Hasses hatte er sich in den Gedanken verbissen, Rache an seinen Feinden zu nehmen, und die Leidenschaft hatte seine Energie gestählt und sein Selbstbewußtsein wachgerüttelt.
Er fürchtete sich nicht mehr vor dem Heiratsantrag, vor dem Verkehr mit der Braut, er wußte genau, was er sagen wollte – aber er bebte vor einem Nichterfolg, – er verkam in Unruhe und Angst, daß Johanna ihm einen Korb geben könnte! –
Nur das nicht! – Alles andere soll sie ihm anthun, ihn mit Launen und Grillen quälen, ihn tyrannisieren, verspotten und ärgern – nur nicht abweisen! nur nicht seinen Antrag ausschlagen!
Und ist überhaupt eine Möglichkeit, daß sie ihn erhört? –
Graf Willibald drückt die Hände gegen die Schläfen und schließt wie ein Schwindelnder die Augen. Johanna ist jahrelang leidend gewesen, das hat sie vielleicht menschenfeindlich und verbittert gemacht, – hat sie weltlichen Interessen entfremdet. – Wie oft hört man nicht von kranken Mädchen, welche mit allem Irdischen abschließen, um treue, entsagungsvolle Bräute des Himmels zu werden! –
Und wäre Johanna auch keine freiwillige Nonne geworden, – je nun, so hat sie doch sicher von dem greulichen Prozeß gehört, welchen Vetter Rüdiger gegen ihn, den angeblich Verrückten, angestrengt! –
Welch ein Mädchen aber hat Mut und Selbstverleugnung genug, einen Mann zu wählen, welcher im Ruf eines Geisteskranken steht, über welchen man so viel gelästert und gehöhnt hat, wie über den Majoratsherrn von Niedeck? Und außerdem ... wird Johanna es über sich gewinnen, ihn, den häßlichen, unansehnlichen Mann zu freien? –
Ein Frösteln geht durch die Gestalt des Denkenden, Graf Willibald erhebt sich und tritt jählings vor den kleinen Spiegel, welcher über dem roten Sitzpolster an der Wand angebracht ist. Er starrt sich an, als müßte er sein eigener Richter sein.
Gott im Himmel, wie häßlich ist er! Noch nie im Leben ist es ihm so aufgefallen wie heute. Aber Graf Willibald vergißt, daß er in diesem Augenblick in ein Gesicht blickt, welches Angst und Aufregung verzerrt haben!
Seine sonst so freundlichen, schwermütigen milden Augen blicken jetzt starr und ausdruckslos, – sie treten weit hervor und geben dem heißgeröteten Gesicht einen fremden, erschreckenden Ausdruck.
Der Einsiedler von Niedeck sinkt ächzend wieder zurück und stützt den dicken Kopf auf die Hände. »Nein, – sie nimmt mich nicht! – sie nimmt mich nicht!« – stöhnte er auf, und die Verzweiflung überkommt ihn und flüstert ihm zu »kehr um, Du Narr! und blamiere dich nicht erst!« –
Soll er wirklich umkehren? – Soll er's – Nein! tausendmal nein! – Dazu ist auch später noch Zeit, wenn alles verloren ist! – Rüdiger soll nicht triumphieren! er haßt ihn! o, so wie er diesen Menschen haßt, so hat wohl noch kein Anderer einen Anderen verabscheut! Er will sich rächen an ihm – um jeden Preis! Und ist er auch häßlich und von der Welt verhöhnt, es giebt ja doch vielleicht noch ein Mädchenherz, welches sich seiner erbarmt – gerade die Kranke, welche weiß, wie bitter das Verlassensein ist, gerade sie, die ebenso einsam ist, wie er, fühlt Mitleid mit ihm! –
O wenn sie es thäte! wie wollte er ihr dieses Opfer lohnen! Willibalds Augen leuchteten auf in schwärmerischem Entzücken. Wie eine Göttin wollte er sie anbeten! wie ein Sklave ihr dienen! sie überschütten mit Liebe – Gold und Schätzen! –
Der Zug sauste an großen Güterschuppen und langen Reihen rangierender Wagen vorüber, hohe Häuser rechts und links, – ein Pfiff – langanhaltendes Schrillen der Signale ... man fährt in den Bahnhof der Residenz ein.
Der Majoratsherr schrickt zusammen. Alles Blut drängt nach seinem Herzen. Noch einmal überkommt ihn eine lähmende, entsetzliche Angst. – Soll er umkehren?! –
Mechanisch greift er nach seiner kleinen Handtasche, und starrt, ohne zu erkennen, in das Gewühl der Bahnhofshallen hinaus.
Die Coupéthür wird aufgerissen, Kuhnert steht mit freudigem Gesicht auf dem Perron, schwingt sich empor und ergreift das Handgepäck seines Herrn.
»Zur Stelle, Herr Graf!« – meldet er heiter, »Nun Glück auf!« – Verdutzt blickt ihn Willibald an. Ahnt der Alte etwa – –? – Nein, unmöglich. Sein Plan liegt als Geheimnis tief in seiner Brust eingesargt. Nachdenklich sieht er den Getreuen an.
»Warum bist Du so vergnügt, Kuhnert?« fragt er.
Der Getreue lächelt verschmitzt: »Diese Reise bringt uns Glück, Ew. Gnaden! die alte Lene hat mir gestern die Karten gelegt.«
Der Majoratsherr wird dunkelrot. Mit energischem Ruck richtet er sich empor.
»Unsinn! – haben denn Lenes Karten schon öfters die Wahrheit gesagt?« –
»Immer, Herr Graf; – man kann darauf schwören. Wo befehlen Ew. Gnaden hin?« –
»Wieder nach British Hotel!« – nickt Willibald hochaufatmend. – »Vorwärts!« –
*
Die Altstadt der mitteldeutschen Residenz bestand nicht aus engen, hohen, verräucherten Straßen, sondern aus jener Species von kleinstädtischen Gassen, welche durch vornehme Altmodischkeit auffallen.
Langgestreckte Fachwerkhäuser mit vielen gleichmäßigen Fensterreihen, breiter Thorfahrt vor steinernen Freitreppen, erzählten dem Beschauer, daß hier seit vielen hundert Jahren der alte Landadel seine Heimstätte gegründet hatte. Noch prangten hie und da die Wappen über den wunderlich geschnitzten und verschnörkelten alten Thüren, ein Garten drängte sich, durch hohe Mauern abgeschlossen, zwischen die Häuserreihen und über manchen Thorbogen nickten dunkle Lindenwipfel oder knorrige Akazien, welche noch von Zeiten erzählten, da die alten gräflichen Galakutschen mit den feierlich geputzten Lakaien über das holprige Pflaster schwankten, die gräfliche oder freiherrliche Familie zu Festen und Ehrentagen in das Schloß ihres Herzogs zu bringen. –
Andere Zeiten waren gekommen und hatten gar manches in den herrschaftlichen Straßen der kleinen Residenz geändert. Manch schöner Garten, welcher ehemals der Stolz und friedliche Erholungsplatz der Großeltern gewesen, war dem praktischen Erwerbssinn der Enkel zum Opfer gefallen. –
Da, wo ehemals die blühenden Wipfel über die Mauer nickten, erhoben sich nun neue, vielstöckige Gebäude, welche wunderlich abstachen gegen ihre niederen altehrwürdigen Nachbarn! Hier und dort war auch einer der herrschaftlichen Besitze verkauft, und seine großen, niederen saalartigen Zimmer waren in Magazine und Geschäftsräume umgewandelt, und da, wo ehemals die Krone über dem Wappen geprangt, leuchteten jetzt die buntgemalten Firmenschilder und die Reklametafeln.
So waren die alten Gassen ein eigenartiges Gemisch von »ehemals und jetzt« geworden, ohne doch im großen Ganzen ihren eigenartigen, ruhigen und altmodischen Charakter zu verlieren. In einem der grauen, einstöckigen Gebäude wohnte auch jetzt noch der Freiherr von Nördlingen-Gummersbach, so wie es Väter und Vorväter vor ihm auch gethan hatten.
Außer dem alten Haus war kein großes Erbe auf den jungen Offizier überkommen, als seine Eltern gestorben waren und ihn und seine Schwester Johanna in bescheidensten Vermögensverhältnissen zurückließen.
Die Geschwister wohnten nach wie vor in dem Vaterhause, dessen unteren Stock sie günstig an eine verwitwete Hofmarschallin vermietet hatten. Hans Georg stand als Offizier in dem Leibgrenadier-Regiment seines Herzogs, und als er Hauptmann geworden war, vermählte er sich mit der Tochter des Staatsministers, welche außer ihrem vornehmen Namen auch nicht mehr wie die Kaution mit in die Ehe brachte.
Die Eltern aber unterstützten durch gute Zulage, eine alte Pathentante that desgleichen, und so lebte das junge Paar in sorglosen und glücklichen, wenn auch nicht glänzenden Verhältnissen. Johanna sah man offiziell als die dereinstige Gemahlin des Majoratsherrn von Niedeck an, denn es war bekannt, daß sie wohl die einzigste passende Partie für ihn sei, in einer Zeit, wo ein ganz wunderbarer Mangel an jungen Damen von tadelloser Ahnenreihe war.
Nie hatte ein Niedeck eine derart knappe Auswahl an passenden Partieen gehabt, und darum rechnete die Familie Nördlingen mit Bestimmtheit auf den reichen Freier.
Aber das Schicksal zog durch all die glänzenden Pläne einen jähen, grausamen Strich. Bei einer Wagenfahrt über Land verunglückte die junge Dame so schwer, daß sie die Hüfte brach und jahrelang als Patientin das Zimmer hüten mußte.
Der Freiersmann blieb selbstverständlich aus. Die Zeit flog mit grauen, trägen Schwingen dahin, und der Einsiedler aus Niedeck verlor sich in seine Einsamkeit, – so fern und tief, daß kaum noch eine Kunde von ihm in die Residenz drang, es sei höchstens das Gerücht seiner Wunderlichkeit und Unzurechnungsfähigkeit, welche jede Heirat ausschloß und den ältesten Sohn des Grafen Rüdiger, den kleinen Wulff-Dietrich zum künftigen Erben machte.
Der Ehe Hans-Georgs war während dessen ein Töchterchen entsprossen, welche Pia getauft und scherzender Weise schon in der Wiege mit Wulff-Dietrich verlobt ward.
Graf Rüdiger war ein vorsichtiger Mann und sicherte sich die »Braut mit den sechzehn Ahnen« rechtzeitig für den Sohn, denn unbegreiflicherweise schien auch für die Zukunft wenig Aussicht, daß die alten Stammbäume liebliche Blüten für die Niedecks ersprießen ließen. Bei Pias Taufe hatte man das kleine Pärchen miteinander »versprochen« – ein Freier wie Graf Niedeck hatte nicht leicht in der armen Offiziersfamilie einen Korb zu befürchten! – und der leutselige und sehr animierte Vater Rüdiger hing dem zukünftigen Schwiegertöchterchen eigenhändig ein blitzendes Brillantmedaillon um, auf dessen Rückseite der scherzhafte Vers eingraviert war. –
»Du Kind mit goldenen Härchen,
Wart' noch achtzehn Jährchen,
Dann kommt mein Sohn Wulff-Dieterich
Und macht zu seiner Gräfin Dich!«
Das Kind Pia wuchs in holder, eigenartiger Schönheit heran, gepflegt und gehegt, geliebt und verhätschelt von allen, am meisten aber von Tante Johanna, der armen Kranken, welche kein größeres Vergnügen kannte, als den Besuch ihres kleinen Lieblings in ihrem einsamen Stübchen. Gar oft preßte sie die Augen auf das lichte Goldhaar des Nichtchens und netzte es mit Thränen, sah sie doch in der Kleinen die Verwirklichung all ihrer eigenen Träume, die Erfüllung alles dessen, was sie mit blutendem Herzen als Traum zu Grabe gelegt hatte.
... Es war ein sonniger, leuchtender Junitag! Johanna hatte die Fenster ihres Zimmerchens weit geöffnet und saß, einen blühenden Fliederstrauß, wohl den letzten dieses Jahres, auf dem Schoß, in dem altmodischen Lehnstuhl, um sehnsuchtsvoll zu dem blauen Himmel empor zu blicken. Sie kam soeben von einer kleinen, ganz kleinen Promenade heim, – das Gehen strengte sie immer noch an und machte es ihr unmöglich, die ferner gelegenen Parkanlagen zu erreichen.
Ein Spaziergang in den schattenlosen, engen Gassen war jedoch kaum eine Erquickung, und so sank die Baroneß mit schmerzlichem Aufseufzen in den Sessel nieder und schloß erschöpft die Augen. Thränen rannen über die bleichen, zarten Wangen, welche sich noch so voll und lieblich rundeten als sei ihre Besitzerin nicht ein Mädchen von fünfunddreißig Jahren, sondern ein Backfischchen, welches soeben in das Leben eintritt.
Die tiefe Ruhe und Abgeschlossenheit des jahrelangen Liegens und Sitzens hatten Antlitz und Figur rund und voll gestaltet, und wenn auch die Frische und rosige Farbe fehlte, sah Johanna dennoch überraschend jung aus.
Der feine Leidenszug zwischen den dunklen Augenbrauen gab dem milden, unbeschreiblich herzensguten und freundlichen Gesicht der Kranken einen ganz besonderen Reiz, und wen ihre braunen, sammetigen Augen – »Aurikelaugen« nannte sie ehemals ihr Vater – anschauten, dem ward es gar wohl zu Sinn und er fühlte warme Sympathieen für das arme verunstaltete Mädchen.
Nach Aussagen der Ärzte war die Hüfte sehr langsam und schwierig, aber doch endlich ganz normal und zur Zufriedenheit geheilt.
Eine gewisse Steifheit war aber trotzdem zurückgeblieben, die Figur war ein wenig schräg geworden und der Gang behielt ein leichtes Hinken bei. Johanna empfand diese Gebrechen tief und schmerzlich und zog sich um ihretwillen vollständig von allem Verkehr zurück. Was sollte sie, die mittellose, verunstaltete alte Jungfer zwischen frohen, lebenslustigen Menschen?
Das Geld, welches Toilette und Gesellschaft gekostet haben würden, sparte Johanna und gönnte sich dafür im Sommer allwöchentlich eine Spazierfahrt in die freie, herrliche Gottesnatur, welche sie so über alles liebte, und von welcher sie die grauen Stadtmauern so unbarmherzig trennten!
Auch heute empfand sie ein heißes, sehnsüchtiges Verlangen nach Wald und Feld, welche sie gestern mit wahrer Begeisterung geschaut hatte, – aber es war unmöglich, daß sie heute schon wieder einen teuern Wagen bezahlen konnte, darum faltete sie die Hände resigniert um ihre geliebten Fliederzweige und blickte zu dem Himmel empor, als hege sie nur noch einen einzigen Wunsch, bald die schmerzgelösten Glieder droben in dem unermeßlichen Reich des Lichtes und des Friedens zu baden! Das Leben war so namenlos traurig und arm für sie!
Seit ihr Liebling und einziger Trost, die kleine Pia, das Haus verlassen hatte, war aller Sonnenschein mit ihr erloschen.
Bittere, blutige Thränen hatte das einsame, verlassene Mädchen geweint, als sie Abschied von ihrem Herzblatt nehmen mußte. – Hans-Georg aber machte ihr klar, daß es ein großes Glück für das Kind sei, in dem Haus der reichen, vornehmen Verwandten in Paris erzogen zu werden! Wie konnte sich bessere Gelegenheit für Pia bieten, der französischen Sprache vollkommen mächtig zu werden?
Und Sprachkenntnisse sind für ein unbemitteltes Mädchen von hohem Wert.
Das Schicksal Johannas hatte es bewiesen, daß über Nacht alle Pläne und Hoffnungen auf eine Heirat vernichtet werden können.
Das sah Johanna nur allzu gut ein, auch wußte sie, daß Pia im Hause des Legationsrates auf das beste und gewissenhafteste aufgehoben sei und sie bekämpfte heldenmütig ihren Schmerz, und gab auch das letzte Glück, welches ihr geblieben, selbstlos dahin. –
Ihr Leben aber ward öd und trostlos; ihre beiden wilden, kleinen Neffen fanden keinen Geschmack an der Krankenstube und den liebevollen Feen- und Engelgeschichten der Tante. Sie hielten sich fern, – ebenso fern wie ihre Mutter, welche, jung und lebenslustig, den ganzen Tag über viel zu sehr beschäftigt war, um eine uninteressante, alte Jungfer unterhalten zu können. Der Bruder war zumeist im Dienst – er sprach nur selten einmal bei ihr vor, wenn er Bücher, Blumen oder sonst eine kleine Aufmerksamkeit für sie hatte.
Johanna nahm es nicht übel, sie wußte, daß man in dieser schnelllebigen Zeit nicht viel Muße hatte, in ein Erkerstübchen empor zu steigen und vergilbte Jungfernweisheit zu hören; aber sie empfand ihre Einsamkeit dennoch sehr schmerzlich, und hauptsächlich darum, weil ihr jeder Naturgenuß in derselben versagt war. Ja, hätte sie jeden Tag nur eine Stunde lang hinaus in die schöne Gotteswelt gekonnt, – sie würde alles andere darum vergessen haben! Ob im Sonnenschein, Sturm, Regen oder Schnee, – die Natur hatte stets einen magischen Reiz für sie, und ihre tief empfindende Seele lauschte grade dem Wechsel und Wandel in Wald und Feld die zauberhafte Schönheit ab.
Wie oft saß sie nicht abends und malte sich liebe Bilder aus, wie sie es wohl haben möchte!
Reisen! – ja still im Wagen sitzen und alle Herrlichkeiten schauen, – am schönsten Fleckchen und Plätzchen aussteigen und langsam, so langsam wie es ihr Gebrechen bedingte, dahin wandeln in trunkenem Entzücken! –
Reisen, wie konnte sie an Reisen denken! Ach, es hätte ja auch schon längst genügt, wenn sie draußen im Walde hätte wohnen können, sein Leben und Weben vom Fenster aus hätte schauen können, rauschende Wipfel, Vogelgezwitscher, friedlich grasende Rehe, – ach, welch ein anderer Anblick, als diese hohen, verräucherten Mauern, über welche fern herein ein paar staubige Laubkronen blicken! Und wenn Johannas Herz sich wund und weh nach solch stillem Glück sehnte – dann preßte sie wohl die Hände gegen die Brust und seufzte tief auf: »Ach, daß eine Menschenseele sich meiner erbarmte und mir die Kerkerthüren öffnen wollte! Auf den Knieen würde ich es danken, mein Leben lang!« –
Der Herr hört das Gebet der Verlassenen. –
Wie geheimnisvoll der Flieder heute duftet! wie die kleine Schwalbe mit hellem Jubelschrei an dem Fenster vorüberschießt, als wolle sie sagen: So schnell wie ich fliegt auch das Glück! Es trägt goldene Schwingen und fällt unvermutet vom Himmel herab! Auch das fernste, versteckteste Stübchen findet es auf und huscht durch die engste Ritze herein! – Seine Zeit muß nur kommen! Es wartet ebenso auf den Frühling wie ich! – Wenn des Winters Not und Qual siegreich überwunden, kommt jedesmal der Lenz mit den Schwalben und dem Glück! – – –
An der Thüre klopft es, die ehemalige Köchin der verstorbenen Eltern, welche bei »unserem armen kranken Kinde« – treulich – wenn auch etwas tyrannisch Haus hält, tritt ein.
Sie hält eine Visitenkarte in der Hand, und scheint sprachlos vor Überraschung.
»Gnä' Frölen Hanning« – sagt sie und streicht hochatmend mit dem Handrücken über die Stirn: »nu endlich kümmt hei!« – Verständnislos blickt die Baronesse sie an und streckt die weiße, zierliche Hand nach der Karte aus. Einen schnellen Blick darauf, und dann schießen dunkle Blutwellen in ihr Antlitz, wie schwindelnder Schreck überkommt es sie, und doch zuckt ihr Herz auf wie in jäher Ahnung großen, unendlichen Glückes.
Einen Augenblick kämpft sie an gegen die Überraschung, welche sie vollständig verwirrt, dann schilt sie sich in Gedanken selber eine Thörin, und blickt mit dem alten, ruhigen, etwas wehmütigem Lächeln auf.
»Ich lasse den Herrn Grafen bitten, einzutreten! Er wird sich gewiß nach seiner künftigen kleinen Nichte erkundigen wollen!« – Die Alte sieht bei diesen Worten etwas enttäuscht aus, wendet sich kopfschüttelnd ab und verschwindet hinter der Thüre, – Johanna aber preßt die Hand gegen das Herz und erhebt sich, – mit zitternden Knieen steht sie neben dem Sessel.
Die schmale grüne Wollportiere regt sich abermals, Graf Willibald schreitet über die Schwelle.
Die Erregung hat auch sein Antlitz gerötet, er bleibt ein wenig unbeholfen an der Thüre stehen und verneigt sich.
Da sieht er, wie die kleine, rundliche Mädchengestalt ihm entgegen tritt und die Hand zum Gruße reicht!
Sie sitzt nicht mehr im Fahrstuhl? Sie geht sogar ganz allein ohne Stock und Stütze?
Diese freudige Überraschung malt sich in unverhohlenem Entzücken auf seinem Antlitz und verschönt es durch den Ausdruck reiner, ehrlicher Freude.
»Baroneß, Sie gehen? Sie können wieder ganz allein gehen? Sie sind wieder gesund?« poltert er anstatt jeder Begrüßung heraus, aber es klingt ein solcher Jubel durch seine Stimme, eine so aufrichtige, wahre Freude, daß Johannas Herz in dankbarstem Empfinden hoch aufwallt. So viel Teilnahme an ihrer Genesung hat ihr noch niemand erzeigt.
»Ja, Herr Graf – Gott sei Dank geht es mir bedeutend besser, wenngleich ich noch immer hinke und wohl auch zeitlebens an diesem Gebrechen tragen werde!«
Er drückt stürmisch, aufgeregt ihre weiche, kleine Hand: »oh, das ist ja ganz unbedeutend – das ist ja ganz nebensächlich! Welch ein Glück, daß Sie so frisch und wohl sind! Habe es mir gar nicht träumen lassen, Baroneß – ... sonst ... ja – sonst wäre ich wohl schon eher gekommen!« –
Sie erglüht abermals und bittet mit freundlicher Handbewegung Platz zu nehmen.
»Es ist eine rechte Überraschung, Sie einmal wieder in der Residenz zu sehen, Herr Graf!« lächelte sie so unbefangen wie möglich: »Wie lange Jahre haben Sie sich nicht mehr blicken lassen!« –
Er sieht sie ehrlich an: »Was sollte ich hier, Fräulein Johanna? Sie wissen es wohl selber, wie man mir hier begegnet ist. Die traurigen Erfahrungen haben mich menschenscheu und wunderlich gemacht, die Welt gab mir kein Glück, darum bin ich in die Einsamkeit geflüchtet, wohin solch ein ungeschlachter, häßlicher Geselle wie ich einzig hingehört!« – Wie in flehender Angst hing sein Blick an ihren Lippen, Johanna aber schüttelte voll milden Ernstes das Haupt und antwortete: »Wie können Sie so etwas sagen, Herr Graf! Schönheit und Häßlichkeit sind Geschmacksache!« –
»Und wie urteilt Ihr Geschmack, Baroneß?« fragt er leise, wie ein bittendes Kind.
Sie schaute ihm – abermals errötend – in die Augen.
»Ich finde selbst das schönste Antlitz häßlich, wenn es den Ausdruck gemeiner, unlauterer und sündhafter Empfindungen und Begierden trägt, und ich nenne das häßlichste Gesicht schön – wenn sich in seinen Augen eine Seele spiegelt, wenn Güte, Treue, Wahrheit ihm ihren Stempel aufgeprägt haben!« –
Der Klang ihrer Stimme sagte mehr noch wie ihre Worte, wie in einem Taumel des Entzückens faßte Willibald ihre Hand und zog sie mit einer Kühnheit, welche er selber nicht begriff, an die Lippen.
»Wenn die Wahrheit schön macht, Johanna – so lassen Sie mich auch durch sie schön werden!« rief er ungestüm: »denn wahr sein möchte ich in dieser Stunde mehr denn je! Lassen Sie uns jetzt nicht von gleichgültigen Dingen reden, denn das würde eine Lüge sein angesichts unserer tiefinnersten Empfindungen. Sie wissen warum ich hierher komme, Johanna, – Sie wissen es so gut wie ich! Da ist nur ein Wunsch und Gedanke, welcher mich beschäftigt, und Alles, was eine Entscheidung aufhält, quält und beunruhigt mich! Ich kann nicht über Wetter, Menschen und Theater mit Ihnen sprechen, wenn mein Herz ganz andere Dinge denkt! – Warum wenden Sie sich ab? – Erschreckt Sie diese schnelle, ehrliche Wahrheit nun doch? – Habe ich es falsch angefangen? Oh dann vergeben Sie mir! Haben Sie Nachsicht mit einem Mann, welcher der Welt so fremd geworden ist. – Ich meine es ja gut, Johanna – so von Herzen gut!« – –
Er hatte ihre Hand ergriffen und drückte sie wie beschwörend zwischen den seinen.
Abermals begegneten sich ihre Blicke, und in beider Augen lag derselbe Ausdruck, eine selig bange Scheu, eine Bescheidenheit und Verzagtheit, an das Glück zu glauben! –
Johannas Wangen färbten sich immer höher, wie eine glühende, blühende Rose lächelte ihn ihr Antlitz an, und die engelhafte Güte und Demut, welche sich darin aussprachen, ließen sein Herz wie in trunkenem Entzücken aufjauchzen. Er preßte ihre Hand an seine Lippen.
»Sie kennen mich noch nicht, Johanna – und alles was Sie wohl von mir hörten, war nicht dazu angethan mir Ihr Herz zu gewinnen! Ich weiß, welch eine Vermessenheit es von mir ist, hier vor Ihnen zu stehen und unter solchen Umständen um Ihre Hand zu werben! Aber bei Gott, Johanna, Sie sollen es nie bereuen, mein Weib geworden zu sein! – Mich selber und meinen äußeren Menschen kann ich ja leider nicht ändern, den müssen Sie nachsichtig mit in den Kauf nehmen, aber mein Leben – mein Handeln – Denken – Fühlen – das steht in meiner Gewalt, und das will ich Ihnen in innigster, treuster Liebe zu eigen geben – das soll Sie glücklich machen!« –
Er hatte schnell, leidenschaftlich erregt gesprochen, er staunte nicht über seine Kühnheit und wunderte sich nicht, woher er all die Worte nahm – sie flossen ihm ungesucht aus dem tiefsten Herzen heraus – und darum gingen sie auch zu Herzen. Große, leuchtende Thränen glänzten in Johannas Augen.
»Wie sind Sie so gut zu mir, der Einsamen, Kranken, die auf der Welt kein Glück mehr erhoffte! Aber ich fürchte, Graf Niedeck, Sie überschätzen mich, Sie halten mich für gesünder als ich bin –«
»Ich wähnte Sie noch im Rollstuhle sitzend und kam dennoch als Freier zu Ihnen!« – rief er stürmisch, legte den Arm um sie und zog sie an sich – »ich bin wie geblendet von dem, was ich sehe!« –
»Aber Sie kennen mich noch so wenig –«
Da lachte er, und das Lachen machte sein Gesicht, das glückstrahlende, schön. –
»Mir ist es zu Sinnen, als ob wir uns schon lange, lange Jahre kennten, – so wie ein Kind sich seine Weihnachtspuppe in Gedanken ausmalt und wenn es sie dann am heiligen Abend in den Händen hält, ausruft: ›ja – die meinte ich! die grade, die wollte ich haben!‹«
Nun lachte sie auch, aber sie lehnte das Haupt an seine Schulter und flüsterte: »Es ist ja erst Sommerzeit! ich kann es noch gar nicht fassen und begreifen, daß es schon Weihnacht für mich geworden!«
Einen Augenblick blieb es still, nur zwei übervolle Menschenherzen klopften in dem Rausch unglaublichen Glückes zum Zerspringen. Ein nie gekanntes Gefühl durchschauerte den einsamen Mann, als er die weiche, kleine Mädchenhand mit festem Druck in der seinen fühlte, als er die Wange auf ihr seidenweiches Haar preßte.
Er, welcher aus Haß und Rachsucht den Plan gefaßt, zu heiraten, welcher hierher gekommen war, einzig um eine Gemahlin zu gewinnen, welche die Wünsche und Hoffnungen des Grafen Rüdiger durchkreuzen sollte, er saß plötzlich als zärtlicher Bräutigam zu Füßen der Erwählten, voll himmelanstürmender Seligkeit den Inbegriff alles Glückes in ihr vergötternd! Und Johanna, welche im ersten Augenblick in dem Freier nur einen Erlöser aus tiefster Verlassenheit gesehen, von welchem sie nur das bescheidenste erhofft, den Genuß, ohne Sorgen in Niedeck, dem freien, waldumrauschten wohnen zu können, sie fühlte es plötzlich so frühlingswarm in ihrem Herzen emporquellen, als sei ihr in dem Freier, welchen alle Welt so häßlich nannte, das Ideal aller edlen, treuen, preisenswerten Männlichkeit erschienen.
Wenn es bei den Frauen vom Mitleid bis zu der Liebe nur eines kleinen Schrittchens bedarf, so geht bei ihnen die Dankbarkeit mit der Liebe wohl immer Hand in Hand.
Es war ein wunderliches Finden, welches die beiden Herzen dieser einsamen, freudearmen Menschen verband. Eines fühlte sich tief und unauslöschlich in der Schuld des Anderen, eines erblickte in dem Anderen seinen größten Wohlthäter, jedes empfand das Glück, welches ihm geworden, als unverdientes Gnadengeschenk, welches ihm die Barmherzigkeit gemacht. Im Übermaß des Empfindens waren sie beide verstummt. Hand in Hand saßen sie nebeneinander, – vor einer Stunde noch fremd und weltenfern – jetzt im innigsten Glück vereint für alle Zeit. Willibald küßte die Braut auf den Mund: »Laß uns zu Deinem Bruder gehen!« bat er.
Und sie gingen, wie von Engelschwingen getragen. Ein wunderliches Brautpaar. Der häßliche, unförmige Mann, das hinkende, verkrüppelte Mädchen; und doch stand der Himmel über ihnen offen, und sie hörten den Liebespsalter der Cherubim.
