
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
![]()
Der Neunzigmarkkommis– Das Kaffeehaus – Die Erbtante – Die internationale Magentee-G. m. b. H. – Der Don Juan – »Efka«
Tante Lieschen erscheint noch einmal auf der Bildfläche. Ihr mächtiges Doppelkinn allerdings, ihre buschigen Augenbrauen und alles, was sonst sterblich an ihrem mit der Zeit immer umfangreicher gewordenen Körper gewesen war, ruhte nun schon seit längerer Zeit friedlich in Gott. Kurze Zeit nach der Portokassenaffäre, die im vorigen Kapitel so traurig abgeschnitten hatte, war Fritz nach seiner Heimat geeilt, um Tante Lieschen das letzte Geleit zu geben. Diese liebe gute alte Person verschwindet nun endgültig aus unserer Betrachtung, und wir begnügen uns zu berichten, daß sie nur noch in diesem Kapitel indirekt auf Fritzens Leben Einfluß hatte.
Nach dieser schon erwähnten, nicht sehr rühmlichen Portokassenaffäre begab es sich, daß Herr Meyer sen. ein paar Monate später den Entschluß faßte, Herrn Fritz Krohn höchsteigenhändig zum Kommis zu ernennen. Es fehlten zwar noch einige Monate an den drei Jahren, die ein Lehrling benötigt, um die Höhen der kaufmännischen Wissenschaft zu erklimmen, aber Herr Meyer sen. hielt es im Interesse seines Geschäftes für wichtiger, wenn Fritz wo anders die bei ihm erworbenen Kenntnisse verwenden würde. Es dauerte auch nicht lange, so übernahm unser Held als frischgebackener Neunzigmarkkommis die verantwortungsvolle Stelle eines Lagerunterchefs in einem Konkurrenzhaus der Firma Meyer & Co. Nach kurzer Zeit hatte er sich aber zu der Überzeugung durchgerungen, daß er hier auf einem falschen Platz stände, und sein neuer Chef schien die gleiche Meinung von ihm zu haben.
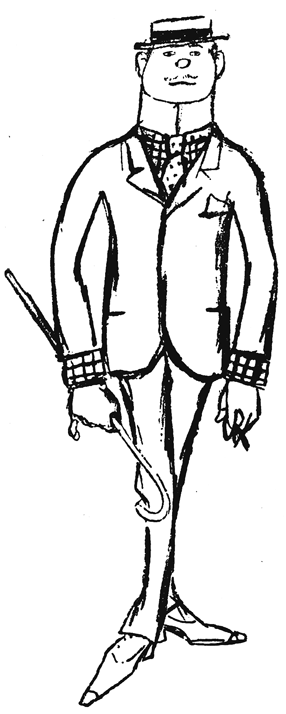
Da die Konjunktur nicht besonders günstig war, begegnete unser Held Schwierigkeiten, in der gleichen Branche eine seinen Fähigkeiten sich unpassende Stellung zu finden, und er beschloß, erst einmal seinen Neigungen zu leben. Seine Neigungen hatten allmählich den engen Rahmen der Lyrik gesprengt. Er entdeckte die Kultur für sich. Diese Kulturadaption zeigte sich vor allen Dingen im Streben nach einer vollendeten Lebensform, die er sich aus den Schaufenstern der Friedrichstraße und Leipzigerstraße holte. Fritz trug den höchsten Kragen, der seinen langen Hals wie in eine Manschette preßte. Mit den Krawatten trieb er den größten Luxus, und seine bunten Oberhemden spielten in allen Farben des Regenbogens. Ein Schneider in der Köpenickerstraße, der einmal früher Zuschneider in einem fashionablen Atelier gewesen war, verschaffte ihm die modernsten Futterale, und obgleich manchmal der Kragen nicht anschloß und die Hosenknie beutelten, hatten die Anzüge doch den Schick, der hoch über dem Niveau des Provinzialen stand.

Fritz war mit einem Wort zum Kavalier avanciert und hatte auch bereits in den Tanzlokalen ohne Weinzwang bedeutende Erfolge zu verzeichnen. Auch interessierte er sich für Pferderennen, und in den Kaffeehäusern der Friedrichstadt war er in der freien Zeit, die ihm jetzt reichlich zur Verfügung stand, bald ein gern gesehener Stammgast geworden. Auch benutzte er seine schon in der Schule erworbenen Kenntnisse der Stralsunder Karten dazu, um seine Einkünfte zu verbessern, was jedoch zur Folge hatte, daß es ihm jetzt selten gelang, die Reichshauptstadt vor der dritten Nachmittagsstunde in Augenschein zu nehmen. Denn die Stunden von sechs Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags brauchte er notwendig zum Schlafen, und so sparte er auf diese Weise jeden Tag das Frühstück.

Bald hatte er seine ganze dichterische Veranlagung vergessen. Er stand jetzt auf dem ganz realen Boden des Genusses, der allerdings im Café »Unter den Linden«, wo er verkehrte, äußerst sumpfig war.
Da kam Tante Lieschen. Man wird vielleicht denken, daß Tante Lieschen durch irgend welche spiritistischen Einwirkungen Nachricht von dem Bummelleben des lieben Neffen bekommen hätte. Es wäre nicht wunderbar gewesen, wenn sie sich darüber aus Kummer im Grabe umgedreht hätte. Denn schließlich ergreift man doch nicht die Kaufmannskarriere, wenn man die Absicht hat, Kommerzienrat zu werden, um im Kaffeehaus Karten zu spielen und gelegentliche Kommissionsgeschäfte auf Provision zu machen. Man sieht jedoch wieder, wie ein Frauenherz milde sein kann, selbst wenn es einer dicken Tante angehört hat. Und die Einrichtung, die die gütige Natur mit dem Institut der Erbtanten geschaffen hat, ist von jeher eine segensreiche gewesen.
Fritz wurde nämlich 21 Jahre und großjährig. Nun hat dieser bedeutsame Augenblick im Leben gewöhnlicher Menschenkinder keine besondere Wichtigkeit. In patriarchalischen Familien wirkt dieser Tag höchstens dekorativ durch das große Licht, um das die anderen zwanzig Lichte stecken, und der nunmehrige junge Staatsbürger »fühlt sich«. Wenn aber, wie bei Fritz, eine Erbschaft zu erwarten war, so erhält der Tag der Großjährigkeit eine schwerwiegende Bedeutung und in unserem vorliegenden Falle knüpften sich hieran bereits schon langgesehnte Pläne.

Von der nicht sehr großen, aber für einen, der bisher nichts hatte, noch ganz anständigen Summe blieb Gott sei Dank noch etwas übrig. Aber die Kavalierfreunde hatten bereits über Fritzen disponiert, und Herr Moritz Genendelsohn aus Wien war der richtige Mann, der jetzt Fritz an die Seite trat. Herr Genendelsohn besaß ein Patent auf einen Magentee, angemeldet in allen Staaten der Welt; und es fehlten ihm nur die Mittel, um damit ein Bombengeschäft zu machen.
Vier Wochen später prangte an einer Tür in der Kronenstraße ein Schild mit der Schrift: »Internationale Magenteegesellschaft Krohn & Genendelsohn.« Und darüber ein zweites Schild in knallroter Farbe, auf dem in einem blauen Kreis in weißem Schild lakonisch und mystisch das Wort stand: »Efka«.
Fritz war jetzt Chef. Seine erste Tätigkeit bestand darin, daß er sich bei einem Modeschneider einen Anzug machen ließ. Genendelsohn, sein Kompagnon, übernahm die interne Leitung der neuen Gesellschaft und die Reklame. Mit der künstlerischen Seite der Reklame befaßte sich Fritz selber. Es dauerte nicht lange, so klebten an allen Säulen und überall da, wo man in Berlin nur kleben konnte, ein riesengroßes rotes Plakat, auf dem in einem blauen Kreis das weiße Wort leuchtete »Efka«. Krohn und Genendelsohn beherrschten eine Zeitlang die Großstadt, und alles zerbrach sich den Kopf über das mystische Wort. Hunderttausende von Reklameprospekten wurden weggeschickt, aus aller Welt liefen Bestellungen ein, und man konnte an diesem Betriebe mit Leichtigkeit feststellen, wieviel Tausende von Menschen unter Magendrücken zu leiden hatten. Alles wollte den Magentee und alles hoffte, dadurch in eine bessere Stimmung zu kommen.
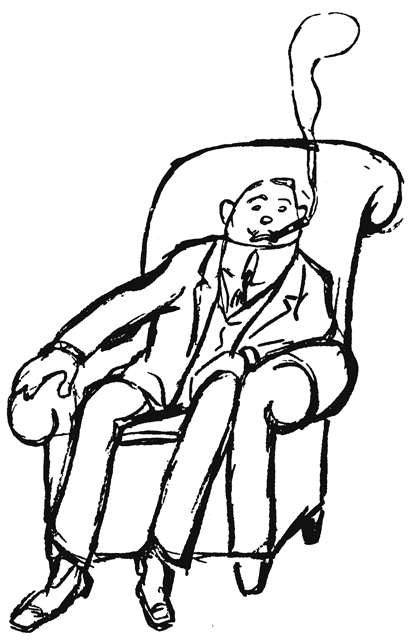
Denn bekanntlich ist der Mensch dann am unangenehmsten, wenn die Verdauung nicht in Ordnung und der Magen nicht in Form ist. So war Moritz Genendelsohn aus Wien der Retter der Menschheit! Und Fritz Krohn der Geldgeber für den Retter der Menschheit! Wer von den beiden hatte nun mehr Anrecht auf die Menschheitsrettungsmedaille, denn ihre Verdienste waren gleich groß. Das heißt ihre Verdienste im idealen Sinne. In Wirklichkeit hatte zwar Fritz das bare Geld gegeben, aber Genendelsohn bewertete sein Patent und seine Erfahrungen mit fünfundsiebzig Prozent. Auch konnte Fritz seit der Portokassenangelegenheit kein rechtes Vergnügen mehr weder an der einfachen noch an der doppelten Buchführung finden, und er beschränkte seine geschäftliche Tätigkeit darauf, daß er um elf Uhr morgens einen Augenblick ins Bureau kam, sich vom Hausdiener etwas Frühstück holen ließ, ein paar Privatbriefe diktierte, und mit seinem neu erworbenen Freund, dem Plakatmaler Neudorf, konferierte. Fritzens Spezialität waren überhaupt Konferenzen. Zwischen elf und zwölf beliebte Fritz zu konferieren. Er hatte sich den Titel »Direktor« verliehen, auf den Herr Genendelsohn zu seinen Gunsten verzichtete. Herr Direktor Krohn konferierte also zwischen elf und zwölf und besprach die für den Betrieb der »Internationalen Magenteegesellschaft« seiner Meinung nach notwendigsten Dinge, indem er die Zeichnung für eine neue Packung dreißigmal verändern ließ. Herr Genendelsohn störte seinen Sozius, den Direktor, keineswegs bei dieser Beschäftigung, nur annullierte er gewöhnlich am Abend schriftlich das, was der Herr Direktor am Vormittag mündlich besprochen hatte. Es kam auch vor, daß der Herr Direktor nachmittags ins Bureau kam, wenn er zufälligerweise in der Nähe gegessen hatte. Im kleinen Privatkontor war nämlich ein bequemer Diwan.
Fritz hatte seinen Vater eingeladen, ihn in Berlin zu besuchen, und der alte Herr Apotheker, der voller Stolz in der Stadt seines Sohnes Magentee eingeführt hatte, freute sich, den großen Betrieb kennen zu lernen, Genendelsohn machte auf den alten Herrn Krohn einen sehr vertrauenerweckenden Eindruck durch die Liebenswürdigkeit, die sowohl sein österreichischer Dialekt, wie seine anderen österreichischen Eigenschaften ausstrahlte. Der Herr Apotheker sagte sich nach dreitägigem Aufenthalt in Berlin, daß es ein himmelschreiendes Unrecht ist, wenn man über einen jungen Menschen, der als Lehrling nicht die geraden Wege von Meyer & Co. geht, den Stab brechen wollte. In diesen drei Tagen hatte er eingesehen, daß sein Sohn wirklich ein Genie ist, denn nach den Versicherungen des Herrn Genendelsohn schien die erste Million bereits so gut wie sicher zu sein. Auch war er ganz entzückt über seinen Sohn als Lebemann, denn die drei Tage waren für ihn drei lustige Nächte geworden. Und Fritzens sicheres Auftreten und seine große Beliebtheit an den Stätten, wo man sich nachts nicht langweilt, erfüllten ihn mit väterlichem Stolz. Er sagte sich mit Recht, daß hier eine Vererbung von seiner Seite vorliege und war froh, daß Fritz nur äußerlich etwas von seiner Mutter hatte. Geistig glich er dem Vater. Und mit dem Bewußtsein, der Vater eines zukünftigen großen Mannes zu sein, stieg er in den Zug, um wieder zu den Pillen seiner heimatlichen Apotheke zurückzukehren.
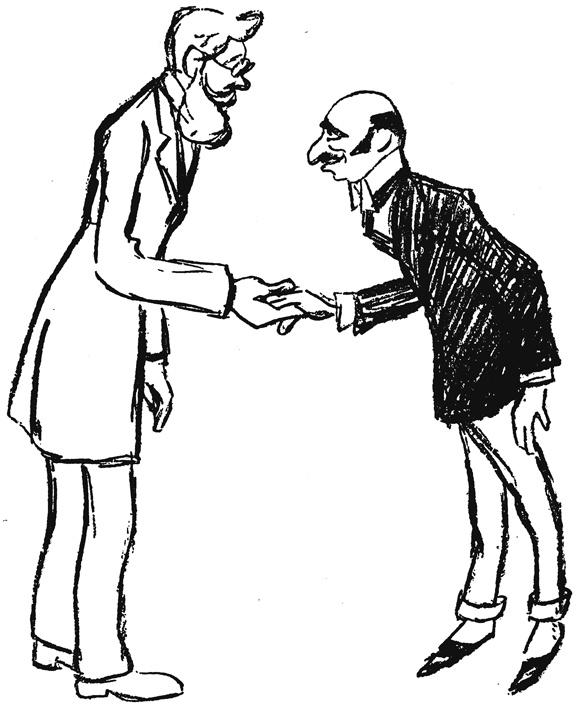
Wir müssen hier die Betrachtung einflechten, daß das Leben aus vielen Zufälligkeiten besteht. Man hat sogar wissenschaftlich diese Zufälligkeiten in ein Gesetz gefaßt. Man spricht vom Gesetz des Zufalls. Beobachten wir die Zufälligkeiten im Leben unseres Helden. Ein anderer junger Kaufmann würde eben drei Jahre Lehrlingszeit durchgemacht haben; er würde von dem Anfangskommis bis zum Prokuristen hinaufgestiegen sein, hätte geheiratet, wäre wahrscheinlich in das Geschäft seines Schwiegervaters eingetreten und hätte bei seinem Tode seinen Kindern einen anständigen Namen und ein bürgerliches Auskommen hinterlassen. Aber das Leben eines solchen Menschen ist bereits in der Wiege in normaltechnischem Sinne vorgesehen. Es ist zu wenig interessant, als daß sich der kapriziöse Zufall damit weiter beschäftigt. Wenn aber im Hause Meyer & Co. die Tippdame der »Englischen Korrespondenz« nicht einen lyrischen Knacks gehabt hätte, wenn ferner Tante Lieschen noch länger eine Zierde der »Gesellschaft« ihrer Stadt geblieben wäre, wenn ferner Herrn Genendelsohn niemals in Wien sich der Boden zu sehr erhitzt hätte, so würde Fritz Krohn weder mit jungen Jahren bereits Direktor geworden sein, noch hätte sich sein Genie entfalten können, und Herr Genendelsohn hätte seinen »Patent-Magentee« nicht mit fünfundsiebzig Prozent vom Reingewinn bewerten können.

Wir haben nun gesehen, wie die »internationale Magenteegesellschaft« einen riesenhaften Aufschwung genommen hat, und wie Herr Direktor Fritz Krohn in vornehmer Weise sein Haus repräsentierte. Da seine lyrischen Gefühle und seine poetische Ader seit den Zeiten der »Blauen Leyer« eingetrocknet waren, hatte er auch seine frühere mit Sentimentalität gepaarte Anschauung von der Frau und der Liebe einem gewissen Pessimismus weichen lassen, und er war auf dem besten Wege, ein »Don Juan« zu werden. Vorläufig übte er diesen neuen Nebenberuf in den nächtlichen Lokalen der Friedrichstadt aus, denn das Scheckbuch, das Herr Genendelsohn ihm gütigst zur Verfügung stellte, öffnete ihm alle Herzen.
Vielleicht wäre Fritz Krohn jetzt schon wirklich ein Millionär geworden, aber das Schicksal beschäftigte sich wieder mit ihm und wollte es anders. Das Schicksal wollte erstens, daß er nicht Reserveleutnant werden sollte, denn trotz seiner Größe und seines Umfangs fand der Stabsarzt bei der Ausmusterung heraus, daß er irgend etwas hatte, was ihn vom Militärdienst ausschloß. So mußte der Staat auf einen der elegantesten Kavaliere verzichten, dem der Dienst Spaß gemacht hätte, wenn er etwas weniger anstrengend gewesen wäre. Aber das Schicksal wollte auch ferner, daß Herr Genendelsohn beabsichtigte, in Paris eine Filiale zu errichten und zu diesem Zweck dorthin eine längere Reise unternahm.
Nachdem Herr Genendelsohn acht Tage abwesend war, stellte es sich heraus, daß die Barmittel erschöpft waren und das Konto auf der Deutschen Bank abgehoben. Ferner liefen keine Postanweisungen mehr ein und Ware wurde auch nicht mehr geliefert, da der mazedonische Fabrikant nicht mehr aufzufinden war. Nachdem der Herr Direktor Fritz Krohn in den ersten Tagen versucht hatte, mit seinem Sozius in Paris sich telephonisch verbinden zu lassen, ohne Anschluß zu bekommen, und ein eingeschriebener Brief mit dem Vermerk zurückgekommen war: »Adressat abgereist, unbekannt wohin«, dauerte es nicht mehr lange, bis die Gläubiger der »Internationalen Magenteegesellschaft« das Lokal in der Kronenstraße stürmten.
Und dann kam es so, wie es öfters kommt.
Herr Moritz Genendelsohn aus Wien hatte eingesehen, daß sein Patent mit fünfundsiebzig Prozent nicht hoch genug bewertet war, und übernahm die ganzen Anteile. Er hatte allerdings vorsichtigerweise vermieden, seine Adresse zurückzulassen, um nicht die Staatsanwaltschaft zu bemühen. Seine bekannte österreichische Liebenswürdigkeit ließ es nicht zu, daß man seinetwegen zu viel Umstände mache, und wir sind überzeugt, daß er es sehr bedauern wird, wenn er in New York an seinen ehemaligen Sozius denkt, dem er eine kleine Unannehmlichkeit bereiten mußte. Denn schließlich ist es immerhin eine Unannehmlichkeit, gestern noch Direktor mit einem Scheckbuch gewesen zu sein, und heute leider nur noch über fünf Mark und fünfzig Pfennige bares Geld verfügen zu dürfen.
Und so muß dieses Kapitel wiederum mit einem traurigen Ausgang enden. Unser Held hatte die fatale Gewißheit, daß man wohl ein Genie sein kann, daß aber der Erwerb gerade der ersten Million ungeheuer schwierig ist.
Die roten Plakate mit dem blauen Kreis und der weißen Schrift »Efka« verschwanden ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren, und der Volksmund fand jetzt die richtige Erklärung für das mystische Wort und sagte »Efka heißt F. K. oder fauler Kopf«.
