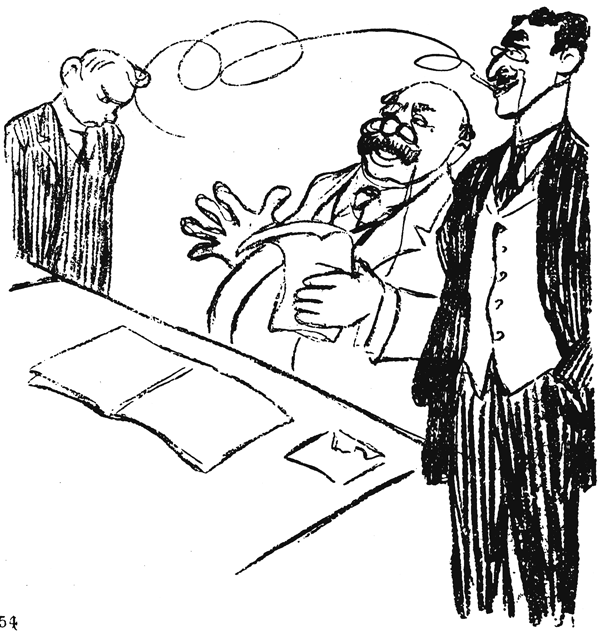|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
![]()
Der Lehrling – Die Portokasse – Der höhere Flug – Die Tippdame – Der Kuß bei der dritten Droschkentaxe – Das Manko – Der Abgrund der Frauenseele – Poesie und Prosa – Ende mit Schrecken
Fritz Krohn trug schon lange keine mütterlichen wollenen Socken mehr. Zwei Jahre in Berlin hatten genügt, um aus dem Provinzjüngling einen auch äußerlich leicht zu erkennenden Großstadtlebemann zu kristallisieren. Er hatte es bald herausgehabt, daß die Aufmachung heutzutage ein großer Bestandteil des Lebens ist. In diesen zwei Jahren war Fritz bemüht gewesen, so viel wie möglich von der Kaufmannskunst zu erlernen; wobei wir in Paranthese bemerken, daß die Bemühungen nicht gleichen Schritt mit der Ausdauer hielten. Aber wir haben die Absicht, eine lustige Geschichte zu schreiben und verzichten daher auf pädagogische Randbemerkungen. Wenn es einen Kursus gegeben hätte, die ganze kaufmännische Wissenschaft schnell zu erlernen, so wäre Fritz nicht abgeneigt gewesen, den ganzen Rummel abzubüffeln. So aber war die Kunst, in vierundzwanzig Stunden Kaufmann zu werden, noch nicht erfunden, und Fritz sah sich gezwungen, monatelang Briefe zu kopieren, Skripturen zu ordnen, Geldsäcke von der Reichsbank zu holen und sich von dem älteren Kommis anschnauzen zu lassen. Nachdem er auf diese Weise in die Tiefen der kaufmännischen Wissenschaft eingedrungen war, gelang es ihm endlich, auf einen Bureauschemel zu avancieren und selbständiger Verwalter einer Kasse zu werden.
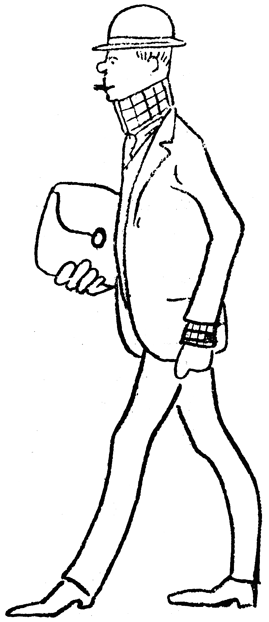
Diese Kasse bestand in täglichem Wechselverkehr von zwei Zwanzig-Markstücken, die das Briefporto des Hauses Meyer & Co. erforderte, wenn man bedenkt, daß die monatliche Remuneration (das Wort Gehalt fing erst bei höheren Beträgen an) des Lehrlings Fritz Krohn dreißig Mark nicht überschritt, wenn man ferner den väterlichen Zuschuß von siebzig Mark in Betracht zieht und selbst die gelegentlichen heimlichen Übermittelungen von den vereinten weiblichen Kräften des Apothekerhauses dazu rechnet, so muß man zu der Überzeugung kommen, daß die Summen, die täglich aus der Portokasse durch die Finger unseres Helden rollten, auf ein lyrisches Gemüt ungeahnte Reflexe ausüben konnten. Es war daher gar nicht wunderbar, daß das Vorhandensein des flüssigen Geldes Fritzens Lebetätigkeit beeinflußte, wir werden noch in diesem Kapitel sehen, wie die Portokasse in intellektuellem Zusammenhang mit »Wein, Weib und Gesang« steht, und wie Tante Lieschen Recht gehabt hätte, wenn sie nicht wie Schuft, das Hundevieh, leider zu früh von hinnen gegangen wäre. Aber diese Pointe und die Konsequenzen aus Tante Lieschens Tod müssen wir uns für das nächste Kapitel aufsparen, und wir bitten den geehrten Leser und die liebreizende Leserin, Tante Lieschen inzwischen nicht zu vergessen.
Fritz hatte sehr bald eingesehen, daß jemand, der etwas werden will, nicht nur in den Geschäftsstunden streben, sondern auch in den Stunden der Muße sich weiter bilden müßte. So jung wie er war, fühlte er den großen Organisator in sich und, nachdem er unter dem jüngeren Personal ein paar verwandte Seelen gefunden hatte, die zwischen dem Knopfsortieren und Musterabschneiden ihre Seele auf einen höheren Flug dressierten, gründete er mit ihnen einen Verein für lyrisches Sichausleben mit anschließendem Tanz.

Wir haben bisher unseren Helden in Beziehung auf das weibliche Geschlecht noch schwankend gesehen, und außer seinen provinzialen Erlebnissen noch nichts von seinem Liebesleben erfahren. Der neu gegründete Verein, dem Fritz den wohlklingenden Namen gab: »Die blaue Leyer«, sollte für ihn das Sprungbrett in den Venusberg werden. Fräulein Marie Stüpke, die Tippdame aus der »Englischen Korrespondenz«, fühlte wie Fritz, das heißt auch sie träumte zwischen den Schriftzeichen ihrer Remington-Maschine von dem Lande des Wunderbaren, und wenn sie »Sehr geehrter Herr« und »Hochachtungsvoll und ganz ergebenst« tippte, führte sie ihre Seele spazieren, was zur Folge hatte, daß sie nachher radieren mußte. Aber abends im Verein trug sie schüchtern selbstverfaßte Gedichte vor, die von heißen Kämpfen mit blonden Liebsten erzählten und von naß geküßten Kopfkissen. Die Haare trug sie über die Ohren frisiert und eine Spange mit blitzenden Edelsteinen für fünfundachtzig Pfennige krönte ihren Scheitel, wenn sie in einen violetten langen Schleier gehüllt am Klavier stand und mit ihren Fingern nervös auf die Politur klopfte, konnte man sie nicht mehr von einer Kabarettkünstlerin unterscheiden, nur die tippenden Finger erinnerten noch an ihren Ursprung.

Fritz aber machte täglich zwei Gedichte auf sie; Fräulein Stüpke revanchierte sich, doch konnte sie Fritzens Rekord nicht brechen, und sie kam nur auf vier Poeme in der Woche, die sie ihm wiederum widmete.
Nachdem sie sich beide vierzehn Tage lang in allen möglichen Versmaßen ausgelebt hatten, schien ihre gegenseitige Liebe festere Form annehmen zu wollen. Man weiß, daß helles Bier und Butterstullen schlechte Wärmeleiter für Seelenempfindungen sind. Man kann wohl bei hellem Bier große politische Gefühle haben und überhaupt scheint verdünnter Alkohol für die Lösung sozialer Probleme von besonderem Vorteil zu sein, was der Konsum bei Wahlversammlungen und ähnlichen den Staat fördernden Abendgesellschaften beweist. Aber ein Kuß läßt sich mit dünnem hellem Bier nur unter den größten Schwierigkeiten konstruieren. Ein Kuß ist wie die Perle, die aus dem Sektglas aufsteigt. Kann man es daher Fritz Krohn verdenken, daß er nach dem achtzehnten Liebesgedicht und nach der metrischen Betätigung seiner Angebeteten danach dürstete, seine Versfüße, um uns so auszudrücken, in die Wirklichkeit und auf Maries Lippen umzusetzen? Übrigens nannte sie sich nur geschäftlich Marie. Abends hieß sie »Mia« und ihr literarisches Pseudonym war »Mia Pippa«.

In einer Automobildroschke küßte Fritz seine Mia zum ersten Male, allerdings bei der dritten Taxe. An diesem Abend hatten einige Auserwählte des Vereins »Die blaue Leyer« eine Kommissionssitzung in den »Winzerstuben« abgehalten. Hier in diesem großen Weinlokal herrschte das ganze Jahr die Stimmung, die notwendig ist, um dem Menschen das Herz und den Mund zu lösen. Hier knallten die billigen Sektpfropfen, hier dudelte die Musik die neuesten Gassenhauer, hier sang und grölte sich eine fröhliche Menschheit die Sorgen aus dem Kopf. Und manches letzte Goldstück wurde den schönen Augen einer Tischgenossin geopfert. Wir müssen um Entschuldigung bitten, wenn wir ein ganz klein wenig unsittlich werden, aber schließlich ging es doch nicht, daß Fritz und Mia den ersten Kuß mit schalem dünnen Biere begossen. Schon des Nachgeschmacks wegen ging es nicht. Und wer weiß, ob es überhaupt zu einem Kuß gekommen wäre, zumal es gegen Ende des Monats war. Leider kompliziert sich hier der Fall. Auf der einen Seite drängte die poetische Tätigkeit beider Kontrahenten auf einen realen positiven Schlußpunkt. Selbst Plato hätte, wenn er nicht darüber gestorben wäre, mit der Zeit einsehen müssen, daß seine Grundsätze über die Liebe auf die Dauer nicht durchführbar sind. Also drängten Mia und Fritz ihre Seelen auf diesen realen Schlußpunkt hin. Auf der anderen Seite war es, wie gesagt, Ende des Monats. Fritz war erschöpft. Seine pekuniären Bezüge waren zusammengeschmolzen und es hätte höchstens an jenem denkwürdigen Abend, an dem seine Liebe eine greifbare Form annahm, zu Aschinger ausgereicht. Wir begreifen, daß Leute, die gewöhnt sind, den Pegasus über den Wolken zu reiten, durch dünn geschmierte Buttersemmeln und dem blau und weiß gestreiften Allgemeincharakter der Aschingerei unmöglich angeregt werden können.
Aber an diesem Tage war der Restbestand in Fritzens Portokasse achtzehn Mark und achtundsiebzig Pfennige – – –
Als Mia in der Autodroschke in den Armen des Geliebten lag und die Küsse auf den Lippen perlten, wie die Kohlensäure im eben getrunkenen Sekt (Hausmarke vier Mark fünfzig) berechnete Fritz, daß er Gott sei Dank noch dreißig Pfennige Überschuß haben würde, wenn er den Taxameter eine Straße vorher halten ließ, denn Küsse kommen einem mit der dritten Taxe doch zu teuer.
Die Portokasse mußte aber von nun an leider öfters unter Mias und Fritzens lyrischen Ergüssen leiden.
* * *
Fritzens Dilemma wurde immer größer. Bekanntlich ist es stets nur der erste Schritt, der kostet. In Fritzens Fall wurden die Kosten allerdings täglich bedeutender. Beide Liebenden konnten sich jetzt nur noch Anregung in besseren Lokalen holen, und Fritz holte sich wiederum die dazu nötigen Anregungen aus den Beständen der von ihm verwalteten Portokasse.

Es schien jedoch, als ob die Sonne des Glückes nie untergehen würde, bis eines Tages zwei Ereignisse eintraten, die Fritzen bis aufs Innerste erschütterten. Am Vormittage hatte nämlich Fräulein Marie Stüpke, wie dies öfters geschah, etwas zu viel radiert und war plötzlich entlassen worden. Den ganzen Tag über weinte ihr Fritz heimliche Tränen nach und dachte an die Gemeinheit des Alltags, unter der eine so schöne Seele, eine so empfindsame Frau, wie seine Mia, dulden mußte. Zwischen den Korrespondenzen und den Enveloppen schrieb er auf einen Briefbogen seiner Firma ein Klagegedicht, in dem er von dem Schmetterling sprach, der mit seinen farbenfreudigen Flügeln über die Wiesen des Idealismus fliegt und plötzlich von einer rauhen Hand auf einer schmutzigen Pappe aufgespickt wird:
Es fliegt der Schmetterling in blaue Fern',
Er fliegt über Feld und Wiesen,
Er nippt an jeder Blume gern,
O Unschuld sei gepriesen!
Doch der Philister meistens ringsumher,
Er kennt kein Fühlen und Schaffen.
Er pflegt nur seines Bauches Schmeer
Und sauft sich einen Affen…
Voller Verzweiflung ging er des Abends durch die Straßen. Aber als er gegen Morgengrauen, um die vierte Stunde, an die Ecke »Unter den Linden« kam, sah er seine Mia mit dem Sohn seines Chefs eng umschlungen in einer offenen Autodroschke vorüberfahren, und das einzige, woran er in diesem Augenblick noch denken konnte, war, daß es bei ihm auch mit der dritten Taxe angefangen hatte. Dann schwand ihm die Besinnung und irgend eine hilfreiche Hand mußte ihn von dannen geführt haben, denn er wachte am andern Morgen in einem Zimmer auf, das nicht das seine war, und als er auf die Elektrische stieg, um ins Geschäft zu eilen, bemerkte er, daß die hilfreiche Hand ihm gerade noch zehn Pfennige im Portemonnaie zurückgelassen hatte.
Soll man unsern jungen Helden für dieses Ausgleiten verantwortlich machen? Greift man nicht nach einem Strohhalm, wenn man dem Ertrinken nahe ist? Ist man Herr über seine Sinne, wenn eine hilfreiche Hand sich bietet, die an einem vollen Arm sitzt, der aus einer weißen Mullbluse heraussteckt, die einen zwar schon überreifen, aber begehrenswerten Körper umhüllt?

Schweigen wir lieber und trauern wir mit Fritz über die Duplizität der Fälle. Jedenfalls hatte er zwei große Erfahrungen hinter sich. Er hatte tief in den Abgrund der Frauenseele gesehen und wußte, daß man sich auch auf eine Tippdame nicht verlassen kann, selbst wenn sie Gedichte macht und sie in violetter Pose vorträgt. Aber er kannte die Liebe jetzt auswendig und beherrschte alle ihre Phasen. Nur verzichtete er die nächsten beiden Tage auf poetische Niederschläge, denn er rechnete nach, daß er in den letzten sechs Wochen ein Defizit von über Hundertfünfzig Mark in seiner Kasse gemacht hatte, eine Summe, die im Verhältnis zu dem geringfügigen Treubruch riesenhaft erschien. Und das Unangenehmste an der ganzen Affäre war die Unmöglichkeit, auch nur drei Mark irgendwo leihweise aufzubringen. So sah er sich außerstande, das Loch zuzustopfen, und die psychischen Magenschmerzen, die ihm diese plötzliche Erkenntnis verursacht hatte, schalteten bei ihm jede andere Seelenbetätigung aus.
Was nützt es, wenn der Mensch sich müht, sein Schicksal anders zu gestalten, als es in den Sternen geschrieben steht? Was nützte es Fritz, zwei Tage lang mit schlotternden Beinen herumzuwandeln, das heißt mit seelisch schlotternden Beinen, denn äußerlich behielt er Haltung und man konnte ihm seine Zerrüttung nicht ansehen. Sein Schicksal wollte es, daß es so kommen mußte, und sein Schicksal wollte es, daß er am Morgen des dritten Tages nach oben erwähnter Selbsterkenntnis eine halbe Stunde zu spät im Geschäft erschien. Der Chef, Herr Meyer sen., stand in der Tür, machte eine tiefe Verbeugung, als Fritz eintrat, zog aus der Tasche die dicke goldene Uhr und sagte lakonisch: »Guten Morgen, Herr Krohn!!« Weiter sagte er nichts. Aber es war, als wenn er sich auf jeder Silbe eine halbe Stunde lang ausruhen wollte, so langsam und deutlich akzentuierte er die vier Worte. Man hörte ordentlich die zwei Ausrufungszeichen hinterher; und dann hatte er außerdem noch »Herr Krohn« gesagt, sonst nannte er ihn immer nur Fritz, nach Lehrlingssitte.
Wir wissen nicht, ob unser Held in diesem bedeutsamen Augenblick sehr imponierend ausgesehen hat. Wir können nur berichten, daß fünf Minuten nach diesem Auftritt Fräulein Müller, die Lagerdame von oben, heruntertelephonierte, Fritz möchte ins Privatkontor hinaufkommen.
Man erzählt von Ertrinkenden oder wenigstens von Leuten, die beinahe ertrunken sind, daß sie in dem Augenblick, wo sie unter Wasser sind und wo sie merken, daß es nun endgültig mit ihnen aus ist, sie lebten in diesem Tausendstel einer Sekunde ihr ganzes Leben noch einmal. Wir können begreifen, wie Fritz im Fahrstuhl zumute war, als er zu einer so ungewöhnlichen Zeit zu seinem Chef ins Privatkontor gerufen wurde.
Als er nach einer Viertelstunde wieder vor seiner Portokasse saß, schämte er sich. Aber er schämte sich nicht so sehr über den Rüffel, den er eben bekommen hatte, als daß er eine der schönsten Blüten seiner dichterischen Phantasie, das Gedicht: »Die Gemeinheit des Alltags« vor den profanen Händen der Firma Gottlieb Bomsdorf Söhne in Teterow prostituiert hätte. In seiner Aufregung über Mias plötzliche Entlassung, eine Aufregung, die vor dem abendlichen Treubruch zu verstehen war, hatte er zu der Faktura über gelieferte drei Gros Knöpfe anstatt des Begleitbriefes seine Poesie gesteckt. Meyer & Co. bekam von Gottlieb Bomsdorf Söhne folgenden Brief, den Meyer sen. Herrn Fritz Krohn mit derselben langsamen Betonung vorlas, mit der er ihm beim Zuspätkommen begrüßt hatte:
Herren Meyer & Co., Berlin. In der Anlage überreichen wir Ihnen ein Gedicht, das wir gestern mit Ihrer Faktura über drei Gros Steinnußknöpfe erhalten haben, wir wußten nicht, daß Sie auch solche Artikel führen, wie beiliegendes Gedicht, wir hoffen aber, daß dieser neu eingeführte Artikel mit der Zeit ebenso gut in Qualität werden wird, wie ihre Knöpfe und Besätze. Von der übersandten Probe bedauern wir, für den Augenblick keinen Gebrauch machen zu können, da unser Bedarf gedeckt ist. Wir bitten Sie, uns auch fernerhin in diesem Artikel nichts mehr zu bemustern.
Hochachtungsvoll
Gottlieb Bomsdorf Söhne.
Meyer sen. hatte diesen Brief langsam und deutlich vorgelesen. Und Felix Meyer jun. grinste inzwischen und machte mit den Schultern zuckende Bewegungen und blies Fritz den Zigarettendampf ins Gesicht. Meyer jun. war kleiner und schmächtiger als Fritz und hatte so etwas Wegwerfendes in seinen Bewegungen. Es war klar, wenn man die Krawatten der beiden jungen Leute verglich, ließ sich ein gewisser sozialer Unterschied sofort konstatieren, aber trotz der Demütigung, die der Brief der witzigen Provinzfirma unserm Helden bereitete, mußte sich dieser über Mia ärgern, die den geschniegelten kleinen Herrn Meyer ihm, dem blonden Dichterteutonen, vorzog.
Als er abends die Post bekam, um sie zu kuvertieren, war er bereits über das Ereignis des Morgens beruhigt, da er sich klar gemacht hatte, daß er das Schicksal aller Genies teile, die im Anfang ihrer Laufbahn mit Hohn und Spott übergossen werden. Was verstehen Teterow und Bomsdorf Söhne und Meyer sen. und Meyer jun. von den grünen Wiesen der Ideale! Ihnen ist ein Steinnußknopf wichtiger, als die ganze Literaturgeschichte und die ganze Kultur überhaupt. Mit dieser Betrachtung ging er zur Tagesordnung über und klebte wohlgemut die Marken auf die Enveloppen.
Doch das Schicksal beschäftigte sich diesen Tag besonders viel mit unserem Helden. Plötzlich stand Meyer sen. hinter ihm und klopfte ihm auf die Schulter:
»Nu, Fritz, dichten Se noch?« Und dann wollte er mit ihm einen Witz machen, aber er gelang nicht recht, denn er blieb mitten in der Pointe stecken, weil er in dem kleinen Kassabuch blätterte. Seine geübten Augen sahen sofort, daß das Buch nicht gut geführt war.
Es brach über Fritz herein. Ganz spät am Abend verließ er mit geröteten Backen und klopfenden Herzens das Geschäftslokal. Meyer sen. hatte noch mit seinem eigenen Füllfederhalter einen Privatbrief geschrieben und den Brief sogar selber in den Kasten geworfen. Dem Lehrling Fritz hatte er anbefohlen, zwar am anderen Morgen wieder pünktlich im Geschäft zu erscheinen – bis auf weiteres, hatte er bedeutungsvoll gesagt –, aber die Portokasse führe von morgen früh ab sein Sohn, denn das wäre sicherer. Innerlich war er überzeugt, daß auch Felix manchmal ein kleines Defizit haben würde, aber dann bliebe es wenigstens in der Familie.
Wir können dieses Kapitel nicht schließen, indem wir unseren Helden zwischen Hangen und Bangen schweben lassen. Auch wollen wir die Nerven unserer Leser nicht zu sehr auf die Folter spannen. Es ist nur billig und gerecht, eine Tragödie auch ausgehen zu lassen. Und es ist besser, den schlimmen Ausgang zu wissen, als im Zweifel zu sein, was nun geschehen wird. Die Portokassen-Tragödie unseres Helden endete mit dem Besuch seines Vaters in Berlin, der das Defizit ausglich und sich dafür drei Tage lang in der Reichshauptstadt anderweitig gütlich tat. Über die Moralpauken und sonstigen Entrüstungs-Sermone des Herrn Apothekers wollen wir den Mantel der Liebe decken. Fritz zeigte sich bis auf die Fingerspitzen zerknirscht und versprach, wie man es von einem jungen Mann mit zwanzig Jahren nicht anders erwarten konnte, reumütige Besserung. Und als sein Vater abreiste und ihm in grellen Farben die Schmach der Zukunft ausmalte, in die ihn sein Leichtsinn noch hineintreiben würde, weinte Fritz wirklich, und er versprach, niemals wieder zu dichten und wieder reuevoll zu hellem Bier und Aschinger zurückzukehren.
Mia Pippa, die frühere Tippdame, trat bald darauf in einem Kabarett auf, und das gelbe Libertykleid, das von ihren mageren poetischen Schultern herunterfloß, hatte Felix Meyer jun., der Sohn ihres früheren Chefs, gestiftet, der jetzt die Portokasse führte, weil, wenn schon einmal ein Defizit wäre, es wenigstens in der Familie bliebe.