
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die mathematischen Wissenschaften im weitesten Sinne des Wortes stellen einen der ältesten und wichtigsten Kulturbesitze des Menschen dar; ihr Ursprung begann mit den einfachen Verrichtungen des Zählens und des Messens, ihre Entwicklung erfolgte anfänglich aus den notwendigsten Bedürfnissen des täglichen Lebens. So erscheint uns bei historischer Betrachtung die Mathematik zunächst als aus der Anwendung heraus geboren und genährt; aber alsbald erklomm sie stufenweise auch Bedeutung als reine Wissenschaft, der die praktischen Bedürfnisse erst in zweiter Linie stehen. Es wechseln im Laufe der Zeiten Perioden, in denen die reine Forschung überwiegt, mit solchen Perioden, in denen sich das Interesse bedeutender Forscher auf praktische Probleme richtet und die Mathematik in ihrer Anwendung besonders gefördert wird.
Im alten Ägypten waren es bekanntlich die durch die Nilüberschwemmungen alljährlich nötig werdenden Vermessungen der Ländereien, die den Anstoß zur Entwicklung geometrischer Sätze gaben; für die Absteckung von rechten Winkeln waren besondere Fälle des pythagoreischen Lehrsatzes bekannt. In Indien erkennt man das Vorhandensein geometrischer Betrachtungen aus religiösen Vorschriften für den Bau der Altäre, und auch hier war lange vor Pythagoras bekannt, daß ein Dreieck, dessen Seiten 13, 12 und 5 Längeneinheiten betrugen, rechtwinklig sei. Aber auch für beliebige rechtwinklige Dreiecke scheint in Indien der pythagoreische Satz längst bekannt gewesen zu sein, da man die Differenz zweier Quadrate als Quadrat darzustellen wußte. Der Schwerpunkt mathematischer Betätigung der Inder lag aber schon in den ältesten Zeiten auf arithmetischem Gebiete, gelang es ihnen doch, Quadratwurzeln durch Teilbruchreihen darzustellen. In Mesopotamien führten die religiösen Bedürfnisse des Sternenkultes zu besonderer Ausbildung astronomischer Beobachtungen und deren rechnerischer Verwertung. Daß der Winkel eines gleichseitigen Dreiecks der sechste Teil der vollen Umdrehung ist, scheint der Anlaß zur Einteilung des Kreises in 360º gewesen zu sein, und hier ist die Quelle des seit alten Zeiten neben dem Dezimalsystem bestehenden Sexagesimalsystems, dessen letzte Spuren noch in das tägliche Leben unsrer Zeit reichen (Winkelteilung, Schock, Dutzend usw.).
Auch in China hat sich in vorgriechischer Zeit besonders die Arithmetik zu beachtenswerter Höhe entwickelt; hier wie in Indien sind Probleme, die keinerlei Bedeutung für das praktische Leben haben, wie die Auflösung der sogenannten Diophantischen Gleichungen, mit Geschick behandelt worden. Es ist nicht zu bezweifeln, daß schon in jenen fernen Tagen durch den Handelsverkehr und durch Reisen hervorragender Gelehrter zwischen den genannten Völkern Kulturbeziehungen bestanden, durch die manche Errungenschaften der Mathematik weiter verbreitet wurden. Für das Rechnungswesen der Kaufleute versteht sich dies ebenso von selbst wie für die zu praktischer Anwendung gediehenen geometrischen Kenntnisse. Eine wichtige Urkunde ist der etwa um 1800 v. Chr. in Ägypten geschriebene Papyrus Rhind, in dem praktische Rechenaufgaben nach Art der heute noch üblichen Regeldetri durchgeführt sind; diese bestimmten Regeln haben sich bis ins Mittelalter erhalten, ja es ist sogar nachgewiesen, daß sich ein Beispiel aus dem Papyrus Rhind durch verschiedene Völkerschaften hindurch behauptet hat und sich noch in arabischen und italienischen Büchern des Mittelalters vorfindet. Die in jenen alten Zeiten von den Priestern gehüteten Geheimnisse ihrer Schulen werden sich dagegen immer nur auserwählten Fremdlingen erschlossen haben. Losgelöst von religiösen und von praktischen Fragen, als reine Wissenschaft, treten Arithmetik und Geometrie zuerst bei dem Volke des Altertums auf, das, ohne weltabgekehrt zu sein, zugleich den lebhaftesten Drang nach philosophischer Vertiefung zeigte, bei den Griechen, von der sicherlich außerordentlich vielseitigen, phantasiereichen Entwicklung von Pythagoras (um 500 v. Chr.) bis Plato (429 bis 348) ist nur wenig Sicheres überliefert. Dann aber schuf der überall nach Klarheit und Formvollendung strebende Geist der Griechen in voller Erkenntnis ein rein theoretisches Lehrgebäude der Mathematik, dessen Zusammenfassung und musterhafte Darstellung ein unsterbliches Verdienst Euklids (300 v. Chr.) ist. In jenen Jahrhunderten lebhafter Förderung reiner Wissenschaft sehen wir, was sich auch später immer wiederholte, daß die hervorragenden Gelehrten sich gegenseitig schwierige Probleme zur Lösung aufgaben, Probleme, deren Bewältigung oft nur durch neu zu erfindende Methoden gelang. Seit jener klassischen griechischen Zeit besteht die Mathematik als Wissenschaft, und sie hat diesen Charakter nie wieder verloren. Die meisten und wichtigsten Entdeckungen der Mathematik sind aus rein mathematischen Bedürfnissen hervorgegangen, und nur auf einigen wenigen Gebieten waren es technische Probleme, die zur Förderung der Wissenschaft beitrugen, während in der Regel die Technik schon die nötigen mathematischen Methoden ausgebildet vorfand.
Versuchen wir nun einen Überblick über die Entwicklung der Mathematik und ihre Bedeutung für das Geistesleben und für den Kulturfortschritt zu gewinnen, so wird sich als leitender Gesichtspunkt der empfehlen, darzulegen, wie an einzelnen wichtigen Problemen die Jahrhunderte sich gemüht haben, und wie nach und nach daraus die einzelnen Disziplinen entstanden sind, die heute den stolzen und weiten Bau dieser Wissenschaft bilden. Dabei ist namentlich für die neuere Zeit eine auch nur angenäherte Vollständigkeit um so weniger zu erreichen, als die Mathematik immer abstrakter geworden ist und sich auf Gebiete ausgedehnt hat, die auch nur andeutungsweise zu berühren sich aus dem Grunde nicht empfiehlt, als dabei höchstens Mißverständnisse bei nicht sachkundigen Lesern entstehen könnten.
Beginnen wir mit der Zahlenlehre, hier haben wir zunächst das Problem der großen Zahlen in Sprache und Schrift, dessen Schwierigkeit jetzt kaum mehr zu ermessen ist. Wenn wie bei den Griechen der ältesten Zeit die 24 Buchstaben des Alphabets zur Bezeichnung der 24 ersten ganzen Zahlen benutzt wurden, so war damit eine natürliche Begrenzung der schriftlichen Festlegung von Zahlen durch Zeichen gegeben; größere Zahlen konnten nur durch Worte schriftlich ausgedrückt werden. Indessen folgte aus der Benennung der Zahlen, die im wesentlichen dekadisch und additiv erfolgte, die Möglichkeit einer analogen Bezeichnung, und es ist beachtenswert, daß diese das Prinzip des Stellenwertes (Positionssystem), das uns so naheliegend erscheint, nicht kennt. Die Zehner und die Hunderte werden durch andre Buchstaben bezeichnet als die entsprechenden Einer, so daß die Griechen, um Zahlen bis zu 999 zu schreiben, 27 Zeichen brauchten, die sie in ihrem Alphabet (unter Zuziehung von 3 im klassischen Griechisch nicht mehr benutzten Buchstaben) vorfanden. Erst für die Tausender kehren die ersten Buchstaben wieder, und zwar mit Index, mit einem links unten angefügten Strich, während bei den Zehntausendern die Abkürzung Μυ des Wortes μυριοι die betreffende Anzahl als Index über dem õ trug.
Daß dies System weiterer Entwicklung fähig war, zeigte Archimedes † 212 v. Chr.) in seiner berühmten Abhandlung von der Sandrechnung; es handelte sich darum, zu berechnen, wieviel Sandkörnchen eine Kugel von 20 000 Erdhalbmessern Radius fasse, wenn 10 000 Sandkörnchen so groß wie ein Mohnkorn seien und der Erdhalbmesser gleich 1 000 000 Stadien angenommen werde. Zur Lösung dieser Aufgabe bildete er zunächst das Quadrat der damals größten Einheit 10 000, also 108und faßte alle Zahlen bis 108als erste Oktade zusammen. Die zweite Oktade ging bis 1016, die achte also z. B. bis 1064, eine Zahl, die bereits größer als die gesuchte Sandeszahl ist. So geht Archimedes weiter; 108 Oktaden bilden dann die erste Periode, die also alle Zahlen von 1 bis 108·10^8 umfaßt. Nun kann man periodenweise weiter fortschreiten. Man sieht, daß hier geometrische Reihen benutzt werden, allerdings nicht in moderner Schreibweise, denn unsere Exponentenbezeichnung ist eine Errungenschaft der neueren Zeit. Erst mit der indischen Erfindung des Zeichens für Null und seiner Benutzung neben nur 9 anderen Zahlenzeichen im Positionssystem war es ohne Schwierigkeit möglich geworden, beliebig große Zahlen nicht nur zu denken, sondern auch zu schreiben. An diesem einfachen Beispiele erkennt man die Wahrheit des berühmten Leibnizschen Ausspruches, daß in der Mathematik eine zweckmäßige Bezeichnung von größter Bedeutung ist.
Wie lange es aber dauerte, bis man alle Vorteile der dekadischen Schreibweise erkannte, erhellt daraus, daß erst gegen das Ende des 16. Jahrhunderts Jobst Bürgi (1552 bis 1632) die Dezimalbrüche einführte. Damit kommen wir zu dem zweiten wichtigen Problem der Arithmetik, zur Erweiterung des Zahlbegriffes. Die erste, schon in ältesten Zeiten als notwendig empfundene Erweiterung der Zahlen erfolgte durch die gemeinen Brüche, deren Begriff bei allen Kulturvölkern nachzuweisen ist. Dem ägyptischen wie später dem griechischen Rechnen eigentümlich ist die als fundamental betrachtete Aufgabe, jeden Bruch in eine Summe von Stammbrüchen aufzulösen, ein höchst umständliches Verfahren; erst mit diesen Stammbrüchen wurde gerechnet. Die Nenner waren fassende Zahlen, über deren Auffindung uns jedoch keinerlei gesicherte Kenntnis aus dem Altertum überkommen ist. Daneben aber bahnte sich ein in der Zeiteinteilung und der Winkelteilung noch heute lebendiges Prinzip an, die Einheit in 60 erste Unterteile ( partes minutae primae), jede dieser »Minuten« abermals in 60 zweite Unterteile ( partes minutae secundae) usw. zu zerlegen, eine Sitte, die, von Babylon ausgehend, sich ungemein lange erhalten hat – finden wir doch in einer nach dem Jahre 1200 erschienenen Schrift des Lionardo pisano (mit dem Beinamen Fibonacci) als Wurzel einer Gleichung, die in unserer Schreibweise x3+2x2+10x = 20 lautet, den Wert x = 1° 22' 7'' 42''' 33IV 4V 38VI 30VII. Ja selbst am Ende des 16. Jahrhunderts wurden solche Sexagesimalbrüche noch gelehrt, wie ein 1592 erschienenes Lehrbuch der Arithmetik beweist. Die Erkenntnis, daß es neben den rationalen Zahlen auch irrationale gibt, stammt aus geometrischen Untersuchungen und geht angeblich auf die Pythagoreer zurück; bekannt ist ferner der von Aristoteles überlieferte Beweis, daß das Verhältnis der Seite zur Diagonale eines Quadrats nicht durch ganze Zahlen darstellbar ist. Damit waren die früher schon in Indien und China bekannten Berechnungen von v2 als notwendigerweise angenähert streng erkannt, aber erst unseren letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten war es vorbehalten, hier Ordnung und Klarheit zu schaffen. Um die Mitte des 1. Jahrhunderts beweist M. Stiefel (1486 bis 1567), daß keine Potenz eines Bruches ganzzahlig sein kann, und führt damit die Wurzeln aus rationalen Zahlen als völlig neue Zahlenart bewußt ein. Um dieselbe Zeit lernt man auch negative Zahlen als Wurzeln von Gleichungen anerkennen, und Cardano (1501 bis 1576) führt sogar Quadratwurzeln aus negativen Größen als zulässige Zahlen in die Rechnung ein. Den wichtigsten Schritt aber tat Vieta (1540 bis 1603), indem er in seinem 1591 gedruckten Werke » in arten analyticam isagoge« neben der Zahlenrechnung ( logistica numerosa) die Buchstabenrechnung ( log. speciosa) einführte. Die Bedeutung der Buchstabenrechnung liegt vor allem darin, daß die Ergebnisse der Rechnung allgemein gültig sind, d. h. daß man in eine fertige Formel, die die Antwort auf eine vorgelegte Frage enthält, beliebige Zahlenwerte einsetzen kann, ohne jedesmal von neuem wieder dieselbe gedankliche Arbeit zu leisten, die eben schon bei der Entwicklung der Formel aufgewendet wurde, ein Vorzug, der, wie schon oben angedeutet, jeder passenden Symbolik eignet. Damit war nun für die Behandlung der Gleichungen freies Feld gewonnen. Jene irrationalen Quadratwurzeln waren Wurzeln binomischer Gleichungen, und ihnen reihten sich die irrationalen Wurzeln der vollständigen Gleichungen an. Daneben hatte man aber schon von anderer Seite her Zahlen kennen gelernt, die man für irrational hielt, z. B. die trigonometrischen Zahlen sin, cos usw. Leibniz reihte diese in eine neue Klasse von Zahlen, er schied die transzendenten von den algebraischen Zahlen. Daß bei jedem Kreise der Umfang zum Durchmesser ein von der Größe des Kreises unabhängiges, also konstantes Verhältnis habe, wußte man schon im Altertum, ebenso daß auch der Kreisinhalt zum Quadrat des Halbmessers dasselbe Verhältnis habe. Aber welcher Art diese später mit dem Buchstaben p bezeichnete Zahl sei, blieb verborgen, bis 1761 J. H. Lambert bewies, daß diese Zahl irrational sei und endlich 1882 Lindemann (geb. 1852) der Nachweis glückte, daß p nicht Wurzel einer algebraischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten sein könne, also eine transzendente Zahl sei. Die Tatsache, daß bei der Auflösung von algebraischen Gleichungen negative Zahlen und sogar Quadratwurzeln aus diesen nötig werden, bewirkte die volle Anerkennung der negativen Zahlen und später auch der imaginären Größen; sie rief die Einführung der komplexen Zahlen hervor, von denen sich dann zeigte, daß sie die allgemeinsten Zahlen sind, die den üblichen Rechengesetzen unterworfen werden können.
Neben diese Entwicklung trat nun schon in alten Zeiten durch die Bedürfnisse des täglichen Lebens zunächst und sodann durch religiöse und mystische Bedürfnisse genährt die Frage nach der Zerlegbarkeit der ganzen Zahlen in Faktoren, nach Beziehungen der ganzen Zahlen untereinander, nach den Primzahlen und ihren Eigenschaften. Den ersten erfolgreichen Vorstoß in neuerer Zeit auf diesem Gebiete verdankt man einem der genialsten Mathematiker, P. Fermat (1601 bis 1665), dessen »großer« Satz, daß die Gleichung xn+yn = zn für n>2 in ganzen Zahlen unlösbar sei, neuerdings eine besondere Berühmtheit erlangt hat. Aber die Schwierigkeit dieser Probleme und zahlreicher anderer, die nur anscheinend einfach sind, hat man erst im letzten Jahrhundert erkannt; ihnen forscht die durch C. F. Gauß (1777 bis 1855) mächtig geförderte Zahlentheorie nach.
Bei der theoretischen Vervollkommnung der in Ägypten und Indien aus praktischen Bedürfnissen herausgewachsenen Geometrie durch die Griechen spielte als ein wichtiger Teil der Planimetrie die Konstruktion von Figuren aus gegebenen Stücken eine besondere Rolle. Dabei bediente man sich als Hilfsmittel vorzugsweise des Lineals und des Zirkels, verwendete daher als geometrische Örter nur gerade Linien und Kreise. Diese Beschränkung durch die technischen Hilfsmittel konnte aber die Geometrie nicht auf die Dauer in Fesseln schlagen. Schon bei den Griechen mußte dies Prinzip gelegentlich zur Lösung einzelner Aufgaben durchbrochen werden, und gerade auch Plato, der Hauptvertreter der Beschränkung auf Lineal und Zirkel, tat dies, um eine eigenartige mechanische Lösung des berühmten delischen Problems der Würfelverdoppelung zu geben. Dieses Problem der Verdoppelung des Würfels stellte mit zwei andern: Quadrierung des Kreises und Dreiteilung eines Winkels, Anforderungen an die Mathematiker von mehr als zwei Jahrtausenden und verknüpfte die Entwicklung der höheren Geometrie mit der elementaren.
Aber auch die Astronomie hat durch die den Menschen so bedeutsam erscheinende Planetenbewegung und die Finsternisse ebenfalls zur Ausbildung der Geometrie erheblich beigetragen. Man suchte, ohne nach dem Grunde der Planetenbewegung zu forschen, zunächst die Frage zu lösen, ob die Bewegung des Mondes und der Planeten überhaupt gesetzmäßig sei, d. h. ob man ein mechanisches Modell dafür finden könne. Die Betrachtung der Bahnen, die die Punkte eines Wagenrades bei dessen Fortbewegung beschreiben, die Zykloiden mit ihren Spitzen und Schleifen führten zur Untersuchung der Bahnlinie eines Kreispunktes, wenn dessen Kreis aus einem andern Kreise rollt, Ptolemäus brachte die Epizyklenlehre am Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zu solcher Vollendung, daß seine Darstellungsweise über ein Jahrtausend zur Berechnung der Planetenbahnen genügte. Sein 250 Jahre früher lebender Vorgänger, Hipparch, hatte den wichtigen Schritt der Einführung von festen Koordinatensystemen getan. Daß diese nur zur Bestimmung der Lage einzelner Punkte auf der Erde und am Himmel dienten, mag hier besonders hervorgehoben werden; für die Geometrie der Kurven waren sie nicht verwendet worden, wennschon Apollonius (250 v. Chr.) bei seiner eingehenden Untersuchung der Kegelschnitte als Schnitte eines Kreiskegels vielfach bestimmte Koordinatensysteme, die der Kurve angepaßt waren, benutzte. Der Grund lag einerseits in dem Mangel einer ausreichenden algebraischen Technik, andrerseits in dem Fehlen eines zwingenden praktischen oder theoretischen Bedürfnisses. Man untersuchte nur Kurven, die geometrisch oder kinematisch in einfacher Weise bestimmt waren. Erst durch die Einführung eines selbständigen Koordinatensystems (Descartes 1596 bis 1650) – Leibniz sagt schon sehr richtig: ... posset aliquis Cartesii analysin etiam Apollonia vindicare, qui rem calculi habebat, calculum ipsum non habebat – war Bahn gebrochen für eine freiere Entwicklung der Mathematik und war vor allem auch ihre Anwendbarkeit auf praktische Probleme ungemein gesteigert, hatte man schon früher, sogar auch bei den Griechen, geometrische Probleme, die auf Gleichungen führten, geometrisch, z. T. sogar durch den Schnitt von Kurven, gelöst, so war jetzt ein Zusammenhang zwischen der neu erfundenen Algebra und der Geometrie hergestellt, der in wenigen Jahrzehnten eine ungeahnte Ausbreitung und Vertiefung der mathematischen Wissenschaften herbeiführte und auch die Möglichkeit ihrer Anwendung auf praktische Probleme erheblich erweiterte. Die erste Aufgabe war nun, die bisher bekannten Kurven analytisch darzustellen, d. h. die zwischen den Koordinaten ihrer Punkte bestehende Gleichung auszusuchen und die geometrischen Eigenschaften der Kurven durch algebraische Operationen aus den Gleichungen zu entwickeln. Die zweite Aufgabe war gerade umgekehrt; man lernte eine Gleichung zwischen zwei Unbekannten x und y ganz anders und viel besser verstehen, indem man die zusammengehörigen Wertpaare x, y als Koordinaten von Punkten der Ebene auffaßte. Man erhielt so als geometrisches Bild der Gleichung, als ihre graphische Darstellung oder ihr Diagramm eine Kurve, Hiermit war aber wieder nach drei Richtungen ein Fortschritt gewonnen. Erstens wurde in dieser so entstandenen analytischen Geometrie die Wissenschaft um eine geradezu unerschöpfliche Menge von Kurven bereichert, die noch dazu nach einem bestimmten Prinzip – nach der Art und nach dem Grade der Gleichung – geordnet waren, und deren Untersuchung in geregelten Bahnen erfolgte. Zweitens wurden die Mathematiker in augenfälliger Weise darauf hingelenkt, die durch eine Gleichung gegebene Abhängigkeit einer veränderlichen Größe von einer andern zu untersuchen. Drittens konnten, wo immer Bewegungsvorgänge an Mechanismen oder bei Naturerscheinungen in gesetzmäßiger Weise auftraten, die dabei beschriebenen Bahnkurven der Punkte der analytischen Behandlung unterworfen werden. Eine nähere Betrachtung dieser soeben angedeuteten Fortschritte der Mathematik nach einzelnen Richtungen hin wird uns einen Überblick über die Weiterentwicklung und einige wichtige dabei auftretende Probleme gewinnen lassen.
Bei der analytischen Betrachtungsweise einer Kurve sind die Koordinaten jedes Punktes der Gleichung der Kurve unterworfen, die Kurve erscheint als geometrischer Ort in dem alten Sinne dieses Wortes. Zwei geometrische Örter, deren Schnittpunkte in endlicher Anzahl die Lösungen einer Konstruktionsaufgabe lieferten, konnten hier also durch zwei Gleichungen zwischen den zwei veränderlichen x und y dargestellt werden. Bildete man daraus durch Elimination von y eine Gleichung für x allein, so boten die Abszissen jener Schnittpunkte die Wurzeln dieser Gleichung. Aber auch umgekehrt konnte man für eine vorgelegte Gleichung mit einer Unbekannten auf mehrfache Weise zwei Gleichungen mit zwei veränderlichen finden, deren geometrische Darstellung Schnittpunkte der eben beschriebenen Art ergab. So war eine allgemeine Methode entdeckt zur Erledigung des für alle Anwendungen höchst wichtigen Problems, eine numerische Gleichung (angenähert) graphisch aufzulösen. Diese vor mehr als zweihundertfünfzig Jahren entdeckte und eifrig benutzte Methode kommt in unseren Tagen in, der Technik wieder zu ausgedehntester Anwendung. – Es lag nahe, die Frage aufzuwerfen, wann man eine vorgelegte Gleichung geometrisch nur mit Lineal und Zirkel lösen könne. Die Antwort darauf hat bereits Descartes selbst gegeben, und die Untersuchungen, die im 19. Jahrhundert wieder prinzipiell aufgenommen wurden, haben festgestellt, daß nur dann Lineal und Zirkel ausreichen, wenn die Gleichung durch quadratische Gleichungen lösbar ist, und daß umgekehrt, wenn ein Problem nur durch Auflösen einer endlichen Anzahl von quadratischen Gleichungen erledigt werden kann, zur geometrischen Lösung nur eine endliche Anzahl von Geraden und Kreisen gezeichnet zu werden braucht. Zusammen mit dem oben erwähnten Lindemannschen Beweis über die Transzendenz der Zahl p ist damit auch das uralte Problem der Quadratur des Kreises endgültig – und zwar negativ – erledigt.
Bei der Kurvenuntersuchung gab es von jeher vier fundamentale Probleme, die Feststellung der Gestalt einer konstruktiv, kinematisch, oder durch eine Gleichung gegebenen Kurve, die Konstruktion der Tangente an einen beliebigen Punkt, die Berechnung der Bogenlänge ( Rektifikation) und die Ermittlung des Inhaltes der von der Kurve oder von einem Bogen und einigen Strecken begrenzten Fläche (Quadratur). Für diese Probleme, die stets an jeder Kurve einzeln studiert zu werden pflegten, eine allgemeine Methode entdeckt zu haben, ist die Leistung eines ganz besonders auf mathematischem Gebiete schöpferischen Genies ersten Ranges, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 bis 1716).
Leibniz war zweifellos der erste, der das Tangentenproblem in der uns jetzt geläufigen Form rein analytisch anfaßte, der erste auch, der den für die Folgezeit wichtigsten Begriff der
Funktion bildete (ja sogar das Wort Funktion rührt von ihm her). Der Begriff der Abhängigkeit einer Größe von einer andern war keineswegs neu; kannte man doch schon im Altertum die einfachsten Beziehungen dieser Art, das gerade und das umgekehrte Verhältnis. An einem klaren Erfassen der allgemeinen Bedeutung hinderte die Notwendigkeit, derartige Beziehungen in Form von Proportionen zu denken und zu schreiben. Wenn man z. B. die Tatsache des umgekehrten Verhältnisses zweier Größen durch die
Proportion y1:y2 = x2:x1 ausdrückt, so nimmt man zwei bestimmte Werte y1 und y2 der einen Größe und schreibt hin, daß diese sich umgekehrt wie die zugehörigen Werte der andern verhalten. Drückt man aber dieselbe Tatsache durch die Gleichung y = a/x aus, so kann man aus dieser Gleichung sofort auch jene Proportion bilden; die Gleichung aber gibt viel mehr, sie gibt uns gewissermaßen
in nuce die ganze Tabelle der unendlich vielen Wertpaare x, y. Wir können vor allem die Größe x, die unabhängige Variable, sich stetig ändern, alle Werte zwischen beliebigen Grenzen durchlaufen lassen und sehen dann, daß auch y, die abhängige Variable, in bestimmter Weise alle Werte zwischen zwei Grenzen durchläuft. Zudem haben wir in der graphischen Darstellung nach Descartes ein geometrisches Bild dieser ununterbrochenen Reihe von Wertpaaren; durchläuft ein Punkt die durch obige Gleichung gegebene Hyperbel, so bewegen sich die durch die zugehörigen Werte von x und y auf den beiden Achsen bestimmten Punkte in gewisser Weise mit. Von diesen drei Bewegungen ist nur eine willkürlich, die andern beiden sind dadurch bestimmt. Läßt man also die Größe x um einen kleinen Betrag zunehmen, so ändert sich auch y um einen gewissen Betrag, der um so kleiner ist, je kleiner die Änderung von x war; gleichzeitig verschiebt sich aber auch der zugehörige Kurvenpunkt um ein kleines Stück. Man bemerkte bald, daß sich die Verbindungslinie der beiden »benachbarten« Kurvenpunkte um so mehr der Kurventangente näherte, je kleiner die Zunahme von x war, und daß dann das Verhältnis jener kleinen Änderungen von x und y um so angenäherter die Richtung der Tangente bestimmte. Leibniz behandelte nun diese aus geometrischen Überlegungen bekannten Tatsachen prinzipiell und rein analytisch und bestimmte für
die einfachen algebraischen und transzendenten Funktionen den
Grenzwert, dem der Quotient jener beiden Änderungen von x und y zustrebt, wenn die Änderungen beliebig klein werden. Dazu schuf er eine eigene neue Bezeichnungsweise, die sich bald als ungemein zweckmäßig erwies und sich ebenso erhalten hat wie der Name
Differentialrechnung, den er selbst seiner Erfindung gab. Auch das umgekehrte Problem löste Leibniz, wenn von einer gesuchten Kurve die Tangentengleichung bekannt ist, diese Kurve zu bestimmen. Er wies nach, daß diese Aufgabe identisch ist mit der Aufgabe, den Flächeninhalt einer gegebenen Kurve zu berechnen; ja, er erdachte sogar einen
Mechanismus, der es gestattete, diese
Integration graphisch auszuführen, die Integralkurve zu zeichnen, eine Aufgabe, die erst in den letzten Jahrzehnten durch die modernen
Integraphen befriedigend gelöst ist. Daß man die Quadratur von Kurven wie auch die Ermittlung der Oberfläche und des Rauminhaltes gesetzmäßig gestalteter Körper sowie Momente, Schwerpunkte usw. durch Zerlegung in unendlich viele Teile und deren Summierung finden könne, war bereits im Altertum bekannt und wurde namentlich von
Archimedes unter gewissen
Vorsichtsmaßregeln ausgeführt; aber erst seit dem Ende des 16. Jahrhunderts wendeten sich die Mathematiker wieder diesem Problem zu. Es seien hier besonders
Kepler (1571 bis 1630) und
Cavalieri (1591 bis 1647) genannt, dessen Methode mit einer nicht unwesentlichen Vervollständigung in die elementare Stereometrie aufgenommen worden ist. Den Begriff des Integrals macht man sich am einfachsten klar, wenn man (s. Fig.) zu einer gegebenen Kurve y = f(x) eine innere und eine äußere Treppe von gleicher Stufenbreite zeichnet. Die beiden dadurch entstehenden Rechtecksummen, deren Differenz das schraffierte Rechteck von gleicher Breite ist, geben eine untere und eine obere Grenze der gesuchten Fläche, die von der Kurve, den beiden Ordinaten f(a) und f(b) und dem zwischen ihnen liegenden Teile der x-Achse umschlossen wird. Je kleiner die Stufenbreite genommen wird, desto geringer wird der Unterschied der beiden Summen. Leibniz nennt die Stufenbreite dx, wörtlich: das
Differential von x; die Fläche eines Streifens ist dann y·dx oder f(x)·dx, und er schreibt nun die Summe
![]() .
.
Auch hier handelt es sich, wie bei der Bildung des Differentialquotienten, um einen Grenzprozeß: Das Integral stellt den Grenzwert dar, dem sich jene Summe immer mehr nähert, je kleiner man die Stufenbreite nimmt. Die Herstellung und Berechnung solcher Integrale bildet den Inhalt der Integralrechnung. Betrachtet man den Bogen einer Kurve als Grenze eines Tangentenpolygons, so sieht man ein, daß auch die Berechnung der Bogenlänge eine Aufgabe der Integralrechnung ist. Beide, die Differential- und die Integralrechnung, bilden zusammen die Infinitesimalrechnung, die es also im wesentlichen mit der Ermittelung von Grenzwerten zu tun hat und feststellt, wie man mit solchen – früher unbekannten oder gemiedenen – Grenzwerten zu rechnen hat. Der Erfassung dieser Begriffe, der Erkenntnis ihrer fundamentalen Wichtigkeit für viele Gebiete der Mathematik, der Naturforschung und der Philosophie gilt das heiße Bemühen des ganzen 17. Jahrhunderts, das man als das Jahrhundert der Renaissance der Mathematik bezeichnet hat. Von allen Seiten tauchten Probleme auf, deren mathematischer Ansatz und deren völlige Durchführung nun ermöglicht war, vor allem Probleme der Mechanik.
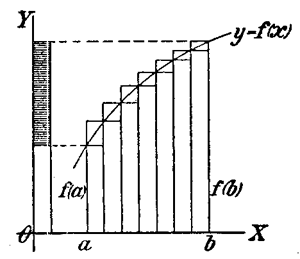
Während im Altertum nur die Bedingungen des Gleichgewichtes an den einfachen Maschinen untersucht werden konnten ( Statik), waren zuerst durch die Scholastiker, dann aber vor allem durch Galilei (1564 bis 1642) auch Bewegungsvorgänge betrachtet und ihr zeitlicher Verlauf studiert worden ( Dynamik); die Zeit erhielt damit die Rolle einer veränderlichen, in die Rechnungen einführbaren Größe, und naturgemäß war die Zeit die unabhängige Veränderliche. Das Hauptverdienst gebührt hier dem ebenbürtigen Nebenbuhler Leibnizens, dem englischen Mathematiker Newton (1642 bis 1727), der Jahrzehnte vor Leibniz schon für sich die wesentlichen Probleme der Infinitesimalrechnung gelöst hatte. Er schuf in seinem berühmten Werke Philosophiae naturalis principia mathematica (1686) von Grund aus ein großartiges Lehrgebäude der theoretischen Mechanik. Newton sagt selbst in der Vorrede zur ersten Auflage dieses stets lesenswerten Buches:
Die theoretische Mechanik ist die genau dargestellte und erwiesene Wissenschaft, die von den aus gewissen Kräften hervorgehenden Bewegungen und umgekehrt von den zu gewissen Bewegungen erforderlichen Kräften handelt ... Wir betrachten hauptsächlich diejenigen Umstände, die sich auf Schwere und Leichtigkeit, auf die Kraft der Elastizität und den Widerstand der Flüssigkeiten und auf andere derartige anziehende oder bewegende Kräfte beziehen, und stellen daher unsere Betrachtungen als mathematische Prinzipien der Naturlehre auf. Alle Schwierigkeit der Physik scheint nämlich darin zu bestehen, aus den Erscheinungen der Bewegung die Kräfte der Natur zu erforschen und hierauf durch diese Kräfte die übrigen Erscheinungen zu erklären. Hierzu dienen die allgemeinen Sätze, die im ersten und zweiten Buche behandelt werden. Im dritten Buche haben wir zu deren Anwendung das Weltsystem erklärt. Dort wird nämlich aus den Erscheinungen am Himmel mit Hilfe der in den ersten Büchern mathematisch bewiesenen Sätze die Schwerkraft abgeleitet, vermöge der sich die Körper den einzelnen Planeten und der Sonne zu nähern streben. Aus derselben Kraft werden dann, gleichfalls durch mathematische Sätze, die Bewegungen der Planeten, Kometen, des Mondes und des Meeres abgeleitet.
Möchte es gelingen, die übrigen Erscheinungen der Natur ebenso aus mathematischen Prinzipien abzuleiten! Viele Gründe lassen mich vermuten, daß alle Naturerscheinungen von gewissen Kräften abhängen können. Durch diese werden die Teilchen der Körper nämlich aus noch unbekannten Ursachen entweder gegeneinandergetrieben und hängen alsdann als reguläre Körper zusammen, oder sie weichen voneinander zurück und fliehen sich. Bis jetzt haben die Physiker es vergebens versucht, die Natur durch diese unbekannten Kräfte zu erklären; ich hoffe jedoch, daß die hier aufgestellten Prinzipien entweder über dieses oder irgendein richtigeres Verfahren Licht verbreiten werden.
Herrlich ist die Saat aufgegangen, die die drei großen Männer Galilei, Leibniz und Newton ausgestreut haben. Es hat sich in der Tat gezeigt, daß der von Galilei beschrittene Weg der messenden Beobachtung zusammen mit den von Newton aufgestellten mathematischen Prinzipien der Mechanik und der von Leibniz entdeckten infinitesimalen Analysis geeignet ist, die Naturerscheinungen richtig darzustellen und Hypothesen über das Wesen derselben, über die zugrunde liegenden Ursachen auszuarbeiten. Stellt man den Weg eines Punktes als Funktion der Zeit dar, so wird die Geschwindigkeit der erste Differentialquotient des Weges nach der Zeit, und die Beschleunigung wird gleich dem zweiten Differentialquotienten des Weges nach der Zeit. Da man nun seit Newton die Kraft als Produkt aus Masse und Beschleunigung definiert, so erkennt man, daß bei gegebener Kraft eine Gleichung für jenen zweiten Differentialquotienten vorliegt, deren Lösung (Integration) ein rein mathematisches Problem ist. Wie in der Astronomie die Bewegung der Planeten um die Sonne, so führen auch die Probleme der Wärmelehre, der Akustik, Optik, Elektrodynamik usw. auf solche Differentialgleichungen. Ein berühmtes Beispiel dafür bieten die Differentialgleichungen Maxwells (1831 bis 1879), aus denen theoretisch die mit der Lichtgeschwindigkeit übereinstimmende Fortpflanzungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Gleichgewichtsstörungen folgte. 20 Jahre später hatte Heinrich Hertz (1857 bis 1894) den kühnen Gedanken, der Theorie Maxwells experimentell näher zu treten – und es war eine wissenschaftliche Tat ersten Ranges, als es ihm gelang, die Bedingungen aufzudecken, unter denen eine volle Bestätigung jener Theorie möglich ist. Hertz legte damit den Grund zu der heute immer wichtiger werdenden Telegraphie ohne Draht. In unsern Tagen richten sich die Bemühungen einer großen Anzahl von theoretischen Physikern darauf, dem Rätsel der Schwerkraft näher zu kommen.
Wir haben oben auf eine Methode hingewiesen, angenähert Wurzeln einer gegebenen Gleichung durch den Schnitt zweier Kurven zu finden (von denen die eine übrigens auch die x-Achse sein kann); man erhält so naturgemäß nur reelle Wurzeln einer Gleichung. Daß es auch komplexe Wurzeln geben könne, und daß eine algebraische Gleichung nten Grads nicht mehr als n Wurzeln hat, war schon zu Leibnizens Zeiten bekannt. Ob aber jede beliebige algebraische Gleichung überhaupt Wurzeln habe, das Existenztheorem der Wurzeln, der sog. Fundamentalsatz der Algebra, war noch nicht bewiesen; Leibniz selbst war der Meinung, daß es wurzellose Gleichungen gäbe. Die volle Aufklärung brachte hier der größte Mathematiker aller Zeiten, Karl Friedrich Gauß, der zuerst streng nachwies, daß jede Gleichung nten Grades n Wurzeln hat. Die Ermöglichung erwuchs aus der Funktionentheorie. Damit war aber nicht gezeigt, wie man allgemein aus den Koeffizienten einer algebraischen Gleichung diejenigen Werte der Unbekannten finden könne, die ihr genügen, welche Funktionen der Koeffizienten also die Wurzeln der Gleichung seien. Von der Mitte des 16. Jahrhunderts an wußte man, daß die allgemeinen Gleichungen des zweiten, dritten und vierten Grades » algebraisch lösbar« seien, d. h. daß man zur Berechnung ihrer Wurzeln nur Wurzelausziehungen nötig habe. Den Bemühungen, die allgemeine Gleichung fünften Grades durch ebensolche elementare Methoden zu lösen, setzte Abel (1802 bis 1829) ein Ende durch den Nachweis, daß keine allgemeine Gleichung von höherem als dem vierten Grade durch eine endliche Anzahl von Wurzelziehungen gelöst werden kann. Da aber die Existenz der Wurzeln feststeht, so handelt es sich nun darum, die allgemeine Gleichung nten Grades auf die einfachste Form (Normalform) zu bringen und dann diejenigen transzendenten Funktionen zu studieren, die als deren Wurzeln definiert sind. Für n = 5 ist diese Aufgabe zuerst von Hermite (1822 bis 1901) gelöst, später in anschaulicher und zugleich systematischer Weise von Felix Klein (geb. 1849), der auch einen Weg gezeigt hat, die Gleichungen 6. und 7. Grades zu bewältigen. Hier spielt der fundamentale Begriff der Gruppe eine entscheidende Rolle, dessen Wesen und weitgreifende Bedeutung hier allerdings nicht erläutert werden kann.
Welche Funktionen hatte man im Laufe der Jahrhunderte kennen gelernt oder genauer umgrenzt, welche Beziehungen zwischen Zahlenwerten fanden die Mathematiker des 17. und 18. Jahrhunderts vor, als sie anfingen, den Begriff der Funktion zu bilden und zu verwerten? In unserer heutigen Ausdrucksweise waren es die einfacheren algebraischen Funktionen, die Exponentialfunktion, der Logarithmus, die trigonometrischen und die zyklometrischen Funktionen. Unter ihnen haben die trigonometrischen Funktionen die längste Geschichte, und, da sie allgemeiner bekannt sind, so mag auf sie näher eingegangen werden. Die ersten Anfänge finden wir bei Mathematikern des Altertums, bei Hipparch, Menelaos (100 n. Chr.) und Ptolemäus. Man hatte schon längst bemerkt, daß ein Kreisbogen dem Mittelpunktswinkel proportional ist; das Verdienst jener drei Männer bestand nun darin, daß sie die Beziehungen von Winkeln zu ihren Sehnen numerisch feststellten und Sehnentafeln berechneten. Natürlich war dies nicht von vornherein für einen beliebigen Winkel, sondern zunächst nur für die mit Zirkel und Lineal herstellbaren möglich. Ptolemäus gelang es aber doch schon, durch eine Grenzeinschließung die Sehne von 1° in Teilen des Radius auszudrücken und mit Hilfe des nach ihm benannten Lehrsatzes und anderer einfacher Beziehungen sowie unter Benutzung von Interpolationen eine bei seinen praktischen Anwendungen völlig ausreichende Sehnentafel für alle halben Grade herzustellen. Die praktischen Anwendungen bezogen sich nicht so sehr auf die ebene, als auf die sphärische Trigonometrie, deren man dringend zu astronomischen Rechnungen bedurfte. Erst im 6. Jahrhundert n. Chr. taucht in Indien die halbe Sehne des doppelten Winkels, also der Sinus als Strecke auf. Weitere Entwicklung fand die sphärische Trigonometrie bei den Arabern, deren Astronomen die religiös wichtige Aufgabe oblag, an jedem Orte die Richtung nach Mekka festzustellen, und so finden wir denn um das Jahr 900 eine für halbe Grade fortschreitende Sinustabelle und bald darauf auch Tabellen für Tangens und Kotangens. Aber erst im 13. Jahrhundert fand die Trigonometrie eine Bearbeitung als mathematischer Wissenszweig für sich, während sie bisher nur als Hilfsmittel der rechnenden Astronomie nebenbei entwickelt worden war. Hervorragend förderte die Trigonometrie dann Johann Müller aus Königsberg in Franken ( Regiomontanus 1436 bis 1476), der den Radius des Kreises gleich 107 Einheiten setzte; durch seine Tafeln, in denen die Winkel nach Minuten fortschreiten, war für Dreiecksberechnungen in der Ebene und auf der Kugel ein wesentlicher Fortschritt erzielt. Nach mancherlei goniometrischen Ansätzen schuf dann Vieta gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Goniometrie. So ausgerüstet vermochte man mit besserem Erfolge als früher die Vermessung von Ländern vorzunehmen, die Triangulation, da man nicht von Längenmessungen allein abhängig war, sondern die gemessenen Winkel zur Berechnung von Strecken, zur Feststellung der Lage ausgezeichneter Geländepunkte verwenden konnte.
Aber neben der Erdmessung galt es noch eine zweite Aufgabe zu lösen, die wichtig und wesentlich zu allen Zeiten gewesen ist und deren eigentümliche Schwierigkeiten nur teilweise überwunden werden können, die Darstellung der Erdoberfläche durch Karten. Solange man die Erde als ebene Scheibe ansah, war die Sache verhältnismäßig einfach, und sie ist es auch heute noch, solange es sich nur um ein kleines Gebiet handelt. Vergleicht man aber die aus früheren Zeiten auf uns gekommenen Karten der Grenzländer des Mittelmeeres mit den heutigen Darstellungen, so erkennt man den gewaltigen Unterschied. Die Erdoberfläche, als Oberfläche eines kugelförmigen Körpers, läßt sich nicht völlig treu auf eine Ebene abbilden, man mußte sich also entschließen, die vollkommene Ähnlichkeit des Kartenbildes mit der Wirklichkeit aufzugeben. Schon im Altertum hatte Hipparch (zwischen 161 und 126 v. Chr.) gezeigt, daß man eine geeignete Abbildung einer Kugel auf eine Ebene durch Projektion von einem Punkte der Kugeloberfläche aus leisten könne, wenn der von jenem Punkte ausgehende Durchmesser auf der Ebene senkrecht steht. Die besondere Eigenschaft dieser stereographischen Projektion beruht darauf, daß Kreise der Kugel auch in der Ebene Kreise werden und daß die Bilder irgend zweier Linien der Kugeloberfläche sich unter denselben Winkeln schneiden. Eine solche Abbildung nennt man winkeltreu oder konform, sie ist dem Original »in den kleinsten Teilen ähnlich«. Die Aufgabe nun, in allen Fällen die geeignete Abbildung von Teilen der Erdoberfläche auf eine Ebene zu finden, ist ein rein theoretisches Problem der Mathematik, das vielfache Lösungen gefunden hat; jeder Atlas zeigt in seinen Karten, namentlich denen größerer Bereiche der Erde, eine reiche Mannigfaltigkeit von Projektionsmethoden. Dieses Problem der Abbildung nun führte zu wichtigen Ergebnissen, als man es allgemeiner auffaßte und Abbildungen zweier Ebenen sowie auch anderer Flächen aufeinander studierte; es führte zu wichtigen geometrischen Sätzen und diente vor allem auch der Förderung der Funktionentheorie, besonders nachdem Euler (1707 bis 1783) die komplexen Zahlen in diese Theorie eingeführt hatte.
Waren es bisher immer Flächen, die auf Flächen abgebildet werden sollten, so lenken wir nun unsere Aufmerksamkeit darauf, daß körperliche Figuren, Raumgebilde auf einer Ebene abzubilden, ein uraltes Problem der Menschheit ist. Die Steinzeitleute und Höhlenbewohner, die die Gewölbe und Wände ihrer Behausungen vor vielleicht 20 000 Jahren mit Bildern aus ihrer Tierwelt, mit Darstellungen aus ihrem Leben schmückten, sie taten das naiv und doch treffend. Als man aber später, namentlich zu architektonischen Zwecken, genauere Darstellungen verlangen mußte, konnte die naive Zeichnung nicht mehr genügen, man mußte die mathematischen Gesetze der Projektion auffinden. Vitruv (unter Augustus und Tiberius) benutzte bereits Grundriß und Aufriß in Parallelprojektion sowie einfache Fälle der Zentralprojektion; er war damit für Jahrhunderte der Lehrmeister, denn erst im Mittelalter wurden die Methoden der Parallelprojektion und der Zentralperspektive weiter ausgebildet. Als Wissenschaft erstand aber die darstellende Geometrie unter den Händen von Monge (1746 bis 1818), und sie hat sich als mathematische Disziplin im 19. Jahrhundert die Schulen erobert. Nebenbei mag erwähnt sein, daß auch die Reliefperspektive eine mathematische Behandlung erfahren hat. Die wissenschaftliche Bearbeitung der Projektionsmethoden förderte aber nicht nur die Praxis des Zeichnens, sondern sie gab den Anstoß zu weitreichenden geometrischen Untersuchungen. Schon in der Planimetrie kannte man die Begriffe der Kongruenz und der Ähnlichkeit – beide lassen sich unter dem Begriffe der Abbildung vereinigen, und beide lassen sich durch Projektion erzeugen. Projizieren wir nämlich die Figuren einer Ebene auf eine parallele Ebene aus einem im Unendlichen oder im Endlichen gelegenen Punkte, so erhalten wir ein kongruentes oder ein ähnliches Bild. Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung der darstellenden Geometrie stellte es sich heraus, daß auch die Projektion der Figuren einer Ebene auf eine sie schneidende Ebene genauerer Untersuchung wert sei. Die dadurch erhaltenen Bilder nannte man affin oder perspektiv, je nachdem das Projektionszentrum im Unendlichen oder im Endlichen liegt. So kann man also auch auf konstruktivem Wege die Abbildung einer Ebene auf eine andere bewirken und untersuchen; von hier aus eröffnete sich ein Weg mit ganz neuen geometrischen Betrachtungen zur Geometrie der Lage, einer Schöpfung des 19. Jahrhunderts. Eng mit der Ausbildung der Geometrie der Lage hängen zwei andere Disziplinen zusammen, die Graphostatik und die Kinematik. In der ersteren werden die Zug-, Druck- und Torsionskräfte und die durch sie bedingten Formänderungen an Stäben, die äußeren Kräften unterworfen sind, graphisch behandelt. In der Kinematik werden die Bewegungsmechanismen geometrisch untersucht; es wird festgestellt, welche Linien die einzelnen Punkte eines mit Gelenken versehenen Mechanismus bei seiner Bewegung beschreiben, und welche Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eintreten, wenn ein Teil des Mechanismus eine vorgeschriebene Bewegung ausführt. Demnächst aber ist es auch eine Aufgabe der Kinematik, Mechanismen zu konstruieren, mit denen vorgeschriebene Bewegungen ausgeführt werden können; es sei hier nur das wichtige Problem der Geradführung erwähnt. Man erkennt daraus, daß die Geschichte der Kinematik bis in sehr alte Zeiten zurückreicht, und versteht, daß die Wissenschaft erst im Zeitalter der Maschine ihre volle Bedeutung erlangen konnte. Eine besondere Erwähnung verdienen hier noch diejenigen Mechanismen, die man namentlich in neuerer Zeit konstruiert hat, um gewisse Rechnungen mechanisch ausführen zu können. Die Rechenmaschinen, deren erste von Leibniz herrührt, dienen dazu, die elementaren Operationen der vier Spezies und die Ausziehung von Quadratwurzeln zu ermöglichen; daneben tritt für angenäherte Rechnungen der logarithmische Rechenschieber. Zur Ausmessung der Inhalte beliebig gezeichneter Flächenstücke der Ebene (und der Kugel) hat man Planimeter hergestellt; umfährt man mit einem dazu angebrachten Stifte den Umriß der Fläche, so kann man an einer beweglichen Rolle den Inhalt der Fläche ablesen. Noch weitergehende Aufgaben bewältigen die schon oben erwähnten Integraphen. Der Untersuchung willkürlicher, graphisch gegebener Kurven, wie sie z. B. von den Barographen aufgezeichnet werden, dienen die harmonischen Analysatoren.
Betrachten wir nun nach diesem gedrängten und notwendigerweise lückenhaften Überblick noch kurz die Bedeutung der Mathematik für unsere Kultur. Weshalb lernt man die Anfangsgründe dieser Wissenschaft auf allen Schulen? Zunächst sind es praktische Erwägungen, die die Notwendigkeit des Rechnens fordern und die Kenntnis der Inhaltsbestimmungen von einfachen Flächen und Körpern als wünschenswert erscheinen lassen. Über diesen primitivsten Standpunkt erheben sich einige Fachschulen, in denen auch trigonometrische Kenntnisse, die für den späteren Beruf unentbehrlich sind, erworben werden. Ähnliche Erwägungen praktischer Bedürfnisse kann man auch für den weitergehenden Betrieb an unseren höheren Schulen geltend machen. Aber man würde völlig fehl gehen, wenn man darauf allein die Berechtigung eines ausgedehnten Unterrichts in der Mathematik gründen wollte, man käme da zu einem unfruchtbaren Dilettantismus, und man würde der irrigen Meinung Vorschub leisten, daß der eigentliche Zweck der Mathematik die Gewinnung praktisch brauchbarer Formeln sei, eine Meinung, die allerdings vielfach noch verbreitet ist. Die Mathematik soll an den höheren Schulen als Erziehungsmittel, als Mittel zur allgemeinen Bildung getrieben werden. Die Mathematik ist, wie keine zweite Wissenschaft, geeignet, zu einer freien schöpferischen Verstandesbildung beizutragen. »Wer den Beweis eines Satzes verstanden hat,« sagt A. Voß, »hat damit die Überzeugung gewonnen, eine Wahrheit auf Grund eigener Arbeit erfaßt zu haben ... Durch einen mathematischen Beweis wird aber nicht nur das sichere Bewußtsein, daß man durch Denken Wahrheit finden könne, geweckt, sondern auch das Selbstvertrauen zum eigenen Verstand, die kritische Urteilskraft, die den wahrhaft Gebildeten von dem im bloßen Autoritätsglauben Befangenen unterscheidet. Diese Fähigkeit herauszubilden, ist wohl das höchste Ziel, das sich die Erziehung des jugendlichen Geistes stellen kann. – Und das nicht allein ... In der Mathematik weckt jede erkannte Wahrheit, jede gelöste Aufgabe, sofort die schöpferische Phantasie, die sie entweder zu erweitern oder ihren noch verborgenen Zusammenhang mit anderen Wahrheiten aufzufinden strebt. Das ist jenes unbeschreiblich hohe Gefühl, das jeder empfindet, der zum ersten Male die Selbständigkeit seines eigenen Geistes in der freien wissenschaftlichen Arbeit erkennt, der seine schöpferische Kombinationsgabe mit jedem erfolgreichen Schritte wachsen sieht.« So hat die Mathematik nicht nur Erkenntniswerte, sondern auch Erziehungswerte höchsten Ranges. Und wenn in jeder Disziplin nur so viel wahre Wissenschaft steckt, als Mathematik in ihr enthalten ist, so soll der mathematische Unterricht an den höheren Schulen dazu erziehen, die Umwelt und ihr Geschehen in der besonderen Art aufzufassen und verstehen zu suchen, die aus dem Wesen der Mathematik entspringt.
In der Tat sehen wir vor allem in unseren Tagen, daß fast alle Wissenschaften auf die Hilfe der Mathematik angewiesen sind, daß fast alle durch mathematische Untersuchungen auf einzelnen Gebieten wesentliche Fortschritte gemacht haben. Für die Physik und Astronomie braucht das nicht nochmals ausgeführt zu werden, ebenso hat die Chemie ihre große Erweiterung durch die physikalische Chemie nur mit Hilfe der Mathematik gewinnen können. Aber auch den sogenannten beschreibenden Naturwissenschaften, den biologischen sowohl wie auch der Mineralogie (Kristallographie) und der Geologie (Erforschung des Erdinnern), sind neue Erkenntnisse und neue Forschungsmethoden durch mathematisch-physikalische Methoden gewonnen worden. Daß auch die Medizin ohne gründliche mathematische Kenntnisse nicht mehr möglich ist, bezeugt Fr. v. Müller in München durch eine in den Abhandlungen des Deutschen Ausschusses für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht veröffentlichte Arbeit. Für die Technik im weitesten Sinne versteht sich die Notwendigkeit gründlicher mathematischer Bildung von selbst. Die Bedeutung der Mathematik für unser soziales Leben kommt in besonders hohem Maße zum Ausdruck in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und in der Kollektivmaßlehre mit ihren Anwendungen auf die Statistik, die Nationalökonomie und das Versicherungswesen. Aber noch ein großes, bisher nicht berührtes Wissenschaftsgebiet gibt es, das seit den ältesten Zeiten mit der Mathematik gleichsam verbündet ist und dessen Abkehrung von dieser natürlichen Grundlage stets verderblich war, die Philosophie. Eine stolze Reihe von Thales, Pythagoras, den Eleaten, Plato, Aristoteles, N. Cusanus, Descartes, Spinoza, Hobbes, Locke, Leibniz bis auf Kant ist es, aus deren Werken dieser Zusammenhang, die Unentbehrlichkeit der Mathematik für die Philosophie klar hervorgeht. Und in der Gegenwart? »Das Schicksal und die Zukunft der kritischen Philosophie«, sagt E. Kassirer, »wird durch das Verhältnis zu den exakten Wissenschaften bedingt. Wenn es gelänge, das Band zwischen ihr und der Mathematik und der mathematischen Physik zu durchschneiden, so wäre sie damit ihres Inhaltes und ihres Wertes beraubt.«
Auch die Mathematik selbst hat tiefe philosophische Probleme zu erledigen, die sich auf die Grundlagen ihrer einzelnen Disziplinen beziehen. In der Geschichte der mathematischen Wissenschaften ist ein interessantes Wechselspiel zu beobachten. Irgendeine schwierige theoretische oder praktische Frage läßt ein Problem entstehen, das meist zuerst noch nicht in voller Klarheit erkannt ist, das aber einen lebhaften Wettstreit der Mathematiker – manchmal jahrhundertelang – entfesselt und auf solche Weise die Wissenschaft und die Praxis mit einer Fülle von Tatsachen, mit einer Menge von neuen Methoden bereichert. Es entsteht so ein ganzer Komplex von Problemen, oftmals ein neuer Wissenszweig. Hat dieser einen gewissen befriedigenden Umfang angenommen, so beginnt man mit einer möglichst einwandfreien Darstellung. Da nun die auftretenden Lehrsätze bewiesen werden müssen, d. h. auf einfachere Sätze zurückzuführen sind, so ergibt sich sofort, daß man schließlich auf gewisse einfachste Sätze als auf die Grundlagen des Wissenszweiges, auf seine Axiome und Definitionen kommen muß. Die Untersuchung solcher Grundlagen ist meist sehr schwierig; es handelt sich darum, ein widerspruchsfreies und vollständiges System von Definitionen und Axiomen aufzustellen, das jedoch auch nichts Überflüssiges in diesen enthält. So gehen die Bemühungen z. B. dahin, den Zahlbegriff, die Grundlage der Arithmetik, genau zu umgrenzen, wobei die irrationalen Zahlen die heikelste Stelle einnehmen. So sind ferner die Grundlagen der Infinitesimalrechnung der Gegenstand lang andauernder Untersuchung gewesen. Das berühmteste Beispiel bildeten jedoch die Grundlagen der Geometrie. Nachdem Euklid die Grundlagen in einer für viele Jahrhunderte mustergültigen und unbezweifelten Form gelegt hatte, war man gegen Ende des 18. und im 19. Jahrhundert daran gegangen zu untersuchen, ob das von ihm aufgestellte System von Definitionen und Axiomen die notwendige und hinreichende Grundlage der Geometrie bilde. Man hat hierbei erkannt, daß beispielsweise eine logisch einwandfreie Geometrie geschaffen werden kann, wenn man das sogenannte Parallelenaxiom Euklids fallen läßt, wenn man also annimmt, daß durch einen Punkt zu einer Geraden nicht nur eine, sondern unendlich viele, nichtschneidende Geraden, die in einem äußerst schmalen Büschel laufen, gezogen werden können. Die auf dieser Grundlage gewonnenen Lehrsätze bilden die nicht-euklidische Geometrie.
![]()
Aus kleinen Anfängen, aus der Not des täglichen Lebens heraus, haben sich die mathematischen Disziplinen erhoben, sie sind Wissenschaften geworden mit dem sicheren Boden, den genau untersuchte Grundlagen geben. Die strenge und exakte Denk- und Schlußweise, die Auffassung der funktionalen Abhängigkeit und deren graphische Darstellung, die Prinzipien zumal der Infinitesimalrechnung sind Errungenschaften, die unser ganzes Kulturleben durchdringen und von ihm unzertrennlich sind, ja denen der Hauptteil des technischen Kulturfortschritts zu danken ist. So ist die Mathematik wieder wie zu Zeiten der Akademie Platos die unentbehrliche und wichtigste Grundlage unserer Geistesbildung und unserer Kultur geworden, und dies erklärt auch die in vergangenen Jahrzehnten nicht geahnte Bedeutung der Mathematik für die Erziehung der Jugend, eine Bedeutung, die ihr erhalten bleiben wird, ja die noch wachsen muß, wenn die Unterweisung in der Mathematik sich von vornherein den Anforderungen der Gegenwart anpaßt. Inzwischen haben neuerdings Mathematiker durch ihre mit durchdringendem Verstande gepaarte Phantasie neue, weite Gebiete der mathematischen Forschung erschlossen, physikalische Untersuchungen insbesondere auf dem Gebiete der Elektrodynamik und technische Unternehmungen, z. B. auf dem Gebiete der Luftschiffahrt, haben ganz neue, eigenartige Probleme veranlaßt, die nur durch mathematische Behandlung abschließend gelöst werden können, so daß die Zukunft der Mathematik auch in dieser Beziehung in hohem Maße erfreulich und fruchtbringend erscheint.