
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mit Frau Benedikta war in der Stille ihres Turmes, unter den alten Folianten, die ihre ganze Gesellschaft bildeten, eine große Wandlung vorgegangen.
Eines Tages fiel ihr ein kleines, vergriffenes Büchelchen in die Hand, die heiligen Schriften des Neuen Testaments.
Die Nonnen hatten nur einen Auszug der Heiligen Schrift in Gebrauch, und Frau Benedikta begann in dem kleinen Buch zu blättern. Da fielen ihr da und dort feine rote Bleistiftstriche auf, die sich durch das ganze Neue Testament hinzogen.
Wessen Hand mochte diese Stellen angestrichen haben?
Frau Benedikta begann eine der bezeichneten Stellen zu lesen:
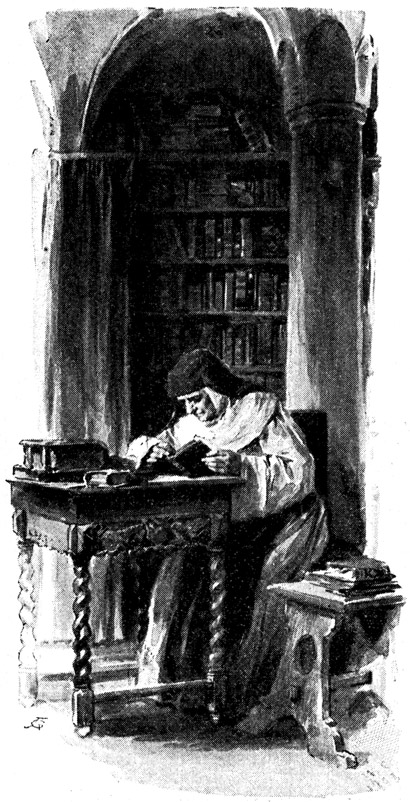
»Denn sie binden schwere, unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie aber wollen dieselben nicht mit ihrem Finger anrühren.«
Die Leserin erschrak; die hier saß und diese Stelle anstrich, litt sie unter den »schweren, unerträglichen Bürden«, von denen die Heilige Schrift sprach?
Und ist Frau Notburga diese Unglückliche gewesen?
Eilig forschte Frau Benedikta weiter:
»Wenn ihr betet, sollt ihr nicht Worte häufen wie die Heiden; denn sie meinen, daß sie erhöret würden, weil sie viel Worte machen.«
Und wiederum erschrak Frau Benedikta; sie mußte der Nonnen im Garten gedenken, wenn jede für sich ging, ihren Rosenkranz oder das Brevier betend, wobei sie so eifrig die Lippen bewegten und nicht minder eifrig ihre Augen herumspazieren ließen –
In der Heiligen Schrift aber stand:
»Du aber, wenn du betest, gehe in dein Kämmerlein und schließ die Thüre zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen –«
Frau Benedikta las und las, eifrig der Schwesterhand folgend, die alle jene Stellen bezeichnet hatte, in denen den Menschen die Weisung ward, ihres Lebens froh zu sein, wenn es schön, und sich darin zurecht zu finden, wenn es dunkel und finster war.
Frau Benedikta las auch, was zwischen diesen Strichen stand; sie suchte nach einem Ausspruch, allein sie fand nirgends die Lehre:
›Ziehet euch von der Welt zurück‹; der Gottessohn selbst, er wartete nicht, bis die Menschen zu ihm kamen, er ging unter sie; auf dem Markt, in den Häusern suchte er sie auf, an ihrem Tisch ließ er sich nieder, selbst den Umgang mit Unwürdigen verschmähte er nicht und hielt seine Jünger an, zu thun wie er –
›Und sind wir nicht alle seine Jünger, alle bis auf den heutigen Tag?‹ fragte sich Frau Benedikta.
Wenn auch geschrieben stand:
»Wahrlich, ich sage euch, ein jeder, welcher verläßt Haus oder Brüder oder Schwestern, oder Vater oder Mutter oder Kinder, oder Äcker um meinetwillen, und um des Evangeliums willen, der wird hundertfältig empfangen –«
Hieß es nicht an einer anderen Stelle:
»Worin ein jeglicher berufen ward, Brüder, darin bleibe er bei Gott.«
Frau Benedikta atmete tief; sie mußte manchmal das Buch weglegen, so mächtig rührten diese Stellen ihr Inneres auf.
Arme Schwester, die da oben im Turme hauste, was verrieten nicht die von ihr angestrichenen Stellen:
»Es ist besser heiraten, als brennen –« – »wer sich verheiratet, der thut wohl, und wer sich nicht verheiratet, der thut besser –«
Für diese Arme war wohl dieses Bessere nicht das Richtige gewesen –
Wunderbares Zusammensein, fern von den betenden Nonnen im Garten, mit dem Geiste der hingeschiedenen Notburga!
Denn sie war es; am Ende des dreizehnten Kapitels der Epistel Pauli an die Korinther stand ihr Name, von einem feinen roten Rand umfaßt; darüber hinaus gab's keine Striche mehr. Verdunkelte Stellen wiesen Spuren von Thränen auf –
Auch aus Frau Benediktas Augen flossen Thränen; hatte die gequälte Frau nicht wiederholt nach ihr verlangt?
»Ihr Friede thut mir wohl,« hatte sie einmal gesagt, aber auf die Frage der Frau Benedikta: »Kann ich Ihnen denn nicht helfen?« weinte die Arme und schüttelte den Kopf: »Wie sollten Sie mich verstehen?«
›O über diese verderbliche Unschuld,‹ stöhnte Frau Benedikta auf, ›dieses nichts vom Leben wissen und nichts verstehen wollen –‹
Jetzt, ja jetzt hätte sie die Arme verstehen können; Maria hatte kommen müssen, um ihr die Augen zu öffnen, daß es eine Kraft des Fühlens giebt, die in der stillen Welt des Klosters nimmermehr ihre Befriedigung finden kann.
Seltsam, und nun lieh ihr eben jene unverstandene Frau die Hand zur weiteren Erkenntnis –
War das nicht ein Fingerzeig von oben, die Antwort auf ihre Fragen und Zweifel: was darf ich – was darf ich nicht? Das rote Fragezeichen hinter diesem letzten Spruch:
»Die größeste aber unter ihnen ist die Liebe« – was bedeutete es anders, als daß Frau Notburga diese Liebe nicht gefunden, daß niemand im Kloster dies große Werk der Liebe an ihr gethan – Auch sie, Frau Benedikta, hatte die arme Seele neben sich verschmachten lassen – Und nun – war sie nicht nahe daran gewesen, auch Maria ihrem Schicksal zu überlassen, in ihrem Wahne, dies ihrem Gelübde des Gehorsams schuldig zu sein?
Wenn Gott sie da heraufgeführt, damit sie an der Hand ihrer unglückseligen Schwester sehend werde, war es da nicht sein Wille, daß sie in Marias Schicksal eingreife?
Was aber konnte sie thun, um die Profeß zu verhindern? Und hatte diese stattgefunden – sie, eine Nonne, durchdrungen von der Heiligkeit der Gelübde, sie sollte einer anderen helfen, diese Gelübde zu brechen?
Frau Benedikta fand keinen Schlaf mehr; denn so oft sie sich vornahm: ›Nein ich thue nichts, ich darf nichts thun‹ – erschien Frau Notburgas schmerzentstelltes Antlitz vor ihrem inneren Auge, sie hörte ihr Jammern und Stöhnen, und der Gedanke scheuchte sie vom Lager:
»Gott, mein Gott, und Maria – dies urkräftige, lebensvolle Geschöpf, wenn sie einem solchen Verfall entgegenginge –«
Vielleicht wäre Notburga noch zu retten gewesen – damals, als die Unruhe in ihr anfing. Aber niemand öffnete ihr die Pforte, niemand sagte zu ihr: Flieg aus, du traurige Seele und werde froh –
Mit der großen Traurigkeit fing's an.
Frau Benedikta beobachtete Maria in der Kirche; sie sah die zunehmende Blässe ihres Gesichts und die fremde Linie um ihren Mund – ein Mund wie zum Lachen geformt.
Und er sollte das Lachen verlernen.
»Mein Gott,« betete Frau Benedikta aus der Tiefe ihres gequälten Herzens, »will ich denn das Böse? – Wenn ich sie machen könnte, wie ich bin, wie meine Schwestern sind – wer von uns möchte das Haus verlassen? Sind wir nicht alle zufrieden in unserem Berufe, unserer Gottesgemeinschaft? Aber was wir an einer Notburga erlebt, sollen wir es an einer zweiten erleben? O, warum haben die anderen keine Augen, warum nur ich?«
Schwer war die Last, unter der sie seufzte – fast nicht zu ertragen. In solchen Augenblicken tiefster Seelenangst wußte sie sich nicht anders zu helfen, sie griff zum Neuen Testament –
Und eines Tages beim Lesen der Stelle:
»Wenn ich spräche der Menschen und der Engel Sprache, die Liebe aber nicht hätte, da wäre ich wie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle –«
Bei dieser Stelle tauchte plötzlich die Äbtissin vor ihrem inneren Auge auf, und ob Frau Benedikta wollte oder nicht, aus der innersten Seele gellte es ihr heraus:
»Sie hat die Liebe nicht, von der es heißt«:
»Und wenn ich hätte alle Glaubenskraft, so daß ich Berge versetzte, die Liebe aber nicht hätte, nichts wäre ich.«
›Sie kennt die Liebe nicht, von der es heißt‹:
»Der Wahrheit freuet sie sich –«
›Der Wahrheit muß ich mich freuen‹, wiederholte Frau Benedikta, ›auch wenn sie mich kränkt, auch wenn sie mich vernichtet – Mut, Mut, mein Herz –‹
Aber schon im nächsten Augenblick erschreckte sie der Gedanke:
»Bin ich denn sicher, daß sie draußen glücklicher sein wird als hier – daß ihre Seele nicht auf ewig verloren geht?« –
Allein der Einsamen dort oben sollte alles zur Erleuchtung, zur Entwickelung ihres inneren Menschen gereichen.
Was die Äbtissin bezweckte, indem sie Frau Benedikta die Armenpflege anvertraute, es fiel ganz anders aus, als die hohe Frau sich eingebildet hatte.
Sie selber hatte in ihrer kühlen, freundlichen Weise die Gaben ausgeteilt und erbauliche Worte gesprochen hinter dem Gitter des Armensprechzimmers; allein niemand von den Bittenden hätte den Mut gehabt, sich der hohen Frau zu nähern. Sie sprachen wohl von ihren Leiden und Bedrängnissen, aber es erging ihnen unter dem erziehenden Blick der Äbtissin genau wie den Nonnen – sie sagten nicht mehr als die hohe Frau zu hören wünschte.
Kaum aber erschien statt dieser die kleine, zarte Frau Benedikta, als auch das Vertrauen der Leute keine Grenzen mehr kannte. Der schmale, kahle Raum links vom Eingang des Klosters faßte die Zahl der Bittenden nicht.
Und als Frau Benedikta einmal schüchtern meinte: »Aber Kinder, ihr müßt jetzt gehen, ich habe ja nichts mehr für euch –« da gab ihr ein altes, gebeugtes Weiblein zur Antwort:
»Sie haben immer was. Sie haben gute Worte –«
Und in der That, sie mußte es erleben, daß um dieser ihrer guten Worte willen ein noch viel größerer Wetteifer entstand als um das Beutelchen Silbergeld, das ihr zur Austeilung anvertraut war. Aus den Frauen und Mädchen, die kamen, um über ihr Schicksal zu klagen, entpuppten sich allgemach Menschen, voll der tiefsten Sehnsucht nach Güte, nach Glück und Friede.
Und so wurde Frau Benediktas Blick immer weiter, immer verstehender. Wohl schauderte sie über manche Einblicke, und die Dinge, die die Äbtissin häßlich und verabscheuungswürdig gefunden, erfüllten auch Frau Benediktas Seele mit Schrecken, allein sie erkannte die Ursachen dieser Übel, und die Welt, die sie hatte hassen lernen sollen, kam ihr unendlich erbarmungswürdig und ebenso bewunderungswert vor.
Denn in diesem Kampfe nicht erlahmen, nimmer müde werden, sein täglich Brot zu erringen und helfen und raten, wo es not that – war das vielleicht nicht viel heiliger als die Einschließung im Kloster und die Verbringung der Tage mit Gebetübungen und dürftigem Liebeswerk? –
Bald kamen nicht mehr die Armen allein, auch ehemalige Zöglinge des Klosters suchten Frau Benedikta heim.
Eines Tages trat eine junge Frau mit vier kleinen Knaben ins Sprechzimmer; sie weilte zu Besuch bei den Eltern im nahen Städtchen und wollte nicht abreisen, ohne der ehemaligen Lehrerin ihre Knaben gezeigt zu haben.

Sie erzählte und erzählte, ohne den Blick von ihren Büblein zu lassen.
»Sind sie nicht herzig?« flüsterte sie Frau Benedikta zu.
Freilich, Arbeit machten sie auch, sie mußte sich tüchtig rühren; der Mann war Beamter; sie hatten eine wunderhübsche Dienstwohnung mit einem großen Garten, den besorgte sie ganz mit ihrem Mädchen; welches Glück, daß dieses eine Gärtnerstochter war! So hatten sie immer Glück. Da war eine kleine Schneiderin im Ort, von der hatte sie in kurzer Zeit so viel gelernt, daß sie jetzt der Knaben und ihre eigenen Sachen ganz hübsch zuzuschneiden verstand. Das war eine große Ersparnis, dafür machten sie im Sommer jeden Sonntag einen kleinen Ausflug.
»Eine herrliche Erfrischung für meinen lieben Mann,« versicherte sie, »er hat's nötig bei seiner anstrengenden Berufsarbeit; aber wir klagen nicht, wir tummeln uns gern, wir sind ja jung und gesund und glücklich – Und dann – die lieben, lieben Racker« –
Sie küßte ihre Büblein nacheinander ab; sie mußten Frau Benedikta die Händchen reichen.
Die junge Mutter sah den Bemühungen der Kleinen, die sich gewaltig streckten, um ihre Fingerchen durch das Gitter zu reichen, mit lachenden Augen zu –
Sie waren gegangen; Frau Benedikta saß noch immer an ihrem Platz, tief in Gedanken verloren –
In solche Verhältnisse – in solch ein Leben würde Maria passen – Sie wußte es mit einemmal – sie war sich klar –
Es erschien ihr wie eine Fügung, daß Gott ihr dies Leben vor Augen geführt.
Nun galt es zu wachen – die Augen offen zu halten und in Demut auf einen neuen Fingerzeig von oben warten –
