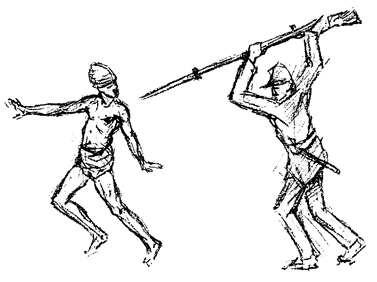|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es war Abend. Tine saß lesend in der Innengalerie, und Havelaar zeichnete ein Stickmuster. Der kleine Max beschäftigte sich mit einem Zusammensetzspiel und bemühte sich eifrig »den roten Leib der Frau« zurecht zu schieben.
»Ist es so gut, Tine?« fragte Havelaar. »Ich habe das Palmenmuster etwas vergrößert, ... jetzt entspricht es wohl deinen Forderungen? Nicht wahr?«
»Ja, ... nur die Knopflöcher stehen noch zu dicht aneinander.«
»So? ... Und die übrigen Streifen? ... Max, zeig' mal deine Höschen! ... Ach, so, du hast den anderen Streifen an! ... Ach, Tine, ich weiß noch, wo du den gestickt hast!«
»Ich nicht. Wo denn?«

»Im Haag, als Max krank war. Du warst damals voller Angst, weil der Arzt die Schädelform des Jungen so eigentümlich fand und dich darauf aufmerksam machte, daß jeder Blutandrang nach dem Kopf vermieden werden müßte. Da sticktest du gerade an dem Streifen.«
Tine erhob sich und küßte das Kind.
»Ich hab' den Bauch! Ich hab' den Bauch!« rief der Junge vergnügt, und die rote Dame war komplett.
»Wer hört da den tontong tongtong, ein großer hohler Holzblock, auf dem die Stunden durch Aufschlagen verkündet werden. schlagen?« fragte die Mutter.
»Ich«, sagte der kleine Max.
»Und was bedeutet das?«
»Daß ich ins Bett muß! ... Aber ich habe noch nicht gegessen!«
»Erst bekommst du natürlich zu essen!«
Tine erhob sich und reichte ihm sein einfaches Mahl, das sie aus einem sehr sorgfältig verschlossenen Schrank in ihrem Zimmer geholt zu haben schien, denn man hatte sie nebenan wiederholt schließen gehört.
»Was gibst du ihm da?« fragte Havelaar.
»Habe keine Angst, es ist Biskuit aus einer verschlossenen Dose aus Batavia. Und der Zucker war auch unter sicherm Gewahrsam.«
Havelaars Gedanken kehrten zu dem Gegenstand zurück, von dem sie sich einen Augenblick entfernt hatten.
»Du,« begann er plötzlich, »die Rechnung vom Arzt haben wir noch nicht bezahlt. Das ist sehr peinlich.«
»Wir leben jetzt so sparsam, Max, das haben wir wohl schnell erübrigt. Außerdem mußt du doch bald zum Residenten befördert werden, und dann können wir alles in kurzer Zeit regeln.«
»Das ist mir gerade so unangenehm,« erwiderte Havelaar, »ich möchte jetzt nicht gerne Lebak verlassen. Ich will dir das erklären. Hatten wir unseren Jungen nicht nach seiner Krankheit noch mehr lieb als vorher? So geht es mir mit Lebak. Wenn es von der Pest, die seit Jahren darin wütet, genesen ist, wird es mir noch teurer sein als vorher. Mir ist jetzt der Gedanke an eine Beförderung schrecklich. Ich bin hier nötig ... Allerdings, wenn ich auf der anderen Seite bedenke, was wir für Schulden haben ...!«
»Das kann doch alles gut werden, Max! Wenn du auch von hier weggehst, Lebak kannst du später helfen, wenn du Generalgouverneur wirst.«
Da kamen wüste Streifen in Havelaars Stickmuster, der Zorn verwirrte die Blumenranken und verzerrte die Knopflöcher ...
Tine begriff, daß sie etwas gesagt hatte, was ihn störte.
»Lieber Max ...« begann sie zutraulich.
»Ja, zum Teufel, sollen denn die armen Teufel so lange hungern! Kannst du von Sand leben?«
»Lieber Max ...«
Er sprang auf. An dem Abend wurde nichts mehr gezeichnet. Verstimmt und zornig ging er in der Innengalerie auf und ab, und endlich sprach er in einem Ton, der jedem rauh und grob geklungen hätte, der aber von Tine ganz anders aufgefaßt wurde.
»Der Teufel hole die Lauheit, die schändliche Lauheit! Da sitze ich nun seit einem Monat und warte, daß Recht geschehe, und inzwischen muß das arme Volk die entsetzlichsten Leiden ertragen. Der Regent scheint damit zu rechnen, daß sich niemand an ihn heranwagt!«
Er ging in sein Arbeitszimmer und kam mit einem Brief zurück, ... mit einem Brief, der gleichfalls vor mir liegt.
»Da, in diesem Briefe erlaubt er sich, mir Vorschläge zu machen über die Arbeiten, die wir durch die unrechtmäßig zum Herrendienst eingezogenen Leute verrichten lassen sollen. Heißt das nicht, die Unverschämtheit auf die Spitze treiben? Weißt du, um wen es sich diesmal handelt? Um Frauen mit kleinen Kindern, mit Säuglingen, um schwangere Frauen, die man von Parang-Kudjang an den Hauptplatz getrieben hat, damit sie für ihn arbeiten. Männer gibt's nicht mehr! Nahrung haben sie nicht. Sie schlafen am Wegrande und essen Erde, Kannst du Erde essen? ... Sollen die Erde essen, bis ich Generalgouverneur bin? Zum Donnerwetter!«
Tine wußte sehr wohl, gegen wen sich sein Zorn richtete, während er so zu ihr, die er lieb hatte, sprach.
»Und das alles geschieht unter meiner Verantwortung,« fuhr Havelaar fort. »Die armen Geschöpfe, die draußen herumirren, wenn sie den Schein unserer Lampe sehen, sagen sie: ›Da wohnt der Schurke, der uns schützen sollte. Da sitzt er ruhig mit Frau und Kind und zeichnet Stickmuster, und wir liegen hier wie wilde Hunde am Straßenrand und verhungern mit unseren Kindern!‹ Ich höre es, ich höre es förmlich, wie sie die Rache über mein Haupt herabbeschwören ... Komm her, Max!« Er küßte das Kind so ungestüm, daß es erschrak.
»Kind wenn man dir sagt, daß ich ein Schurke bin, der nicht den Mut hat, Recht zu tun, daß soviel Mütter starben durch meine Schuld, wenn man dir sagt, daß die Pflichtvergessenheit deines Vaters dir den Segen raubte, dann bezeuge du, Max, was ich gelitten habe!«
Er brach in Tränen aus, die ihm Tine von den Wangen küßte. Sie brachte dann das Kind zu Bett, und als sie zurückkehrte, fand sie Havelaar im Gespräch mit Verbrugge und Duclari, die soeben eingetreten waren. Die Unterhaltung drehte sich um den erwarteten Beschluß der Regierung.
»Ich verstehe sehr gut, daß der Resident in einer sehr peinlichen Lage ist. Er kann dem Gouvernement nicht gut empfehlen, Ihren Vorschlägen nachzugeben, denn dann würde zu viel ans Licht kommen. Ich bin lange in Batavia und weiß genug, viel mehr als Sie selbst, Herr Havelaar. Ich habe hier schon als Unteroffizier Dienste getan, und da erfährt man vieles, was der Eingeborene dem Beamten gar nicht zu berichten wagt. Wenn das alles durch eine öffentliche Untersuchung aufgedeckt würde, müßte der Generalgouverneur den Residenten zur Verantwortung ziehen und ihm vorhalten, daß er in zwei Jahren nicht bemerkt hat, was Ihnen sofort auffiel. Er hat also ein lebhaftes Interesse eine solche Untersuchung zu verhindern.«
»Das habe ich eingesehen,« entgegnete Havelaar, »sein Versuch, den Adhipatti zu einer Beschwerde gegen mich zu veranlassen, hat mir die Augen geöffnet. Er will scheinbar die ganze Geschichte umdrehen und eine Anklage gegen mich, ich weiß zwar nicht worüber, herausholen. Dagegen habe ich mich gedeckt, indem ich alle Abschriften direkt an die Regierung gesandt habe. Ich habe das Gouvernement ausdrücklich ersucht, gegen mich ein Verfahren zu eröffnen, falls er etwa behauptet, daß ich mich irgendwie vergangen hätte. Wenn mich der Resident angreift, kann kein Beschluß gefaßt werden, ehe ich nicht selbst vernommen worden bin. Das ist man wohl jedem Verbrecher schuldig, und da ich schließlich nichts verbrochen habe – – –
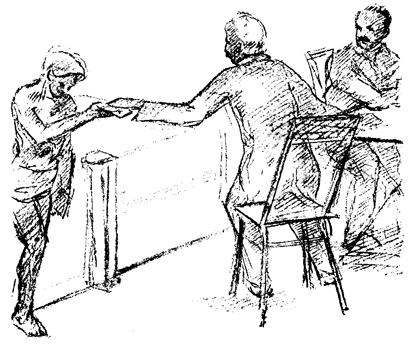
»Da kommt die Post!« rief Verbrugge.
Es war die Post! Die Post, die ihm den Brief brachte, den der Generalgouverneur von Niederländisch-Indien dem »ehemaligen« Residentschaftsassistenten von Lebak, Havelaar, geschrieben hatte.
Kabinet Buitenzorg, den 23. März 1856.
No. 54.
Die Art und Weise, in der Sie bei der Entdeckung oder Unterstellung unerlaubter Handlungen seitens der inländischen Großen innerhalb der Abteilung Lebak zu Werke gingen, und die Haltung, die Sie dabei Ihrem Vorgesetzten, dem Residenten von Bantam, gegenüber eingenommen haben, haben in hohem Maße meine Unzufriedenheit hervorgerufen.
Ihre Handlungsweise läßt alle Überlegung, Einsicht und Zurückhaltung vermissen, die für einen Beamten, der mit der Verwaltung im Binnenlande betraut ist, erforderlich sind, wie jedes Maß von Subordination gegenüber Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten.
Bereits wenige Tage nach Ihrem Amtsantritt haben Sie es für richtig gehalten, ohne sich vorher mit dem Residenten ins Einvernehmen zu setzen, den Chef der inländischen Verwaltung von Lebak zum Gegenstande Ihrer belastenden Untersuchungen zu machen.
Diese Untersuchungen genügten Ihnen, obgleich Sie für Ihre Anschuldigungen keinerlei Tatsachen oder Beweise anführen konnten, den Anspruch zu erheben, einen inländischen Beamten vom Range eines Regenten von Lebak, einen trotz seiner sechzig Jahre immer noch eifrigen Diener der niederländischen Interessen, der mit den angesehensten benachbarten Geschlechtern verwandt ist und über den stets nur das Günstigste bekannt geworden ist, einer Behandlung zu unterwerfen, die seiner moralischen Vernichtung gleichkäme.
Darüber hinaus haben Sie, als der Resident Ihren Vorschlägen widersprach, sich geweigert, Ihrem Vorgesetzten die von ihm geforderten Angaben, die Ihre Anschuldigungen bestätigen sollten, zu unterbreiten.
Eine solche Handlungsweise verdient die höchste Mißbilligung, und sie läßt Sie als durchaus ungeeignet erscheinen, ein Amt bei der Verwaltung unserer Kolonien zu bekleiden.
Ich sehe mich deshalb verpflichtet, Sie von der weiteren Ausübung Ihrer Tätigkeit als Residentschaftsassistent von Lebak zu entheben.
Mit Rücksicht auf Ihre bisherige gute Führung habe ich in dem Vorgefallenen keinen ausreichenden Grund erblicken wollen, Ihnen die Aussicht auf Wiederanstellung bei der Kolonialverwaltung zu nehmen. Ich habe Sie daher vorläufig und vertretungsweise mit der Residentschaftsassistenz von Ngawi betraut.
Es wird von Ihrem ferneren Verhalten abhängen, ob Sie bei der Verwaltung angestellt bleiben können.«
Und darunter stand der Name des Mannes, auf dessen Eifer, Eignung und Treue sich der König verlassen hatte, als er seine Ernennung zum Generalgouverneur von Niederländisch-Indien unterzeichnete.
»Wir gehen hier weg, liebe Tine,« sagte Havelaar gelassen und reichte das Kabinettsschreiben Verbrugge, der zusammen mit Duclari den Brief las.

Verbrugge hatte Tränen in den Augen, aber er sprach nichts. Duclari, ein gebildeter Mensch, brach in wüstes Fluchen aus:
»Verdammtes Pack! ... Ich habe hier im Dienst Lumpen und Spitzbuben an der Arbeit gesehen ... Die sind in Ehren weggegangen, und Ihnen schreibt man einen solchen Brief!«
»Das beweist nichts,« erklärte Havelaar. »Der Generalgouverneur ist ein ehrlicher Mann. Er ist betrogen worden, ... obgleich er sich vor dem Betrug hätte schützen können, wenn er mich vorher angehört hätte. Er ist gefangen im Netz der Buitenzorg'schen Bürokratie. Das kenne ich. Aber ich gehe zu ihm hin und zeige ihm, wie die Dinge hier in Wirklichkeit stehen. Er findet dann schon das Richtige, davon bin ich überzeugt.«
»Aber wenn Sie nach Ngawi gehen?«
»Das habe ich durchschaut! Der Regent von Ngawi ist mit dem Hofe von Djokakarta verwandt. Ich kenne Ngawi, denn ich war zwei Jahre in Baglen, das ganz in der Nähe liegt. Ich müßte dort genau dasselbe beginnen, was ich hier getan habe. Außerdem kann ich unmöglich ein Amt zur Probe, gewissermaßen mit Bewährungsfrist antreten, als ob ich mich irgendwie vergangen hätte. Und schließlich sehe ich ein, wenn man allen diesen Schiebungen ein Ende machen will, darf man kein Beamter sein. Als Beamter stehen zwischen der Regierung und mir viel zu viel Personen, die ein Interesse daran haben, die Not der Bevölkerung zu leugnen ... Es gibt noch andere Gründe, die es mir verbieten, nach Ngawi zu gehen. Die Stelle war gar nicht frei, sie ist erst für mich frei gemacht worden, ... da, sehen Sie!«
Er wies auf die Zeitung, die eben mit der Post gekommen war und in welcher der Regierungsbeschluß bereits veröffentlicht war, demzufolge Havelaar mit der Verwaltung von Ngawi betraut wurde, während der bisherige Residentschaftsassistent dieser Abteilung an eine andere Stelle versetzt wurde, die gerade frei war.
»Wissen Sie, warum ich gerade nach Ngawi soll und nicht auf den freien Posten gesetzt werde? Ich kann es Ihnen ganz genau sagen, der Resident von Madiun, wozu Ngawi gehört, ist der Schwager des vorigen Residenten von Bantam, und ich habe erklärt, daß dieser frühere Resident ein schlechtes Beispiel gegeben hat ...«
»Ah so,« riefen Duclari und Verbrugge gleichzeitig aus. Sie begriffen jetzt, weshalb Havelaar nach Ngawi versetzt wurde, um dort zu beweisen, daß er sich bessern wolle.
»Aber ich habe noch einen anderen triftigen Grund, die Versetzung nicht anzunehmen. Der jetzige Generalgouverneur steht am Ende seiner Dienstzeit. Seinen Nachfolgen kenne ich, und ich weiß, daß ich von ihm nichts zu erwarten habe. Wenn ich also für das arme Volk hier noch irgend etwas erreichen will, muß ich den gegenwärtigen Generalgouverneur noch vor seinem Weggange sprechen, und wenn ich nach Ngawi ginge, wäre das unmöglich. Tine, hör mal zu.«

»Du hast doch Mut, nicht wahr?«
»Max, du weißt doch, daß ich allen Mut habe, wenn ich bei dir bin.«
»Also gut.« Er erhob sich und schrieb das folgende Gesuch:
Rangkas-Betung, den 29. März 1856.
An den Herrn Generalgouverneur von
Niederländisch-Indien.
Ich hatte die Ehre, Euer Exzellenz Kabinettsbotschaft No. 54 vom 23. dieses Monats zu empfangen.
Als Erwiderung darauf sehe ich mich genötigt, Euer Exzellenz zu ersuchen, mich mit Ehren aus dem Dienst des Landes verabschieden zu wollen.
Max Havelaar.
Man brauchte zu Buitenzorg zur Gewährung dieses Gesuches lange nicht so viel Zeit, wie man verwendet hatte, um ein Mittel zu finden, Havelaars Anklagen zu vereiteln. Das hatte immerhin fast einen Monat gedauert, die erbetene Entlassung traf schon nach wenigen Tagen in Lebak ein.
»Gott sei Dank!« rief Tine, »daß du endlich du selbst sein kannst!«
Havelaar erhielt nicht den Auftrag, die Verwaltung seines Bezirks vorläufig Verbrugge zu übergeben, und er glaubte deshalb, die Ankunft seines Nachfolgers abwarten zu müssen. Das dauerte lange, da der Mann aus einem anderen entfernten Winkel Javas kommen sollte. Nach einer Wartezeit von nahezu drei Wochen, während welcher er seine Funktionen weiter ausgeübt hatte, schrieb der ehemalige Residentschaftsassistent von Lebak den nachstehenden Brief an den Kontrolleur Verbrugge:
No. 153. Rangkas-Betung, den 15. April 1856.
An den Kontrolleur von Lebak.
Es ist Ihnen bekannt, daß ich laut Regierungsbeschluß vom 4. dieses Monats auf meinen Wunsch den ehrenvollen Abschied erhalten habe.
Es wäre vielleicht mein Recht gewesen, nach Empfang dieser Verfügung meine Tätigkeit als Residentschaftsassistent sofort niederzulegen, da es als eine Anomalie erscheinen muß, eine amtliche Funktion auszuüben, ohne Beamter zu sein.
Ich hatte jedoch keinerlei Weisung erhalten, die Geschäfte jemandem zu übergeben, und teils, weil ich die Verpflichtung fühlte, meinen Posten ohne gebührende Ablösung nicht verlassen zu dürfen, teils aus anderen Gründen untergeordneter Natur wartete ich die Ankunft meines Nachfolgers ab, in der Meinung, daß dieser sehr bald hier eintreffen würde.
Nun erfahre ich, daß dieser Beamte nicht so schnell hier erwartet werden kann und daß, – Sie werden in Serang davon gehört haben, – der Resident seiner Verwunderung darüber Ausdruck gegeben hat, daß ich bei der seltsamen Lage, in der ich mich befinde, noch nicht versucht habe, die Geschäfte Ihnen zu übertragen.
Nichts konnte mir angenehmer sein als diese Ansicht. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu versichern, daß ich, der ich erklärt habe, nicht anders dienen zu können, als ich es bisher tat, und der für diese Art des Dienstes mit Tadel, mit einer mich benachteiligenden und entehrenden Versetzung, mit der Zumutung, die armen Leute zu verraten, die sich meiner Loyalität anvertraut hatten, bestraft, mit einem Worte vor die Wahl zwischen Unehrenhaftigkeit oder Hunger gestellt wurde, daß ich nach alledem nur unter größter Selbstüberwindung weiter da verharrte, wo mich mein Pflichtgefühl hinstellte, obgleich mir die einfachsten Dinge erschwert wurden durch die Empfindung, zwischen meinem Gewissen und den Forderungen der Regierung, denen ich, solange ich mein Amt verwalte, Gehorsam schulde, wählen zu müssen.
Diese Schwierigkeit offenbarte sich vor allen Dingen bei der Antwort, die ich neu auftretenden Beschwerdeführern erteilen mußte.
Ich hatte gelobt, niemanden der Rache seiner Unterdrücker auszuliefern, ich hatte, – unvorsichtig genug, – mit meinem Worte für die Gerechtigkeit der Regierung gebürgt. Die arme Bevölkerung konnte nicht wissen, daß mein Gelübde sowohl wie meine Bürgschaft desavouiert worden waren, daß ich arm und machtlos in meinem Kampfe um Recht und Menschlichkeit allein stand. Und so gingen mir neue Klagen zu.
Es war für mich bedrückend, nach dem Empfang der Kabinettsbotschaft vom 23. März hier noch als die vermeintliche Zuflucht der Armen, als ihr ohnmächtiger Beschützer zu verweilen. Es war herzzerbrechend, Klagen anhören zu müssen über Mißhandlung, Knechtung, Armut und Hunger, während ich selbst mit Frau und Kind einer Zukunft von Hunger und Armut entgegengehe.
Aber auch die Regierung wollte ich nicht verraten. Ich wollte den armen Leuten nicht sagen: »Gehet und leidet, denn die Verwaltung will, daß ihr geknechtet werdet.« Ich wollte meine Ohnmacht nicht eingestehen, denn das wäre gleichzeitig das Eingeständnis der Schande und der Gewissenlosigkeit der Ratgeber des Generalgouverneurs gewesen.
Deshalb antwortete ich ungefähr folgendes:
»Augenblicklich kann ich euch nicht helfen. Doch ich gehe nach Batavia, und dort werde ich über euer Elend mit dem Großen Herrn sprechen. Er ist rechtschaffen und wird euch beistehen. Geht vorläufig ruhig nach Hause, widersetzt euch nicht, flüchtet noch nicht, wartet geduldig. Ich denke, ... ich hoffe, daß euch euer Recht werden soll.«
So glaubte ich im Gefühl der Scham über die Mißachtung meiner Hilfsbereitschaft meine Empfindungen mit meinen Pflichten gegenüber der Verwaltung, die mich noch diesen Monat bezahlt, zu vereinen, und ich hätte es weiter so gehalten bis zum Eintreffen meines Nachfolgers, wenn mich nicht heute ein besonderer Vorfall zwänge, dieser Unklarheit ein Ende zu bereiten.
Sieben Personen hatten sich bei mir beschwert. Ich gab ihnen die oben erwähnte Antwort, und sie kehrten nach ihrem Wohnplatz zurück. Unterwegs begegnen sie ihrem Dorfhäuptling. Er muß ihnen wohl verboten haben, ihren Kampong wieder zu verlassen und nahm ihnen, wie man mir berichtet, ihre Kleidung weg, um sie dadurch zu zwingen, zu Hause zu bleiben. Einer von ihnen entfernt sich doch, kommt heimlich wieder zu mir und erklärt mir, er wage es nicht, in sein Dorf zurückzukehren.
Was ich nun diesem Manne antworten soll, weiß ich nicht.
Schützen kann ich ihn nicht, meine Ohnmacht wage ich nicht, ihm zu bekennen. Den schuldigen Dorfhäuptling will ich nicht verfolgen, da ich dadurch den Anschein hervorrufen könnte, diese Angelegenheit pour le besoin de ma cause Im Interesse meiner Sache. aufgebauscht zu haben. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.
Ich übergebe Ihnen vorbehaltlich der späteren Bestätigung durch den Residenten von Bantam von morgen früh ab die Verwaltungsgeschäfte der Abteilung Lebak.
Der Residentschaftsassistent von Lebak.
Max Havelaar.
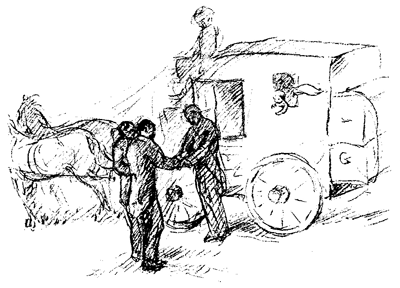
Darauf verließ Havelaar mit Frau und Kind Rangkas-Betung. Er lehnte jedes Geleit ab. Duclari und Verbrugge waren beim Abschied tief gerührt. Auch Havelaar war ergriffen, besonders als er an der ersten Raststelle eine zahlreiche Menge vorfand, die aus Rangkas-Betung weggelaufen war, um ihn ein letztes Mal zu grüßen.
In Serang stieg die Familie bei Herrn Slymering ab, der sie mit der üblichen indischen Gastfreundschaft aufnahm.
Am Abend kamen viele Besucher zum Residenten. Man machte kein Hehl daraus, daß man Havelaar begrüßen wollte, und er empfing manchen vielsagenden Händedruck.
Aber er mußte weiter nach Batavia, um den Generalgouverneur zu sprechen.
Dort angekommen, bat er um eine Audienz. Diese wurde ihm verweigert, da Seine Exzellenz an einem Geschwür am Fuße litt.
Havelaar wartete, bis das Übel geheilt war und bat zum zweiten Male um Gehör. Seine Exzellenz »war so beschäftigt, daß er selbst dem Generaldirektor der Finanzen keine Audienz gewähren konnte«, und er konnte also auch Havelaar nicht empfangen.
Havelaar wartete, bis seine Exzellenz das Übermaß von Arbeit bewältigt haben würde. Während dieser Zeit beneidete er diejenigen, die dem Generalgouverneur bei der Arbeit helfen durften, denn ihm war Beschäftigung sehr erwünscht, und gewöhnlich schmolz ihm solche Arbeitslast unter den Händen weg. Aber es blieb ihm nichts anderes zu tun, er mußte warten.
Und er wartete. Endlich ließ er abermals um eine Audienz bitten und er erhielt den Bescheid, daß ihn Seine Exzellenz nicht empfangen könne, weil man bereits mit den Vorbereitungen für die bevorstehende Abreise beschäftigt war.
Havelaar empfahl sich der Gnade Seiner Exzellenz und bat um eine halbe Stunde Gehör, sowie sich diese kurze Frist bei den Vorbereitungsarbeiten erübrigen ließe.
Plötzlich vernahm er, daß Seine Exzellenz am folgenden Tag abreisen würde. Das war wie ein Donnerschlag. Noch immer klammerte er sich krampfhaft an die Überzeugung, daß der abtretende Landvogt ein ehrlicher Mann war, der von anderen betrogen wurde. Der vierte Teil einer Stunde hätte genügt, um die Rechtlichkeit seiner Sache zu beweisen, und diesen vierten Teil einer Stunde schien man ihm verweigern zu wollen.
Unter Havelaars Papieren finde ich den Entwurf eines Briefes, den er dem abtretenden Generalgouverneur am letzten Abend vor dessen Abreise nach den Niederlanden geschrieben zu haben scheint. Am Rande steht mit Bleistift die Bemerkung: »Nicht richtig«, woraus ich entnehme, daß einzelne Sätze bei der Abschrift verändert worden sind. Ich betone das ausdrücklich, um nicht aus dem Mangel an buchstäblicher Übereinstimmung Zweifel an der Zuverlässigkeit der anderen offiziellen Briefe herleiten zu lassen, die ich sonst noch mitteilte, und die sämtlich durch dritte Hand als »gleichlautend mit dem Original« bestätigt sind. Vielleicht entschließt sich der Mann, an den dieser Brief gerichtet war, ihn im Wortlaut zu veröffentlichen?
Man könnte dann feststellen, wieweit Havelaar von seinem Entwurf abgewichen ist. Dem Sinne nach lautete der Brief beiläufig folgendermaßen:
Batavia, den 23. Mai 1856.
Exzellenz!
Mein von Amtswegen eingereichtes Gesuch vom 28. Februar in bezug auf die Angelegenheiten der Abteilung Lebak gehört zu werden, ist ohne Folge geblieben.
Ebenso hat es Ew. Exzellenz nicht beliebt, meinen wiederholten Bitten um Audienz zu willfahren.
Ew. Exzellenz haben also einen Beamten, dessen bisherige gute Führung Sie selbst anerkannten, der siebzehn Jahre seinem Lande in den Kolonien gedient hat, der nichts verschuldet hat, als daß er unter äußerster Selbstverleugnung das Beste erreichen wollte und aus Ehr- und Pflichtgefühl alles preisgab, schlimmer als einen Verbrecher behandelt, denn einen solchen hört man wenigstens an.
Daß man Ew. Exzellenz über mich falsch informiert hat, begreife ich, aber unbegreiflich bleibt es mir, daß Sie die Gelegenheit, sich zuverlässig zu unterrichten, nicht wahrgenommen haben. Morgen verlassen Ew. Exzellenz das Land, aber ich will Sie nicht abreisen lassen, ohne Ihnen nochmals gesagt zu haben, daß ich meine Pflicht getan habe, voll und ganz meine Pflicht, mit Einsicht und Überlegung, mit Menschenfreundlichkeit, mit Milde und mit Mut! Die Gründe, auf die sich Ew. Exzellenz' Mißbilligung in dem Schreiben vom 23. März stützt, sind erfunden und erlogen.
Das kann ich beweisen, und das wäre bereits geschehen, wenn Ew. Exzellenz mir eine halbe Stunde Gehör geschenkt hätten, wenn Sie eine halbe Stunde Zeit gefunden hätten, um Recht zu tun!
Das ist nicht geschehen, eine anständige Familie ist dadurch an den Bettelstab gebracht worden.
Ew. Exzellenz haben das Gewaltsystem von Raub und Totschlag, unter dem der arme Javaner schmachtet, gebilligt, und dessen klage ich Sie an! Das schreit zum Himmel!
An dem, was Sie von Ihrem indischen Diensteinkommen erspart haben, klebt Blut, Exzellenz!
Noch einmal bitte ich um einen Augenblick Gehör, sei es heute nacht, sei es morgen früh. Nicht für mich bitte ich, nur für die Sache, die ich vertrete, für die Sache der Gerechtigkeit und Menschlichkeit, die, meine ich, auch die Sache einer weisen Politik sein müßte.
Wenn es Ew. Exzellenz mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, von hier abzureisen, ohne mich gehört zu haben, so wird sich mein Gewissen mit der Überzeugung trösten, alles aufgeboten zu haben, um die traurigen, blutigen Ereignisse abzuwenden, die bald als Folge der Unkenntnis der Regierung über die wahre Stimmung in der Bevölkerung eintreten werden.
Max Havelaar.
Havelaar wartete den ganzen Abend, die ganze Nacht.
Er hatte gehofft, daß möglicherweise Empörung über den Ton seines Briefes erwirken würde, was er mit Milde und Geduld nicht erreicht hatte. Seine Hoffnung war eitel! Der Generalgouverneur reiste ab, ohne ihn gehört zu haben. Wieder hatte sich eine Exzellenz in die Heimat begeben, um sich zur Ruhe zu setzen!
Arm und verlassen irrte Havelaar umher, ... er suchte ...
Genug damit mein lieber Stern! Ich, Multatuli, nehme die Feder auf. Es ist nicht deine Aufgabe, Havelaars Leidensgeschichte zu schreiben! Ich habe dich ins Leben gerufen, ich ließ dich aus Hamburg kommen, ich lehrte dich in kurzer Zeit leidlich gut holländisch schreiben, ich ließ dich Louise Rosemeyer küssen, die in Zucker handelt, ... genug damit, Stern, du kannst wieder gehen.
»Dieser Schalmann und seine Frau ...«
Schweig, elendes Produkt schmutziger Habgier und gotteslästerlicher Heuchelei! Ich habe dich geschaffen, und unter meiner Feder bist du zum Scheusal gewachsen! Mich ekelt vor meinem eigenen Geschöpf ... Erstick im Kaffee und verschwinde!

Ich allein, Multatuli, »der ich viel gelitten habe«, nehme jetzt die Feder zur Hand. Ich verlange keine Nachsicht für die Form meines Buches. Ich habe sie gewählt, weil ich sie für geeignet hielt, mein Ziel zu erreichen.
Doppelt ist mein Ziel:
Zum ersten wollte ich dem kleinen Max und seinem Schwesterchen eine pusaka schaffen, wenn einstmals seine Eltern im Elend verkommen sind!
Ich wollte mit eigener Hand meinen Kindern den Adelsbrief schreiben.
Und zum zweiten: ich will gelesen werden!
Jawohl, ich will gelesen werden, von Staatsmännern, die verpflichtet sind, auf die Zeichen der Zeit zu achten, von Literaten, die doch ein Buch, von dem man so viel Schlechtes spricht, kennen lernen müssen, von Maklern, die sich für Kaffeeversteigerungen interessieren, von Kammerjungfern, die mein Buch für wenige Cent leihen, von Generalgouverneuren in Pension, von Ministern im Amt, von den Lakaien der Exzellenzen, von Bußpredigern, die mir ruhig vorwerfen mögen, ich lästere Gott, wo ich nur den Götzen angreife, den sie nach ihrem Bilde schufen, von den Tausenden und Zehntausenden der Droogstoppelrasse, die mein schönes Buch am lautesten preisen werden, um in aller Heimlichkeit ihren schmutzigen Handel weitertreiben zu können, von den Mitgliedern der Volksvertretung, die erfahren müssen, was in dem großen Reiche über See, das zu den Niederlanden gehört, vorgeht!
Jawohl, man wird mich lesen!
Und wenn dieses Ziel erreicht ist, bin ich zufrieden. Denn mir war es nicht darum zu tun, gut zu schreiben, ich wollte so schreiben, daß ich gehört wurde! Wie jemand, der laut brüllt »Haltet den Dieb!« sich wenig um den Stil seiner improvisierten Ausrufe kümmerte, so kümmert auch mich nichts, wenn nur mein »Haltet den Dieb!« laut in alle Ohren gellt!
»Das Buch ist wirr und bunt, ... ungleichmäßig, ... auf den äußerlichen Effekt gestellt, ... der Stil ist elend, ... der Verfasser ein blutiger Anfänger, ... talentlos ...«
Gut, gut! Meinetwegen! Aber: Der Javaner wird mißhandelt!
Eine Widerlegung dieser Tendenz meines Buches ist nicht möglich!
Je lauter man meine Arbeit tadelt, um so lieber ist es mir, denn um so deutlicher wird man mich hören. Und das will ich!
Nur Ihr, die ich in ihrer »Tätigkeit« und in ihrer »Ruhe« störe, Minister und Generalgouverneure, rechnet nicht zu stark auf die Schwerfälligkeit meiner Feder! Sie kann sich üben, und bei einiger Anstrengung bekommt sie es möglicherweise noch fertig, selbst dem Volke die Wahrheit begreiflich zu machen. Dann werde ich vielleicht dieses Volk um einen Sitz in seinem Parlament ersuchen, um dort dagegen zu protestieren, wenn Unwissenheit und moralische Feigheit sich gegenseitig die Zeugnisse von Sachverständnis und Rechtschaffenheit ausstellen, protestieren gegen die endlosen Expeditionen und Heldentaten gegen arme, elende Geschöpfe, die man mit Raub und Knechtung zur Revolte reizt, protestieren gegen die heuchlerischen öffentlichen Sammlungen für die Opfer eines organisierten chronischen Diebstahls!
Allerdings, die Rebellen sind ausgemergelte Skelette, die Räuber wehrhafte Männer!
Und wenn man mir den Sitz verweigert, wenn man mir nicht glaubt? Dann werde ich mein Buch in die wenigen Sprachen, die ich kenne, und in alle Zungen, die ich zu erlernen vermag, übersetzen, um von Europa zu fordern, was ich vergeblich in den Niederlanden gesucht habe.
In allen Hauptstädten würde das Lied gesungen werden mit dem Kehrreim:
Es liegt ein Raubstaat an der See
Zwischen Ostfriesland und Schelde!
Und wenn auch das nichts nützte?
Dann würde ich mein Buch übersetzen ins Malayische und Javanische, in die Sunda-, Alfur- und Battahidiome. Klewangklirrende Kriegsgesänge würde ich in die Gemüter der armen Märtyrer schleudern, denen ich, Multatuli, meine Hilfe gelobt habe.
Rettung und Hilfe auf gesetzlichem Wege, wo es geht, auf dem naturgesetzmäßigen Wege der Gewalt, wo es sein muß!
Und das würde sich sehr unangenehm auf die Kaffeeversteigerungen der Niederländischen Handelsgesellschaft auswirken!
Denn ich bin kein fliegenrettender Dichter, kein sanftmütiger Träumer wie der getretene Havelaar, der seine Pflicht tat mit dem Mute eines Löwen und Hunger litt mit der Geduld eines Murmeltieres im Winter.
Dieses Buch ist nur ein Anfang! Ich werde meine Kräfte und meine Angriffe steigern in dem Maße, in dem es erforderlich sein sollte.
Gott gebe, daß es nicht nötig werde!
Es wird nicht nötig werden! Denn Dir lege ich mein Buch unter die Augen, Dir, Wilhelm der Dritte, König, Großherzog und Fürst! Mehr noch als Fürst, Großherzog und König ... Kaiser des herrlichen Reiches Insulinde, das sich wie ein smaragdener Gürtel um den Äquator schmiegt.
Dich darf ich voll Vertrauen fragen, ob es Dein kaiserlicher Wille ist, daß Havelaar bespien wird mit dem Geifer der Slymering und Droogstoppel! Und daß dort, fern über See, dreißig Millionen Deiner Untertanen mißhandelt und geknechtet werden in Deinem Namen!