
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ehe ich fortfahre, möchte ich bemerken, daß der junge Stern nunmehr bei uns angelangt ist. Es ist ein ganz nettes Bürschchen. Er macht einen flotten, angenehmen Eindruck und scheint anstellig, aber ich glaube, er »schwärmt«. – Marie ist 13 Jahre alt! – Seine Ausstattung ist ganz gut. Ich lasse ihn erst einmal am Kopierbuch arbeiten, damit er sich im holländischen Stil üben kann. Ich bin gespannt, ob nun bald Aufträge von Ludwig Stern kommen. Marie soll ein Paar Pantoffeln für ihn stricken ... für den jungen Stern, meine ich. Busselinck & Waterman haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht! Ein ordentlicher Makler geht nicht auf Schleichwegen, das ist meine Meinung!

Den Tag nach dem Kränzchen bei Rosemeyers, die in Zucker machen, rief ich Fritz und beauftragte ihn, mir das Paket von dem Schalmann zu bringen. Ihr müßt wissen, liebe Leser, daß ich in meinem Hause sehr auf Frömmigkeit, Rechtschaffenheit und Sittenstrenge achte. Nun, am Abend vorher, gerade als ich meine erste Birne geschält hatte, las ich in dem Gesicht eines der Mädchen, daß irgend etwas in dem Gedicht vorkam, was nicht schicklich war. Ich selber hatte zwar nicht auf das Zeug gehört, aber ich bemerkte, daß Betsy ihr Brötchen zerkrümelte und wußte Bescheid. Ihr werdet schon erkannt haben, liebe Leser, daß Ihr es bei mir mit jemand zu tun habt, der in der Welt Bescheid weiß. Ich ließ mir also von Fritz das Gedicht, das gestern abend so angesprochen hatte, vorlegen, und ich fand sehr bald den Satz, der Betsy in Verlegenheit gebracht hatte. Es ist da etwas viel von Liebe die Rede, das mag noch hingehen ..., aber plötzlich taucht auch ein Kind auf: »das kaum dem Mutterschoß entsprossen«, und das fand ich durchaus unpassend, – von so etwas zu reden meine ich, – und meine Frau ist ganz derselben Ansicht. Marie ist 13 Jahre alt. Von »Kohlköpfen« und »Störchen« wird bei uns im Hause nicht gesprochen, aber so die Dinge beim Namen zu nennen, das finde ich ungebührlich, weil ich durchaus auf Sittlichkeit halte. Ich verbot Fritz, der es ja nun einmal auswendig weiß, es jemals wieder aufzusagen, – zum mindesten nicht, bevor er Mitglied der »Doktrina« sein wird, weil dort keine jungen Mädchen hinkommen, – und dann steckte ich ihn in meinen Schreibtisch, den Zettel mit dem Gedicht mein ich. Aber ich mußte wissen, ob nicht noch mehr anstößige Sachen in dem Paket waren. So fing ich an, zu suchen und zu blättern. Alles konnte ich nicht lesen, denn manches war in Sprachen abgefaßt, die ich nicht verstehe, aber plötzlich fiel mein Blick auf ein Bündel: »Bericht über die Kaffeekultur in der Residentschaft Menado Menado auf Celebes..«
Mein Herz klopfte, denn ich bin doch schließlich Makler in Kaffee – Lauriergracht Nr. 37 – und Menado ist eine gute Marke. Also hatte der Schalmann, – der so unsittliche Verse machte, – auch in Kaffee gearbeitet. Nun sah ich das Paket mit ganz anderen Augen an und fand Abhandlungen darin, die ich zwar nicht alle begriff, die aber wirklich von einiger Sachkenntnis zeugten. Es waren Statistiken, Tabellen, Berechnungen und Ziffernreihen, in denen kein Reim zu finden war, und alles mit solch einer Sorgfalt und Genauigkeit gemacht, daß ich, ehrlich gesagt – denn ich halte auf Wahrheit – auf den Gedanken kam, daß der Schalmann, wenn unser dritter Buchhalter weggeht – was sehr wohl geschehen kann, da er alt und gebrechlich wird – ganz gut dessen Stelle einnehmen könnte. Es ist selbstverständlich, daß ich erst Erkundigungen über seine Ehrlichkeit, seine Religion und seine Lebensführung einziehen werde, denn ich nehme niemand in mein Kontor, ehe ich nicht über diese Punkte volle Gewißheit habe. Das ist ein festes Prinzip von mir, Ihr habt es aus meinem Brief an Ludwig Stern ersehen können.
Ich wollte nicht, daß Fritz bemerkte, daß mich das Paket zu interessieren begann, weshalb ich ihn wegschickte. Mir wurde tatsächlich schwindlig, wie ich so ein Bündel nach dem anderen nahm und die Aufschriften las. Es ist wahr, es waren viel Verse darunter, aber ich fand auch viel Nützliches, und ich war erstaunt über die Verschiedenheit der behandelten Gegenstände. Ich gebe zu, – denn ich halte auf Wahrheit, – daß ich, der ich stets in Kaffee gehandelt habe, nicht imstande war, alles nach seinem Wert zu beurteilen, aber, selbst ohne diese Beurteilung, waren die Aufschriften allein schon seltsam genug. Da ich Euch die Geschichte von dem Griechen erzählt habe, wißt Ihr schon, daß ich in meiner Jugend etwas Latein getrieben habe, und wie sehr ich mich auch in meiner Korrespondenz aller Zitate enthalten, – die ja in einem Makler-Kontor durchaus nicht am Platze wären, – fiel mir doch beim Lesen von all diesen Sachen ein: multa, non multum Wörtlich: Vieles, nicht vielerlei., oder: de omnibus aliquid, de toto nihil Von allem etwas, doch nichts ganzes..
Aber das geschah eigentlich nur aus einem kleinen Anfall von Bosheit heraus, und um das gelehrte Zeug, das da vor mir lag, lateinisch anzusprechen, als daß ich es in Wirklichkeit so meinte. Denn sowie ich mich mit dem einen oder anderen Stück etwas eingehender beschäftigte, mußte ich erkennen, daß der Schreiber über seine Sache Bescheid zu wissen schien, und daß seine Angaben und Meinungen solid und zuverlässig begründet waren.
Ich fand die folgenden Abhandlungen und Aufsätze:
Über das Sanskrit als Mutter der germanischen Sprachzweige.
Über die Strafbestimmungen auf Kindermord.
Über den Ursprung des Adels.
Über die Verschiedenheit der beiden Begriffe: » Unendliche Zeiten« und » Ewigkeit«.

Über die Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Über das Buch Hiob (ich fand noch etwas über Hiob, aber das waren Verse).
Über Proteïne in der atmosphärischen Luft.
Über die russische Politik.
Über die Vokale.
Über Zellengefängnisse.
Über die alten Vorstellungen vom: horror vacui.
Über die Notwendigkeit der Abschaffung strafrechtlicher Moralgesetze.
Über die Ursachen des Aufstandes der Niederlande gegen die Spanier, welche nicht in dem Streben nach religiöser und politischer Freiheit liegen.
Über das Perpetuum Mobile, die Quadratur des Kreises und die Wurzel wurzelloser Zahlen.
Über das Gewicht des Lichtes.
Über den Rückgang der Zivilisation seit der Entstehung des Christentums. (Nanu?)!
Über die Isländische Mythologie.
Über Rousseaus » Emile«.
Über die Zivilklage im Handelsrecht.
Über den Sirius als Mittelpunkt eines Sonnensystems.
Über Einfuhrzölle und ihre Unzweckmäßigkeit, ihr Unrecht und ihre Unsittlichkeit. (Das ist mir neu.)
Über die Verse als älteste Sprache. (Das glaube ich nicht.)
Über weiße Ameisen.
Über das Widernatürliche von Schuleinrichtungen.
Über die Prostitution in der Ehe. (Das ist ein schändliches Kapitel.)
Über hydraulische Bewässerung im Zusammenhang mit den Reispflanzungen.
Über das scheinbare Übergewicht der westlichen Zivilisation.
Über Kataster, Registratur und Stempel.
Über Bilderbücher, Fabeln und Sinnsprüche. (Das werde ich mal lesen, denn er dringt darin auf Wahrheit.)
Über den Zwischenhandel. (Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich glaube, er will die Makler abschaffen. Aber ich habe es mir doch zur Seite gelegt, weil verschiedenes darin vorkommt, was ich für mein Buch gebrauchen kann.)
Über das Erbrecht als bester Steuerquell.
Über die Erfindung der Keuschheit. (Das ist mir unverständlich.)
Über Vervielfältigung. (So einfach dieser Titel ist, ich habe tatsächlich eine Menge darin gefunden, woran ich früher nie gedacht habe.)
Über eine gewisse Art von Geist bei den Franzosen, als Folge ihrer Spracharmut. (Das lass' ich gelten! Geist und Armut – er scheint Bescheid zu wissen.)
Über den Zusammenhang zwischen Romanen von August Lafontaine und der Schwindsucht. (Das werde ich einmal lesen, weil nämlich ein paar Bücher von diesem Lafontaine bei uns auf dem Boden liegen. Aber er sagt, der Einfluß offenbare sich erst im zweiten Gliede. Mein Großvater las nicht.)
Über die außereuropäische Macht der Engländer.
Über das Gottesgericht im Mittelalter und heute.
Über die Rechenkunst der Römer.
Über den Mangel an Poesie bei Komponisten.
Über Pietismus, Biologie und Tischrücken.
Über ansteckende Krankheiten.
Über den maurischen Baustil.
Über die Macht der Vorurteile, ersichtlich aus den vielen Krankheiten, die ihre Ursache in Luftzug haben sollen. (Ich sagte ja gleich, es ist eine sonderbare Aufstellung.)
Über die deutsche Einheit.
Über die Länge auf See. (Ich vermute, daß auf See alles genau so lang ist, wie an Land.)
Über die Pflichten der Regierung bezüglich öffentlicher Lustbarkeiten.
Über die Verwandtschaft der schottischen und friesischen Sprache.
Über Prosodie.
Über die Schönheit der Frauen von Nîmes und Arles, unter Berücksichtigung des Kolonisationssystemes der Phönizier.
Über Landbauverträge auf Java.
Über die Saugkraft eines neuen Pumpenmodells.
Über die Legitimität der Dynastien.
Über die Volksliteratur bei javanischen Rhapsoden.
Über eine neue Art, die Segel zu reffen.
Über die Perkussion bei Handgranaten. (Das Kapitel stammt aus dem Jahre 1847, ist also vor Orsini Graf Orsini, der 1858 ein Bombenattentat auf Napoleon III. beging. Der Kaiser blieb unverletzt. entstanden.)
Über den Ehrbegriff.
Über apokryphe Bücher.
Über die Gesetze des Solon, Lykurg, Zoroaster und des Confucius.
Über Shakespeare als Geschichtsschreiber.
Über die Sklaverei in Europa. (Was er damit bezweckt, verstehe ich nicht. Aber mir bleibt manches bei ihm unverständlich.)
Über das fürstliche Begnadigungsrecht.
Über die chemischen Bestandteile des Ceylon-Zimtes.
Über die Mannszucht auf Kauffahrteischiffen.
Über die Opiumpacht auf Java.
Über die Bestimmungen hinsichtlich des Verkaufes von Giften.
Über den Durchstich der Landenge von Suez und seine Folgen.
Über die Bezahlung der Landrente in Naturalien.
Über die Kaffeekultur in Menado. (Habe ich schon erwähnt.)
Über den Verfall des Römischen Reichs.
Über die deutsche Gemütlichkeit.
Über die skandinavische Edda.
Über die Pflicht Frankreichs, sich im Indischen Archipel ein Gegengewicht gegen die Engländer zu schaffen. (Das war französisch geschrieben, warum weiß ich nicht.)
Über die Herstellung von Essig.
Über die Verehrung Schillers und Goethes im deutschen Mittelstand.
Über die Rechte des Menschen auf Glück.
Über das Recht des Aufstandes bei Unterdrückung. (Das war auf Javanisch, ich habe den Titel erst später erfahren.)
Über die ministerielle Verantwortlichkeit.
Über einige Punkte im Kriminalrecht.
Über die berechtigte Forderung eines Volkes, daß die von ihm aufgebrachten Steuern zu seinem Wohle angewandt werden. (Das war wieder auf javanisch.)
Über das doppelte A und das griechische ETA.
Über die Existenz eines unpersönlichen Gottes im Herzen der Menschen. (Eine ganz infame Lüge.)
Über den Stil.
Über eine Verfassung des Reiches »Insulinde« Insulinde, die von Multatuli stammende und heute in den Niederlanden sehr gebräuchliche Bezeichnung des holländischen Kolonialbesitzes in Ostindien.. (Von einem solchen Reich hab' ich noch nie etwas gehört.)
Über Pedanterie. (Ich glaube, dieses Kapitel hat er mit viel Sachkenntnis geschrieben.)
Über die Verpflichtungen Europas Portugal gegenüber.
Über Brennbarkeit von Wasser. (Wahrscheinlich meint er Branntwein.)
Über den Milchsee. (Mir unbekannt. Er scheint in der Gegend von Banda zu liegen.)
Über Seher und Propheten.
Über Ebbe und Flut der Zivilisation.
Über die epidemische Korruption der Staatsverwaltungen.
Über bevorzugte Handelsgesellschaften. (Hierin kommt verschiedenes vor, das ich für mein Buch benötige.)
Über Etymologie als Hilfsquelle für ethnologische Studien.
Über die Vogelnestklippen an der Südküste Javas.
Über persönliche Begriffe als Maßstab der Verantwortlichkeit in der sittlichen Welt. (Lächerlich! Er sagt, jeder müsse sein eigener Richter sein. Wohin würde das denn führen?)
Über Galanterie.
Über den Versbau der Hebräer.
Über das » century of inventions« Jahrhundert der Erfindungen. des Marquis von Worcester.
Über die nicht-essende Bevölkerung der Insel Rotti bei Timor. (Da muß es sich billig leben lassen.)
Über die Menschenfresserei der Battah's und die Kopfjägerei der Alfuren.
Über das Mißtrauen gegen die öffentliche Sittlichkeit. (Er will, vermute ich, die Türschlösser abschaffen. Ich bin jedenfalls dagegen.)
Über » das Recht« und » die Rechte«.
Über Béranger als Philosoph. (Mir wieder zu hoch.)
Über die Abneigung der Malayen gegen die Javaner.
Über die Wertlosigkeit des Unterrichtes an den sogenannten Hochschulen.
Über den lieblosen Geist unserer Vorfahren ersichtlich aus ihren Anschauungen über Gott. (Schon wieder etwas Gottloses.)
Über den Zusammenhang der Sinne. (Das ist schon richtig, als ich ihn sah, roch ich Rosenöl.)
Über die Wurzel des Kaffeebaumes. (Das habe ich für mein Buch beiseite gelegt.)
Über Gefühl, Gefühlsduselei, Sensibilität, Empfindelei usw.
Über das Durcheinander von Mythologie und Religion.
Über die Zukunft des Niederländischen Handels. (Das ist eigentlich das Kapitel, das mich veranlaßt hat, dieses Buch zu schreiben. Er sagt, daß die Kaffeeversteigerungen nicht immer in so großem Stil abgehalten werden würden wie jetzt, und ich lebe für mein Fach.)
Über Genesis. (Ein tolles Stück.)
Über die Geheimbünde der Chinesen.
Über das Zeichnen als natürliche Schrift. (Er behauptet, ein kaum zur Welt gekommenes Kind könne schon zeichnen.)
Über die Wahrheit in der Poesie. (Stimmt!)
Über die Unbeliebtheit der Reisschälmühlen auf Java.
Über den Zusammenhang der Poesie und der Mathematik.
Über den Preis von Java-Kaffee. (Das habe ich beiseite gelegt.)
Über ein europäisches Münzsystem.
Über Bewässerung von Gemeindefeldern.
Über den Einfluß der Rassenvermischung auf die Geistesbildung.
Über Gleichgewicht im Handel. (Er spricht darin vom Wechsel-Agio; ich habe es für mein Buch vorgemerkt.)
Über die Beständigkeit asiatischer Gewohnheiten. (Er behauptet, Jesus hätte einen Turban getragen.)
Über die Lehren Malthus' über Bevölkerungsziffern im Verhältnis zur Nahrungsbeschaffung.
Über die ursprüngliche Bevölkerung von Amerika.
Über die Hafenpolizei von Batavia, Samarang und Surabaja.
Über Baukunst als Ausdruck einer Idee.
Über das Verhalten europäischer Beamten gegenüber den eingeborenen Fürsten auf Java. (Hiervon beabsichtige ich, einiges in mein Buch aufzunehmen.)
Über Amsterdamer Kellerwohnungen.
Über das Versagen eines höheren Wesens bei reinen Naturgesetzen.
Über das Salzmonopol auf Java.
Über die Würmer in der Sagopalme. (Die, seiner Behauptung nach, gegessen würden – na!)
Über Sprüche, Prediger, das Hohelied und die Pantuns der Javaner.
Über das » jus primi occupantis« Das Recht der ersten Besitzergreifung..
Über die Armut der Malerei.
Über die Unsittlichkeit des Angelns. (Hat man sowas schon mal gehört?)
Über die Untaten der Europäer außerhalb Europas.
Über die Waffen der niederen Tiersorten.
Über das » jus talionis« Das Recht der Vergeltung.. (Schon wieder etwas sehr Unsittliches. Es kam ein Gedicht darin vor, das ich, wenn ich es überhaupt ausgelesen hätte, sicher sehr unanständig gefunden haben würde.)

Und das war noch nicht alles! Ich fand, – um von den Versen, die in großer Menge und in allen Sprachen vorkamen, gar nicht erst zu reden, – eine Anzahl Bündel ohne jegliche Aufschrift, malayische Romanzen, javanische Kriegsgesänge, und was nicht alles noch! Auch Briefe fand ich, worunter viele in Sprachen abgefaßt waren, die ich nicht verstand. Einige waren an ihn geschrieben oder genauer, es waren nur Abschriften an ihn gerichteter Briefe, doch schien er damit einen bestimmten Zweck zu verfolgen, denn alles war durch fremde Personen gezeichnet und bestätigt als: »gleichlautend mit dem Original«. Dann fand ich noch Auszüge aus Tagebüchern, Aufzeichnungen und lose Blätter ... einige wirklich sehr lose.
Ich hatte, wie ich schon sagte, einige Stücke beiseite gelegt, weil sie mir in Beziehung zu meiner Branche zu stehen schienen, und für mein Fach lebe ich. Aber ich muß zugeben, daß ich mit dem Rest eigentlich nichts anzufangen wußte. Ihm das Paket zurückzuschicken, war unmöglich, denn ich wußte nicht, wo er wohnte. Und geöffnet war es nun einmal. Ich hätte nicht leugnen können, daß ich Einblick darin genommen hatte, was ich schließlich sowieso nicht getan hätte, da ich doch sehr wahrheitsliebend bin. Auch scheiterte mein Versuch, das Paket wieder so zu schließen, daß man nicht bemerken konnte, daß es geöffnet worden war. Überdies kann ich nicht verhehlen, daß einige Abhandlungen über Kaffee mir das stärkste Interesse einflößten und ich gern davon Gebrauch gemacht hätte. Ich las täglich einige Seiten und kam immer mehr zu der Überzeugung, daß man unbedingt Makler in Kaffee gewesen sein muß, um so genau über die Dinge Bescheid zu wissen. Ich bin sicher, daß die Rosemeyers, die in Zucker machen, nie etwas derartiges unter die Augen bekommen haben.
Nun fürchtete ich, daß der Schalmann wieder eines Tages plötzlich vor mir stehen und mir wieder etwas zu sagen haben würde. Ich fand es ärgerlich, daß ich an jenem Abend den Kapelsteeg entlang gegangen war, und ich sah ein, daß man nie vom richtigen Weg abweichen soll. Er hätte mich selbstverständlich um Geld angegangen und mir von seinem Paket gesprochen. Ich hätte ihm vielleicht etwas gegeben, und wenn er mir dann am nächsten Tag diese Unmasse Geschreibsel zugeschickt hätte, wäre es mein gesetzliches Eigentum gewesen. Ich hätte dann Spreu und Weizen voneinander sondern können, hätte die Kapitel, die ich für mein Buch gebrauchen kann, herausgesucht und den Rest verbrannt oder in den Papierkorb geworfen, was ich jetzt alles nicht tun darf. Denn wenn er wiederkäme, würde ich es ihm aushändigen müssen, und wenn er bemerkte, daß ich mich für einige Sachen interessiere, würde er wahrscheinlich einen viel zu hohen Preis dafür verlangen. Nichts gibt nämlich dem Kaufmann mehr Übergewicht als die Entdeckung, daß der Käufer um seine Ware verlegen ist. Ein solcher Anschein wird deshalb natürlich von einem tüchtigen Menschen, der sein Fach versteht, ängstlich vermieden.
Ein anderes Beispiel, – ich erwähnte es bereits, – das beweist, wie der ständige Besuch der Börse einen für menschenfreundliche Eindrücke empfänglich macht, ist folgendes: Bastiaans, – das ist der dritte Buchhalter, der so alt und gebrechlich wird, – war in letzter Zeit von den dreißig Tagen im Monat kaum fünfundzwanzig im Kontor gewesen, und wenn er wirklich ins Kontor kommt, macht er oft seine Arbeit auch noch schlecht. Als ein ehrlicher Mann bin ich gegenüber der Firma, – Last & Co., seit Meyer ausgeschieden ist, – verpflichtet, darauf zu achten, daß jeder seine Arbeit erledigt, und es entspricht nicht meiner Gewohnheit, aus falschen Gefühlen, wie Mitleid, das Geld des Geschäfts zum Fenster hinauszuwerfen. Das ist mein festes Prinzip. Lieber gebe ich dem Bastiaans aus eigener Tasche ein Dreiguldenstück, als daß ich fortfahre, ihm jährlich 700 Gulden auszuzahlen, die er nicht mehr verdient. Ich habe ausgerechnet, daß der Mann seit 34 Jahren der Firma, – sowohl Last & Co., als auch Last & Meyer, aber Meyers sind ja nun raus, – ungefähr 15 000 Gulden an Gehalt zu stehen gekommen ist, und ich meine, das ist für einen einfachen Bürger eine anständige Summe. Es gibt in seinem Stand nicht viele, die so viel haben. Ein Recht zu klagen steht ihm also nicht zu. Ich bin auf diese Berechnung gekommen durch das Kapitel, das der Schalmann über Multiplikation geschrieben hat.

Der Schalmann hat eine leserliche Handschrift, dachte ich weiter. Überdies sah er hinreichend heruntergekommen aus und wußte nicht, wie spät es war ...! Wie wäre es also, kalkulierte ich, wenn ich ihm Bastiaans Stelle gäbe! Ich würde ihm in diesem Falle schon sagen, er müsse mich Mynheer nennen, aber das würde er wohl schon von selbst tun, denn ein Angestellter kann doch seinen Chef nicht beim Namen nennen, und ihm wäre wahrscheinlich für sein ganzes Leben geholfen. Er würde mit 400 bis 500 Gulden beginnen können – Bastiaans hatte auch lange genug gearbeitet, bis er auf 700 kam – und ich hätte eine gute Tat begangen. Ja, sogar mit 300 Gulden würde er schon anfangen können, denn da er ja kein Fachmann ist, könnte er die ersten Jahre als eine Art Lehrzeit ansehen, was auch ganz in der Ordnung wäre, denn er kann sich nicht mit Menschen, die schon einige Erfahrung haben, auf eine Stufe stellen. Ich bin überzeugt, er würde sich mit 200 Gulden begnügen. Aber ich traute ihm nicht recht in puncto Moral ... er hatte seinen Schal um! Und obendrein wußte ich nicht, wo er wohnte.
Ein paar Tage später waren Fritz und der junge Stern zusammen bei einer Bücherauktion im »Berner Wappen«. Ich hatte Fritz verboten, sich etwas zu kaufen, jedoch Stern, der ein ganz auskömmliches Taschengeld hat, kam mit einigen Schwarten nach Hause. Das ist seine Sache. Aber plötzlich erzählte Fritz, er habe den Schalmann gesehen, der bei der Versteigerung beschäftigt gewesen zu sein schien. Er hatte die Bücher aus der Kiste genommen und sie auf der langen Tafel dem Auktionator zugeschoben. Fritz erzählte, daß er sehr blaß ausgesehen hätte, und daß einer der aufsichtführenden Herren ihn ausgescholten habe, weil er ein paar Jahrgänge der »Aglaja« fallen gelassen hatte, was ich auch sehr ungeschickt finde, denn das ist eine sehr hübsche Sammlung von Damenhandarbeiten. Marie hält sie zusammen mit den Rosemeyers, die in Zucker machen. Sie häkelt daraus ... aus der »Aglaja« mein' ich. Aber aus diesem Schelten hatte Fritz herausgehört, daß er 15 Stüber Stüber, gleich 5 Cent. den Tag verdient. »Meinen Sie, ich hätte Lust, täglich 15 Stüber an Sie zu vergeuden?« hatte der Herr gesagt. Ich rechnete aus, daß 15 Stüber täglich – ich nehme an, die Sonn- und Festtage zählen nicht, denn sonst hätte der Mann ein Monats- oder Jahresgehalt genannt – jährlich 225 Gulden ausmachten. Ich bin ein Mann schneller Entschließungen, – wenn man schon so langjährige Erfahrungen hat, weiß man immer sofort, was man zu tun hat, – und den folgenden Morgen war ich schon an aller Frühe bei Gaafzuiger. So heißt der Buchhändler, der die Versteigerung abgehalten hatte. Ich fragte nach dem Angestellten, der die »Aglaja« hatte fallen lassen.

»Der ist entlassen,« sagte Gaafzuiger. »Er war faul, schwerfällig und kränklich.«
Ich kaufte eine Schachtel Klebeetiquetten und war sofort entschlossen, mir die Sache mit Bastiaans noch eine Weile mit anzusehen. Ich konnte es nicht über mich bekommen, einen alten Mann vor die Türe zu setzen. Streng und gewissenhaft, aber, wenn es geht, auch nachsichtig, das ist immer mein Prinzip gewesen! Jedoch ich versäume nie irgend etwas, was mir geschäftlich von Nutzen sein kann, und darum fragte ich Gaafzuiger, wo der Schalmann wohnte. Er gab mir die Adresse, und ich schrieb sie mir auf.
Ich dachte ununterbrochen über mein Buch nach, aber da ich für Wahrheit bin, muß ich offen gestehen, daß ich nicht wußte, wie ich die Sache anfangen sollte. Eins stand fest: Das Material, das ich in des Schalmanns Paket gefunden hatte, war für jeden Makler in Kaffee von größter Wichtigkeit. Die Frage war nur, wie ich dieses Material sichten und ordnen sollte. Jeder Makler weiß, wie wichtig bei jeder Mischung eine sachgemäße Sortierung ist.
Aber schreiben – außer der Korrespondenz im Geschäft – ist durchaus nicht mein Fall, und doch fühlte ich deutlich, daß ich schreiben mußte, da vielleicht die Zukunft der ganzen Branche davon abhängt. Die Ratschläge, die ich in den Bündeln des Schalmanns fand, sind nicht von der Art, daß Last & Co. allein einen Nutzen daraus ziehen könnten. Wenn das der Fall wäre, würde ich – das wird jeder begreifen – nicht extra ein Buch drucken lassen, das schließlich Busselinck & Waterman auch zu lesen bekämen, denn wer der Konkurrenz den richtigen Weg zu neuen Vorteilen zeigt, ist verrückt. Das ist ein unerschütterliches Prinzip von mir. Nein, es leuchtet mir ein, daß dem ganzen Kaffeemarkt eine Gefahr drohte, der entgegenzutreten es der vereinten Kräfte aller Makler bedarf, und es schien mir sogar möglich, daß diese Kräfte allein nicht ausreichen könnten, so daß schließlich die Zuckerhändler und die Makler in Indigo auch noch dabei erforderlich sein würden.
Wenn ich so schreibenderweise nachdenke, erscheint es mir, daß schließlich sogar die Schiffsreedereien von der Gefahr betroffen werden können und die Kauffahrteiflotte ... sicher, das stimmt schon! Und ebenso die Seiler, der Finanzminister, die Armenverwaltung und die anderen Ministerien, die Pastetenbäcker, die Kurzwarenhändler, die Frauen, die Schiffsbaumeister, die Großhändler und die Detailleure, die Hausverwalter und die Gärtner!
Und, – seltsam doch, was einem Menschen nicht alles für Gedanken beim Schreiben kommen, – mein Buch geht auch die Müller an, und die Theologen, die Schnapsbrenner und die Ziegelbrenner, die Leute, die von der Staatsschuld leben, und die Brunnenbauer, die Weber, die Schlächter, die Lehrlinge in jedem Maklerkontor und die Aktionäre der Niederländischen Handelsgesellschaft und eigentlich, ganz genau besehen, alle anderen Menschen überhaupt!
Und den König auch ... ja, den König vor allen anderen! Mein Buch muß in die Welt hinaus. Das steht felsenfest! Und wenn selbst Busselinck & Waterman es schließlich auch zu lesen bekommen ... Neid ist meine Sache nicht. Aber Kriecher und hinterhältige Schleicher sind sie, dabei bleibe ich! Ich habe es erst heute zu dem jungen Stern gesagt, als ich ihn in die »Artis« einführte. Er kann das ruhig seinem Vater schreiben.
So saß ich noch ein paar Tage und wußte nicht, wie ich es mit meinem Buch anfangen sollte, da plötzlich und unerwartet half mir Fritz über den Berg. Ich habe ihm das natürlich nicht eingestanden, weil ich es nicht für richtig halte, jemanden merken zu lassen, daß man ihm verpflichtet ist, – das ist mein festes Prinzip, – aber stimmen tut es schon. Er erzählte, daß Stern so ein gescheiter Junge sei, und daß er so fabelhafte Fortschritte in der Sprache mache und bereits die deutschen Verse des Schalmannes ins Holländische übersetzt hätte, Ihr seht, in meinem Haus war die Welt ganz verdreht: Der Holländer hatte Deutsch geschrieben, und der Deutsche übersetzte es ins Holländische. Wenn jeder bei seiner eigenen Sprache geblieben wäre, hätten sie sich die Mühe gespart. Aber, dachte ich, wie wäre es, wenn ich mein Buch durch diesen Stern schreiben ließe? Wenn ich noch etwas hinzuzufügen habe, schreibe ich eben selber von Zeit zu Zeit ein Kapitel. Fritz kann schließlich auch helfen. Er hat ein Buch mit der Rechtschreibung aller Wörter, und Marie kann das alles ins Reine übertragen. Das ist für die Leser gleichzeitig eine Bürgschaft, daß das Buch nichts Unsittliches enthält. Denn Ihr werdet doch begreifen, daß ein anständiger Makler seiner Tochter nichts in die Hände geben wird, was nicht ganz den guten Sitten entspräche!
Ich habe die beiden Jungen in meinen Plan eingeweiht, und sie fanden ihn gut. Nur schien Stern, der eine Menge orthographische Gelehrtheit im Kopfe hat – wie das bei vielen Deutschen der Fall ist – etwas gegen meinen Vorschlag über die Art der Ausführung einzuwenden zu haben. Das behagte mir zwar nicht sehr, aber weil die Frühjahrsversteigerung vor der Tür steht, und von Ludwig Stern noch keine Aufträge eingelaufen sind, wollte ich ihm nicht zu sehr widersprechen. Er sagte, wenn ihm das Herz überströme für das Wahre und Schöne, ihn keine Macht der Welt davon abhalten könne, die Töne anzuschlagen, die mit diesen Gefühlen übereinstimmen, und daß er viel lieber schweigen würde, als seine Worte entwürdigt zu sehen durch die entehrenden Ausdrücke des Alltags. Ich fand das zwar ein bißchen überspannt von Stern, aber mein Fach geht mir über alles, und der Alte ist ein guter Kunde. Wir setzten also fest:
§ 1. Daß er jede Woche ein paar Kapitel für mein Buch abzuliefern hat.
§ 2. Daß ich an seiner Bearbeitung nichts verändern darf.
§ 3. Daß Fritz die Sprachfehler verbessern soll.
§ 4. Daß ich dann und wann ein Kapitel schreiben werde, um dem Buch einen soliden Anstrich zu geben.
§ 5. Daß das Buch den Titel »Die Kaffeeversteigerungen der Niederländischen Handelsgesellschaft« führen sollte.
§ 6. Daß Marie eine saubere Abschrift des Buches für den Drucker machen soll, daß man aber auf sie Rücksicht zu nehmen habe, wenn Wäsche ist.
§ 7. Daß die fertigen Kapitel jede Woche zum Kränzchen vorgelesen werden sollen.
§ 8. Daß jede Unsittlichkeit zu vermeiden ist.
§ 9. Daß mein Name nicht auf dem Titel stehen soll, da ich doch Makler bin.
§ 10. Daß Stern eine deutsche, eine englische und eine französische Übersetzung des Werkes machen soll, weil – seiner Behauptung nach – solche Sachen im Auslande mit mehr Verständnis aufgenommen würden als bei uns.
§ 11. Darauf bestand Stern durchaus, daß ich dem Schalmann ein Ries Papier, ein Gros Federn und ein Fläschchen Tinte schicken soll.
Ich war mit allem einverstanden, denn ich hatte es sehr eilig mit meinem Buch. Stern hatte den folgenden Tag sein erstes Kapitel bereits in Angriff genommen, und damit ist für Euch, liebe Leser, gleichzeitig die berechtigte Frage beantwortet, wie ein Makler in Kaffee, – Last & Co., Lauriergracht Nr. 37 – dazu kommt, ein Buch zu schreiben, das einem Roman sehr ähnlich sieht.
Aber kaum hatte Stern mit seiner Arbeit begonnen, als er auf große Schwierigkeiten stieß. Außer der Mühe, aus solcher Unmenge von Baumaterial das Nötige auszusuchen und zu ordnen, kamen in dem Manuskript fortwährend Worte und Ausdrücke vor, die er nicht verstand und die auch mir vollständig fremd erschienen. Es war meistens Malayisch oder Javanisch. Ferner stieß man hier und dort auf Abkürzungen, die nur mit Mühe zu entziffern waren. Ich sah ein, daß wir den Schalmann brauchten, und da ich es nicht für gut halte, wenn ein junger Mensch unangebrachte Bekanntschaften macht, konnte ich natürlich weder den jungen Stern noch Fritz hinschicken.
Ich steckte mir also etwas Zuckerzeug ein, das vom letzten Kränzchen übriggeblieben war, – denn ich denke immer an alles, – und suchte den Schalmann auf. Pompös war seine Behausung nicht gerade, aber die Gleichheit für alle Menschen, also auch was ihre Wohnungen betrifft, ist ein Hirngespinst. Das hatte er selbst gesagt in seiner Abhandlung über den Anspruch auf das Glück. Außerdem mag ich die Menschen nicht, die immer unzufrieden sind.
Es war in der Langen Leidener Querstraße in einem Hinterhaus. Im unteren Teil des Hauses wohnte ein Althändler, der allerlei Zeug verkaufte, Tassen, Schüsseln, Möbel, alte Bücher, Glassachen, Bilder von Van Speyk usw. Ich war sehr besorgt, daß ich etwas zerbrechen könnte, denn in solchem Falle fordern die Leute meist einen Ersatz, der in keinem Verhältnis steht zu dem tatsächlichen Wert der Sache. Ein kleines Mädchen saß auf der Treppe und zog seine Puppe an. Ich fragte, ob Herr Schalmann hier wohne. Sie lief weg, und die Mutter kam.

»Ja, der wohnt hier, Mynheer. Gehen Sie nur die Treppe hinauf nach dem ersten Stock, und dann die Treppe nach dem zweiten Stock, und dann noch eine Treppe, dann sind Sie schon da, und Sie stoßen von selbst darauf. Minchen, geh' mal sagen, daß ein Herr da ist. Wen kann sie anmelden, Mynheer?«
Ich sagte, daß ich Mynheer Droogstoppel sei, Makler in Kaffee auf der Lauriergracht, aber anmelden würde ich mich schon selber. Ich kletterte so hoch, wie sie mir gesagt hatte, und hörte im dritten Stock eine Kinderstimme singen: »Bald kommt Papa, der süße Papa.« Ich klopfte an, und die Tür wurde geöffnet von einer Frau oder Dame, ich weiß selbst nicht recht, was ich von ihr halten mußte. Sie sah sehr blaß aus. Ihre Züge trugen Spuren von Müdigkeit und erinnerten mich an meine Frau, wenn die Wäsche vorbei ist. Sie war bekleidet mit einer langen weißen Bluse oder Jacke, die ihr bis zu den Knieen ging und vorne mit einer schwarzen Nadel zusammengehalten war. Anstatt eines richtigen Rockes trug sie darunter ein Stück dunkel geblümte Leinewand, das einige Male um den Körper geschlungen zu sein schien und ihre Hüften und Knie sehr knapp umschloß. Es war keine Spur von Falten, Weite oder Umfang zu sehen, wie sich das bei einer Frau doch gehört. Ich war froh, daß ich Fritz nicht geschickt hatte, denn ihre Kleidung machte auf mich einen sehr unanständigen Eindruck, und das Befremdende daran war noch, daß sie sich ganz ungezwungen bewegte, als wäre alles in Ordnung. Die Person schien gar nicht zu wissen, daß sie absolut nicht so aussah wie andere Frauen. Auch schien es mir, daß sie mein Kommen durchaus nicht in Erstaunen versetzte. Sie verbarg nichts unter dem Tisch, schob die Stühle nicht zurecht und tat überhaupt nichts von dem, was doch üblich ist, wenn ein Fremder von vornehmem Aussehen kommt.

Sie hatte wie eine Chinesin die Haare nach hinten gekämmt und sie am Hinterkopf in eine Art Zopf oder Knoten zusammengebunden. Später erfuhr ich, daß ihre Kleidung eine Art indische Tracht ist, die man da zu Lande Sarong und Kabai nennt, aber mir mißfiel sie durchaus.
»Sind Sie Juffrouw Schalmann?« fragte ich.
»Mit wem habe ich die Ehre?« erwiderte sie und zwar in einem Ton, in dem so etwas lag, als hätte auch ich sowas wie Ehre in meine Frage bringen sollen.
Nun, von Komplimenten halte ich nichts. Mit einem Prinzipal ist das was anderes, und ich bin lange genug Geschäftsmann, um Bescheid zu wissen. Aber im dritten Stock nach hinten noch viel Umstände zu machen, hielt ich durchaus für überflüssig. Ich sagte darum kurz, daß ich Mynheer Droogstoppel sei, Makler in Kaffee, Lauriergracht Nr. 37, und daß ich ihren Mann sprechen wolle. Nun, muß ich da etwa schöne Worte machen?
Sie bot mir einen Korbstuhl an und nahm ein kleines Mädchen auf den Schoß, das spielend auf dem Fußboden saß. Der kleine Junge, den ich singen gehört hatte, sah mich fest an und betrachtete mich von Kopf bis Fuß. Der Bengel schien auch nicht im geringsten verlegen zu sein! Es war ein Knabe von vielleicht 6 Jahren und gleichfalls sehr fremdartig angezogen. Sein weites Höschen reichte kaum bis zur Hälfte der Schenkel und die Beinchen waren bloß von da bis an die Knöchel. »Kommst du, um Papa zu sprechen?« fragte er auf einmal, und ich begriff sofort, daß die Erziehung des Kindes viel zu wünschen übrig ließ, denn sonst hätte er: »Kommen Sie« gesagt. Aber weil ich in meiner Lage etwas verlegen war und ganz gern sprechen wollte, antwortete ich:
»Ja, Kerlchen, ich komme, um deinen Papa zu sprechen. Wird er bald kommen, was denkst du?«
»Das weiß ich nicht. Er ist ausgegangen, um Geld zu suchen, damit er mir einen Farbkasten kaufen kann.
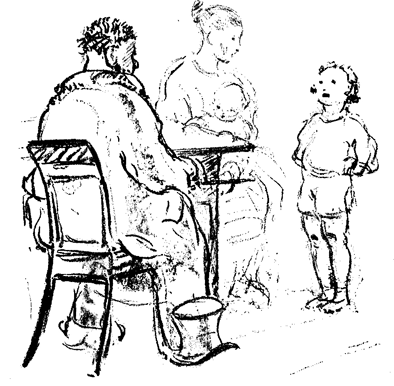
»Sei ruhig, mein Junge«, sagte die Frau. »Spiel ein bißchen mit den Bildern oder mit der chinesischen Spieldose!«
»Du weißt doch, daß der Herr gestern alles mitgenommen hat.«
Auch seine Mutter nannte er: Du, und ein Herr war also dagewesen, der alles mitgenommen hatte ... ein angenehmer Besuch! Die Frau schien auch nicht sehr aufgeräumt zu sein, denn heimlich wischte sie sich über die Augen, während sie das kleine Mädchen zu ihrem Brüderchen brachte. »So, sagte sie, spiel etwas mit Nonni.« Ein komischer Name. Und das tat er dann auch.
»Nun, Juffrouw«, fragte ich, »erwarten Sie Ihren Mann bald?«
»Ich kann gar nichts Bestimmtes sagen«, antwortete sie.
Da ließ plötzlich der kleine Junge, der mit seinem Schwesterchen gespielt hatte, dieses los und fragte mich:
»Mynheer, warum sagen Sie zu meiner Mama Juffrouw Juffrouw: Fräulein, die Anrede für unverheiratete Frauen oder auch für Ehefrauen niedrigen Standes. Die respektvolle Anrede lautet: Mevrouw.?«
»Wie denn sonst, Kerlchen, wie soll ich denn sagen?«
»Nun ... so wie die anderen alle! Die Juffrouw ist unten, sie verkauft Schüsseln und Kreisel.«
Nun bin ich Makler in Kaffee – Last & Co., Lauriergracht Nr. 37 – wir sind dreizehn Mann im Kontor, und wenn ich Stern dazurechne, der ja kein Gehalt bekommt, sind wir vierzehn. Meine Frau wird mit Juffrouw angeredet, und da soll ich zu dieser Person Mevrouw sagen? Das ging doch nicht. Jeder muß in seinem Stand bleiben, und außerdem hatte gestern der Gerichtsvollzieher die ganze Bude ausgeräumt. Ich fand mein: Juffrouw durchaus angebracht, und ich blieb auch dabei.
Ich fragte, warum der Schalmann nicht zu mir gekommen sei, um sein Paket abzuholen. Sie schien Bescheid zu wissen und sagte, sie seien verreist gewesen und zwar in Brüssel. Daß er dort für die »Indépendance« Indépendance Belge, bekannte belgische Tageszeitung. gearbeitet hätte, aber da nicht hätte bleiben können, weil gerade wegen seiner Artikel das Blatt an der französischen Grenze so oft zurückgewiesen worden wäre. Daß sie seit einigen Tagen nach Amsterdam zurückgekehrt seien, weil der Schalmann hier eine Stellung in Aussicht hatte ...
»Sicher bei Gaafzuiger?« fragte ich.
Ja, das war es. Aber es hatte sich zerschlagen, erklärte sie. Nun, davon wußte ich mehr, als sie selbst. Er hatte die »Aglaja« fallen lassen, und war faul, schwerfällig und kränklich ... und darum war er entlassen.
Sie fuhr im Gespräch fort und meinte, er würde sicher dieser Tage zu mir kommen, und vielleicht sei er sogar gerade bei mir, um sich die Antwort zu holen auf die Bitte, die er mir unterbreitet hätte.
Ich sagte, daß Schalmann gelegentlich zu mir kommen möge, aber er solle nicht klingeln, denn das sei für das Mädchen so lästig. Er könne etwas warten, bis die Tür sich mal öffne, wenn jemand hinausgeht. Und dann ging ich und nahm mein Zuckerzeug wieder mit, denn, ehrlich gesagt, es gefiel mir da nicht. Ich fühlte mich nicht wohl. Ein Makler ist ja schließlich kein Arbeiter, und ich meine doch, daß ich anständig aussehe. Ich hatte meinen Überzieher mit Pelz an, und trotzdem saß sie so selbstverständlich da und redete so ungezwungen mit ihren Kindern, als ob sie allein wäre. Außerdem schien sie geweint zu haben, und unzufriedene Menschen kann ich nicht ausstehen. Überdies war es in der Stube kalt und ungemütlich, – sicher, weil die ganze Einrichtung weggeholt war, – und ich lege großen Wert auf behagliche, angenehme Räumlichkeiten. Auf dem Heimweg beschloß ich, es mit Bastiaans noch mal zu versuchen, weil ich nicht gerne jemand auf die Straße setze.
Jetzt folgt die erste Woche von Stern. Es bedarf keiner Erwähnung, daß vieles darin vorkommt, was mir durchaus nicht gefällt. Aber ich muß mich an § 2 halten, und die Rosemeyers haben es gut gefunden. Ich glaube, daß sie Stern loben, weil er in Hamburg einen Onkel hat, der in Zucker macht.
Schalmann war tatsächlich bei mir gewesen. Er hatte mit Stern gesprochen und dem einige Worte und Dinge erklärt, die er nicht begriff. Die Stern nicht begriff, mein ich. Ich ersuche nun den Leser, sich durch die folgenden Kapitel durchzuarbeiten, dann verspreche ich später etwas von einer solideren Art, von mir, Batavus Droogstoppel, Makler in Kaffee: Last & Co., Lauriergracht Nr. 37.