
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es war Nachmittag. Havelaar trat aus seinem Zimmer auf die Veranda, wo ihn Tine zum Tee erwartete. Frau Slotering erschien vor ihrem Hause und schien sich zu Havelaars begeben zu wollen; aber plötzlich wandte sie sich nach dem Zaun und wies dort heftig einen Mann hinaus, der eben eingetreten war. Sie blieb stehen, bis sie sich überzeugt hatte, daß der Fremde fort war, dann erst kehrte sie zurück und kam am Rasenplatz vorbei auf Havelaars Haus zu.

»Ich will doch endlich wissen, was das zu bedeuten hat«, nahm sich Havelaar vor, und sowie die erste Begrüßung vorbei war, fragte er sie in scherzendem Tone, um sie nicht annehmen zu lassen, daß er ihr das bißchen Autorität auf ihrem ehemaligen Grund und Boden mißgönne:
»Bitte, Frau Slotering, warum weisen Sie eigentlich alle Menschen, die das Erbe betreten, hinaus? Wenn der Mann, der eben hier war, nun Hühner oder sonst etwas für die Küche verkaufen wollte?«
Auf Frau Sloterings Antlitz zeigte sich ein schmerzhafter Zug, der Havelaar nicht entging.
»Ach,« erwiderte sie, »es gibt hier so viel schlechtes Volk!«
»Sicher, das gibt es überall. Aber wenn man es den Menschen so schwer macht, werden die guten auch bald wegbleiben. Kommen Sie, Frau Slotering, sagen Sie mir ganz offen heraus, warum Sie auf das Grundstück so strenge aufpassen?«
Havelaar blickte sie an und versuchte vergebens in ihren feuchten Augen eine Antwort zu lesen. Er bat dringender um eine Erklärung; da brach die Witwe in Tränen aus und sagte, daß ihr Mann im Hause des Distrikthäuptlings von Parang-Kudjang vergiftet worden sei.
»Er wollte Recht üben, Herr Havelaar,« jammerte die arme Frau, »er wollte der Behandlung, unter der die Bevölkerung seufzt, ein Ende machen! Er ermahnte und drohte den Häuptlingen in den Versammlungen und schriftlich, – – – Sie müssen ja seine Briefe im Archiv gefunden haben!«
Das war richtig, – Havelaar hatte die Briefe gelesen, deren Abschriften hier vor mir liegen.
»Er sprach wiederholt mit dem Residenten,« fuhr die Witwe fort, »aber immer vergebens. Es war allgemein bekannt, daß die Beraubung und Bedrückung unter dem Schutze des Regenten und zu seinem Vorteil geschah, und da der Resident den Adhipatti nicht bei der Regierung anklagen wollte, führten alle Beschwerden und Verhöre zu nichts anderem als zur Mißhandlung der Beschwerdeführer. Mein Mann hatte ausdrücklich erklärt, wenn bis Ende des Jahres keine Besserung eintrete, würde er sich direkt an den Generalgouverneur wenden. Das geschah im November. Bald darnach ging er auf eine Inspektionsreise und aß unterwegs bei dem Dhemang von Parang-Kudjang zu Mittag. Kurz darauf wurde er in einem erbarmungswürdigen Zustande nach Hause gebracht. Er schrie fortwährend auf seinen Magen zeigend: »Ich verbrenne! Ich verbrenne!« Nach ein paar Stunden war er tot. Ein Mann, der immer ein Muster der besten Gesundheit war!«
»Haben Sie den Arzt aus Serang kommen lassen?« fragte Havelaar.
»Ja, aber der konnte kaum etwas machen, denn bald nach seiner Ankunft starb mein Mann. Ich wagte gar nicht, dem Doktor meinen Verdacht mitzuteilen, denn ich wußte, daß ich in meinem Zustande das Haus hier nicht so schnell verlassen konnte, und ich fürchtete die Rache. Ich habe gehört, daß Sie ebenso wie mein Mann gegen den Mißbrauch, der hier herrscht, ankämpfen, und deshalb habe ich keine ruhige Minute. Ich wollte das alles vor Ihnen verbergen, um Sie und ihre Frau nicht zu ängstigen, und darum habe ich so scharf aufgepaßt, daß kein Unbekannter hinter in die Küche kam.«
Nun wurde Tine klar, weshalb Frau Slotering ihren eignen Haushalt hatte führen wollen und selbst die Küche nicht gemeinsam mit ihr benutzte, obgleich genügend Platz für beide vorhanden war.
Havelaar ließ den Kontrolleur rufen. Inzwischen forderte er den Arzt in Serang auf, ihm einen genauen Bericht über alle Symptome, die sich bei Sloterings Tod bemerkbar gemacht hätten, einzureichen. Die Antwort, die er erhielt, entsprach nicht den Vermutungen der Witwe. Nach Angabe des Arztes war Slotering an einem Leberabszeß gestorben. Ich vermag nicht zu beurteilen, ob dieses Übel so plötzlich auftreten und innerhalb weniger Stunden zum Tode führen kann. Ich glaube hier auch die Erklärung von Frau Slotering beachten zu müssen, daß ihr Gatte immer kerngesund gewesen sei. Und selbst wenn man die Zuverlässigkeit dieser Erklärung bezweifeln will, bleibt es wohl noch fraglich, ob ein Mann, der heut an einem Leberabszeß stirbt, noch gestern hätte zu Pferde steigen können, um eine Inspektionsreise in eine gebirgige Gegend zu unternehmen, die ihn zwang stundenlang im Sattel zu bleiben. Der Arzt, der Slotering behandelte, kann ein sehr geschickter Mediziner gewesen sein und sich dennoch in seiner Diagnose geirrt haben, da ihm der Verdacht, es könne sich um ein Verbrechen handeln, verschwiegen wurde.
Ich kann jedenfalls nicht beweisen, daß Slotering vergiftet worden war, da man Havelaar keine Zeit ließ, die Sache aufzuklären. Ich kann aber beweisen, daß seine Umgebung von seiner Vergiftung überzeugt war, und daß sich dieser Verdacht auf das Streben des Verstorbenen, dem Unrecht entgegenzutreten, gründete.
Der Kontrolleur Verbrugge trat ein. Havelaar fragte ihn kurz:
»Woran ist Herr Slotering gestorben?«
»Das weiß ich nicht.«
»Ist er vergiftet worden?«
»Ich weiß es nicht, aber – – –«
»Offen und ehrlich, Verbrugge!«
»Er wollte die Mißwirtschaft hier ändern, – – genau wie Sie, Herr Havelaar, – – und – – –«
»Sprechen Sie's nur aus!«
»Ich bin jedenfalls überzeugt, daß man ihn vergiftet hätte, wäre er noch länger hier geblieben.«
»Schreiben Sie das nieder!«
Verbrugge schrieb seine Aussage nieder. Die Erklärung liegt vor mir.
»Noch etwas! Ist es wahr oder nicht, daß die Bevölkerung von Lebak geknechtet wird?«
Verbrugge antwortete nicht.
»Antworten Sie Verbrugge!«
»Ich wage es nicht.«
»Schreiben Sie nieder, daß Sie nicht zu antworten wagen!«
Verbrugge tat, wie ihm geheißen. Die Niederschrift liegt vor mir.
»Nun noch eins! Sie wagten nicht, meine letzte Frage zu beantworten. Sie sagten mir unlängst, als von Vergiftungen gesprochen wurde, daß Sie die einzige Stütze ihrer Schwester in Batavia seien, nicht wahr? Ist das vielleicht die Ursache Ihrer Ängstlichkeit und dessen, was ich Ihre Halbheit nenne?«
»Ja!«
»Schreiben Sie das nieder!«
Auch dieses Bekenntnis liegt vor mir.
»'s ist gut. Jetzt weiß ich genug,« erklärte Havelaar. Verbrugge konnte gehen.
Havelaar trat ins Freie und spielte mit dem kleinen Max, den er mit besonderer Innigkeit küßte. Als Frau Slotering sich verabschiedet hatte, ging er mit Tine allein in sein Arbeitszimmer.
»Liebe Tine, ich habe eine Bitte: Du mußt mit dem Kinde nach Batavia übersiedeln. Ich reiche heute die Anklage gegen den Regenten ein.«
Sie fiel ihm um den Hals, und zum ersten Male ungehorsam, rief sie unter Tränen:
»Nein, Max! Nein! das tu ich nicht! Ich bleibe bei dir ... Wir essen und trinken zusammen!«
War Havelaar im Unrecht, als er ihr ebensowenig wie den Frauen in Arles das Recht zuerkennen wollte, sich die Nase zu schnauben?
Er schrieb und sandte den Brief ab, von dem ich hier eine Abschrift habe.
Ich habe die Umstände geschildert, unter denen der Brief entstand, und so brauche ich wohl ebensowenig auf die beherzte Pflichterfüllung, die aus jeder Zeile spricht, besonders hinzuweisen, wie auf die Güte, mit der Havelaar versuchte, den Regenten auch jetzt noch gegen allzu schwere Strafe in Schutz zu nehmen.
In den Abschriften der amtlichen Urkunden, – Abschriften, die sonst wörtlich mit dem Original übereinstimmen, – ersetze ich die albernen, umständlichen Titulaturen durch einfache Fürwörter, und ich erwarte von dem guten Geschmack meiner Leser, daß sie die Änderung gutheißen.

No. 88. Geheim! Dringend!
Rangkas-Betung, den 24. Februar 1856.
An den Residenten von Bantam.
Seit ich vor einem Monat mein Amt hier antrat, habe ich mich vornehmlich damit befaßt, die Schliche zu untersuchen, mit welchen sich die inländischen Großen ihrer Pflichten gegen die Bevölkerung in bezug auf Herrendienstforderungen, Pundutan Pundutan = Lebensmittel, die ohne Bezahlung geliefert werden. und dergleichen entziehen.
Ich entdeckte sehr bald, daß der Regent unter Mißbrauch seiner Stellung und zum eigenen Vorteil weit mehr Leute zum Arbeitsdienst einzog, als ihm als Pantjen und Kemit Pantjen und Kemit sind unbesoldete Wächter und Diener. zukommen.
Ich schwankte, ob ich sofort amtlich berichten oder zunächst durch gütiges Zureden und später auch durch dringende Vermahnungen diesen eingeborenen hohen Beamten von seinen Verfehlungen abzubringen versuchen sollte. Ich zog das letztere vor, um ein doppeltes Ziel zu erreichen, erstens die Gewalttätigkeiten ernsthaft zu unterbinden und zweitens den alten Diener der Regierung nicht sogleich allzustrenge zu behandeln, da ihm aus vielen schlechten Beispielen, die ihm gegeben wurden, und aus der Tatsache, daß er den Besuch zweier Verwandten, der Regenten von Bandung und von Tjandjor, erwartete, mildernde Umstände erwuchsen. Der letzte dieser beiden, der Regent von Tjandjor, befindet sich meines Wissens bereits auf dem Wege hierher, und so war für meinen Regenten mit Rücksicht auf seine außerordentlich beschränkten Geldmittel die Versuchung sehr groß, auf ungesetzlichem Wege die großen Kosten, die dieser bevorstehende Besuch ihm verursachen muß, aufzubringen.
Ich versuchte es also mit Milde, was die vergangenen Übergriffe anbelangte, ließ ihn aber nicht im Zweifel darüber, daß ich für die Zukunft keinerlei Nachsicht walten lassen würde, und bestand darauf, daß das ungesetzliche Verfahren sofort einzustellen sei.
Von diesen vorläufigen Versuchen, den Regenten durch Ermahnungen an seine Pflicht zu erinnern, habe ich Sie bereits unter der Hand in Kenntnis gesetzt.
Es hat sich aber herausgestellt, daß er alle Ermahnungen mit frecher Schamlosigkeit in den Wind schlägt, und so fühle ich mich auf Grund meines Diensteides verpflichtet:
Den Regenten von Lebak Radhen Adhipatti Karta Natta Nagara anzuklagen, sein Amt mißbraucht zu haben, indem er ungesetzlich über die Arbeitskraft seiner Untergebenen verfügte, und ich beschuldige ihn der Erpressung, begangen dadurch, daß er von diesen selben Untergebenen Naturallieferungen, sei es ohne jegliche Gegenleistung, sei es gegen Bezahlung von durch ihn willkürlich niedrig festgesetztem Preise, erzwingt:
Ich erkläre ferner, daß ich den Dhemang von Parang-Kudjang, seinen Schwiegersohn, im begründeten Verdacht der Mitschuld an den vorgenannten Vergehen habe.
Um beide Anklagen ungestört untersuchen zu können, bitte ich Sie, mir folgende Maßnahmen aufzutragen:
1. Den vorgenannten Regenten von Lebak mit größter Eile nach Serang führen zu lassen und dafür Sorge zu tragen, daß er weder vor seiner Abreise noch während des Transports eine Gelegenheit finde, durch Bestechung oder auf andere Weise die Zeugen, die ich vernehmen muß, zu beeinflussen.
2. Den Dhemang von Parang-Kudjang vorläufig in Haft zu nehmen.
3. Die gleiche Maßregel gegenüber Personen von minderem Range anzuwenden, soweit sie zur Familie des Regenten gehören und in den Verdacht geraten, ihren störenden Einfluß auf die Untersuchung auszuüben.
4. Die Untersuchung sofort zu beginnen und von ihrem Resultat einen ausführlichen Bericht einzureichen.
Ich gestatte mir ferner, Ihnen zur Erwägung anheimzugeben, ob es nicht zweckmäßig wäre, die Ankunft des Regenten von Tjandjor durch Gegenbefehle zu verhindern.
Ich habe die Ehre, zum Schlusse noch zu bemerken, was Ihnen gegenüber vielleicht überflüssig erscheint, da Sie von der Abteilung Lebak eine eingehendere Kenntnis besitzen, als ich mir bisher habe aneignen können, daß aus politischen Gründen einer rücksichtslosen Erledigung dieser Angelegenheit nicht das mindeste entgegensteht, und daß ich vielmehr eine Gefahr darin erblicken würde, die Untersuchung nicht restlos zu Ende zu führen. Nach meinen genauen Informationen kann ich versichern, daß die notleidende Bevölkerung völlig ratlos und verwirrt von dem fortwährenden Druck nach einer Erlösung seufzt.
Die Kraft zu der mühseligen Aufgabe, die ich mit diesem Briefe erfülle, schöpfe ich aus der Hoffnung, daß es mir zu gegebener Zeit vergönnt werden wird, manches zur Entschuldigung des alten Regenten vorzubringen, mit dessen Lage, so sehr sie auch durch eigene Schuld verursacht ist, ich nichtsdestoweniger tiefes Mitleid fühle.
Der Residentschaftsassistent von Lebak
Max Havelaar.
Am Tage darauf erhielt er die Antwort. Vom Residenten von Bantam? O nein! Von dem Privatmann Herrn Slymering.
Diese Antwort ist ein köstlicher Beitrag, um das System kennen zu lernen, nach welchem Niederländisch-Indien regiert wird. Herr Slymering beklagte sich, daß ihm Havelaar von der Angelegenheit, die in dem Briefe No. 88 erwähnt wurde, nicht erst mündlich Kenntnis gegeben habe, weil dann natürlich mehr Aussicht gewesen wäre, die Sache zu vertuschen. Und ferner war ihm nicht recht, »daß ihn Havelaar in seinen dringenden Geschäften störe.«
Der Mann war sicher dabei, einen Jahresbericht über die ruhige Ruhe abzufassen. Der Brief liegt vor mir, aber ich vermag meinen Augen nicht zu trauen. Ich lege beide Episteln nebeneinander, ... ich vergleiche den Residentschaftsassistenten von Lebak mit dem Residenten von Bantam, Havelaar mit Slymering ...
— — —
Der Schalmann ist ein gemeiner Strolch!
Nämlich, Bastiaans fehlt wieder häufig im Kontor, weil er die Gicht hat. Mein Pflichtgefühl erlaubt nicht, daß das Geld der Firma, – Last & Co. – zum Fenster hinausgeworfen wird, und in meinen Prinzipien bin ich unerschütterlich. Deshalb fiel mir wieder ein, daß der Schalmann eine leidlich gute Handschrift hat, und da er so heruntergekommen aussieht und wohl gegen mäßiges Gehalt zu haben sein würde, fühlte ich mich im Interesse der Firma verpflichtet, zu versuchen, Bastiaans auf die billigste Art zu ersetzen.
Ich ging also nach der Langen Leidenschen Querstraße. Die Frau unten im Laden war wieder da, doch schien sie mich nicht zu erkennen, obgleich ich ihr das letztemal deutlich gesagt hatte, daß ich Mynheer Droogstoppel, Makler in Kaffee, Lauriergracht, bin. – Dieses Nichtwiedererkennen hat immer etwas Kränkendes, aber ich hatte, weil es nicht mehr so kalt ist, diesmal keinen Pelzmantel an, darum zog ich's mir nicht an, – die Beleidigung meine ich. Ich sagte also noch einmal, daß ich Mynheer Droogstoppel, Makler in Kaffee, Lauriergracht, bin und bat sie, nachzusehen, ob der Schalmann zu Hause sei, denn ich wollte nicht wieder so lange bei seiner Frau, die immer unzufrieden ist, warten müssen. Aber die Person weigerte sich, hinaufzugehen. Sie könne nicht den ganzen Tag für das Bettelvolk Treppen steigen, ich sollte selbst gehen! Und dann beschrieb sie mir Stufen und Gänge, was gar nicht notwendig war, denn wo ich einmal gewesen bin, finde ich mich immer wieder zurecht, weil ich auf alles genau acht gebe. Daran habe ich mich im Geschäftsleben gewöhnt. Ich stieg also die Treppen hinauf und klopfte an die bekannte Tür, die nur angelehnt war. Ich trat ein, und da niemand im Zimmer war, habe ich mir alles ordentlich angesehen. Na, viel war ja nicht zu sehen! Über einem Stuhl hing ein halblanges Höschen mit einem Stickereirand. Was brauchen solche Menschen gestickte Höschen zu tragen?! In einer Ecke stand ein nicht sehr schwerer Reisekoffer, den ich ganz in Gedanken am Griff hochhob, und auf dem Kaminmantel lagen einige Bücher, die ich mir mal ansah. Es war eine sonderbare Gesellschaft. Ein paar Bände von Byron, Horaz, Béranger und mitten darunter, – niemand würde das erraten, – eine Bibel. Eine vollständige Bibel mit den Apokryphen! Das hatte ich bei dem Schalmann nicht erwartet. Und er schien auch darin gelesen zu haben, denn ich fand zwischen den Seiten auf losen Blättern eine Unmenge Notizen, die auf die Heilige Schrift Bezug hatten, und die Handschrift war die gleiche wie auf den Blättern in dem verwünschten Paket. In einer solchen Notiz stand, Eva sei zweimal zur Welt gekommen! ... Der Mann ist verrückt! –
Vor allem schien er das Buch Hiob eifrig durchstudiert zu haben, denn da klafften die Seiten weit auseinander. Ich glaube, er beginnt nun die strafende Hand des Herrn zu spüren, und da will er sich durch die Lektüre der heiligen Bücher mit Gott versöhnen.
Dagegen habe ich nichts.
Während ich so wartete, fiel mein Blick auf ein Handarbeitskästchen, das auf dem Tische stand. Ohne mir etwas zu denken, sah ich hinein. Ich fand ein paar halbfertige Kinderstrümpfe und eine Menge alberner Verse, dann auch einen Brief an die Frau vom Schalmann, wie aus der Adresse hervorging. Der Brief war geöffnet und er sah aus, als ob man ihn hastig zusammengefaltet hätte. Nun ist es mein Prinzip, nie etwas zu lesen, das nicht an mich gerichtet ist, weil ich das nicht anständig finde. Ich tue es auch nie, wenn ich kein Interesse daran habe. Aber hier war es mir wie eine Eingebung, daß es meine Pflicht sei, den Brief kennen zu lernen, da mich der Inhalt vielleicht bei meiner menschenfreundlichen Absicht, die mich zum Schalmann führte, auf den rechten Weg leiten könnte. Ich mußte daran denken, wie der Herr doch allzeit über die Seinen wacht, wie Er mir hier unverhofft die Gelegenheit bot, näheres über den Mann zu erfahren, und mich so vor der Gefahr beschützte, eine Wohltat an einen Unwürdigen zu verschenken. Ich achte immer eifrig auf solche Winke von Gott, und das hat mir im Geschäft oft Nutzen gebracht.

Zu meiner großen Überraschung sah ich nun, daß die Frau vom Schalmann aus einer sehr vornehmen Familie stammte, denn der Brief war von einem ihrer Blutsverwandten unterschrieben, dessen Namen in den Niederlanden sehr angesehen ist. Ich war auch wirklich erbaut von dem herrlichen Inhalt des Schreibens. Der Verfasser schien ein Mensch zu sein, der eifrig im Sinne des Herrn wirkte, denn er schrieb, daß sich die Frau des Schalmanns von diesem Elenden scheiden lassen müsse, der sie Not leiden ließ und seinen Unterhalt nicht erwerben konnte, der obendrein ein Schurke war, weil er Schulden hatte. Mit ihrem Schicksal habe der Briefsteller Mitleid, obgleich sie ihr Los durch eigene Schuld mit verursacht hätte, da sie Gott verlassen und sich dem Schalmann zugewandt habe. Sie möge zurückkehren zu Gott, dann würde vielleicht die ganze Familie für sie sorgen, indem man ihr Näharbeit beschaffen könne. Aber vor allem müsse sie sich vom Schalmann scheiden lassen, der für die Familie eine Schande sei – – –
Mit einem Wort, selbst in der Kirche hätte ich nicht mehr Erbauung finden können als in diesem Briefe.
Ich wußte genug, und ich war dankbar, daß ich auf so wunderbare Weise gewarnt worden war. Ohne diese Warnung wäre ich doch sicher wieder ein Opfer meines guten Herzens geworden. Ich beschloß also, vorläufig Bastiaans noch zu behalten, bis ich geeigneten Ersatz finde, denn ich entlasse nicht gern jemanden, und wir können jetzt auch niemanden entbehren, weil wir soviel zu tun haben.
Der Leser ist wahrscheinlich neugierig, wie ich's auf dem letzten Leseabend gemacht habe, und ob ich mich mit dem Geduldspiel beschäftigen konnte.
Nun, ich bin gar nicht dabei gewesen! Ich war mit meiner Frau und Marie in Driebergen. Mein Schwiegervater, der alte Last, der Sohn vom ersten Last, – als die Meyers noch mit drin waren, aber jetzt sind sie raus, – hatte immer schon gesagt, daß er meine Frau und Marie sehen wollte. Nun war ziemlich schönes Wetter, und in meiner Angst vor der Liebesgeschichte, mit der Stern gedroht hatte, erinnerte ich mich mit einem Male der Einladung. Ich sprach mit unserem Buchhalter darüber, der Mann hat viel Erfahrung, und nach reiflicher Überlegung riet er mir, die Sache nochmals zu überschlafen. Schon am nächsten Tage sah ich ein, wie gut der Rat gewesen war, denn nachts war ich auf den Gedanken gekommen, meinen Entschluß bis Freitag aufzuschieben. Kurz, nachdem ich alles eingehend hin und her erwogen hatte, – es sprach vieles dafür, aber auch vieles dagegen, – sind wir losgezogen, und zwar Sonnabend mittag, und Montag früh sind wir zurückgekommen. Ich würde das alles nicht so ausführlich erzählen, wenn es nicht in engem Zusammenhang mit meinem Buche stünde. Erstens soll man wissen, warum ich nicht gegen die Albernheiten von Stern protestiere, die er am letzten Sonntag sicher wieder ausgekramt hat. Und zweitens habe ich von neuem die feste Überzeugung erworben, daß alle Erzählungen von Elend und Unruhe in den Kolonien offenkundige Lügen sind. Man kann daraus sehen, wie uns das Reisen dazu bringt, die Dinge ordentlich zu ergründen.
Am Sonnabend abend hatte mein Schwiegervater nämlich eine Einladung angenommen zu einem Herrn, der früher in den Kolonien Resident war, und der nun auf einem großen Landsitz in Pension lebt. Wir sind alle dagewesen, und wahrhaftig, ich kann den reizenden Empfang gar nicht genug rühmen. Er hatte uns seinen Wagen geschickt, um uns abzuholen, und der Kutscher hatte eine rote Weste an. Nun war es wohl noch ein bißchen zu frisch, um den Landsitz zu besichtigen, der im Sommer herrlich sein muß, aber im Hause selbst konnte man gar nicht mehr verlangen, denn es war alles vorhanden, was das Leben angenehm macht. Ein Billardzimmer, ein Bibliotheksaal, eine gedeckte eiserne Glasveranda als Gewächshaus, und der Kakadu saß auf einem silbernen Ring. So etwas hatte ich noch nie gesehen, und es fiel mir sofort auf, wie alles Gute doch belohnt wird. Der Mann hatte immer auf seine Sachen acht gegeben, denn er besaß, glaube ich, drei Ritterorden. Er hatte diesen herrlichen Landsitz und außerdem noch ein Haus in Amsterdam. Beim Souper war alles mit Trüffeln, und auch die Bedienten bei Tisch hatten rote Westen an, genau wie der Kutscher.
Da ich mich für indische Angelegenheiten sehr interessiere, – wegen des Kaffees, brachte ich das Gespräch darauf, und ich wußte bald, woran ich mich zu halten hatte. Der Resident hat mir gesagt, daß es ihm in den Kolonien immer sehr gut gegangen sei, also da konnte von all den Erzählungen über Unzufriedenheit unter dem Volke kein Wort wahr sein. Ich erwähnte auch den Schalmann. Er kannte ihn und zwar von sehr unvorteilhafter Seite. Er sagte mir, daß der Schalmann ein sehr unzufriedener Mensch ist, der immer und über alles seine Bemerkungen macht, während sein eigenes Verhalten sehr viel zu wünschen übrig läßt. Er holte sich z. B. öfters Mädchen heran und brachte sie zu seiner Frau, und dann bezahlte er auch seine Schulden nicht, was doch sehr unanständig ist. Da ich nun aus dem Briefe, den ich gelesen hatte, ganz genau wußte, wie begründet diese Beschuldigungen waren, bereitete es mir eine große Genugtuung, daß ich alles so richtig beurteilt hatte, und ich war mit mir sehr zufrieden. Dafür bin ich ja auch an der Börse bekannt, – daß ich immer richtig urteile, meine ich.
Der Resident und seine Frau waren liebe, reizende Menschen. Sie erzählten uns viel davon, wie sie in den Kolonien gelebt hatten. Es muß doch da sehr angenehm sein. Sie sagten uns, daß ihr Landsitz in Driebergen nicht halb so groß sei wie ihr »Erbe«, wie sie es nannten, im Innern von Java war, und daß sie dort fast hundert Menschen hatten, um alles zu unterhalten. Aber, – und das ist mir doch ein deutlicher Beweis, wie beliebt sie waren, – das taten die Leute absolut umsonst, nur aus Anhänglichkeit. Sie erzählten auch, daß bei ihrer Abreise der Verkauf ihrer Möbel vielleicht zehnmal mehr eingebracht hätte, als die Sachen wert waren, weil die inländischen Häuptlinge so gern ein Andenken an einen Residenten kaufen, der gut zu ihnen war. Ich erzählte das später Stern, und der behauptete, daß das unter Zwang geschehe und wollte es aus dem Paket vom Schalmann beweisen. Aber ich habe ihm gesagt, daß der Mann ein Verleumder ist, daß er Mädchen verführt habe, – genau wie der deutsche junge Mann bei Busselinck & Waterman, – und daß ich auf sein Urteil absolut nichts gäbe, denn nun habe ich von einem Residenten selbst gehört, wie die Dinge dort stehen, und nun kann mir der Schalmann nichts mehr weismachen.
Bei der Gesellschaft waren noch mehr Leute aus den Kolonien, unter anderen ein Herr, der sehr reich war und noch immer sehr viel Geld an Tee verdient, den die Javaner für ihn gegen geringen Lohn bauen müssen, und den ihm die Regierung zu hohem Preise abkauft, um den Arbeitsfleiß der Javaner anzuregen. Auch dieser Herr war schlecht zu sprechen auf die unzufriedenen Menschen, die immer gegen die Regierung reden und schreiben. Er konnte die Verwaltung unserer Kolonien gar nicht genug rühmen, denn er sagte, er sei überzeugt, daß an dem Tee, den man von ihm kaufte, sehr viel verloren würde. Und daß es deshalb reiner Edelmut war, ihm weiterhin so hohe Preise zu zahlen für einen Artikel, der eigentlich wenig Wert hatte, und den er selbst auch gar nicht mochte, denn er trinke immer chinesischen Tee. Er sagte auch, daß der Generalgouverneur, der die sogenannten Teekontrakte verlängert hatte, obgleich das Land daran soviel verlor, ein lieber, tüchtiger Mensch sei und sich allen, die ihn von früher kannten, als treuer Freund erwiesen habe. Denn der Generalgouverneur hatte sich um all das Gewäsch über die Verluste der Teeplantagen nicht gekümmert und ihm, als davon die Rede war, die Kontrakte aufzuheben, ich glaube, es war 1846, einen großen Dienst erwiesen, indem er anordnete, daß sein Tee weiterhin aufgekauft wurde. »Mir blutet das Herz,« rief er aus, »wenn ich sehe, daß so vornehme Menschen so verleumdet werden! Wenn der Mann nicht gewesen wäre, müßte ich heute mit Frau und Kindern zu Fuß gehen.« Dann ließ er seinen Wagen vorfahren, und der sah sehr gut aus. Die Pferde waren in einem ausgezeichneten Futterzustande, und ich konnte sehr gut begreifen, daß man so einem Generalgouverneur dankbar ist. Es ist mir wirklich eine Wohltat, die Aufmerksamkeit auf so angenehme Tatsachen zu lenken. Vor allen Dingen, wenn man das mit dem verwünschten Murren und Klagen von Subjekten vergleicht wie dieser Schalmann.
Am folgenden Tage machte uns der Resident und auch der Herr, für den die Javaner den Tee bauen, Gegenvisite. Es sind reizende und wirklich vornehme Menschen. Sie fragten uns beide, mit welchem Zuge wir in Amsterdam eintreffen. Wir begriffen erst nicht, was das zu bedeuten hatte, aber später wurde es uns klar, denn als wir am Morgen in Amsterdam ankamen, standen am Bahnhof zwei Bediente, der eine mit einer roten und der andere mit einer gelben Weste, die uns beide erklärten, telegraphisch Auftrag erhalten zu haben, uns mit dem Wagen am Bahnhof abzuholen. Meine Frau war ganz verwirrt, und ich dachte mir, was wohl Busselinck & Waterman sagen sollten, wenn sie das sehen würden, – daß da gleich zwei Equipagen auf einmal für uns da waren, meine ich. Es war aber nicht einfach, sich zu entscheiden, denn ich konnte doch keinen von beiden dadurch beleidigen, daß ich eine so gütige Aufmerksamkeit zurückwies. Da war guter Rat teuer. Aber ich habe mich doch schließlich aus der Affäre gezogen. Ich habe meine Frau und Marie in die rote Equipage gesetzt, – in den Wagen von dem Kutscher mit der roten Weste meine ich, – und ich habe in der gelben Platz genommen, – ich meine in der Equipage.
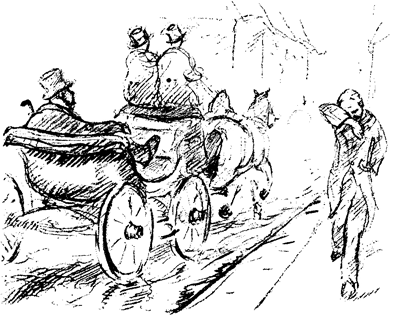
Die Pferde liefen, was das Zeug hielt. In der Weesperstraat, wo es immer sehr schmutzig ist, flog der Schlamm rechts und links haushoch. Wie auf Verabredung, kam uns plötzlich der schmierige Schalmann in gebeugter Haltung mit gesenktem Kopfe entgegen, und ich sah, wie er mit dem Ärmel seiner dünnen Jacke sein blasses Gesicht von den Spritzflecken reinigte. Ich habe noch nie einen so schönen Ausflug gemacht, und meine Frau fand das auch.