
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Darf man nun wissen, weshalb Sie eigentlich suspendiert worden sind?« fragte Duclari.
»Selbstverständlich! – Ich kann auch alles, was ich darüber berichte, belegen und beweisen, und Sie werden bald sehen, daß es in meiner Erzählung über das verschwundene Kind nicht so leichtfertig war, sich auf den Küstenklatsch in Padang zu berufen. Diese Geschichten erscheinen einem gar nicht mehr unglaubwürdig, wenn man den tapferen General van Damme in meiner Affäre kennenlernt.
Also meine Kassenabrechnung in Natal war unordentlich und unklar. Sie wissen, wie man durch solche Unklarheiten immer im Nachteil ist ... Nachlässigkeit führt nie zu Überschüssen in der Kasse. Der Buchhaltungschef in Padang, der mir nicht gerade freundlich gesinnt war, behauptete, daß Tausende fehlten. Aber seltsamerweise ist das nie vorgebracht worden, solange ich noch in Natal war. Ganz unerwartet wurde ich ins Oberland von Padang versetzt. Sie wissen, Verbrugge, daß man auf Sumatra eine solche Versetzung als vorteilhafter und angenehmer betrachtet, als etwa den Dienst in der nördlichen Residentschaft. Kurz vorher noch war der Gouverneur bei mir gewesen, – Sie werden gleich erfahren, warum und weshalb, – und während seines Aufenthalts in Natal, sogar in meinem Hause, hatten sich Dinge abgespielt, bei denen ich glaubte, sehr gut abgeschnitten zu haben, so daß ich meine Versetzung als Auszeichnung betrachtete und von Natal nach Padang übersiedelte. Ich reiste auf einem französischen Schiff, der ›Baobab‹, das in Atjeh Pfeffer geladen und in Natal, natürlich wegen Trinkwassermangels, angelegt hatte. Kaum in Padang angekommen, von wo ich mich in die Binnenländer begeben wollte, machte ich, wie es Brauch und Pflicht war, dem Gouverneur meine Aufwartung. Er ließ mir aber sagen, daß er mich nicht empfangen könne, und daß ich meine Weiterreise nach meinem neuen Amtssitz bis auf weiteren Befehl einzustellen hätte. Sie können sich vorstellen, wie erstaunt ich darüber war, um so mehr, als ich seit unserem letzten Zusammentreffen in Natal die feste Überzeugung hatte, bei ihm sehr gut angeschrieben zu sein. Ich hatte nur wenig Bekannte in Padang, und von diesen, oder besser noch aus deren Verhalten mir gegenüber, erfuhr ich, daß der General nicht gut auf mich zu sprechen war. Ich sagte, ich erfuhr es aus ihrem Verhalten mir gegenüber: Nämlich Padang war damals noch ein ziemlich vorgeschobener Posten, und man konnte sehr gut das Verhalten der anderen Beamten als Gradmesser für die Stimmung des Gouverneurs benutzen. Ich fühlte, daß ein Sturm im Anzuge war und wußte nicht, woher der Wind kommen würde. Da ich Geld brauchte, bat ich den einen und den andern, mir beizuspringen, und ich war aufs höchste überrascht, daß ich überall einen ablehnenden Bescheid bekam. Das widersprach auf Padang, ebenso wie an allen anderen indischen Plätzen, ganz und gar dem, was üblich war. Es galt als Selbstverständlichkeit, irgendeinem Kontrolleur, der sich auf Reisen befand und an einem Orte aufgehalten wurde, ohne weiteres mehrere hundert Gulden vorzuschießen. Und mir verweigerte man jede Hilfe! Ich drängte bei einigen auf Erklärung dieses Mißtrauens, und so kam ich allmählich dahinter, zu erfahren, daß man in meiner Finanzverwaltung in Natal Fehler und Unregelmäßigkeiten entdeckt hatte, die mich in den Verdacht der Unehrlichkeit brachten.
Daß in meiner Verwaltung Fehler vorgekommen waren, verwunderte mich nicht; das Gegenteil würde mich überrascht haben. Ich fand es aber höchst sonderbar, daß der Gouverneur, der sich persönlich davon überzeugt hatte, wie ich meinen Amtssitz auf längere Zeit verlassen mußte, um die überall aufkeimende Unzufriedenheit und die Neigung zu Aufständen zu unterdrücken, der mir selbst sein höchstes Lob über meine Beherztheit, wie er es nannte, gespendet hatte, nun plötzlich die entdeckten Fehler als Unterschlagungen und Unehrlichkeiten hinstellen konnte. Er selbst mußte es am allerbesten wissen, daß in diesen Dingen von nichts anderem die Rede sein konnte als von einer force majeure.
Und selbst wenn man diese force majeure leugnete, selbst wenn man mich verantwortlich machen wollte für Unregelmäßigkeiten, die begangen worden waren, während ich, – häufig in Lebensgefahr, – fern von aller Finanzverwaltung tätig war, und diese Verwaltung inzwischen anderen überlassen mußte, selbst, wenn man forderte, daß ich das eine tun mußte, ohne das andre zu lassen, selbst dann noch durfte man mich doch höchstens der Nachlässigkeit beschuldigen, aber nicht der Untreue. Es gab damals eine ganze Reihe von Beispielen dafür, daß die Regierung diese Schwierigkeiten, die sich aus der Stellung ihrer Beamten auf Sumatra ergaben, völlig begriff, und es war ein allgemeiner Grundsatz, daß bei solchen Kassendifferenzen ein Auge zugedrückt wurde. Der betreffende Beamte hatte das Manko zu ersetzen, und es mußten schon sehr deutliche Beweise vorhanden sein, ehe man das Wort Untreue aussprach oder nur selbst daran dachte. Das war alles so selbstverständlich, daß ich in Natal dem Gouverneur selbst gesagt hatte, ich fürchtete bei der Nachprüfung meiner Amtskasse in Padang einen großen Fehlbetrag nachzahlen zu müssen, worauf er mir achselzuckend geantwortet hatte: ›Ach, was, die Geldsachen!‹ als fühlte er selbst, daß ich wichtigere Aufgaben zu erledigen hatte. Ich weiß, daß Geldsachen durchaus wichtig sind, aber in diesem Falle mußten sie wirklich hinter anderen Dingen zurücktreten, denen ich all meine Sorge und meine ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden hatte. Wenn durch Nachlässigkeit und Bummelei in meiner Verwaltung einige Tausende fehlten, so ist das selbstverständlich keine Kleinigkeit. Aber wenn diese Tausende fehlten, infolge meiner gelungenen Versuche, Aufstände zu verhüten, die die ganze Landstrecke von Mandheling in Feuer und Flammen gesetzt, die die Atjehs wieder in dieselben Bezirke zurückgelockt hätten, aus denen wir sie eben erst unter großen Opfern an Gut und Blut vertrieben hatten, dann wurden jene Beträge bedeutungslos, und es wäre sogar unbillig gewesen, ihre Rückzahlung von einem Manne zu fordern, der unendlich größere Werte gerettet hatte.
Und doch mußte man natürlich eine solche Rückerstattung fordern, denn wenn das nicht geschah, hätte man allen Unehrlichkeiten Tür und Tor geöffnet.
Nachdem ich tagelang in entsprechender Stimmung gewartet hatte, erhielt ich aus dem Sekretariat des Gouverneurs ein Schreiben, in dem man mir eröffnete, daß ich der Untreue verdächtigt sei, und mich aufforderte, mich zu einzelnen aufgeführten Fällen zu äußern. Einiges konnte ich sofort aufklären. Bei anderen Punkten hätte ich in die Akten Einsicht nehmen müssen, und vor allem forderte es mein Interesse, den Dingen in Natal selbst nachzugehen, und bei meinen Beamten nach den Ursachen der verschiedenen Differenzen zu forschen. Dort wäre ich allem wahrscheinlich sehr bald auf die Spur gekommen. Vielleicht war eine Löhnungszahlung, die an die Truppen ins Aufstandsgebiet gegangen war, nicht abgeschrieben, oder irgendeine ähnliche Unterlassung vorgekommen, die ich bei einer Nachprüfung an Ort und Stelle sofort richtiggestellt hätte, aber der General erlaubte mir nicht, nach Natal zurückzukehren.
Diese Weigerung machte mich noch stutziger als die seltsame Art, in der die Beschuldigung gegen mich vorgebracht worden war. Weshalb war ich plötzlich von Natal wegversetzt worden, wenn ich unter einem solchen Verdacht stand? Warum wurde mir die Beschuldigung erst entgegengehalten, nachdem ich weit von meinem alten Amtssitz, wo ich alles sehr schnell hätte aufklären und belegen können, entfernt war? Und warum wurde im Gegensatz zu allem sonstigen Brauch und aller Billigkeit die Sache gerade bei mir in das ungünstigste Licht gestellt?
Ehe ich noch alle Aufklärungen, so gut ich das ohne Akten und Rückfragen vermochte, beantwortet hatte, erfuhr ich hintenherum, daß der General gegen mich so aufgebracht sei, weil ich ihm in Natal widersprochen hätte, was, wie man wohlwollend hinzufügte, sehr falsch gewesen wäre.
Jetzt ging mir ein Licht auf. Ja, ich hatte ihm widersprochen, aber ich hatte in meiner Naivität angenommen, gerade darum würde er mich höher schätzen. Ich hatte ihm widersprochen, aber bei seiner Abreise hatte er nicht im entferntesten mich vermuten lassen, daß er das übel genommen haben könnte. In meiner Dummheit, war mir meine vorteilhafte Versetzung nach Padang als Beweis dafür erschienen, daß ihm mein Widerspruch imponiert habe. Sie werden bald sehen, wie schlecht ich den Mann kannte.
Sowie ich erfuhr, daß das die Ursache seines Auftretens gegen mich war, beruhigte ich mich einigermaßen. Ich beantwortete die einzelnen Aufstellungen Punkt für Punkt, so gut ich konnte, und schloß meinen Brief, – die Abschrift habe ich noch, – mit den Worten:
Ich habe die mir in bezug auf meine Amtstätigkeit gemachten Vorwürfe beantwortet, so gut mir das möglich war ohne Einblick in die Akten nehmen oder Untersuchungen an meinem ehemaligen Amtssitz anstellen zu können. Ich ersuche nunmehr Euer Hochedelgestrengen Diese und ähnliche lächerliche Anredeformen sind heute noch in Holland üblich. Der Richter und der höhere Vorgesetzte wird »Hoogedelgestrenge« angesprochen, andere sind »Hoogedelgelaart« oder »Hoogedelachtbaar«. Natürlich gilt das nur für den schriftlichen Verkehr. mich mit jeglicher wohlwollender Rücksichtnahme zu verschonen. Ich bin jung und bedeutungslos im Vergleich mit der Macht der herrschenden Anschauungen, gegen die mich meine Grundsätze aufzutreten zwingen, aber dessen ungeachtet bin ich stolz auf meine moralische Unabhängigkeit, stolz auf meine Ehre.
Am Tage darauf wurde ich wegen ›Untreue im Amt‹ suspendiert, dem Staatsanwalt wurde aufgegeben, mich im Auge zu behalten.
So stand ich nun, dreiundzwanzig Jahre alt, als ehrlos gebrandmarkt, in Padang und starrte in die Zukunft. Man riet mir, mich auf meine Jugend zu berufen, – ich war zur Zeit der angeblichen Verfehlungen nicht mündig, – aber das wies ich zurück. Ich hatte schon zu viel gedacht und gelitten, auch schon zu viel geleistet, um mich hinter meiner Jugend zu verstecken. Aus den Schlußworten meines Briefes geht schon hervor, daß ich, der ich in Natal dem General gegenüber meine Pflicht als Mann getan hatte, nicht als Kind behandelt sein wollte. Der ganze Brief beweist, wie grundlos die Beschuldigungen gegen mich waren! Wer schuldig ist, schreibt anders!
Man setzte mich nicht ins Gefängnis, und das hätte doch eigentlich geschehen müssen, wenn meine kriminelle Schuld so offenbar war! Aber vielleicht war diese scheinbare Versäumnis nicht unbeabsichtigt. Den Gefangenen hätte man mit Nahrung und Unterkunft versehen müssen. Da ich Padang nicht verlassen konnte, war ich ja auch Gefangener, nur eben ein Gefangener ohne Obdach und Brot. Ich schrieb wiederholt, aber immer erfolglos, dem General, er möge mir meine Abreise von Padang ermöglichen, denn wenn ich selbst das Schlimmste begangen hätte, so dürfe doch kein Verbrechen mit Hungerleiden bestraft werden.
Der Rechtsrat, dem die Sache wohl etwas brenzlich erschien, erklärte sich für unzuständig, da Strafverfolgungen wegen Untreue im Amt nur auf Antrag der Regierung in Batavia eingeleitet werden dürfen. Dennoch hielt mich der General noch neun Monate in Padang zurück, bis er endlich von oben herab den Befehl erhielt, mich nach Batavia reisen zu lassen.
Als ich ein paar Jahre darauf wieder Geld hatte, – du hast es mir gegeben, meine liebe Tine, – bezahlte ich die paar tausend Gulden um das Kassenmanko von 1842 und 43 aus Natal wieder glattzumachen, und da sagte mir jemand, der die Regierung von Niederländisch-Indien sehr genau kannte: ›Das hätte ich an Ihrer Stelle nicht getan; ich hätte einen Wechsel auf die Ewigkeit gegeben!‹
So geht es zu in der Welt.«
Havelaar wollte gerade weiter erzählen, wieso er General van Damme in Natal widersprochen hatte, als Frau Slotering auf der Vorgalerie ihrer Wohnung erschien und den Polizeiaufseher, der neben dem Grundstück auf einer Bank saß, heranwinkte. Der näherte sich und rief dann einem Manne, der wahrscheinlich in der Absicht, zum Küchengebäude zu gelangen, das Grundstück betreten hatte, etwas zu. Der ganze Vorgang wäre wahrscheinlich unbemerkt geblieben, wenn nicht Frau Havelaar schon während der Mahlzeit über die Menschenscheu von Frau Slotering geklagt hätte, die alles beobachtete, was zwischen den Wohnhäusern geschah. Jetzt sah man den Mann, den der Polizeidiener angerufen hatte, zu ihr hingehen. Sie schien ihn in ein Verhör zu nehmen, das wohl nicht zu seinen Gunsten ablief, denn er wandte sich um und lief wieder hinaus.
»Schade,« sagte Tine, »der Mann wollte vielleicht Geflügel oder Gemüse verkaufen, ich habe noch gar nichts im Hause.«
»Dann schicke doch jemanden danach,« riet Havelaar. »Du weißt die inländischen Damen zeigen gerne ihre Autorität. Ihr Mann war hier der Erste am Platze ... So wenig ein Residentschaftsassistent auch bedeutet, in seinem Bezirk ist er ein kleiner König. Sie hat sich an die Entthronung noch nicht gewöhnt. Laß der armen Frau das unschuldige Vergnügen, tue als ob du nichts bemerktest!«
Das fiel Tine nicht schwer, sie legte gar kein Gewicht auf Autorität.
Ich muß hier abschweifen, und zwar ziemlich weit abschweifen. Es wird dem Verfasser nicht immer leicht, zwischen den beiden Extremen »zuviel« und »zu wenig« die richtige Mitte innezuhalten, und diese Schwierigkeit wächst, wenn man Zustände beschreibt, die den Leser in eine unbekannte Umwelt versetzen. Milieu und Ereignisse stehen in engem Zusammenhang. Behandelt der Autor europäische Begebenheiten, so kann er vieles als bekannt voraussetzen, während er, wenn seine Erzählung in Indien spielt, sich immer wieder fragen muß, ob der nichtindische Leser diesen oder jenen Umstand richtig auffassen wird. Wenn er sich nun Frau Slotering als Logiergast bei Max Havelaar etwa nach europäischem Muster vorstellt, muß es ihm unbegreiflich erscheinen, daß sie nicht an der Mahlzeit teilnahm und nicht beim Kaffee mit den anderen auf der Veranda saß. Ich habe zwar schon erklärt, daß sie ein anderes Haus bewohnte, aber um den ganzen Zustand und auch manches der späteren Ereignisse, verständlich zu machen, muß das Grundstück Havelaars nach Lage und Einrichtung näher beschrieben werden.
Man darf sich ein Wohnhaus in Niederländisch-Indien durchaus nicht auf Grund europäischer Begriffe vorstellen, etwa einen Steinbau mit übereinandergelagerten Zimmerfluchten, die Front nach der Straße, zu beiden Seiten Nachbarn, deren Hausgötter sich mit den Deinigen vereinen, und hinten das Gärtchen mit ein paar Beerensträuchern usw. Von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, hat das indische Haus überhaupt keine Stockwerke. Das kommt dem Europäer absonderlich vor, da er im allgemeinen alles, was nicht seiner Zivilisation, oder was er dafür hält, entspricht, seltsam findet. Das indische Haus ist von dem unseren ganz verschieden, doch nicht jenes, vielmehr unsere Häuser sind absonderlich.
Wer sich zuerst den Luxus gestattete, nicht länger in einem Raum mit seinen Haustieren zu schlafen, hat den zweiten Raum nicht über dem ersten, sondern daneben angelegt, denn auf der gleichen Fläche zu bauen, ist erstens leichter, und zweitens ist die Benützung der Räume bequemer. Unsere Hochbauten verdanken ihr Entstehen der Raumnot, wir suchen in der Luft, was auf dem ebenen Boden fehlt. In jenen Ländern nun, in denen Zivilisation und Übervölkerung die Menschen noch nicht in die Luft gehoben haben, besitzen die Häuser keine Stockwerke, und dasjenige von Havelaar machte keine Ausnahme von dieser Regel.
Man stelle sich ein langes Viereck vor, in der Breite in drei, in der Tiefe in sieben Abschnitte geteilt, so daß sich einundzwanzig Kammern ergeben.
Die einzelnen Fächer numerieren wir, links oben mit 1 beginnend und nach rechts weitergehend. Die ersten drei Nummern zusammen bilden dann die Vorgalerie oder Veranda, die nach drei Seiten offen ist, und deren Dach vorn auf Säulen ruht. Durch zwei Doppeltüren gelangt man in die Innengalerie, die durch die Abteilungen 4, 5 und 6 gebildet wird. Die Fächer 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 und 18 sind Zimmer, von denen die meisten durch Türen miteinander verbunden sind. Die drei Teile mit den höchsten Zahlen sind die Hintergalerie, und die übrigbleibenden Nummern 8, 11, 14, 17 bilden einen abgeschlossenen Korridor oder Durchgang. Auf diese Beschreibung bin ich ordentlich stolz!
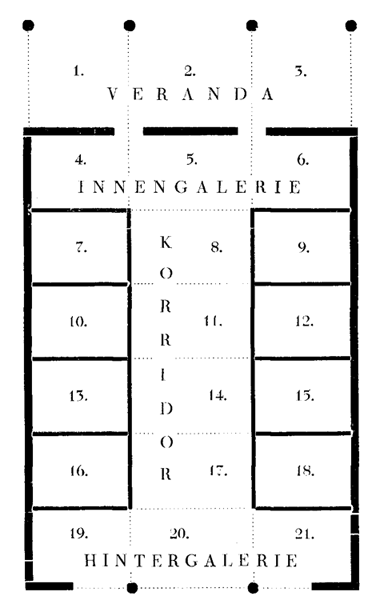
Das Grundstück, oder vielmehr dessen unbebauten Teil, nennt man in Niederländisch-Indien das »Erbe«. Es ist nahezu unmöglich, diesen Begriff für das europäische Verständnis genau zu beschreiben. Es kann Garten, Park, Feld, Gebüsch oder auch wieder ein Weidestück umfassen, häufig weist es keinerlei Vegetation auf, und wir müssen uns schon mit dem Ausdruck Grundstück begnügen, um den Begriff »Erbe« wiederzugeben.
Havelaars Erbe war sehr groß, nach der einen Seite zu konnte man es sogar unendlich nennen, da es dort in eine Schlucht überging, die sich bis an die Ufer des Tjudjung erstreckte, des Flusses, der Rangkas-Betung mit einer seiner Windungen umschließt. Es ist schwer, festzustellen, wo das Erbe aufhörte, und das Gemeindegrundstück begann, da der Fluß zeitweise seine Ufer bis außer Sehweite zurückzog, bei Hochwasser aber die ganze Schlucht bis an Havelaars Haus füllte, und dadurch die Grenze fortwährend verschob.
Diese Schlucht war von jeher ein Dorn in den Augen von Frau Slotering, und das erscheint sehr begreiflich. Die Vegetation ist überall in Indien sehr üppig; an dieser Stelle aber, die durch den jeweils zurückbleibenden Flußschlamm immer wieder gedüngt wurde, wuchs sie ins Unendliche. Oft strömten die Wasser mit solcher Gewalt daher, daß alles Buschwerk entwurzelt und mitgerissen wurde. Aber kaum hatten sich die Fluten verlaufen, da bedeckte sich in kurzer Zeit der ganze Boden wieder mit soviel Strauchwerk, daß die Säuberung des Grundstückes bis in die unmittelbare Nähe des Hauses erschwert wurde. Das ist natürlich ärgerlich, selbst wenn man keine besondere Neigung zur Hausfrau hat. Denn abgesehen von der Unzahl von Insekten, die abends in solcher Menge um die Lampe fliegen, daß Lesen und Schreiben zur Unmöglichkeit wird, birgt das Gestrüpp auch allerlei Schlangen und anderes Gezücht, das sich im vorliegenden Falle nicht auf die Schlucht beschränkte, sondern manchmal im Garten in der Nähe des Hauses und im Vorgarten selbst entdeckt wurde.
Diesen Vorgarten übersah man am besten, wenn man auf der Veranda, den Rücken an das Haus gelehnt, stand. Links davon erstreckte sich das Regierungsgebäude mit den Büros der Kasse und der Versammlungsgalerie, wo Havelaar seine Ansprache an die Häuptlinge gehalten hatte. Dahinter fiel die Schlucht ab, über die hinweg man bis an den Tjudjung sehen konnte. Gegenüber den Regierungsgebäuden befand sich die alte Residentschaftsassistenten-Wohnung, die nun vorübergehend durch Frau Slotering eingenommen wurde. Der Zugang von der Straße führte über zwei Wege, die zu beiden Seiten einer breiten Grasfläche entlangleiteten. Aus dieser Beschreibung ist es klar ersichtlich, daß jeder, der das Erbe betrat, um sich nach den hinter dem Hauptgebäude befindlichen Küchen und Ställen zu begeben, entweder an den Büros oder an der Wohnung der Frau Slotering vorbei mußte. Rechts von dem Hauptgebäude erstreckte sich der große Garten, der die besondere Freude von Tine sowohl durch seine Blumenpracht als auch durch den Umstand hervorgerufen hatte, daß er ihr als geeigneter Spielplatz für den kleinen Max erschien.
Havelaar hatte sich bei Frau Slotering entschuldigen lassen, daß er ihr noch keinen Besuch gemacht hatte. Er nahm sich vor, das am nächsten Tage nachzuholen; aber Tine war bereits dort gewesen und hatte die Bekanntschaft der Dame gemacht. Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß sie ein sogenanntes, »inländisches Kind« war und keine andere Sprache als Malayisch verstand. Sie hatte den Wunsch geäußert, ihren eigenen Haushalt weiter zu führen, und Tine war gern damit einverstanden. Dieses Einverständnis entsprang nicht etwa irgendeiner mangelnden Gastfreiheit, sondern vielmehr der Befürchtung, daß sie so unmittelbar nach der Ankunft in Lebak und ohne vollständige Einrichtung Frau Slotering nicht mit derjenigen Rücksicht und Sorgfalt bei sich aufnehmen könnte, wie es der gegenwärtige Zustand dieser Dame erforderlich machte. Aber selbst, wenn es die Umstände gestattet hätten, wäre der ständige Umgang mit jemandem, der nur eine Eingeborenen-Sprache spricht, kaum zu einer Annehmlichkeit für beide Teile geworden. Tine hätte ihr natürlich Gesellschaft geleistet, hätte mit ihr über Küchenangelegenheiten, über sambal-sambal Sambal-sambal ist der Sammelname für die schier unübersehbare Anzahl indischer Vor- und Zuspeisen., über das Einmachen von kelimon geplaudert, aber sehr abwechslungsreich ist das auf die Dauer nicht, und so war es ihr natürlich viel lieber, daß der Verkehr durch Frau Sloterings freiwillige Zurückgezogenheit so geregelt war, daß beiden Parteien vollkommene Freiheit blieb. Seltsam war es allerdings, daß sich Frau Slotering nicht nur geweigert hatte, an der gemeinschaftlichen Mahlzeit teilzunehmen, sondern auch von dem Anerbieten, ihre Speisen in der Küche von Havelaars Haus zu bereiten, keinen Gebrauch machte. »Das heißt die Bescheidenheit etwas sehr übertreiben,« erklärte Tine, »denn die Küche ist doch groß genug.«