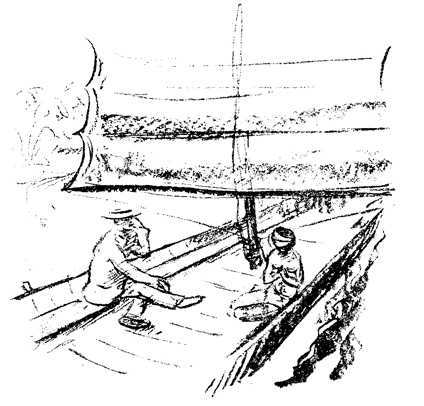|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Also, um mit Abraham Blankaart zu reden, will ich gleich erklären, daß ich dieses Kapitel als »wesentlich« betrachte, weil es, nach meiner Meinung, Havelaar deutlicher erkennen läßt, und er scheint doch nun einmal der Held dieser Geschichte zu sein.
»Tine, was ist das bloß für ketimon Ketimon = Gurken.! Kind, du darfst doch Früchte nicht mit Essig einmachen! Gurken, Ananas, Pampelmusen, alles was aus der Erde wächst nur mit Salz, Fisch und Fleisch mit Essig! ... Das kannst du bei Liebig nachlesen.«
»Aber Max,« sagte Tine, »wie lange sind wir denn hier? Den Ketimon hat noch Frau Slotering eingemacht.«
Havelaar mußte sich wirklich darauf besinnen, daß er erst gestern angekommen war und Tine beim besten Willen noch nichts in Küche und Haushalt hatte regeln können. Er selbst hatte das Gefühl, schon lange in Rangkas-Betung zu sein. Die ganze Nacht hatte er mit der Durcharbeitung des Archivs hingebracht, durch seine Seele war schon so unendlich vieles, was sich auf Lebak bezog, gegangen, daß er wirklich nicht mehr so ohne weiteres sich erinnern konnte, erst seit gestern da zu sein. Tine verstand das sehr gut, wie sie immer und alles verstand, was ihn betraf.
»Ja richtig, das stimmt,« lachte er, »aber Liebig kannst Du trotzdem lesen! ... Haben Sie viel von Liebig gelesen, Verbrugge?«
»Wer ist das?« fragte der Kontrolleur.
»Das ist ein Mann, der viel über das Einlegen von Gurken geschrieben hat. Und außerdem hat er entdeckt, wie man aus Gras Wolle macht. Verstehen Sie das?«
»Nein«, erwiderten Verbrugge und Duclari gleichzeitig.
»Na, das Verfahren ist lange bekannt, man braucht nur Schafe auf die Weide zu schicken ... Aber Liebig rationalisiert das alte Verfahren, indem er zeigt, daß Quantum und Qualität der Schafwolle von der Güte der Weide abhängen. Andere bestreiten seine Theorie, und nun suchen die Gelehrten, wie sie auf dem Produktionswege von der Weide zur Wolle das Schaf ganz ausschalten können! Ja, die lieben Gelehrten! Molière hat sie richtig erkannt ... Ich schwärme für Molière. Wenn Sie wollen, richten wir uns ein paarmal in der Woche Leseabende ein. Tine macht mit, wenn der Junge zu Bett ist.«
Duclari und Verbrugge stimmten gerne zu, und Havelaar erklärte, zwar nicht viel Bücher zu haben, aber doch befänden sich in seiner Bibliothek Schiller, Goethe, Heine, Vondel, Lamartine, Thiers, Say, Malthus, Scialoia, Smith, Shakespeare, Byron ...
Verbrugge warf ein, daß er nicht Englisch lese.
»Mann, Sie sind doch über dreißig Jahre alt! Was haben Sie denn die ganze Zeit getan? Das muß für Sie doch auf Padang, wo so viel englisch gesprochen wird, sehr hinderlich gewesen sein! Haben Sie Miß Mata-Api Mata-Api = Feuerauge. gekannt?«
»Nein, den Namen kenne ich nicht.«
»Es war auch nur ein Spitzname, weil ihre Augen so glänzten. Ich glaube, sie ist längst verheiratet. Das ist ja schon so lange her, aber nie wieder habe ich etwas so Schönes gesehen ... Ja doch in Arles, ... da müssen Sie mal hinfahren. Das ist das Herrlichste, was ich auf allen meinen Reisen je gesehen habe. Es gibt überhaupt, nach meiner Meinung, nichts, was uns die Schönheit an sich, das überirdisch Reine, so greifbar vorstellt wie eine schöne Frau. Ich rate Ihnen, fahren Sie mal nach Arles und Nîmes.«
Duclari, Verbrugge und auch Tine konnten sich nicht enthalten, laut aufzulachen bei dem Gedanken, so ohne weiteres aus dem westlichen Winkel von Java nach Arles oder Nîmes in Südfrankreich zu fahren. Havelaar, der in seinen Gedanken wahrscheinlich auf den Türmen stand, die einst die Sarazenen neben der Arena zu Arles errichtet hatten, mußte sich erst wieder zurechtfinden, ehe er den Grund dieses plötzlichen Gelächters verstand. Dann fuhr er fort:
»Ich meine natürlich, wenn Sie da mal in der Nähe sind. Etwas Ähnlichem bin ich wirklich nirgends begegnet. Ich war daran gewöhnt, beim Anblick vieler gepriesener Herrlichkeiten nur Enttäuschung zu empfinden, z. B. bei den Wasserfällen, von denen man soviel spricht und schreibt. Ich kann mir nicht helfen, ich habe am Tondano, am Maros Tondano und Maros, beides große Katarakte auf Celebes., in Schaffhausen, am Niagara wenig oder nichts empfunden. Man muß erst immer in seinen Reiseführer blicken, um das verlangte Maß von Bewunderung aufzubringen über so und soviel Fuß Fallhöhe und über so und soviel Kubikfuß Wasser in der Minute, und wenn dann die Ziffern sehr hoch sind, tut man erstaunt. Ich sehe mir keine Wasserfälle mehr an, wenn sie mir nicht gerade auf meinen Wegen begegnen. Bauten machen stärkeren Eindruck auf mich, besonders, wenn sie gewissermaßen Blätter aus dem Buche der Geschichte sind. Da spricht doch eine ganz andere Empfindung mit! Man blickt in die Geschichte zurück und läßt die Geister der vergangenen Zeit Revue passieren. Ich gebe zu, daß sich darunter manchmal auch sehr abscheuliche Geister befinden, so interessant sie auch sonst sein mögen, und die Erinnerungen befriedigen unser Schönheitsgefühl gerade nicht, wenigstens nicht ohne peinlichen Beigeschmack. Aber auch ohne alle historischen Reminiszenzen steckt in manchen Bauten doch unendlich viel Schönes. Gewöhnlich wird es einem allerdings durch die Führer verdorben. Durch die aus Papier und die aus Fleisch und Bein, das kommt auf eines heraus. Jede Andacht stören sie durch ihr eintöniges: »Diese Kapelle wurde im Jahre 1223 durch den Bischof von Münster erbaut, die Säulen sind 63 Fuß hoch und ruhen auf ...« Ich weiß viel worauf, und das ist mir auch höchst gleichgültig. Dieser Singsang ist so ärgerlich, man fühlt förmlich, daß man 63 Fuß Bewunderung aufbringen muß, sonst wird man in den Augen der anderen zu einem Vandalen oder Geschäftsreisenden. Das ist ein Volk!«
»Die Vandalen?«
»Nein, ich meine die Anderen. Nun könnte man ja sagen, steckt den Führer in die Tasche, wenn er gedruckt ist, und lasse ihn draußen stehen oder schweigen, wenn er auf zwei Beinen herumläuft; aber abgesehen davon, daß man, um zu einem einigermaßen gerechten Urteil zu kommen, wirklich häufig zuverlässige Angaben braucht, würde man wohl auch bei einem Gebäude vergeblich länger als einige sehr kurze Augenblicke etwas suchen, das unser Verlangen nach Schönheit befriedigt, weil die Architektur starr und unbewegt ist. Das gilt nach meiner Ansicht auch für das Werk des Bildhauers und des Malers. Natur ist Bewegung. Wachstum, Hunger, Denken, Fühlen, das ist Bewegung, ... Stillstand ist der Tod; ohne Bewegung gibt es keinen Schmerz und keine Freude, gibt es keine Empfindung. Da unser Schönheitssinn in einem Blick auf das Schöne keine Befriedigung genießt, sondern nach der Bewegung dürstet, empfinden wir beim Anschauen dieser starren Kunstwerke etwas Unvollendetes, und deshalb behaupte ich, daß eine schöne Frau, sofern es sich nicht um eine langweilige Porträtschönheit handelt, dem Ideal des Göttlichen am nächsten kommt. Wie scheußlich wirkt es, wenn eine große Tänzerin, und wäre es die Elssler oder die Taglioni, am Schlusse ihrer Darbietungen plötzlich auf einem Bein stehend, ins Publikum lächelt.
»Das sieht doch wirklich abscheulich aus,« warf Verbrugge ein.
»Das meine ich auch; aber sie gibt es doch als schön und als Steigerung des Vorhergegangenen, das vielleicht wirklich sehr viel Schönes enthielt. Sie gibt es als die Pointe eines Epigrammes, als das » Aux armes!« Aux armes! Zu den Waffen! Mit diesem Ruf beginnt der Kehrreim der Marseillaise. der Marseillaise, die sie mit ihren Füßen sang. Und die Zuschauer, die im allgemeinen ihren Geschmack, genau wie wir das mehr oder weniger auch tun, aus Gewohnheit und Nachahmung bilden, sehen in diesem Augenblick die Krönung des Ganzen und brechen in lauten Beifall aus, als ob sie es nun gerade jetzt vor Bewunderung nicht länger aushielten. Sie sagen, daß die Schlußpose abscheulich sei, ich bin der gleichen Meinung; aber woran liegt das? Weil sie die Bewegung abbricht und damit die Geschichte, die die Tänzerin erzählte. Glauben Sie mir, Stillstand bedeutet Tod.«
»Ja aber«, erklärte Duclari, »Sie haben auch die Wasserfälle als Ausdruck des Schönen verworfen, und Wasserfälle bewegen sich doch.«
»Richtig, aber ohne Geschichte! Sie bewegen sich, aber sie kommen nicht von der Stelle. Sie bewegen sich wie ein Schaukelpferd, nur daß ihnen auch das Auf und Nieder fehlt, sie machen Geräusch, aber sie verkünden nichts, sie rufen ihr tosendes Ru ... Ru ... Ru ... und nichts Anderes. Rufen Sie mal 6000 Jahre lang oder noch länger, Ru ... Ru ... Ru ..., dann wollen wir mal sehen, wer Sie noch als unterhaltsamen Mitbürger betrachten wird.«
Duclari lachte: »Den Versuch werde ich lieber nicht unternehmen, aber ich stimme mit Ihnen doch nicht überein, daß die Bewegung so unbedingt notwendig sei. Ein gutes Bild kann doch sehr viel ausdrücken.«
»Sicher, aber nur einen Augenblick. Ich will versuchen, Ihnen meine Auffassung durch ein Beispiel zu erklären. Es ist heute der 18. Februar ...
»Aber nein«, rief Verbrugge, »wir sind ja noch im Januar!«
»Nicht doch, heute ist der 18. Februar 1587, und Sie sitzen im Kerker des Schlosses von Fotheringhay.«
»Ich?« fragte Duclari, der nicht richtig verstanden zu haben glaubte.
»Jawohl Sie, – Sie langweilen sich und suchen Zerstreuung. Da, in der Mauer, ist eine Öffnung, aber sie ist zu hoch, um durchblicken zu können, und das gerade wollen Sie. Sie schieben Ihren Tisch davor, stellen einen Schemel darauf, von dessen drei Beinen das eine etwas schwach ist. Sie haben mal auf einem Jahrmarkt einen Akrobaten gesehen, der sieben Schemel aufeinander türmte und auf dem obersten auf dem Kopfe stand. Sie langweilen sich so, daß in Ihnen der Wunsch entsteht, etwas ähnliches zu tun. Sie klettern auf den schwankenden Stuhl, erreichen das Loch in der Mauer, blicken hindurch und in demselben Augenblick rufen Sie aus: ›O Gott‹ und fallen herab. Können Sie mir nun sagen, warum Sie ›O Gott‹ riefen und herunter gefallen sind?«
»Wahrscheinlich, weil das schwache Bein des Schemels brach,« erklärte Verbrugge.
»Vielleicht, aber darum sind Sie nicht gefallen. Vor jeder anderen Maueröffnung hätten Sie es ein Jahr lang auf dem Schemel ausgehalten. Und vor dieser mußten Sie herabstürzen, selbst, wenn der Schemel wer weiß wieviel starke Beine gehabt, ja selbst, wenn Sie mit beiden Füßen fest auf dem Boden gestanden hätten.«
»Ich gebe meinen Widerstand auf«, sagte Duclari, »ich sehe schon, Sie haben es sich in den Kopf gesetzt, ich muß fallen. Jetzt liege ich also da, so lang ich bin, aber ich weiß wahrhaftig nicht, warum.«
»Das ist sehr einfach! Sie erblickten durch die Maueröffnung eine schwarzgekleidete Frau, die vor einem Richtblock kniete. Sie beugte ihr Haupt, und weiß, wie Silber, hob sich ihr Hals aus dem schwarzen Samt. An ihrer Seite stand ein Mann mit erhobenem großen Schwert, seine Augen starrten auf den weißen Hals, er suchte, welchen Bogen sein Schwert beschreiben müßte, um da zwischen den Wirbeln mit Sicherheit und Macht durchzuschlagen ... Und da fielen Sie, Duclari. Sie fielen, weil Sie das alles sahen und deshalb riefen Sie: ›O Gott!‹ und nicht, weil der Schemel nur drei Beine hatte. Lange nachdem Sie aus Ihrem Kerker in Fotheringhay erlöst wurden, – vielleicht auf Fürsprache eines Verwandten, oder aber auch, weil es den Leute zu dumm wurde, Sie noch länger wie einen Kanarienvogel im Käfig zu füttern, – lange danach, ja bis heutigen Tages träumen Sie wachend von dieser Frau. Im Schlaf selbst schrecken Sie empor, als wollten Sie dem Henker in den Arm fallen. Ist das nicht richtig?«
»Möglich, aber ganz genau kann ich es doch nicht sagen, denn ich habe nie in Fotheringhay durch ein Mauerloch geguckt.«
»Ich auch nicht. Aber denken Sie sich jetzt einmal ein Bild, das die Enthauptung der Maria Stuart schildert, und wir wollen annehmen, daß es ein vollendetes Kunstwerk sei. Es hängt da in vergoldetem Rahmen, ... aber nein, das sehen Sie ja alles gar nicht. Der Eindruck ist so stark, daß Sie alles vergessen. Sie sehen weder den Rahmen noch das Bild; Sie sehen nichts als die Hinrichtung von Maria Stuart, genau so wie in Fotheringhay. Der Henker steht, so wie er wirklich dort gestanden haben muß, der Eindruck ist so stark, daß Sie den Arm erheben, um den Schlag abzuwehren.«
»Ja und was weiter? Ist dann der Eindruck nicht ebenso heftig, als wenn ich alles in Fotheringhay in Wirklichkeit sähe?«
»Nein, denn diesmal sind Sie nicht auf einen Schemel mit drei Beinen geklettert. Sie nehmen wieder einen Stuhl, aber nun einen mit vier Füßen, am liebsten einen Sessel. Sie setzen sich vor das Bild, um es lange mit Genuß zu betrachten. Denn selbst der Anblick von etwas Gräßlichem kann uns noch Genuß verschaffen. Und welchen Eindruck ruft das Bild nun bei Ihnen hervor?«
»Schreck, Angst, Mitleid, Rührung, genau als ob ich durch die Maueröffnung blickte. Wir haben vorausgesetzt, daß das Bild ein vollkommenes Kunstwerk sei, es muß auf mich also genau denselben Eindruck machen wie die Wirklichkeit.«
»Keineswegs! Nach zwei Minuten tut Ihnen Ihr rechter Arm weh, aus Sympathie mit dem Henker, der so lange den schweren Stahl unbeweglich hochhalten muß.«
»Jawohl, Mitgefühl. Und auch mit der Frau, die da so lange in unbequemer Haltung und wahrscheinlich auch in sehr unangenehmer Stimmung vor dem Block liegt. Sie haben immer noch Mitleid mit ihr, aber nun nicht mehr, weil sie enthauptet werden soll, sondern weil man sie so lange darauf warten läßt, und wenn Sie jetzt noch etwas sagen oder ausrufen sollten, so würde es wahrscheinlich lauten: ›Schlagt doch in Gottes Namen zu, die Frau wartet ja darauf!‹«
»Was liegt dann aber in der Schönheit in Arles für Bewegung?« fragte Verbrugge nach einer kleinen Pause.
»O, das ist was Anderes! Auf ihrem Antlitz spielen Jahrtausende der Geschichte, auf ihrer Stirn blüht Karthago und sendet seine Schiffe aufs Meer, ... Hannibals Schwur gegen Rom steigt empor, ... sie flechten Bogensehnen für ihre Krieger, in ihrem Antlitz brennt die Stadt ...«
»Max, Max, ich glaube, du hast dein Herz in Arles verloren,« lächelte Tine.
»Ja, einen Moment, aber ich fand es zurück. Du sollst es gleich hören. Ich sage nicht, daß ich eine Frau gesehen habe, die so schön war. Nein, sie waren es alle, und so wird es zur Unmöglichkeit, sich da zu verlieben, weil jede folgende die vorige aus Ihrer Bewunderung verdrängt. Ich mußte an Caligula denken, der der ganzen Menschheit nur ein Haupt wünschte, und unwillkürlich kam auch mir der Wunsch, daß die Frauen in Arles ...«
»Nur ein gemeinschaftliches Haupt haben sollten?«
»Ja.«
»Um es abzuschlagen?«
»O, nein, um es auf die Stirn zu küssen, aber das ist es auch nicht, ... um es anzublicken, davon zu träumen, und um ... gut zu sein.«
Duclari und Verbrugge fanden diese Bemerkung wahrscheinlich wieder sehr seltsam, aber Max sah ihr Erstaunen nicht und fuhr fort:
»So edel waren die Züge, daß man sich schämte, nur ein Mensch zu sein und nicht ein Funke, ein Strahl, ein Gedanke, aber dann tauchte plötzlich an der Seite dieser Frauen ein Bruder oder ein Vater auf, und eine habe ich gar gesehen, die sich die Nase schnäuzte ...«
»Ich wußte schon, daß du wieder mit einem schwarzen Strich das ganze Bild zerstören würdest,« sagte Tine verdrießlich.
»Ich kann's nicht ändern. Ich hätte sie lieber tot zu Boden sinken sehen! Darf so ein Mädchen sich so profanieren?«
»Ja, Herr Havelaar«, sagte Verbrugge, »wenn sie nun aber einen Schnupfen hat.«
»Mit solch einer Nase darf man keinen Schnupfen haben.«
»Das ist leicht gesagt.«
Als ob der Böse im Spiele wäre, mußte Tine plötzlich niesen, und ehe sie noch daran dachte, hatte sie auch schon die Nase geputzt.
»Lieber Max«, bat sie mit unterdrücktem Lachen, »du mußt mir deshalb nicht böse sein.«
Er antwortete nicht. Und so lächerlich es scheint, er war böse! Und so seltsam es auch klingt, Tine war froh darüber, daß er böse war und von ihr mehr forderte, als von den phokäischen Frauen in Arles, wenn sie auch keinen Grund hatte, auf ihre Nase besonders stolz zu sein.
Falls Duclari noch der Meinung war, daß Havelaar ein Narr sei, hätte man ihm das bei der Verstimmung, die sich nach Tines Niesen auf seinem Gesicht malte, nicht übelnehmen können.
Aber Havelaar kehrte schnell aus den Gefilden Karthagos in die Alltäglichkeit zurück und erkannte, daß sich auf den Mienen seiner Gäste zwei Ansichten malten:
1. Wer nicht will, daß sich seine Frau die Nase schnaubt, ist ein Narr.
2. Wer der Ansicht ist, daß eine schöngeschwungene Nase nicht geputzt werden darf, tut Unrecht, dieses Gebot auf Frau Havelaar anzuwenden, deren Nase ein wenig à la pomme de terre à la pomme de terre – kartoffelförmig. gebildet ist.
Wenngleich die Gäste viel zu höflich waren, um diese Ansichten auszusprechen, Havelaar war doch bereit, auf das Thema einzugehen. Aber ein bittender Blick von Tine legte ihm etwas Zurückhaltung auf. Er ging sofort ins Allgemeine:
»Wissen Sie, meine Herren, wir täuschen uns häufig über den berechtigten Anspruch des Menschen auf gewisse körperliche Unvollkommenheiten.«
Die Gäste sahen ihn fragend an. Von solchen Ansprüchen hatten sie nie etwas vernommen.
»Ich habe auf Sumatra ein Mädchen gekannt«, fuhr Havelaar fort, »die Tochter eines datu datu = Häuptling.. Die hatte einen solchen Anspruch nicht, und doch habe ich erlebt, wie sie bei einem Schiffbruch ins Wasser fiel, genau wie der erste beste! Ich, ein gewöhnlicher Mensch, mußte ihr an Land helfen.«
»Hätte sie etwa wie eine Möwe fliegen sollen?«
»Natürlich! ... Oder vielmehr, sie hätte überhaupt nichts Körperliches haben dürfen! Ich lernte sie kennen, ... im Jahre 42, ich war damals Kontrolleur in Natal Natal an der Westküste von Sumatra. ... Sind Sie da auch gewesen, Verbrugge?«
»Ja.«
»Dann wissen Sie, daß in Natal hauptsächlich Pfeffer angebaut wird. Die Pflanzungen liegen in Taloh-Baleh, nördlich von Natal an der Küste. Ich sollte sie inspizieren, und da ich von Pfeffer nicht viel verstand, nahm ich in meiner prahu prahu entspricht der Prau der Chinesen. Ein mittelgroßes Segelboot. einen datu mit, der Bescheid wußte. Sein Töchterchen, – es war damals ein Kind von dreizehn Jahren, – fuhr mit. Wir segelten längs der Küste und langweilten uns. Es war entsetzlich heiß. So eine prahu bietet wenig Abwechslung, und obendrein befand ich mich aus allerlei Gründen in einer scheußlichen Stimmung. Ich schwankte gerade zwischen mehreren unglücklichen Lieben und litt ständig an unbefriedigtem Ehrgeiz. Ich saß in der prahu mit saurem Gesicht und schlechter Laune und war mit einem Worte: Ungenießbar. Ich war empört, daß ich Pfefferplantagen inspizieren mußte, anstatt als Gouverneur eines ganzen Sonnensystems angestellt zu werden. Es war einfach moralischer Mord, einen so erhabenen Geist wie den meinen mit so einem dummen datu und seinem Kinde in eine prahu zu pferchen.

Ich muß gestehen, daß ich sonst die malayischen Großen gern mochte, und gut mit ihnen auskam. Ja, ich weiß, Verbrugge, Sie stimmen da nicht mit mir überein, und die meisten sind anderer Ansicht, ... aber das können wir jetzt dahingestellt sein lassen.
Wäre meine Bootsreise auf einen anderen Tag gefallen, – mit weniger großen Rosinen in meinem Schädel, – so hätte ich schnell mit dem datu ein Gespräch angeknüpft, und ich wäre auch wohl bald zu der Überzeugung gekommen, daß er meines Umganges würdig sei. Vielleicht hätte ich dann auch das Mädchen zum Sprechen bewogen und mich dabei selbst unterhalten, denn so ein Kind hat meist noch viel Ursprüngliches, Ungekünsteltes. Ich war zu jener Zeit allerdings selbst noch zu sehr Kind, um besonderen Wert auf Ursprünglichkeit zu legen. Heute ist das anders. Heute erscheint mir jedes Mädchen von dreizehn Jahren wie ein Manuskript, in dem noch so gut wie nichts durchgestrichen ist. Man überrascht den Autor gewissermaßen im Négligé, und das hat manchmal seinen Reiz.
Das Kind reihte Korallen auf eine Schnur, und diese Beschäftigung schien ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Immer drei rote, eine schwarze, drei rote, eine schwarze, ... es war sehr schön.
Sie hieß Si Upi Keteh. Das bedeutet auf Sumatra soviel wie »Kleines Fräulein«. Ja, Verbrugge, Sie wissen das, aber Duclari hat immer nur auf Java gedient. Sie hieß also Si Upi Keteh, aber in meinen Gedanken nannte ich sie immer »Kleinchen«, weil ich ja so himmelhoch erhaben über ihr thronte!
Es wurde Mittag, ... beinahe Abend, die Korallen waren alle untergebracht. Die Küste glitt langsam an uns vorbei, und immer kleiner und kleiner wurde der Ophir Berg an der Westküste von Sumatra. rechts hinter uns. Links im Westen, fern über der weiten, weiten See, die bis Madagaskar und dem dahinterliegenden Afrika keine Grenzen kennt, sank die Sonne und ließ ihre Strahlen in immer stumpfer werdendem Winkel über die Wogen gleiten, als suchten sie Kühlung in den unendlichen Wassern, ... Herrgott, wie war doch das Ding!
»Was für'n Ding? Die Sonne?«
»Ach wo! ... Ich hab' damals ein Gedicht gemacht ... Wunderschön ... So ging's:
Ihr fragt, warum der Ozean,
Der Natals Strand umspült,
Nie lieblich lächelnd Ruhe fand
Und immer nur an Natals Strand
So stürmisch kocht und wühlt?
Der Fischerknabe hört die Frag'.
Den Blick er fliegen läßt
Hinüber, wo der Sonnenbrand
Versinkt am roten Weltenrand
Im fernen, weiten West.
Soweit sein dunkles Auge reicht,
Da wogt es wild einher,
Da schäumt und wallt es, ohne End',
Bis an das weite Firmament
Ergießt sich Meer auf Meer.
Darum tobt hier der Ozean
Und kocht und wütet schwer,
Weil er die erste Barre fand
Bei uns, an Natals weißem Strand,
Von Madagaskar her.
Und immer Opfer gierig heischt
Des Meeres dunkler Schlund!
Weh, wer in diesen Schlund geblickt!
So mancher Schrei ward' da erstickt,
Geschlossen mancher Mund.
Wen hier die Woge mit sich riß
Und spülte über Bord,
Der tauchte nimmermehr empor,
Sein Hilferuf erreicht kein Ohr,
Sein Blick kein Rettungsport.
Und wer ...
Havelaar stockte: »Jetzt weiß ich nicht mehr, wie's weiter geht!«
»Das ist nicht schwer, festzustellen,« erklärte Verbrugge. »Sie brauchen sich nur an Krysman in Natal zu wenden. Der hat das Gedieht.«
»Wo hat er denn das her?« fragte der Autor.
»Vielleicht aus Ihrem Papierkorb. Jedenfalls hat er es. Folgt darin nicht die Legende des ersten Sündenfalles, durch den das Eiland, das früher die Reede von Natal schützte, ins Meer versinkt? Die Geschichte von Djiwa mit den beiden Brüdern?«
»Richtig! Stimmt! Bloß war es keine Legende, es war vielmehr eine Parabel, aber wenn Krysman die Geschichte häufig vorträgt, wird vielleicht in ein paar Jahrhunderten eine Legende daraus. So ähnlich beginnen die meisten Mythologien.
Djiwa bedeutet soviel wie »Seele« oder »Geist«. Ich habe eine Frau daraus gemacht, eine unvermeidliche sündige Eva ...«
»Aber Max, wo bleibt denn unser kleines Fräulein mit den Korallen?« fragte Tine.
»Ja, richtig! ... Also es war sechs Uhr geworden, und der Abend brach herein. Nun finde ich, daß der Mensch am Abend immer etwas besser ist als am Morgen, und das hat seine natürlichen Gründe. Des Morgens hat man, besonders als Beamter, alle Pflichten vor sich, alle Sorgen des kommenden Tages, alle Rückstände, die man in den nächsten Stunden erledigen muß, kurzum, des Morgens beim Erwachen fällt einem die ganze Welt aufs Herz, und das ist ein bißchen schwer, wenn das Herz auch noch so stark ist. Aber des Abends hat man Ferien! Da liegen zehn volle Stunden vor einem, bis man den Dienstrock wieder anziehen muß! Zehn Stunden, das sind sechsunddreißigtausend Sekunden, um wieder Mensch zu sein. Da lacht man freudig, und das ist auch die Tageszeit, zu der ich zu sterben hoffe, um mit einem inoffiziellen Gesichtsausdruck, das heißt ohne Amtsmiene, im Jenseits anzukommen. Das ist der Augenblick, wo die eigene Frau den Mann so sieht wie damals, als er ihr das erste Taschentuch wegnahm ...«
»Als sie noch kein Recht auf Schnupfen hatte!« warf Tine ein.
»Ach, du neckst mich nicht! ... Ich will sagen, abends ist man gemütlicher. Während also die Sonne allmählich verschwand,« fuhr Havelaar fort, »hob sich meine Stimmung. Und als erstes Zeichen dieser gehobenen Stimmung sagte ich zu dem kleinen Fräulein: »Nun wird es bald kühler werden.«
»Ja, tuwan«, war ihre Antwort.
»Aber ich ließ mich noch tiefer zu dem »Kleinchen« herab und begann mit ihr ein Gespräch. Mein Verdienst war um so größer, als sie mir sehr einsilbig antwortete. Mit allem, was ich sagte, hatte ich recht, und das wird auf die Dauer langweilig. Ich fragte: »Wirst du das nächste Mal wieder nach Taloh-Baleh mitfahren?«
»Wie es der tuwan Kommandeur befiehlt!«
»Nein, ich meine, ob es dir Vergnügen macht, mit uns auf die Reise zu gehen?«
»Wie es mein Vater bestimmt.«
Da konnte man doch wirklich die Geduld verlieren! Aber ich verlor sie nicht. Die Sonne war untergegangen, und meine Stimmung hatte sich zu sehr verbessert, um durch soviel Dummheit verdorben zu werden. Vielleicht auch machte es mir Spaß, mich selbst reden zu hören, – die meisten unter uns lauschen gern der eigenen Stimme, – jedenfalls glaube ich, nachdem ich den ganzen Tag geschwiegen habe, jetzt ein besseres Schicksal zu verdienen, als die inhaltslosen Antworten von Si Upi Keteh.
Ich werde ihr ein Märchen erzählen, nahm ich mir vor, dann höre ich selbst mit zu und brauche ihre Antworten überhaupt nicht. Nun kommt der letzte Ballen, der aufs Schiff geladen wird, beim Löschen der Ladung zuerst wieder zum Vorschein, und ebenso packen wir gewöhnlich die Geschichte zuerst aus, die wir zuletzt gelesen haben. In der »Zeitschrift für Niederländisch-Indien« hatte ich kurz vorher eine reizende Sache von Jeronimus »Der japanische Steinmetz« gefunden und verschlungen. Meine Herren, Jeronimus hat wundervolle Geschichten geschrieben! Kennen Sie seine »Auktion im Trauerhause«, seine »Gräber« und vor allem »Pedatti Pedatti = von Büffeln gezogener Wagen, der nicht auf Rädern, sondern auf Kufen ruht.« ... Ich geb's Ihnen zu lesen.
Also, ich hatte kurz vorher den »japanischen Steinmetz« kennengelernt ... Ach, jetzt weiß ich auch, wie ich vorhin auf mein Lied mit dem Fischerknaben an Natals Strand gekommen bin. Das war eine Ideenassociation! Meine Verstimmung damals bei der Küstenfahrt hing mit den Gefahren zusammen, die an der Reede von Natal drohen ... Sie wissen, Verbrugge, kein Kriegsschiff darf dort landen wegen der furchtbaren Brandung. Nun war ich wiederholt beim Residenten vorstellig geworden, um ihn zum Bau einer Mole zu veranlassen, oder wenigstens zur Anlage eines künstlichen Hafens an der Flußmündung. Das hätte den Bezirk Natal, der die wichtigen Battahländer mit der Küste verbindet, mächtig emporgebracht. Anderthalb Millionen Menschen im Hinterlande wußten für ihre Erzeugnisse keinen Absatzweg, weil die Reede von Natal mit Recht gefürchtet war. Aber der Resident wollte von meinen Plänen nichts wissen, oder vielmehr, er behauptete, die Regierung würde sie nicht gutheißen. Ein tüchtiger Resident gibt natürlich nur dann etwas weiter, wenn er vorher genau weiß, daß er bei der Regierung Gnade findet. Der Plan, in Natal einen Hafen zu bauen, widersprach dem System gewollter Abschließung, wir durften keine Schiffe anlocken, wo es uns sogar untersagt war, diejenigen, die von allein kamen, landen zu lassen! Und wenn doch welche kamen, – meist waren es amerikanische Walfischfänger oder Franzosen, die in den unabhängigen kleinen Reichen des nördlichen Winkels Pfeffer geladen hatten, – ließ ich mir immer erst vom Kapitän einen Brief schreiben, in dem er um Erlaubnis bat, Trinkwasser einnehmen zu dürfen. Jedenfalls war ich in meiner Eitelkeit schwer verletzt, daß ich es nicht einmal durchsetzen konnte, eine Hafenanlage zu bauen. Und in dieser Verstimmung, Verbitterung und Unzufriedenheit fiel mir die Geschichte vom japanischen Steinmetz ein. Ich erzählte sie wahrscheinlich viel mehr für mich als dem Kinde, aber dieses Kind brachte mich dann zur Besinnung, wenigstens vorübergehend. Ich erzähle ihr das Märchen ungefähr folgendermaßen:
Upi, es war einmal ein Mann, der Steine aus dem Felsen schlug. Die Arbeit war schwer und hart, und er mußte viel schaffen, denn sein Lohn war nur gering, und er war nicht zufrieden.
Er seufzte über seine schwere Arbeit und rief: ›Oh, daß ich reich wäre und auf einer baleh-baleh baleh-baleh = Ruhebank. mit klambu Klambu = Gardine, Vorhang. von roter Seide ruhen könnte!‹
Da stieg ein Engel vom Himmel herab und sprach: ›Dir geschehe, was du gewünscht hast!‹
Da ward er reich. Und er ruhte auf einer baleh-baleh, und die klambu war von roter Seide.
Des Landes König zog vorbei. Reiter sprengten vor seinem Wagen, und Reiter folgten ihm. Und über das Haupt des Königs hielt man den goldenen pajong.
Als der reiche Mann das sah, verdroß es ihn, daß über seinem Haupte kein goldener pajong gehalten wurde, und er war nicht zufrieden.
Er seufzte und rief: ›Ich wollte, ich wäre König!‹
Da stieg ein Engel vom Himmel herab und sprach: ›Dir geschehe, was du gewünscht hast!‹
Da war er König. Vor seinem Wagen sprengten Reiter, und Reiter folgten ihm, und über sein Haupt hielt man den goldenen pajong.
Und die Sonne schien mit sengenden Strahlen und verbrannte das Erdreich, daß die Gräser verdorrten.
Da klagte der König, daß die Sonne ihm das Antlitz versengte und Macht hatte über ihn, und er war nicht zufrieden.
Er seufzte und rief: ›Ich wollte, ich wäre die Sonne!‹
Da stieg ein Engel vom Himmel herab und sprach: ›Dir geschehe, was du gewünscht hast!‹
Da ward er die Sonne. Er sandte seine Strahlen nach oben und nach unten, nach rechts und nach links, überall hin. Er verdorrte die Gräser auf der Erde und versengte das Antlitz der Könige, die auf Erden herrschten. Aber eine Wolke schob sich zwischen ihn und die Erde, und seine Strahlen prallten an ihr zurück.
Da ward er zornig, daß ihm die Wolke widerstand und Macht hatte über ihn, und er war nicht zufrieden.
Er seufzte und rief: ›Ich wollte, ich wäre eine Wolke!‹
Da stieg ein Engel vom Himmel herab und sprach: ›Dir geschehe, was du gewünscht hast!‹
Da ward er eine Wolke und schob sich zwischen Sonne und Erde und fing die Strahlen auf, daß die Gräser zu grünen begannen. In großen Tropfen regnete die Wolke auf die Erde, daß die Flüsse schwollen, und Sturmfluten die Herden ertränkten. Seine Wasser verwüsteten die Felder. Da fiel er auf einen Felsen, der nicht wich. Er stürmte in reißenden Strömen daher, aber der Fels wankte nicht.
Da ward er wütend, daß der Felsen standhielt, und daß alle Kraft seiner Ströme eitel war.
Er rief: ›Der Fels hat Macht über mich, ich wollte, ich wäre der Fels!‹
Da stieg ein Engel vom Himmel herab und sprach: ›Dir geschehe, was du gewünscht hast!‹
Da ward er ein Fels und bewegte sich nicht, ob die Sonne schien, ob es regnete.
Doch es kam ein Mann mit Hacke, mit scharfem Meißel und schwerem Hammer, und der schlug Steine aus dem Felsen.
Der Fels sprach: ›Was bedeutet das? Der Mann hat Macht über mich und schlägt Steine aus meinem Schoß!‹ Und er war nicht zufrieden.
Er rief: ›Ich bin schwächer als dieser! Ich wollte ich wäre der Mann!‹
Da stieg ein Engel vom Himmel herab und sprach: ›Dir geschehe, was du gewünscht hast!‹
Da ward er ein Steinmetz und schlug Steine aus dem Fels. Die Arbeit war schwer und hart, und er mußte viel schaffen, denn sein Lohn war nur gering ... und er war zufrieden.‹«
»Sehr hübsch,« rief Duclari aus. »Aber was geschah nun mit der kleinen Upi?«
»Nichts,« erwiderte Havelaar. »Als mein Märchen aus war, fragte ich sie:
›Nun, Upi, was würdest du verlangen, wenn der Engel vom Himmel käme, um dir einen Wunsch zu erfüllen?‹
»O, tuwan, ich würde den Engel bitten, mich mitzunehmen in den Himmel!«
»Ist das nicht herrlich?« fragte Tine ihre Gäste, die es vielleicht etwas närrisch fanden.
Havelaar stand auf und strich sich etwas von seiner Stirn.