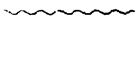|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es war in dem hintern Zimmer eines vornehm ausgestatteten Wirthshauses in einer deutschschweizerischen Kantonshauptstadt. Es war das Zimmer, in welchem allabendlich um 8 Uhr die Mitglieder der Regierung des kleinen Landes als Stammgäste sich versammelten und, der Regierungsgeschäfte ledig, alle möglichen Dinge besprachen, auch manchmal, die Würde abwerfend, sich einen Scherz erlaubten. Ein wenig Lärm, der dabei entstand, konnte nicht bis zur vordern großen Gaststube dringen, wo oft neugierige Blicke auf die Thüre geheftet waren, hinter der sich die Regierungsmänner bargen.
Einer der Gäste am runden Tisch schaute etwas ungeduldig nach der Uhr: »Er läßt heute lange auf sich warten, unser Herr Präsident.« Dabei blickte er den ihm gegenübersitzenden Sekretär fragend an. Eine leichte Befangenheit lag auf dessen hellem, intelligenten Gesichte. Jedenfalls hatte er, in Nachdenken versunken, den alten Herrn Regierungsrath nicht verstanden und wußte nicht, ob dieser ihn etwas gefragt hatte. Der alte Herr liebte es nicht, eine Frage zu wiederholen. So sagte dann der junge Mann mit einem Achselzucken: »Ich weiß nicht, Herr Regierungsrath!«
Sein Nachbar zur Rechten, ein breitschulteriger Mann mit massivem Schädel und etwas grobknochigem Gesichte, der Finanzdirektor des Kantons, nahm ebenfalls die Uhr zur Hand und sagte, indem er sie aufzog: »Da ist die Geschichte von heute Morgen schuld, derer er sich natürlich wieder angenommen hat. Sie wird ihn ein schönes Geld kosten bei seinem guten Herzen. So ist er!«
Der Staatsanwalt an seiner Seite kehrte sich gegen ihn. Er hatte, wie er es jeden Abend that, wieder das Bild betrachtet, das an der gegenüberliegenden Wand hing. Ein schmucker Bursche raubte vor dem Fenster des Hauses einem sich sträubenden Mädchen einen Kuß, während hinter den Blumen auf dem Fenstergesimse das zornige Gesicht einer alten Frau sichtbar war, welche die Faust erhob.
Vielleicht dachte der Jurist darüber nach, welcher Paragraph des Strafgesetzbuches in diesem Falle wohl anzuwenden wäre, oder das Bild erinnerte ihn an eigene derartige Erlebnisse, da er früher ein Don Juan gewesen zu sein sich rühmte.
»Welche Geschichte?« fragte er neugierig. »Bitte, Herr Rath!«
»Sie wissen nichts davon?« fragte der Finanzdirektor. »Dann muß ich es erzählen. Wie ich heute Morgen über die Brücke gehen will, bemerke ich, daß weiter unten ein Auflauf von Leuten entsteht. Ich eile hinzu und finde inmitten der Menge, die mir Platz macht, ein Mädchen fast ohnmächtig in den Armen eines Arbeiters, von den Kleidern Beider tropfte es. Die dünnen Kleider des Mädchens hatten sich ganz an den Körper gelegt, so daß die schönen Formen scharf hervor traten.«
Der gegenübersitzende Rath erhob lächelnd den Finger.
Der Erzähler fuhr fort: »Ich sah in ein todtblasses, nicht unedles Gesicht, über welches eine Strähne des aufgelösten, reichen Haares gefallen war. Nußbraune Augen öffneten sich mit dem Ausdrucke größter Angst und schlossen sich erschreckt wieder vor denjenigen der vielen fremden Menschen. Dann machte sie eine Bewegung, als wollte sie fliehen, wieder in das Element zurück, welchem sie von den kräftigen Armen des Arbeiters entrissen worden. Doch dieser schlang den rechten Arm, auf dem Schultern und Haupt ruhten, fester um sie, mit den Augen Hülfe suchend.«
»Der Hergang war leicht zu errathen, auch ohne die Rufe der neugierigen Menge, in welcher Fragen und Antworten durcheinander schwirrten. Etwas selbstbewußt erzählte der Retter dann seine That:
»Auf die Brücke tretend, sah ich, wie ich zufällig nach rechts blickte, am andern Ufer sie in das Wasser treten. Wie sie bis fast an den Hüften darin stand, kreuzte sie die Hände vor der Brust und hob das Gesicht empor – ich werde es nie mehr vergessen. Dann wandte sie sich zurück und wie sie sich wieder gegen das Wasser kehrte, erblickte sie mich und stürzte sich nun in die Fluth. Ich hatte schon zu laufen angefangen und setzte nun in großen Sprüngen über die Brücke, kugelte den Abhang hinunter und in den Fluß. Das Wasser trug sie aber, da die Kleider sich ausgebreitet hatten. Wie sie untersinken wollte, war ich gerade zur Stelle, faßte sie an den Haaren und dann um die Hüfte und arbeitete mich mit ihr gegen das Ufer, bis ich fühlte, daß ich Grund finden würde. Dann trug ich sie. Sie war ohnmächtig geworden; aber jedenfalls mehr aus Angst als etwa, daß sie Wasser geschluckt hatte. Wer sie ist, weiß ich nicht.«
»Es ist die Tochter des Schuhmachers Brandenberg, Juliane,« bemerkte Jemand aus dem Publikum.
»Und es ging ein Geflüster, daß Liebe eine Rolle in dem Drama spiele. ›Sie hat ein Verhältniß mit einem Büreaugehilfen,‹ befriedigte Jemand die Neugier der Menge.«
»Ich hatte Mitleid mit dem armen Geschöpfe, dessen schreckliches Erwachen ich mir vorstellte. Mit dem Leben abgeschlossen haben, in Gedanken gestorben sein und sich plötzlich wieder im Leben finden, muß schrecklich sein; leben müssen mit dem Brandmal des Selbstmörders, das eine vorurtheilsfreie Welt an der Stirne sieht und nicht vergißt, das ist noch mehr als ein Tod mit der vorangehenden Verzweiflung. Ich sann eben, wohin ich das Mädchen führen lassen solle, um es den neugierigen Blicken zu entziehen, als ein Mann sich durch die Menschen drängte. Man erkannte ihn sofort als Schuster, da er die Hemdärmel umgelegt und den braunen Lederschurz vorgebunden hatte. Man sah ihm auch ohne Weiters den Handwerker an, der die meiste Zeit in den Wirthsstuben zubringt und über die theure Zeit und die Kosten der Haushaltung klagt. Er rannte umher, ballte die Fäuste und rief fortwährend: »Mir, diese Schande zufügen, mir!«
»Er geberdete sich, als ob er der angesehenste Ehrenmann wäre. Dann trat er vor die Tochter und hob in seiner verdutzten Zerfahrenheit in pathetischer Weise die Fäuste vor ihr Gesicht, um seiner sittlichen Entrüstung Ausdruck zu verleihen. Da wollte ich zwischen den Verwirrten, dem dunkel das Gewissen sagte, daß er die Schuld trage, und sein unglückliches Kind treten. Schon aber stand unser Herr Landammann bei demselben, faßte es energisch, daß es die Augen aufschlug, und zog das unglückliche, durch die Scham fast niedergedrückte Mädchen an der Hand aus dem umgebenden Kreis und führte es gegen die Stadt. Niemand wagte der Neugier zu gehorchen und dem allbekannten, verehrten Beamten und seinem Schützlinge zu folgen.«
»Nun ging ich auf das Bureau. Ich wußte, daß das Mädchen aufgehoben war und, wenn es überhaupt in menschlicher Macht lag, durch des Collegen großartige Opferwilligkeit zu seinem Glücke kommen würde. Kommt er heute Abend noch, so dürfen wir von ihm mehr über den Fall erwarten.«
Die Gesellschaft schwieg. Jeder stand eine Zeit lang unter dem Eindrucke des peinlichen Vorfalles, der sowohl schmerzliches Empfinden erregte, als das ästhetische Gefühl verletzte.
In das Gesicht des Sekretärs war eine leichte Röthe gestiegen. Das Erzählte mußte ihn auf unangenehme Gedankenwege gebracht haben. Dazu kam Befangenheit, weil er fürchtete, die Unruhe zu verrathen und dann wieder das Opfer der Bemerkungen des Staatsanwaltes zu werden, der etwas unzart mit den Empfindungen der jungen Leute umsprang.
»Die Liebe ist eine große Macht,« sagte er, um das Schweigen zu unterbrechen.
»Oder vielmehr die Menschen haben eine große Schwäche,« bemerkte der Staatsanwalt. »Denn Schwäche muß man es nennen, wenn diese Liebe, welche der Natur dazu dient, zwei verschiedene Samenpollen zu vereinigen zur Bildung eines neuen Individuums, wenn diese Liebe eine solche Macht über die Menschen gewinnt, daß diese, wenn ihre Leidenschaft den begehrten Gegenstand nicht erringen kann, mit demselben auch sich selbst verlieren und aus dem Leben fliehen.«
Unmuth kämpfte in den Zügen des jungen Mannes.
»Entschuldigen Sie, Herr Anwalt!« sagte er, »wenn ich widerrede. Sie urtheilten wohl zu hart über die Opfer des Liebesgrames und dann möchte ich die Anwendung dieser rohen Theorie nicht ohne Weiteres auf solche Verhältnisse angewendet wissen; denn diejenigen, die hier in Betracht kommen, sind Menschen, die eine geistige Art, einen Willen besitzen und nicht absolut von einem blinden Naturtriebe beherrscht werden.«
»In letzterer Beziehung mag der Herr Anwalt Unrecht haben – zwar besitzt er Erfahrung in diesem Kapitel, –« nahm der Rath das Wort, »aber im Uebrigen muß ich ihm vollständig beipflichten. Diese Menschen, welche dem Ansturme einer Leidenschaft, sei sie nun edlerer oder gemeinerer Art, sofort unterliegen, sind schwache Naturen. Es fehlt ihnen die Kraft des Willens und deshalb sind sie nicht im Stande, sich in dieser Welt des Kampfes zu behaupten; so wie so würden sie stets den Kürzern ziehen und erdrückt werden. Statt nun im Getümmel unterzugehen, ziehen sie es vor, den Untergang zu beschleunigen und arbeiten dadurch nur im Dienste der Natur, welche die schwächern Individuen untergehen läßt.«
»Ihre Theorie ist grausam,« bemerkte der Sekretär. »Ich meine, jene schwächern Individuen sind auch die edlern. Sie sind Gefühlsmenschen. Ihr reiches Gemüth besitzt die Herrschaft über ihr gesammtes Geistesleben. Ihr Glück besteht in der Befriedigung des mächtigen Bedürfnisses nach Liebe. Letztere ist der Anker, an dem ihre Existenz hängt, sie ist ihre Lebensbedingung. Wird ihnen diese genommen, so schwindet ihnen jede Hoffnung auf Glück auf dieser Erde, ihre Seele wird öde und leer, von Nacht und Graus nur erfüllt. Ihre Verzweiflung an jedem Glücke, die den Verstand verwirrt, sie in einen Zustand augenblicklichen Wahnsinns versetzt, läßt einem fürchterlichen Entschlusse, dessen Ausführung ihnen als Erlösung namenloser Qual erscheint, sofort die That folgen, die Allem ein Ziel setzt. Was Sie Schwäche nennen, ist oft nichts als der Mangel eines Gegenstandes, der in der Zeit des Seelenschmerzes sie von demselben ablenkt und sie nach und nach wieder in's Gleichgewicht und zum Glücke bringen würde, wenn sie nicht so voreilig handelten.«
»Was die andern Menschen betrifft, denen Sie einzig die Existenzberechtigung zugestehen, so siegen sie über die Herzensnoth meistens nur, indem sie kurzer Hand die Ursache ihres Schmerzes wegräumen, das Gefühl ertödten, wodurch sie allerdings sich Ruhe erwerben, aber einen köstlichen Theil ihres Selbst verlieren. Der Wille siegt nur über den scheinbaren Gegner Gefühl, indem er diesen beseitigt. Dies ist ein billiger Sieg. Das Gleichgewicht zwischen beiden herzustellen gelingt ihnen so wenig als denjenigen, bei welchen das Gefühl alles, der Wille nichts ist. Das eine ist Schwäche, das andere Barbarismus, welches von beiden Extremen das schlimmere ist, will ich nicht entscheiden. Nur möchte ich fragen, wer edler ist, derjenige, welcher so bald Mittel findet, sich über Seelenschmerz zu trösten und sich in roher Weise damit brüstet, oder derjenige, für dessen Verlust, den sein weiches Herz erlitten, sich nicht so bald ein Ersatz findet und über welchen dann die lieblose Welt den Stab bricht, wenn er der Last des Daseins erliegt?«
»Wie warm Sie den Selbstmord vertheidigen, Herr Sekretär!« erwiderte der Staatsanwalt. »Das sieht fast aus, als hätten Sie schon Aehnliches erlebt, was ich jedoch nicht glaube, denn Ihre Rede ist noch von wenig Erfahrung angekränkelt.«
Wieder stieg die Röthe der Verlegenheit in das Gesicht des Jüngern unter den forschenden Blicken des Anwaltes, der ihm seine etwas spöttische, jedoch wohlwollende Miene zukehrte.
Jener fuhr fort:
»Sie mögen nicht Unrecht haben mit Ihrer vorhin aufgestellten Behauptung; von dem idealen Standpunkte aus, auf dem Sie sich befinden, erst recht nicht. Aber in der Wirklichkeit lernt man anders urtheilen. Im Leben gilt nur der, welcher sich durchschlägt, sei es auch mit mehr oder weniger Rohheit, nicht der, dessen zartbesaitete Seele springt bei dem ersten Ton, den das Leben darauf greifen will. Aus solchen Elementen bildet sich keine kräftige, strebende Gesellschaft. Es ist ja Fritz Vischer, der irgendwo meint: »Durch dieses Leben sich durchzuschlagen braucht's ein Stück Rohheit.« Sie sehen, meine Autorität ist ein Dichter, dessen Seele doch auch kein grob besaitetes Instrument ist.«
»Aber ich vertheidigte keineswegs ihre unglückselige That, durch welche sie sich ihrer Qual, aber auch ihren Pflichten entziehen, sondern ich wollte sie in Schutz nehmen gegen das Pharisäerthum derjenigen, welche sie ohne Weiteres verdammen.«
»Was streiten sich die Herren um Theorien,« bemerkte der dem Sekretär gegenübersitzende Rath, »lassen wir den Fall von heute Morgen entscheiden! Der Herr Präsident wird uns den Sachverhalt mittheilen, falls er heute noch kommt.«
Die Thüre aus der großen Gaststube öffnete sich und heller Lichtschein und verworrene Stimmen fielen in das Halbdunkel des Zimmers. Als hätte er die letzte Bemerkung verstanden, stand der Erwartete unter der Schwelle. Die Bejahrten verneigten sich bei seinem Gruße leicht, der Sekretär erhob sich schnell und blickte den allgemein verehrten Beamten fast zärtlich an. Er schaute zu ihm auf als einem herrlichen Vorbilde.
Der Eingetretene war von hoher, trotz des Alters noch ungebeugter Gestalt. Haar und Bart waren ergraut. Aber aus seinem Gesichte sprach so viel Güte des Herzens und neben dem Edelsinne und der Würde des Beamten so gewinnende Freundlichkeit, daß jedes Herz sofort für ihn schlug. Das Auge sprach Ruhe des Weisen. Er versah mit großer Einsicht sein Amt und war der Liebling des Volkes. Die Kinder sprangen ihm auf der Straße nach und reichten ihm die Hände. Die Jungfrauen hingen sich gern an seinen Arm und vertrauten ihm, was sie selbst ihren Freundinnen verbargen. Die Männer hörten auf seine Stimme. An den Volksfesten verlangte das Volk, ihn zu hören. Und er schmeichelte ihm nicht, wie andere Redner thaten. Er redete wenige, aber kräftige Worte und ermahnte zur Pflichterfüllung eines Jeden, stehe er wo er stehe; denn Jeder besitze ein hohes Amt, so gut als das seinige. Und diese Worte schlugen an des Volkes Brust und trugen bei Manchem Früchte, denn seine Worte waren seine Werke und man vertraute ihm, kannte seine Rechtlichkeit und Strenge gegen sich, aber Milde gegen Andere.
Er setzte sich auf den Stuhl, welchen der Sekretär ihm hingeschoben. Die Wirthin brachte ihm sein Fläschchen goldenen Weines und schenkte ein. Er brachte es mit einer Handbewegung den übrigen und sagte dann, nachdem er getrunken:
»Ich komme spät heute, ungewöhnliche Geschäfte hielten mich zurück.«
»Hängen sie etwa mit dem Vorfalle von heute Morgen zusammen?« fragte der Finanzdirektor. »Apropos, wie geht es Ihrem Schützlinge?«
Die Augen des Mannes leuchteten auf.
»Sie ist gänzlich hergestellt und auch glücklich und verlangt nicht wieder nach dem Tode, vor dem sie jetzt schaudert.«
»Und Sie verschweigen, daß Sie das Mädchen glücklich gemacht, mit großen Opfern, ohne Zweifel!«
Der Gute lehnte mit einem Kopfschütteln und einer unnachahmlichen Handbewegung die Schmeichelei ab.
Der neben ihm sitzende Kollege nahm das Wort: »Dürften Sie wohl uns, da Sie jedenfalls die Verhältnisse genau kennen, dieselben im Vertrauen mittheilen? Sie dürften dazu dienen, einen Streit zu entscheiden, der sich zwischen den Herren entsponnen über die Qualität der Selbstmörder aus Liebesgram.«
Die Stirne des Präsidenten legte sich in Falten und die Augen erhielten einen Ausdruck von Strenge.
»Mich übernimmt Zorn, wenn ich daran denke. Auch dieser Fall beweist wieder, wie sich die Menschen ihr Glück selbst zerstören, es opfern einer Laune, einem Vorurtheil, falschem Stolze, kurz irgend einem kleinen falschen Götzen, einer Nebensächlichkeit, welche sie die Hauptsache vergessen läßt. Dann ist es auch die Ungeduld, welche sie, da ihnen das Glück nicht sofort in den Schooß fällt, ganz daran verzweifeln läßt.
»Jetzt ist dieses Mädchen glücklich. Wäre nicht zufällig jener Arbeiter über die Brücke geschritten, läge es todt im Flusse und wüßte nichts von der Seligkeit, die es jetzt fühlt und eine Reihe anderer Menschen wäre dafür elend geworden. Schwache Menschen! – Doch, wer ist nicht schwach? Ich wollte erzählen, nicht verdammen.«
»Juliane, so heißt das Mädchen, besorgte, seit die Mutter gestorben, die Haushaltung des Vaters. Dieser ist ein Schuster, der Typus jenes Handwerkerthumes, das immer mit dem Arbeitsfelle und irgend einem Handwerkszeuge versehen überall zu treffen ist, nur nicht bei der Arbeit, sich aber stets den Anstrich großer Geschäftigkeit gibt, die meiste Zeit in der Wirthsstube stehend, kannegießert und, ohne ein Trunkenbold zu sein, doch liederlich genannt werden muß.«
»Begreiflicher Weise war deshalb die Aufgabe des Mädchens, die Haushaltung zu führen und die jüngern Geschwister aufzuziehen, keine leichte. Manchmal schien ihr Muth sie zu verlassen. Was sie aufrecht hielt, war ein Verhältniß mit einem Bureaugehilfen. Die jungen Leutchen hatten sich die Heirath versprochen, aber nun schon seit mehreren Jahren, ohne sich vereinigen zu können. Juliane hatte dies so gewünscht, um sich den ihrigen nicht zu entziehen. Dann hatte sie ihrem Verlobten erklärt, nicht zu heirathen, bevor sie eine Aussteuer besitze. Sie wolle wenigstens in einem eigenen Bette schlafen. Sie hatten gewartet. Daß sie so gut hauszuhalten verstanden, war dem Vater zu Gute gekommen, der deshalb weniger arbeiten zu müssen geglaubt hatte. Je mehr sie sparte, desto mehr fiel nach der andern Seite aus. Trotz ihrer verzweifelnden Bitten, der Vater möge bei der Arbeit sitzen, damit es ihr möglich sei, für ihre Aussteuer etwas bei Seite zu legen, änderte sich nichts an ihrer Lage. Vergebens rechnete sie vor, daß sie, wäre sie nicht zu Hause geblieben, sich längst in einem Dienste die Aussteuer verdient hätte. Der Vater mußte seinen Zechgenossen doch die Schwierigkeit, sich durchzuschlagen, klagen, ihnen sagen, wie sauer es ihm werde, jetzt noch zu den Kosten der Haushaltung der Tochter eine Aussteuer zu verschaffen.«
»Mit dieser Sorge, die er sich in Wirklichkeit nicht machte, that er groß und wichtig. Er betheuerte: »Sie muß eine haben und zwar etwas Rechtes, ich thue es nicht anders.« Und die Genossen bedauerten ihn als einen von schweren Sorgen niedergedrückten Mann und tranken deshalb um so tapferer mit ihm, um sie zu ertränken.«
»Juliane mußte einsehen, daß ihre Hoffnung jeden Tag mehr zerrann und sie vollständig machtlos war, etwas dagegen zu thun. Große Bitterkeit überkam sie, Groll gegen den Vater, der das Lebensglück seines Kindes so leichtsinnig zerflattern ließ. In dieser Stimmung mußte sich in ihren Augen jedes Ungemach vergrößern, die Blindheit der Leidenschaft sie gegen Jedermann mißtrauisch machen. Und als sie mit ihrem Verlobten einen kleinen Wortwechsel hatte – er tadelte sie ihres Eigensinnes wegen, der ihm sein Glück vorenthielt – da stieg in ihrer krankhaften Seele der furchtbare Verdacht auf, er habe den Streit veranlaßt, um mit ihr zu brechen, er begehre sie nicht mehr, da sie auch gar nichts in die Ehe mitbringe.
Die Leidenschaft wittert ja hinter dem herzlichsten Wohlwollen eigennützige Absichten.
»Getäuscht!« rief es in ihr, wie wollte sie leben mit ihrer großen Liebe, ohne ihn? Und kein Ausweg aus diesem Chaos! Doch der Fluß! Der bringt Erlösung. Sie spürte sich von den kühlen Wellen umkost, die sich um ihre lodernde Seele lindernd legten. Und sie ging im verständigen Wahnsinne.
»Wollt Ihr sie verurtheilen, meine Herren?« –
»Sehen Sie,« sagte er nach tiefem Athemholen, »ich bin selbst in Aufregung gerathen. Aber es dreht sich um ein Menschenleben.« Tiefes Mitgefühl zeigte sich auf den Gesichtern der Uebrigen. Der Staatsanwalt sah nach dem Bilde, aber er konnte nichts deutliches unterscheiden, da ihm etwas die Augen trübte. Die zwei Regierungsräthe schauten ernst vor sich hin. In das Gesicht des Sekretärs aber war eine starke Röthe gestiegen, und ein heißes Gefühl bereitete ihm Unbehagen. Es war gut, daß er nicht Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit war.
Wieder sagte er, aber diesmal beinahe tonlos, mehr für sich hin: »Die Liebe ist eine große Macht.«
Es schien, als bestünde er eben einen Kampf mit derselben.
Der Präsident sah ihm forschend in's Gesicht und in seinen Augen leuchtete es verständnißvoll auf. Nicht ohne Absicht sprach er:
»Aber noch größer oft als die Liebe ist der Unverstand der Menschen. Sie gehorchen ihren kleinen Schwächen, wo es sich um ihr Lebensglück handelt. In unglaublicher Verblendung verlieren sie dasselbe aus den Augen, ganz von etwas Nebensächlichem erfüllt. – Für die meisten Menschen,« fuhr er nach einer Pause fort, »besteht doch das Lebensglück in der Vereinigung mit einem geliebten Wesen des andern Geschlechtes, in der Befriedigung des Bedürfnisses, Liebe zu geben und zu empfangen. Bedingung dieses Glückes ist aber eine strenge Selbstzucht, die Vernichtung des Egoismus und ein vom Zartgefühl bestimmtes, rücksichtsvolles Benehmen. Aber die Menschen sind nicht im Stande, sich einer geliebten Gewohnheit, wäre es auch einer schädlichen, zu entäußern. Deshalb zertrümmern sich die Meisten selbst das Glück, das einer guten Ehe entsprießen kann. – Und mir scheint, unendliche Seligkeit kann eine solche verschaffen.«
In seinen Augen lag heller Glanz.
»Jeder preist das, was er nicht kennt,« sprach lächelnd der an seiner linken Seite sitzende, verheirathete alte Rath. »Doch dies kann unmöglich bei Ihnen der Fall sein und Sie besitzen jedenfalls Gründe für Ihre Darlegungen. Immerhin ist es etwas seltsam, das Glück der Ehe aus dem Munde eines alten Junggesellen preisen zu hören.«
In den Zügen des Landammannes zuckte es und er schien eine starke Gemüthsbewegung niederzukämpfen und verbergen zu wollen.
Nach einem kurzen Stillschweigen sprach er mit etwas gepreßter Stimme, die ruhig klingen sollte: »Die Herren wissen wohl nicht, daß ich einmal verlobt war.«
Alle erstaunten. Der Jurist kehrte sich schnell von der Betrachtung des Bildes ab und kehrte dem Redenden sein von Erwartung gespanntes Gesicht zu. Der Sekretär schien zu zweifeln, ob er recht verstanden habe und der leichte Schatten auf seinem Gesichte wich dem Ausdrucke der Verwunderung.
Also gab es für sie in dem Leben des Verehrten Dinge, die ihnen unbekannt waren. Und doch lag seine Vergangenheit klar vor der Öffentlichkeit da, weil sein Leben seit langer Zeit nur dieser angehört hatte. Auch die zwei andern Herren hatten verwundert aufgehorcht.
Noch stärker war der Eindruck, den die folgenden Worte des Präsidenten auf die Ueberraschten machten.
»Auch verdorben war ich schon einmal,« fuhr er fort. »Glauben Sie mir,« fügte er hinzu, als er die ungläubigen Mienen sah, »ich war im eigentlichen Sinne des Wortes moralisch verdorben. – Doch das ist schon lange her,« bemerkte er mit einem feinen Lächeln.
Die Neugierde der Herren war aufs Höchste gestiegen; doch sie behielten die Fragen auf den Lippen. Mit Bewunderung und Zärtlichkeit sah der Sekretär seinen Chef an, der solches zu bekennen wagte.
»Da ich die Neugierde der Herren geweckt, muß ich sie wohl auch befriedigen,« fuhr jener fort. »Wenn Sie mir eine ziemlich starke Zumuthung an Ihre Geduld und Ihr Interesse gestatten, so will ich Ihnen die Geschichte meiner Verlobung und Verdorbenheit, die beide zusammenhängen, mittheilen.«
Die Herren rückten mit Lebhaftigkeit auf ihren Stühlen zurecht und ihre Blicke hingen am Munde des greisen Erzählers, welcher begann:
»Wenn ich Ihnen die Geschichte meiner Jugend und die Verirrung der letztern ohne Scheu und ohne Beschönigung überliefere, so geschieht es, weil ich dieselbe selbst aus weiter Ferne und vom objektiven Standpunkte des Menschenforschers aus betrachte und weil ich weiß, daß Sie die Unvollkommenheit des Menschen kennen und mich deshalb verstehen werden, so daß ich keiner Entschuldigung bedarf.«
»Wie Sie wissen, stamme ich aus ganz ärmlichen Verhältnissen und zudem aus einem Geschlechte, dessen männliche Glieder zumeist Alkoholiker waren und deshalb großes Unheil über ihre Familien brachten, nicht in Anschlag gebracht der Umstand, daß ihre Leidenschaft in das Blut ihres Nachwuchses übergieng und für denselben stets wieder eine Quelle großen Elendes wurde. So floß auch in meinen Adern unnatürlich entzündetes Blut, das einmal zu Ausschreitungen drängen mußte, wenn nicht ein starker Wille demselben beigesetzt wurde.
Dem stand aber wieder Mehreres entgegen. Wie alle schwachen, den Leidenschaften unterliegenden Naturen ursprünglich weichen Gemüthes sind, so war auch mein Erbtheil ein zartes, fast krankhaftes Gefühl. Durch die furchtbaren häuslichen Scenen, deren ich von frühester Kindheit an bis zum Jünglingsalter Zeuge war, wurde dasselbe, weil es täglich in so hohem Maße gerüttelt wurde, noch erheblich gesteigert und ich wurde beinahe hysterisch, wie ein Fräulein von schwachen Nerven. Deshalb wurde ich von der grausamen Wirklichkeit abgestoßen und zog mich ganz in mich selbst zurück. Da ich die Schmach, mit welcher meine Familie durch die unglückseligen Verhältnisse bedeckt wurde, lebhaft fühlte, so entstand in mir zudem ein scheues, furchtsames Wesen gegenüber den Menschen. Ich erröthete fortwährend für die Familie, weil ich in meiner Unerfahrenheit glaubte, daß bei den Andern eitel Herrlichkeit und Rechtschaffenheit herrsche. Deshalb war der Grundzug meiner Jugend eine große Demuth, die vor den Menschen zusammenknickte, ferner ein träumerisches Wesen, das mich die Einsamkeit den Spielen der Genossen vorziehen ließ. Ueberhaupt war meine Kindheit eine sehr unglückliche, da ich, im Gegensatz zu der sonstigen Art der Jugend, erlebte Unbill nicht vergaß und fortwährend darunter litt und daraus entstehende Abneigungen oder Sympathieen oft Jahre lang beibehielt. Deshalb besaß ich auch einen frühreifen Ernst. Aeltere Leute haben mir später versichert, daß sie mich niemals hätten lachen sehen und daß ich ihnen mit dem furchtbaren Ernst in den träumerisch blickenden Augen beinahe unheimlich vorgekommen sei.
Da wir kein Gewerbe zu besorgen hatten, war meinem Hang zur Träumerei trefflich Vorschub geleistet, wie auch der ersten Leidenschaft, die mich gefangen nahm, sobald ich in der Volksschule die Fibel überwunden hatte, nämlich der Lesewuth. Diese hatte für mich manches Gute zur Folge, aber auch großen Schaden, nicht viel geringer als derjenige, den die Leidenschaft des Lesens weiland in Don Quixote anrichtete. Denn ich las, was mir unter die Hände kam, jedes Buch, jeden Papierschnitzel. Ich rannte letztern nach, wenn sie der Wind dahin jagte, und ich war glücklich, wenn ich sie erhaschte, wie andere Kinder über einen gefangenen bunten Schmetterling. Ich trug ganze Haufen alter Bücher zusammen, die ich mir von Nachbarn leihen ließ. Oft hatte ich den Schmerz, zu entdecken, daß Blätter in den Scharteken fehlten. Leute, die meine Leidenschaft bemerkten, beuteten sie in eigennütziger Weise aus. Sie verwendeten mich zu allerlei Dienstleistungen und Botengängen, indem sie sicher waren, daß ich dieselben blitzschnell verrichtete und bei Gängen wie der Sturm flog, um den verheißenen Lohn, Bücher zum Lesen, möglichst bald zu erhalten und zu verschlingen. Vergebens suchten die Eltern dieser Leidenschaft Einhalt zu thun, ich versteckte mich zuletzt mit meinen Büchern auf dem Estrich oder verborgenen Winkeln des Hauses oder rannte auf einsamen Wegen zu ausgesuchten Plätzchen im Walde. Eine ungeheure Menge Bücher verschlang ich während meiner Jugendzeit auf diese Weise. Und was für Bücher!
Sie, die in geordneten Verhältnissen eine wohl geleitete Erziehung genossen haben und vor allem Unschönen behütet worden sind, können sich kaum einen Begriff machen von dieser geistigen Nahrung, die mir geboten wurde. Ich habe mich seither oft gefragt, warum das Schicksal mir so übel mitspielte, daß es mir unter einer Unmenge Schriften so wenige gute in die Hand lieferte. Denn die meisten waren Produkte ganz mittelmäßiger Schriftsteller mit ungezügelter, unreiner Phantasie. Da waren ganz gewöhnliche Diebs- und Räubergeschichten und, etwas seltener, sentimentale Indianerromane. Ferner brütete ich über ungeheuerlichen Werken wie »die Geheimnisse von Newyork,« die »Geheimnisse von Paris,« sowie eine Menge anderer »Geheimnisse,« welche alle das Leben der niedersten Bevölkerung der großen Städte schilderten und mit Vorliebe die Ausschreitungen der viehischen Natur darstellten. Damit das andere Extrem nicht fehlte, kamen hinzu oft mehrbändige Werke über das Leben fürstlicher Höfe und deren Sittenverderbniß, in denen über gewisse Dinge mit affenähnlicher Ungenirtheit geredet wurde.
Noch gefährlicheres Gift sog ich auf solche Weise in meine unbeschriebene Seele. Es waren die Durchschnittsnovellen deutscher Autoren, welche die geringe Kunst der Darstellung verdeckten durch den pikanten Stoff. Inhalt derselben waren wieder nur Liebesverhältnisse, welche auf der äußersten Grenze der Sittlichkeit sich bewegten. Nur war hier das Laster mehr verhüllt, mit einem glänzenden Firniß aus Rührseligkeit, moralischer Entrüstung und heuchlerischer Prüderie überzogen. Denn dies war das gefährlichste an diesen Schriften, daß sie solche Dinge halb verbargen und deshalb um so eher gefährliche Neugierde weckten; daß sie sich über das Laster entrüstet ausließen, dasselbe aber doch in verführerischem Glanze darstellten. Diese Lektüre entwickelte meine Phantasie in großem Maße, füllte sie mit unreinen Bildern und verwandelte mein Gefühl in krankhafte Empfindsamkeit. Ja, sie vergifteten, ohne daß ich die Schuld trug, meine kindliche Seele und raubten mir die Freuden der Jugend. Solche Schriften verderben noch jetzt die Seele unseres Volkes, dem in diesen Dingen kein gebildeter Geschmack schützend zur Seite steht. Glauben sie mir, bei gar vielen Bewohnern unserer Zuchthäuser fängt die Ursache ihres Schuldigwerdens an, da ihnen ein schlechtes Buch in die Hand gegeben wurde.
Da zugleich mein Gedächtniß stark ausgebildet wurde, behielt ich alle jene Geschichten im Kopfe und grübelte darüber nach und änderte sie wohl auch um, wodurch meine Phantasie übermächtig wurde. Wenn ich auch anfangs über die heiklen Dinge hinwegglitt, so ging mir doch alsgemach das Verständniß dafür auf und sie bemächtigten sich meiner. Vollends bei den Schriften der letztgenannten Art durchrann mich oft ein süßes Gefühl, so daß ich dieselben dieses sinnlichen Rausches wegen liebte und begehrte. Ich fing an, in solchen Vorstellungen zu schwelgen und mich in Situationen, wie sie in den Büchern vorkamen, hineinzudenken. Nach und nach verlor sich deren Fremdartigkeit. Ich glaubte, dies sei der gewöhnliche Lauf der Dinge und im Leben gehe es gar nicht anders, als wie ich gelesen und so müsse es auch sein und sei durch die Natur geheiligt; denn so trösteten sich in den Liebesgeschichten die schönen Sünderinnen. So war mein Vorstellungsleben derart, daß es moralischem Wahnsinne gleichkam. Ich war verdorben und doch nicht. Denn ich war gleichwohl weit davon entfernt, diese Dinge im Leben zu suchen und sah aus meiner seltsamen Welt durch die blöden Augen das Leben in verklärtem Glanze; in meiner großen Demuth, welche meine Person ganz verschwinden ließ, hatte ich einen großen Respekt vor allen andern Menschen und die Mädchen und Frauen erschienen mir vollends als Engel.
Am schlimmsten erging es in dieser Zeit meinem armen, weichen Herzen, welches alle die Qualen miterlebte, welche die unglücklichen Personen in den Erzählungen ausstehen mußten. Ich weinte mit ihnen; fast wollte das Herz mir brechen und im Hals spürte ich einen stechenden Schmerz. Dann lief ich etliche Tage mit großer Verzweiflung herum und zerdrückte manche heimliche Thräne und die Leute schrieben mein ernstes Gesicht, worauf der Schmerz deutlich zu lesen war, unsern unglücklichen häuslichen Verhältnissen zu und widmeten mir ein unnöthiges Mitleid, das mir bisweilen Aepfel und andere eßbare Dinge eintrug.
Darob wurde mein gemartertes Herz aufs Aeußerste empfindsam und fühlte auch die geringste Rohheit; immerhin wurde mit der Rührseligkeit ein großes Zartgefühl ausgebildet, welches mir nachher zu Statten kam, indem es mich befähigte, sofort die Atmosphäre jedes neuen Kreises, in welchen ich trat, zu ahnen und mich darnach einzurichten. All dies erschwerte aber die Ausbildung des Willens und die Charakterbildung, weil durch meine durch die Lektüre groß angelegte Menschenkenntniß ich nicht so leicht zu Grundsätzen gelangte, sondern gewohnt war, die Dinge von allen Seiten zu betrachten, auf jeder derselben etwas Gutes herauszufinden. Ich traure nicht deswegen; denn ich habe nachher oft die Beobachtung gemacht, daß beschränkte Menschen, welche an allen Dingen nur eine Seite sehen, frühe und leicht einen »Charakter« erhalten, das heißt bald mit einem Urtheile fertig sind, das nicht mehr zu korrigiren ist, und worauf sie sich etwas zu Gute thun und dabei gegen Andere höchst herzlos sind. Derart ist der Charakter, den die Welt bewundert, der aber nichts anders ist als Einseitigkeit oder Eigensinn.
Ich habe Ihnen alles dies so weitschweifig erzählt, damit Sie das Folgende zu verstehen im Stande sind, denn dieses ist nur die Konsequenz meines verschrobenen Wesens in der Jugendzeit, das andauerte bis weit über die zwanziger Jahre und so meine Mannbarkeit verzögerte.
Begreiflich war ich auch ein seltsamer Schüler. In allen Fächern, welche meiner Phantasie Nahrung boten, leistete ich das Beste und galt als der erste Schüler, in den übrigen nichts oder nur Ungenügendes, so daß ein Theil der Lehrer mich als den vorzüglichsten, der andere als den schlechtesten Schüler erklärte und sie anläßlich der Promotionen stets in Streit geriethen. Meine ganze geistige Beschaffenheit zeigte überhaupt bis viel später große Lücken neben einem gründlichen Wissen. Während ich in gewissen Gebieten den Stoff beherrschte und selbstständig verarbeitete, wohl auch Neues hinzutrug, denn die Gedanken kamen mir blitzartig und oft mich selbst überraschend, war ich in andern unwissender als ein Kind und blieb es; besonders ging mir über die gewöhnlichsten Dinge des Lebens, deren Kenntniß allgemein ist, erst im Mannesalter eine Ahnung auf. Es konnte auch nicht anders sein, da meine Augen statt nach der äußern stets nach der innern Welt gerichtet waren.
Da es Mühe genug gekostet hatte, bis ich die Bezirksschule hatte besuchen können, mußte ich zu meinem Schmerze dieselbe zu früh verlassen. Ein Advokat nahm mich in sein Bureau auf. Für ein Bischen Lohn, der meinen Eltern in die Augen gestochen, schrieb ich ihm die Prozeßakten in's Reine. Zugleich sollte ich das Notariatsgeschäft lernen, was ich in mechanischer Weise that. Wichtiger waren mir aber Schätze, die ich im Hause entdeckt, eine große Bibliothek mit Geschichtswerken und vor Allem Rechtsschriften. Begierig machte ich mich hinter die erstern. Mein gutes Gedächtniß setzte mich in Stand, bald eine Uebersicht über die Menschheitsgeschichte zu erlangen; diese und meine theoretische Menschenkenntniß aus den Romanen ließen mich bald Gesetze in dem scheinbar zufälligen Gang der Ereignisse erkennen. Die ganze Menschheit erschien mir als ein Individuum, dessen Lebensdauer Jahrtausende beträgt und dessen Entwicklung eine gesetzmäßige ist. Die schweren Zeiten der Verdorbenheit und der Reaktion erschienen mir als Krankheiten, wie sie der Einzelne durchzumachen hat.
Auch die Einrichtungen des Staates lernte ich aus den Gesetzbüchern kennen und verstehen. Die Prozeßakten schon hielten mein Interesse gefangen, da während des Abschreibens die Bilder der darin genannten Personen vor mir aufstiegen und ich ihren Charakter zu errathen suchte. Die stete Berufung auf Gesetze und Verordnungen hatten mich zu der Frage geführt, wer wohl ein Recht zu solchem Kommando habe. Und ich lernte den Staat verstehen als nothwendige, nützliche Einrichtung, als Kunstwerk dazu da, um durch Ordnung die ganze Gesellschaft in gesundem Zustande zu erhalten, wie der Einzelne auch zum Besten seiner Wohlfahrt sich gewissen Gesetzen freiwillig unterziehen muß. Ich betrachtete die bestehenden Gesetze und Ordnungen und fing bald an, Kritik zu üben. Schon längst war mir die vielorts große Armuth, unter der auch ich gelitten, schwer auf dem Herzen gelegen und ich hatte auf Abhülfe gesonnen. Die damalige Art der Armenunterstützung, welche zumeist auf freiwilliger Wohlthätigkeit ruhte, erschien mir als ungenügend und zudem unzuverlässig und ich hielt dafür, der Staat sollte hier Ordnung schaffen, indem er einestheils die Gründung von Armenvereinen anrege und unterstütze, anderseits durch Gesetze die Armenunterstützung regulire und zu diesem Behufe auch eine Armensteuer fordere. Bis dahin war diese im Belieben der Gemeinden gelegen.
Ich trug mich damit, diese Gedanken in einer Schrift zu veröffentlichen. Und dies war nicht sehr seltsam, war doch während meiner Lesewuth oft in mir der Wunsch und der Ehrgeiz erwacht, selbst Bücher zu schreiben. Zudem hatte ich die leise Hoffnung, durch meinen Schritt berühmt zu werden und vollends zu hinterst in der Seele regte sich ein Vorstellungsgewürm, geweckt durch den geheimen Wunsch, nach Herzenslust studiren zu können und eine rechte Schulbildung nachträglich zu erhalten: Es war das Abwägen der Möglichkeit, daß mir vielleicht selbst diese für Andere geforderte Hülfe zu Theil werden möchte und ich durch Unterstützung reicher Leute zum Studium gelangen könnte. Ich quälte mich schon über dem Einleitungssatze, als mein Luftschloß zusammengeworfen wurde durch die Liebe. Daß diese eine große Macht ist, habe auch ich erfahren, Herr Sekretär.
Es war nicht das erste Mal, daß mein Herz von diesem Gefühle bewegt wurde. Bei meiner leicht erregbaren Einbildungskraft und meinen überschwächlichen Vorstellungen von dem weiblichen Geschlechte wäre das Gegentheil sonderbar gewesen. Gar oft hatte ich für Mädchen oder Frauen geschwärmt, aber nur sofern sie den mich beschäftigenden Romanfiguren glichen. Meine Verehrung aber beschränkte sich auf ein scheues, ehrerbietiges Anbeten aus der Ferne. Deren Gegenstand wirklich zu begehren, hatte ich die Kühnheit nicht. Und wenn es etwa vorkam, daß meine Verehrung bemerkt wurde und man mir entgegenkam, wich ich erschreckt zurück, wie mich alle Wirklichkeit sofort zurückscheuchte. Die Phantasie wurde durch alles Körperliche gestört. Hatte einmal ein Mädchen durch seine schöne Gestalt dieselbe gefangen genommen, so flammte mein schüchternes Empfinden zur übermächtigen Leidenschaft auf und ich war jeder Tollheit fähig. Dann setzte mein überquellendes Gefühl bei der Angebeteten solches in gleichem Maße voraus und betrachtete alle deren Handlungen in diesem Lichte, sah geheime Zeichen des Einverständnisses in den unbedeutendsten, natürlichsten Bewegungen, so daß in Folge dieser Einbildungen sich die Leidenschaft noch vergrößerte.
Doch dauerten diese Täuschungen nicht lange an. Entweder bemerkte ich plötzlich, daß meine Neigung nicht erwiedert wurde und ich mich gröblich verrannt hatte, oder ich sah ein, daß ich wie Don Quixote eine Magd zu meiner Dulcinea von Toboso gemacht hatte. Die Sache verleidete mir, ich schämte mich tüchtig und ließ das Ganze aus dem Gedächtnisse fallen.
»Ganz mein Fall!« bemerkte der Anwalt.
Aber die Mienen der Herren drückten deutlich Zweifel an der Richtigkeit dieses Einwurfes aus.
Der Erzähler fuhr fort.
Doch endlich war es die ächte, überwältigende Liebe, welche an mich herantrat.
Bei einer bekannten Familie traf ich ein Mädchen, Namens Hermina an, das auf Besuch weilte. Es glich keiner meiner idealen Romangestalten und war auch nicht von ausgezeichneter Schönheit. Gleichwohl war der erste Eindruck, den es auf mich machte, ein bleibender.
Sie war ein Geschöpf von übersprudelnder Heiterkeit und Lebenslust. Wie eine Hummel stürmte sie übermüthig umher, alles zur Freude anregend. Unbekümmert um Sitte und ängstliche Konvenienz setzte sie sich ihren Bekannten, Männern sowohl als Frauen, ohne Weiteres auf den Schoß und zwang sie zu bisweilen ausgelassener Fröhlichkeit. Sie durfte dies gefahrlos thun, da sie von kindlicher Unschuld und großer Anmuth war. Selbst mich, der zuerst durch dieses Gebahren in Verlegenheit gerieth, riß sie aus meiner Sprödigkeit heraus und verführte mich zu einigen unbeholfenen Sprüngen, derer ich mich aber sofort schämte. Sie bemerkte dies und ließ mich in Ruhe. Dann wurde sie stiller.
Dies war überhaupt ein charakteristischer Zug ihres Naturells, daß sie plötzlich von ausgelassener Fröhlichkeit zum größten Ernst überspringen, ja beinahe melancholisch werden konnte. Denn sie hatte einen scharfen Verstand, gesunde Ansichten über die Dinge. Deshalb sah sie jeweilen ihr Benehmen im Spiegel ihres Verstandes und schämte sich und wurde nur um so ernster.
In diesem Falle hielt sie sich an mich und wir führten ernste, oft wissenschaftliche Gespräche, da sie selbst viel gelesen hatte und somit schnell ein Berührungspunkt gefunden war. Auch war ihr Kopf erfüllt von wenigen romanhaften Vorstellungen, welche wie die meinigen ihren Ursprung in der Lektüre derartiger Werke hatte.
Während der Gespräche blickte ich ihr unverwandt in die braunen Augen, die bald übermüthig blitzten, bald ernst und treu mir entgegenschauten. Von jedem ihrer Worte schloß ich auf die geistige Art Herminas, welche mir bald als der meinigen verwandt erschien. Vorerst dunkel, dann immer klarer tauchte in mir der Gedanke auf, daß dieses Wesen einzig im Stande wäre, mich glücklich zu machen, daß aus einer Verbindung mit ihr mir großer geistiger Genuß entsprieße. In meinem Geiste tauchte das Bild einer unendlich glücklichen Ehe auf. Welche Wonne, stellte ich mir vor, müßte mir werden, wenn Leib und Seele beider Menschen eins würden, ganz in einander aufgingen, wenn ich schon ein seliges Gefühl empfand durch das bloße Beisammensein, welches durch die Sitte zudem beschränkt war!
Sie wissen wahrscheinlich jetzt, daß leider das Gegentheil wahr ist, daß der Zauber der Liebe so lange andauert, als sich vor ihr Schranken aufthürmen. Vergessen Sie aber nicht mein damaliges träumerisches Wesen, meine überaus große Gefühlsseligkeit, die ein Meer von Liebe stets bereit hatte und Sie werden meine thörichte Schwärmerei begreifen.
Es mag auch sonderbar erscheinen, daß der junge Mensch sofort an die Ehe dachte, da doch dieser Gedanke der ersten Liebe durchaus fern ist, da sie nichts denkt und nichts will, eben nur liebt.
Den Schlüssel zu dieser Absonderlichkeit haben Sie nur wieder in meinem durch die Lektüre verschroben gewordenem Wesen zu suchen. Ferner ward der Gedanke mir nahe gelegt durch die unseligen häuslichen Verhältnisse.
Da ich sah, wie viel Unglück dem Zerwürfnisse entsproß, schloß ich, daß das Gegentheil, eine gute Ehe, große Seligkeit verschaffen müsse. Ich erinnere mich noch gut daran, daß mich oft ein Stich der Eifersucht durchzuckte, wenn ich ein liebendes Päärchen Arm in Arm dahinwandeln sah.
Bald war ich ganz von der Gestalt Herminas erfüllt. Erst jetzt bemerkte ich die Anmuth derselben, da ich bis dahin für alle Form blind gewesen war.
Sie hatte beinahe italienischen Typus. Von der Fülle schwarzen Haares stach die gelblichweiße Gesichtsfarbe ab. Die ovale Stirne war breiter als hoch. Die schwarzen Augenbrauen bildeten kräftig geschwungene Linien. Der untere Theil des Gesichtes war etwas stark entwickelt und ließ ohne Weiteres auf große Energie schließen. Der feine Mund zeigte von den Lippen nur eine rothe Linie. Aber den mächtigsten Zauber übte das braune, treue, lebhafte, bald ernst und klug, bald träumerisch und dann wieder muthwillig blickende Auge des Mädchens aus.
Und der Präsident legte einen Augenblick lang seine Rechte beschattend über die Augen.
Die Zuhörer schauerten für ihn. Sie wußten, vor ihm stand die verlorene Geliebte so schön wie ehemals und Erinnerungsweh zog sein Herz zusammen.
»Ihre von einem schwarzen Gewand umschlossene Gestalt war klein, zeigte etwelche Fülle, ohne daß der Ebenmäßigkeit Eintrag gethan war. Die weichen Formen ergingen sich in raschen, doch anmuthigen Bewegungen. – Es ist mir unmöglich, Ihnen ein anschauliches Bild des Mädchens zu zeichnen. Was sie schön machte, waren nicht die Formen des Körpers, sondern der Geist, der aus jenen glänzte und sie lenkte. Der Zauber, der von ihr ausströmte, war wesentlich die Wirkung ihres geistvollen Temperamentes.
In manchen Zügen war sie die Mignon, die sich in Wilhelm Meisters Bett legt.
Es war Winter und wir waren auf die Stube beschränkt. Wir küßten uns mit den Augen, wobei die Lippen erzitterten. Als wir nebeneinander zu sitzen kamen, fanden sich die Hände zu sanftem Drucke. Die Berührung ihres leise rauschenden seidenen Gewandes erzeugte in mir ein süßes Gefühl. Ihr Athem streifte mich und versetzte mich in selige Betäubung. Meine ganze Seele neigte sich ihr zu. Mein Denken und Wollen ging verloren. Ueberall in meinem Innern fand ich nur sie. Ich betrachtete zärtlich ihre Augen, ihren Mund, ihre Haare, jedes Glied ihres Körpers mit heiliger Ehrfurcht. Und stets wieder wurde mein Auge nach ihrem Ohrläppchen gezogen, das ein feines, fast durchsichtiges Ding und die einzige röthliche Stelle war.
Mich hatte vorher immer gelächert und es war mir unbegreiflich und eines Mannes unwürdig erschienen, für ein einzelnes Glied eines Frauenkörpers zu schwärmen, wie ich es bei den Dichtern gefunden hatte.
Nun versetzte mich ein Ohrläppchen in Entzücken! Nun war mein Glaube an der Wahrhaftigkeit der Dichter, welcher ein wenig erschüttert gewesen, wieder hergestellt. Auch später habe ich ihnen glauben gelernt.
Auch Hermina mußte fühlen wie ich. Sie erschien verändert. Nur selten, wie um ihre Befangenheit zu verbergen, fand ein Ausbruch ihres wilden Wesens statt, ähnlich den stoßweise erfolgenden Eruptionen eines erlöschenden Vulkans.
Es waren die letzten Zuckungen ihres Mädchenthums, das von der Liebe getödtet wurde.
Als ahnten sie unsere geheimen Wünsche, ließen uns die Freunde allein. Besonders die Frau des Hauses wußte die Entfernung der Uebrigen zu bewerkstelligen. Ein Blick und wir sanken wortlos zu einander hin. Immer und immer wieder fanden sich unsere glühenden Lippen. Wir konnten nicht genug bekommen. Ich trank ihren Athem und lehnte in seliger Trunkenheit mich an ihre Brust. Wir waren beide besinnungslos. Mächtig strömten unsere Gefühle, in welche die Sinnlichkeit geflossen, zu einander hin. Das aufgespeicherte Liebesgefühl und die durch die Lektüre geweckte Sinnlichkeit brachen sich fessellos Bahn.
In Folge unserer Befangenheit waren wir für die Gesellschaft ungenießbar geworden. Für Jedes war nur noch das Andere vorhanden. Wir wanderten hinaus in die Winterlandschaft.
Eine eisige Bise umwehte uns, wir fühlten sie kaum. Stumm schritten wir daher lange bis vor die Stadt. Wir gerieten in einen Waldweg. Der Schnee knarrte unter den Füßen. Die kalte Wintersonne ließ die wunderbaren Formen des Reifes an den Bäumen in großer Pracht erglänzen. Ich bemerkte sie trotz des Gefühlssturmes, denn über allem standen doch wieder die Gedanken. Nicht die meinigen, sondern Phantasieen, Erinnerungen an Gelesenes, immerhin nur undeutlich.
Endlich brach ich das Schweigen.
»Hermina, willst Du mich glücklich machen? Willst Du mir versprechen, einst, wenn ich mir eine Stellung gewonnen, meine liebe Frau zu werden?«
Ich nannte sie zum ersten Male bei ihrem Vornamen und meine Frage war die Folge des Bildes von einer glücklichen Ehe, das ich während des Gehens ausgeführt hatte.
Sie zitterte und schwieg, schaute mich aber an mit einem Blicke, in welchem Liebe, Angst und Flehen um Schonung lag. Unbeirrt, wie im Fieber, fuhr ich fort und redete auf sie ein, während sie an meiner Seite in großer Bewegung dahinschritt. Ich redete ihr von meiner freudelosen Jugend, schilderte ihr meine Armuth und die unbefriedigte Sehnsucht nach dem Studium. Ich sprach von meinen Plänen, wie ich mich dem Wohle des Volkes widmen wolle, aber noch eifrig arbeiten müsse und daß ihre Liebe, ihr Wort mich stärken würden in dem schweren Kampfe. Ferner redete ich von der Kürze des Menschenlebens, dem traumartigen Dasein, das uns so schnell dem Ende zuführt, weshalb wir so viel Glück als möglich auf dem schnellen Wege erhaschen sollten und Anderes mehr. Ich bin nicht mehr so beredt gewesen wie damals.
Endlich stand sie still. Die Bewegung in ihrem Gesichte ging in ein krampfhaftes Weinen über. Aufschluchzend schlang sie die Arme um meinen Hals und sagte:
»So nimm mich hin für alle Ewigkeit.« Lange standen wir enge verschlungen, so daß Eines des Anderen Herz schlagen hörte. Als wir uns loslösten, schaute Jedes in des Andern sonniges, glückliches Gesicht. Sie lächelte durch die Thränen hindurch.
Nun gingen wir in eine ausgelassene Heiterkeit über, lachten und schwatzten wie Kinder und sprangen umher. Wir gaben uns allerlei läppische Kosenamen. Ich nannte sie meine Frau und sie mich ihren Herr Gemahl und wir redeten von unserm künftigen Eheleben, das die Götter neidisch machen müßte. Wir meinten, es müsse immer lustig zugehen und in unsern ehelichen Statuten müsse im ersten Paragraphen das Zanken strenge verboten sein und mit Buße belegt.
Ich war in einem unbeschreiblichen Zustande. Die mächtige Leidenschaft drohte mir die Besinnung zu rauben. Ich empfand ein Gefühl großer Seligkeit. Meine glühenden Sinne sahen in der kalten Winterpracht eitel Frühlingsherrlichkeit. In meiner Seele jubelten Stimmen und war ein solch freudiges Wesen, wie ich es noch nie an mir gekannt. Aber daneben drückte mich doch eine geheime Angst vor der Zukunft, die ich vergebens mit dem Troste verbannen wollte, Hermina warte mir und ich werde zu Hab und Gut gelangen. Wirklich hatten wir die vorläufige Dauer der Wartezeit auf sechs Jahre festgesetzt.
Ich hatte ein Wesen an mich gekettet, dem ich Brod verschaffen sollte, während ich kaum das meinige verdiente. Dann schlug mich dunkel das Gewissen, daß ich in meinen Gedanken nicht rein und deshalb noch ihrer unwürdig sei.
Vergebens versuchte ich mit der Seele eine Reinigung vorzunehmen.
Als wir Arm in Arm bei unsern Freunden eintraten, beglückwünschten sie uns sofort, mich dadurch in großes Erstaunen versetzend.
In meiner Blindheit hatte ich dieselbe auch bei ihnen vorausgesetzt. Leise fügte Herminas Freundin ihrem Glückwunsche bei:
»Jetzt hast Du, was Du gewollt.«
Die Worte blieben mir im Gedächtniß, da sie mich befremdeten, wenn ich sie auch nicht verstand.
Später wurde mir ihre Bedeutung klar.
Hermina hatte keine Eltern mehr und verfügte selbstständig über ein bedeutendes Vermögen, wovon ich jedoch keine Ahnung hatte. Sie hatte schon eine Aussteuer angeschafft und es fehlte ihr hiezu nichts als ein Mann. Sie war nun ausgezogen, den passenden zu suchen. Schon vorher hatte sie unbefangen erklärt, sie wolle bald einen Mann und sie sehe bei ihrer Wahl weder auf Vermögen noch Schönheit, sondern lediglich auf einen tüchtigen Charakter. Denn neben ihres geringen Anfluges von romantischer Schwärmerei, den ihre Phantasie verschuldet, hatte sie einen berechnenden, praktischen Verstand, der energisch ein in's Auge gefaßtes Ziel verfolgt. Sie war sich ihrer Bestimmung bewußt und bestrebte sie in ebenso klarem Bewußtsein zu erfüllen, während ich noch unfertig war und meinen oft unklaren Gefühlen gehorchte.
Da ich träumerisch und still war, glaubte sie in mir den soliden und charaktervollen Mann gefunden zu haben, der ihr Garantie zu einem friedlichen und glücklichen Leben bot. Meine Pläne und mein Streben schienen eine ehrenvolle Laufbahn im öffentlichen Leben wahrscheinlich zu machen, wenn ich jetzt auch noch ein Wechsel auf lange Sicht war.
Dieser letzte Punkt mußte ihr wichtig erscheinen, da sie sehr viel auf äußeres Ansehen hielt. Damals war ich jedoch weit entfernt, solche Dinge zu denken, da ich viel zu unerfahren und vertrauensvoll war und kaltblütige Berechnung in diesen Angelegenheiten nur aus den Romanen kannte.
Hermina hatte sich jedoch keineswegs infolge dieser kühlen Berechnungen mit mir verlobt, sondern aus wahrer, leidenschaftlicher Liebe. Allerdings hatten diese Bedingungen, welche sie in mir erfüllt geglaubt, das Erwachen ihrer Neigung befördert, aber sie waren auch zugleich mit dieser vergessen worden und ihr Frauenherz trug über ihrem Verstand den Sieg davon.
In verständiger Weise hatten wir, um die Neigung nicht übermächtig und unserm heroischen Entschlusse, sechs Jahre zu warten, nicht gefährlich werden zu lassen, festgesetzt, daß wir uns nur selten sehen, hingegen um so häufiger Briefe wechseln wollten.
Hermina reiste sofort nach Hause, weil der Wunsch, die Verlobung ihren Verwandten mitzutheilen, ihr keine Ruhe ließ.
Ich versuchte, meine Arbeit wieder aufzunehmen, aber ich fand die nöthige Ruhe nicht. Immer erfüllte mich Herminas Bild. Die Liebe ließ jede Faser meines Körpers erzittern. Ich nahm wieder die Liebesgeschichten zur Hand, die ich seit langer Zeit bei Seite gelassen. Auch machte ich mich hinter einige Bändchen Gedichte, welche mich früher fremd gelassen, da ich deren bilderreiche Sprache nicht verstanden und welche mich, weil mir deren Inhalt affektirt vorgekommen, beinahe angewidert hatten. Nun war mir das Verständniß dafür aufgegangen und ich las sie mit Begierde.
Ich fand meine Leidenschaft durch eine schöne Sprache ausgedrückt, sah sie in einem schönern Spiegel und lebte mich von Neuem in die Sinnlichkeit ein, welche mir, weil ich sie so schön dargestellt sah, berechtigt erschien.
Gleichwohl hörte ich in meinem Innern eine warnende Stimme.
Zu meinem Unglücke wurde ich von meinem Advokaten in eine Gesellschaft eingeführt. Es waren Männer, welche in der Politik eine ziemliche Rolle spielten und deren Namen man oft hörte. Ich fühlte mich geehrt und gehoben, als würde ich mit an das Steuer des Staatsschiffes gestellt.
Sie redeten wohl von den politischen Ereignissen des Landes und manches Wort fiel, welches mir plötzlich meinen Gesichtskreis erweiterte. In der Hauptsache aber vergnügten sie sich damit, einander rohe, oft unfläthige Witze zu erzählen und ihre Gespräche bewegten sich meist auf dem Gebiete des Geschlechtlichen, wobei eine große Verachtung der Frauen zu Tage trat. Es schien, daß sie dieselben nur soweit achteten, als sie ihnen zu Willen waren. Und doch thaten diese Männer gar lieblich und ehrerbietig, wenn Frauen zugegen waren, hüteten sich vor jedem kräftigen Worte und benahmen sich sehr galant, so daß ich aus diesem Widerspruche ihres Benehmens nicht klug wurde.
Ich hatte seither oft Anlaß, mich darüber zu verwundern, daß so viele Männer unseres Landes, welche auf Bildung Anspruch machen, unter einander sich derart unterhalten, daß ihren Gesprächen Frauen nicht das Ohr leihen könnten, ohne zu erröthen. Mir erschien ein derartiges zwietheiliges Benehmen stets als Heuchelei.
Mir mußte das Anhören solcher Gespräche zum Nachtheile gereichen. Da ich die Aussprüche dieser welterfahrenen und verehrten Männer als Wahrheiten auffaßte, wurde meine sittliche Verirrung befestigt, meine Phantasie durch die cynischen Reden noch mehr entzündet. Diese äußerte sich in meinen Briefen an Hermina, welche in einer glühenden Sprache abgefaßt waren.
Wie ich später erfuhr, glaubte sie, in ähnlicher Weise antworten zu müssen, so daß wir uns in der Leidenschaftlichkeit des Ausdruckes überboten und unsere Gefühle unnatürlich steigerten.
Als dann der Frühling nach einem kalten, langen Winter mit einem Male in wunderbarer Herrlichkeit das Land überraschte und jeder Baum als Blüthenstrauß prangte, da vermochten wir unsere Sehnsucht nicht mehr zu dämmen und Hermina schrieb mir, ich sollte mich endlich ihren Verwandten vorstellen.
Wenn Sie verstehen wollen, wie unangenehm mir die Erfüllung dieses Wunsches war, so müssen Sie sich stets meine scheue und unbeholfene Art vergegenwärtigen, derer ich mir wohl bewußt war. Zudem besaß ich, da ich dergleichen als unwesentlich verachtete, ein recht fadenscheiniges Gewand.
Ich fühlte, daß ich mich nicht vortheilhaft präsentiren werde. Dies that mir leid im Interesse Herminas, welche trotz ihrer Selbständigkeit viel den Meinungen ihrer Verwandten folgte und hierin große Unselbständigkeit zeigte.
Ich reiste zu ihr durch schöne, blühende Gegenden. Ich sah Dörfer, welche die Städte unseres Kantons um ein Bedeutendes an Schönheit und Reichthum übertrafen, aber auch an Regsamkeit. Jeder Blick auf die Menge großer Fabriken, und anderer, der Industrie dienende Gebäude, die freundlichen Häuser mit dem Blumenschmuck vor den Fenstern, die in vornehmem Stile aufgeführten Landhäuser, welche von den Höhen durch die edlen Gesträucher ihrer Gärten blinkten, zeigte mir die Ueberlegenheit dieser Gegend über meine Heimat. Dort strengten sich die Menschen aufs Aeußerste an, ließen sich aber auch an nichts fehlen und gönnten sich bisweilen ein rechtes Vergnügen, während in meiner Gegend ein halbes Wesen war.
Die Leute lebten sehr ärmlich und brauchten deshalb für ihren geringen Aufwand nicht besonders zu arbeiten und kamen zu nichts und führten ein Wirthshaus- und Jaßleben in halber Dumpfheit. Deshalb hatten sie auch gar keinen Stolz auf sich und waren Gegenstand des Spottes der selbstbewußten Leute in Herminas Heimatkanton, welche viel auf sich hielten, sich selbst genügten, ihre Gegend als die schönste des Landes erklärten, während meine Landsleute das Schöne und Gute stets auswärts suchten.
Allerdings hatten sie vor letztern die größere Gemüthlichkeit voraus, da deren Stolz bis zum Hochmuth und das Selbstbewußtsein bis zum Egoismus und zur Hartherzigkeit ging.
Wenn Sie sich den unbeholfenen, zartfühlenden, scheuen und demüthigen Menschen vorstellen, der ich damals war, können Sie ermessen, welcher Art meine Gefühle waren beim Eintritt in die Familie meiner Braut.
Schon die kräftigen Gestalten mit den großen Bewegungen, welche einen für die nahen Gegenstände fürchten machten, die rothen, gesunden Gesichter, die lauten Stimmen, die mir wie Kommandorufe in den Ohren gellten, wirkten bedrückend auf mich. Die Wohlhabenheit, welche sich dem Auge aufdrängte und vollends die, welche vor mir zu Ehren meines Besuches ausgebreitet wurde, ließen mein geringes Selbstbewußtsein noch mehr zusammenschrumpfen. Ich fühlte die Blicke von Herminas Angehörigen über mein unscheinbares Gewand gleiten und schaute ängstlich auf meine Braut, welche, wie ich wußte, ebenfalls mit Sorge beobachtete, welchen ersten Eindruck ich auf ihre Familienglieder mache.
Meine Befangenheit wich selbst nicht beim reichlichen Mittagessen. Die Hausbewohner zeigten einen gesunden Appetit und es verschwanden in kurzer Zeit mächtige Portionen, während ich aß und trank wie ein Bienlein und sie mir vergebens zusprachen.
Auch dies brachte mich in Verlegenheit, da ich wußte, daß mich die Menschen nach diesen Leistungen beurtheilten, nach dem Grundsatze: Wer nicht ißt, mag auch nicht arbeiten, was aber bei mir nicht zutraf, weil ich bis jetzt nur nicht Gelegenheit gehabt hatte, mich an's Vielessen zu gewöhnen. Den Wein konnte ich aus demselben Grunde nicht ertragen.
Sie mußten schließen, daß ich ein Untüchtiger sei.
Auch die Unterhaltung näherte uns einander nicht, da ich den Mund kaum öffnete. Ich fand nicht den geringsten Anknüpfungspunkt. Was die Leute sprachen, war so korrekt, abgeschlossen, daß man höchstens ein langweiliges »Ja« darauf erwiedern konnte. Das Gespräch auf die Politik hinüberzulenken, wie ich versucht war, hätte mir noch mehr geschadet. Denn es war natürlich, daß sie Konservative waren, während ich ein junger, radikaler Demokrat war. Vom Kulturkampf, der damals begonnen, durfte ich ebenfalls nicht reden, weil sie von starker, kirchlicher Gesinnung waren, des Beispiels wegen.
Es war unheimlich geworden, da die Hausgenossen wegen meiner Gegenwart zurückhaltend wurden und zuletzt niemand mehr redete. Nur bisweilen wurde ich von zweideutigen, forschenden Blicken gestreift.
Ich wußte klar, daß ich abgeschätzt worden war als ein Minderwerthiger, als ein künftiges unwürdiges Glied ihrer ehrenhaften, guten Familie und daß sie es Hermina nicht Dank wissen würden, den fremden Vogel mit dem unscheinbaren Gefieder in ihre Gesellschaft gebracht zu haben.
Sie schämte sich für mich, schien mir, weil sie kaum aufblickte.
Ich athmete froh auf, als Hermina und ich das Haus verlassen hatten, um den verabredeten Ausflug zu unternehmen.
Ich war erbittert über die Solidität von Herminas Angehörigen, welche mich nur nach dem äußern Schein gewogen hatten. Es war thöricht von mir und auch etwas Eitelkeit, zu denken, daß man Gutes in mir hätte finden sollen, während ich gerade Blößen gezeigt und mir wenig Mühe gegeben hatte, das Gute in mir herauszukehren. Trotzdem empfand ich beinahe Haß gegen die mich umgebenden Wahrzeichen des Reichthums, da ich denselben für die Quelle des Hochmuthes und der Hartherzigkeit hielt, welche ich bei meinen künftigen Verwandten gefunden zu haben glaubte.
Wir wollten einen berühmten, wegen seiner Aussicht bekannten Berg besteigen, der sich zur Seite eines Sees erhebt. Es war ein schöner Sonntag und rings blühte die Maipracht. Wir gingen auf schmalen Wegen durch blühende Wiesen, in welchen die Obstbäume gleich Blumensträußen sich erhoben und welche umsummt waren von Tausenden von Insekten. Der Himmel wölbte sich in hellem Blau über uns. Die Sonne machte das Leben der Erde beinahe hörbar pulsiren. Wir schritten stumm neben einander her, nur einander bisweilen betrachtend. Ich verschlang ihre ebenmäßige, reich und anmuthig bekleidete Gestalt und erfreute mich an dem Gedanken, daß All dies sammt der innwohnenden wundervollen Seele mir gehöre. Und diese Vorstellung berückte mich, versetzte mich in einen Rausch des Entzückens.
Vergessen war meine peinliche Lage von vorhin.
Nun klommen wir ein Rebgelände hinan und als wir oben waren, standen wir vor einem Landhause von edler Bauart, dessen marmorne, weiße Veranda durch dunkle Tannengipfel blinkte.
Hier war kühle Ruhe inmitten des glühenden, reichen Lebens. Wie eine Insel der Seelen Abgeschiedener stand das schimmernde Landhaus in dem dunklen Grün des Parkes.
Zu unsern Füßen lag der blaue, berühmte See, der von unsern Klassikern besungen worden. Reiche Ortschaften traten an seinen Ufern aus dem Blättermeere blühender Obstgärten hervor. An seinem untern Ende war der höher gelegene Theil einer größern Stadt, welche durch Pflege der Künste und Wissenschaften glänzte, deutlich sichtbar. Im Süden standen in erhabener Majestät die schneebedeckten, silbernen Riesen des Hochgebirges.
Dies war der Augenblick, da mir die Augen aufgingen über die herrliche Natur unseres Vaterlandes.
Es war das erste Mal, daß ich der Form achtete, da ich bis dahin nur ein Stoffmensch und blind gewesen war. An der Seite meiner Braut, welcher meine Seele gehörte, ging mir das Reich der Schönheit auf.
Liebe Freude, ein mächtiges Lebensgefühl und die geistige Freude neuer Erkenntniß wölbten mir die Brust. Trunken schweifte mein Auge über die, wie mir schien, von mir erst entdeckte Schöpfung. Ich schwor bei mir, edel und gut zu sein und dieses Leben würdig zu verwenden, es in den Dienst der irrenden Menschheit zu stellen.
»Wenn wir so wohnen könnten!« schreckte mich die Stimme Herminas auf.
Ich eilte sofort den Gedankenweg zurück, auf dem dieser Wunsch gewandelt. Die häßliche Sorge um das Dasein trat wie eine Spinne wieder an mich heran. Ich wurde mir plötzlich wieder meiner großen Armuth bewußt und um so schärfer, je größer der Gegensatz zwischen meinen Verhältnissen und denjenigen der Besitzer der Villa waren. »Daran dürfen wir nie denken, erwiderte ich kleinlaut. Ich habe Dir meine Armuth nicht verschwiegen.«
»Aber ich hoffe, daß unsere Verhältnisse doch nicht beschränkter sein werden als jetzt die meinigen,« erwiderte sie.
Die Worte versetzten mir einen Stich in die Seele und ich zuckte zusammen.
Sie fuhr in leidenschaftlichem Tone fort: »Ich könnte es nicht ertragen, könnte Dich nicht mehr lieben; ich glaube, ich würde Dich hassen, daß Du mich an Dich gefesselt; denn ich brauche herrliche Lust, ein reiches, wenn auch kurzes Leben, voller Genüsse, die nur der Reichthum verschaffen kann. Ich muß schön wohnen, wie diese da. Auf einem edlen Pferde möchte ich durch das schöne Land jagen hoch über den andern Menschen. Du bist ein Mann, arbeite und verschaffe mir das alles und ich will Dich lieben wie nur ein Weib lieben kann, und ich will mich Dir ganz hingeben mit Seele und Leib.«
Trotzig, herausfordernd hatte sie zu mir gesprochen.
Sie stand vor mir glühend und zitternd vor Erregung. Die weichen, zarten Formen zeigten eine wunderbare Spannkraft. Sie bot einen herrlichen Anblick, der mir beinahe die Besinnung raubte.
War das meine Hermina?
Ich hatte sie mir anders gedacht. Ihre Worte hatten mich betroffen gemacht und lasteten als schwere Vorwürfe auf mir. So viel konnte ich ihr nie bieten, auch ihr Vermögen erlaubte kein solches Leben, wie sie es verlangte. Als ich sie um ihr Jawort gebeten und sie es mir gegeben, hatte ich geglaubt, die Macht der Liebe werde sie lehren, sich zu bescheiden, mir zu Liebe auf vieles zu verzichten. Mir war das Wort vorgeschwebt: »Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar.«
Nun war Alles anders als ich es mir in meiner Schwärmerei vorgestellt hatte. Aber sollte ich verzichten?
Ein Blick auf das Geschöpf vor mir zeigte mir, daß dies für mich gleichbedeutend mit Wahnsinn wäre. Zudem fühlte ich große Kraft mich durchströmen und es schien mir nicht unmöglich, das Ziel, das sie mir gesteckt, zu erreichen, wenn ich auch den Weg hiezu nicht kannte. Und ihre Leidenschaftlichkeit hatte sich auf mich übertragen.
Ich umfaßte sie, übersäte sie mit Küssen und sagte: »Ja, ich werde arbeiten, ringen für Dich, Du sollst mein glückliches, stolzes Weib sein.«
Und wir glaubten und hofften, denn wir waren jung.
Wir stiegen höher empor durch einen Buchenwald. Es war ein wildes Wesen über uns gekommen. In uns pulsirte die Leidenschaft mit kräftigen Schlägen, das Geräusch des äußern Lebens übertönend. Wir schauten uns mit sonderbaren Blicken an. Um meine Befangenheit zu verbergen, fing ich etwas verwirrt an zu reden und sprach von Politik, von meiner Ueberzeugung, von meiner Liebe zu unserm herrlichen Lande und meinem Stolz aus dasselbe. Und als ich zu Ende war, sagte Hermina:
»Mich freut, daß Du ein Vaterlandsliebhaber bist.«
Mich ärgerte das Wort, das meine Gefühle so verkleinert und trivial ausdrückte. Eine Weile zankten wir darüber.
Nun geriethen wir in einen jungen Schlag Laubholzes, in welchem zerstreut einige Tännchen stunden. Die Sonne stand schon ziemlich tief im Westen und warf langen Schatten. Wir arbeiteten uns durch das Gebüsch, ich sorgfältig jedes Hinderniß vor Hermina entfernend. Plötzlich standen wir vor einem freien Plätzchen, das von einigen dunklen Tännchen, die ihren Schatten darüber warfen und jungen Buchen abgeschlossen war. Eine zarte Moosdecke breitete sich vor den Tännchen aus. Man sah nur mehr den tiefblauen Himmel. Die Vögel zwitscherten im Gebüsche. Das fröhliche Geschmetter weckte ein Echo in der Seele. Sonst war alles still; kein Geräusch des andern Lebens tönte herein.
»Ich bin müde,« sagte Hermina.
Ich konnte kein Wort sprechen; ich zitterte. Sie nahm mir den Mantel ab und breitete ihn über das Moos. Wir setzten uns darauf. Nun umfingen wir einander und sanken zurück, mit den Häuptern unter die grünen Zweige zu liegen kommend. Nun löste sich die verhaltene Leidenschaftlichkeit, die uns beinahe besinnungslos gemacht, auf in ruhige Seligkeit. Hermina ruhte an meiner Brust. Wir träumten uns als Mann und Frau in unschuldiger Weise.
Die Erde war verschwunden.
Da kam mein Dämon.
In meinem Gehirne regten sich die Phantasieen. Die Liebesgeschichten kehrten zurück, die Gespräche der Männer, ihre absprechenden Urtheile über die Frauen. Ein furchtbarer Verdacht stieg in mir auf. Hatte ich etwa nur nicht verstanden? Ich wußte nicht was, denn mein Herz war rein. Aber mein Blut kam in Wallung. Das Unreine – mir war es, wie Ihr wißt, Schönheit – war da. Ich wurde ungestüm und Hermina erwiderte. Fremde Geschichten gingen dabei durch meinen Kopf, Dinge, die ich gelesen. Und da schlüpfte ein Wort heraus, das nicht mein war und – des Erzählers Stimme zitterte – für das, wenn es ungesagt geblieben, ich nachher Jahre meines Lebens gegeben hätte. Aber es war lebendig geworden.
Und darauf ging ein Beben durch Herminas Gestalt. Ueber ihr Gesicht ging ein Zug furchtbaren Schmerzes und in ihren Augen lag es einen Augenblick wie Irrsinn. Auch auf meinem Herzen lag ein großes, hülfloses Weh, das gen Himmel schrie.
Woher war dies gekommen, das unsere Seelen in einen Abgrund schmetterte?
Wir erhoben uns langsam, wie leblos, in dumpfer Betäubung.
Die Schöpfung schien abgestorben.
Aber aus der Nacht des Schmerzes stieg mir glänzend das Bild Herminas auf. Mir war die Erkenntniß herrlicher, reiner Jungfräulichkeit gekommen, die bis jetzt für mich nicht vorhanden gewesen war.
Aber mit welchen Opfern! Das Glück war zersprungen, das die Erkenntniß in sich geschlossen. Ererbtes leidenschaftliches Blut und eine einseitige Entwicklung meines Wesens hatten mich unglücklich gemacht.
Das Ziel, der Aussichtspunkt, war dahingefallen. Unsre Lust war verschwunden. Stumm und freudelos gingen wir zurück. Wir kehrten in einem ländlichen Wirthshause ein und aßen das bittere Brot der Uneinigkeit, die nicht ausgesprochen war, aber in unsern Herzen keimte. In mir ertönte immer wieder jenes Wort und wuchs und stellte sich als ein riesengroßes Gespenst vor mich hin. Vorwürfe hallten mir im Gewissen. Ich geleitete Hermina zur Bahn. Ihre Hand war kalt, als sie Abschied nahm. Als sie im Coupé saß, schaute sie durch das Fenster in die Gegend hinaus. Es that mir weh, daß sie mir keinen Blick schenkte.
Ich duldete stumm meine Strafe.
In der folgenden Zeit trat meine Schuld zurück, da das Bild Herminas sich immer reiner und schöner in mir erhob. Immer größer wurde die Sehnsucht nach ihr und der Wunsch, bald mit ihr vereinigt zu sein, um ganze Seligkeit zu genießen. Durch mächtige Anstrengung, schien mir, sollte es mir gelingen, Reichthum und Ehre zu erringen, um in kurzer Zeit zur Verbindung zu gelangen. Ich arbeitete fieberhaft, von früh Morgens bis tief in die Nacht. Meine Arbeit rückte schnell vorwärts. Ich nahm noch Nebenbeschäftigungen an, nur um Geld zu verdienen. Ich machte die Erfahrung, daß Arbeit, welche nur nach Lohn geht, eine schreckliche ist. Aber die Hoffnung gab mir Kraft. Ich sah immer das Bild unserer glücklichen Ehe. Schöne Kinder umspielten uns.
Dabei läuterte ich mich immer mehr und begann selbstbewußter zu werden.
Die Briefe Herminas zeugten von unveränderter Liebe. Aber bisweilen klang ein herber, bitterer Ton durch, der mich schmerzte. Manchmal tadelte sie mich wegen einiger Stellen meiner Briefe. Auch fing sie an, mich zu regieren und ordnete manches bezüglich meines Aeußern an.
Ich folgte ihr willig und fing an, mich herauszustaffiren, obwohl mir dies im Grunde zuwider war, die Zeit hiefür mich reute und ich mich meines Geckenthums schämte. Ihr zu Liebe hätte ich noch viel mehr gethan, wie sie mich denn auch in ihrer Hand hatte.
Nun fing ich auch an, sie besser zu verstehen. Ich erkannte, daß wohlerzogene Menschen ebensosehr die Form schätzen als den Inhalt und ein für die Schönheit und Anmuth empfängliches Auge besitzen, das leicht vom Unharmonischen und Einseitigen, wie ich es damals war, abgestoßen wird. Freilich ist die Bedingung hiefür ein gewisser Wohlstand, welcher der Seele Freiheit gestattet. Ich suchte mich derart zu erziehen, um meiner Braut ebenbürtig zu werden und überwand manche Beschränktheit, die mich blind gemacht.
Aber immer spitziger wurden Herminas Bemerkungen und immer größer meine Liebe.
Manchmal wurde ich eifersüchtig auf ihre Verwandten, da sie immer dieselben mir als Muster hinstellte, ihre Ansichten auf jene stellte und auf die meinigen nichts hielt, während es früher anders gewesen war. Sie schwärmte sogar für einzelne Glieder ihrer Verwandtschaft, welche, wie ich merkte, ein ruhiges, gesetztes Wesen hatten, während ich, weil unfertig, auch unbeständig in meinen Urtheilen war.
Diese Anhänglichkeit an ihre Verwandten machte mich eifersüchtig, weil mir schien, jenes ihnen zugewendete Maß von Zuneigung sei mir entzogen. Ich begriff es auch nicht, weil es mir selbst fehlte, da die meinigen sich keine Stütze waren, während diejenigen Herminas sich gegenseitig aufrecht hielten. Ich wurde mißtrauisch und zanksüchtig und kam endlich dazu, der Verlobten vorzuwerfen, sie bereue meiner Armuth wegen ihre Wahl. Hermina antwortete gekränkt und wir führten in den Briefen einen steten Krieg miteinander, obwohl ich endlich beinahe krank wurde vor Liebe.
Der Sommer war fast vorüber, als meine Arbeit fertig wurde und ich ein ordentliches Sümmchen Geld, wie ich es noch nie besessen, beisammen hatte. Nun waren die Segel meiner Hoffnungen geschwellt und ich hatte ein freudiges Selbstbewußtsein. Ich wollte Hermina mit einem Besuche überraschen.
Alles sollte wieder gut werden.
Ich fuhr durch dieselbe Gegend, die ich schon einmal in knechtischer Demuth durcheilt, mit blindem Auge, die Seele von unreinen Bildern erfüllt.
Wie anders erschien sie mir jetzt.
Das Auge erfreute sich an der schönen Landschaft, bemerkte, wie scharf sich die bewaldeten grünen Hügel in der reinen Luft vom tiefblauen Himmel abhoben, wurde geblendet vom glitzernden Strom und sah mit Stolz die idyllisch gelegenen Ortschaften. Ich freute mich über meine Reinigung der Seele, daß jene Verirrung wie ein wüster Traum hinter mir lag. Ich war mir des Werthes meiner Persönlichkeit bewußt und besaß ein ziemliches Selbstgefühl.
Als ich mich Herminas Heimatgegend näherte und den Reichthum derselben sah, fühlte ich nicht Neid, sondern Achtung vor der tüchtigen Art seiner Besitzer und wünschte dieselbe auch den Leuten meiner Gegend. Ich fühlte mich meiner künftigen Verwandtschaft nicht mehr so unwürdig, besonders nicht, wenn ich an den gespickten, schweren Geldbeutel griff.
Ich spann sogar den Gedanken, daß aus meiner Verbindung mit Hermina eine bessere, solidere Art hervorgehen werde, welche dem Dämon der verzehrenden Leidenschaften entrückt sein werde.
So eilte ich mit hoffnungsfreudigem Herzen meinem mit Ungeduld ersehnten Ziele zu.
Als ich unerwartet vor Hermina stand, suchte sie ein Erschrecken zu verbergen. Schmerz durchzuckte mich, als sie so geringe Freude zeigte.
Ihre Leute verkehrten gemessen höflich mit mir, so daß ich etwas kleinlaut wurde. Dem Imbiß, der mir vorgesetzt wurde, sprach ich vorsätzlich stark zu, um schon hierin eine günstigere Meinung von mir zu erwecken.
Dann zog ich mich mit Hermina in ihr Zimmerchen zurück, das elegant ausgestattet war und einem Schmuckkästchen glich. Sie besaß eine ausgewählte Bibliothek, auf welche zuerst mein Auge fiel. Schöne Pflanzen hingen von der Decke des Zimmers und überspannen zum Theil die Wände. Da und dort lagen Naturgegenstände, seltene Versteinerungen, wofür ich keinen Sinn gezeigt hatte. Das Gemach athmete geistige Vornehmheit und bot ein ziemlich vollständiges Abbild von Hermina.
Ein Gefühl der Ehrfurcht durchschauerte mich, als ich bedachte, daß meine Braut täglich hier weile und ein Behagen überkam mich bei der Vorstellung, daß mit Hermina alle diese schönen Dinge einst mein sein würden.
Ich fragte nach einer Thüre, die aus dem Zimmer in ein anderes führte. Mit schwachem Erröthen sagte sie:
»Das ist mein Schlafgemach« und führte mich dahin.
Ich sah ihr weißes Bett und erzitterte beinahe, da ich mir ihre keusche Jungfräulichkeit vergegenwärtigte.
Erst jetzt fiel mir die Veränderung der Geliebten auf.
Die Züge ihres Gesichtes waren weicher und frauenhafter, sie schöner geworden. Unter den Augen lag ein leichter, bläulicher Schatten. Großer Ernst war über sie gebreitet. Mein Herz wallte in mächtiger Liebe auf.
Wir setzten uns nebeneinander auf das Sopha. Sie duldete meine Liebkosungen schweigsam, ohne sie zu erwiedern. Und da fühlte ich auch wieder den Stachel in der Brust und eine geheime Angst. Sie erwiderte auf meine Reden, ernste und heitere, nichts. Sie nahm meine Küsse hin, ruhig, ohne zu beben; ich lehnte ihr Haupt an meine Brust, sie ließ es geschehen und bewegte sich nicht.
Immer größer wurde meine Angst und meine Liebe. Und ich fing an zu flehen, zu schmeicheln, zu bitten: Um ihren Mund zuckte ein schmerzliches Lächeln, das mir in die Seele schnitt.
Ich gab meine Bemühungen auf und setzte mich von ihr. Große Bitterkeit stieg allmählig in mir auf, Groll über den Empfang, der mir geworden, der ich so fröhlich hergekommen.
Ich glaubte um so eher ein Recht zu meinem Zorn zu haben, als ich mich geläutert und ihrer würdig wußte. Daß sie davon nichts wissen konnte, dachte ich nicht. Ich redete bittere, stechende Worte. Ihr Lächeln wurde trauriger, das Weh in den Augen größer.
Doch der Mund blieb stumm.
Das Stübchen wurde mir zu enge. Ich schlug vor, nach der Stadt am untern Ende des See's zu gehen. Die Geliebte willigte mit einem Nicken ein, denn in unserer Gemüthsstimmung, die deutlich von den Gesichtern zu lesen war, durften wir uns nicht länger den forschenden Blicken der Verwandten aussetzen.
Wir saßen im Eisenbahnwagen einander gegenüber, beide stumm und Bitterkeit im Herzen, die jeweilen in einem traurigen Lächeln auf die Lippen trat. Mein Herz war so elend, daß ich mit Mühe einen lauten Aufschrei unterdrückte. Ich betrachtete nur immer ihr frauenhaftes Gesicht. Für einen Augenblick schloß ich die Augen und drückte mir das Bild in die Seele. Ich sah noch einmal die Gegend an, von welcher mir eine bange Ahnung sagte, daß ich von ihr Abschied nehme. Ich schied von der Tüchtigkeit, Kraft und dem Reichthum und von meinem Glücke. Meine flehenden Augen baten Hermina um Versöhnung.
Da wandte sie die ihrigen weg.
Wieder überkam mich Zorn.
Jetzt, da ich das Glück verdiente, da Hermina mir am begehrenswerthesten erschien, sollte ich sie verlieren, von dem Gipfel der Hoffnungen plötzlich in das Elend geschmettert werden! Ich hatte so viel Mühe an mich gewendet.
Und jetzt! –
Die Leute wiesen auf uns und flüsterten. Wir hörten mehr als einmal das Wort: »Brautpäärchen.« Ein solches ist den Leuten stets eine willkommene Gelegenheit, zu urtheilen und zu prophezeien. Das Wort schmerzte uns, es entsprach so wenig der Wirklichkeit und stellte uns doch das Glück vor Augen, dessen wir uns unter andern Umständen zu erfreuen gehabt hätten.
In der Stadt schritten wir stumm nebeneinander hin. Dieses Schweigen wurde unerträglich. Mit Anstrengung brachte ich endlich die Frage hinaus: »Was hast Du gegen mich?«
Mit gepreßter Stimme antwortete sie: »Du sollst es wissen. Ich will die Wahrheit bekennen: Ich liebe Dich nicht mehr so sehr wie anfänglich, nicht in der Weise, wie es einer Braut geziemt. Es dünkt mich nicht recht. Aber ich habe lange nach dem Verlorenen gesucht.«
Ich taumelte zurück und starrte sie mit weitaufgerissenen Augen an. Also doch!
Dann sagte ich leise, zitternd, mit jammernder Stimme: »So müßten wir uns also trennen?«
Da sah sie mich von der Seite mit einem seltsamen Blicke an:
»Sage kein solches Wort!«
Beinahe jammernd suchte ich ihr begreiflich zu machen, daß meine Erziehung jenes Unglück verschuldet, daß ich unschuldig sei daran, mein Unrecht eingesehen habe und ein anderer geworden sei.
Am Ende meiner Rechtfertigung sagte sie nur: »Du bist ein Leichtsinniger.«
Nun wußte ich, daß auch sie mich abgeschätzt hatte. Das Wort gab mir einen schmerzhaften Stich.
Noch gab ich die Hoffnung nicht auf, ich hielt mit Zähigkeit, selbst zum Nachtheil meines Stolzes an der Rechtfertigung fest. Ich erwähnte jener Männer mit ihren Urtheilen über die Frauen, die schädlich auf mich gewirkt.
Da unterbrach sie mich flammenden Auges, mit ihrem kleinen Fuße stampfend:
»Also für das haltet ihr die Frauen? Pfui über euch Männer! Pfui! Ihr prahlt mit eurer Macht, die euch gegeben, ihr übt sie auch unumschränkt aus, aber euch selbst beherrschen könnt ihr nicht!«
Und eine Thräne des Zornes blinkte in ihrem Auge. Nun schwieg ich; ich war erschöpft.
Nach geraumer Zeit fing ich in ruhigem Tone von unserer Trennung zu sprechen an, wir wollten in unauffälliger Weise von einander gehen, um den Leuten nicht zu viel Stoff zu Gerede zu geben. Großmüthigst versprach ich, selbst noch einmal zu ihr zu kommen, trotz der Schmerzhaftigkeit des Schrittes.
Da zuckte sie doch zusammen und sprach in leisem ängstlichem Tone: »Du willst mich also nicht? Es könnte vielleicht wieder gut werden.«
Aber ich fuhr hartnäckig fort, von der Trennung zu reden und eigensinnig uns Schmerzen zu bereiten mit Worten, die in unsern Herzen wühlten. Es gibt auch eine Wollust des Schmerzes. Ich dachte nicht mehr an den großen Verlust.
Da war sie auf einmal wie umgewandelt.
Ihre Gestalt streckte sich aufrechter, um den Mund lagerte sich ein herber, strenger Zug. Wir gingen auf den Bahnhof. Sie lief umher und besah sich allerlei Dinge. Sie fing mit fremden Menschen zu reden an.
Ich war für sie nicht mehr vorhanden.
Ich stand vor der Treppe. Mein Blick fiel auf sie und meine Liebe kehrte in der ganzen leidenschaftlichen Größe zurück: »Darf ich bei Dir bleiben? Es soll noch alles gut werden!« Und ich faßte ihre Hand.
Sie entzog mir dieselbe und sagte kurz: »Ich mache in solchen Dingen nicht hin und her. Leben – Sie wohl!«
Das »Sie« machte mich todtenbleich.
Ich stieg ein. Der Zug fuhr ab.
Sie stand auf dem Perron und schaute geradeaus. Ihr feines, bleiches Gesicht entschwand mir allmählig. Zuletzt noch ein Schimmer und mir war, als entschwinde damit mein Lebensglück. Ich war allein im Coupé. Da senkte ich meinen Kopf in beide Hände und weinte bitterlich. –
Die Brust des Erzählers ging schwer. Der Sekretär kehrte sich ab, Thränen quollen aus seinen Augen.
Als er etwas ruhiger geworden, fuhr der Erzähler fort:
Ich fuhr heimwärts und sah theilnahmslos in das glühende Abendroth. Gleichgültig ließ ich die Dinge vor meinen Augen hingleiten. Ich fühlte eine große Leere in mir. Ungewiß und unheimlich lag die Zukunft vor mir. Vergebens redete ich mir den Trost vor, daß ich frei und ungehindert sei.
Drei Tage verrichtete ich ruhig meine Arbeit. Dann erwachte die Liebe mit verstärkter Gewalt. Leuchtender als je stand Herminas Gestalt vor mir und edler ihr Charakter. Und ich sollte sie verlieren, ihr Gesicht nicht mehr sehen, nie mehr in ihre braunen, lieben Augen blicken, sie nicht mehr in die Arme schließen können? Ohne sie sollte ich durch das Leben gehen! Das konnte, durfte nicht sein!
Der Gedanke machte mich fast wahnsinnig.
Ich schrieb ihr einen leidenschaftlichen, verzweiflungsvollen Brief, bat sie darin um Verzeihung, versuchte nochmals eine Rechtfertigung und bat sie um ihre Liebe, indem ich versprach, sie glücklich zu machen. Ich erinnerte sie an die Kürze unseres Lebens, an die Zeit, da wir vermodert im Grabe lägen. Warum denn uns unser Glück verderben! schrieb ich. Ich sei ja gut und sie solle sich zwingen, das Gespenst jenes Wortes zu bannen.
Erst nachdem ich den Brief abgesandt, merkte ich, daß mehr Trotz hineingeflossen, als in meinem Willen gewesen war.
Es kam keine Antwort. Die Unruhe trieb mich umher. Wie oft ich auch den Verlauf der Dinge überdenken mochte; ich mußte stets Hermina Recht geben. Mich sah ich in immer erbärmlicherm Lichte.
Ich schrieb den zweiten Brief, in welchem ich flehte, daß sie mich wenigstens aus der Qual der Ungewißheit reißen, eher mir sofort alle Hoffnung vernichten, als mich noch länger diesem Zustand überlassen möge.
In unbegreiflicher Verblendung forderte ich für den Fall, daß sie keine Versöhnung wolle, sofortige Zurückgabe meiner ihr geschickten Briefe und der übrigen Sachen; nicht des Werthes derselben wegen. Ich Thor glaubte, daß wenn mir jede Hoffnung zerstört, jedes Bindemittel zwischen uns zerschnitten sei, ich es um so eher vergessen und die ganze Erinnerung über Bord werfen könnte.
Es kam keine Antwort.
Statt nun dieses Zögern für mich günstig zu deuten, wie ich es mit Recht hätte thun dürfen, versetzte mich dasselbe in Zorn, weil ich es als Mißachtung aufnahm. Ich bedachte nicht, daß, während meine Liebe gleich oder größer, die ihrige erschüttert war und benahm mich, als ob man Liebe wie eine Sache fordern und erhalten könnte. Auch hatte ich vergessen, daß sich Hermina gelobt, sich nie mehr von ihrem Temperamente zu voreiligen, unbedachten Entschlüssen hinreißen zu lassen.
Zornig packte ich, jedoch mit einer Thräne im Auge, ihre Briefe und die mir gemachten kleinen Geschenke, ein Taschenbüchlein, Hebels Gedichte, das ihr Lieblingsbüchlein war und anderes zusammen und that sie zur Post. Dennoch hatte ich den geheimen Wunsch, daß sie zurückkommen möchten.
Statt dessen erhielt ich das meinige zurück. Fast sank ich um, und alles Blut strömte zum Herzen zurück, als ich das Packet aus der Hand des Postboten nahm. Ich hatte nicht die Kraft, die Sachen anzusehen; aber das oben aufliegende Brieflein mit den theuren, zierlichen Schriftzügen nahm ich zur Hand. Es stand darin die zärtliche Anrede von ehemals.
Fast schöpfte ich Hoffnung.
Aber Hermina sagte mir höflich und ruhig Lebewohl, wünschte mir viel Glück und meinte, es sei sehr schade, daß unsere Liebe so ende.
Und da lachte ich auf, zerriß den Brief und weinte.
Es war vorbei für immer.
Vorbei war das Glück, das ich in meinen Phantasieen mir so schön vorgemalt.
»Und Sie haben nachher keinen Versuch zur Versöhnung gemacht?« fragte mit gespanntem Gesichte der Sekretär.
Ich war damals in meiner Leidenschaft um nichts verständiger als unsere Juliane. Ich setzte mir in den Kopf, meine Liebe zu überwinden, Hermina mit aller Gewalt zu vergessen. Es gelang mir nicht. Auf dem Grunde meiner Seele lag fortwährend ein großer, dumpfer Schmerz ähnlich einem See, der bisweilen aus der unheimlichen Ruhe aufgeschreckt wurde und dessen wilde Fluthen dann Zerstörung brachten. In solchen Zeiten, da mein ganzes Selbst in Aufruhr gerathen war und der Sturm der Leidenschaft mich wüthend packte, glaubte ich oft, das Dasein nicht länger ertragen zu können. Dann stürzte ich mich in wilde Vergnügungen, so daß es schien, ich werde ein Verlorener.
Aber immer stand Herminas Gestalt vor mir. Wenn ich, um den Schmerz zu betäuben, über den Durst zechte und mit den Dirnen schön that, war sie plötzlich wieder in aller Schönheit bei mir, schien auf meine Erbärmlichkeit zu weisen, sodaß ich mich schämte, mich Eckel erfaßte und ich forteilte, um in wildem Gefühlssturme mehrere Stunden in der Nacht mich müde zu laufen, bis mit der Erschöpfung auch das große Maß des Schmerzes nachließ und ich ruhiger, aber geschwächter beim Morgengrauen heimkehrte.
Es muß damals Wahnsinn über mir gelegen sein, da meine Sinne überall nur sie sahen. Wo ich auch gehen mochte, mehrmals in einem Tage, glaubte ich meine verlorene Braut zu erkennen und jedesmal durchzuckte mich freudiges Erschrecken, welchem aber stets die Enttäuschung folgte.
An den Sonntagen ging ich auf den Bahnhof und erwartete die Züge, welche von Herminas Heimat kamen.
Dann befand ich mich in der sonderbarsten Verfassung.
Das ungestüme und unregelmäßige Pochen des Herzens, ein Gefühl, gemischt aus Sehnsucht, Freudigkeit und heimlichem Bangen verrieth unzweifelhafte Hoffnung, während weiter oben im Gehirn das dunkle Bewußtsein lebte, daß die Hoffnung vergeblich sei und ich mich lächerlich gemacht habe. So trafen denn auf meinen Lippen ein schmerzliches und ein ironisches Lächeln zusammen, so daß sie bezüglich ihrer einzunehmenden Stellung in Verlegenheit geriethen.
Wenn dann der Zug herangebraust kam, so suchte das Auge des Herzens unter den aussteigenden Menschen die in die Seele gegrabene, theure Gestalt der Geliebten. Und wenn sich die fremden Gesichter entfernt hatten und selbst das dumme Herz nach einem kleinen Stiche sich beruhigt hatte, so zankte der erhabenere Verstand es aus, bis er einmal plötzlich entdeckte, daß er, der Herr, eigentlich die Schuld an dem Unsinne trage.
Erst jetzt begriff ich, daß der Kopf über das Herz gesetzt sei und sein müsse. Gleichwohl traf mich das gleiche mächtige Verlangen noch etliche Male auf den Bahnhof.
Das Bewußtsein meiner Schuld trug hauptsächlich dazu bei, daß meine Leidenschaft für Hermina die gleiche Stärke behielt.
Nun versuchte ich mich in Zorn über sie zu versetzen und redete mir allerlei vor, bis ich es selbst beinahe glaubte. Ich ließ den Verdacht wachsen, daß Hermina mich gern fallen gelassen, weil ich ihr zu wenig bedeutend und zu arm gewesen sei. Wahrscheinlich sei ihr eine »gute Parthie« in Aussicht gestanden und dieser zu Liebe habe sie den Bruch herbeigeführt. Möglicherweise habe sie schon beim Bruche einen Andern geliebt.
Der Gedanke, daß ein anderer als ich sie in seine Arme schließen, sie sein eigen nennen könne, zersprengte mir beinahe die Brust.
Ich sah sie im hochzeitlichen Kleide an der Seite eines Andern.
Mehrere Stunden des wahnsinnigsten Umherirrens genügten kaum, dieses quälende Bild in mir zu tilgen.
Oft kam es wieder, denn in jener Zeit sah ich es an, daß Mädchen sich verkauften.
Blühende, junge, schön gewachsene Geschöpfe gaben sich in naturwidriger Weise reichen Greisen, verständige Mädchen reichen Affen hin, denen nebst dem Geiste die körperliche Schönheit mangelte, und dies nur, um versorgt zu sein, um angenehm leben, in der Gesellschaft glänzen zu können. Sie zogen dieses Leben demjenigen an der Seite eines braven, gesunden, tüchtigen Mannes, der sich sein Brod mit Schweiß verdienen mußte, vor. Mich ekelte, denn sie erschienen mir verächtlicher als diejenigen, die nur ihren Leib um Lohn hingeben.
Ich redete mir ein, auch Hermina werde eine Geldheirath machen.
Als nichts dergleichen geschah und ich vernahm, daß sie ein freudloses Leben führe, nur etwas fromm geworden sei, bat ich sie in Gedanken um Verzeihung.
In ungetrübter Herrlichkeit stand von nun an ihr Bild über mir, um nie mehr befleckt zu werden.
Die Leidenschaft und der Zorn lösten sich in ruhige Wehmuth auf.
Ich hielt Einkehr, durchforschte mein Wesen und erkannte dessen Verschrobenheit und Verirrung. Ich verfluchte die schlechten Bücher und die sittenlose Gesellschaft, welche die Phantasie und das Herz der jungen Männer vergiften und mied beide.
Ich erkannte die sittliche Weltordnung und suchte die Hoheit der Frauenseele. Es wurde mir beinahe zur Leidenschaft, immer mehr edle Frauencharaktere aufzufinden.
Und ich fand viele, in der Hütte und auf den Balkonen der Paläste.
Seither möchte ich jedem jungen Manne – und es ist so nöthig – zurufen: Achte die Frau! Achte sie, weil Du eine Mutter hast! Achte sie, denn sie sind die Hüterinnen der Schönheit und Sittlichkeit! Ja! sie sind die Säulen der Sittlichkeit! Wie wäre es mit dieser bestellt, wenn sie von der brutalen Willkür der Männer abhinge! Und wo die Frau fehlt, da fehlt sie aus Liebe zum Manne, der die Aufopfernde oft sogar verachtet.
Hüte Dich, dieses feiner als Du organisirte und deshalb für alles, auch für die Wollust empfänglichere Wesen zu reizen! Es ist stets das, wozu der Mann es macht. Begegne selbst der Verworfenen mit Achtung, denn diese erhebt sie, bringt sie vielleicht auf den rechten Weg zurück!
Mich hatte diese Erkenntniß mein Lebensglück gekostet, das theuer, doch nicht zu theuer bezahlt war.
Noch mehr lernte ich in dieser Zeit. Ich erkannte, daß nur die Bezwingung der Leidenschaft, nur das Maßvolle das Glück möglich macht.
Nun erwachte auch meine Liebe wieder, aber stiller, ruhiger, resignirter.
Tausend Vorkommnisse des täglichen Lebens erinnerten mich an die Zeit unseres ungetrübten Glückes. Ich aß die Gerichte, welche Hermina liebte und dachte ihrer mit Sehnsucht. Worte, welche sie gebraucht im mündlichen und schriftlichen Verkehr riefen mir ihre Gestalt in's Gedächtniß zurück. Und vieles Andere.
Ich suchte die Orte auf, wo wir zusammen gewandelt und sah die Sträucher, welche ich vor ihr zurückgebogen, sah die Stelle, wo sie Blumen gepflückt und den Rasen, wo wir nebeneinander gesessen waren. Jede dieser Erinnerungen verwundete mich. Manchmal preßte ich die Hand auf das Herz, wenn ich Jünglinge und Mädchen fröhlich beinander sah.
»Aber warum haben Sie keinen Schritt der Annäherung versucht, da Sie wußten, daß Hermina Ihnen treu blieb und Sie also auf Erfolg hätten rechnen dürfen?« So fragte angstvoll der Sekretär.
Mit einem matten Lächeln entgegnete der Gefragte:
Das war sehr ungewiß, denn es gibt Dinge, welche – jedoch nur bei zartfühlenden Menschen – wenn sie dieselben getrennt haben, die Kluft zwischen ihnen unüberbrückbar machen. Zudem kannte ich Herminas unbeugsamen Willen.
Meine Leidenszeit hatte schon beinahe ein volles Jahr gedauert und mir meine beste Kraft hinweggenommen. Der Frühling nahte wieder und brachte tausend schmerzliche Erinnerungen, verbunden mit einer süßen Sehnsucht nach der verlorenen Geliebten. An einem der schönen Frühlingsabende ging ich in Wehmuth dahin. Da erklang durch die Abendruhe melodischer Gesang. Der gemischte Chor des Dorfes hielt Uebung im Schulhause. Der Gesang fiel besänftigend in meine Seele. Ich blieb stehen und lauschte. Es war ein altes Volkslied. Noch jetzt ist es frisch in meinem Gedächtnisse:
» ... I hatt' scho drei Sommer
Mir 's Heimgehn vor'gnommen;
I hatt' scho drei Sommer
Mei Schätzel nit g'sehn.
Auf mi wart's no immer,
Es glaubt, i komm' nimmer;
Wie wird ihm dann g'schehn?
Die Nacht sinkt schon wieder;
Man sieht gar nichts mehr ...
Heut' muß i's heimsuchen,
Wenn's no so weit wär'! ...«
Das Lied klang so einfach, innig, so entschieden der Schluß:
»Heut' muß i's heimsuchen,
Wenn's no so weit wär'!«
Wie wurde mir so sonderbar! Nicht anders als müßte auch ich es heimsuchen, mein theures, verlorenes Lieb. Frühlingskraft schwellte meine Muskeln und meine Einbildungskraft war erregt. Mächtig erwachte meine Liebe und im Gehirn lebte nur noch der eine wahnsinnige Gedanke: Heute noch zu Hermina zu eilen, mich ihr zu Füßen zu werfen, damit Alles wieder gut werde. Ich sah uns vereinigt, sah ihr bezauberndes Lächeln. –
Ich begann einen schnellen Marsch, sah weder rechts noch links, sondern in meine entzündete Seele, wo das Bild Herminas thronte wie die Mutter Gottes ob dem Flammenherz.
Um zur Geliebten zu gelangen, hätte ich einem langen Thale folgen und von dessen Ende bis zu ihrem Orte oben an einem See noch viele Stunden gehen müssen. Ich konnte aber auch die gerade Richtung einschlagen und hatte dann drei ziemlich hohe Hügelketten mit zwei dazwischenliegenden Thälern zu überschreiten. Ich nahm diesen Weg und stieg bergan durch den Wald. Ich arbeitete mich durch dessen Dunkelheit und zog mich an den Bäumen aufwärts.
Ich murmelte für mich in einemfort:
»Die Nacht sinkt schon nieder ...«
Sie sank nieder und gespenstige Dunkelheit umfing mich. Ich irrte nicht von der Richtung ab; ich hatte sie mir in glücklichen Tagen genau gemerkt und meine Gedanken waren oft mit dem Flug der Vögel dieselbe Richtung geeilt. Ich kam auf die Höhe und sah unter mir die traulichen Lichter in den Wohnstuben friedlicher Menschen. Lange, weiße Nebelstreifen zeigten mir zwischen mächtigen, langen Schatten die vielen Flußläufe des Landes.
Ich stieg hinab und wieder hinauf; schon mehrere Stunden war ich auf dem Wege, ich spürte keine Müdigkeit, die Leidenschaft gab mir übermenschliche Kraft.
Nun lag das letzte Thal, die letzte Kette vor mir. Ich stürzte hinunter; der Schweiß troff von mir, ich schlug an die Bäume und sank oft um und sprang wieder auf. Der Wahnsinn dauerte gleichmäßig an. In meinem Innern war es licht. Ich hielt Zwiegespräche mit Hermina, murmelte vor mir hin, was ich ihr sagen wolle.
Als ich den letzten Hügel hinanstieg, spürte ich Müdigkeit. Ich arbeitete mich verzweiflungsvoll vorwärts, das nahe Ziel gab mir neue Kraft. Nun stand ich oben. Zu meinen Füßen über dem See lag das Nebelmeer. Ich wußte, wo Herminas Heimatort war. Ich sah sie in ihrem trauten Zimmerchen auf ihr weißes Bett gestreckt, ruhig schlummernd.
Da kam mir der Wahnsinn meines Beginnens zum Bewußtsein. Ich schauderte vor mir. Die Müdigkeit übermannte mich und ich sank im jungen Schlage auf das feuchte Gras. Die Starrheit löste sich in Thränen auf und der Thau fiel kühlend auf meine glühende Stirne, als ich das Haupt zum langen Schlafe niedersinken ließ.
Es war heller Tag als ich erwachte.
Meine Seele war heiter und das Auge klar. Ohne Schmerz sah ich den blauen See, den Ort und zwischen Obstbäumen Herminas Haus. Ich fuhr nach Hause, kühle Ruhe in mir.
Meine erste Liebe war überwunden. Seither war ich ein stiller, fleißiger Mensch, der unentwegt vorwärts strebte, das Gute wollend nach Goethes Wort: »Edel sei der Mensch, hülfreich und gut!«
Die Macht des Gefühles war überwunden, nicht vernichtet; aber der Ausgleich zwischen ihm und dem willenskräftigen Verstande hatte stattgefunden.
Zum Inhalte war die Form gekommen.
Erst von dieser Zeit an, da meinem jungen Herzen Fesseln angelegt wurden, war meine Arbeit von Erfolg und machte ich, wie man sagt, Karriere. Ich hatte die Menschen verstehen, mich mit des Lebens Rohheit abzufinden gelernt, ohne daß ich mein Bestes verloren hatte.
Nun ich selbst ein Mann war, verstand ich erst die tüchtige Art von Herminas Verwandten als Leuten, die ein Besitzthum haben und deshalb von anderer Denkweise sind, als die Uebrigen, bei denen sich keine Pietät für Güter des Lebens bilden kann, weil sie keine haben, weßhalb sie auch auf dem Strome geringe Sicherheit bekommen.
Es ist sehr spät geworden, verzeihen Sie, meine Herren, daß ich Ihre Geduld und Zeit so stark in Anspruch genommen für das Anhören der Geschichte meiner ersten und einzigen Liebe! Sie werden verstanden haben, aus welcher Verkehrtheit, aus welchem Wuste von Unreinem ich mich herauszuschälen hatte, bis ich genießbar war.
»Und es war wirklich Ihre letzte Liebe, Herr Präsident?« fragte der Anwalt. »Trotz Ihrer Schwärmerei für die Ehe machten Sie keinen zweiten Versuch, in dieses Paradies zu treten?«
In dem Gesichte des Erzählers zeigte sich eine Spur von Unwillen über die etwas indiskrete Frage. Einen Augenblick schwankend, sprach er: »Ja, in diesen Dingen bin ich noch heute, aber mit Bewußtsein, Sklave meines Gefühles, das, wie mir scheint, ein richtiges ist.«
Mit der Zeit war ich eine »gute Parthie« geworden. Manche schöne Mädchenknospe stellte sich mir absichtlich in den Weg, damit mein Auge auf sie falle und ich sie pflücke. Ich dachte aber daran, daß sie mich nicht ansehen würden, wenn ich kein solches Ansehen besäße, wäre ich auch von größerer Trefflichkeit.
Ich fragte mich wohl auch, ob ich nicht das Glück ergreifen solle, das so verlockend schön vor mir stand und einen Augenblick lang mochte ich schwanken. Dann hörte ich nach meiner Brust, wo alles ruhig und still lag; das Bild Herminas stieg vor mir auf und – ich ging weiter.
Ich gewöhnte mich auch an den Gedanken, meine Schuld zu büßen das ganze Leben hindurch, sie zu bezahlen mit meinem Glücke. Ich blieb einsam.«
»Fühlten Sie sich glücklich?« fragte mit sonderbarer Befangenheit im Gesichte der Sekretär.
Forschend weilte das Auge des Greises auf ihm.
»Ja und nein. Die Arbeit gewährte mir Befriedigung – und ich liebte die Menschen. Aber es kamen Stunden, da die frühere Gewalt der Sehnsucht nach der Geliebten wiederkehrte, ich mich einsam und unglücklich fühlte.
Manchmal, wenn ich zwei glückliche Gatten nebeneinander erblickte, durchzuckte mich Schmerz und ich mußte mich abwenden. Dann sagte ich mir wohl auch, daß mein falscher Stolz, der mich abhielt, später noch einmal die Versöhnung zu versuchen, mich des höchsten Menschenglückes beraubt hatte.
Und Hermina hatte auf mich gewartet. –
Aber ich hatte verzichtet. Gleichwohl stand sie stets über meinem arbeitsamen Leben, wie am Himmel der Stern über dem nachtwandelnden Pilger.«
Er erhob sich hastig: Gute Nacht, Ihr Herren! Dann ging er hinaus. Die andern folgten ihm. Vor ihnen verschwand die hohe Gestalt in der Nacht. Sie vermeinten in den verhallenden Schritten diejenigen des Schicksals zu hören ...
Der Sekretär schlief jene Nacht nicht.
Drei Tage später begegnete ihm der Landammann auf der Straße. Der Edle hatte wie immer den milden, freundlichen Zug im Gesichte.
Als er des jungen Mannes ansichtig wurde, eilte er in sichtbarer Freude auf ihn zu und ergriff seine Hand: »Ich wünsche Ihnen von Herzen Glück zu Ihrer Verlobung! Das freut mich; von dem Unglücke und den Fehlern Anderer soll man lernen. Auf die Verlobungskarte werde ich besonders antworten. Leben Sie wohl für heute!«
Mit feuchten Augen schaute ihm der Glückliche nach: »Immer stiftet er Segen, sein Unglück selbst schlägt Andern zum Heile aus.«