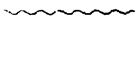|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
An der Straße, die sich unter dem grünen Hügel hinzog, saß auf einem Wegsteine, der aus dem Borde ragte, ein bestaubter Mann. Ueber ihm wölbte sich das dichte Laubdach eines der vielen Birnbäume, die in langer Reihe das Straßenbord beschatteten und am Abend, wenn die Sonne im Westen stand, ihren Schatten auf die ganze Breite der Straße warfen. Auf der andern Seite der Straße, wo ein holperiger Feldweg abzweigte, stand ein hohes steinernes Kreuz mit einem Christus, an dessen obersten Theil, den Kopf darstellend, man nur schwer menschliche Züge entdecken konnte. Der Fremde schien an dem Marterbilde auch keinen Gefallen zu finden, er mochte Schöneres gesehen haben. An dem Sockel war eine verrostete Messingplatte angebracht, deren Inschrift sich mit Noth entziffern ließ. Als der Blick des Mannes darauf fiel, zog ein Lachen über sein Gesicht. »Ob ich wohl noch lesen kann?« Er stand schwerfällig auf zum Kreuze und beugte sich zur Inschrift nieder. »Zum Andenken an ihren selig verstorbenen Mann Leonz Reimann, gestiftet von seiner Wittwe,« – las er langsam, mit Mühe buchstabirend.
Da ließ der Mann das Haupt niedersinken, schlug andächtig ein Kreuz und legte dann einen Augenblick die rechte Hand über die Augen. In seinem Innern mußte eine sonderbare Bewegung vorgehen. Die Gedanken versetzten ihn 20 Jahre zurück in die Zeit, da er den Eltern entlief.
Er hatte ein Kalb, das der Vater ihm zugesprochen, um 16 Batzen zu billig verkauft. Nicht weil er überlistet wurde, schloß er so schlechten Handel ab, sondern weil er das Geld brauchte, um an der Kirchweih, die am folgenden Tag stattfand, theilnehmen zu können. Im Wortwechsel, der sich am Sonntag Morgen darob entspann, hatte ihn der Vater geschlagen. Er wußte nicht, wie es gekommen, er war sinnlos vor Zorn: Sein Arm hatte sich erhoben und hatte den Vater getroffen. Dann kam die Furcht und die Reue. Er entfloh an selbem Morgen kurzwegs, auf die Kilbe verzichtend, das bestellte Mädchen im Stiche lassend. Nicht die Eltern, die er verließ, sondern den Verlust der Kirchweihfreuden fühlte er in jener Zeit am meisten und das Bewußtsein, um jene gekommen zu sein, bereitete ihm damals längere Zeit Aerger.
Jetzt aber empfand er den größern Verlust, den der Eltern, welchen er sich selbst zugefügt. Während er durch ein wildes Leben in hartem Trotze dieses Gefühl bis heute erstickt hatte, schlug es jetzt empor. Die unzerreißbare Bande, die das Kind mit seinen Erzeugern verknüpft, empfand er jetzt, da letztere nicht mehr da.
Der, dessen Gedächtniß das Kreuz geweiht, war sein Vater, die Stifterin, seine Mutter.
Der harte Mann, in dessen Brust sich seit Jahren keine edlen Gefühle geregt hatten, war weich geworden. Müde setzte er sich wieder auf den Stein und ließ den Blick über die Gegend gleiten, die im Glanz der Sonne vor ihm lag.
Die Mittagstunde war vorbei und Landleute kamen des Weges, mit Hacken auf der Schulter, um die Arbeit auf dem Kartoffelfelde, das weiter unten anhob, wieder aufzunehmen. Sie betrachteten neugierig den Mann, wodurch der dem Kreuze gebührenden Observanz ein Schaden erwuchs dadurch, daß diesem gegenüber das sonderbare, die Neugier reizende Individuum sich befand. Sie schlugen die Kreuze nur flüchtig, alle drei zusammenziehend, in die Form des arithmetischen Mal-Zeichens, kehrten sich dabei auch nicht nach ihm zu, sondern wandten sich nach der andern Seite. Der Fremde sah auch gar zu seltsam aus. Das dürre, gebräunte Gesicht war mit einem gewaltigen Schnurrbart bewehrt, der wohl in Handslänge zu beiden Seiten ausgespitzt war und zuletzt nur noch den Fühlern eines Krebses glich. Die grauen, stechenden Augen mit der etwas schiefen Nase geben ihm gleichsam ein spitzbubiges Aussehen – worin zwar seine Absonderlichkeit für die Leute nicht bestand, denn die Mehrzahl der Vorübergehenden konnte in dieser Beziehung nach ihm wie zum Spiegelbilde schauen. – Auch die Kleidung wies ihn als einen Landsfremden aus. Der Hut war ungewöhnlich breitkrämpig, ganz zerknittert und saß schief auf dem Kopfe. Die gelbbraune Leinwand-Joppe war nur über die Schultern geworfen. Eine Weste trug er nicht, so daß das farbene, schmutzige Hemd zum Vorschein kam, und wenn dieses sich öffnete, die haarige Brust. Die Hose war durch eine breite grellrothe Binde festgehalten. Unter den groben Schuhen hervor starrten eine Menge großer Nägelköpfe. Aus der rothen Binde schlossen die Leute, daß der Fremde einer der Italiener sei, deren Aussehen ihnen vom Eisenbahnbaue her noch in Erinnerung stand. Deshalb betrachteten sie den Sitzenden nicht allzufreundlich, da die fremden Männer, die so gern scharlachrothe Tücher trugen, ihnen erhebliche Konkurrenz gemacht hatten und ihr verdientes Geld zum Lande hinaustrugen, statt es, wie die Einheimischen, am Zahltage zum größten Theil zu verschlemmen.
»Ein Polentafresser,« sagte ein vorübergehender jüngerer Bursche zu seinem Begleiter, indem er dem allgemeinen Gefühl Ausdruck gab.
Der Gegenstand der Neugier würdigte aber die Leute, die vom nahen Dorfe her kamen, keiner besondern Aufmerksamkeit. Wohl schaute er bisweilen prüfend in ein Antlitz, als ob er bekannte Züge entdecken wollte. Sein Auge richtete sich den Feldweg hinunter. Eine gute halbe Stunde weiter unten erhoben sich aus grünem Grunde etwa ein dutzend schwarzer Häuser, von Obstbäumen halb verborgen. Unmittelbar hinter dem abgelegenen Weiler zogen sich Weidengebüsche hin. Hohes Riedgras war zu erkennen und man konnte vermuthen, daß dort ein großer Fluß sich hinschlängle. Das dunkle Grün dichter Erlengebüsche verliehen dort der Gegend einen düstern Charakter. Die Häusergruppe machte den Eindruck der Weltverlassenheit. Der Fremde schien mit diesem vertraut zu sein. Aber etwas Anderes machte ihn stutzig, so daß er die Räume seines Gedächtnisses durchlief. Dort, wo helles Grün der Wiesen schimmerte, waren zur Zeit, als er fortzog, Kartoffel- und Getreideäcker gewesen, hohe Bohnenstangen ragten aus Gemüsepflanzungen, und in den Hanfschilden hielten furchtbare Vogelscheuchen Wache, deren schrecklichstes Montirungsstück ein hoher, schwarzer Cylinder war, der ein halbes Jahrhundert vorher von Bauern zum ersten Mal am Hochzeitstage getragen worden war. Dies konnte der Fremde, – nennen wir ihn endlich bei seinem Namen, Joseph Reimann – nicht begreifen. Er wußte eben nichts von dem Umschwung, der seit wenig Jahren durch die Eisenbahnen in der Landwirthschaft stattgefunden, und dem zufolge selbst die zähen Bauern seines Dörfchens den unrentabeln Getreidebau aufgegeben, die Acker in Wiesen umgewandelt hatten, so daß sie jetzt das Brod kaufen mußten, dafür aber für Milch und Butter ein Schönes erhielten. Nun konnte er sich gar nicht dareinfinden, den Boden, auf dem er früher Schollen zerschlagen hatte, als grünen Teppich zu sehen. Deshalb war die Heimat plötzlich etwas Interessantes für ihn geworden, hatte einen hellern Glanz erhalten, den er früher nicht an ihr bemerkt hatte. Das neue Gewand, in dem er sie sah, weckte die Vermuthung, daß auch innerhalb desselben vieles anders geworden sein möchte. Mit größerer Bewegung, als er geglaubt – nicht das Heimweh hatte ihn heimgetrieben, – stand er auf und schritt den Feldweg hinunter der Stelle zu, wo sein junges Leben an das Licht gekommen.
Der Weg, welcher zuerst zwischen einigen Kartoffeläckern hindurchführte, zweigte sich da, wo der Wiesengrund begann, nach links ab und nur ein schmaler Fußweg führte nach Schadenweiler, seinem Ziele zu. Er wandelte zwischen hohem Grase, denn die Heuernte hatte begonnen. In der Nähe der Häuser sah er eine Wiese die längst abgemäht worden. Sechs schwarze Schafe weideten darauf. Das Oertchen mußte sich sehr zu seinem Vortheil verändert haben. Schafe hatte er zu Schadenweiler nie gesehen. Der Fußweg führte nach einem einzelnen Gehöft, das nicht in der Richtung des elterlichen Hauses lag.
Umwege haßte er und trat in das hohe Gras, eine häßliche Spur geknickter Gräser hinterlassend. Damit war er an die Grenze des Obstbaumwaldes getreten und in seinen Schatten, auf welchem goldene Reflexe der Lichtstrahlen, die vereinzelt durch das grüne Gewölbe fielen, in leiser Bewegung zitterten. Nun schimmerten aus geringer Entfernung die Häuser zwischen den Bäumen hindurch. Dort mußte sein Haus liegen! Eine grüne Wildniß in schräger Lage, das Dach des Hauses trat allmählig hervor. Das Stroh war mit einer dichten Moosdecke belegt, aus welcher sich verschiedene Kräuter, darunter sogar die gelben Blüthen des Löwenzahns und die hohen Stengel der Glockenblume, erhoben. Jetzt befand er sich dem Scheunenthore gegenüber, das er wieder erkannte. Noch war der unregelmäßige Kreis, den er mit rother Kreide darauf gezeichnet, um ein Ziel für seine Bolzen zu haben. Auch das Loch unter dem Thore war dasselbe, das er gemacht, um Abends dort hineinschlüpfen zu können, wenn der Zorn des Vaters ihm drohte und er den Hauseingang zu vermeiden Ursache hatte. Gleich schief standen die schwarzen Riegelwände, an welchen, da der Lehm abgefallen, die eingelegten Ruthen sichtbar waren. Alles schwarz, durchräuchert, wie zur Zeit, da er fortgezogen! Beim Anblick der düstern Hütte, die sich seltsam zwischen den grünen Baumkronen ausnahm, sah er unwillkürlich die stolzen Paläste, die in so reinen und edlen Formen aus Lorbeerbüschen und Orangenhainen sich erheben. Ihn schauderte doch ein wenig, in dieser unheimlichen Höhle zu leben. Nun trat er auf den grasigen Weg, der sich vor dem Hause hinzog, um auf der vordern Seite in das Haus zu treten.
Da kam um die Ecke herum in schlürfendem Gange ein alter Mann und lief, ohne den Fremden zu beachten, an ihm vorbei, der Landstraße zu.
»Der Ohm,« sprach dieser, »lebt der denn noch?« Nach seiner Berechnung mußte »Nazi,« wie dessen Name Ignatius abgekürzt wurde, mindestens 90 Jahre alt sein. Kann noch Leben in diesem Körper sein, der so stark gebeugt ist und nur noch Haut und Knochen zu sein scheint und bei dessen Anblick man beinahe fürchtet, das Ganze möchte wie eine Mumie in Staub zusammen fallen? Zwei böse Augen in dem dürren, gelben Gesicht verriethen, daß noch ein kleiner Rest von Kraft und ziemlich viel Willen in dem morschen Körper steckte. Und wie seltsam war der Oheim gekleidet! Lange Rockschösse hingen bis auf den Boden. Die weite Weste mußte früher roth gewesen sein, Joseph erkannte sie als diejenige des Vaters. Große, schmutzige Vatermörder reichten ihm fast bis über die Ohren. Ein hoher Cylinder mit ganz schmalem Rande wackelte auf dem Kopfe und drohte herabzufallen, umsomehr, als der Mann vor Aufregung zitterte. Offenbar hatte er Eile und war ärgerlich, daß er nur langsam vom Flecke kam. Was der alte Mann nur hatte? Der Angekommene hatte nicht Zeit, weiter darüber nachzudenken.
Um die Ecke herum humpelte eine andere Gestalt, eine dicke Frau mit fettem Gesicht, aber welken Zügen und einer reichen Fülle ungeordneten grauen Haares. Sie eilte an ihm vorbei dem alten Manne nach. Sie ging nur wenig schneller als jener und trat auf den Rasen, damit er sie nicht hinter sich höre. Endlich holte sie ihn ein. Mit beiden Händen griff sie nach dem Hute und eilte damit zurück. Der Stock des Alten fuhr durch die Luft, ohne sie zu treffen. Eine Weile stand Nazi da und erholte keuchend Athem, dann humpelte er keuchend der Frau nach.
Verwundert hatte Joseph Reimann den Vorgang angesehen. Als die Frau bei ihm ankam, trat er auf sie zu und streckte ihr die Hand hin. Ueberrascht sah sie ihn an, beinahe erschreckt und unwillkürlich den Hut zum Schutze vorhaltend.
»Base, ich bin Joseph.«
»Du gleichest dem Leonz,« sagte sie, ihm die Hand reichend und ohne den Gesichtsausdruck im Geringsten zu verändern. »Komm herein!« Der alte Mann war herangekommen und hob den Stock, um sie zu schlagen. Da fiel sein Auge auf den Fremden und der Stock sank nieder.
»Joseph!« sagte die Schwester und die beiden reichten sich die Hände. »So bist Du wieder da! Bist Du weit fort gewesen?« So fragte der Erboste, als wären seit des Neffen Flucht nicht 20 Jahre, sondern 8 Tage verflossen. Dann schien er über etwas nachzudenken und bewegte die Lippen. »Kannst Du jassen?« fragte er plötzlich. Augenscheinlich freute er sich, in dem Ankömmling einen neuen Partner zu erhalten und diese Frage war das Resultat seines Nachdenkens. Joseph lachte. »Ich werde es wohl wieder lernen. Der heilige Vater zu Rom duldete keine Karten und da werde ich's vergessen haben. Aber macht, daß ich endlich etwas für meinen hungrigen Magen bekomme!«
Die drei traten durch die allerorts geschwärzte Küche in die niedere Stube. Auch da alles morsch und schwarz, vor Alter riechend. Ein beengender Modergeruch umfing den Heimgekehrten. Als er eintrat, stand eine Frau, die strickend am Fenster gesessen war, auf und reichte ihm mit lebhafter Bewegung die Hand: »So kommst Du endlich, Joseph, Du hast so lange gewartet! Wie bist Du groß geworden!« Zugleich lag ein Strahl sonnigen Glücks auf ihrem Gesichte. Aber als ob sie schon zu viel gesagt, setzte sie sich schon wieder, nahm den Strumpf vom Gesimse und arbeitete fort, ohne indessen den leuchtenden Blick von Joseph zu wenden. Der freundliche Empfang that ihm wohl.
Dann aber durchfuhr ihn sichtbar ein Schrecken. »Lebt die auch noch?« fragte er, auf die Gestalt zeigend, die unter der Thüre stand, welche in die Nebenkammer führte. Offenbar hatte er vorausgesetzt, sie nicht mehr zu finden. Es war eine Frau, die nur dürftig mit dem Allernothwendigsten bekleidet war und deren in's graue spielende Haare in wilder Unordnung über das Gesicht fielen, das noch leise Spuren früherer Schönheit verrieth, aber jetzt schrecklich entstellt war. Sie lachte. Als Joseph vor sie hintrat, lachte sie lauter und verzerrte das Gesicht. Es war ein entsetzliches Lachen, das keine Seele hatte, sondern nur den trockenen Ton. Sie war irrsinnig und lachte über ihre schönen Wahnvorstellungen.
Unterdessen hatte die erste Frau eine gefüllte Flasche und ein Glas sammt dem Brod auf den Tisch gelegt. Joseph schenkte ein und trank.
»Brr!« rief er, wie sauer! Das ist nicht Sizilianer. Das macht einen frieren im Sommer!« »Nun,« begütigte er, als die Sitzende ob des derben Ausrufes zusammenschrack, »für Most ist das Ding ganz gut. Ich bin nur nicht mehr daran gewöhnt. Da d'rin, er wies gegen Süden, ist ein Wein, der gießt Feuer in die Adern.«
Die Frau hatte geschlagene Eier gebracht und er hatte in kurzer Zeit Alles gegessen und in der Flasche war nur noch ein geringer Rest.
Sich behaglich dehnend, fragte er: »Kathri, warum bist Du dem Nazi nachgelaufen und hast ihm den Cylinder vom Kopfe genommen?«
In aufbegehrendem Tone erzählte sie ihm, daß der Alte zum Notar habe gehen wollen, um das Testament zu machen zu Gunsten eines Vetters, der ihm alle Neujahr ein Päckchen schlechten Tabaks schenke, »so schlecht wie Heublumen,« fügte sie hinzu. Das komme aber fast alle Tage vor. Wenn er beim Jasse verliere, so ziehe er die rothe Weste an, nehme Cylinder und Stock, um in fauchendem Zorne nach dem Bezirkshauptorte zu gehen. Sie lasse ihn eine Strecke weit ziehen und raube ihm sodann den Hut; denn ohne den Cylinder gehe er um alle Welt nicht fort. Und bald sei er wieder zufrieden.
Joseph lachte ob des regelmäßigen Manövers. »Dann schadet es auch nichts.«
Ernster werdend erkundigte er sich nach den Eltern und erfuhr dann von Lisbeth, der Strickenden, die Vorgänge seit seiner Flucht. Ihr Bericht wurde bisweilen in scheltender Weise von Katharina ergänzt.
Als er an jenem Sonntagsmorgen mit seinem Bündel vom Hause weg gegen den Fluß gesprungen sei, habe der Vater gedroht, ihn bei der Rückkehr todt zu schlagen. Als er aber am dritten Tage noch nicht zurückgekommen sei, habe die Mutter zu weinen angefangen, meinend, er sei in den Fluß gegangen und sei der Fische Speise. Lange habe sie geschrieen: »Mein Einziger so, so! womit sie sagen wollte, daß es ihr sehr leid thue deshalb, weil er in verbrecherischer Weise sich selbst das Leben genommen und ohne geistlichen Trost abgegangen sei. – Wir haben 38 Sester Aepfel verkauft und für alles Geld Messen lesen lassen,« schaltete sie ein.
Von jener Zeit an sei der Friede zwischen Vater und Mutter zu Ende gewesen. Die Mutter sei immer am Vater mit Vorwürfen gelegen und sie hätten oft Streit gehabt, wobei sie einander geschlagen. Nicht lange hernach sei Krieg ausgebrochen im Lande. Die Ketzer unten im Thale hätten beschlossen, die Kutten abzuschaffen, und als solches die guten Brüder im Kloster nicht thun wollten, seien sie mit Gewehr und Säbel gekommen, so daß die Patres ihre Kutten hoben und fürbas gingen in ein andres Land. In der wilden Unordnung, die hierauf im Kloster geherrscht, sei viel zerstört und beschädigt worden. In den Kellern sei der Wein in rothen dicken Strahlen auf den Boden gelaufen. Die Umwohner des Klosters sollen auch manches auf die Seite gebracht haben. Auch der Vater habe einen guten Griff machen wollen. Als er mit einem großen Käse auf der Schulter entweichen gewollt, sei ihm ein Soldat gegenübergestanden und habe zu schießen gedroht. Da habe ihm der Vater den Käse an den Kopf geworfen, daß er nicht mehr aufstand und hernach dem Arzte unter die Hände kam. Da seien andere gekommen und hätten den Vater, da er sich gewehrt, elend todtgeschlagen. Auf dem Klosterkirchhof liege er begraben.
Darnach habe die Mutter noch mehr geschrieen, darüber, daß ihr Mann im Unfrieden von ihr geschieden und eines so plötzlichen, elenden Todes verblichen, daß er nicht einmal mit den heiligen Sakramenten versehen war. Sie sei dann stiller und schwächer geworden. Ein Jahr bevor sie gestorben, habe sie sich nach schwerem Kampfe entschlossen, das viele Geld zu opfern und ein Kreuz zu stiften zum Andenken an ihren unselig verstorbenen Mann.
»Es steht am Kreuzweg, oben an der Landstraße,« bemerkte sie. »Ich hab's gesehen,« nickte Joseph.
Vor ihrem Ende habe sie aber noch Zweifel an die Wirkung des Kreuzes bekommen, weil dieses, da keine andern zu beschaffen gewesen waren, aus reformirten Steinen gebaut worden war, die man unten im Thale geholt hatte.
Die Erzählerin schlug ein Kreuz und Joseph auch.
»Nun ist es gut, daß Du heimgekommen bist. Es gibt so viele Aepfel dieses Jahr, daß wir wieder fremde Leute anstellen müßten, um sie zu versorgen und zu mosten. Es kostet so viel Geld.«
Der Angeredete war durch die Erzählung erschüttert worden. Er suchte in sich das Gedächtniß der Mutter herzustellen, aber das Bild war ein verblaßtes. Die Vorwürfe, die sich zu regen begonnen hatten, wurden nun durch die letzte Bemerkung der Base erstickt.
»Nun erzähle Du! Du siehst so fremdländisch aus. Gewiß hast Du viel erlebt.«
»Ja, ich habe viel erlebt,« begann er in rennomirendem Tone, »ich glaubte nicht mehr, daß ich in dieses Nest komme. Das wäre mir nicht im Traume eingefallen, in das Wasser zu springen. Ich eilte den Fluß hinauf, der Rigi zu, bis ich dahin kam, wo er von den Bergen in den vielarmigen See fließt. Dort war mein Kilbigeld zu Ende und ich begann zu betteln. Wo die Straße aufsteigt nach der Höhe des Gebirges, kam ich einem Reisenden nach, der unter seinem Tornister schwitzte. Ich anerbot mich, ihm denselben zu tragen, wenn er mich unterhalten wolle. »Ja, sagte er, aber es geht über das Gebirge in ein fremdes Land, dessen Sprache Du nicht verstehst.«
»Es ist mir auch recht,« entgegnete ich und wir zogen nebeneinander über das Gebirge, wo es nicht so heiß war, als damals da unten. Der Herr sprach ein anderes Deutsch als wir reden, ich verstand ihn kaum. Er war auch ein wirklicher Tedesko, wie der Italiener sagt. Wo wir durchzogen, immer blieb er wieder stecken, meinte, das wäre ein Motiv und fing an in ein Buch zu zeichnen, teufelsmäßig schön, ganz ähnlich. Item, ich hatte es gut und es that mir leid, als er mich ablöhnte, sobald wir auf der andern Seite des Gebirges angekommen waren, da wo die vielen Seen und die schönen Gärten mit den Lorbeerbüschen beginnen; wo auch der Wein feuriger ist. Ich bettelte mich weiter bis in die Ebene, wo die Felder unter Wasser stehen. Das ist die Lombardei. Und in Milano, einer Stadt, die größer ist und mehr Häuser hat, als unser ganze Kanton, wo auch eine Kirche ist, die der Herrgott gebaut haben muß, so groß und schön ist sie, dort traf ich einen Landsmann aus Unterwalden. Der überredete mich, Soldat seiner Heiligkeit des Papstes zu werden. Wir wanderten in die ewige Stadt, wie die Leute sagen, nach Rom und ich stand vor dem Vatikan, so heißt der Palast des Papstes, Wache, bis ich fortzog.«
»Warum bist Du denn fort?« fragte Lisbeth.
»Man sagte, der Thron des heiligen Vaters wackle, auch war er, wahrscheinlich aus diesem Grunde, oft böse und ungnädig, besonders, wenn er wieder eine »Enzianklee« schrieb. Das ist ein großer Brief, worin er der Welt seine Meinung sagt. Auch war ich der vielen Läuse und Wanzen überdrüssig und nahm den Abschied und da bin ich nun!«
Der Dolchstich, den er einem Kameraden versetzt und dessen kleinen Schatz, der sich in seine Tasche verbarg, was auch Ursache seiner Flucht war, verschwieg er und auch die kleine Unruhe, die er zu unterst in seinem weiten Gewissen empfand.
»Du bist also beim heiligen Vater gewesen, fragte die Neugierige? Hast Du ihn denn wirklich gesehen?«
»Natürlich habe ich das! Er hat uns ja alle Tage seinen Segen gegeben, wenn er an uns vorbeiging.«
»Ist es der da?« fragte sie, auf ein geschwärztes Bild eines Papstes oben an der Wand hinzeigend.
»Nein, das ist ein anderer, der schon lange gestorben ist.«
»Ist denn nicht immer der Gleiche?«
»Nein,« lachte er, »die Päpste sind auch Menschen und sterben, wenn ihre Zeit da ist.«
Weder Katharina noch Nazi hatten dem Gespräche zugehört. Erstere saß am Spinnrade und netzte fleißig die Finger an der durch diese Arbeit herabgezehrten Unterlippe. Der letztere saß auf der Ofenbank so stark gebeugt, daß der Kopf beinahe zwischen die Kniee kam. Hie und da stieg ein schwaches Rauchwölklein auf. Wahrhaftig, der Einundneunzigjährige rauchte! Die Spitze des billigen, irdenen Pfeifchens war bis nahe an den Kopf abgebrochen, so daß der Alte die Lippen spitzen mußte, um es in dem zahnlosen Munde halten zu können.
Joseph kam sich im Vaterhause fremd vor. Wie sollte er es in diesem Neste aushalten, wie die Zeit verbringen? Mit dem Ohm wie mit der Base war keine Unterhaltung zu führen. Der erste hatte kein Gedächtniß mehr und die andere öffnete den Mund nur, um zu schimpfen. Lisbeth war zu schüchtern und auch zu beschränkt, wie ihm ihre Frage bewiesen hatte. Und erst die Irrsinnige, seine Schwester! Als sie in's Haus gebracht worden, kurze Zeit, bevor er sich davon gemacht, hatte er sie gefürchtet, obschon sie damals weniger furchterregend ausgesehen und der Irrsinn nicht so deutlich auf ihrem Gesichte gestanden hatte wie jetzt. Einen Augenblick dachte er daran, sich sofort wieder aus dem Staube zu machen und, da es Sommerszeit war, sein Wanderleben fortzusetzen. Aber er besaß ja noch Geld und zudem freute er sich darauf, vor seinen ehemaligen Kameraden groß zu thun mit seinen Erlebnissen und mit den Brocken der fremden Sprache, die er sich angeeignet hatte. Eine Zeit lang wenigstens den Versuch zu machen, konnte nicht schaden.
Die Mitte des Nachmittags war gekommen. Er ging, um im Dörfchen Umschau zu halten. Außer der Umwandlung des Ackergrundes in Wieswachs war keine Veränderung zu bemerken. Die Häuser waren so verlottert wie früher. Er traf die Leute beim Vesperbrode, wobei sie wacker Aepfelmost tranken. Sie kannten ihn nicht mehr und betrachteten ihn seiner sonderbaren Kleidung wegen mit mißtrauischen Blicken. Doch bald erneuerten sich die Bekanntschaften mit Männern seines Alters, mit denen er seine bemerkenswerthesten Streiche verübt hatte. Sie waren anders, als die Männer zu der Zeit, da er fortgegangen. Sie waren besser gekleidet als jene und hatten ein hurtiges Mundwerk, trotz Waschweibern, das nie stille stand. Auch Witze wurden gemacht, allerdings unfläthige, doch es war immerhin eine Unterhaltung, die man früher im Oertchen vergebens gesucht hätte.
Diese Veränderung des Charakters der jüngern Generation von Schadenweiler war eine Folge der genannten Umänderung in den Bodenverhältnissen. Die Arbeit war um Vieles geringer geworden. Die Bauern mußten das Vieh besorgen, zwei Mal im Jahre kam die Heuernte und damit war ihre Arbeit beendet, so daß ihnen viel Zeit zur Faulenzerei blieb. Da sie nicht mehr mit dem Erdreiche in Berührung kamen, sahen ihre Kleider reinlicher aus und deswegen waren die jungen Schadenweiler auch appetitlicher anzusehen als früher.
Aus Bauern waren sie meistentheils Viehhändler geworden, d. h. sie trieben irgend einen Handel, sei es mit Großvieh, auch nur Kälbern, Schafen, Ziegen oder Kaninchen. Gehandelt mußte sein, denn das war ihre Leidenschaft geworden. Hatten sie nichts zu tauschen oder zu verkaufen, was sie unglücklich machte, so gingen sie gleichwohl auf die Viehmärkte, um wenigstens Käufe anzusehen und dabei mitzurathen. Oder sie ließen sich von einem Andern für ein Trinkgeld als »Dolmetscher« anstellen, wie sie sagten. Die Aufgabe dieser »Dolmetscher« war, auf den Märkten zu thun, als ob sie ein Stück Vieh kaufen wollten, damit Andere zum Kaufe verlockt wurden. Immer mußten sie des Händlers Waare übermäßig loben und dabei thun, als kennten sie ihn nicht, oder wären sogar sein Gegner. Ihre Redensart war denn: Ein schlechter Kerl ist er, aber schönes Vieh hat er, das muß der Neid ihm lassen. Sie machten sich an ein Bäuerlein und zischelten ihm mancherlei in's Ohr, um es zum Kaufe zu verleiten: So gute Gelegenheit sollte es sich nicht entgehen lassen oder es wäre ein Narr. Es solle nur erst bieten, sie werden ihm helfen, den Händler über die Löffel zu balbiren, d. h. wenn es sich ein Trinkgeld nicht reuen lasse, denn sie meinen es gut mit ihm. Sie seien ehrliche Kerle, es könne nur dem und dem nachfragen, dabei gaben sie ihm einen andern Namen an. Wurde dann der Handel abgeschlossen, so war das Bäuerlein geprellt. Die Kuh gab nur an zwei Strichen Milch oder wenigstens nicht so viel, als ihr volles Euter versprochen hatte, da sie zwei Tage vom Händler nicht mehr gemolken worden war. Den Händler konnte er nicht fassen und den Verführer nicht ausfindig machen, der sein und des Händlers Trinkgeld vergnüglich eingesteckt hatte.
Die Männer von Schadenweiler gelten überall für verschmitzte »Dolmetscher« und waren begehrt. Sie verstanden es ausgezeichnet, zu betrügen. Dabei pochten sie immer auf ihre bekannte Ehrlichkeit, während fast in jedem Orte des Landes ein betrogener Bauer ihnen fluchte und sie sich darauf gefaßt machen mußten, erkannt und zur Rede gestellt zu werden. Doch mit groben Titulaturen war ihnen nicht beizukommen, diese schüttelten sie ab, wie der Landstreicher die Läuse. Zeigten sie sich auch einmal beleidigt, so war dies Verstellung und sie zogen den Beleidiger nicht vor Gericht. Ohne diese nützliche Eigenschaft hätten sie sich eine Menge von Injurienprozessen auf den Hals geladen. Es gab in Schadenweiler überhaupt keine Injurie. So waren seine Bewohner eine eigentliche Landplage, da Jeder ein »Dolmetsch« war, sobald er nichts zu verhandeln oder zu tauschen hatte und er sich nicht herabließ, mit Lumpen oder Zündhölzchen zu hausiren, welches Geschäft den gemeinern ihrer Species zufiel.
Daher ist es auch zu begreifen, wenn Joseph sich darüber verwunderte, ihre Zungen gelöst zu finden. Früher war das anders gewesen. Zur Zeit, als der Bann noch Ackergrund war, waren von ihnen die Worte nicht wohlfeil zu bekommen gewesen. Von jener Art waren noch die Väter der jüngern Generation, welche sich durch die Zeit nicht hatten kultiviren lassen. In ihrem bäuerischen Egoismus hatten sie sich um nichts weiter als um ihre eigenen Angelegenheiten bekümmert. Deshalb waren sie auch um ein Jahrhundert zurückgeblieben. Als ob sie zeitlebens in einem Urwalde gelebt hätten, abgeschnitten von allem menschlichen Leben, hatten sie keine Ahnung von dem, was die Welt bewegte. Der Eisenbahnzug war ihnen ein Ungethüm, dem sie sich nicht anvertrauten. So führten sie ein fast unbewußtes Leben. Dem modernen Menschen mochten sie wie Druiden aus den germanischen Wäldern erscheinen. Aber nicht, daß ihr Leben ein idyllisches gewesen wäre, sondern es war ein rauhes, wildes, aller Freuden baares. Knorrigen, verbissenen Charakters und verbitterten, freudlosen Herzens schlugen sie auf die Schollen ein. Und die Hausbewohner schlugen einander noch im hohen Alter auf die Köpfe. Nicht daß sie deßwegen keine Liebe zu einander gefühlt hätten! Aber diese ruhte im tiefsten Grunde des Herzens als ein Glühwürmchen, das nur in außergewöhnlichen Fällen sein Licht zeigte. Dann war diese Liebe, die sich sträubte, an's Tageslicht zu kommen, in ihrem naiven Trotze etwas Rührendes.
Vor der Zeit von der schweren Arbeit gekrümmt, erreichten sie dennoch ein hohes Alter. Da sie sich ungern verheiratheten, kam es nicht selten vor, daß mehrere Geschwister ledig beisammen blieben und ein Menschenalter hindurch ihr Heimwesen besorgten, so daß sie sich bei ihrer Sparsamkeit ein artiges Vermögen zusammenscharrten. So hatten es Josephs Basen und der Oheim gehalten, die bei seinem Vater geblieben waren.
Diejenigen Schadenweiler Bauern, welche noch über Ackergrund gestolpert waren, hatten den genannten Charakter und redeten, da ihr Wortschatz ein ganz geringer war, nur wenig und dieses unbeholfen. Auch gegen das Heirathen verhielten sie sich konservativ. In Allem dem war die junge Generation der Viehhändler und Hausirer das Gegentheil. Sie kamen in Ausübung ihres Berufes in die Welt hinaus und brachten Nachricht über Dinge nach Hause, von denen sich die Alten nichts hätten träumen lassen. Auch klebte ihnen äußerlich ein bischen Aufklärung an. Auch war, wie oben bemerkt, ihre Zunge sehr geläufig. Und, ihrer höhern Kultur entsprechend, waren sie gegen das Heirathen nicht spröde, sondern griffen früh schon und keck nach einem Weibsbilde, so daß sie bald eine ziemliche Schaar Kinder hatten, welche sie nicht eben zart behandelten. Dadurch waren die Geschwisterfamilien auf den Aussterbe-Etat gesetzt.
Da es bei Einigen schon vorgekommen war, daß sie ihr Geld in unglücklichen Spekulationen verloren hatten, so fielen ihre Kinder der Gemeinde zur Last. Deren Eltern zogen dann mit einem Karren, über den ein weißes Tuch gespannt war, in der Welt herum als Lumpensammler, Hausirer oder Schirmflicker und schickten von Zeit zu Zeit der Gemeinde wieder ein Kind nach Hause. Dadurch wurde die Armenlast des Oertchens immer größer und die großen Steuern für die Bewohner beinahe unerschwinglich und das ganze Gemeinwesen verkam nach und nach. Dies alles war die Folge der Revolution, welche sie mit ihrem Grund und Boden vorgenommen hatten. Anfänglich hatte Joseph an dem veränderten Charakter der jungen Schadenweiler seinen Gefallen. Er fand seine Kurzweil dabei und legte ebenfalls los und erzählte von den Streichen der päpstlichen Gardisten, wobei er immer der Hauptkerl war. Es schmeichelte ihm, angestaunt zu werden als Einer, der so weit draußen in der Welt gewesen sei und sogar den Heiligen Vater gesehen habe. Als aber sein Anekdotenschatz erschöpft war, kam seine verschlossene Natur wieder zu ihrem Recht. Er hatte sich nicht verändert und gehörte seinem Wesen nach mehr zu den alten Schadenweilern. Als er in der Säulenhalle des Vatikans Wache gestanden war, hatte er wenig geredet, sondern nur allerlei Gedanken und die fremden Erscheinungen durch seinen Kopf gehen lassen. Er hatte fast immer seinen zurückgelegten Sold überschlagen und die dunkle Vorstellung gehabt, daß er einst nach einem rechten Glücksfalle als Herr in die Heimat zu den Eltern zurückkehren und als ebenbürtiger Mann sich an ihre Seite stellen werde. So waren ihm die Jahre wie im Traume vergangen und an deren Ende erschien ihm seine Abwesenheit vom Hause ganz kurz, bis die Ereignisse, die er vernahm, sie wieder vergrößerten. Redselig war er nicht geworden, da er stets ein mürrischer, trotziger Geselle gewesen war, der mit Niemanden Freundschaft hielt. Der Glücksfall war dann eingetreten, als er mit einem Kameraden, der gleich ihm vom Hause sich geflüchtet hatte, Streit bekommen und ihn, nachdem er ihn niedergestoßen, seines ersparten Geldes beraubt hatte. Gewissensbisse darüber empfand er nicht, da er sein Verfahren für gerechtfertigt hielt.
Bald war ihm das unaufhörliche Schwadroniren der Genossen zuwider. Auch verlor sich der Respekt, den er anfänglich vor ihnen gehabt hatte, als er sah, daß hinter ihren Prahlereien nicht viel steckte und daß sie eigentlich nicht viel mehr als Lumpazi waren, die vor dem Konkurse standen. Diese Wahrnehmung, daß die jüngern Schadenweiler ihren Worten nicht mit blankem Gelde Nachdruck zu geben vermochten, bewog ihn, sich allmählig von ihnen zu sondern und seine eigenen Wege zu gehen oder vielmehr, sich mit seinen seltsamen Hausgenossen zu begnügen.
Er blieb also zu Hause. Da er wenig redete, mochten ihn alle gern leiden. Lisbeth erwies ihm manchen kleinern Liebesdienst und versah ihn vor Allem mit schönen, weißen Socken und stellte ihm ein Paar Pantoffeln hin, die für sie zu schön schienen, wofür er ihr auf ihre neugierigen Fragen geduldig Antwort gab. Auch fütterten sie ihn auf's Beste, so daß er sich nach und nach ganz behaglich fühlte und sich mit den finstern Wänden aussöhnte.
In den ersten Tagen schlenderte er umher und suchte die Orte auf, die aus irgend einem Grunde sich in seinem Gedächtnisse festgesetzt hatten. Dann fing er an, am Hause herumzuflicken, die Löcher in den Lehmwänden wieder auszubessern und da und dort einen Laden anzunageln. Diese kleinen Hantirungen gewannen ihm die Neigung der alten Leute vollends. Selbst der alte Ohm zeigte einen Schimmer von Wohlwollen und Katharina fauchte in seiner Gegenwart weniger. Er brachte die Heuernte ein, so daß sie nicht wie sonst zuletzt fertig waren. Damit war aber auch für einige Zeit die Arbeit abgethan und er langweilte sich. Dann erinnerte er sich an seine frühern Künste und strich dem Strome nach, um irgend etwas, was daher geschwommen kam, aufzufischen. Oder er angelte, setzte Schlingen und fieng manchen schönen Aal, den er entweder verkaufte oder sich selbst wohl schmecken ließ. Nach und nach paßte er auch seine Kleider denjenigen der Uebrigen an. Nur die rothe Binde behielt er bei.
Wenn Regenwetter eintrat, so suchte er vergebens die Langeweile mit einer großen Menge Mostes zu ertränken. In diesem Falle kam er der Aufforderung Nazi's nach, mit ihm zu jassen. Dieser nahm dann vom Fenstergesimse ein schmutziges Kartenspiel, das schon viele Jahre gebraucht worden und dessen Bilder kaum noch zu erkennen waren, und legte zwei große Stücke Kreide auf den Tisch, auf welchen er die Striche malte. Das Spiel war aber die größte Geduldprobe, weil der alte Mann vergeßlich war und stets die Zahlen des Partners bestritt, so daß dieser ihm mitten im Spiel dessen Verlauf von Anfang wieder entwickeln und vorrechnen mußte, womit sich denn der Ohm zuletzt zufrieden gab, aber nicht überzeugt zu sein schien und allerlei Unverständliches brummte. Hinwiederum ertappte Joseph den Gegner auf scheinbaren Vergeßlichkeiten, daß er sich entweder überzählt oder einen Zwanziger an die Stelle der Fünfziger geschrieben hatte. Die Richtigstellung des Fehlers erforderte immer eine längere Auseinandersetzung, die ärgerlich war. Nazi spielte gut und schlug Joseph öfters, so daß diesen das Spiel ziemlich theuer zu stehen kam; denn jener knusperte aus den Westentäschchen ein ordentliches Häufchen Geld zusammen und legte es neben sich. Joseph blieb nichts anderes übrig, als dem Beispiele zu folgen. Da der Einsatz ziemlich hoch war, so hatte einer der Spielenden bald einen fühlbaren Verlust zu verzeichnen. Verlor der Oheim, so war sein Zorn nicht zu erkennen, er schlug auf den Tisch und Joseph mußte fürchten, daß der Alte wieder das Testament zu machen versuchen werde. Deßhalb schob er ihm den Gewinn wieder zu, den der Andere vergnügt einsteckte. Josephs Geld aber wanderte in des Alten Westentäschchen und kam nicht wieder zum Vorschein. Als ihm der Verlust empfindlich wurde, lehnte er das Spiel ab und überließ es dem Oheim und der Base, denen es Bedürfniß war, miteinander zu zanken und die es auch weidlich thaten.
Er versuchte auch in dem nächsten Dorfe, mit welchem Schadenweiler durch einzelne Verwaltungszweige vereinigt war, Bekanntschaften anzuknüpfen. Dort waren die Leute aber schon vornehm und verachteten die Schadenweiler Händler und Dolmetscher, was sie aber nicht verhinderte, letztere für ihre Zwecke zu verwenden. Ihm brachten sie zwar Interesse entgegen, weil sie Kurzweil von ihm erwarteten. Als er aber den Mund nicht öffnete und überhaupt als Einen der Sorte der alten Schadenweiler sich auswies, welche sie vom hohen Standpunkte ihrer Bildung aus verachteten, bekümmerten sie sich nicht mehr um ihn. Joseph fühlte sich bei ihrer Vornehmthuerei auch nicht behaglich. Sie nannten sich gegenseitig »Herr«, während die Schadenweiler ihre Freundschafts- und Kosenamen aus der Menagerie, zur Hauptsache von den Bewohnern ihrer Ställe genommen hatten. Jeder führte einen stolzen Titel, den man ihm an den »Herrn« anhängen mußte, wollte man es nicht mit ihm verderben, und diese Titulaturen umfaßten alle, vom Herrn Pfarrer bis zum »Herrn« Schärmauser. Da war ein »Herr« Ammann, 5-6 Herren Alt-Ammänner, (denn die Aemter wechselten schnell, daß Viele des Titels theilhaftig werden konnten), ferner ein »Herr« Schulgutsverwalter und 3 Alt-Seckelmeister, ein »Herr« Polizeiverwalter und mehrere gewesene, daneben ein paar »Herren Gemeinderäthe« und Alt-Gemeinderäthe. Es war schwierig, eines Jeden Titel zu behalten und ihn nicht zu verletzen, denn ihren höhern Rang konnte man ihnen äußerlich nicht ansehen.
Es blieb also Joseph nichts anderes übrig, als seinen einsamen Weg zu gehen und dem Flusse entlang zu streifen, oder an dessen Ufer zu liegen und zu warten, bis die Angelschnur zuckte, von einem zappelnden Fische gezogen, den er in weitem Bogen in den jungen Erlenschlag zurückschleuderte und ihm sodann das Genick brach.
Als zu Hause im Verlaufe der Gespräche gewisse Dinge berührt wurden, suchte er bisweilen die alten Leute zu veranlassen, sich weiter darüber auszubreiten. Da sie aber an jenen Dingen keine tiefere Bedeutung hatten wahrnehmen können, so war ihnen nur das Gedächtniß des Faktums geblieben, ohne daß sie eine Ahnung von seinen Ursachen und Folgen hatten, auch hatten für sie die Ereignisse keinen Zusammenhang und so konnten sie auch nichts erzählen.
Aber der 91jährige Nazi?
Wie viel war vorgefallen seit der Zeit, da dieser Mensch das Licht der Welt erblickte! Wie viel mußte er zu erzählen haben, ein lebendes Geschichtsbuch!
Der große Korse stieg auf wie ein Meteor und erlosch. Das Menschenwesen sah die trüben Zeiten der Reaktion, sah die Revolutionen. Es machte in unserm Lande die Putsche mit und verbarg sich, als der schweizerische Bruderkrieg in seine Gegend kam. Reiche erhoben sich, während andere auseinanderfielen. – Keine Spur mehr von Allem, Alles erloschen!
Vor einigen Jahren noch war es anders gewesen. Er erzählte damals noch aus den Ereignissen seines langen Lebens. Was er erzählte?
Im Hungerjahr 1817 galt ein Sester Weißrüben 22 Batzen. Ein Laib Brod kostete so viel als jetzt ein Zentner Mehl. Im Jahre 1818 mußten sie 2 Kühe abthun und erlitten großen Schaden. Bei einem Zuge in den reformirten Landestheil wurde er in einem Städtchen (der Name war ihm entfallen) zu reichen Leuten einquartirt. Zum Frühstück erhielt er (zum ersten Male im Leben) Kaffee, Zucker und Käse. Beim Mittagessen kamen zur Suppe noch Rindfleisch, Schinken, Braten und am Schlusse Backwerk. Noch andere Fälle erzählte er, wo er es gut getroffen und etwas Rechtes zu essen bekommen hatte. Man sah die Gerichte an sich vorüberziehen, die in jeder Zeit beliebt waren und die durch andere ersetzt wurden – eine vollständige Kochgeschichte.
So hatte also der Mensch von All dem, was die Welt bewegte und über die Erde rauschte, nichts gesehen. Wohl sah er fremde Heersäulen im Lande und hörte so manchmal die Sturmglocken heulen. Warum? Darüber hatte er nie nachgedacht. Er zog einst mit in einen der fröhlichen Putsche, die in den 30iger und 40iger Jahren an der Tagesordnung waren. Nie hatte er gewußt, warum er mitgegangen, er war der allgemeinen Bewegung gefolgt. Er war wieder heimgekehrt und damit war die Bewegung in seinem Leben dahingegangen, wie die Welle des Wasserspiegels sich wieder glättet – keine Spur und kein Gedächtniß. Er war ein kleines Rad, das sich dreht, ohne von der großen Maschine, der es angehört und in deren Dienst es steht, eine Ahnung zu haben. Einzig die mechanische Lebensgewohnheit, ein bischen böser Wille und die Kunst des Jassens – die größte der Schadenweiler – war ihm geblieben, dazu noch deren Fertigkeit, einen Andern zu übervorteilen.
Gerade diese Gedanken über den alten Oheim, der nicht mehr in die helle Sonne paßte, sondern als bestes Kabinetstück zu den übrigen Möbeln der schwarzen Antiquitätenkammer, machte sich Joseph nicht. Aber er fühlte sich nicht ganz behaglich diesem Menschen gegenüber, bei dem auch gar nichts zu suchen war, weder Auskunft über Hausgeschäfte, noch über Dinge, die an ihm vorbeigegangen waren und ihn berührt hatten, der einzig noch seine Münzen und den Wert der einzelnen Karten kannte und dessen gutes Spiel und Schachzüge nicht mehr eine Folge des Denkens, sondern nur der Gewohnheit waren.
Katharina, etliche Jahre jünger als Nazi, war für ihr Alter noch ziemlich beweglich mit Geist und Zunge. Sie war aber unfreundlichen Gemütes und sprach fast kein ruhiges Wort, sondern immer in polternder Weise. Eine Unterhaltung war mit ihr nicht zu führen. Eine solche war nur möglich zwischen ihr und dem Oheim, zwar immer streitartig, doch nicht so böse gemeint, aber ihnen zum Bedürfniß geworden. Was sonst an Stimmungen über die Seele eines Menschenkindes geht, das nicht in so absoluter Einsamkeit seine Tage verlebt, hatte sie nicht erfahren. Arbeit hatte ihr geringes Denken fortwährend in Anspruch genommen von Jugend auf und der Grundton ihres Herzens war immer der Mißmuth gewesen. Doch einmal hatte sie beinahe gefühlt, was Liebe ist.
Es war zur Zeit, als die Spinnstubenabende noch Sitte waren. Die Mädchen und jungen Burschen versammelten sich an den Winterabenden in der niedern, aber vom mächtigen Ofen angenehm durchwärmten Stube eines der geschwärzten Häuser. Der Versammlungsort wechselte. Während die Mädchen spannen, rauchten die Burschen ihre Heublumen aus billigen Tabakpfeifen und verkürzten den Mädchen die Zeit durch Erzählen von allerhand Schnurren und Witzen. In Rauch und Kienholzdampf gehüllt erhoben sie dann manchmal ein lang andauerndes Gelächter. Hinter den Burschen versteckt auf dem Ofen saßen die schmutzigen Jungen und sogen in ihre dumpfen Seelen manchen unfläthigen Witz und manche unzweideutige Anspielung, die in Schadenweiler Neckerei hieß. Beim Nachhausegehen mußten die Burschen den Mädchen die Spinnräder tragen. Einst begegnete Kathri, die nicht viel auf den Burschen hielt, etwas Seltsames.
Der Begleiter, ein stiller, scheinbar schüchterner Mensch, stellte das Spinnrad auf den Boden – die Nacht und die Einsamkeit machten ihm Muth – schlug plötzlich den Arm um ihren Hals und drückte ihr Gesicht an das seinige und flehte: »Kathri, willst Du mich gern haben?« Und ihr war's so seltsam in der stillen Nacht. Ein fremdes, angenehmes Gefühl durchrann ihren Körper, sie war in süßer Betäubung und konnte sich nicht wehren. Der Mund des Burschen nahte sich dem ihrigen und – ein heftiger, schallender Schlag darauf, ließ ihn zurückfahren. Gleichzeitig hatte das Mädchen das Spinnrad ergriffen und eilte davon. Ein boshaftes Gelächter tönte durch die Nacht zu dem Getroffenen, der immer noch zurückgebeugt da stand.
Seitdem war's still gewesen in ihrem Herzen, nie mehr war ein ähnliches Gefühl über sie gekommen. Das andere Geschlecht hatte nur insofern noch Bedeutung für sie, als sie sich mit ihm zanken konnte.
Hie und da führte Joseph eine kurze Unterhaltung mit der stillen Lisbeth. Er entdeckte dabei, daß sie viel verständiger war, als er anfänglich geglaubt. Sie war es auch, welche der Irrsinnigen ihre Pflege widmete, so daß sie nicht ganz verkam, da sie oft nur mit Anwendung von List dazu gebracht werden konnte, Nahrung zu sich zu nehmen.
Lisbeth war von jeher ein seltsames Menschenleben gewesen. Mit reichen Gaben ausgestattet hatte sich ihr Geist in dieser Einsamkeit entwickelt, wie es bei solcher Umgebung überhaupt möglich war. Da sie schwächlichen Leibes gewesen war, hatte man sie nicht zur Feldarbeit verwendet, sondern sie dazu bestimmt, für die übrigen Hausbewohner die Strümpfe zu stricken. Das hatte sie von Jugend auf gethan, war am Fenster gesessen, hatte für die Uebrigen und andere Leute Strümpfe gestrickt und dabei ein ruhiges Traumleben geführt. Fast ihr ganzes Leben hatte sie an demselben Platz am Fenster zugebracht mit aufmerksamem Auge die Dinge und kleinen Vorgänge ihrer Umgebung beobachtend und sie in ihrer Seele bewegend. Wie ihr Leib dabei schmächtiger, die Hände und das Gesicht feiner und weißer geworden, so war ihre Seele gleichsam abgemagert und war ein zartes Seelchen geworden, so dünn, wie die Spinnfäden, die sich von einem Grashalm zum andern ziehen und an welche sich viele Tausende kleiner Thauperlen angesetzt haben, die in der Morgensonne glitzern. Und es war so fein, daß es beim geringsten Lufthauche schwankte und die Thauperlen erst recht in der Sonne glänzten. Bei ihr war der Glanz ein zartes Roth, von dem die Wangen durch die geringste Ursache gefärbt wurden. Denn die Perlen waren eine Menge guter Eigenschaften, welche man in einem so kleinen Seelchen, das in solch zartem Gezweige hängt, nicht zu finden glaubte.
Eine dieser Eigenschaften war eine seltsame Frömmigkeit, die sich ihrer großen Bescheidenheit zufolge nicht in Aeußerlichkeiten zu offenbaren wagte. Sie hätte sich gescheut, durch ein lautes Gebet oder einen Kniefall ihre Gottverehrung zu zeigen. Da sie wegen ihrer großen Menschenscheu nie zur Kirche gegangen war, wußte sie nichts von dem Streite und der Eifersucht der religiösen Genossenschaften und wenig von dem Dogma ihrer Kirche. Sie hatte sich im Laufe der Jahre eine eigene Religion gebildet, ohne zu wissen, daß sie dadurch eine Ketzerin geworden war. Denn ihre Religion war lauter Licht und Glanz. Die ganze schöne Welt in ihrem Farbenreichthum erschien ihr als Tempel Gottes und darin war eitel Liebe. Ueber Gott hatte sie sich nie klare Vorstellungen gemacht. Eigentlich dachte sie sich ihn als gutmüthigen, alten Mann mit großem grauem Barte. Dennoch aber verehrte sie in der Sonne, die unter das Dach herein durch die trüben Fenster ihre goldnen Strahlen in die Stube warf, das Auge Gottes. Stand die Sonne so, daß die Frau ihr gerade in's Gesicht sehen konnte, so schaute sie lange voll Ehrfurcht in das glühende Auge, und die Wärme, die dabei ihr Gesicht übergoß, gab ihr den Trost, daß der, welcher ein so mächtiges, glänzendes Auge besitze, sie nicht verlassen werde. Und ihre Seele hob sich alle Tage neu beim Anblick der Sonne. So war sie eine kleine Feueranbeterin geworden.
Dem rauchgeschwärzten Christus an der Wand schenkte sie nur nebensächliche Aufmerksamkeit. Wohl fühlte sie Ehrfurcht vor seiner Aufregung, aber es fehlte ihm der Glanz eines Sonnenauges.
Während die andern laut die Vaterunser beteten und den Rosenkranz drehten, saß sie mit gefalteten Händen in süßer Verklärung da und ließ die Sonnenstrahlen auf ihrem Gesichte spielen, wodurch sie einen lieblichen Contrast bildete zu den finstern Wänden und dem grämlichen Aussehen der übrigen Bewohner.
Ihre Bescheidenheit und Schüchternheit war so groß, daß sie kein Bewußtsein der zu ihrer Person gehörenden Rechte hatte. Vor Personen mit entschiedenem Auftreten knickte sie zusammen, so daß Bruder und Schwester eine unbeschränkte Herrschaft über sie ausübten und ihr auch das Geld abnahmen, welches sie für ihre Arbeit erhielt.
Ihre ganze Einwirkung auf die äußere Welt bestand in der Verarbeitung des Baumwollgarns zu langen und weiten Strümpfen, welche an starken, behaarten Beinen über die Erde marschirten und die alle viel weiter in der Welt herumkamen, als ihre Urheberin.
Der Mangel jeglichen kräftigen Willens hinderte sie daran, ihre schönsten Tugenden, deren viele aufzuzählen wären, zu bethätigen, so daß sie eigentlich nur in ihr schlummerten und höchstens durch die ausdrucksvollen, klugen Augen verrathen wurden.
Ihre Schüchternheit hinderte sie sogar an der Befriedigung ihrer Neugier. Personen vor dem Hause getraute sie sich nur hinter dem Vorhange stehend zu betrachten.
Trotz ihrer Einschränkung auf das Haus hatte sie sich aus den Reden der Geschwister eine ziemlich richtige Kenntniß von den Menschen gebildet. Nur über die Dinge hatte sie seltsame, kindische Vorstellungen. Deshalb war es Joseph möglich, mit ihr eine Unterhaltung zu pflegen und deswegen verband sie die gegenseitige Zuneigung inniger als dies mit den Uebrigen der Fall war.
Eigentlich aber langweilte er sich. Nur die Erinnerung daran, daß die lustige Zeit des Jahres der Herbst gewesen war, wenn in Schadenweiler gemostet wurde, hielt ihn vorläufig ab, davon zu gehen. Die Obstbäume trugen seltenen Segen und überall waren Stützen nothwendig geworden. Mit dem Herbste rückte auch die Kilbi näher. Er wollte diese als Schadenersatz betrachten für diejenige, welche er vor zwanzig Jahren verloren hatte. Er dachte sich, da müsse es so lustig hergehen, wie er es sich damals vorgestellt hatte.
Denn wie die Griechen nach ihren großen Festen, so berechneten die Schadenweiler die Zeit nach den Kilbenen. Solche, an denen besonders viele Stuhlbeine zerschlagen und viele Löcher in die Köpfe gemacht wurden, waren es hauptsächlich, an welchen ihre Zeitrechnung hing. Für sie gab es eigentlich keine Zeit als diese Festtage, wie es bei ihrem einförmigen Leben zu begreifen ist.
Eines Nachmittages aber, als die brennende Sonne recht hell schien, geschah ein Ereigniß. Der »Herr« Gemeindeammann, der zugleich »Herr« Wegknecht war, da er als Nebenamt die Straßen zu reinigen übernommen, trat in die Stube mit einem großen Couvert in der Hand.
Er machte die Anzeige, daß das Kind der Irrsinnigen innert kurzer Zeit da sein werde. Er wies auf die Zuschrift, die er von dem »Kollegen« in einer der größern Städte erhalten hatte und worin dieser ihn aufforderte, das Mädchen ihren Angehörigen zu übergeben.
»Es ist alles richtig« fuhr er fort, als er die Ueberraschung der Leute bemerkte.
»Da steht es: Justina, unehliche Tochter der Josephina Reimann. Es ist ihr Kind und auch im Register eingetragen worden zur Zeit, da es zur Welt kam. Ich habe euch die Mittheilung gemacht, damit ihr euch vorbereiten könnt.
»Nun wird's kurzweiliger werden bei euch,« wandte er sich an den verdutzten Joseph, »wenn ein hübsches Weibsbild in's Haus kommt. Ueber der Mitte der Zwanziger steht sie nicht.«
Damit ging er.
Längere Zeit fanden die Bewohner der finstern Stube keine Worte, ihre Ueberraschung auszudrücken. Wäre das Haus von einem Erdbeben erschüttert worden, ihre Aufregung hätte nicht größer sein können. Ein Mädchen kam in das stille Haus, das sie nicht kannten und das doch ihre nahe Verwandte war! Sie fühlten instinktiv, daß ihrem kleinen Haushalte eine Revolution bevorstand.
Katharina war die erste, welche ihrem Gefühle, es war Zorn, Ausdruck verlieh. Sie erhob die Faust gegen die Irrsinnige, welche sich an ihrem gewöhnlichen Platze unter der Kammerthüre befand und sagte:
»Da ist der Hochmuth schuld. Warum wollte sie fort!« Aber die Irrsinnige lachte.
»Ich gehe fort« sagte Joseph. Er wollte nicht die Herrschaft mit ihr theilen. Im Grunde aber war er doch neugierig, wie seiner Schwester Tochter aussehe.
»Sie wird wohl in der obern Kammer schlafen müssen, ich will das Bett heute noch aufschlagen, Du hilfst mir, Joseph!« So sagte Lisbeth, welche einzig das Kind der Unglücklichen mit Theilnahme erwartete. Nazi pustete in die Pfeife, daß große Rauchwolken aufstiegen. Er wußte nicht, um was es sich handelte, fühlte aber, daß die gewöhnliche Ordnung gestört werde.
Seit zwanzig Jahren war die Ruhe des Hauses nicht gestört worden und nun zwei wichtige Ereignisse in wenig Wochen! Es war nur begreiflich, daß die Bewohner aus ihrem Gleichgewichte geworfen wurden durch die stürmische Zeit und die schnelle Folge großer Begebenheiten.
Die Angekündigte war wirklich das Kind der Irrsinnigen, welche Josephs einzige, um mehrere Jahre ältere Schwester war. Obwohl sie von dessen Geburt Kenntniß erhalten hatten, war im Laufe der Zeit, als keine Nachricht über das Kind einlief, die Erinnerung an dessen Vorhandensein erloschen. Nun sollte es plötzlich vor sie hintreten!
Ungefähr bis zu der Zeit, da in Schadenweiler die große Umwälzung der Dinge allmälig begann, war Josephines Geist wach gewesen. Obwohl sie also noch zu der alten Schadenweiler Art gehörte, hatte sie doch ganz aus derselben geschlagen. Aber indem sie mit der Tradition der alten Generation, von der Welt nichts zu sehen, brach, zerschellte sie dabei. Es schien, als ob die Revolution schon in ihr geschlummert hätte. Und sie stellte gleichsam jene Elemente dar, welche, indem sie den folgenden Geschlechtern die neue Zeit vorbereiten, dabei zu Grunde gehen, unbewußt das Opfer für die andern sind, wie die Pioniere, welche die schwere Arbeit der Urbarmachung übernehmen und deren Nachkommen erst ein behagliches Dasein genießen.
Denn Josephine hatte den Schadenweilern den Weg in die Welt hinausgezeigt. Als einige ihrem Beispiele folgten und ihre Schritte hinauswagten, brachten sie die Kenntniß von der neuen Art der Benutzung des Bodens nach dem einsamen Weiler und nun begann auch für Schadenweiler die neue Zeit, die Aera der Händler und Dolmetscher.
Zu dieser hatte also Josephine den Anstoß gegeben, obwohl die Schadenweiler von diesem ihrem Verdienste keine Ahnung hatten.
Sie war das schönste Mädchen der Umgegend gewesen und auch das hochmüthigste, wie die Leute ihren Stolz taxirten. Der letztere war aber berechtigt, denn sie war in der Schule die beste Schülerin gewesen. Das war aber noch nie, vorher nicht und nachher nicht mehr vorgekommen, daß eine Schadenweilerin in der Schule sich ausgezeichnet hatte, ein junger Schadenweiler zum Voraus nicht. Sie hatte auch alle Klassen der Schule durchgemacht, während die übrigen höchstens bis zur mittlern kamen und dann stecken blieben. Denn die Schadenweiler Jugend mußte in das nächste »vornehme« Dorf zur Schule und war dort von den andern Kindern ebenso über die Schultern angesehen, wie ihre Väter von den »Herren« des Ortes. In der Schule waren sie die Aschenbrödel, um welche sich der Schulmeister nicht sehr bekümmerte, sie galten ja doch für Dummköpfe insgesammt. Und die Leute des Dorfes hatten ihre Freude daran und sorgten dafür, daß in die Dumpfheit der Schadenweiler Köpfe kein Licht fiel.
Josephine hatte eine Ausnahme gemacht. Sie hatte in der obersten Klasse von andern, schönern Gegenden unseres Landes gehört und jene Schilderungen spukten ihr auch nach Absolvirung der Schule im Kopfe wie die Märchen des Heliko in den alten Helvetiern. Ihr Sinnen und Trachten ging dahin, etwas von jener schönern Welt und deren Bewohnern zu sehen. Die schwere Arbeit und das einförmige Leben zu Hause war ihr verleidet und sie pflegte in sich die unbestimmte Hoffnung auf ein glänzenderes Dasein mit leichter Arbeit. In den düstern Winterabenden nährte sie das leuchtende Flämmchen der schönen Erinnerungen von der Schule her.
Eines Tages fiel ihr Wort, daß sie fort wolle, wie eine Bombe unter die Glieder des Hauses. Fort! – In die fremde Welt! Josephine mußte ganz aus der Art geschlagen haben. Eine Schadenweilerin in die Fremde!
Sie hielt Wort und machte somit eine große Bresche in die herkömmliche Weise der Schadenweiler. Durch die Vermittlung einer der »Herren«, der Holzhändler war und aus den »Ländern« seine mächtigen Buchenstämme bezog, kam sie in ein Hotel in den Bergen, wo eben die Fremdenindustrie aufgegangen war. Aus weiter Ferne kamen die Leute, um auf den Bergen herumzustolpern und sie mit vier Augen zu begaffen und darnach sich in raffinirtem Luxus davon zu erholen, wobei sie das Geld nicht sparten.
Wie ward ihr in den glänzenden Räumen mit den großen Spiegeln, bei den vornehmen Herren, bei der Pracht, die ihr beinahe überirdisch erschien, die sie von den Strohhütten von Schadenweiler hergekommen! Ihr schwindelte beinahe, sie glaubte sich im Himmel, obwohl sie, sonst am Spühleimer stehend, nur einzelne Blicke in die Herrlichkeit werfen konnte.
Sie schrieb einen Brief nach Hause, was dort auch ein Ereigniß war. Es standen Dinge darin, welche die guten Leute nicht verstanden, so daß sie glaubten, Josephine sei überschnappt.
Sie war groß und üppig gewachsen, eine wilde Schönheit mit mächtiger Lebenslust. Ihre scharfen Augen hatten manchen Burschen abgewiesen und sie war sehr trotzig gewesen. Hier aber schwand der Trotz und wandelte sich in geschmeidige Schüchternheit durch das Gefühl der Nichtigkeit dem Reichthume gegenüber.
Dann kam Bericht, die schöne Josephine habe geboren und etwas später, sie sei verrückt und werde nach Hause gebracht. Und sie kam und lachte und lachte immer, trotz der geballten Fäuste und Vorwürfe der Ihrigen, welche sie nicht verstand.
Man erzählte sich allerlei über ihr Unglück. Sie sei mit einem reichen Herrn in einer Kutsche gefahren und habe es schön gehabt, sei in Sammt und Seide gekleidet gewesen. Nach der Geburt des Kindes sei aber der Herr verreist und da sei sie überschnappt und lache jetzt immer, weil sie sich für eine vornehme Frau halte. Es geschehe ihr aber Recht, warum sei sie so hochmüthig gewesen und habe etwas Besseres sein wollen als sie.
So hatte also die erste, welche sich in das Leben hinausgewagt, darin Schiffbruch erlitten. Und das war natürlich, denn von Schadenweiler war der Schritt zu groß und der beschränkte Sinn seiner Bewohner war nicht im Stande, die Welt zu erfassen.
Das Kind war versorgt worden und weil sie sich nicht darum zu bekümmern hatten, wurde es vergessen.
Dieser erste Auszug eines Schadenweilerkindes hatte einige Jahre vor demjenigen Josephs stattgefunden und nun sollten letzterer und der Sproß des ersten wieder in der Heimat zusammentreffen!
Eines Tages, als die Sonnenstrahlen an den schwarzen Wänden auf- und abglitten, stand die Erwartete in der Stube und sah die erstaunten Blicke der Bewohner auf sich gerichtet. Das Mädchen mochte etwa 26 Jahre zählen. Sie war in ein einfaches schwarzes Gewand gekleidet. Ihr Kopf war schön geformt, das Gesicht zeigte schöne, aber nicht feine Züge, deren Aehnlichkeit mit denjenigen der Irrsinnigen unschwer herauszufinden war. Aber die blauen Augen hatten einen scheuen Ausdruck, wie wenn sich ihre Besitzerin fortwährend fürchtete und als ob sie kürzlich stark erschreckt worden wäre und sich noch immer nicht davon erholt hätte. Beim Anblick Josephs ging ein Leben durch ihre Gestalt. »Bin ich bei Reimanns?« fragte sie leise, als ob sie hoffte, die Frage verneint zu hören. »Ich bin Justina, die Tochter der Josephina« fügte sie hinzu, als noch keine Antwort erfolgte.
Denn noch immer fanden die Ueberraschten keine Worte angesichts der lieblichen Erscheinung, die sich von den düstern Wänden um so schöner abhob.
Lisbeth allein erhob sich und reichte ihr mit glücklichem Lächeln die Hand: »Ja, Du bist am rechten Orte, willkommen!« Nun reichte sie den übrigen die Hand. Joseph erhob sich unwillkürlich, als er ihr die seinige reichte. Selbst der Oheim nahm die Pfeife vom Munde, so wirkte mit Macht die Jugend.
Sie war im Begriff, auch der Irrsinnigen die Rechte zu reichen, als sie erst deren grinsenden Gesichtsausdruck bemerkte. Wie Joseph, so schrack auch sie zusammen. Eine Ahnung sagte ihr, daß sie vor der Mutter stehe und trübte ihr die Augen. Gleichwohl ergriff sie der Irrsinnigen Hand, die diese aber schnell zurückzog mit einem leisen Schrecken, der über ihr Gesicht ging, so daß es schien, als sei ein Schimmer geistigen Lichtes darüber hinweggehuscht. Dann lachte sie wieder.
Nun war die Neuangekommene aufgenommen und das einförmige Leben nahm seinen Fortgang. Joseph ging nicht davon; Justinens Gegenwart war leicht zu ertragen, es war nicht mehr Geräusch, sondern stille Anmuth in's Haus gezogen. Denn Justine redete nicht viel. Sie zeigte sich als ein räthselhaftes Menschenkind, das wenig aus seinen Tiefen an's Tageslicht brachte. Immer lag auf dem Grund ihrer blauen Augen der zitternde Punkt der Furcht, wie das Herzklopfen beim Reh noch dauert, wenn es auch der Verfolgung und dem Tode entronnen.
Ihr geräuschloses Walten verschönerte nach und nach den Raum. Der Staublappen ging über die Wände, so daß die Holzfarbe schwach hervorschimmerte. Er ging auch über die Porträts, über den alten Papst und die Madonna mit dem Flammenherz, so daß der erste wie ein frisch gewaschener Mensch wieder freundlicher ausschaute und bei letzterer die Flammen wieder ihre rothen Strahlen erhielten. Selbst der porzellanene Christus in der Mitte erlitt eine gründliche Waschung durch die neue Magdalena, so daß seine runden Glieder wieder glänzten. Auf das Fenstergesims neben die Strickarbeit Lisbeths kam sogar ein Strauß Wiesenblumen in einem hohen Mostglase, so daß diese ihren Gottesdienst zwischen der Sonne und den Blumen teilte. Wie oft hatte sie ihre neugierigen Augen auf die lieblichen stummen Kinder der Erde gerichtet, ohne daß ihr der Gedanke gekommen wäre, sie draußen auf der Wiese zu holen und in ihre unmittelbare Nähe zu bringen. Nun verlor sich ihr Duft in der Moderluft des Zimmers, welche selbst Justine nicht zu bannen vermochte.
Ein neuer, freundlicherer Geist war in das Haus gekommen und hatte das Dasein der Bewohner in eine hellere Sphäre gerückt. Joseph wurde munterer, seine Bewegungen kräftiger. Er arbeitete wacker im Hause. Wie Justine in der Stube, so nahm er ein Reinigungsgeschäft im Stalle und fegte uralte Spinngewebe herunter, welche das kleine Fenster verdeckt hatten und es begann auch für die Kühe eine vergnüglichere Existenz. Joseph wurde auch unternehmungslustig und trug sich mit dem Gedanken, ein Saugkalb aufzuziehen.
Justine selbst fühlte sich bald heimisch und begann ihre Verwandten zu lieben. Sie fühlte sich geborgen, hatte sie doch Jemanden, zu dem sie durch Bande des Blutes gehörte. Sonderbarer Weise zeigte sie mehr Zuneigung zu der keifenden Katharina als zu den übrigen. Sie schien das barsche Wesen der alten Frau als die Bürgschaft dafür zu betrachten, daß man sich vor ihr nicht zu fürchten und einer plötzlich hervor tretenden neuen Eigenschaft zu versehen habe. Josephs geschmeidige Freundlichkeit und die Herzlichkeit Lisbeths machten sie eher zurückhaltend.
Als der erstere eines Tages nach dem Mittagessen vor der neben ihm sitzenden Justine sich erheben wollte, schlang er in scherzhafter Weise den Arm um ihre Taille, um sie mit sich empor zu ziehen. Aber wie von einer Natter gestochen fuhr sie wild empor, schlug seinen Arm zurück und flüchtete sich in die Mitte der Stube, wo sie mit hochbebender Brust und einem Ausdrucke wilden Zornes in den Augen dastand, um sofort wieder in die gewohnte Schüchternheit zurückzusinken.
Die Uebrigen hatten sich erschreckt erhoben und selbst Joseph war betreten. Was sie der Kleinigkeit wegen nur hatte! In den Osterien Roms hatte er von mancher schwarzäugigen Italienerin Püffe erhalten, wozu letztere genügenden Grund gehabt hatten. Aber dieser unschuldige Scherz unter Verwandten!
Zwar schien der Eindruck, den dieser peinliche Vorfall hervorgerufen hatte, bald verwischt zu sein, aber innerlich war eine Entfremdung eingetreten.
Auf die schon am ersten Tag ihrer Ankunft erfolgten Fragen über ihren bisherigen Aufenthaltsort hatte das Mädchen nur unvollkommene Antworten gegeben. Erst im Laufe der Zeit gab sie nähere Auskunft und selbst diese mußte man aus einzelnen Bemerkungen ihrer Gespräche ergänzen. Sie war in einem Kloster erzogen worden, das zugleich eine Erziehungsanstalt für Waisenmädchen war. Es mußte dort nach ihrer Geburt eine genügende Summe abgegeben worden sein, daß sie im Kloster ihre Jugend verbringen konnte. Nachher blieb sie noch dort, da dasselbe ihre Heimat geworden war und sie erst spät ihren Ursprung erfuhr. Daß sie dort viel gebetet und außer dem Katechismus wenig gelernt hatte, merkte man aus ihren Gesprächen. Sonst machte sie keine besondern Andachtsübungen, als daß sie mit den Uebrigen betete. Warum sie, da sie im Kloster als freiwillige Magd gute Dienste geleistet hatte, aus demselben getreten sei, darüber äußerte sie sich nicht. Bei diesem Punkte wurde jedesmal die Unruhe in den Augen sichtbar. Sie mußte im Kloster Erfahrungen gemacht haben, auf welche auch der eigenthümliche Vorfall bei Tische zurückzuführen war. Sie erklärte, daß sie auf einmal eine unbezwingliche Sehnsucht nach der Heimat bekommen, weshalb sie den Abschied verlangt habe.
In der Messe setzte sie sich nahe der Thüre und erhob nur selten den Blick zum Geistlichen. Sie bekümmerte sich nicht um die neugierigen Blicke der Leute und sah kaum, wie sie von ihr wegrückten, der »unehrlichen« Tochter der Irrsinnigen.
Den Leuten von Schadenweiler wich sie scheu aus. Dieselben hatten sie das erste Mal, da sie mit ihnen zusammengetroffen war, in plumper Weise ausfragen wollen. Einige hatten sie ohne Weiteres gefragt, wie sie auch neben der Verrückten es aushalten könne, sie würden sich fürchten.
Deshalb blieb sie zu Hause und pflegte keinen Verkehr, sich von den Schadenweilern zurückziehend wie seiner Zeit Joseph. Darüber wurden die Leute erbost und ihnen aufsässig und schwatzten allerlei über beide. Joseph war in Italien ein Räuber gewesen und hatte viele Menschen umgebracht und sei mit dem geraubten Gelde heimgekommen. Im Hause habe er einen großen Schatz versteckt mit dem er das ganze Dörfchen ankaufen könnte.
Justine war den Gerüchten zufolge eines unnennbaren Verbrechens wegen im Kloster ausgepeitscht und fortgejagt worden. Deshalb dürfe sie auch keinen Menschen ansehen, sie sei vom bösen Gewissen geplagt.
Beiden kam Einiges von diesen Gerüchten zu Ohren und dieses hatte zur Folge, daß ihre Abneigung gegen die Menschen sich vergrößerte und sie sich ganz auf ihr Haus beschränkten.
Die Verfolgung, die beide erfuhren und das Mißtrauen, das man ihnen offen zeigte, wo sie mit den Menschen verkehrten, diente dazu, sie selbst inniger zu verbinden, sodaß beide eine verschwiegene Zuneigung zu einander bekamen.
Denn seit jenem Vorfalle, da sich Justinens herbe Jungfräulichkeit geoffenbart hatte, war mit Joseph eine Veränderung vorgegangen. Sein einschmeichelndes Benehmen war rücksichtsvolles Betragen geworden. Bei tausend kleinen Gelegenheiten zeigte er sich um seine räthselhafte junge Base besorgt und nahm ihr schwerere Arbeiten ab. Das mußte sie empfinden und es that ihr wohl. Er war auch ein äußerlich schmucker Mensch geworden, der sich herausstaffirte. Bei alledem wurden keine besonders freundlichen Worte zwischen ihnen gewechselt, so sehr hatte sich Josephs Schadenweiler-Natur nicht verändert. Aber er bewies, daß ein Trieb des Herzens, eine relative Zartheit des Gefühls, die bei den Uebrigen verdorrt war, bei ihm keimte, daß sie beide, die fremden Schosse, im Grunde von edlerer Art waren als ihre Sippschaft, deren Verderbtheit ihnen mißfiel.
Das war der neue Geist, der mit Justine in's Haus gezogen war, eine gewisse Rücksicht, welche die Bewohner instinktiv gegeneinander übten und welche bis dahin nie darin gewaltet hatte. Die harten Naturen, die sich nicht verstanden hatten, waren bei jeder Differenz in Meinung oder Willen aufeinandergeprallt, sodaß Streit entstanden war und sie sich infolge dessen von einander entfernt hatten. Jetzt war Frieden im Haus und eine ruhige Behaglichkeit. Diese hatte Justinens wortloses Herrschen gebracht. Ihr stilles Wesen, das eine Folge des klösterlichen Lebens war, weckte in den Hausgenossen den Glauben, daß in den Tiefen ihrer Seele noch mancherlei steckte, das ihnen verborgen bleibe und vor Jemanden, der im Kloster gelebt hatte, hatten sie zum Voraus großen Respekt. So wurde Justine für bedeutender gehalten als sie war und übte deshalb ihr wohlthätiges Regiment aus.
Denn sie war ein einfaches Menschenkind, das wenig Kenntniß von dem Treiben der Welt hatte und nur sein tiefes unklares Gefühl besaß. Erst jetzt begann sie ihre Blicke in das Leben zu werfen und darin zu arbeiten wie andere.
Die Arbeit war zuerst eine kurzweilige, die ihr ausnehmend gefiel. Am frühen Morgen, wenn die Thauperlen in der Sonne glitzerten, verwarf sie das Emdgras, das Joseph niedergestreckt hatte. Sie machte es ungeschickt, die Gabel drehte sich ihr in den Händen und sie wurde vom Mähder ausgelacht. Gleichwohl suchte sie ihm auf dem Fuße zu bleiben, um mit ihm fertig zu sein. – Am Nachmittage ihm Gabeln voll duftigen Heu's auf den Wagen zu reichen, damit er dasselbe verlade, bereitete ihr großes Vergnügen. Oft fiel der Haufe, den sie hinaufgeworfen hatte, wieder zurück und auf ihr Gesicht, das vor Eifer und Lust glühte. Dann begegneten sich vier lachende Augen. Damit war die Schranke, die noch zwischen ihnen bestanden, beseitigt und der Verkehr war fortan zwangloser und konnte sogar in Neckerei ausarten. Sie war bestrebt, demselben nur die heitere Seite abzugewinnen und verrieth einen großen Eifer, fröhlich zu sein. Mit Lebhaftigkeit nahm sie die ihr ungewohnten Hantirungen auf und lachte über ihre Unbehilflichkeit, worin sie sich gerne von Joseph corrigiren ließ.
Dann kam die schöne und fröhliche Zeit, da man in Schadenweiler das Vieh auf die Weide trieb. Auch Joseph trieb seine zwei alten Kühe auf die Wiese. Dieselbe erstreckte sich längs des Waldsaumes vor dem Flusse und war nur durch den Erlenschlag von demselben getrennt. Er gab die Geißel Justinen in die Hand, welche fröhlich damit knallte und ihre zwei Kühe immer hübsch beisammen haben wollte. Dann ging er nach Hause und kam bald zurück mit einem Schemelchen und einem Bündel Stroh beladen. Holz brach er im Gebüsche und bald flackerte ein lustiges Feuer, das auf Justinens Gesicht einen röthlichen Schimmer warf und ihre Gestalt angenehm durchwärmte. Joseph kniete vor dem Feuer und pustete in dasselbe und das Mädchen auf dem Schemel war in glücklicher Stimmung, daß Alles so schön war. Herbstzeitlosen blühten zu ihren Füßen. Das dunkle Grün der jungen Erlen hatte sich zu färben angefangen. Der Höhenzug im Westen mit den düstern Tannen war mit einem bläulichen Dufte umzogen. Geklingel der Glocken und Schellen, welche die Kühe trugen, tönte von allen Seiten. Da und dort stieg der Rauch eines Weidefeuerchens auf, um das sich Buben und Mädchen lagerten. Und über Allem der röthliche Sonnenschein: Es war der schönste Herbstnachmittag. Das Dörfchen befand sich in einiger Entfernung und weil die Häuser kaum im Obstbaumwalde zu bemerken waren, glaubten sie, von dort aus nicht gesehen werden zu können. Justine fand sich beinahe versucht zu tanzen, so groß war das Glück, dessen sie sich bewußt war. Sie verglich das düstere einförmige Leben in dem Kloster mit dem jetzigen. Wie groß war der Unterschied! Und dieses Bewußtsein wurde um so lebhafter, je wohliger die Wärme war, welche vom Feuer über ihre Glieder strömte, sie schwellend und ihr das Gefühl der Kraft weckend, die sie nun in der größten Freiheit gebrauchen durfte.
Wie Joseph so vor ihr für sie sich abmühte, betrachtete sie ihn mit Blicken, aus denen der scheue Ausdruck verschwunden war. »Er war doch ein guter Mensch!«
Nun brachte er große gelbe Aepfel aus der Westentasche zum Vorschein und legte sie in das Feuer: »Die kannst Du dann essen, sie schmecken gebraten gut.«
Damit trat er in den Schlag um Brennholz zu sammeln und überließ sie ihren Gedanken, die sich mit ihm beschäftigten. Wohl waren sie Verwandte, das wußten sie, aber ihr Gefühl war dasjenige fremder Menschen, die sich durch Verkehr näher treten und einander schätzen lernen. Bis zu ihrem Zusammentreffen hatte keines von des Andern Dasein eine Ahnung gehabt.
Eine ziemliche Reihe solch schöner Herbsttage verlebte Justine auf der Weide. Joseph sorgte für sie wie für ein Kind und sie ließ sich das gerne gefallen. Seine Geschäftigkeit, die ihr nichts zu thun übrig ließ, bereitete ihr ein süßes Gefühl, ähnlich demjenigen eines Kranken, dem seine Pflegerin an der Bettdecke nestelt und dabei ihr liebes, besorgtes Antlitz nahe auf das seinige beugt. Er verweilte nach und nach längere Zeit bei ihr, behaglich seine Pfeife rauchend und mit ihr plaudernd. Dabei fragte sie ihn einst, das erste Mal, über seine Vergangenheit und hörte mit Erstaunen ihn über seine Erlebnisse berichten.
Es kamen ihr allerlei kindliche Einfälle, wie sie denn überhaupt einen Theil der verlorenen Kindheit nachholte. Einst meinte sie: »Am schönsten wäre es, wenn wir hier kochen könnten.« Joseph ging sofort nach Hause und brachte ein Pfännchen, das er in einem Winkel lange gesucht und endlich gefunden hatte. Vor beinahe einem halben Jahrhundert war darin Kindsbrei bereitet worden. Jetzt hatte es nur noch zwei Beine und war voller Spinngewebe. Er reinigte es am Flusse mit Sand und Kieselsteinen und sagte: »Jetzt hole Du das Andere!« Justine brachte bald einen Brocken Butter und Messer und Gabeln. Indessen stand Joseph am Flusse und hatte bald zwei Nasen, nicht sehr geschätzte Fische, herausgeangelt. Nun brodelten sie im Pfännchen über dem Feuer zur großen Freude Justinens, die zum ersten Male das Kochgeschäft betrieb und mit wichtigem Eifer die Fische um und um drehte. Gemeinsam verzehrten sie dieselben aus dem Pfännchen und fanden sie sehr schmackhaft. Manchmal stach das Eine mit der Gabel in den Rücken eines dem Andern zugetheilten Fisches und sagte dann: »Ich will auch sehen, wie der Deinige schmeckt,« wobei es mit dem Bissen schnell zum Munde fuhr, um nicht auf die Finger getippt zu werden. Zum Schlusse leckten sie sorgfältig die Gräte ab.
»Nun haben wir zusammen gekocht und gegessen,« meinte Justine.
»Wie Mann und Frau,« ergänzte Joseph. Nun ging ein ernster Zug über des Mädchens Gesicht.
Das Wort war in ihre Seelen gefallen und blieb in einem Winkelchen sitzen als kleiner, undeutlicher Gedanke, unmerkbar keimend und wachsend.
In solch kindlicher, anmuthiger Weise verbrachten Beide die schönen, stillen Herbsttage. Ganz anders die Schadenweiler Burschen und Mädchen! Die saßen zu Viert am Hirtenfeuer und jaßten. Der Schooß eines Mädchens diente als Tisch und auf dessen Schürze malten sie ihre Ziffern, wobei sie oft Streit erhielten. Dann wälzten sich Knaben und Mädchen auf dem feuchten Grase, wobei sie mit den strampelnden Beinen das Feuer auseinander schlugen.
Josephs Einladung, an die Kilbe zu kommen, die mittlerweile herangerückt war, wurde von Justine abgelehnt und auch er blieb zu Hause. Es gefiel ihnen besser auf der Weide.
Joseph erhandelte in dieser Zeit ein Kalb von einem Glaser des Herrendorfes, der sich auch mit Dekorationsmalerei, allerdings in primitivster Weise, befaßte. Nach langem Feilschen zahlte Joseph den geforderten Preis, marktete aber noch etwas hinzu: Der Künstler sollte das Kreuz, das seine Mutter gestiftet, übertünchen. Auf diesen Einfall hatte ihn Justines Reinigungsgeschäft zu Hause gebracht. Es geschah, und das Kreuz schimmerte nun in der weißen Farbe bis zu ihrem Hause hinunter und erfüllte sie mit einem Gefühl der Genugthuung wegen der erfüllten Pflicht der Pietät.
Als die rauhern Herbststürme den Winter herbeizerrten, schloß er sie in die Stube ein und das Leben wurde wieder einförmig und still. Lisbeth strickte am Fenster, Katharina spann und Nazi wärmte seinen Rücken am warmen Ofen, wobei schwache Rauchwölkchen von Zeit zu Zeit aus seinem Pfeifchen stiegen. Joseph saß hinter dem Tische vor einer Flasche Mostes und rauchte ebenfalls, Justine zusehend, die eine Näharbeit unter den Händen hatte.
Wenn ihm die Pfeife ausgegangen war, legte er sie bei Seite und fing an zu erzählen, unaufgefordert und an einen bestimmten Ort anknüpfend, als ob er voraussetzte, die Zuhörer müßten denselben kennen.
Seine Erzählung bestand eigentlich mehr in einer Aufzählung aller der Dinge, die er dort gesehen und die in seiner Gegend unbekannt waren oder höchstens auf dem Markte als ihnen unerreichbare Süßigkeiten zur Schau gestellt waren. Er redete von den Feigen und Orangen, die in Menge wuchsen, von dem billigen Weine, daß vor der Weinlese der alte Wein auf den Boden geschüttet werde, damit man für den neuen Platz habe. Er schilderte die schönen Paläste mit den vielen Verzierungen und den großen Gärten mit den schönen Pflanzen, den dunklen Gebüschen, in deren Schatten nackte, schöne Menschen aus weißem Marmor stünden. Die Kirchen wären auch viel größer und prachtvoller als die ihrige. Außen und innen seien große schöne Bilder, die berühmt seien und welche anzuschauen und nachzumachen die Menschen aus der ganzen Welt kämen. Hauptsächlich verweilte er bei der Lebensweise der Bewohner, um welche er sie, als einer sehr bequemen, oft beneidet hatte. Ihr Vorzug bestand darin, daß sie sehr wenig arbeiten mußten, da die Dinge, an welche man hierzulande viele Mühe verwende, beinahe von selbst gedeihen und man sie nur zu ernten brauche. Deshalb sei auch Alles so billig. Bisweilen erzählte er auch von den großen Prozessionen, die er angesehen und dem Glanz, der dabei entfaltet worden.
Trotz dieser unvollkommenen Erzählungsweise hörte Justine mit großem Interesse zu und in ihrer Seele konstruirte sich ein Bild jenes Landes, in welchem die aufgezählten Dinge im Vordergrund standen. Besonders die hohen Paläste mit den zauberischen Gärten wollten ihr nicht mehr aus dem Sinne. Italien erschien ihr als das reinste Schlaraffenland, nach welchem sie eine leise Sehnsucht verspürte und das ihre Träume beschäftigte.
So hatte also Joseph Italien nach dem Schadenweiler gebracht und verschuldet, daß von jenem sonnigen Lande ein glänzendes Bild inmitten der rauhen Wintergegend und der schwarzen Hütten in Justinens Kopfe entstand, wie weiland in den Helvetiern durch die ähnlichen Schilderungen des Heliko.
Wenn er wieder hinkäme, meinte Joseph, würde er es anders verstehen, das schöne Leben zu genießen.
Während hier ein kleines Zauberland der Poesie blühte, wurde in den Schadenweiler Hütten gejaßt. Die Viehhändler und Dolmetscher setzten sich, wenn sie sich nicht auf einer Geschäftsreise befanden, zusammen vor eine große Flasche Mostes, zündeten ihre Pfeifen an und begannen das Kartenspiel, das neben dem Handel ihre größte Leidenschaft war. Am Anfange plauderten sie noch ein wenig von ihren Käufen und trugen einander Kühe oder Schafe zum Kaufe an. Bald aber verstummten sie, sobald die Leidenschaft erwacht war. Dann schlugen sie nur noch auf den Tisch, stießen hie und da einen Fluch hervor, wenn eine Hoffnung fehl schlug. Sie spielten schnell und immer schneller; weh dem, der das Spiel verzögerte durch unrichtiges Ausgeben der Karte: Eine Fluth von Schimpfworten stürzte auf ihn herab. Frau und Töchter schauten ihnen zu, nahmen an der Erregung Theil und ergriffen Partei für ihre Leute. Sie erschracken, wenn dieselben einen schlechten Stich machten, bis auf den Grund des Herzens und frohlockten, wenn dieselben die Gegner übertrumpften. Und doch war der Einsatz geringer als derjenige Kathris und Nazis, welche sogar Silberstücke aus ihren Strümpfen hervor auf den Tisch legten.
Auch die Jungen spielten auf dem Steinofen mit einem Kartenspiel, das wegen seiner Unreinlichkeit von den Vätern weggeworfen worden war, und das mochte etwas heißen. Sie trieben ein Spiel, das sie »Mariasch« nannten, wobei sie, ihre Väter nachahmend, ebenfalls die Fäuste hart aufschlugen, was ihnen aber auf dem Sandsteine erheblich weh that.
Denn ihre Stellung in der Schule des Herrendorfes war nicht viel besser als zu der Zeit, da Josephine sich dort ausgezeichnet hatte. Die Bewohner jenes Ortes hatten dafür, daß sie von den Schadenweiler Händlern betrogen wurden, die Genugthuung, daß deren Kinder in der Schule die hintersten waren. Am Schulexamen hieß der Lehrer sie vor dem Schulinspektor aufstehen, was eine stillschweigende Entschuldigung war für den Fall, daß derselbe die Schule zurückgeblieben finde. Denn man mußte das Kontingent der Schadenweiler Schuljugend nur ansehen, um zu begreifen, daß sie der Radschuh für die übrigen war. Ihre Eltern sorgten auch rechtschaffen dafür. Sie schimpften mit der lieben Jugend weidlich über Schule und Lehrer, weil sie in der erstern nur eine ihnen aufgezwungene lästige Einrichtung sahen. Es war ihnen eine rechte Freude, der Schule zu Leide zu leben, indem sie ihre Sprossen von derselben zurückhielten. Deshalb schwänzte die Schadenweiler Jugend wacker. Die Schulpflege fand es überflüssig, diesem Treiben durch Bußen Einhalt zu thun, vom Gedanken ausgehend, der Besuch der Schule nütze ihnen ja doch nicht viel. Zudem glänzte an den Examen die Geschicklichkeit ihrer Kinder besser, wenn die Dummheit der Schadenweiler contrastirend daneben stand.
An den Sonntagen gingen Joseph und Justine nebeneinander den Weg zur Kirche ohne sich an andere anzuschließen und mit ihnen zu schwatzen. Justine hatte Erstern zudem allerlei zu fragen und dieser war etwas stolz auf seine schöne Begleiterin und schritt deshalb mit einer gewissen Würde dahin. Die Schadenweiler wurden deshalb immer mehr erbost über die hochmüthigen »Vagabunden,« wie sie in lächerlicher Selbstverkennung Beide nannten. Sie fraßen sich immer tiefer in ihren Zorn hinein, daß jene ihnen keine Ehre anthaten und verdächtigten sie sogar im Herrendorfe, so daß auch dort die Fama sich der Geheimnißvollen annahm und einen Abscheu vor ihnen verbreitete.
Joseph trug einige Schuld an dieser Unbeliebtheit.
Wie er sich seit Justinens Ankunft zu einer gewissen Würde aufgeschwungen hatte, so war auch in ihm das Bedürfniß nach Geselligkeit, nach der Gelegenheit, die Freude zu äußern, erwacht und es trieb ihn oft fort, seiner inneren Lustigkeit Luft zu machen. Er war dann im »Goldenen Löwen« des Herrendorfes ein fröhlicher Zecher und der Ausbruch seiner Heiterkeit war für die Leute dann unerwartet und überraschend, weil er nachher wieder der einsilbige Geselle war, bis die Fröhlichkeit von Neuem aufsprudelte.
Bei diesen Zechereien deckte er bisweilen etwas aus seiner Vergangenheit auf, von dem fremden Leben, das er gesehen. Geheimnißvoll thuend und dabei mit den Augen zwinkernd machte er Andeutungen, daß nicht Alles so glänzend sei, wie man hierzulande glaubte. Wenn er erzählen wollte von den weiblichen Gestalten, die bisweilen an ihnen vorbeigehuscht und gegen das Morgengrauen sich wieder herausgestohlen hätten! – Auch erzählte er allerlei Menschliches vom heiligen Vater und von den hohen Kirchenfürsten, von ihrem Gezänke und dem Aerger, die letztere dem Papste bereiteten, daß dieser sich oft schmollend in seine Gemächer zurückziehe. Er schilderte ihnen, wie sie oft einen weinseligen Pater aufgehoben und nach seiner Behausung begleitet hätten, wo denn eine böse tyrannische Haushälterin den Armen mit einer Litanei von Scheltwörtern empfangen habe. Und derlei Geschichten mehr.
Diese Dinge wurden wohl mit Gelächter aufgenommen und weiter ausgesponnen. Sie wurden aber auch zu Hause erzählt, wenn die Zuhörer wieder aus der guten Stimmung gekommen waren. Dieselben Leute, welche im Wirthshause Josephs Geschichten vergnügt angehört hatten, erzählten sie wieder mit einer großen Entrüstung. Und die frommen, alten Frauen entsetzten sich darüber und erhoben ein großes Geschrei über den Gotteslästerer. In diesen Geruch war Joseph gekommen. Von Allem dem erfuhr er aber nichts, konnte nur etwas merken wegen der großen Scheu, die man vor ihm verrieth. Gleichwohl suchte man immer mehr Geschichten von ihm abzuzapfen, um wieder Schreckliches von ihm erzählen zu können. Das Fest des Kirchenheiligen des Kirchdorfes war gekommen.
Als Justina, die sich etwas verspätet hatte, in die Kirche kam, fand sie dieselbe gefüllt und ihren gewöhnlichen Platz besetzt. Es blieb ihr nichts übrig, als auf die Emporkirche zu steigen, wo sich die Sänger und die kleine Orgel befanden. Dort war auch der Platz für die Männer. In langen Reihen standen sie vor den Bänken, alle die Ellbogen auf deren Lehne stützend, den Rücken gewölbt und das Haupt gebeugt wie müde Esel. Die Ursache dieser Kopfhängerei war das Bestreben, sich den Blicken des Geistlichen zu entziehen, indem sie die Köpfe hinter der Brüstung der Emporkirche versteckten. Dann konnten sie schwatzen und lachen, ohne daß sie bemerkt wurden. Während der Pfarrer die Messe auf einer Leiter von unbestimmbaren Tönen dahinrollte, zischte es unter der langen Reihe der hängenden Köpfe hervor.
»Die braune (Kuh) gefällt mir noch besser.«
»Unter 18 Napoleons bekommst Du sie nicht.«
»Des Richterseppen Fleck (Kuh) hat ein schönes Kalb geworfen, ob er es wohl selbst aufziehen wird, ich möchte einen Handel mit ihm machen?«
»Kommst Du heute zum Jaß in den Löwen?«
»Was glaubst Du auch, Du Kameel!«
»Et cum spiritu tuo« erklangen die Responsorien.
»Alt-Gemeinderaths Christian ist vom Sigristen schön übertölpelt worden. Die Kuh ist 5 Napoleons weniger werth, ich wollte sie nicht für 10.«
»Sed libera nos a malo!« –
»Gestern Nacht haben die Nachtbuben einen Schadenweiler Bengel vor den Fenstern von Weibels Anna Marie ob der Kiltgängerei erwischt und ihn tüchtig durchgeprügelt.«
»A-men.«
Schellte es dann unter der Wandlung, so fuhren sie erschrocken auf und schlugen die Kreuze.
In der Mitte war die alte Orgel mit scharfen, gellenden Tönen. Der sie schlug, war ein Zimmermann, der einzig diese Kunst verstand. Er begleitete die Responsorien mit der Orgel, traf aber den Ton, mit welchem der Geistliche geschlossen hatte, nie, spielte auch nicht zusammenhängend, sondern hüpfte auf den Tasten umher, die Hände hoch erhebend und dann wieder niederschlagend.
Zu Ehren der Heiligen sang der Chor ein eigens für diesen Anlaß gelerntes Lied. Es begann mit einem Solo und diese Parthie war des Posthalters schnippischem Töchterchen übertragen. Schon lange hatte es mit klopfendem Herzen diesen Augenblick gefürchtet. Seit Beginn des Gottesdienstes hatte es den Mund geölt und den Ansatz probirt, damit der Anfang recht schön ausfalle. Immer und immer wieder hatte es die Lippen gefeuchtet und den Mund in die rechte Stellung gebracht. Ausgehustet hatte es sich längst. Nun fiel die letzte Antwort der Orgel zu und der Zimmermann zimmerte seine Cadenz, nach deren Schluß der Gesang beginnen sollte. Jetzt war er fertig.
In diesem Augenblicke trat Justine neben die Solo-Sängerin. Diese verzog die Lippen zu einem häßlichen Ausdruck der Verachtung und trat auf die Seite. Darob kam sie zu spät mit dem Einsatz, sah in der Angst sich bereits bloßgestellt und platzte nun, obschon der Anfang piano gesungen werden mußte, mit einem schrillen Tone heraus. Mit feuerrothem Gesichte sang sie das Solo, wobei bisweilen der Ton zu ersterben schien, da ihr wegen ihrer Angst und Verwirrung der Athem ausging, so daß die Uebrigen fürchteten, sie höre ganz auf. Auch diese kamen in ihrer Angst aus dem Geleise und setzten zu unrechter Zeit ein, so daß die Stimmen nie zusammenklangen und Alle nur mit großer Verwirrung das Lied zu Ende sangen, vom Gedanken gequält, sich dem Spotte bloßgestellt zu haben.
Die Köpfe hatten sich erhoben und nach den Sängern gedreht. Justine sah zornige Blicke auf sich gerichtet, sie begriff das Unheil nicht, das sie verursacht, oder brachte es wenigstens nicht mit sich selbst in Zusammenhang. Die Solosängerin, noch immer roth vor Scham, überbot den ersten Ausdruck der Verachtung, den sie Justinen gezeigt und welcher sie in Verwirrung gesetzt hatte. Sie glich einer kleinen Medusa. Als Justine beim Umwenden den Arm eines andern Mädchens berührte, wandte sich dieses unwillig ab mit einer nicht mißzuverstehenden Bewegung. Es war ein Gezische um sie herum, aus welchem sie einzelne Worte heraushörte:
»Die Landstreicherin« –
– »unehliche« –
– »ganz gleich« –
– »Pack« –
Sie war dem Weinen nahe, drängte aber die Thränen zurück. Sie versuchte der mittlerweile begonnenen Predigt zuzuhören, worin der Geistliche das Verdienstvolle an des Heiligen Märtyrium erläuterte.
Als nach Beendigung des Gottesdienstes die Menge sich hinausdrängte, stürzten die Mädchen des Chores zu einer Gruppe zusammen, um ihrem Zorne neuerdings und deutlichern Ausdruck zu geben. Sie gestikulirten in heftiger Weise, hielten die Vorübergehenden an, wiesen auf Justine, als diese aus der Kirchenthüre trat und riefen: »Diese da ist schuld!«
Justine sah die Aufmerksamkeit der Leute auf sich gerichtet. Von allen Seiten hörte sie beleidigende Ausdrücke. Hastig suchte sie sich den Weg durch das Gewühle, schwenkte beim nächsten Fußwege ab und eilte nach Hause, wo sie laut aufschluchzend auf einen Stuhl sank.
Vergebens suchte die erschreckte Lisbeth die Ursache ihres heftigen Schmerzes zu erfahren, das Weinen des Mädchens wurde krampfhaft.
So traf sie Joseph, der vergebens auf sie gewartet hatte. Es ging ihm nahe, als er die Schluchzende sah. Nachdem er die Verfolgung erfahren hatte, erfaßte ihn grimmiger Zorn gegen alle Menschen. Wie ein Löwe in seinem Käfig, so schritt er wild die Stube auf und ab, die Fäuste geballt, als ob er den Kampf aufnehmen wollte. Dann trat er zu Justinen, legte den Arm um ihre Schulter, – sie zuckte diesmal nicht zusammen – und sagte: »Gräme Dich nicht so sehr, sie sind es nicht werth, die Elenden. Kümmern wir uns nicht mehr um die Leute, gehen wir unsern eigenen Weg! Wehe dem, der Dich noch einmal beleidigt!«
»Ich habe ihnen doch nichts zu leide gethan,« klagte Justine, »sie verachten mich, weil ich unehlich bin.«
Damit war der Frohsinn von Justinens Gesicht weggewischt worden und sie war wieder das scheue Menschenkind; auch der zitternde Punkt im Auge erschien wieder. Gegen Joseph aber zeigte sie sich, wenn auch nur ihm bemerkbar, herzlicher als zuvor. In die Kirche ging sie nicht mehr. Die Menschen waren ihr ganz und gar verleidet.
Als wäre die Beleidigung ihm zugefügt worden, kehrte Joseph gegen die Leute den Trotz heraus und behandelte sie als Feinde. Er verachtete sie auch, die einem solch unschuldigen Wesen wie Justinen Unrecht und Schmach anthun konnten. Erst jetzt ging ihm eine Ahnung auf von dem Vorhandensein eines gewissen Zartgefühls einerseits und einer brutalen Herzlosigkeit, die ersteres verletzt, auf der andern Seite. Die wortlose Qual Justinens brachte ihn darauf. Er machte sich Gedanken darüber, lernte auf diese Weise manches und wurde dabei besser und unbewußt rücksichtsvoller. Zu dem war aber noch nie ein Schadenweiler gekommen. Also keimte in ihm eine edlere Art auf unter der Sonne von Justinens Blicken.
Draußen lag harter Schnee, der den Glanz der Sonne in ihre Stube warf. Der Wind pfiff an den Hausecken. Innen aber war behagliche Wärme. Justine und Joseph ertappten sich oft auf sonderbaren Blicken. In ihren Herzen ging eine Saat auf, die von unbekannter Hand hineingestreut worden. Und deshalb entfernten sie sich wieder von einander, mieden eine Berührung und redeten wenig. Beiden war wohl dabei und doch nicht, ein Druck lastete auf ihnen, der um so fühlbarer war, da sie in den engen Raum der Stube gebannt waren und ihn nicht ob größerer Thätigkeit abschütteln konnten.
Fastnacht kam, die Zeit, da die Phantasie der »Herren« und der Schadenweiler Bauern sich maß durch die Art der Maskirungen, die sie vornahmen, denn jene verfertigten »Kostüme«, die ziemlich hübsch waren und irgend etwas Typisches darstellten. Dabei verfuhren sie immerhin nach einer gewissen hergebrachten Schablone, gingen aber selten über die Grenze des Schönen hinaus. Große Sprünge machte aber die Phantasie der Schadenweiler, die selbständig Verkleidungen nach eigener Erfindung hatten, die alle in's Fratzenhafte, Ungeheuerliche gingen. Sie kauften sich Masken mit schrecklichen Gesichtern und langen Nasen, oder malten selbst solche mit Kohle und rother Kreide. Sie nähten ihre alten Kartenspiele oder Stechpalmzweige auf zerlumpte Kleider. Auch hatten sie an einem Stecken eine aufgeblasene Schweinsblase, welche sie in ihrer Maskenfreiheit jedermann, ohne Ansehen der Person, in's Gesicht schlugen. Oder sie hatten irgend ein Werkzeug, das einen betäubenden Lärm verursachte. Damit tollten sie herum, jedermann Entsetzen einjagend. Sie nahmen sich unter den zierlichen Masken des Herrendorfes aus wie die scheußlichen Tritonen unter den zierlichen Nixen des Meeres. – Ihre Jungen steckten sich in Säcke und ließen sich als Bären an einer Schnur führen, wobei sie brummten oder vielmehr bellten wie junge Hündlein.
An der Fastnacht mußte alles theilnehmen, was noch eine Spur von menschlicher Narrheit in sich spürte und dem die Beine noch einige Sprünge erlaubten. Im »Goldenen Löwen«, dem größten Gasthause des Herrendorfes, war Tanz.
Am Abend des Sonntages, da die Fastnacht begonnen, sagte Joseph zu Justine: »Diesmal kommst Du mit, wir wollen auch einmal fröhlich sein, den Leuten fragen wir nichts nach!«
Das Mädchen lehnte entschieden ab.
»Dann bleibe auch ich daheim. Ich habe mich schon lange sehr darauf gefreut, mit Dir hinzugehen und jetzt ist die Freude zu Wasser zerronnen,« sagte Joseph.
Diese Bemerkung und die Zureden Lisbeths, sowie etwas Anderes bewog sie, die Zusage zu geben. Das Andere war der Gedanke, sich mit Joseph auszusprechen, um sich von dem Banne, der auf ihr lag, zu befreien.
Schüchtern trat sie mit ihrem Begleiter in das Getümmel der großen Wirthsstube. Die Masken verursachten einen betäubenden Lärm, neckten die am Tische sitzenden, nicht maskirten Bürger mit hoher Fistelstimme oder schrieen einander in die Ohren: »Kennst Du mich? kennst Du mich?« Die Wirthsstube öffnete sich durch eine breite Thüre nach dem Tanzsaale, in welchem sich nach dem Takte der Musik die phantastischen Paare drehten. Ueber ihnen lag eine Staub- und Dunstsphäre. Von ihrem Platze aus konnten die Beiden in die Mitte des Saales blicken. Hie und da sahen sie, wie eine Gestalt in einer schrecklichen Maske wild durch die Mitte des Saales rannte, an die Tanzenden stieß und sie aus dem Takte brachte. Das waren die Schadenweiler, deren größtes Vergnügen darin bestand, die Andern zu stören. Joseph wurde von der wilden Lust angesteckt, der alte Schadenweiler erwachte in ihm. Er riß zwei Stühle hervor und ließ sich auf einen hinfallen:
»Hätten wir uns nur auch maskirt!« wandte er sich an Justine, »aber wir wollen auch so recht lustig sein.«
»Einen Liter vom Besten!« rief er der Wirthin zu. Er hörte nicht auf Justinens Einwurf: »Nicht so viel!«
Denn Wein zu trinken war selbst im Herrendorfe ein Luxus, da in der Gegend keiner wuchs und sie nur ihren Most hatten. Verstiegen sie sich zu einer Flasche Wein, so erhielten sie nur gepanschten.
Justine aber wurde unter der Menge Menschen ängstlich, sie wäre am liebsten sogleich nach Hause geeilt. Zudem waren sie Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit geworden und die Masken umdrängten sie.
Ein Geselle, ganz von Stechpalmzweigen bedeckt, das Gesicht unter einer schreckbaren Maske verborgen, trat an sie heran, streckte die lange Nase ihr in das Gesicht, daß ihr graute und sie die Stacheln spürte und rief mit quickender Stimme: »So, bist du auch da, Schatz! Komm wir wollen tanzen.« Damit ergriff er sie an beiden Schultern, um sie empor zu ziehen.
Justine stieß einen Schrei des Entsetzens aus und griff nach dem Halse Josephs, der eben einschenkte und deshalb den Wein verschüttete. Dieser fuhr empor und stieß den Burschen zurück, daß er an die hinter ihm Stehenden taumelte.
»Du Bandit, Du Räuber, Schelm!« rief dieser zornig. Ein Schlag Josephs mit der Faust zerbrach ihm die Maske und nun faßten sie einander und rangen.
Justine hatte sich erschreckt erhoben. Da sah sie die scheußlichen, grinsenden Masken mit den rollenden Augen, deren Weiß unheimlich schimmerte, vor sich. »Das feine Dämchen.«
»Das Klosterfräulein!«
»Die Metze!«
So schallte es ihr entgegen. Die vordersten rückten ihr näher, um sie zu umfassen. Der Zorn, den man gegen beide gehegt, kam zum vollen Ausbruch.
Neben und hinter den Hetzern stand eine Menge solcher, welche ihr Vergnügen an dem Auftritt hatten und heulten und mit ihren Instrumenten einen sinnverwirrenden Lärm verursachten. Vom Tanzsaale her kamen lange Reihen.
Justine sank beinahe um, ihr schwindelte.
Joseph warf seinen Gegner zu Boden. Da drang der Schwarm auf ihn ein. Justine faßte ihn und rief: »Führe mich fort!« Er erinnerte sich ihrer wieder, ergriff ihre Hand und arbeitete sich aus dem Haufen, der sich durcheinander wälzte, da Jeder den Andern in der Blindheit für seinen Gegner hielt.
Sie entkamen durch die offene Thüre in die finstere Nacht. Da stürzte der Haufe nach und sie flohen in den Schatten eines Hauses, wo sie regungslos standen. In der Nähe führte ein schmaler Weg nach Schadenweiler. Dort hinunter rannten die Gesellen johlend und fluchend.
Immer noch hielt Joseph Justinens Hand gefaßt. Sie zitterte, durch die ganze Gestalt zuckte es von unterdrücktem Schluchzen. Nun gingen sie still die Dorfstraße hinunter. Der gefrorene Schnee knarrte unter ihren Füßen. Nur schwach drang noch der Fastnachtslärm zu ihnen durch die Nacht.
Sie traten aus dem Dorfe heraus, wo das Feld anhob und links der Hügel aufstieg, an dessen Bord Joseph bei seiner Heimkehr geruht und dabei den grünen Teppich des Schadenweiler Bodens mit verwunderten Augen angesehen hatte.
Sie kamen zum Kreuze und drückten stumm ihre Verehrung aus. Dort schwenkten sie denselben Weg ab, den Joseph gegangen und standen nun im weiten Felde, weit entfernt vom Herrendorfe sowohl als von Schadenweiler.
Hier brach sich das Weinen, das die Furcht bisher unterdrückt hatte, Bahn und Justine schluchzte krampfhaft auf, von Furcht, Scham und großem Weh bewegt.
Joseph wußte nichts anzufangen, er drückte nur ihre Hand inniger.
»Was haben sie nur mit uns!« klagte sie, »warum verachten und verfolgen sie uns?«
Da faßte er sie: »Sie dürfen Dir nichts anthun, ich beschütze Dich!« Nun schwiegen sie. Gespenstisch schimmerte schwach der weiße Schnee durch die Nacht, sonst war alles ruhig. Sie waren aneinandergeschmiegt und Jedes von des Andern warmem Athem angehaucht.
Da küßten sie sich. Da fuhr es wie ein Blitzstrahl durch Beider Körper. Sie küßten sich immer und immer, leidenschaftlich, wild, fest gegen einander sich pressend. Sie rangen miteinander wie Gegner, in süßem Ringkampf.
Da erwachte Justine, ließ die Arme sinken und sagte leise, in erschütterndem Tone: »Es ist Sünde.«
Nun schmetterte sich das Bewußtsein derselben in ihre Seelen und stürzte sie in stummes Entsetzen. Ihnen war wie nach einem Fall und als ob sie vor einem zweiten Abgrund hingen, in welchen sie hinabzustürzen drohten.
Langsam und schweigend schritten sie nebeneinander. Ohne es zu wissen, hielt Joseph die rechte Hand Justinens gefaßt. Sie fieberte.
Bald beschleunigten sie die Schritte und wie von Neuem verfolgt, flüchteten sie dem Hause zu.
Noch einmal riß Joseph das Mädchen an sich, bevor sie ins Haus traten.
Das Licht wirkte beruhigend auf sie, ebenso der Anblick ihrer Hausgenossen. Lisbeth saß, die Strickarbeit auf dem Schooße, träumerisch auf der Ofenbank und fragte bloß: »Seid Ihr schon da?« Katharina und Nazi saßen am Tische und jaßten. Justine setzte sich neben Lisbeth und Joseph in ihre Nähe auf den Steinofen. Beide hingen ihren trostlosen Gedanken nach. Wohin führte ihre Liebe, die nach der Menschensatzung eine verbotene war? Sie sahen keinen Ausweg, schwarz lag die Zukunft vor ihnen. Sich trennen? Justine konnte nicht fort und Joseph mochte nicht daran denken.
Lisbeth blickte verwundert auf die verstörten Gesichter der Beiden. Es schien, als ob sie etwas ahnte.
Bisweilen zog sie die Neugierde aus ihrer Versunkenheit, wenn die Spielenden hart auf den Tisch schlugen.
»Du bist mir sechs schuldig,« rief Nazi.
»Jetzt machen wir nur noch um halbe,« sagte knurrend Katharina.
Sie spielten um Vaterunser. Wer verlor, mußte für den Gewinnenden ein Vaterunser beten. Katharina mußte für den Bruder sechs Gebete sprechen. Jetzt war's ihr zu viel und der Einsatz sollte nur noch das halbe Vaterunser betragen. Die erste Hälfte war das eigentliche Gebet und die zweite der englische Gruß. Sie spielten eifrig, selbst einander betrügend. Keines mochte für das Andere zu dessen Heile beten.
Den Zuschauern wurde beinahe unheimlich. Es schien, als ob der Christus oben an der Wand sich entsetzte ob diesem Mißbrauch des Gebetes, das er die Menschen gelehrt.
Das Weh in den Herzen Beider wurde größer, mächtiger die Gewalt, die sie zueinander hinzog.
Da erscholl Gejauchze vor den Fenstern. Alle schracken auf. Justine ergriff die Hand Josephs, der vom Sitze aufgesprungen war. Die wilde Schaar war, nachdem sie die Verfolgten nicht gefunden, wieder zurückgekehrt. Später, als sie von Wein und Tanz erhitzt waren, wurde der Vorschlag desjenigen, der von Joseph geworfen worden war, nach Schadenweiler zu dessen Hause zu ziehen, mit Jubel aufgenommen. Der Zug diente ihnen zur Abkühlung, daß sie nachher die Lust von vorn beginnen konnten.
Die Bande sammelte sich vor den Fenstern und begann dann ihr Höllenkonzert mit ihren Lärminstrumenten. Wer kein solches besaß, muhte, bellte oder miaute.
Katharina erhob sich zitternd, ihre Karten in den Händen behaltend.
Nun schwieg das Gejohle. Sie pochten an die Scheiben und riefen:
»Klosterfräulein heraus!«
»Der Italiener soll hervorkommen, wir bereiten ihm eine schmackhafte Polenta!«
Solch läppische Reden nebst einer Menge roher Schimpfwörter riefen sie in die Stube.
Als Einer sogar an die Fenster schlug, daß die Scheiben klirrten, wollte Joseph hinausstürzen. Justine hielt ihn zurück. Schnell löschte Lisbeth das Licht aus, so daß sie im Finstern saßen und Nazi brummte.
Bald verstummte der Lärm. Die Leute froren entweder, oder es wurde ihnen unheimlich vor dem finstern Hause, aus welchem ungesehen ein Bengel unter sie fliegen konnte. Und sie hatten gemäß ihren Erfahrungen Grund, in dieser Beziehung vorsichtig zu sein.
Längere Zeit noch saßen die Bewohner der Stube im Finstern.
Der Sturm der Gedanken, die Verachtung gegen die Verfolger, das Gefühl, verfehmt zu sein, die Gewalt der unglücklichen Liebe und ihre Qual hatten den Ausruf Josephs zur Folge, der wie ein elektrischer Funken plötzlich Klarheit in Justinens Seele warf:
»Wir gehen fort!«
»Nach Italien –« jauchzte Justine auf. Die ganze Herrlichkeit jenes Landes stand vor ihren Augen und – ihnen blühte ein seliges Liebeleben. »Diese Nacht noch!« sagte Joseph.
»Dann bin ich allein« sprach leise Lisbeth. Diese einfachen Worte erschütterten die Beiden. Es lag unendlich viel Liebe und Traurigkeit und Trennungsweh darin. Vor Lisbeth lag wieder das einsame, freudlose Leben, das Zanken der Geschwister. »Wir schreiben Dir,« sagte Justine und schlang ihre Arme um sie, »große Briefe, daß Du nicht Langeweile hast.«
Große Beweglichkeit kam in die Liebenden. Schnell fort – zur Vereinigung!
Das Licht wurde wieder angezündet. Bald stand Justine mit ihrem Bündel in der Stube, reisefertig, strahlend vor Freude. Joseph überzählte sein Geld, er hatte wenig davon verbraucht. Lisbeth redete mit Katharina. Dann holte sie in der Kammer einen alten Strumpf. Er war bis zur Hälfte mit Geldstücken gefüllt und zog schwer.
»Da!« sagte sie zu Justine, »werdet glücklich!« Diese reichte ihn Joseph, welcher hineinschaute. Es waren große Thalerstücke darin, auch Gold blinkte dazwischen.
»Sorgt für meine unglückliche Mutter! Wir werden für sie beten.«
Ein dichter Nebelstreif lag über dem Flusse. Die Erlen trugen glänzenden Schmuck in den wunderbaren Formen, die der Reif gebildet. Vom Herrendorfe her drang schwach der Fastnachtslärm. Eine kalte Luft wehte vom Thale herauf. Die zwei Menschen wanderten der Sonne entgegen auf dem Wege, den hinauf vor 20 Jahren der Mann geeilt war.
Von Schadenweiler nach Italien! –