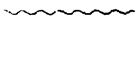|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In unserm Lande greift bei den Leuten von halber Bildung immer mehr ein dem Genius des Schönen feindliches Wesen um sich. Ach, diese Zerfahrenheit in unserem Lande, welchem zu seiner Schönheit und den herrlichen Institutionen nichts fehlt als der Kultus der Schönheit, um es zu einem Hellas zu machen! Wie weit entfernt sind wir noch von jenem Zustand, den unser Gottfried Keller schon im Jahre 1859 gewünscht hat:
»Da nun die niedern Mächte überwunden,
Die gröbern Elemente sich gefüget,
Laßt uns der Schönheit einen Ort bereiten,
Daß sie das Eigenart'ge und Besond're,
Was uns beschränkt, frei mit der Welt verbinde
Und auch bei uns zugleich Gestalt erwerbe
Sie, die oft heimatlos im Aether wohnt.«
Doch wann, hehre Göttin der Schönheit, wirst du nicht
mehr gequält werden?
Gottfried Keller's Städtchen Seldwyla ist, wie der Dichter sagt, eine Vereinigung vieler einzelner im Schweizerland zerstreuter Thürmchen. Das will heißen, die Schnurren und Faxen, die in unserm Land geschehen sind, die seltsamen, sonderbaren Leute, wie der Dichter sie liebt, hatte er alle nach seinem Seldwyla verlegt, so daß die Seldwyler gewissermaßen das Spiegelbild der andern Schweizer sind, die vielleicht mit Verachtung auf das närrische, lumpige Seldwyla herabsehen.
Auf meinen Reisen durch unser schönes Land habe ich einen scharfen Ausblick gehalten nach den Seldwyler Thürmchen. Glücklicher Weise habe ich einige entdeckt.
Ich habe die Heimat des Viggi Störteler gefunden, des Seldwyler Dichters mit den langen, zerzausten Haaren, dem Dichterhütchen und dem feinen Spazierstöckchen.
Die Heimat des Dichters ist nicht nur ein Thürmchen, sondern ein großes Dorf. Daß es ein solches sei, wollen aber seine Bewohner nicht zugeben. Sie nennen den Ort immer Flecken, weil an einer Straße auf beiden Seiten je vier oder fünf Häuser neben einander stehen. Es ist aber doch nur ein Dorf, da die Mehrzahl der Gebäude durch Baumgärten von einander getrennt sind.
Nur hier konnte ein Viggi Störteler werden. Er stellt in seiner Person am reinsten den Charakter der Bewohner dar. Diese sind nämlich wie er Dichter, nur mehr oder weniger, je nach Begabung. Das Dorf ist ein literarisches Nest, doch ohne daß es im Schweizerland zur Anerkennung gelangt wäre.
Dem Orte aber, der in der Zukunft vielleicht eine große Wichtigkeit erlangt, die Anerkennung jetzt schon zu verschaffen, ist mein liebster Wunsch. Denn nicht nur, daß ich den Lohn in mir trage, sondern ich habe Grund zu hoffen, daß ich dereinst von einem jener Dichter verherrlicht werde und Ruhm ernte.
Das Dorf liegt in der denkbar schönsten Gegend. Wie eine Biene, die auf dem Honiggrunde einer Blüthe sitzt und über sich umsonst den Anblick des bunten Blüthenrandes hat, so liegt das Dorf in der schwarzen, fruchtbaren Erde der Hochebene, umkränzt von einer niedern grünen Hügelreihe, die wie der Kelch der Blume sich ausnimmt. Weiter oben, nur etwas weiter weg, blicken in den Grund die Schneefirnen der Alpen, die schönste Blumenkrone. Wenn sich die Bewohner die Mühe nehmen, so sehen sie am Abend diese Blumenkrone in schönstem Feuer erglänzen.
In der Nähe des Dorfes liegt auch ein kleiner, nur eine Stunde langer, blauer See mit freundlichen Ufern, aus denen im Obstbaumwald verborgene Dörfer nur durch die Kirchthurmspitzen ragen. An den Enden des See's liegen zerfallene Burgen, deren Gemäuer man unter wucherndem Epheu suchen muß. An diese Burgen knüpft sich ein duftiger Kranz von Sagen, die heute noch die Großmütter des See's am Abend den Kindern wieder und wieder erzählen.
Wenn man nun aber glauben sollte, die schöne Gegend sei es, die die Bewohner zu ihren poetischen Ergüssen begeistere, so schließt man falsch. Ihrer dichterischen Entwicklung liegen ganz andere Ursachen zu Grunde.
Weil die Einwohner glauben, ihr Ort sei ein Flecken, so halten sie es unter ihrer Würde, das Land, das zum Gemeindebanne gehört, selbst zu bebauen. Vielmehr halten sie Pächter darauf, die Bauern der umliegenden Dörfer, die ihr Land ausnützen, wie die Fuhrleute ihre Pferde. An den bestimmten Zinstagen, die immer auf einen Sonntag angesetzt sind, lassen diese Rentiers ihre Zinsleute kommen und geben ihnen gnädigst nach dem Braten Audienz. Gewöhnlich haben sie die Einrichtung so getroffen, daß Besuch da ist, irgend ein Vetter aus der Stadt, der nur sein Geschäft hat. Wenn dann der Hausherr weggerufen wird, so sagt die Hausfrau oder die Tochter so ganz obenhin: Können denn die Leute nicht zu anderer Zeit kommen, sie machen eine Wichtigkeit aus ihrem Geldchen!
Da die Zinsen aber doch nicht hinreichen, um ein tägliches Müßiggehen zu erlauben, so treiben die meisten Bewohner noch ein Geschäft. Gegen die Straße hin haben sie einen Laden mit großen Schaufenstern. Im hintern Theil des Hauses befindet sich die Werkstatt, wo der Meister mit ein paar Gesellen arbeitet. Vorn im Laden verkaufen Frau und Tochter die im Hinterhause verfertigten Waaren.
So aber Einer durch das Dorf geht, der würde fast glauben, er sei in ein wälsch Dorf gekommen, das in diese Gegend zwischen die andern Ortschaften mitten hinein geschneit worden, wie jene altfranzösische Emigrantencolonie bei Frankfurt am Main.
Wenn er die großen Aushängetafeln liest ob den Ladenthüren und nicht Französisch versteht, so muß er im Schaufenster die Erklärung suchen. Es gibt da Cordonnier, Menuisier, Bottier, Tailleur, Modes, Chapelier, Marchand tailleur u. s. f. Hie und da hat Einer auch noch den deutschen Namen hinzugesetzt für den Deutschen, der sich etwa hieher verirrte. Es ist aber im Gegentheil zu sagen, daß kaum einmal ein Franzose in den Ort kommt. Die Bauern der umliegenden Orte haben schon oft über diese Verwälschungsmanier gelacht, so daß die Bewohner sich täuschen, wenn sie glauben, den Landleuten damit zu imponiren. Es hat im Gegentheil für Erstere noch den Schaden, daß die Dörfler glauben, wo ein solcher wälscher Name angebracht sei, müsse Alles extra theuer sein, und an einen Ort hingehen, wo der Schuster Schuhmacher heißt und nicht anders.
Und ist über genannte Mode zu bemerken, daß sie immer weiter um sich greift und daß die Handwerker selbst in den einsamsten Dörfern ihrem Gewerbe den fremdländischen Namen geben, gleich als ob sie sich der Muttersprache schämten.
Noch habe ich aber die Ursache des literarischen Lebens nicht genannt. Dies rührt nicht etwa von einem reichen Mäcen her, der die Poesie protegierte und dem zu Gefallen sich Alles poetisch anhauchte. Eben so wenig sind die jungen Schullehrer daran schuld, die doch gern so etwas verüben. Nein, von den genannten Läden her, aus dem Geruche von Leder und Tabak steigt die Blume Poesie so üppig auf, wie wenn sie jene Gerüche liebte.
Es liegt hauptsächlich den Töchtern von achtzehn bis zwanzig Jahren ob, des Ladens zu warten und die Kunden zu bedienen. Die Mädchen waren vorher im Wälschland und brachten ein leidliches Französisch mit, davon ein Theil an den Aushängeschildern steht. Außer diesem aber brachten sie noch ein sentimentales, schmachtendes Herz und die Lust am Lesen empfindsamer Liebesromane. Diese wurde mit der Zeit immer größer und wirkte ansteckend, so daß sie jetzt ganz allgemein im Dorfe, ja sogar zur förmlichen Lesewuth geworden ist.
Das Interesse für Romane und Liebesgeschichten ist in den Mädchen so ausschließlich geworden, daß sie nicht mehr die gewöhnlichen Mädchengespräche führen, vom Kochen, von den Kleidern oder von ihren Liebhabern, sondern meistens nur von dem, was sie gelesen, und von dem Autor, in den sie ganz verliebt sind.
Wenn zwei Freundinnen einander begegnen, so fragen sie nicht: »Was machst Du?« oder: »Wie befindest Du Dich?«, sondern sobald sie sich begrüßt haben, sie können kaum warten: »Nicht wahr, die Geschichte in den ›Abendglocken‹ ist rührend und poetisch? Ich habe geweint wegen der treuen Liebe Heinrich's.« Die Andere erwidert dann: »Mich hat's so ergriffen, daß ich den Tag über nichts Rechtes mehr arbeiten konnte. Wie schön und unvergleichlich ist doch die Scene, wo Heinrich mit der Ida im Mondschein unter den Platanen spaziert und Beide so schöne Worte sprechen, daß ich sie nicht einmal mehr sagen kann!«
Die Ursache liegt in Folgendem.
Während die Töchter vor ihren Ladentischen sitzen und auf Käufer warten, die jedoch selten genug sind, wissen sie nichts Anderes zu thun, als zu lesen. Sie lesen nicht etwa Goethe und Schiller. Für diese haben sie die größte Verehrung, weil sie Klassiker sind; ihre Werke haben sie aber nicht gelesen, weil sie zu langweilig sind. So bilden ihren Lesestoff die Romane, die in den gewöhnlichsten deutschen Unterhaltungsblättern vorkommen. Sie lesen auch alle die kleinen Beilagen zu den wöchentlichen Zeitungen wie: »Abendglocke,« »Feierabend,« »Erholungsstunden« u. s. f. Mit welcher Begierde sie auf den Samstag warten, auf die Fortsetzung der Geschichte! Sie lassen die Nummer auf der Post holen und lesen sie schnell, weil Andere darauf warten. Oft bitten sie einen Kunden, sich noch ein wenig zu gedulden, weil sie die schöne Geschichte nicht unterbrechen wollen.
Wenn eine Erzählung gar zu rührend ist, so vergießen sie heiße Thränen. So ist ihre Gefühlsseligkeit zu einer krankhaften Sentimentalität geworden.
In der Gesellschaft, die sich städtischen Anstrich gibt, sprechen sie meist nur von ihren schönen Geschichten. Da sind dann die jungen Männer übel dran, wenn sie nicht mitzusprechen wissen und in den Augen ihrer Schönen gar zu prosaisch erscheinen. Letzteren zu liebe haben sie auch angefangen, sich die Unterhaltungsschriften von diesen leihen zu lassen. Dadurch sind sie in dieselbe Rührseligkeit hineingekommen wie die Mädchen.
Denn in ihren Erzählungen sind so viele Mondscheinnächte nebst unter Bäumen wandelnden Liebenden, schreckliche Verwicklungen, wo die Leute schon vor Schrecken den Starrkrampf kriegen, daß diese romantische Richtung in ihnen festgewurzelt ist. Ihre ungereinigte Phantasie beschäftigt sich mit diesen unharmonischen Bildern und findet sie poetisch. Es gibt deshalb kein Wort, das sie so oft gebrauchen wie das Wort »poetisch.«
Da ihre Erzählungen hauptsächlich Liebesgeschichten sind, wo Liebende durch viele Hindernisse glücklich zusammengeführt werden, und dabei viel Liebesgeseufze vorkommt, werden sie selbst viel liebesdurstiger. Wenn in einer Novelle eine Mondscheinzusammenkunft sich ereignet, die zwei Liebende lesen, so stecken sie sich geheimnißvolle Billets zu, worin eine ähnliche Zusammenkunft an einem poetischen Orte verabredet ist. Während es sonst Brauch war, daß der Liebste zu den Eltern seines Mädchens zum gemüthlichen Abendsitz kam, geben sich jetzt die Liebenden ein Rendez-vous. Bei diesem girren sie wie zwei verliebte Turteltauben. Wenn der junge Mann sonst höchstens wagte, unter dem Tische des Mädchens Fuß zärtlich zu drücken, küssen sie sich jetzt unzählige Male und umarmen sich leidenschaftlich. Dabei gebärden sie sich, als ob ihrer Liebe große Gefahren drohten, und schwören sich ewige Treue, die Alles überwindet. Hierin sind sie nicht sehr verschieden vom edlen Don Quixote.
Bei diesem vielen Lesen haben sie es nicht wie die Kinder, die sich um den Autor nicht kümmern und gar nicht daran denken, daß das Buch von Jemand geschrieben worden sei. Vielmehr werden sie dem Autor zugethan, behalten seinen Namen und lesen eine andere Erzählung von ihm mit um so größerer Andacht. Unter sich erzählen sie von ihm und thun, als ob sie ihn persönlich kennten.
Solcher Dichter und Dichterinnen haben sie schon eine ganze Anzahl zusammengebracht. Sie sprechen viel von ihnen, voraussetzend, es kenne sie Jeder. Es wäre auch beschämend für Jemand unter ihnen, zu bekennen, er wisse nichts von Rosalie Liebenfels, er habe noch nichts gelesen von Curt von Stolzenberg.
So verehren sie eine Anzahl Schriftsteller und Schriftstellerinnen, welche nicht einmal in Kürschners Literaturkalender aufgeführt sind. Bei der Verehrung dieser dunkeln Autoren bleiben sie jedoch nicht stehen, sondern sie werden von Ehrgeiz erfüllt, selbst Schriftsteller zu werden. Ihre durch das viele Lesen erhitzte unreife Phantasie spiegelt ihnen vor, sie könnten auch so etwas machen. Wenn sie eine Erzählung in jener blühenden Stilart, die ihnen so wohl gefällt, gelesen haben, so setzen sie sich im größten Eifer hin und fangen an, eine Erzählung zu schreiben, in der die Personen denselben Charakter haben, nur noch poetischere Namen, und wo die Verwicklung etwas anders ist. Sonst ist die Tonart ganz dieselbe, aus der gleichen Stimmung heraus, in die jene Erzählung sie versetzt; in der gleichen dramatischen Form: kurze herausgestoßene Sätze mit vielen Gedankenstrichen und Ausrufzeichen.
Glücklicher Weise fehlt ihnen aber die Ausdauer, die Sache zu beendigen. Oder die Erzählung wird ihnen vielmehr zu kurz, denn was ihnen schön vorgeschwebt und schön vollendet vor Augen lag, zerrinnt unter ihren Händen und mit ein paar Sätzen haben sie Alles gesagt. Dann scheint ihnen ihr Produkt selbst nicht druckfähig. Sie trösten sich aber leicht, indem sie sagen, es fehle ihnen nur an der nöthigen Ausdauer.
Dagegen produzieren sie auf dieselbe Art Gedichte. Nur unmittelbar nach der Lektüre einer Erzählung ist ihre Phantasie wach und schreiben sie ein Gedicht. Müßten sie ein paar Wochen ohne ihre Romane sein, so wären sie ganz prosaische Leute, die bald fett würden. Bei der Abfassung eines Gedichtes müssen sie die Augen schließen, weil das Tageslicht sie stört. Ueberhaupt steht ihnen die Wirklichkeit im Wege, weil sie sich darin nichts vorstellen können. So machen sie Gedichte, in denen Landschaften geschildert werden, die nirgends vorkommen, die noch formloser sind als die Ossianischen. Sie können aber am schönsten Abend umherwandeln, ohne etwas Poetisches zu fühlen, außer es komme ihnen eine Schilderung eines ähnlichen Abends in den Sinn. Sie wissen auch nicht, wie schön ihre Umgebung ist, und schwärmen nur für die bekannten, eingebildeten Orte der Dichter, wie Arkadien u. s. f.
Sie machen meistens Liebesgedichte und diese ganz elegisch. Es sind meist Klagen über unglückliche Liebe, obschon sie glückliche Liebhaber sind. Die Stimmung in den Gedichten richtet sich nach derjenigen der Erzählung, die sie lesen. Sie ist bisweilen wild, leidenschaftlich, voller Weltverachtung. Oft ist der Dichter, ja sogar die Dichterin kühn atheistisch, wie der Verfasser der Novelle oder des Romans. Im Gedichte stehen große schwere Sätze des Unglaubens. Sie können es aber nicht über's Herz bringen, einmal den Besuch des Gottesdienstes zu versäumen.
Sie sind in ihrer dichterischen Begeisterung naiv, obwohl sie es mit ihrem Dichterberuf ernst nehmen. Ihre Unschuld ist die der Kinder, welche, wenn sie ihr Spielzeug aufstellen, glauben, es sei dies so wichtig wie die Arbeit des Vaters.
Sitzt da ein schöngeistiger Commis oder ein schmachtendes Fräulein einsam bei der Lektüre eines Romans, den er oder sie verschlingt, um an's Ende der Handlung zu kommen. Nun kommt der Lesende zu einer reflektirenden Stelle. Wegen eines schweren Schicksals bricht der Verfasser in Verwünschungen aus über das Elend des Menschenlebens. In schwungvollen Worten drückt er seine Lebensverachtung aus, dieses Lebens, das eine Kette bilde von fortwährenden Täuschungen u. s. f.
Mit steigender Spannung ist der Lesende bis hieher gekommen, Wehmuth im Herzen, tropfende Melancholie in den Augen. Jetzt mag er es nicht länger aushalten, das Herz bricht ihm fast wegen des Menschenelendes und er ist auch voll kühner Lebensverachtung. Er nimmt schnell ein Blatt Papier, reißt den Bleistift heraus und fängt an, ein Gedicht aus dieser Stimmung zu schreiben. In seiner Unschuld braucht er ganz dieselben Worte, die der Autor angewendet hat, glaubt aber nichts Anderes, als er habe jetzt ein Gedicht gemacht wie andere Dichter auch, und freut sich der kräftigen Worte, auch noch über seine zierliche Schrift und die schöne Darstellung, da das Blatt nur in der Mitte beschrieben ist, denn das ist auch noch für ein Gedicht charakteristisch.
Ist das Gedicht fertig, fährt er mit der Lektüre fort. Kommt er nun zu einer Stelle im Roman, wo eine Person in Liebesklagen ausbricht, so macht er ein Liebesgedicht. Diese sind weitaus die häufigsten.
Auf diese Weise wird von den vielen Herren und Fräulein täglich eine ziemliche Anzahl Gedichte geliefert. Wenn Jemand ein Gedicht gemacht hat, so zeigt er es nicht etwa voller Freude einem Andern, nicht einmal seiner Liebsten, sondern hält es sehr geheim, weil er es in die Zeitung schicken will.
Denn der Ort ist so glücklich, eine Zeitung zu besitzen, ein kleines Blatt, wo der Verleger auch einziger Redaktor ist. Die Zeitung führt den Namen »Bote« mit dem vorgesetzten Thalnahmen. In dieses Blatt schicken die Leute ihre Gedichte. Deßhalb suchen sie auch mit dem Verleger recht befreundet zu werden. Wenn sie es sind, so darf derselbe ihnen ihr Gedicht nicht zurückschicken, aber auch schon deßhalb nicht, weil er einen Abonnenten verlieren würde. Das Gedicht steht dann in der Zeitung oberhalb des Leitartikels oder erscheint in der kleinen Beilage am Samstag ohne Namen. Wenn der Dichter vorher sein Gedicht verborgen gehalten hat, so sorgt er jetzt dafür, daß die Leute wissen wer dessen Verfasser ist. Im Geheimen sagt er es Jemand, läßt sich aber von diesem das Versprechen geben, nicht zu plaudern. Dasselbe macht er bei verschiedenen Andern eben so, so daß es am Ende im Dorfe doch allbekannt ist. Zwar trägt ihm dies weiter nichts ein, als die Befriedigung seiner Eitelkeit selbst. Denn die Andern, welche auch Gedichte machen, werden ihm fast feindlich gesinnt und sehen ihn als Konkurrenten an. Dann verachten sie sein Zeug auch, weil Jeder sich für den größern Dichter hält. Doch hat der junge Mann oder das Fräulein den Erfolg, daß wenigstens die Familienglieder stolz zu ihm emporsehen, weil er »gedruckt ist.« Diese sorgen auch dafür, daß sein Ruhm entfernt wohnenden Verwandten bekannt wird.
Weil eine ganze Anzahl solcher Dichter und Dichterinnen im Dorfe sind, hat der Verleger immer eine ganze Menge Gedichte auf Lager und jedesmal bringt die Zeitung eins oder zwei derselben.
Unter dieselben sind die seltsamsten Namen gesetzt, weil jeder Verfasser ein Pseudonym angenommen hat. Diese Namen zaubern die ganze duftige Zeit des Minnegesanges herauf. Die Dichter treten als Gottfried von Straßburg, Frauenlob, Hartmann von der Aue, als Tristan u. s. f. auf. Auch kommen neuere poetische Namen vor wie Edgar von Waldau, Adelbert von Treuburg. Die republikanischen Dichter adeln sich Alle.
Die Dichterinnen lassen sich erkennen an Namen wie Isolde, Gudrun u. s. f. Selbst die ehrwürdige Nonne Roswitha von Gandersheim hat ein neueres poetisches Machwerk geliefert. Weiß Gott, woher die Verfasserin deren Name hat!
Ein Gedicht in der Zeitung hat eine Wirkung wie Werther's Leiden, es ruft eine ganze Menge Nachahmungen hervor, welche auch wieder eingeschickt werden. Oft sind diese Gedichte Antwort auf das Gedruckte.
Wenn der erste Dichter seine Verzweiflung über das Menschenelend ausgesprochen hat und in tiefe Klagen ausgebrochen ist, findet sich eine fühlende Seele, die ihn tröstet, ihn auf das Leben nach dem Tode hinweist oder, da diese Trösterinnen meistens Fräulein sind, auf das »Paradies der Liebe.« Unterschrieben hat sie »die Trostreiche.« Nun schickt er wieder ein Dankgedicht ein als »Verzweifelter.« Gewöhnlich geschieht es, daß in einem solchen Falle Leutchen, die sich als schöne Seelen erkannt haben, Liebesleute werden und sich heirathen.
Wenn ein poetischer junger Mann eine Liebste hat, so richtet er an sie Gedichte in die Zeitung, worauf sie dann antwortet. Dann gibt es eine Zeit lang ein Gegirre, dem das ganze Dorf zuschaut. In ihren Liebesgedichten sprechen die Leutchen ungescheut von Küssen und Umarmungen und den »höchsten Wonnen der Liebe.« Würden aber solche Dinge in ihrer Gegenwart gesprochen, so würden sie schamroth werden. Nur vor dem Papier haben sie keine Scham.
Das Pathos, das die poetischen Leute des Dorfes in ihren Romanen gefunden, haben sie sich auch angeeignet. Ihre Umgangssprache ist deßhalb so poetisch als möglich. Wenn die Leute sich zur Gesellschaft versammelt haben, wird sehr gewählt gesprochen, wenn möglich immer in Bildern, aber in den trivialsten, die nur in einem schlechten Romane vorkommen mögen. Käme ein fremder, natürlich gebildeter Mann herein, so würde er zuerst überrascht sein, so viel Bildung in einem Dorfe zu finden. Bald würde er aber bemerken, welcher Art diese Bildung ist, weß Geistes Kinder die Leute sind, die einander nicht verstehen und doch thun, als verständen sie sich, die vom Gott Orpheus sprechen statt Morpheus.
Zwischen den Familien im Dorfe herrscht unausgesprochene Feindschaft, entstanden aus gehässiger Nachrede. Diese spielt eine große Rolle im Orte. Sie spinnt sich von einem Hause zum andern, kein Mensch bleibt davon unberührt. Diese Fräulein, die Gedichte machen und darin über die untergegangene Liebe der Menschen klagen, die ein liebevolles Herz darbieten, machen in aller Unschuld ihre boshaften Bemerkungen über Andere. Dieselben werden weiter getragen, bis sie das Ohr des Opfers erreichen und hier ein verwundetes Herz machen.
Ein Fremder bringt das ganze Dorf so lange in Aufregung, bis die Neugierde über seinen Beruf und seine Verhältnisse befriedigt ist.
Letzthin nahm ein berühmter nordischer Schriftsteller mit seiner schönen bleichen Frau für einige Wochen Aufenthalt im Dorfe. Die Leute kannten den Namen nicht, merkten aber aus seinem Treiben seinen Beruf. Der ernste Mann arbeitete den ganzen Tag und Nachts gewöhnlich bis um Mitternacht. Das ganze Dorfgespräch drehte sich um ihn. Man fragte den Briefträger nach den Briefen, die der Fremde bekam. Dann machte man sich an ihn. Als er einsam spazierte, trat ein literarischer Commis auf ihn zu, fing ein Gespräch an und gab ihm zu verstehen, sie seien Kollegen, er sei auch Dichter. Von der Zeit an sah man ihn nicht mehr spazieren und nun bildete sich ein ganzer Sagenkreis um ihn. Man bezweifelte, daß er Schriftsteller sei, denn man habe noch nichts gelesen von ihm im »Boten«, er sei wahrscheinlich ein Anarchist, Nihilist oder – ein Freimaurer. Bei den Töchtern aber galt er als verkappter Prinz oder Graf.
Das Geschlecht im Dorfe ist ein schwächliches. Durch das fortwährende Sitzen haben die jungen Männer eingefallene Brust und krummen Rücken bekommen. Der große Ort liefert deßhalb an der Rekrutenaushebung am wenigsten taugliche Leute. Auch dieser Umstand bildet einen Gegenstand des Spottes für die Nachbardörfer.
Nicht einmal bei den pädagogischen Prüfungen stellen sich die jungen Leute gut. Mancher junge Dichter, der im »Boten« gedruckt ist, weiß nicht einmal das Elementarste aus der Vaterlandskunde. Den Geschäftsaufsatz fassen sie in einer Sprache ab, die so schwungvoll ist wie in den schönsten Stellen Shakespeare'scher Dramen, nur wissen die Prüfenden nichts anzufangen damit, weil Alles unverständlich ist.
In diesem sonderbaren Orte kommen, wie leicht zu begreifen, auch viele sonderbare Geschichten vor, die alle darauf warten, gesammelt zu werden, zum Vergnügen des andern, nüchternen Volkes im Lande. Vielleicht erzähle ich einmal eine dieser Geschichten. Oder thut man nicht besser, von so abgeschmackten Leuten lieber ganz zu schweigen?