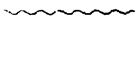|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Auf der Wiese draußen vor der Stadt, dort wo der Hügel beginnt und die Straße gegen den Wald hinführt, wo die Kinder der Vorstadt über den Abhang hinunter kollern und Purzelbäume schlagen, sobald der Frühling wieder die alte Erde mit der Hoffnung austapeziert und überall herrliches Grün und närrische Farben hingemalt hat, dort standen zwei Veilchen. Ganz leise und schüchtern hatten sie einst über Nacht ein wenig hervorgeguckt: da hatte der lustige Gesell, der Frühling, sie angelacht und sie hervorgezogen in die Herrlichkeit und ihnen gesagt: »Seid nicht so schüchtern, ihr müßt mir auch helfen, den Menschen die Erde schön zu machen, damit sie ob der Freude und dem Staunen das Böse vergessen und unschuldige, heitere Kinder werden; wartet jetzt nur fein ruhig, bis sie kommen und von euch Bescheidenheit lernen.«
Und die Veilchen warteten träumend der Dinge, die da kommen sollten. Ihre Veilchenseelen ruhten tief und klar, so daß am Tage ein Sonnenstrahl sich in ihnen badete und Nachts ein Sternchen weit oben am dunkeln Himmel immer auf sie herabsah und seine innige Freude an ihnen hatte. Denn Veilchen und Sternchen müssen einander lieb haben, beide werfen ja Licht in die Menschenseelen, eines auf der Erde, das andere am Himmel.
Die Veilchen mußten aber lange warten, bis etwas geschah. Da wurde es ihnen etwas langweilig, sie schüttelten sich, streckten die Köpfchen empor, wurden munter und betrachteten sich. Da sahen sie, daß sie ja gleich waren und einander also lieb haben müßten. Nur war eines kleiner als das andere, so daß es sich vergeblich streckte und mit dem andern messen wollte, es reichte doch nicht zu ihm hinauf. Darüber wollte es fast ein wenig traurig werden und ein Thränchen wollte sich in sein Aeuglein stehlen. Da lachte das andere es aber aus und sagte: »Du bist ja so schön wie ich, wenn du schon kleiner bist, was willst du dich grämen!« Nun fingen sie an, allerlei Kurzweil zu treiben und wurden bisweilen etwas muthwillig. Wenn sie lange geschwatzt hatten und dann einander in der Bewegung, in die sie gerathen, küssen wollten, so reichte das Kleinere nicht zum andern hinauf und sie mußten's unterlassen. Bisweilen kam ihnen aber der Wind zu Hülfe. Er beugte das Größere zum Kleinern hinunter, so daß sie sich mit den Lippen berühren konnten. Am meisten Schabernack trieben sie, wenn die Frühlingsnacht sie mit Thauperlen beschenkt hatte und dann am Morgen der Sonnenstrahl wieder kam und viele schöne Farben darin glitzern ließ. Da wurden sie ganz ausgelassen. Das größere Veilchen bespritzte das Kleinere mit ganz feinen Tropfen und dieses Spiel gefiel ihnen ungemein. So lebten sie ein fröhliches Veilchenleben. Endlich aber sollte etwas geschehen.
Es war an einem schönen Frühlingstage. Die Sonne warf einen glänzenden Schein über das schöne Gelände und ließ die Farbenherrlichkeit an den Hügeln und in den Gärten so stark leuchten, daß ihre Wirkung auch auf die gefühlloseste Seele nicht ausblieb. Die wohlige Wärme that das Ihre auch, um die Menschen die Schönheit ganz fühlen zu machen und sie heraus zu locken zu völliger Hingabe an das Schöne.
Eine kleine Schaar schöner Fräulein in farbigen Kleidern und wehenden Bändern an den Hüten bewegte sich nebst einer Schaar junger fröhlicher Herren die Straße hinauf und an der Wiese vorbei, wo die zwei Veilchen standen. In mehrere Gruppen zerstreut, die für sich einen eigenen Kreis der Fröhlichkeit bildeten, tauschten sie unbefangen Scherzreden, alle, ohne sich dessen bewußt zu sein, unter dem Banne des gegenseitigen Wohlgefallens. Von der Gesellschaft getrennt, in der allgemeinen Fröhlichkeit unbeachtet, ging hinter her, etwa hundert Schritte von den andern entfernt, ein Fräulein. Sie schien nicht Theil zu nehmen an der allgemeinen Fröhlichkeit, sie trug auch kein hellfarbenes Kleid, wie die übrigen. Das feine Gesicht, das sonst so geeignet schien, heiter und fein zu lachen, war ernst und traurig, die braunen schönen Augen waren in Trauer zu Boden gesenkt. Um die Lippen zuckte es bisweilen, als ob sie sich zum Weinen verziehen wollten. Ein Blick aber auf die fröhliche Gesellschaft vorn ließ sie ihre Trauer etwas vom Antlitz wegzwingen und versenken in das traurige, niedergedrückte Herz, wo sie still, aber um so erfolgreicher fortzehren mußte.
Sie schaute oft unruhig und voll Besorgniß zurück. Es ging dort ein junger Mann in schwarzen, einfachen Kleidern. Er konnte nicht mehr als zweiundzwanzig Jahre zählen. Jedoch sein Gesicht deutete auf ein weit größeres Alter hin. Fein geschnitten, zeigte es doch den Zug jener Energie, die erworben wird durch schweren Lebenskampf von Jugend auf. Es verrieth auch jene Frühreife, die in diesem Kampfe immer gewonnen wird, die es uns schwer macht, das Glück in Dingen zu finden, in denen viele andere es finden.
Wenn solche Naturen es aber einmal finden, da suchen sie zähe es fest zu halten und setzen ihr ganzes Selbst ein, und wenn sie dann das Glück noch verlieren, dann verlieren sie alles – sich selbst.
Er hatte es gefunden und stand in der Gefahr, es zu verlieren. Die dort vorn so traurig ging, die war sein Glück, seine erste Liebe.
Er war Student. Von Gönnern schwach unterstützt, hatte der Sohn der armen Wittwe voll Entbehrungen die niedern Schulen durchlaufen. Als er es dazu brachte, sein höchstes Ziel zu erreichen und die Hochschule zu besuchen, starb die Mutter. Allein in der Welt, hatte er sich auf sich gestellt und den Kampf weiter geführt, voll Entbehrungen, manchen Tag hungernd, fern vom rauschenden Gedränge seiner Commilitonen, getragen durch einen praktischen Idealismus. Er war nahe daran, seine Studien beendigen zu können. Da fiel ein Sonnenschein in sein Herz, zu gleicher Zeit, als wieder die ersten Sonnenstrahlen sich in sein Mansardenstübchen stahlen.
Sie waren einander verschiedene Mal begegnet; er hatte ihr einen kleinen Dienst erwiesen und dann zog die Liebe singend und klingend in ihre offenen Herzen, oder vielmehr, fiel darein, sie wußten nicht, wie, so wie der Sonnenstrahl durch die Zweige auf das grünende Moos. Wie die Sonnenstrahlen, die die Dämmerung aus seinem Stübchen bannten, so räumte die Liebe in seinem Herzen viel altes Spinngewebe auf und spannte darin ihr lustiges Zelt aus, die Wohnung unbekannter, zwitschernder Singvögel. Während sonst wohl die Liebe stumm macht und heimlich seufzend, wie man sagt, ward er fröhlich. Erst jetzt fiel ihm der Mangel jeder Freude auf und suchte er Gesellschaft. Er setzte auch die Wirthsleute in Erstaunen, wenn er jetzt eine Melodie summend, die Stiege hinauf kletterte.
Er war zuerst erschrocken, als seine Geliebte ihm entdeckte, daß sie die Tochter eines reichen Kaufmanns sei. Aber die Hoffnung der Jugend schloß langen Trübsinn aus und zudem hatte er berechtigte Hoffnungen, nach vollendeter Studienzeit eine einträgliche Lehrerstelle zu erhalten. Wie schnell schwand die Zeit ihrer seligen Liebe!
Da fiel ein Blitzstrahl in ihr Glück. Der reiche Kaufmann erfuhr durch einen Zufall die Liebe seiner Tochter zu dem armen Kandidaten. Er war wüthend, seinen Plan einer reichen Heirath durchkreuzt zu sehen. Zuerst beschwor er die Tochter, von dem Geliebten zu lassen, drohte ihr sogar mit dem Fluche und der Verstoßung. Dann, als sie fest blieb, ging er zu dem jungen Manne und suchte ihn durch das Versprechen seiner Hülfe zu weitern Studien zu bewegen, seiner Tochter zu entsagen. Auch er blieb fest. Da fing der Kaufmann an zu kränkeln. Der Ungehorsam seiner Tochter sei sein Tod, sagte er. Das vermochte sie nicht zu ertragen und versprach, sich dem Willen des Vaters zu fügen. Da wurde dieser wieder gesund und verlobte die Tochter dem von ihm gewählten reichen Schwiegersohn. Hochzeitsvorbereitungen wurden getroffen. Die schöne Braut probirte unter Thränen glänzende Kleider. Und der arme Kandidat? Er war vernichtet, als seine Geliebte ihm ihren Entschluß mittheilte. Er mochte sie aber nicht zum weitern Widerstande bewegen. Er war seiner Mutter ein guter Sohn gewesen, durfte sie eine schlechte Tochter sein? Er wußte, daß auch ihr Glück gestört sei, daß sie der Elternliebe ein Opfer bringe, vielleicht ein zu großes Opfer, das Leben.
Nach einer langen Trennung von wenigen Tagen, die er in dumpfem Schmerze verbracht, waren sie in dieser Gesellschaft zusammengetroffen. Sie mußten sich fröhlich zeigen. Zuerst war er vor der Stadt etwas zurückgeblieben und dann sie. Nun gingen sie beide von einander getrennt, aber doch eng verbunden durch das unsichtbare Band des gemeinsamen Unglücks. In welcher Weise durften sie mit einander verkehren, sie die sich in Gedanken für's ganze Leben verbunden glaubten und nun einander doch nicht angehören durften? Getrennte Wege sollten sie von jetzt an gehen. Nicht einmal Abschied als Liebesleute sollten sie von der Gesellschaft nehmen. Ein letzter wehmüthiger Blick und dann das Scheiden!
Er kam nun an den Ort, wo die zwei Veilchen standen. Bevor das Unglück eingetroffen, hatte er der Geliebten Veilchen geschickt. Jetzt erinnerten sie ihn an die Größe des zu verlierenden Glückes. Zum letzten Male wollte er ihr Veilchen schenken – zum Abschied. Er trat über die Straße auf die Wiese und pflückte die Veilchen, die da am Raine den Duft ihrer feinen Seelen aushauchten. Die zwei Freunde zitterten vor Erwartung. Jetzt sollten sie etwas erleben. Er nahte nun auch ihnen. Seine Hand bewegte sich auf sie herab, fast wollten sie sich zurückziehen vor Schrecken. Jetzt, jetzt brach er das größere Veilchen und steckte es zu den übrigen. Das kleinere, das bescheiden im Grase verborgen war, bemerkte er nicht und ging. Nicht einmal Abschied konnten sie von einander nehmen. Als sich das größere Veilchen von seinem Staunen erholt hatte, sah es sich um. Es war mit vielen andern größern und kleinern Veilchen zu einem schönen Sträußchen zusammengebunden. Die dufteten zusammen so stark, daß das Veilchen fast betäubt wurde. Vorher hatte es gar nicht gewußt, daß sie einen solchen Duft hätten.
Als es das traurige Antlitz des jungen Mannes sah, fühlte es tiefes Mitleiden mit ihm und beschloß, heraus zu finden, was ihn so traurig mache. Es hatte nun Acht auf alle Bewegungen des Mannes.
Er lief jetzt schneller vorwärts, indem ein liebevoller Blick entweder die wandelnde Gestalt vorn oder die Veilchen traf. Endlich erreichte er das Fräulein. In großer Bewegung hielten beide still. Mit einem flehenden Blick, in dem sich das tiefe Herzensweh aussprach, blickte sie ihn an wie ein verwundetes Reh, ihn stumm um Verzeihung bittend. Ohne ein Wort zu sagen, überreichte ihr der junge Mann die Veilchen. Sie nahm sie und zugleich fiel eine heiße Thräne auf das Veilchen. Dieses spürte das Zittern ihrer Hände und ihres ganzen Leibes. Nach einem tiefen, bis in die Seele sich senkenden, liebevollen Blicke eilten die zwei Menschen mit schnelleren Schritten den übrigen nach. Die Gesellschaft hatte von dem Vorgang nichts bemerkt und nahm sie bald auf in ihr Gedränge, wo der Schmerz vom Gesichte weggebannt und die Thräne im Auge ausgewischt sein mußte.
* * *
Das Veilchen war schon eine geraume Zeit in dem glänzenden, schweigsamen Hause. Es neigte sich seinem Absterben zu. Die meisten seiner Kameraden lagen welk und todt. Auch das Einsame sehnte sich, das Haupt hinzulegen. Eine Zeit lang hatte es sich seines Freundes wegen gegrämt, dann aber hatte es sein Leid vergessen beim Anblick des tiefen, menschlichen Elendes, das sich ihm, unter glänzender Hülle, dargeboten.
Die schöne, bleiche Braut war an jenem Tage schweigsamer als sonst heimgegangen. Auch das Haus durchwehte unheimliche Stille, denn es wandelte ein unglückliches Wesen darin um. Selbst die Dienstboten fühlten es und wurden still. Es schien ein drohendes, Verderben bringendes Gespenst in der Luft zu schweben. Und der Kaufmann betrieb die Zurichtungen zur Hochzeit. Je näher diese heranrückte, desto bleicher wurde die Braut. Von ihrem ungeliebten Bräutigam kehrte sie jedes Mal unglücklicher in ihr stilles Gemach zu dem Veilchen. Dieses mußte ihr ganzes Elend ansehen. Es wollte ihm fast das Herz brechen, wenn die Braut es mit tiefer Wehmuth ansah, dann laut aufschluchzte und ihr Gesicht unter krampfhaftem Schluchzen in die Kissen verbarg. Das Veilchen sah, wie das schöne Wesen dahin welkte gleich ihm und den Kameraden.
Und endlich brach im Sturme die Blume.
Im schwarzen Sarge vor dem Hause aufgebahrt, lag sie wie eine Lilie, jetzt endlich herrscht Ruhe und Frieden im Gemüthe. Eine weiße Rose steckte ihr im Haare. Auf ihrer Brust lagen die Veilchen, unscheinbar, ohne Duft mehr, neben ihren anspruchsvolleren Geschwistern, den Rosen und Nelken. Nur unser Veilchen lebte noch etwas. Es sah, wie Freunde und Verwandte sich über das todte, schöne Wesen neigten und schluchzten, es sah, wie der strenge Vater gebrochen war und keine Thränen finden konnte. Eine Fülle von Rosen bedeckte die Veilchen fast. Jetzt kam auch noch ein Mann, ein Verwandter der Braut. Er trug einen schönen Strauß Blumen und wollte die schöne, todte Braut damit schmücken. Da sah er die farblosen, todten Veilchen. Er konnte nicht begreifen, wie sie dahin gekommen, zwischen die schönen Blumen. Er warf sie weg und legte sein Bouquet an ihre Stelle.
Die Veilchen fielen auseinander. Ein Lufthauch führte das eine dahin, das andere dorthin. Einige blieben liegen. Unser Veilchen, das kaum noch lebte, wurde fortgetragen. Der Wind führte es eine Strecke weit fort und ließ es wieder fallen. Dann hob er es wieder auf und so kam das Veilchen nach und nach durch die Straßen, bis vor das Thor, wo sich an die Mauern die schönen Baumgärten schmiegen.
Das andere, kleinere Veilchen hatte eine schwere Zeit verlebt. Eine Zeit lang hatte es immer nach seinem Freunde getrauert. Vorbei waren Spiel und ergötzliche Unterhaltung. Einsam und ohne Freude mußte es dastehen und sah nirgends hin als an den Himmel. Nach und nach wuchs das Gras über das Veilchen hinaus.
An diesem Tage war es fast ganz verwelkt. Müde hing sein trübes Köpfchen herab. Es fühlte beinahe gar nichts mehr, nur die Erinnerung an seinen einstigen Freund ging durch seinen Sinn. Es konnte nicht mehr hoffen, ihn zu sehen, er war ja schon so lange verschollen! Da kam ein Wind daher und wirbelte viele todte Blümchen über das Veilchen hinweg. Eines fiel gerade bei ihm nieder. Das Veilchen fuhr auf. Es wurde wieder frisch. Es war sein Freund, der, müde und welk bei ihm niedergefallen. Beide waren ganz stumm vor Bewegung. Da fing das Veilchen, das fortgewesen, endlich wehmüthig zu sprechen an: Nun sind wir beide gleich müde und nahe am Sterben, Du aber bist einsam hier gestanden und ich bin bei den Menschen gewesen. Wir brauchen sie nicht zu beneiden. Sie haben so großes, tiefes Elend zu tragen, daß wir Veilchen es kaum ertragen können, es anzusehen. Deßhalb bin ich auch schnell müde und krank geworden. Ich bin nur froh, daß ich noch bei Dir sterben kann. Und die Veilchen sanken nieder und hauchten ihr schönes Leben aus.