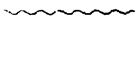|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In ein nordschweizerisches Städtchen, das die andern, kleinern Städte des Kantons mit dem Namen »Philisterstädtchen« beehrt, bringt der Bahnzug jeden Morgen ein großes Paket Exemplare einer bekannten Zeitung. Der Postbote, der dieselben in die Häuser trägt, ist jedesmal sehnlich erwartet und zwar nicht allein, weil er etwas Unbekanntes in einem Briefe bringen kann, sondern auch wegen der Zeitung.
Denn die Väter im Städtchen sind so eifrige Politiker, wie ihre Töchterchen eifrige Leserinnen guter Geschichten. Deshalb wird die Zeitung in jedem Hause von zwei oder drei Personen erwartet. Der Vater liest den politischen Theil, die Tochter denjenigen unter dem Strich, wofür der Vater keinen Blick hat.
Es tritt dann jeweilen die große Frage auf, wer die Zeitung zuerst lesen soll. Gehen die Geschäfte der Politik flau, so hat es das Töchterchen leicht, das Blatt zu erhalten und seinen Theil zu lesen. Geht aber etwas Wichtiges vor am politischen Himmel, so will der Vater die Zeitung zuerst und das Töchterchen hat einen schweren Stand.
Der Kampf in der großen Welt verursacht einen kleinen in der häuslichen. Es handelt sich darum, ob die Politik siegt oder die schüchterne Belletristik.
In solcher Weise war der Kampf entbrannt, als das wackere Bulgarenvölklein von einer brutalen Politik geknechtet wurde und die Zeitungen jeden Tag bedeutende Nachrichten brachten.
Der biedere Zuckerbäcker des Städtchens befand sich in fortwährender Aufregung. Als richtiger Schweizer war er ein Freund der Bulgaren und hatte schon manchen kräftigen Fluch hervorgestoßen aus Zorn über die ohnmächtige europäische Politik. Vor dem Zaren hatte er nicht den geringsten Respekt. Sobald dessen Name genannt wurde, sprach er entschieden aus: »Ist ein verrückter Kerl, sollte eingesperrt werden.«
Da er ein gutes Herz hatte und für jeden Unterdrückten Mitgefühl besaß, so hatte er, als richtiger Bürger des Städtchens, das schon oft dergleichen ausgeheckt, den Vorschlag gemacht, an den »Helden von Sliwnitza« eine Sympathieadresse zu senden.
In seiner Stammkneipe waren die Genossen dafür begeistert gewesen. Alle waren aufgestanden, hatten ihre steinernen Krüge, die sie als Stammgäste vom Wirth gratis erhalten, erhoben und donnernd gerufen: »Hoch Alexander von Bulgarien! Pereat Alexander von Rußland!« Sie hatten vergessen, daß sie, als Republikaner, eigentlich einen Fürsten nicht durften hoch leben lassen.
Aus der Sympathieadresse wurde es aber nichts, weil keiner sie verfaßte. Auch der Zuckerbäcker brachte sie nicht zu Stande. Er verstand wohl, zu geeigneter Stunde einen guten Toast auszubringen; aber einen Brief an einen Fürsten zu schreiben, wenn man nicht weiß, was für eine Sprache die reden! – Das ist etwas anderes. Er setzte sich oft hin und schrieb auf ein schönes Blatt: »An Seine Hoheit Fürst Alexander von Bulgarien.« Weiter aber kam er nicht, denn er war nicht recht sicher, ob das richtig geschrieben sei. Das »Seine« erschien ihm ein etwas sonderbarer Sprachgebrauch. Fragen mochte er nicht. So unterblieb die Sache.
Desto eifriger las er aber die Nachrichten aus Bulgarien. Er wollte deshalb jeden Morgen zuerst die Zeitung. Das Töchterchen Paula aber wollte sie auch. Da der Vater gewöhnlich zur Zeit, da sie gebracht wurde, sich in der Bäckerei befand, erhielt Paula sie zuerst und machte sich sogleich an das Feuilleton. Sie hatte aber jeweilen kaum angefangen, so kam der Vater und verlangte die Zeitung. Paula gab, wenn sie schon vom Inhalte gefangen genommen war, das Blatt nicht gerne fort und bat flehentlich, fertig lesen zu dürfen. Der Vater war aber auch ungeduldig und nahm ihr dann etwas barsch die Zeitung weg, mit dem Bemerken, ihr Lesen nütze nichts, im Feuilleton stehe dummes Zeug. Paula war dann verletzt und verglich sich seufzend mit dem unterdrückten Bulgarenvölklein, von dem der Vater seit einiger Zeit bei Tische immer erzählte. So wurde der biedere Zuckerbäcker, ohne daß er es ahnte, der Zar Alexander, den er so sehr haßte.
An einem schönen Herbstmorgen jenes Jahres nun, als die Verhältnisse in der genannten Weise lagen, stand das anmuthige Töchterchen des Zuckerbäckers im Laden und sah auf die Straße. Es langweilte sich und trug die Langeweile zur Schau auf dem feinen Gesichtchen, das eine gesunde, rothe Farbe hatte, wie man sie sonst bei Zuckerbäckerstöchtern nicht findet. Das kam daher, daß sie von den schönen Sachen, die im Schaufenster standen, kaum versuchte, wenn sie gemacht wurden. Das reiche Haar, das sonst auf der Straße in einem schönen blonden Zopfe hinunterhing, hatte sie unter ein weißes Häubchen gebunden, damit es nicht in zu nahe Berührung kam mit den Süßigkeiten und es vornehmen Frauen nicht eckelte, wenn sie zu kaufen kamen. (Bei den jungen Leuten des Städtchens hätte sie das nicht fürchten müssen.) Die obligate weiße Schürze hatte sie nicht ohne Weiteres vorgebunden wie der Vater, sondern hatte einen Zipfel zierlich heraufgezogen.
Weil keine Kunden kamen, langweilte sich Paula und sah hinaus ohne zu sehen. Sie bemerkte deshalb die Kinder nicht, welche die Gesichter an die Schaufenster preßten und die Herrlichkeiten mit den Augen verschlangen, zugleich aber die erst abgeriebenen Scheiben wieder trübe anhauchten.
Paula erwartete auch sehnlich die Zeitung. Gestern war im Feuilleton der Schluß einer Kritik erschienen, mit der sie nichts anzufangen gewußt hatte. Sie war etwas erzürnt auf den Redaktor, daß er solche Sachen brachte und nicht wie sonst schöne Erzählungen. Sie setzte ihre Hoffnung auf die heutige Nummer und war gespannt auf das, was sie bringen würde.
Der Postbote kam aber lange nicht heute. Sie wurde endlich ungeduldig, trat vor die Thüre und sah nach der Richtung, da der Briefträger kommen mußte. Endlich erblickte sie ihn, der gar keine Eile hatte. Sie ging ihm entgegen. Da stand der alte Spötter still und wartete auf sie: »Keinen Liebesbrief diesmal, schöne Paula.«
»Wie wenn ich deren schon bekommen hätte!« schmollte sie, nahm hastig die Zeitung aus der ausgestreckten Hand und sprang in den Laden.
Der alte Briefträger blieb überrascht stehen: »Wird die auch noch stolz wie die Andern,« brummte er, »die jungen Mädchen von heute scheinen keine Liebesbriefe mehr zu erhalten, sonst wären sie freundlicher mit unsereinem, machen scheints alles mündlich.«
Diesmal blieb Paula nicht im Laden, wo der Vater die Zeitung wahrscheinlich bald geholt hätte, sondern sie ging auf ihr jungfräuliches Zimmer und schlug das Blatt auseinander. Enttäuscht legte sie es nieder.
»Die drei Löwen zu Weidlingen,« las sie, »nun gibts wieder eine Menageriegeschichte, worin in einem Orte drei Löwen ausbrechen und allerlei Verwirrung anrichten.«
Sie fühlte aber doch in sich die Verpflichtung, die Erzählung zu lesen. Sie war nach und nach in ein Freundschaftsverhältniß zum Redakteur getreten und nahm Antheil an Allem, was er schrieb. Sie erzählte ihren Freundinnen von ihm, wie wenn sie ihn kennte. Nur jeweilen am Sonntag wurde sie böse auf ihn, wenn er die schriftstellernden Leute, vor denen sie insgesammt eine große Achtung hatte, so streng beurtheilte und beißend verspottete.
Auch diesmal sollte sie böse auf ihn werden.
Die Erzählung fing nicht mit einer Menagerie an, von keinen Löwen war die Rede. Wohl aber von einem freundlichen Städchen mit einer großen Bibliothek, die fleißig benützt wurde, hauptsächlich von den jungen Mädchen, daß sie alle etwas romantisch geworden wären und daß die Bibliothek daran Schuld gewesen sei.
Während des Lesens machte sich am feinen Halse des Mädchens eine kleine Röthe bemerkbar. Im Weiterlesen wurde sie immer größer und verbreitete sich über das ganze Gesicht. Ihr Athem ging schneller und sie konnte nicht mehr stille sitzen. Sie fühlte sich getroffen, denn sie las ja auch viel.
Und nun war sie wirklich böse auf den Redakteur.
Es schien ihr, als habe er alles auf sie bezogen. Sie stand gereizt auf und war im Zorne schöner als sonst. »Was geht ihn auch mein Lesen an,« sagte sie sich, »er hat gewiß auch viel lesen müssen, bis er selbst Erzählungen schreiben konnte.«
Nun schämte sie sich aber, in Zorn gerathen zu sein. Auch hatte sie ein etwas schlechtes Gewissen. Sie hatte das Gefühl, als ob der Schriftsteller gesehen, wie sie auf ihn zürnte. Ruhiger nahm sie das Blatt wieder zur Hand. Im Folgenden stand von den Zeitungen, die das Städtchen besaß und die einander befehdeten. Auch dies war der Wirklichkeit gemäß, nur führten die Zeitungen des Städtchens andere Namen und nicht so komische.
Damit schloß für heute die Erzählung. Paula war aber doch froh, daß darunter stand »Fortsetzung folgt.« Denn ihr Interesse war auf eine Weise geweckt worden, daß sie die Erzählung zu Ende lesen mußte.
Sie trug die Zeitung nun in den Laden hinunter, wo wirklich der Vater schon darauf wartete und etwas brummte, als er sie in die Hand nahm.
Am folgenden Tage siegte wieder die Belletristik über die Politik. Paula eroberte sich durch den gleichen Kunstgriff wie am Tage vorher die Zeitung. Erregt begann sie mit der Lektüre der Erzählung. Und nun erröthete sie wieder, noch stärker als gestern.
Es traten in der Erzählung drei Mädchengestalten auf, die mit leiser Ironie geschildert waren. Denn zwei von diesen hatten im höchsten Grade die Romantik in sich aufgenommen, doch eine mehr als die andere. Wieder lief Paula das Blut in die Schläfe, als sie in dem einen der romantischen Mädchen sich selbst erkannte. Mit etwas Genugthuung erkannte sie in dem andern romantischen Kinde ihre Freundin Hilda.
Paula wurde wieder mit dem Erzähler versöhnt, als er im Folgenden ihre Freundin und sie gegeneinander abwog und fand, daß bei ihr die Romantik etwas fremdes sei, zu ihr gar nicht passe und daß in kurzer Zeit ihre gesunde Natürlichkeit siegen werde.
Sie erinnerte sich nun verschiedener Vorfälle, wo sie sich geschämt hatte, als Hilda sich gar zu sonderbar und romantisch benommen hatte. So traf auch in dem der Erzähler die Wirklichkeit.
Dann empfand Paula fast etwas wie Schadenfreude, daß Hilda weniger glimpflich als sie behandelt war gerade wegen des größern Maßes Romantik, deretwegen sie ihre Freundin sich überlegen gefühlt und sich deswegen ihr immer untergeordnet hatte.
Anderseits war sie erfreut, daß sie sich bessern sollte. Sie empfand nun zum ersten Mal das Gefühl eines Menschen, der sich beobachtet, und zum Objekt seiner selbst wird. Denn bisher hatte sie sicher gelebt wie ein Kind. Nun wurde sie auf einmal gestört und unsicher. Nach der Prophezeihung des Schriftstellers sollte in nächster Zeit etwas in ihr vorgehen und diese mysteriöse Zukunft versetzte sie in Unruhe.
Diese vergaß sie aber ganz, als das Folgende ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Dies war allerdings geeignet, ein schönes Mädchen von siebzehn Jahren zu fesseln.
Ein junger Mann kam als Gehülfe in die Apotheke des Städtchens, wo die Geschichte spielte. Herr Brausch, so hieß der Neuangekommene, war eine hünenhafte Germanengestalt mit blondem Haar und blauen Augen. Er war der ächte, etwas schwerfällige Deutsche mit ehrlichem, kernhaftem Gemüth. Sein Erscheinen im Städtchen erregte natürlich nicht wenig Aufsehen, wie etwa ein König in einer großen Stadt. Nicht am geringsten war die Aufregung der drei Mädchen, die nicht verfehlten, durch Paradiren vor der Apotheke sich dem interessanten Fremden bemerkbar zu machen. Sie wagten es sogar, bis in die Nähe des Herrn Brausch zu dringen durch eine List, die alt ist: Die Neugierde wurde durch Geschäftigkeit verhüllt. Die Mädchen gingen in die Apotheke um etwas zu kaufen, was sie nie brauchen konnten. Dabei begann die stille Beziehung zwischen dem Gehülfen und dem dritten Mädchen, das gar nicht romantisch war: Die Kristallelemente schossen zusammen, wie Gottfried Keller den geheimnißvollen Vorgang nennt, wenn in zwei Seelen der gleiche Schlag fällt.
Wieder war Paula in Bestürzung. Sie wußte nicht, ob das mit natürlichen Dingen zugieng. War denn der Schriftsteller ein Zauberer, der in alle Herzen sah, wie der hinkende Teufel durch Madrids Dächer? (Paula hatte glücklicherweise »le diable boiteux« nicht gelesen, sondern nur in einem Romane den Vergleich). Oder war ihr Herz ein Spiegel, der wiederspiegelte, was sie selbst nicht wußte?
Vor zwei Wochen war ein neuer Gehülfe in die Löwenapotheke gekommen, auch ein junger Deutscher, Namens Hausmann. Er war nicht von so herkulischer Gestalt wie Herr Brausch, auch nicht von etwas phlegmatischer Gemüthsart, sondern im Gegentheil ein feiner, lebhafter Mann, der sich schnell und gebildet ausdrückte, auch in einem Augenblicke vor den schönen Mädchen so viele Schmeicheleien ausgeschüttet hatte, daß sie kaum zur Besinnung kamen von der Betäubung dieses lieblichen Weihrauchs.
Wie den Mädchen in der Erzählung, war es Paula und den Freundinnen ergangen, als mit Herr Hausmann neuer Gesprächsstoff in die Unterhaltungen über die Gasse, kam. Noch am gleichen Tage war Hilda zu ihr hereingestürmt mit dem Rufe: »Wir müssen den neuen Apotheker sehen, er soll ein ächter Deutscher sein, könntest Du nicht jetzt etwas holen in der Apotheke, ich würde Dich begleiten?« Paula hatte sich geschämt, eines Mannes wegen einen Gang zu thun und hatte Ausflüchte gemacht. Bestimmt hatte aber Hilda gesagt: »Du holst Ananas, ich bezahle sie Dir.« Das hätte Paula nicht geschehen lassen, sondern hatte nachgefragt, ob keine Kommission zu verrichten sei. Zufällig hatte gerade etwas gefehlt, das aus der Apotheke zu beziehen war und Paula hatte den Auftrag erhalten, dasselbe zu holen. Damit war ihr Gewissen erleichtert gewesen: Sie mußte ja gehen.
Der Besuch beim Apotheker war ähnlich ausgefallen, wie derjenige der drei Mädchen in der Erzählung. Nur waren die Kristallelemente nicht zusammengeschossen, sondern hatten sich nur ein wenig gegeneinander hin bewegt, wie etwa Eisenspäne, wenn man ihnen mit dem Magneten Unruhe verursacht.
Der gegenseitige Eindruck war kein tiefer gewesen. Der Herr Apotheker hatte für alle dieselbe Freundlichkeit. Offenbar wollte er nicht dadurch, daß er einer Einzigen den Apfel gab, einen trojanischen Krieg verursachen.
Hilda schwärmte wohl seither von »Blond der Haare, Blau der Augen.« Aber das war nur, weil sie überhaupt für etwas schwärmen mußte. Eigentlich war sie etwas erzürnt auf den Apotheker, daß er sie, die doch über Paula stand, gleich wie diese behandelt und nicht sofort erkannt hatte, daß sie interessanter sei. Sie war sogar nicht ganz sicher, ob sie nicht gesehen hatte, daß sein Blick mit mehr Wohlgefallen auf Paula geruht als auf ihr.
Das war gewesen, weil Paula vor den Blicken des Gehülfen ein schlechtes Gewissen bekommen hatte, verlegen geworden und erröthet war, so daß sie schöner ausgesehen als Hilda, die den Gehülfen stolz gemustert hatte, deren Gesicht aber so weiß geblieben war wie zuvor.
Doch müssen wir wieder zu Paula zurück, die wir bei der Lektüre des Feuilletons verlassen haben. Bei der Stelle, wo der Sturmangriff der drei Mädchen auf Herrn Brausch geschildert war, wurde sie unzufrieden mit sich selbst. Nun da sie sich in diesem ironischen Spiegel sah, kam sie sich häßlich vor. Sie war mit Hilda in die Apotheke gegangen, ohne sich der Ursache bewußt zu sein. Nun erkannte sie diese. Es war das unbewußte gegenseitige Wohlgefallen, das die jungen Leute in gewissem Alter zu einander hinzieht und auch aus demselben Grunde zurückstößt, der jetzt Paula ärgerlich machte: Sie wollte dieses Wohlgefallen nicht gestehen. »Was bekümmerte sie sich um diese ungeschlachten Männer!«
Sie hatte das Blatt kaum niedergleiten lassen, als Hilda eintrat. Diese konnte von der hintern Seite in das Haus gelangen und hier eintreten, ohne daß sie von Jemandem im Hause bemerkt wurde. Im andern Falle wurde sie als Besuch behandelt und mußte eine Weile bleiben. Das war ihr aber unbequem, weil sie öfters nur schnell kam, um Paula eine Neuigkeit zu sagen und dann wieder ging. Sie kam auch gerne, weil sie von Paula jedesmal einige Süßigkeiten erhielt, die sie sehr liebte. Sonst liebte sie Paulas Eltern nicht besonders, weil sie ihr zu hausbacken erschienen.
Jetzt fiel ihr Blick auf das Blatt und sie sagte: »Ah, Du liesest das Feuilleton! Deswegen komme ich gerade. Hast Du vom Apotheker gelesen? Ich glaube, das ist Herr Hausmann. Der Dichter hat ihn nur etwas verändert. Am Ende hast Du das nicht einmal bemerkt und hast die Erzählung wieder hingenommen, ohne etwas dabei zu denken!«
Wenn sie gewußt hätte, wie viel Paula dabei gedacht! Sie war nicht erröthet wie Paula, hatte sich nicht getroffen gefühlt, weil sie kritisch, Paula aber unbefangen an die Erzählung getreten war. Auch hatte sie die einleitende Schilderung als langweilig nur flüchtig gelesen, um zur Hauptsache zu kommen. Diese war dann erschienen in der Person des Apothekers, mit dem sich sofort ihre Phantasie beschäftigte. Dabei stellte sie sich immer Herrn Hausmann vor und setzte diesen consequent an Stelle des Herrn Brausch. Die große Verschiedenheit Beider beachtete sie nicht, beide waren ja Apotheker und zudem Deutsche. Das war bei ihr leicht möglich, weil sie sehr phantastisch war und die heterogensten Dinge verband.
Hilda war kein gewöhnliches Mädchen, d. h. von jener Art, die aber immer gewöhnlicher wird, Dank der neuern Mädchenerziehung. Sie verstand von den Hausgeschäften kaum so viel als einer ihrer Brüder. Sie bedauerte auch alle ihre Freundinnen, welche sich mit dem prosaischen Kochen abgeben mußten.
Sie hatte als Schulkind nicht mehr und nicht minder Talent besessen als Paula. Sie waren aber in der Schule frühzeitig zu ästhetischen Produktionen angehalten worden und diese hatten ihr ganzes Wesen hinaufgeschraubt; auf Paula hatte dies keine Wirkung gehabt. Hilda dagegen, etwas ehrgeizig, hatte Gefühl und Phantasie zu sehr angestrengt. Diese Ueberreizung des Gemüthes hatte sich bei der spätern Romanlektüre gesteigert bis zur Unnatürlichkeit. Dann trat ein Rückschlag ein. Das Maß der Gefühle war nicht so groß, um nicht aufgebraucht zu werden. Hilda wurde kaltherzig. Sie lernte zu früh aus den Büchern die Menschen kennen mit ihren Schwächen und, weil das Herz zuletzt nicht mehr fähig war, die Aufregungen zu vertragen, wurde sie kühl und verständig. Als junges Mädchen kannte Hilda die Welt so ziemlich, war über ihre eigene Bestimmung klar und hatte jeden Duft der jugendlichen Unbefangenheit verloren.
Dann schwebte über dem Ganzen die Phantasie, die sich auf Kosten des Gemüths stark entwickelt hatte. Diese täuschte sowohl sie selbst als die Andern, indem dieselbe sie zu allerlei Handlungen führte, die sie noch kindlich erscheinen ließen. So spielte sie eigentlich Komödie, ohne sich dessen bewußt zu sein.
Als sie auf die höhere Töchterschule kam, führte sie ein eigentliches Phantasieleben. Sie beherrschte alle ihre Mitschülerinnen, ohne eine bessere Schülerin zu sein als jene. Das kam daher, daß sie tausend sonderbare Einfälle hatte, welche ihre fleißigen Mitschülerinnen in Erstaunen setzten. Sie wußte auch über Sachen zu sprechen, die außer dem Gesichtskreise der Andern lagen. Aus allen ihren Vorkommnissen machte sie ein großes Wesen. Selbst die kleinsten Dinge stellte sie interessant dar. Sie regierte die Stimmung der Klasse vollständig, indem sie Vorfälle komisch darstellte oder andere melancholisch färbte.
So konnte sie fröhlich lachen und im nächsten Augenblick niedergeschlagen sein oder weinen, und die ganze Klasse folgte ihr in allen Stimmungen getreulich nach. Und doch war keine wahr.
Sie galt für mitleidig, weil sie fast in Ohnmacht fallen konnte, wenn sie Blut sah, auch wenn eine Freundin sich leicht verletzte. Diese wären für sie durch das Feuer gegangen, wenn sie ausrief: »Hätte es doch mich getroffen, so schmerzte es mich weniger.«
Aber dann und wann blitzte die Kaltherzigkeit hindurch, wenn das Unglück einen Armen traf und sie, wenn die Freundinnen jammerten, tröstete: »Es ist ja nur ein Armenhäusler.«
Eigentlich verkehrte sie nur aus Güte mit den andern Mädchen, die so tief unter ihr standen. Sie kannte alle ihre Schwächen, zog sie, wenn sie Streit mit ihnen hatte, unbarmherzig hervor, so daß die armen Mädchen ganz unglücklich wurden, sich aber doch wieder willig unter ihr Joch beugten.
Hilda versöhnte sie auch leicht wieder, denn sie brauchte ihre Freundinnen. Wie Kinder ihre Puppentheater haben, besaß Hilda ein solches in ihren Freundinnen. Sie dienten ihr dazu, ihre Phantasieen auszuführen. Und ohne daß sie es merkten, spielten die Mädchen Rollen in den ungeschriebenen Schauspielen ihrer Freundin. Hilda wollte alle die Verhältnisse, die sie in den Romanen traf, im Leben finden. Sie wußte dann, indem sie ihre Freundinnen und ihre Brüder benützte, diese Verhältnisse herbeizuführen. Ein dramatischer Dichter hätte von ihr lernen können, wie man Verwicklungen herbeiführt.
Es entstanden so kleine Lustspiele, die keinen andern Zuschauer hatten, als ihren Urheber. Die Spieler selbst wußten nicht, daß sie die Puppen waren, die wie durch Drähte verbunden waren.
Es entstanden aber auch Trauerspiele. Die Kosten der Tragik trugen aber die Freundinnen, die durch sie die ersten Täuschungen erfuhren. Hildas Brüdern machte es nichts, sie waren gelehrige Schüler ihrer Schwester und so kaltherzig wie diese.
In solcher Weise richtete Hilda allerlei kleinere Verwirrungen an unter den Leuten; hauptsächlich deswegen, weil sie es mit der Wahrheit nicht ganz genau nahm und allerlei erfand, oder Andern in den Mund legte.
Nun stand sie vor Paula, als deren strenge Lehrmeisterin. Eine schlanke, hohe Gestalt, etwas eckig, da sie der Rundung entbehrte. Das Gesicht geisterhaft blaß, mit breitem Munde, der gar nicht hieher paßte, ihr aber einen sinnlichen Zug verlieh. Das Gesicht scharf geschnitten mit energischem Ausdruck, trat vor den Blicken des Beschauers zurück wegen der vorherrschend großen Augen. Stahlblau, fest auf einen gerichtet, schaute der scharfe Verstand heraus, vor dem man sich fast beugte. Ein inneres Feuer, das in ihnen brannte, ließ ahnen, daß hinter ihm die Seele kochte. Bald öffneten sie sich groß, so daß es schien, sie seien blind und starr, bald schienen sie sich ganz nach innen zu drehen. Diese Augen raubten Hilda jeden Zug weiblicher Anmuth. Sie stieß jeden von sich ab, indem es schien, als starre sie einem fortwährend an. Das war für Hilda das unglücklichste, weil sie bestrebt war, Eindruck auf die Erwachsenen zu machen. Schon früh zeigte sich dieser Hang zu gefallen. Nicht selten hatte sie die Freundinnen neidisch gemacht, wenn sie rühmte, der oder jener Herr mache ihr den Hof.
Während sie nun solchergestalt vor Paula stand, mit dem Zug der Geringschätzung um ihre Lippen, überfiel diese zum ersten Mal das unbestimmte Gefühl der Furcht vor ihrer Freundin, wie das unschuldige Herz erbebt vor der Nähe des Mephistopheles.
Sie erregte durch ihre Kühnheit das Erstaunen Hildas, da sie trotzig sagte: »Du glaubst immer nur, Du denkest am meisten. Wenn wir schon nicht so viel sprechen wie Du, so sind wir doch nicht dümmer.
Ich hatte nie schlechtere Noten als Du.«
Hilda wollte nicht mit Paula streiten. Sie war schon ganz von dem neuen Verhältniß, das ihrer Phantasie den weitesten Spielraum bot, gefangen und wollte jetzt allein sein. Sie ging deshalb fort mit der Bemerkung: »Mit dir ist heute wenig anzufangen.«
Paula saß dann noch lange träumerisch da, das niedergesunkene Blatt, das ihre Verwirrung verschuldet, auf dem Schooß. Jetzt sah sie klar, daß bis jetzt viel Unnatürliches in ihrem Wesen, daß Vieles nicht wahr gewesen und sie nahm sich vor, nicht mehr so viel zu lesen. Doch diese Erzählung wollte sie noch beenden. Vielleicht, wenn noch ebenso gute kämen, auch ferner solche in diesem Blatte. Das Abonnement auf die Stadtbibliothek wollte sie aufheben.
Hilda aber ging in ihrem Zimmer mit verschränkten Armen schnell auf und ab. Das ganze Chaos gelesener Romane wogte in ihr durcheinander. Einzelnes daraus verband sich mit der neuen Erzählung und gestaltete sich theilweise um, so daß ein sonderbares Ding daraus wurde, so seltsam wie ein maurisches Ornament. Herr Brausch, oder jetzt Herr Hausmann war ein sonderbarer Held, ein Gemisch aus einem abenteuernden Ritter, der seiner Dame zu Liebe Gehülfendienste in einer Apotheke verrichtet und einem blassen, romantischen Jüngling der Jetztzeit, das Ideal der Backfische. Auch sie spielte eine Rolle in dieser Erzählung.
Dann ging sie zu ihren Freundinnen, machte sie aufmerksam auf die Erzählung im Feuilleton der Zeitung, fügte allerlei hinzu, was nicht darin stand, so daß deren Neugier gereizt wurde und sie dieselbe auch lasen.
Und dann gabs ein Flüstern und Kichern unter den Hausthüren. Ein Mädchen rief das andere von der Straße in den Hausgang und vertraute ihm die Neuigkeit.
Sie drang auch in die Familien und freute ehrsame, gravitätische Handwerksmeister und alle Frauen, welche der Ahnfrau Eva nicht Schande machten durch eine unziemliche Schweigsamkeit.
Es war ein Summen und ein Schwirren, wie wenn in einen ehrlichen, fleißigen Ameisenhaufen ein glänzender Goldkäfer tritt und mit seiner ungeheuerlichen Seltsamkeit bei den Ameisen alle Ordnung stört und ihre Seelen aus dem Gleichgewicht bringt.
Sie fanden zum ersten Mal etwas Gedrucktes in Wirklichkeit. »Das hat man noch nie erlebt,« sagten die alten Leute. Sie staunten den Apotheker wie einen Wundervogel an, der eigentlich nicht hieher gehörte. Diese Leute, die jahraus, jahrein tausend Geschichten ersannen und anstellten, waren verblüfft, als sie eine derselben gedruckt fanden. Bis jetzt hatten sie keine gute Meinung von der Belletristik gehabt, indem es hieß: »Es ist ja doch nicht wahr!« Nun war durch die Erzählung in der Zeitung die Ehre der Belletristik für immer im Städtchen gerettet.
Dann kam dazu die kleine Bosheit des Philisters, der Freude hat, wenn ein Anderer in der Leute Mund kommt und so über die Andern erhoben wird. Mag einer, der allgemein besprochen wird, gelobt oder getadelt werden, Beides ist ihm gleich ungeheuerlich und gefährlich. Er fürchtet nichts so sehr, als an das Licht gezogen zu werden und lebt deshalb ein dunkles, aber gemüthliches Leben, dem die Krone aufgesetzt ist durch den Krug Bier, den er alle Abende zu sich nimmt.
So war Herr Hausmann, ohne daß er es ahnte, der Held des Städtchens und Inhalt aller Mädchengespräche- und Träume und sehr interessant geworden.
Eigentlich hätte er etwas merken sollen, da nicht mehr die Kinder, die ihn doch liebten, da er ihnen jedesmal etwas Zucker gab, in die Apotheke kamen, sondern ihre ältern Schwestern selbst. Es kam häufig vor, daß sie auf dem Tische Handschuhe oder dergleichen vergaßen und wieder zurück kommen mußten. Auch verweilten sie gern etwas länger als nöthig, hatten Allerlei zu fragen und zeigten ein großes Interesse für Hygieine. Und Herr Hausmann war freundlich und gab auf alle Fragen bereitwillig und geduldig Auskunft.
Nummer für Nummer aber des Feuilletons ward im Städtchen gelesen. Jeden Tag war die Zeitung sehnlich erwartet. Wenn sie in einem Hause gelesen war, wurde sie in dasjenige des Nachbars getragen.
Paula hatte es jetzt nicht leicht, die Zeitung zuerst zu erhalten, denn der Vater würdigte jetzt sogar das Feuilleton seiner Aufmerksamkeit und Bulgarien war vergessen. Selbst die Mutter, welche sich nie um die Zeitung gekümmert, als wenn sie dieselbe als Umhüllungsmittel brauchte, las jetzt.
Noch nie war im Städtchen mit solcher Aufmerksamkeit gelesen worden, wie jetzt.
Im Verlaufe der Erzählung wurden Herr Brausch und seine Geliebte Luise nach Ueberwindung etlicher Schwierigkeiten zusammengeführt. Episodisch waren noch zwei Gestalten, abenteuerliche Fremde aufgeführt, welche mit Herrn Brausch das Kleeblatt der »drei Löwen zu Weidlingen« bildeten.
Diese köstlich gezeichneten Figuren fanden bei der Leserwelt des Städtchens nur nebensächliches Interesse, da sich dieses auf den Apotheker legte.
Nur ein etwas kritischer Schneider fand, eigentlich passe nur die Verehrung der zwei Fremden auf das Städchen, da ja auch hier ein solcher unsinniger Fremdenkultus sei.
Und Hilda befand sich in der größten Noth. Sie konnte nichts finden, was eine Geschichte verursacht hätte. Kein Punkt, eine Verwicklung zu bilden, bot sich ihr dar. Da war nichts als der berühmte Apotheker, der in der Phantasie wohl in die Rollen paßte, aber in der Wirklichkeit machte sich die Sache schwieriger. Sie wußte nicht, in welcher Weise sie sich nähern konnte. Auch war sie wegen der Luise verlegen, die sie nicht finden konnte. War diese einmal vorhanden, so ließ sich der Konflikt leichter einleiten.
Sie durchlief den ganzen Kreis ihrer Bekannten. Mit keiner derselben konnte sie etwas anfangen.
In einer glücklichen Stunde aber fand sie das Mädchen, welches passend war, die zweite Hauptrolle zu übernehmen. Jetzt war die Hauptschwierigkeit überwunden.
Sie erinnerte sich eines Mädchens, das eine Klasse höher als sie gestanden und das von ihr wegen seiner anspruchslosen Bescheidenheit nicht sonderlich beachtet worden war. Marie Bohler war ein liebliches Mädchen, ein ächtes deutsches Gretchen. Mit ovalem Madonnenantlitz und etwas geschlitzten, mild glänzenden Augen, den blonden Haaren und der peinlichen Reinlichkeit in den ärmlichen Kleidern machte sie den angenehmsten Eindruck.
Sie war aber arm, sehr arm. Ihr Vater war Flickschuster, ein heiterer Mann, der seit dem Tode seiner Frau Marie zu Liebe manches Gläschen weniger nahm, aber immer noch zu viel. Ihre ärmliche Behausung war durch Maries Ordnungssinn wohnlicher gestaltet als diejenigen der Eltern ihrer Freundin, wo Luxusgegenstände regellos umherlagen. Ihre Brüder trugen reinlichere Hemden, als die ihrer reichen Freundin, die oft mit köstlichen, aber beschmutzten einherliefen.
Marie war eines jener Mädchen, die als Frauen, ohne daß ihre Wirksamkeit auffällt, wohlige Wärme im Haus so verbreiten, weil ein liebevoller Geist dasselbe durchweht.
Wegen ihrer Anmuth und Bescheidenheit und auch wegen ihrer Dienstfertigkeit war Marie bei allen Schülerinnen beliebt gewesen. Ihr Geist wehte auch durch ihre Klasse und hielt alle Ausschreitungen fern. Die Mitschülerinnen fühlten die Ueberlegenheit ihrer ernsten Freundin. Diese Ueberlegenheit wurde aber gemildert durch die Befangenheit, welche Marie infolge ihrer Armuth hatte.
Diese Befangenheit wurde oft vergrößert, wenn Marie von den reichern Freundinnen zum Besuche eingeladen wurde und in ihren einfachen Kleidern in den schönen Häusern sich bedrückt fühlte.
Auch bei den Eltern ihrer Freundinnen war sie beliebt und gern im Hause gesehen. Die ehrsamen Bürgersleute fühlten sich geschmeichelt durch die Befangenheit Maries, die verrieth, daß sie dieselben als Vornehme betrachtete.
Marie wurde aber nach Beendigung der Schulzeit von ihren Freundinnen, die sie nicht mehr nöthig hatten, vergessen. Sie erhielt keine Einladungen mehr. Ja sogar die Freundinnen schämten sich fast ihrer, wenn sie ihr begegneten. Sie waren noch besser gekleidet als früher und hatten schon ihre Anbeter, während Marie schon eine kleine Hausfrau war, die flicken und ihre Brüder in Ordnung halten mußte. Nach der bescheidenen Blume schaute keiner der jungen Herren und so wußte sie noch nichts von der Süßigkeit, die mit der Liebe zum ersten Mal in die jungen Herzen zieht.
Einzig Paula hatte sie nicht ganz vergessen und zog sie bisweilen in ihr Haus, wogegen sich Marie wieder sträubte und jedesmal entschuldigte, wenn man ihr etwas anbot für sich oder die Brüder, sie komme nicht deswegen. Sie besaß ganz das Gefühl des redlichen Armen, der immer glaubt, wenn er in das Haus des Reichen tritt, man meine dort, er wolle etwas und deshalb ungern hingeht.
Bei Paula hatte Hilda das bescheidene Mädchen bisweilen angetroffen, hatte sich aber immer kühl gegen sie gezeigt, weil es meistens mit Paulas Mutter über Hausgeschäfte sprach und sich nicht in ihre Mädchengespräche mischte.
Marie war es nun, derer sich Hilda erinnerte und welche sie dazu bestimmte, die Geschichte auszuführen.
Erhobenen Hauptes ging sie umher, ein fröhliches Liedchen summend, denn nun wurde ihr der ganze Verlauf klar und schon hatte sie gefunden, wie der Konflikt zu knüpfen sei.
Erst jetzt beschäftigte sie sich mit Marie. Auch diese erfuhr die seltsamste Umbildung durch Hilda. In deren Phantasie war sie das Aschenbrödel des Märchens, das Hilda schon so oft auf sich übertragen. Diesmal liebte aber der Prinz nicht das Aschenbrödel, sondern umgekehrt hatte Aschenbrödel eine unglückliche, unerwiderte Liebe zum Königssohne, der Aschenbrödel auf der Asche nicht bemerkte. Und dann kam eine gute Fee, die des Prinzen Aufmerksamkeit auf das verhüllte Kleinod lenkte.
Diese gute Fee war Hilda.
Marie war nicht wenig erstaunt, als Hilda, die sie für so hochmüthig gehalten, beim Zusammentreffen bei Paula so freundlich mit ihr verkehrte und vertraulich that, als wären sie alte Freundinnen. Ihre Abneigung gegen Hilda verschwand allmählig und das Herz ging ihr auf gegen das plötzlich veränderte Mädchen. Dieses verkehrte mit Paula jetzt weniger als mit Marie und lud letztere sogar zum Besuche ein. Und Marie wurde zutraulich, erzählte von den Freuden und Leiden ihres kleinen Hauswesens und Hilda hörte mit einem Interesse zu, als wäre sie die fleißigste Hausfrau. Dann erzählte Hilda aus ihrem Kreise.
Schnell, mit vielen hochdeutschen Wendungen sprach sie von ihren Anbetern, wie der ihr tagtäglich Billets schreibe und sie ihn schmachten lasse, wie ein anderer ihr einen schönen Strauß geschickt zum Geburtstage, so daß Marie erst jetzt auf diese Seite des Lebens aufmerksam wurde, die ihr bis dahin fremd geblieben. Sie ahnte, daß da ein guter Theil der menschlichen Glückseligkeit sei und ein unbestimmtes Sehnen schlich sich in ihr Herz ein bei den glänzenden Bildern, die Hilda vor ihr entrollte.
Zwar verstand sie nicht alles, was Hilda sagte. Wie Hilda junge Männer, welche sie liebten, zum Besten halten konnte, begriff sie nicht.
Dann geschah das Unerhörte, die stolze Hilda lud die arme Marie ein, sogleich mit ihr nach Hause zu kommen. Marie machte Einwendungen, ihre Kleider paßten nicht in ihr Haus, sie müsse sich ja vor Hildas jüngern Geschwistern schämen. Diese zog aber Maries Arm in den ihrigen und nun schritten die beiden Mädchen die Gasse des Städtchens hinauf.
Manches Auge folgte den Beiden. Zuerst fiel das Auge auf die stolze Hilda, die größer war als Marie und über deren Rücken eine reiche Haarwelle fiel. Wenn sich der Blick aber Marie zugewendet, blieb er auch auf ihr haften und konnte sich so leicht nicht wegwenden. Das ovale Madonnenantlitz mit zu Boden gesenktem Blicke erregte sofort das Wohlgefallen. Sogar dem oberflächlichen Beobachter fiel in die Augen, daß da zwei ganz verschiedene weibliche Charaktere beisammen waren: Die anmuthige Bescheidenheit und das stolze Selbstgefühl.
Die Bekannten Hildas, welche den Mädchen begegneten, verwunderten sich, daß sie mit der armen Schusterstochter Arm in Arm schritt.
Beim Gange durch das Städtchen machte Hilda ihre Bemerkungen über die Leute, die ihnen begegneten.
»Jener junge Mann, der so müde drein schaut, ist seit zwei Jahren verlobt mit einer armen Näherin. Er ist selbst arm und so können sie sich nicht heirathen. Sie ist aber unklug, wenn sie auf ihn wartet, bis sie eine alte Jungfer ist.«
»Der dort ist mein Cousin, er macht mir immer den Hof und weint fast, wenn ich ihn nicht ansehe.«
Ein Mädchen stand oben am Fenster, das Gesicht an die Scheiben gepreßt: »Das ist die Metta Kaufmann, die, seit sie den zwanzigsten Geburtstag gefeiert, fürchtet, eine alte Jungfer zu werden und jetzt nach einem Manne angelt; aber es will keiner anbeißen, denn sie ist nicht gar schön.«
Ein Mann ging vorüber.
»Der lebt mit seiner Frau fortwährend im Unfrieden. Sie werfen sich gegenseitig Untreue vor. Ich glaube, sie haben Beide nicht sehr Unrecht.«
In dieser Weise ging es fort. Während der kurzen Strecke die sie gingen, legte Hilda das innere Leben vieler Familien bloß. Maries Gesichtskreis wurde um Vieles weiter. Bis jetzt hatte sie geglaubt, daß nur in ihrer Familie das Unglück ein steter Gast sei. Nun sah sie, daß es auch in den Häusern daheim war, die sie stets für glücklich gehalten. Jetzt wollte sie dem Vater seine kleinen Fehler gerne nachsehen und nie wieder unfreundlich mit ihm sein, wenn er angeheitert nach Hause käme.
Sie kamen nun zur Apotheke und Hilda sagte: »Komm, ich muß Oblaten holen.« Marie ging ungern, da sie glaubte, weil sie nichts zu kaufen habe, dürfe sie nicht gehen.
Herr Hausmann blickte überrascht auf, als die Mädchen eintraten und er wandte sich zuerst an Marie: »Was wünschen Sie, mein Fräulein?« Jetzt erröthete Marie, als sie sagen mußte, sie begleite nur ihre Freundin. Der Gehülfe suchte lange die Oblaten die nun Hilda verlangte. Er blickte oft die liebliche Marie an, so daß diese wieder erröthete und nicht wußte, wie ihre Verwirrung verbergen. Und als nun der Apotheker sagte: »Dürfte ich die Ehre haben, Ihre werthe Bekanntschaft zu machen, indem ich mich als Armin Hausmann vorstelle?« wurde sie noch mehr verlegen. Sie wußte nicht, was sie darauf erwiedern sollte. Hilda aber sagte: »Meine liebe Freundin, Fräulein Marie Bohler.« Und der freundliche Herr Apotheker erwiederte, er freue sich, ihre werthe Bekanntschaft gemacht zu haben und indem er sich mehr an Marie wandte: »Wollen Sie mich auch gütigst Ihren Eltern vorstellen, wenn ich mir einmal die Freiheit nehme, Sie aufzusuchen.«
Wieder ward Marie verlegen. Sie fühlte schon jetzt das peinliche Gefühl, das sie bekommen mußte, wenn Herr Hausmann sie einmal besuchen werde. Wieder wußte nur Hilda die passende Antwort zu geben.
Marie athmete ganz auf, als sie die Glasthüre hinter sich zumachte. Als sie im Umwenden noch einen Blick hinein warf, begegnete sie den Augen des Gehülfen und schlug die ihrigen erröthend nieder.
Hilda schaute von der Straße her zurück und sah, wie der Apotheker an das Fenster getreten war, um ihnen nachzusehen. Sie wußte, daß die Beziehung zwischen Beiden begonnen. Sie war nicht einmal eifersüchtig auf den Erfolg Maries bei Herrn Hausmann. Im Gegentheil, bekam sie fast Zuneigung zu ihr, wie zu einem Werkzeug, das gute Dienste leistet.
Marie aber war in froher Stimmung. Der Herr Apotheker hatte sie behandelt, wie ein vornehmes Fräulein und sie war ihm dankbar. Nur wurde ihr heiß bei dem Gedanken an die Möglichkeit eines Besuches. Doch verließ das Bild des freundlichen Herrn Hausmann sie nicht mehr und der Blick, dem sie zuletzt begegnet. Dieser hatte ein kleines Feuer Glückseligkeit angezündet in ihrem Herzen und sie wußte nicht warum.
Sie betrachtete aber Herrn Hausmann als hoch über ihr stehend. Außer dem Arzte schien ihr niemand so achtunggebietend wie der Apotheker. Das rührte noch von der Zeit her, da ihre Mutter krank war und sie fast jeden Tag Arzneimittel holen mußte, dabei aber keine Aussicht hatte, dieselben zu bezahlen und deshalb jeden Gang mit Angst und Zittern that.
Jetzt war sie in ihrem Wesen verändert.
In Hildas Hause trat sie trotz der glänzenden Räume sicherer auf, als bisher in Paulas einfachern Zimmern.
Zwar sank ihr Selbstgefühl noch am gleichen Abend zusammen, als der Vater taumelnd nach Hause kam und sie sich ihrer ganzen Aermlichkeit wieder bewußt wurde. Der Vater wurde trotz seines Zustandes beschämt, als sie mit der Geduld eines Engels ihm das Nachtessen gab und ihn dann mit vieler Mühe zu Bette brachte. Daß die vornehme Hilda von jetzt an öfters in ihre ärmliche Haushaltung kam, hob auch sein Selbstgefühl etwas und er hielt sich mannlicher gegen die Versuchung, sein Gläschen zu nehmen.
In Marie ward das Bild Armins (in Gedanken nannte sie ihn so) immer glänzender. Ihre ganze Seele wob sich um diesen Namen und es war Frühlingszeit im Herzen, ein süßes Klingen und Singen. Sie selbst aber wußte nicht, daß man das »erste Liebe« heißt, weil man das erst nachher versteht, wenn man kühl ist.
Herr Hausmann hatte keine Ahnung von seiner Stellung in dem reinen Mädchenherzen. Er hatte Marie schon fast vergessen, weil er sie seither nicht mehr gesehen. Daß er sie etwas auffallend bevorzugt, wußte er nicht, weil er überaus freundlich war mit allen Leuten und unbewußt noch freundlicher mit schönen Mädchen.
Und Hilda war nicht zufrieden über das unentschiedene Verhältniß. Der erste Theil des Märchens hatte sich verwirklicht. Aschenbrödel liebte den Königssohn und dieser wußte es nicht. Und nun die Fee? Es mußte etwas von dieser Seite gethan werden, was die Beiden einander näherte.
Jetzt zeigte sich ihre phantastische Natur. Sie wollte den Königssohn, Herrn Hausmann rühren, ihn auf das Aschenbrödel Marie aufmerksam machen.
Sie setzte sich hin, nahm ein Blatt Papier und schrieb darauf:
Der Königssohn und Aschenbrödel.
Märchen von Hilda Boll.
Dann fing sie an zu erzählen in der naiven Art des Märchens von dem glänzenden Königssohn und dem armen Aschenbrödel. Dazwischen hinein geriethen aber ganz moderne Ausdrücke, die sich ausnahmen, wie der in geometrische Formen geschnittene Zierbaum in des Urwalds knorrigem Geschlecht. Aber das Ganze war rührend, und deutlich genug trat das Verhältniß zwischen Herrn Hausmann und Marie hervor.
Dieses Märchen überschickte sie durch die Post dem Gehülfen. Dieser war sehr überrascht, als er das sonderbare Manuscript bekam. Er las es mit großem Respekt, da es ihm imponirte, denn den Werth eines literarischen Produktes zu bestimmen, hatte er nicht gelernt. Er verstand auch wohl, welchen Zweck das Märchen hatte. Da er nicht von tiefer Gemüthsart war, glaubte er, die beiden Mädchen steckten unter derselben Decke und wollten sich einen Spaß mit ihm erlauben, bei dem er mitzuhelfen gerne bereit war. Daß das Märchen etwas wahre Zuneigung Maries verrieth, merkte er schon, aber die sonderbare Art und Weise, wie dies ihm kund gethan wurde, bestärkte seine Ansicht, daß Spaß zu Grunde liege.
Es konnte für ihn nichts Angenehmeres geben, als das Spiel mit den beiden Mädchen. Er sah, daß mit Hilda nicht viel anzufangen war und daß man sich bei ihr leicht eine Niederlage holen könnte. Deshalb wollte er sich an Marie wenden. Er schrieb ihr folgendes kleine Brieflein auf Rosapapier:
Mein angebetetes Fräulein!
Seit Sie mir erschienen sind, ist in mein Herz Sonnenschein gezogen und hat darin ein heimliches Feuer entzündet, so daß ich trotz der kalten Zeit Frühling im Herzen habe. Wären Sie nun so grausam, diesen wieder durch den Winter vertreiben zu lassen, wenn Sie es durch ein paar Zeilen Ihrer lieben Hand verhüten können? Damit würden Sie zum glücklichsten der Menschen machen,
Ihren Armin.
Marie wußte sofort, als sie das Briefchen erhielt, von wem es sei. Alles Blut drängte sich ihr zum Herzen und ihre Hand zitterte, als sie es öffnete. Dessen Inhalt brachte ihr ruhiges Empfinden zum Ueberwogen. In hellen Flammen loderte die erste, starke Liebe auf und weckte in ihr das Weib, das zur Erfüllung seiner Bestimmung drängt. Die Glückseligkeit, die in ihr Herz gezogen, drohte ihr die Brust zu zersprengen.
Dann als sie ruhiger geworden, las sie immer und immer wieder die Zeilen ihres Geliebten, an deren Wahrheit sie glaubte, wie an diejenige des Evangeliums. Ach, sie wußte noch nicht, daß man liebe Worte schreiben kann, ohne sie zu fühlen! Ihr Wesen war zu einfach, um anders zu sprechen, als sie fühlte und dachte.
In Wahrheit lag jetzt vor ihr das Ziel, Frau zu werden und es war dies eine natürliche Folge ihrer reinen Seele. Denn ein braves, unverdorbenes Mädchen tritt in kein Verhältniß zu einem Manne, ohne daß es etwas anderes glaubt, als daß die Ehe dessen Krönung bilde. Es ist aber bei gewissen Gesellschaftsklassen nichts Außergewöhnliches, daß zwei Leutchen in ein Verhältniß treten, wo Beide zum Voraus wissen, daß sie bald sich wieder trennen werden.
Herr Hausmann war etwas verblüfft, als er die innige Antwort Maries erhielt und er sah, welche Gluth der Leidenschaft er bei ihr geweckt. Er gerieth in Verlegenheit, als Marie schrieb, daß sie eigentlich zu niedrig sei, sein Weib zu werden, sie, die so arm sei und er so hochstehend, daß sie aber durch ihre Liebe diesen Unterschied auszugleichen hoffe. Er gerieth in Verlegenheit, als er sich mit einem Male vor die Entscheidung gestellt sah, woran er nie gedacht und auch nie denken konnte. Er fragte sich im ersten Augenblick, ob dieses Vorgehen nicht Raffinirtheit des Mädchens sei, doch konnte dies bei der im Gesichte ausgedrückten Unschuld nicht der Fall sein. Um so mehr war er erstaunt über diese unerwartete Folge seines Briefes, als er keine Ahnung von solcher Gemüthstiefe gehabt hatte. Er war auch ein Philister, der diese nicht begreift und mit Neugierde sieht. Doch besaß er so viel Zartheit, um nicht mit einem Schlage des Mädchens Hoffnungen niederzuschlagen. Er nahm sich vor, das Verhältniß, in das er plötzlich gerathen, eine Zeit lang fortzuführen und dann nach und nach durch Kälte das Mädchen sich zu entfremden.
Mit diesem Vorsatze schlug er sich die ärgerliche Geschichte aus dem Kopfe und ging fröhlich an seine Geschäfte.
Marie hatte aber ihr sonst so ernsthaftes Wesen verloren und sie verrieth deutlich, daß sie »verliebt« sei, wie ihre Freundinnen sagten. Sie hielt sich jetzt mehr an Hilda, beendigte schneller ihre Hausgeschäfte, um sich von dieser abholen zu lassen. Mehr als nöthig führte sie nun ihr Weg bei der Apotheke vorbei und sie war glücklich, wenn sie Herrn Hausmann erblicken konnte. Es fiel ihr nicht auf, daß er nicht mehr so viel unter dem Fenster zu sehen war.
Und Hilde war jetzt zufrieden. Sie empfand ein Wohlbehagen, Marie zu beobachten und richtete ihre Gespräche so ein, daß diese Interesse darin finden mußte, weil sie zu ihrem Zustande paßten. Hilda machte auch ihre Freundinnen aufmerksam auf die »Verliebtheit« Maries. Und die Mädchen beobachteten Marie, welche davon keine Ahnung hatte. Sie besprachen die Vorfälle, wo Marie ihre Liebe verriet und lachten darüber. Auch spotteten sie über das arme Mädchen, das im Ernste glaubte, Herr Hausmann habe ernstliche Absichten. Es kam sogar vor, daß sie sich an die Fenster setzten, um Marie und Hilda, da letztere sie davon benachrichtigt hatte, vor der Apotheke hin und hergehen und hinein blicken zu sehen.
Auch Paula hörte davon und war empört über Hilda. Sie ahnte, daß diese hinter dem Spiele steckte. Gern hätte sie Marie aufmerksam gemacht, daß sie zum Besten gehalten werde, aber sie fand den Muth nicht. Dann war es zu spät, als die Kathastrophe eintrat.
Es war im Städtchen Sitte, daß jeden Winter ein Kränzchen veranstaltet wurde, bei dem sich die jungen Leute zum Tanz vereinigten. Dieses wurde jeweilen von den jungen Herren arrangirt. Schon mehrere Wochen vorher waren die Mädchen in Aufregung wegen den Einladungen, da diese immer sehr wichtig waren und fast einer Erklärung gleich kamen.
Vor dem letztjährigen Kränzchen saßen eines Abends mehrere Mädchen, worunter auch Hilda und Marie, beisammen. Auch Paula war anwesend, hielt sich aber etwas fern, da sie auf Hilda böse war und auch sich zwischen Marie und sie etwas störend gelegt hatte. Das war das Verhältniß Maries das sie der Freundin nicht mitzutheilen den Muth hatte, weshalb diese glaubte, Marie habe kein Vertrauen zu ihr. Den Gegenstand des Gespräches bildeten die bevorstehenden Einladungen. Die Mädchen neckten sich gegenseitig damit und spielten auf die verschiedenen zarten Verhältnisse an.
Eines der Mädchen fragte nun: »Herr Hausmann kommt doch auch, wie? Wen wird er wohl einladen?« Ein anderes erwiderte: »die Tochter seines Prinzipals hat mir gesagt, daß sie auf jene Zeit seine Verlobte aus Deutschland erwarten, er wird wohl diese mitbringen, es soll ein vornehmes Fräulein sein.«
Vergebens hatte Paula der Sprecherin zugewinkt, sie solle schweigen. Entweder bemerkte diese es nicht oder sprach zu Ende, um Marie zu kränken.
Jetzt war es zu spät.
Mit einem lauten Aufschrei sank diese zu Boden, umsonst griff Paula nach ihr. Laut schreiend stürzten die erschrockenen Mädchen auseinander und riefen nach Belebungsmitteln. Schon hatte Paula die Bewußtlose aufgehoben und küßte sie weinend.
Hilda stand starr, verwirrt und erschrocken vor dem Opfer ihrer Phantasterei. Paula wandte sich zu ihr: Das hast Du verschuldet mit Deiner Herzlosigkeit. Mit unserer Freundschaft ist es aus!«
Ehe die Mädchen mit ihren Essenzen zurückkamen, schlug Marie die Augen auf und erhob sich aus den Armen Paulas, schwankend, mit todtenbleichem Antlitz. Wie geistesabwesend sagte sie nur: »Ich will nach Hause!«
Paula führte sie fort, die Andern ihrer Verwirrung überlassend.
So war also wieder ein Menschenherz gebrochen worden durch Herzlosigkeit, Unbesonnenheit und durch Freude am Klatsch.