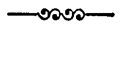|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Abel hatte nichts erraten, weder das Gefühl der Abneigung, das sein Benehmen eingeflößt, noch das Mißtrauen, das sein Verhalten nach und nach erregt hatte. Im tiefsten Innern seines Herzens feierte er Triumphe. Die so sehr gefürchtete große Prüfung war in der besten Weise an ihm vorüber gegangen. Auch nicht ein einziges Mal hatte er sich irre machen lassen und auf alles hatte er eine Antwort gehabt; er, den man für dumm zu halten schien, hatte die Justiz getäuscht und die Beamten auf eine falsche Fährte geleitet.
Abel glaubte, sich sehr schlau benommen zu haben. Er war stolz auf sich selbst. Uebrigens war es ganz gut, daß diese Szene stattgefunden hatte; er hatte der Gefahr ins Gesicht gesehen, und seine Angst war geringer geworden.
Aber einer sollte nicht lange mehr im Hause bleiben. Das war dieser Thomas, der gegen ihn Partei zu nehmen schien. Nicht, daß er gesprochen hätte! Aber sein Benehmen hatte Abel geärgert und gereizt, als er mit gekreuzten Armen im Zimmer stand und die Augen auf Abel richtete. Diese Augen hatten ihn verwirrt gemacht; das war wieder einer, den er instinktiv haßte.
Er war zu seinem Vater zurückgekehrt, das war gleichsam eine Besitzergreifung, denn dieser schwache Greis bildete seinen Schutz, seine Rettung.
Der unglückliche Loisy hatte von dem, was um ihn her vorging, keine Ahnung, auf seine erste Aufregung, die sich in einem ungewöhnlichen Wortschwall, ja auch in Tränen Luft gemacht, war ein müder Stumpfsinn gefolgt. Er lag, den Kopf auf die Brust gesenkt, leichenblaß, mit schlaffer Lippe in seinem Sessel.
Sein mageres, langes Gesicht war weiß wie Linnen. Aus der kleinen Mütze, die seine Stirn bedeckte, fielen graue Haarsträhne, und der lange braune Schlafrock mit der Seidenschnur klebte an dem knochigen Körper, ja, schien förmlich daran festgeschmiedet. In diesen wenigen Monaten hatte der Verfall große Fortschritte gemacht und trat jeden Tag schärfer hervor; die Geisteskräfte schwanden ebenso schnell wie die Körperkräfte.
Namentlich an diesem Abend hatte er bei dem Licht der Lampe, das scharf und grell auf seine unbewegliche Gestalt fiel, die leichenhafte Starre einer Wachsfigur.
An seinen Sessel gelehnt, stand Abel mit halbgeschlossenen Augen neben ihm; er verfolgte seine Gedanken, die mit der Nacht stärker hervorbrachen und sich nicht so leicht leiten ließen. Er versuchte, die wilden, stürmischen Gedanken zu beherrschen und zu bändigen, fürchtete sich aber heute noch mehr vor dem Alleinsein als sonst. Dabei wiederholte er sich aber fortwährend, der Tag wäre gut für ihn verlaufen.
Frau Loisy arbeitete ebenso ruhig wie sonst. Manchmal erhob sie die Augen zu der Gruppe, die ihr die ganze Vergangenheit und die ganze Zukunft verkörperte. Sie fand ihren Mann sehr blaß, doch das machte offenbar die Müdigkeit; die geringste Störung in seinen Gewohnheiten schwächte ihn in der furchtbarsten Weise.
Dann fiel ihr Blick auf Abel.
Warum hatte ihr seine Stimme so falsch geklungen, als sie ihn vorhin den Beamten antworten hörte? Sie hatte gleichsam die Empfindung einer Disharmonie gehabt. Warum hatte dieses boshafte, zornige Grinsen um seine Lippen gespielt, als er die Behauptungen des Wildschützen Lügen strafte? Frau Loisy, die im Grunde ihres Herzens sanft und ehrenhaft war, besaß ein scharf ausgeprägtes Feingefühl und eine echt weibliche Güte.
Außerdem hatte Frau Loisy nie daran gezweifelt, daß der Tod ihres ältesten Sohnes einem Unfall zuzuschreiben war. Ob Voisinot Georges Gewehr aufgehoben und es sich angeeignet hatte oder nicht, das war eine winzige Kleinigkeit, die sich von selbst erklärte.
Doch zum erstenmal blieb ihr Gedanke auf der Stunde haften, – und seltsam, unerklärlich! Voisinots Behauptung war ihr weniger aufgefallen, als die zornige, fast beleidigende Ableugnung Abels. In diesem Augenblick durchlebte der junge Mann wohl zum zwanzigsten Male, trotz seiner körperlichen Apathie, die am Vormittag stattgefundene Szene, und ein halbes Lächeln des Triumphes und des Spottes schwebte um seinen Mund. Wieder sah er das verdutzte Gesicht des Wilddiebes vor sich, wieder hörte er, wie der Richter ihm Schweigen gebot. Dieses stumme Lachen, das etwas Grausames an sich hatte, überraschte die arme Mutter, deren ganzen Schmerz die Ereignisse des Tages aufs neue erweckt hatten.
Unwillkürlich, ohne es zu wissen, verglich sie dieses schmale, eckige, gelbe Gesicht mit dem blühenden jugendlichen Bilde ihres Aeltesten. Diese moralisch und körperlich kranke Physiognomie erinnerte sie durch den Gegensatz an jenes andere so wahrhaft gesunde Antlitz.
Doch schnell bemühte sie sich, diesen Vergleich zu verscheuchen, der sich ihr förmlich aufdrängte. So hatte sie schon vorhin durch einen Mutterkuß den kurzen Zweifel wieder gut gemacht, den sie nicht zu unterdrücken vermocht, ohne selbst recht zu wissen, warum. Jetzt wollte sie sich ihre Ungerechtigkeit klar machen und sich selbst überzeugen, wie unrecht sie ihrem Kinde tat. War Abel nicht der beste, der ergebenste Sohn von der Welt?
Mußten die Bande, die ihn an seinen Vater fesselten und die keine Macht zerreißen konnte, mußten sie ihn nicht auch an das Herz der Mutter schließen? Der Egoismus ihrer Liebe zu ihrem Manne kämpfte gegen das Unbehagen, dessen Sie sich nicht zu erwehren vermochte; denn sie wußte, daß Loisys Leben gewissermaßen von der Aufopferungsfähigkeit seines Sohnes Abel abhängig war. Er konnte ihn keinen Augenblick entbehren, und erst heute hatte eine Trennung von wenigen Sekunden fast eine Krisis herbeigeführt. Und anstatt ihm dankbar zu sein, behandelte sie ihn mit unerträglichem Mißtrauen. Das war fast ein Verbrechen. Die Uhr schlug die neunte Stunde.
Vater, fragte Frau Loisy ihren Gatten, willst du dich niederlegen?
Allabendlich ging er um diese Zeit zu Bett. Er hörte nicht sogleich, sie mußte die Worte wiederholen. Loisy erhob schwerfällig die Lider und sagte:
Schlafen! Ach ja … ja … mir recht!
Sofort suchte seine Hand, ins Leere tastend, Abels Arm, um sich darauf zu stützen.
Der junge Mann gehorchte diesem stummen Ruf. Von den quälenden Gedanken, die in seinem Hirn summten, förmlich hypnotisiert, erfüllte er vollständig mechanisch seine Tätigkeit, indem er den Kranken mit derselben abgemessenen Schonung behandelte und dieselben sanften, fast liebkosenden Bewegungen machte. Wie an jedem Abend, so sagte er auch heute zu ihm:
Du hast mich doch lieb, Vater, nicht wahr?
Ja, ja, Abel! versetzte der Kranke mit einem Zittern der Genugtuung.
Er fühlte Ich noch schwächer als gewöhnlich, doch Abels Arm stützte ihn kräftig. Als Loisy entkleidet war, schleppte er sich bis zum Bett. Er hatte Abels Hand, die er aber nicht drückte, in der seinen behalten. Frau Loisy trat näher, um ihn auf die Stirn zu küssen. Abel machte eine Bewegung, als wolle er den Platz seiner Mutter abtreten.
Nein, nein, rief der Gelähmte, bleib, bleib!
Er will meine Hand nicht loslassen, sagte Abel ganz leise zu seiner Mutter.
Ein Lächeln herzzerreißender Entsagung flog über ihre Lippen, konnte sie, durfte sie eifersüchtig sein?
Abel, dessen Hand der Vater noch immer hielt, stand geduldig da und rührte sich nicht.
Immer tiefer wurde das Schweigen, immer drückender die Melancholie und die tiefe Stille wurde nur von Loisys Atem unterbrochen, der manchmal von einem rauhen Kehllaut, manchmal von einem heiseren Schnarchen abgelöst wurde. Dann wurden die Atemzüge nach und nach länger und ruhiger.
Noch vergingen einige Minuten. Abel dachte nicht daran, seine Hand zurückzuziehen. Eine tiefe, drückende, schwächende Empfindung der Ruhe erfüllte ihn ganz und gar. –
Er schläft, sagte seine Mutter zu ihm.
Abel zitterte; er schien zu erwachen.
Frau Loisy trat von dem Bett fort und kehrte an den Tisch zurück, auf welchem die mit einem Schirm versehene Lampe stand. So war es alle Abend, zu dieser Stunde, wenn das ganze Haus einschlief. Dann begann sie zu arbeiten, und ihr gegenüber saß Abel, der sich schläfrig in dem Sessel ausstreckte, den sein Vater eben verlassen hatte.
Gewöhnlich entspann sich eine Unterhaltung zwischen Mutter und Sohn, bei der man mehr flüsterte als sprach. Doch diesmal berauschte sich Abel förmlich an dem Schweigen und der Unbeweglichkeit und suchte sich für die so sehr gefürchtete Nacht, deren Fieber er bereits an die Schläfen klopfen hörte, zu betäuben. Doch Frau Loisy quälte ein Gedanke, der fast unbewußt ihren Lippen die Worte entriß:
Höre mal, Abel, diese hartnäckige Lüge Voisinots ist doch wunderbar.
Nicht nur bei den Wunden des Körpers bringt ein plötzlicher Stoß einen heftigen Schmerz hervor. Es gibt auch Worte, die wie glühendes Eisen brennen.
Voisinot! versetzte Abel wütend und erbebte vom Kopf bis zu den Füßen, diese Kanaille!
O, weshalb bist du so streng, versetzte Frau Loisy sanft, er ist ein Wilddieb, das weiß ich wohl, doch sonst hat sich niemals jemand über ihn beklagt. Dein Bruder hatte ihn sehr lieb.
Mein Bruder wählte sich recht eigentümliche Freunde.
Frau Loisy zuckte schmerzlich zusammen. Abels Stimme hatte wie ein Hammer auf ihr Herz geschlagen …
Dein Bruder, begann sie halb atemlos und fügte nach einer Pause hinzu: Dein Bruder war gut!
Das heißt vielleicht, ich bin schlecht!
Abel! Warum sprichst du so? Klagt man dich etwa an, wenn man deinen Bruder lobt?
Abel sah plötzlich ein, daß er sich hatte fortreißen lassen, doch eine heftige Wut raubte ihm jede Geistesgegenwart; er zuckte die Achseln und fuhr fort:
Nein; aber schließlich sehe ich nicht ein, weshalb du diesem Wilddieb mehr glaubst, als mir.
Aber das habe ich ja gar nicht gesagt. Wie sollte ich überhaupt darauf kommen; ich frage mich nur, welches Interesse er daran haben konnte, uns zu belügen?
Ja, meinst du vielleicht, daß ich eins habe?
Mit dem Eigensinn der Streitsüchtigen legte Abel die Worte seiner Mutter absichtlich falsch aus und führte das Gespräch auf seine eigenen Gedanken zurück.
In ihrer Güte glaubte Frau Loisy jetzt, ihren Sohn verletzt zu haben und war bemüht, sich zu verteidigen; sie nahm ihre Worte wieder auf, um sie besser zu erklären, reizte den Zorn des Wütenden aber dadurch nur noch mehr.
Ich sage das ja gar nicht, fuhr sie fort, aber verstehe mich doch recht! Was kümmert denn diesen Voisinot die Stunde, wo er das Gewehr gefunden hat? Wenn man ihn eines Verbrechens verdächtigen könnte, hätte er es um neun Uhr morgens ebensogut begehen können, wie um neun Uhr abends. Aber du weißt ganz genau, daß du Georges zu der von dir behaupteten Stunde verlassen und ihn ebenso nach der Stoppelwiese hast gehen sehen.
Auf die Gefahr, seinen Vater zu wecken, hatte Abel seinen Sessel heftig zurückgeschoben und leichenblaß, mit den Zähnen knirschend, sich erhoben. Er machte fast eine Bewegung, um auf seine Mutter loszustürzen, und diese hatte, über diese plötzliche Aufregung entsetzt, einen Schrei ausgestoßen und war zurückgesprungen.
Abel, Abel! rief sie, du machst mir Angst!
Und ich, schrie er mit unverschämter Härte, ich befehle dir, zu schweigen. Ich habe von allen euren Verdächtigungen genug, laßt mich mit Georges in Ruhe! Ich habe ihn um neun Uhr morgens verlassen; er ist um neun Uhr abends gestorben. Das übrige geht mich nichts an, und ich will nichts mehr davon hören.
Wie von dem Dämon des Verbrechens getrieben, den Edgar Poe so wunderbar geschildert, rief er:
Warum sagt ihr nicht gleich, ich hätte ihn getötet?
Mit großen Schritten durchlief er das Zimmer, ohne einen Blick auf seinen Vater zu werfen, den er so zu lieben schien und der in seiner leichenhaften Unbeweglichkeit noch immer schlief. Er öffnete die Tür seines Schlafkabinetts und warf sie heftig hinter sich zu.
Entsetzt und betäubt war Frau Loisy auf ihrem Stuhl zusammengesunken und ihre Zähne klapperten jetzt noch vor Schreck. Ohne eine Träne, ohne auch nur ein Wort finden zu können, streckte sie die Hände nach der Tür aus, und ihrer zusammengepreßten Kehle entrang sich ein schmerzliches Stöhnen.
Dann schlug sie die Hände vors Gesicht und weinte, weinte bitterlich.
Die Worte ihres Sohnes hatten sie mitten ins Herz getroffen. O, Abel, Abel! Er, der so sanft, so unendlich sanft, so gut, ja sogar schwach war! Und er hatte ihr so geantwortet! Sie hatte doch nichts weiter getan, als über die Sache gesprochen. Lag es denn nicht auch in seinem Interesse, daß die Wahrheit an den Tag kam?
Wirr und wüst taumelten die Gedanken in ihrem Hirn durcheinander. Die Worte verschmolzen zusammen, sie vermochte die Gedanken nicht zu Ende zu denken, und alles taumelte wild hin und her. Dann aber schluchzte sie und der gewöhnliche Rückschlag trat ein. Die nervöse Ueberreizung schwand. In der Ruhe, die sich nach und nach in ihr Bahn brach, sprach ihre Mutterliebe jetzt für den Sohn, dessen schreckliches Benehmen sie jetzt schon zu vergessen bemüht war. Er war so leidend! Armes Kind! Sie hatte nicht erraten, daß er infolge der Ereignisse dieses Tages so aufgeregt und leicht erregbar war. War es denn seine Schuld, wenn er nicht die Kraft und Stärke seines Bruders besaß? Fest entschlossen, Abel aufzusuchen, sich bei ihm zu entschuldigen, ihn um Verzeihung zu bitten, erhob sie sich, doch sie war noch so tief bekümmert, daß sie fürchtete, selbst ihr Schmerz und ihre Reue könnten ihn aufs neue reizen.
Es fiel ihr ein, daß Abel in der Hast, in der er sie verlassen, nicht, wie gewöhnlich, daran gedacht hatte, die Fensterläden des Eßzimmers zu schließen. Sie ging deshalb in dieses Zimmer mit der Lampe, die sie auf den leider schon so lange unbenutzten Whisttisch setzte. Sie schob die Vorhänge auseinander und öffnete das Fenster. Es war eine schöne Frühlingsnacht mit sanfter, erquickender Wärme. Sie fühlte sich plötzlich neu belebt und blieb einige Zeit, sich der schönen Ruhe erfreuend, am Fenstersims stehen. Dann schloß sie sorgfältig die Vorhänge, strich die Falten glatt und kehrte zur Lampe zurück.
Georges Uhr war auf dem Tische liegen geblieben. Frau Loisy nahm sie in die Hand. Es war eine traurige Reliquie, und eine heilige Pflicht gebot ihr, sie unversehrt zu halten. Sie hatte sie in die hohle Hand gelegt und betrachtete sie aufmerksam. Die Zeiger standen noch immer auf demselben Punkt des Zifferblattes, auf achtdreiviertel Uhr, sie versteckten sich gleichsam einer vor dem anderen. Eine entsetzliche Angst preßte der armen Mutter die Brust zusammen. Augenscheinlich waren Wassertropfen unter das Glas geraten und hatten die Bewegung aufgehalten.
Bei dieser Betrachtung erwachten ihre Erinnerungen. Wie glücklich war sie früher gewesen. Wenn Georges erschien, kam die Freude ins Haus. Er hatte eine Art, die Mama von hinten beim Kopf zu ergreifen, und sie so auf die Lippen zu küssen, daß die gute Frau ganz entzückt war.
Er erzählte dem Vater Anekdoten aus Paris und rief wieder die Illusionen der Vergangenheit in ihm wach, obwohl der Maler sich nicht weiter nach ihr sehnte. Selbst Herr Bertemont wurde heiter. Und der brave Pfarrer Lambquin! Jeden Abend machte er denselben Scherz mit ihm, indem er das silberne Werk der alten Uhr an seinem Ohr erklingen ließ, und jedesmal erschrak der brave Pfarrer in derselben Weise … klingeling!
Klingeling! Die Uhr schlug. Unwillkürlich hatte Frau Loisy auf die kleine Feder gedrückt und der Schneller hatte gespielt. Klingelingeling! Die Töne beschworen die Vergangenheit herauf. Die Mutter hatte fast Angst bekommen und schrak wie vor einer Kirchenschändung zurück. Die Uhr war also nicht zerbrochen? Ja, warum sollte sie sie denn nicht aufziehen, sollte denn diese Erinnerung an eine entsetzliche Stunde ewig bestehen bleiben? Wozu wäre es nicht überhaupt besser gewesen, die Zeiger wären weiter gewandert? Dann hätte man das Verhör mit Voisinot und auch die traurige Szene heute abend vermieden. Ja, ja, vernichten wir diese Erinnerung, die ihre Schatten auch auf die Gegenwart wirft! Und als wollte sie ein böses Schicksal beschwören, öffnete Frau Loisy das Gehäuse und steckte den Schlüssel hinein. So machte er es früher immer, er zählte ganz laut die Umdrehungen und nannte die Zahlen bis auf elf … Auch sie wollte die elf Umdrehungen zählen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs … ja, was war denn das? Sie war auf die Stillstandkerbe gestoßen und zwar so stark, daß der kleine Schlüssel aus dem kleinen Loch gefallen war. Sechs, das war ja nicht möglich, da die Uhr um neun Uhr abends stehen geblieben war! Wenn nur die Feder nicht zerbrochen war! Sie steckte den Schlüssel wieder hinein und versuchte, ihn ganz sachte umzudrehen. Die Feder war vollständig aufgezogen. Wie war denn das möglich? … Es war doch neun Uhr abends gewesen … Sechs Umdrehungen, das machte ungefähr die Hälfte. Daraus mußte man schließen, die Uhr wäre um neun Uhr morgens stehen geblieben. Das aber war ja nicht möglich, denn Abel behauptete …
Abel lügt, – diese beiden Worte klangen der unglücklichen Frau wie ein helles Glöckchen ins Ohr. Tatsächlich erstand der Gedanke nicht erst infolge dieses Vorfalls, nein, er schlummerte schon seit dem Morgen, besonders seit der vorigen Stunde. Ja, Voisinot hatte die Wahrheit gesprochen; ja, am Morgen war Georges gestorben … Und Abel hatte stets und ständig gelogen, mit einer Wut, einer Zähigkeit, die nichts zu erklären vermochte … er müßte denn ein Interesse gehabt haben, andere über den genauen Zeitpunkt zu täuschen.
Aber warum?
Diese ruhige Frau, die sich von der Erregung nie hatte fortreißen lassen, zitterte plötzlich. Selbst ihr langsames Denken gab dieser Schlußfolgerung, die sich ihrem Hirn ganz unerwartet entrungen hatte, eine außergewöhnliche Kraft und Stärke. Sie wagte noch nicht, den Gedanken zu Ende zu denken, noch schrak sie vor dem unbekannten Dunkel zurück, das sie wohl ahnte, ohne sich aber darüber klar zu werden.
In der Hand die Uhr, die in so eigenartiger Weise zum Zeugen geworden war, trat sie wieder in Loisys Zimmer. Auch sie blieb keinen Augenblick an diesem Bette stehen, in welchem der Mann lag, der eigentlich doch ihre ganze Daseinsberechtigung ausmachte. Nur um ihren Gatten zu verteidigen, trat sie der Gefahr entgegen. Dennoch zögerte sie in dem Augenblick, wo sie die Finger auf die Klinke der Tür legte, die in Abels Kabinett führte.
Die Tür drehte sich in ihren Angeln, sie trat ein. Tiefe Stille. – Sollte Abel schon schlafen? Trotzdem hatte er seiner Mutter von seiner häufigen Schlaflosigkeit erzählt Sie ging um das Bett herum, blickte hinein und wich zurück. Abel saß unbeweglich, halb entkleidet auf dem Rand der Matratze, mit weit aufgerissenen Augen und so blaß, daß die Kerze, die neben ihm brannte, grünliche Flecke auf seine Wangen warf. Und diese grausame, verzerrte, Grauen erregende Physiognomie! Seine Augen waren auf seine Mutter gerichtet, und doch schien er sie nicht zu sehen. Nein, er sah sie nicht; dem war wirklich so. Eine Art hypnotischer Starrkrampf hatte sich seiner bemächtigt, er hatte einen der Arme erhoben, als wollte er mit der Hand nach der Stirn fahren, hatte aber die Geste nicht zu Ende ausgeführt. Seinen halbgeöffneten Lippen entrang sich nicht der leiseste Ton, und doch schienen sie eine Frage zu erwarten, und auf diese Frage antworten zu wollen.

Frau Loisy hatte von den Erscheinungen der Neurose nicht die geringste Idee.
Abel, Abel, murmelte sie, sprich mit mir, du machst mir Angst.
Ohne sich zu rühren, in derselben unbeweglichen Haltung versetzte er:
Nun, denn, ich sehe keinen Ausweg, Herr Präsident, ja, ja, ich gestehe alles, ich habe meinen Bruder getötet.
Frau Loisy schrie nicht, sie weinte auch nicht. Doch sie wich bis zur entgegengesetzten Wand zurück. Von dort starrte sie wie angenagelt auf den Sohn.
Abel spielte sich noch immer im Schlummer die Szene des Schwurgerichtshofes vor, genau in derselben Weise, mit zwei verschiedenen Stimmen, wie er sie sich so oft im wachen Zustande vorgespielt hatte.
Sie gestehen also endlich! Erzählen Sie uns, wie die Sache vor sich gegangen ist!
Hören Sie, Herr Präsident. Morgens ging ich mit meinem Bruder fort, der jagen wollte. Er hatte mir den Vorschlag gemacht, ich solle ihn begleiten.
Nach welcher Seite gingen Sie?
Nach der Arvette zu.
Sie geben also zu, ihn nicht nach der Stoppelwiese geführt zu haben?
Ich gebe es zu.
Fahren Sie fort.
Diese Parodie eines Verhörs mit ihren verschiedenen Antworten und Fragen war entsetzlich.
Tot für alles, nur nicht für diese entsetzliche Szene, die sie tötete, stand Frau Loisy und lauschte.
Wir kamen an die Arvette, die Brücke war fortgeschwemmt. Mein Bruder ging mit mir an dem Lauf des kleinen Flusses hinunter und sagte, er würde schon eine Stelle finden, wo das Eis ihn tragen würde.
Haben Sie ihn nicht auf die Idee gebracht?
Nein, Herr Präsident, ich dachte in jenem Augenblick an gar nichts. Dann sagte Georges: Ich werde hier hinübergehen, du kannst nach Hause zurückkehren, zum Diner bin ich wieder da. Er drückte mir die Hand. Zu stark, es hat mir weh getan. Dann setzte er den Fuß auf das Eis, ich blieb am Ufer und sah zu. Plötzlich hörte ich einen Fluch und gleichzeitig ein Krachen, das Eis war unter seinen Füßen gebrochen. Er war hineingefallen, und einen Augenblick verschwand sogar sein Kopf, tauchte aber sofort wieder auf.
Donnerwetter, rief er, das ist ein Bad. Glücklicherweise ist die Sache nicht so schlimm. Er erhob sein Gewehr, das er nicht losgelassen hatte, und begann mit dem Kolben das Eis zu zerschlagen. Dabei rief er aus: Das Eis ist zu stark, da, nimm mein Gewehr, halte es fest, ich werde mich hinaufschwingen. Es ist kalt hier. Er klapperte mit den Zähnen und wurde ganz blau. Er hielt mir den Lauf seines Gewehres hin, ich ergriff es. Dann zog er sich daran hinauf. Da kam mir der Gedanke, ich könne mich seiner entledigen. Ich zog heftig an dem Gewehr, und er mußte loslassen. Er fiel wieder hinein. Ich streckte den Arm weit aus, und schlug ihn mit dem Kolben. Er verschwand im Wasser, und ich hörte, wie er mit dem Kopf versuchte, das Eis zu zerbrechen. Ich wartete, dann war alles vorüber. Ich blieb noch zehn Minuten an derselben Stelle, dann schleuderte ich das Gewehr mit voller Kraft nach der andern Seite, damit man glauben solle, er wäre hineingefallen, als er von Ville-Girard zurückkehrte. Später merkte ich, daß ich einen Fehler gemacht hatte. Ich hätte das Gewehr ins Wasser werfen müssen. Dann bin ich nach Hause zurückgekehrt, das ist die Wahrheit.
Sie haben also den Mord um neun Uhr morgens begangen?
Die Antwort kam nicht mehr. Ein konvulsivisches Zittern hatte den Körper des Elenden erschüttert. Er schlug die Arme kreuzweise übereinander und fiel auf das Bett zurück.
Frau Loisy versteckte sich hinter den Möbeln, als hätte er sie sehen können und verließ leise das Kabinett.
Als sie im Zimmer ihres Gatten angelangt war, schwindelte ihr, der Kopf war ihr wirr, sie fürchtete zu fallen. Aber gewaltsam hielt sie sich aufrecht und klammerte sich an einen Sessel an, die Augen auf den noch immer schlafenden Gatten gerichtet.
Am nächsten Morgen schien eine warme, herrliche, strahlende Sonne, der Frühling spielte im Garten der Familie Loisy.
Vor der Auffahrt lag ein Rasenplatz, der im frischen, saftigen Grün des ersten Frühlings sproßte.
Es war ungefähr zehn Uhr morgens.
Loisy war erwacht. Er fühlte sich unbehaglich. Die Glieder waren schlaff, die Beine wollten ihm nicht gehorchen. Abel hatte ihm Vernunft eingesprochen. Es war eine so schöne Sonne, der Frühling, der Frühling war da, der alles neu belebte. Da hieß es energisch sein.
Abel hatte seine Mutter zu Hilfe gerufen. Ein Spaziergang würde ihm gut tun, und die Mutter hatte sich der Ansicht des Sohnes angeschlossen. Loisy hatte gelacht, als verstehe er, und hatte sich anziehen lassen. Er lehnte sich mit ganzer Kraft auf den jungen Mann, der ihn stützte und aufrecht erhielt.
Das Gehen wurde ihm noch schwerer als gewöhnlich.
Abel hatte seiner Mutter gesagt, sie solle den großen Lehnstuhl mit der gepolsterten Lehne in den Garten, in die Sonne setzen, – und sie hatte gehorcht.
Nun saß Loisy, die Beine auf einem Stuhle ausgestreckt, warm eingehüllt, in der gesunden Luft, in dem warmen Lichte. Abel hockte zu seinen Füßen auf einem Tabouret. Er sprach zu seinem Vater und wiegte ihn mit seiner Stimme ein, wie ein Kind.
Frau Loisy war ins Haus zurückgegangen und beobachtete von innen durch die Fensterscheiben die Gruppe.
Die Greuel der Nacht hatten tiefe Falten in ihre Schläfen gezogen und der Mund war schmerzlich verzerrt. Am Morgen hatte sie die weißen Haare, die sie am vorigen Tage noch nicht besessen, sorgfältig unter ihrer Haube versteckt.
Doch nichts in ihrer Haltung, nichts in ihrer Stimme verriet die innere Seelenqual. Sie warf einen liebevollen Blick auf Loisy, der sich in dem doppelten Kuß der Sonne und seines opferfreudigen Weibes wärmte. Von diesem Blick stahl auch Abel seinen Teil, ohne daß sie es bemerkte, denn sie sah nur auf ihren Mann, der seines Sohnes bedurfte.
An der Ecke sah sie zwei Männer erscheinen, die auf das Haus zukamen. Es waren Herr Bertemont und der Pfarrer Lambquin. Sie erkannte sie sofort, und sofort schnürte ihr auch eine düstere Ahnung das Herz ein.
Frau Loisy war ihnen schnell entgegen gegangen und hatte gleichzeitig mit ihnen die Tür erreicht. Diese gewöhnlich so naive Frau war durch das Leiden eine scharfe Beobachterin geworden. Schon als sie sie ansah, erriet sie, daß ihr Besuch ein ernstes Ziel verfolgte, obwohl sie sich beide bemühten, ihre Aufregung zu verbergen. Sie sah, wie sie die Blicke von ihr abwandten, um Abel zu suchen, und als sie Miene machten, auf Loisy zuzugehen, sagte sie zu ihnen:
Kommen Sie, meine Herren.
Damit zog sie sie in das Haus.
Die Lage der beiden Männer war äußerst peinlich. Konnten sie dieser Frau sagen, ihr Sohn Abel wäre ein Brudermörder? Konnten sie ihr dieses Geheimnis, das sie töten mußte, ins Gesicht schleudern? Noch an demselben Morgen hatten sie lange Zeit miteinander gesprochen und auf die traurige Mission, die sie sich vorgenommen, fast verzichtet. Der Pfarrer hatte Thomas sogar von neuem aufgesucht, doch der alte Diener war ihm ausgewichen, sogar ziemlich auffällig, damit man über seine Ansichten keinen Augenblick im Zweifel war. Sein Groll verzieh also nicht; er hielt sein Ultimatum aufrecht. Die Gefahr einer noch schrecklicheren Enthüllung von seiten der aufgeregten Dorfbewohner, die die Gestalt der Lynchjustiz annehmen konnte, mußte sie zu festem Entschlusse treiben.
So waren sie denn gekommen, und beide – Herr Bertemont, der so reiche Lebenserfahrung besaß und die Schwere des Schicksals nur zu bitter empfunden hatte, der Abbe, der in der grauen Eintönigkeit seines Lebens die Welt ebenfalls kennen gelernt – beide standen eingeschüchtert und fast zitternd vor dieser armen Frau, der sie das Herz in der furchtbarsten Weise zerreißen mußten.
Schnell hatte sie sie in das große Zimmer geführt, ihnen Sessel hingeschoben und bemühte sich, ruhig zu erscheinen.
Sie stand vor ihnen und wartete; doch keiner sprach.
Endlich entschloß sich der Abbe, zu reden.
Teure Frau Loisy, sagte er. Sie wissen, welche aufrichtige Freundschaft wir für Sie um Herrn Loisy hegen, und es bedurfte unserer ganzen Zuneigung, um uns zu dem Schritte zu veranlassen, der –
Er begann zu stottern und konnte nicht weiter sprechen.
Frau Loisy setzte sich ebenfalls. Dieser Satz hatte ihr genügt. Sie wußte, man würde ihr von Abel erzählen. Sie war bereit und hatte sich mit all ihren Schmerzen, mit all ihrer Angst gewaffnet, die sich ihr wie ein Panzer auf die Brust legte.
Ich höre, sagte sie.
Also in zwei Worten, fuhr Herr Bertemont, der plötzlich einen ganzen Feldzugsplan entworfen, fort, ich möchte Ihnen eine Stellung für Ihren Sohn Abel vorschlagen.
Er hatte bei den letzten Worten leicht gezögert. Frau Loisy hörte aufmerksam zu und erwiderte:
Eine Stellung!
Abel wird bald zwanzig Jahr, es ist also nötig, daß man sich mit seiner Zukunft beschäftigt. Er ist nicht kräftig, und man muß dafür sorgen, daß er unter dem Kampf des Lebens nicht zu leiden hat. Einer meiner alten Kollegen, ein Notar aus Paris, hat mir geschrieben und bei mir angefragt, ob ich nicht einen jungen Mann aus ehrenhafter Familie kenne, den er in seinem Bureau beschäftigen könne, nicht als Schreiber, sondern als Sekretär, als Vertrauensperson; er sollte mehr ein Freund, ein Schützling für ihn sein. Das Gehalt würde zu Anfang nicht nur ausreichend sein, nein, mein Kollege verpflichtet sich sogar, den jungen Mann in wenigen Jahren in die ganzen Geschäfte einzuweihen. Kurz und gut, es ist ein wunderbares Anerbieten, und ich habe keinen Augenblick gezögert, Sie davon zu unterrichten, denn ich bin überzeugt, Sie werden diese außergewöhnliche Gelegenheit mit Freuden ergreifen.
Frau Loisy hatte aufmerksam zugehört. Einen Augenblick war sie versucht, an die Wahrheit dieses Vorwandes zu glauben. Doch ganz kleine Nuancen, die ihr Herz mit wunderbarem Scharfsinn erriet, hatten diese Gedanken schnell verscheucht. Herr Bertemont sprach nicht die Wahrheit. Als sie noch überlegte, ergriff der Abbe das Wort; er war von dem Ausweg, den er für sehr geschickt hielt, entzückt.
Sie begreifen, verehrte Frau Loisy, daß ich mich Herrn Bertemont, der mit einer so guten Nachricht zu Ihnen kam, mit Vergnügen angeschlossen habe.
Meine werten Freunde, sagte Frau Loisy in sanftem Tone, und ihre etwas schwache Stimme hatte dennoch ihre ganze Festigkeit wiedergefunden, ich danke Ihnen herzlich für das Interesse, das Sie uns entgegenbringen, und ich bin ganz besonders gerührt über die Zuneigung, die sie meinem Sohne bezeigen. Doch ich glaube, Sie vergessen hier ein wenig den Vater.
Nein, Madame, versetzte Herr Bertemont, ich weiß … wir alle wissen, wie groß Abels Hingebung für Herrn Loisy ist. Wir wissen auch, daß es Herrn Loisy etwas schwer werden wird, sich von Abel zu trennen. Doch das Interesse Ihres Sohnes zwingt Sie auch, als kluge Mutter nicht seine Zukunft zu opfern … Bedenken Sie, daß mein Anerbieten gleichzeitig die Interessen Abels und die Schonung, die seine Gesundheit verlangt, mit einander in Einklang bringt. Nun, Frau Loisy, Sie müssen einen schnellen Entschluß fassen. Mein Kollege wünscht, daß ich meinen Schützling – wenn ich mich so ausdrücken darf, – in drei Tagen zu ihm schicke.
In drei Tagen, rief Frau Loisy, die Frist ist etwas kurz. Uebrigens würde ich Ihnen in drei Tagen genau so antworten wie heute, vielleicht aus ehelichem Egoismus – wenn Sie wollen –, doch mit der Gewißheit, meine Pflicht zu tun, ich würde Ihnen antworten, daß Abel seinen Vater nicht verlassen kann.
Aber Frau Loisy, ich bitte Sie.
Sie fuhr fort, und mehrmals stockte ihre Stimme infolge der Tränen, die sie nur mühsam zurückzudrängen vermochte.
Ich wiederhole Ihnen, es ist Egoismus, doch das Leben, die Gesundheit meines Mannes, spielt für mich, seine Lebensgefährtin, im Glück wie im Unglück die erste Rolle. Herr Loisy kann seinen Sohn nicht entbehren. Der ganze Rest seiner Kraft hat sich auf ihn konzentriert, Abel ist der Stab seines Alters. Ohne ihn würde er fallen … und er darf nicht fallen!
Tatsächlich war das der ganze Grund für den erhabenen Egoismus dieser Mutter, die genau wußte, daß ihr Sohn ein Mörder war, die, wenn sie ihn nur ansah, alle Qualen des Entsetzens und der Verzweiflung litt, dennoch hatte sie heute morgen Abel ihre Stirn zum Kusse gereicht, sie hatte ihm zugelächelt, sie hatte mit ihm gesprochen und seinen Worten gelauscht, als hörte sie nicht in seiner Stimme das entsetzliche Echo des nächtlichen Geständnisses. Georges war ermordet! Abel ein Brudermörder! Und doch verschwand dies alles für sie in dem einzigen Gedanken, daß sie dem Manne keinen Schmerz bereiten durfte.
So lehnen Sie also ab? fragte Herr Bertemont bestürzt.
Seien Sie mir nicht böse, noch einmal, ich danke Ihnen von ganzem Herzen, ich weiß die Güte und das Zartgefühl Ihrer Bemühungen zu schätzen, doch ich kann, ich darf Ihren Vorschlag nicht annehmen.
Der Versuch war vollständig mißlungen, und die Gefahr rückte immer drohender näher.
Frau Loisy, sagte Herr Bertemont, verzeihen Sie mir, wenn ich noch einmal auf mein Anerbieten zurückkomme. Als ich Ihnen diesen Vorschlag machte, hatte ich nicht nur die Zukunft Abels, sondern auch das Interesse der Gegenwart im Auge.
Die arme Frau fühlte, wie eine Hand ihr langsam das Herz einschnürte.
Der Gegenwart? wiederholte sie.
Es spielen sich hier bei Ihnen, sagte Herr Bertemont in entschlossenem Tone, ernste Dinge ab, von denen Sie nicht die geringste Ahnung zu haben scheinen. Ohne, daß wir nach den Ursachen dieses Zustandes suchen wollen, muß ich Ihnen doch bemerken, daß Ihr Sohn Abel von den Einwohnern von Longpre – verabscheut, gehaßt wird. Es sind Drohungen ausgestoßen worden; wir haben freundschaftliche Warnungen erhalten. Und, aufrichtig gestanden, ich hätte Furcht, ja, wahrhaftig, ich hätte Furcht, es könne ihm irgend ein Unfall zustoßen.
Mit halbgeschlossenen Augen lauschte Frau Loisy diesen Worten. Jetzt war die Anspielung deutlich. Sie zweifelte nicht mehr. Dieses Geheimnis, das sie in ihr Herz wie in ein Grab einschloß, kannte sie also nicht allein. Hatte vielleicht noch jemand außer ihr das entsetzliche Geständnis von Abels Lippen vernommen?
Ich kann Sie nicht verstehen, fuhr sie fort, mein Sohn verläßt das Haus nicht, er kann also niemand etwas zu Leide getan haben. Wenn irgend ein Bewohner der Stadt ihn haßt, so ist mir das unerklärlich; Sie müßten denn mir, die ich ihn zu verteidigen berufen bin, absichtlich etwas verbergen. Sollte man in mein Haus kommen, ihm zu drohen, ihn etwa gar zu schlagen?
Herr Bertemont schüttelte den Kopf; er wagte nicht mit einem »Nein« zu antworten. Der Pfarrer aber erklärte bestimmter:
Wer weiß, Frau Loisy. An Ihrer Stelle würde ich Abel nicht dieser ziemlich schweren Gefahr aussetzen.
Sie sah sie alle beide an, als wolle sie sie auf den Grund ihrer Seelen prüfen. Auf diesen so verschiedenen, und in ihrer Ehrenhaftigkeit doch so gleichen Gesichtern, las sie die Angst dieser zur Lüge genötigten redlichen Menschen. Und plötzlich sagte sie, ebenfalls der Gefahr ins Auge sehend:
Sie wissen mehr. Ich will die ganze Wahrheit hören.
Lassen Sie uns mit Ihrem Sohne Abel sprechen, wir werden ihm alles erklären.
Wozu? Ich bin seine Mutter, und wenn meinen Sohn eine Gefahr bedroht, so geht sie zuerst mich an … Ich bitte Sie, meine Herren, ich flehe Sie an, sagte sie endlich besiegt, sich der Aufregung überlassend, die sie quälte, sagen Sie mir die Wahrheit, was wissen Sie?
Die biblische Form kam dem Abbe zu Hilfe.
Wir wissen, wir glauben …, daß Gott die Hand von Ihrem Sohne Abel abgezogen hat, und daß er vor dem Herrn schuldig geworden ist.
Frau Loisy erstickte einen Schrei und wandte lebhaft den Kopf nach dem Fenster. Loisy saß noch immer an demselben Platze, sein Sohn neben ihm.
Mit einer Geste, die die leidende Mutterliebe majestätisch und erhaben erscheinen ließ, zeigte sie den beiden Männern den Jüngling, den sie verteidigte.
Ich kann meinen Mann nicht töten, sagte sie leise.
Aber Herr Loisy wird ja nicht sterben, meinte Herr Bertemont. Wir werden ihn pflegen, meine Tochter soll Abel vertreten.
Nein, nein, ich weiß, was ich sage, rief die arme Frau weinend, mein armer Mann ist hartnäckig und eigensinnig, und dagegen ist nichts zu machen. Ich sage Ihnen, es wäre sein Tod, sein Tod.
Plötzlich unterbrach sie sich und fragte, den Kopf erhebend:
Könnten Sie mir nicht das Verbrechen nennen, dessen man … Georges Bruder beschuldigt?
Nein, versetzte Herr Bertemont zitternd.
Nun denn, Sie können sprechen, meine Herren, ich weiß es.
Sie, Sie wissen?
Beide hatten sich erhoben, und eine tiefe Achtung vor dieser Märtyrerin der Mutterliebe erfüllte ihr Herz.
Ich weiß alles, ja, alles … Ich weiß sogar, was Sie nicht wissen, was keiner wissen kann, außer mir … Was ich leide, was ich in meinem tiefsten Herzen weine, können Sie sich nicht einmal vorstellen … Und ich, die Mutter schweige seinetwegen, meines Gatten wegen. Ach, die anderen mögen doch auch Mitleid haben und vergessen, wenigstens bis zu dem Tage, wo der Vater seines Sohnes nicht mehr bedarf.
Ja, wenn es nur von uns abhinge! rief der Abbe. Doch Herr Bertemont hat Ihnen die Wahrheit gesagt, es sind Gerüchte im Dorfe im Umlauf, man spricht von bestimmten Zeugenaussagungen, von Leuten, die gesehen haben …
Nun gut, so sagen Sie mir ihre Namen, ich werde sie anflehen! Warum wollten sie sich früher rächen als es sein muß, was tut es ihnen, wenn Sie einige Monate, vielleicht nur einige Wochen warten? … Mein Gott, mein Gott, um einen Sohn zu rächen, wollen sie meinen Gatten töten! Nun denn, ich werde sie um Aufschub, um eine Frist bitten, und wenn der Vater nicht mehr sein wird … denn leider sehe ich ihn alle Tage langsam, aber sicher absterben … dann soll der andere, der Schuldige verschwinden, er mag weit, weit fort fliehen, und man soll nicht einmal erfahren, ob er überhaupt noch lebt … doch man gönne mir die Gnade des traurigen Aufschubes; ich bitte Sie, ich flehe Sie darum.
Sie standen alle drei am Fenster und betrachteten noch immer Loisy und seinen Sohn. Plötzlich schwankte der Sessel des Kranken hin und her, und Loisy fiel wie gebrochen nach der Seite über.
Frau Loisy stieß einen entsetzlichen Schrei aus und stürzte hinaus.
Abel war aufgesprungen und auf seinen Vater zugestürzt, den er in seinen Armen auffing.
Frau Loisy war herbeigeeilt, ihr folgte Herr Bertemont und der Pfarrer. Mit instinktiver, brutaler Bewegung riß sie Abel den Körper seines Vaters aus den Armen und stieß ihn heftig zurück. Sie kniete auf dem Sande nieder und hob den armen, fleischlosen Kopf Loisys mit ihren beiden Händen in die Höhe.
Tot, tot, nein, ich will nicht, ein Arzt, ein Arzt!
Tot! rief jetzt auch Abel, nein, nein, das ist unmöglich!
Und wieder trat er näher, um seiner Mutter zu helfen, die sich umsonst bemühte, den Unglücklichen hochzuheben. Doch Herr Bertemont war ihm zuvorgekommen und hatte die Leiche ins Haus getragen. Der Abbe war schon fortgegangen, um den Doktor zu holen. Loisy wurde auf das Bett gelegt. Doch ein Zweifel war unmöglich. Aus dem schrecklich verzerrten Munde floß ein weißlicher Schaum, es war der Schlagfluß, der mit dem Tode geendet hatte. Frau Loisy hatte ihren Arm um die Schultern des Gatten geschlungen und betrachtete ihn, von der schrecklichen Wahrheit überzeugt und dennoch ungläubig, mit den Augen einer Wahnsinnigen. Da bemerkte sie auf der anderen Seite des Bettes Abel, der wie betäubt dastand. Dieser Tod vernichtete auch sein Leben.
Sie richtete sich auf, erhob den Arm und machte instinktiv eine Bewegung des Fluches. Er rührte sich nicht, er verstand nicht oder wollte nicht verstehen. Seine Mutter schwieg, und ihr Arm fiel wieder langsam hernieder.
Als der Arzt sich ausgesprochen, als sie die Hoffnung, die sogar die Gewißheit überlebte, vollständig hatte aufgeben müssen, da war alles in Frau Loisy zusammengebrochen, sie war zusammengeschrumpft, gleichsam kleiner geworden.
Langsam, mit den Bewegungen einer Nachtwandlerin, hatte sie dem Toten die letzte Toilette gemacht und mit einem ausdruckslosen Zeichen Abel, der ihr helfen wollte, zur Seite geschoben.
Gabriele, die ihr Vater gerufen, war schnell herbeigeeilt. Frau Loisy hatte ihr mit einem traurigen Lächeln gedankt, sich dann neben ihr am Fuße des Bettes niedergelassen und ihr die Hand gereicht, die das junge Mädchen innig drückte. Abel war traurig und verlegen.
Ein so großer Verbrecher ein Mensch auch sein mag, es gibt doch natürliche Eindrücke, gegen die er nicht anzukämpfen vermag. Der Tod seines Vaters war für ihn mehr ein körperlicher, als ein moralischer Schmerz gewesen. Einen Augenblick hatte er geglaubt, er würde einem Nervenanfall unterliegen; in seinem Hirn und seiner Kehle hatte sich gleichsam ein Erstickungsknoten gebildet, dann war eine plötzliche Abspannung eingetreten, als wenn er weinen wolle. Er hätte es gewünscht. Doch er wagte es nicht, bezwang sich und nahm alle seine Kraft zusammen, um in stummer Traurigkeit zu verharren. Ein Instinkt sagte ihm, er müsse sich unbeweglich verhalten, man dürfe ihn nicht hören, ja kaum sehen. Er hatte sich in einen Winkel des Zimmers geschlichen und blieb hier, die Hände auf den Knieen, sitzen.
Warum hatte ihn seine Mutter nicht geküßt? Er war doch jetzt das einzige Wesen auf der Welt, das ihr geblieben war. Warum hatte sie nicht in seinen Armen geweint? Warum schmiegte sie sich nicht an ihn, da sie ja doch nichts wußte?
Von dem Sonnenstrahl beleuchtet, der durch das Fenster brach, saß sie ihm gegenüber; einen scheuen Blick durch seine gesenkten Lider auf sie werfend, betrachtete er sie prüfend von der Seite, doch nie begegnete er ihren Augen.
Dann blickte er auf die starre Gestalt der auf dem Bette liegenden Leiche; das Laken hatte sich langsam gesenkt und ließ die Ecken dieses Körpers hervortreten, der einst so kräftig gewesen und heute den weißen Stoff mit knochigen Spitzen zu durchbohren schien. Er erinnerte sich, wie der Vater früher ausgesehen. Zuweilen hatte er die Halluzination der Bewegung und fragte sich in seiner quälenden Nervosität, ob sich der Leichnam nicht plötzlich aufrichten würde, um ihn anzuklagen. Doch warum benahmen sich alle so kalt gegen ihn? Warum erriet er in dem Schweigen, in der Niedergeschlagenheit dieses tiefen Schmerzes eine Abneigung, fast einen Haß? Gabriele mußte ihm allerdings zürnen und ebenso Herr Bertemont, der stets der Ansicht seiner Tochter war. Doch auch der Abbe hatte sich von ihm abgewendet und seine Mutter hatte nicht die geringste Bewegung gemacht, um ihre Verzweiflung mit ihm zu teilen. Warum? Warum?
Er wünschte sich Lärm, Geräusch, irgend ein furchtbares Ereignis, das dieses tote Haus, über dem ein Gespenst schwebte, in Aufruhr brachte.
Endlich kam die Bewegung. Es war der Arzt, der den Totenschein ausstellte, dann der Tischler, der Maß für den Sarg nahm und endlich die Besucher, gleichgültige Nachbarn, die eine Pflicht erfüllten und gleichzeitig ihre Neugier befriedigten. Mehrere sprachen mit ihm und sagten: Armes Kind! Er fühlte sich ein wenig erleichtert und schleppte sich in den Garten, wo er wohl hundertmal durch dieselben Alleen ging. Doch als er der Hecke sich näherte, riefen ihm Straßenjungen, die gerade vorüberkamen, ein Schimpfwort zu, und einer von ihnen warf einen Stein nach ihm. Er flüchtete sich hinter das Baumdickicht, lehnte sich schaudernd und bleich an eine Pappel, und zog seinen Rock dichter zusammen, als wenn er friere. Ja, was haben sie denn alle, alle! murmelte er und fügte dann leiser hinzu:
Ich habe ihnen doch nichts zuleide getan. Selbst als Strafe für das begangene Verbrechen erschien ihm die Angst, die er ausstehen mußte, zu grausam.
Sollte er ins Haus zurückkehren? Nein, noch nicht. Er wollte sich lieber in diese Einsamkeit zurückziehen, in der niemand ihn störte. Je länger er draußen blieb, desto geringer wurde die Angst vor dem Toten, der noch immer auf seinem Bette lag. Endlich hörte er die Hammerschläge, wenigstens sah er den Leichnam nicht mehr. Bald war alles vorüber. Am nächsten Tage sollte das Begräbnis stattfinden. In vierundzwanzig Stunden war er von seinen moralischen Qualen befreit. Dann würde seine Mutter in ihrer einsamen Verzweiflung zu ihm zurückkehren; er wollte sich ihr widmen, wie er sich seinem Vater gewidmet hatte. Das Haus gehörte ihm, und er wollte einige kleine Veränderungen vornehmen. Er wollte nicht mehr, daß man von draußen zu ihm hineinsehen konnte.
Nach und nach trat an die Stelle seiner Schreckensvisionen der Traum eines Eremiten. Er berechnete die väterliche Erbschaft. Im Grunde genommen war er jetzt allein; er war der Herr. Ein leises Zittern des Behagens überflog seinen Körper, wenn er an das ruhige gemütliche Leben dachte, das er sich schaffen wollte. In dem süßen Traume der ruhigen Zukunft ließ sich alles vergessen. Er atmete leichter, der Abend brach herein. Lange Zeit zögerte er; er fürchtete die Bewegung und glaubte die Ruhe zu verscheuchen, von der er sich umgeben fühlte. Es war besser, seine Mutter ihrem Kummer zu überlassen. Er schlich um das kleine Gebüsch herum und bemühte sich so leise zu gehen, daß der Sand nicht knirschte.
Das Kabinett, in dem er schlief, führte in einen Korridor, dessen Tür auf den Garten hinausging. Er öffnete sie ganz leise und schlich in das Zimmer. Er hatte das Gefühl, diesmal würde er ruhig schlafen. Mit unendlicher Vorsicht schloß er die Fensterläden, die Vorhänge, machte alles dunkel, entkleidete sich ohne Licht und legte sich schlafen. Eine seit langer Zeit unbekannte Ruhe durchströmte sein ganzes Wesen; er schlief ein.
Am Morgen erwachte er, ganz überrascht, daß er nicht geträumt hatte. Es war das erstemal seit Georges Tode. Er fühlte sich kräftig. Im Hause ließen sich leise, erstickte Töne vernehmen. Augenscheinlich bereitete man alles zum Leichenbegräbnis vor. Eine Uhr schlug die siebente Stunde. Noch fünf Stunden hatte er zu warten. Er verließ das Haus durch den Korridor und trat wieder in den Garten. Als er am Hause entlang schlich, sah er vor der Tür Arbeiter, die mit dumpfen Schlägen, als hätten sie ihre Hämmer in Leinwand gewickelt, Behänge festnagelten. Auch das war wohl bald vorüber. Er hatte die Unannehmlichkeit, Thomas zu begegnen, doch der alte Diener, der ihm einen finsteren Blick zuwarf, ging um ihn herum, als wolle er ihn nicht berühren. Abel nahm sich vor, ihn am nächsten Tage fortzujagen. Die Hauptsache war jetzt Geduld. Die Leute in seiner Umgebung sahen ihn mit bösen Blicken an. Instinktive Abneigung, nichts weiter. Ein bestimmter Argwohn wäre nicht so schüchtern gewesen; wenn die Leute ihn anklagten, so würden sie sich heftig, aber nicht heuchlerisch zeigen. Er duldete die Heuchelei nicht bei anderen.
In diesem gestörten Organismus steckte gleichzeitig ein Verbrecher und ein Kranker. Ein Verbrecher, denn er war sich dessen, was er tat und was er getan hatte, vollauf bewußt. Die Gründe, weshalb er seinen Bruder niedergeschlagen, entstammten klar und deutlich seinem Bewußtsein, und heute beurteilte er die Situation mit der scheinbaren Geistesfreiheit eines Fremden, der der Sache vollständig gleichgültig gegenüberstand. Er war aber auch ein Kranker, denn während er tötete, während er sich ängstigte, während er vermutete und träumte, hatte Abel in seinem ganzen Körper, im Schädel, im Herzen, in den Gelenken das krampfartige Zucken des Fiebers verspürt; diese Krankhaftigkeit war so stark, daß er nicht einmal nach einer Entschuldigung suchte.
Vor der Tür hatten sich Gruppen gebildet; die Frauen traten auf den schwarzen, unter den Blumen fast verschwindenden Sarg zu, neigten sich vor ihm und schlugen hastig das Kreuz. Die Männer nahmen den Hut ab und blieben in ihrer schwarzen, ernsten Kleidung stumm und unbeweglich stehen.
In Abwesenheit Abels hatte ein langes Gespräch zwischen Frau Loisy und ihren Freunden stattgefunden.
Soll Abel am Begräbnis teilnehmen? hatte Herr Bertemont gefragt.
Wenn er will, ja, hatte Frau Loisy geantwortet. Alle sollen an seine Reue glauben, ich werde daraus eine Huldigung für meinen Mann ersehen.
Und dann?
Dann werde ich ihn nicht mehr hier aufnehmen.
Frau Loisy hatte diese Worte mit klarer Stimme gesprochen, ohne Zorn, doch mit einem Ausdruck des Willens, den man sonst nicht an ihr kannte.
Ich verstehe Sie, versetzte der Abbe Lambquin, der dieser schnellen Unterredung als dritter beiwohnte. Herr Bertemont hatte Ihnen von einer Stelle bei einem seiner Kollegen gesprochen. Sie haben verstanden, daß dahinter nur die Erfindung eines guten Herzens steckte. Ich habe etwas Bestimmtes gefunden. Einer meiner Freunde, der Prior einer Bruderschaft, will Abel bei sich aufnehmen. Er weiß, daß er ein großer Verbrecher ist, etwas Genaueres ist ihm nicht bekannt. Ich werde ihn ihm morgen nach Beaubais zuführen. An demselben Tage wird er mit ihm nach Marseille, von dort nach Australien reisen, er wird ihn als Kranken behandeln und gleichzeitig seinen Körper und seine Seele pflegen. Gehen Sie darauf ein, Frau Loisy?
Ja, versetzte sie.
Aber Abel? sagte Herr Bertemont.
Nach dem Begräbnis werde ich ihn mit nach dem Pfarrhause nehmen und dort mit ihm sprechen. Mein Charakter und mein Amt gestatten mir, ihm Dinge zu sagen, die andere vor ihm verbergen müßten. Er wird mir nicht widerstehen. Die Nacht wird er bei mir zubringen. Um fünf Uhr früh werden wir aufbrechen. Hören Sie mich an, Frau Loisy, antworten Sie mir ganz offen, Sie wollen ihn nicht wiedersehen?
Nein!
Das dachte ich mir, doch Sie selbst, was wollen Sie tun? – Nichts.
Während des Begräbnisses werde ich hier allein bleiben, ich habe Gabriele gebeten, den Tag bei mir zuzubringen. Außer mir soll heute niemand im Hause wachen. Ich will mit seinen Erinnerungen allein bleiben.
Es soll geschehen, wie Sie wünschen.
Frau Loisy mußte nun die Beileidsbezeugungen der Nachbarn entgegennehmen, sie war ruhig. Doch das war die Ruhe einer Toten. – Es wurde das Zeichen zum Aufbruch gegeben.
Abel erschien in seinem Gehrock, in dem er noch magerer aussah, mit unbedecktem Haupte, und trat, fest entschlossen, mit niemand ein Wort zu sprechen, an die Spitze des Zuges, hinter die Träger, die den Sarg in die Höhe hoben. Er blickte weder nach rechts noch nach links und hielt beständig die Augen auf das Kreuz der Ehrenlegion geheftet, das von dem Leichentuch herabhing und über dem Sarge schwebte.
Hinter ihm gingen Herr Bertemont und einige Nachbarn. Der Abbe ging an der Spitze neben dem Kreuze, von seinem Vikar und einigen Chorkindern umgeben.
Als Abel erschien, zischelte man in der Menge, doch der Respekt vor dem Toten hielt die Leute zurück.
In der Kirche und während des Weges zum Kirchhof blieb alles ruhig. Um zum Kirchhof zu gelangen, mußte man an dem Fußpfad vorbei, der zur Stoppelwiese führte. Dieselbe Erinnerung machte sich bei allen geltend, und die Menge geriet plötzlich in Aufregung.
Abel sah nichts und hörte nichts. Er hatte sich gewissermaßen selbst magnetisiert, um bis zum Abend, bis zum nächsten Tage keinen anderen Gedanken zu haben.
Der Pfarrer sprach die liturgischen Gebete. Herr Bertemont richtete einige Abschiedsworte an den Mann, der sein letzter Freund gewesen war; dann war die Zeremonie zu Ende.
Doch in demselben Augenblick, wo das Band der Ehrfurcht vor dem Toten zerriß, schien die Menge zu erwachen.
Abel stand, ohne etwas zu merken, am Rand des Grabes auf der hoch aufgeschütteten Erde. Von hier sah er auf die Anwesenden hernieder, und seine krankhafte Gestalt zeichnete sich von dem reinen Himmel ab.
Man sah darin eine freche Herausforderung. Ein dumpfes Grollen erhob sich überall, besonders auf seiten der Bauern, die weder Loisy noch seinen Sohn Georges gekannt hatten. Plötzlich rief eine Stimme:
Komm doch herunter, Kanaille, damit man mit dir abrechnen kann.
Ins Wasser mit ihm, in die Arvette, riefen andere.
Der Abbe erkannte die Gefahr. Er rief Thomas und sagte mit leiser Stimme zu ihm:
Sie hatten mir doch drei Tage Frist gegeben.
O, Herr Pfarrer, so lange wie Sie wollen … mag er sich anderswo hängen lassen.
Aber die anderen! Sie haben sie aufgehetzt … ich fürchte für Abel.
Nehmen Sie ihn beim Arm, ich stehe für alles.
Der Abbe Lambquin trat auf Abel zu und berührte ihn leise. Der junge Mann erzitterte, hob den Kopf und sah aller Augen auf sich gerichtet.
Wieder ertönte ein Schrei:
Tötet ihn! Ins Wasser mit ihm!
Augenblicklich erkannte er die Gefahr, und seine Finger bohrten sich in den Arm des Pfarrers.
Dieser schob seinen Arm unter den des jungen Mannes, ging langsam, die Leute fest ansehend, an den feindlichen Gruppen vorüber und zog Abel mit sich fort.
Man schwieg. Nur die Augen sprachen, und man hörte das heisere Stöhnen von Wölfen, die ihr Opfer verlangten.
Abel schmiegte sich an den Abbe. So durchschritten sie die Stadt und kamen nach dem Pfarrhause.
Dort schloß der Pfarrer die Tür, wandte sich zu ihm und sagte: Mein Kind, wollen Sie beichten? Ich bin bereit, Sie zu hören!
Ich wozu? Ich habe nichts zu gestehen.
Hören Sie mich erst, sagte der Abbe, ich will Ihnen Ihre Lage auseinandersetzen, damit Sie wissen, was Sie zu tun haben, wenn Sie überhaupt gerettet sein wollen.