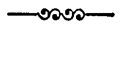|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Longpre-sur-Oise zählte kaum tausend Einwohner, doch diese tausend Einwohner waren in drei Klassen eingeteilt – in drei Kasten, könnte man sagen, – die ebenso streng von einander verschieden waren, wie die der alten Aegypter. Oben, jenseits der Arvette, wohnten die Bauern, die unermüdlichen Arbeiter mit dem undurchdringlichen Gesicht und dem zähen Geiz, auf ihren Feldern. Unten, im Herzen des Dorfes, in der großen Straße, wohnte der dritte Stand, die kleinen Handelsleute, zwei Schlächter, zwei Obsthändler, zwei Krämer, drei bis vier Schankwirte, und auf dem großen, durch seine hundertjährigen Ulmen berühmten Platze ein Café. Diese waren entgegenkommend zu jedem, doch, instinktive Gegner der Höherstehenden, der Protzen, wie sie sie nannten.
Parallel der großen Straße lief eine breite Straße, die von Besitzungen begrenzt wurde, die man aus dem Bezirk des alten, seit der Revolutionszeit wohl zwanzigmal verkauften Schlosses gebildet hatte. Hier wohnten die Großgrundbesitzer, die von den Kaufleuten und Bauern hochgeachtet wurden und schon wegen ihres Einflusses auf die Wahlen in großem Ansehen standen. Zu ihnen gehörte Herr Deroche. Man machte ihm wohl ganz leise den Vorwurf, er verwende alle Gelder der Gemeinde zur Verbesserung der Straßen, die zu seinem Besitztum führten, trotzdem fürchtete man ihn und schmeichelte ihm. Um ihn her wohnten die großen, bedeutenden, reichen Gemeinderäte. Die große Straße und die Avenue bildeten den Mittelpunkt des Ortes, hier schlug das Herz von Longpre-sur-Oise, oder richtiger gesagt, das Herz der Verwaltung.
Endlich hauste an den Ufern der Oise, in der Nähe der Böschung, die sogenannte Kaste der Pariser, d. h. diejenigen, die sich jedes Jahr in der schönen Jahreszeit hier niederließen. Einige siedelten sich vollständig auf dem Lande an, wie Loisy und Herr Bertemont. Doch mehrere Generationen mußten vergehen, bevor sie den Namen »Pariser« verloren, der sie gleichsam als Ausländer kennzeichnete. Im allgemeinen hatten diese Pariser wenig Verkehr mit dem Rest der Bevölkerung. Sie hatten ihre Bekanntschaften und Gewohnheiten in Paris. An jedem Sommersonntag, ließ sich bei den meisten eine Schar von Städtern nieder, die, wenn sie zufällig durch die große Straße kamen, das große Unrecht begingen, das spitze Pflaster und die schwärzlichen Häuser nicht zu bewundern und ihrer geringen Sympathie für die warmen Ausdünstungen des Düngers, der durch die schlecht geschlossenen Türen strömte, beredten Ausdruck zu verleihen.
Um die Gemeindegeschäfte kümmerten sich die Pariser nicht. Keiner von ihnen versuchte, sich in die Verwaltung zu mischen. Sie wohnten an der Lichtung der kleinen Stadt, verschlossen und ruhig, wie Loisy und Bertemont, wenn sie nicht, wie viele andere, die Stadt auf geraume Zeit verließen. Von dem, was in Longpre vorging, von den kleinen Streitigkeiten des Ortes, sogar von den Ereignissen, die den Gesprächsstoff der großen Straße oder des Cafés lieferten, wußten sie nichts und erfuhren nur zufällig, meistens sogar erst lange, lange Zeit nachher die Gerüchte und Klatschereien, die zuweilen auf sie selbst abzielten.
Das einzige Mittelglied zwischen dem Zentrum und seinen fernen Ausstrahlungen bildeten die Lieferanten oder die Aufwartefrauen, die der eine oder der andere beschäftigte.
So teilte eines Morgens Frau Lorran, die zweimal wöchentlich bei Herrn Bertemont die Aufwartung besorgte, Fräulein Gabriele Dinge mit, die auf sie einen starken Eindruck machten.
Ein in der Gegend wohlbekannter Wilddieb hatte einem der Feldhüter gewaltsamen Widerstand geleistet und ihn sogar ziemlich schwer verletzt. Er war verhaftet und nach Beauvais überführt worden, wo er augenblicklich im Gefängnis saß. Bis dahin war die Sache für Gabriele nicht sehr interessant, und, wie gewöhnlich, schenkte sie dem Geschwätz der braven Frau nur eine geringe Aufmerksamkeit, da plötzlich erklärte dieselbe:
Das Merkwürdige ist, Voisinot – so hieß der Wilddieb – soll eine prächtige Jagdbüchse besitzen; es soll dasselbe Gewehr sein, das Herrn Georges Loisy gehörte und das man nie wieder aufgefunden hat.
Bei dem Worte Georges hatte Gabriele den Kopf erhoben und aufmerksam zugehört.
Sie hatte ihrem Vater die Wahrheit, die volle Wahrheit gesagt. Sie hatte Georges mit der ganzen Kraft einer ersten Liebe geliebt, der noch die ganze Wonne und Naivität der Jugend inne wohnte. Vor zwei Jahren hatte sie Georges zum erstenmal gesehen, und sofort hatte er sich ihr Herz erobert.
Noch waren keine acht Tage verflossen, da schienen die beiden jungen Leute schon immer zusammen gewesen zu sein. Er sprach nicht von Liebe, er sprach zu ihr, wie zu einer Gefährtin, einer Freundin, einer Schwester.
Glücklich und vertrauensvoll hatte sie sich dieser Freundschaft überlassen, die zum schönsten Ende führen mußte. Liebte Georges sie wirklich wahr und innig?
Tatsächlich hatte er sich das nie gefragt. Doch, wenn er es getan, so hätte er sich selbst die Antwort gegeben, Gabriele wäre die Frau, die ihm sein Herz als zukünftige Lebensgefährtin bestimmte. Wenn sie sich wiedersahen, schüttelten sie sich offen vor allen die Hände, sie waren wieder zwei gute Kameraden, die eine Reise für den Augenblick getrennt hatte.
Leider sollte Georges von seiner letzten Reise nicht wieder zurückkehren. Gabrielens Schmerz war tief, denn die Wurzeln ihres Herzens wurden erschüttert.
Sie kannte den Grund, weshalb sich ihr Vater von allem zurückgezogen. Frau Bertemont hatte ihren Gatten vor mehr als fünfzehn Jahren verlassen, ohne sich um ihre Tochter zu kümmern. Wo sie war, wußte niemand. Der Mann, um dessetwillen sie das häusliche Dach verlassen, war der Sohn eines Freundes des Herrn Deroche, und dieser Umstand erklärte die eisige Kälte, die die beiden Männer trennte. Herr Deroche fühlte sich verletzt, weil er glaubte, Herr Bertemont wolle ihn durch seine mehr als reservierte Haltung für die Schuld des ihm befreundeten jungen Mannes verantwortlich machen. Bertemont aber litt auf das bitterste, wenn er mit einem Manne zusammenkam, der ihn an die Katastrophe erinnerte, die sein Leben vernichtet hatte. Er hatte seine Tochter erzogen. Er war selbst traurig, und darum hatte er sie traurig gemacht, ohne es zu wollen. Er war ein guter Vater, doch seine Vaterliebe war mehr nachsichtig als zärtlich. Der wahre Vater, – der die Güte und den Verstand der Mutter besitzt, – beginnt erst beim Großvater. Herr Bertemont hatte seine Tochter sorgfältig erzogen, er hatte seine Pflicht erfüllt, ja, sogar mehr als seine Pflicht getan. Ihre Liebe für ihren Vater wurde noch verstärkt durch das Mitleid, das ihr sein stiller und schlecht verhohlener Kummer einflößte. Doch noch besser erklärte sie sich die plötzliche Sympathie, das innige Vertrauen, das sie Georges geschenkt hatte.
Und er war tot! Und von neuem fühlte sie sich allein und einsam, einsam mehr als zuvor, denn auch in ihrem Herzen war es öde geworden.
Sie hatte an einen Unfall nicht glauben können. Warum nicht? Das hätte sie wohl selbst kaum zu sagen vermocht. Gewisse Ideen pflanzen sich in das Gehirn ein, wie sehr man auch dagegen ankämpfen mag. Sie konnte es nicht glauben, daß er sozusagen albernerweise, infolge eines alltäglichen Unfalls, umgekommen sein sollte. Sie war überzeugt, er wäre nicht in der Arvette ertrunken, wenn nicht jemand … aber wer?
Eine Erinnerung quälte sie ganz besonders stark, obwohl sie sich bemühte, sie zu verscheuchen. Eines Tages hatte Georges, als von seinem Bruder die Rede war, zu ihr gesagt:
Dieser Bursche ist eine schlechte Natur; ich weiß und fühle es, daß er mich haßt. Wenn er mir den Hals umdrehen könnte, er würde es tun. Doch das ist nicht seine Schuld, und ich liebe ihn trotzdem. Er ist ein Neurotiker, wenn nicht gar ein Irrsinniger.
Ganz zuerst hatte sie ihn im Verdacht gehabt. Doch kein Beweis hatte ihre Zweifel bestätigt; es war ihr nur aufgefallen, daß er sich dem Leichnam seines Bruders gegenüber ziemlich fühllos verhalten hatte. Das war alles. Die Untersuchung hatte ergeben, daß er Georges seit langen Stunden verlassen, als die Katastrophe eingetreten war. Jetzt war er seinem Vater wie ein Hund ergeben; augenscheinlich hatte auch diese bösartige Natur ihre guten Seiten. Er war am Tode seines Bruders nicht schuld. Und doch hatte sie die unerschütterliche Ueberzeugung, Georges wäre ermordet worden.
Daher erregte sie die Bemerkung der Madame Lorran in so heftiger Weise, daß sie fühlte, wie sich ihr das Herz zusammenschnürte.
Trotzdem bezwang sie sich und fuhr fort:
Das Gewehr des Herrn Georges … ja, da muß man doch glauben …
Daß er es gestohlen hat? Ja, das wissen wir eben nicht. Voisinot sagt, er habe es am Ufer der Arvette gefunden. Das ist möglich. Voisinot ist ein Wilddieb, aber damit ist doch nicht gesagt, daß er ein schlechter Mensch ist. Jeder verdient sich eben sein Brot, wie er kann.
Das Volk wird die Wilddiebe mit den gewöhnlichen Eigentumsverbrechern nie auf eine Stufe stellen. Das ist noch ein Anklang an jene Zeit, wo die Erde und ihre Früchte niemand und ebensogut allen gehörten.
Gabriele fragte ängstlich weiter. Doch Frau Lorran wußte nichts mehr und fügte nur hinzu:
Ich glaube nicht, daß Voisinot Herrn Georges getötet hat.
Herrn Georges getötet? Sie glauben also an einen Mord?
Ich weiß nicht. Jedenfalls haben die Leute immer daran geglaubt, und es sind Gerüchte im Umlauf …
So war Gabriele also nicht die einzige, die auf diesen schrecklichen Verdacht gekommen war.
Weiter war aber nichts herauszubekommen. Erregt wie sie war, bemühte sich Gabriele, doch vergeblich, ihr eine Bemerkung zu entreißen. Sie war von dem festen Willen erfaßt, weiter zu suchen und weiteres zu erfahren.
Frau Lorran, die durchaus nicht dumm war, hatte ihre Aufregung wohl bemerkt. Diese Aufregung war ihr eine Bestätigung eines anderen Gerüchtes, das in der Gegend verbreitet gewesen, daß Fräulein Bertemont und Herr Georges sich liebten. Man hatte sich auch in dieser Annahme nicht getäuscht.
Ach, mein armes Fräulein, sagte sie, das war ein schwerer Verlust. Er war so gut und ein so schöner junger Mann …
Hören Sie, Frau Lorran, sagte Gabriele plötzlich, wollen Sie mir einen Dienst erweisen?
Gern, für Sie würde ich durchs Feuer gehen …
Im Grunde hatte sie ja auch keine Ursache, Gabriele zu hassen, die stets höflich und wohlwollend zu ihr war.
Nun gut! So suchen Sie zu erfahren, wer etwas gesehen hat, oder gesehen zu haben glaubt. Seien Sie verschwiegen, und sagen Sie mir alles, was Sie erfahren …
Das wird nicht viel sein, mein liebes Fräulein. Allerdings habe ich mich auch nicht darum bemüht. Ich hasse die Klatschereien. Solche Sachen gehen mir zu einem Ohr herein und zum anderen heraus … Doch, da Sie es wünschen, werde ich mein Möglichstes tun.
Nach diesen Worten war Frau Lorran fortgegangen.
Während Gabriele, in tiefes Grübeln versunken, dasaß, trat ihr Vater ein.
Ich weiß nicht, was vorgegangen ist, sagte er, doch Frau Loisy läßt mich eben durch Thomas rufen. Ich gehe auf einen Augenblick fort.
Gabriele hatte sich, etwas blaß, aufgerichtet. Alles, was mit ihrer fixen Idee zusammenhing, schien ihr für die Entdeckung der Wahrheit günstig.
Frau Loisy? fragte sie. Soll ich dich begleiten?
Nein, wozu … Wir werden dort nicht mehr so empfangen, wie früher.
Das ist richtig. Doch was tut das, wenn man unserer bedarf …
Ich habe nichts dagegen, dich mitzunehmen, obwohl Thomas nur von mir gesprochen hat. – Es handelt sich, glaube ich, um einen Wilddieb …
Ein Wilddieb? Ich komme, ich komme, Vater!
Mit diesen Worten nahm sie einen Schleier um den Kopf, den sie auf der Brust zusammensteckte, öffnete die Tür, und eilte ihrem Vater voran.
Als Thomas sie sah, nahm er die Mütze ab. Er hatte Gabriele sehr lieb und hatte auch Georges sehr gern gehabt.
Gabriele fragte ihn mit leiser Stimme:
Was ist denn passiert?
Ich weiß nicht, versetzte er derb. Vielleicht kommt es jetzt heraus, daß ich nicht so Unrecht hatte, als ich sagte …
Er hielt inne, biß sich auf seinen Schnurrbart und beendete den Satz in unverständlichem Brummeln.
Als Sie sagten – wiederholte Gabriele.
Doch plötzlich hatte Thomas eine schnellere Gangart eingeschlagen. Die Wiesenstraße, die sich auf der entgegengesetzten Seite der Oiseböschung an der Besitzung der Loisys hinzog, wimmelte von Menschen. Zwei Gendarmen waren vor der kleinen Tür aufgestellt, zwei andere bewachten die Auffahrt.
Gabriele fühlte, wie das Herz sich ihr zuschnürte, als stände sie vor einem unvorhergesehenen und ausschlaggebenden Ereignis.
Herr Bertemont trat zuerst ein, durchschritt den Vorflur und öffnete die Tür zum großen Zimmer.
Dort stand ein Mann, mit Fesseln an den Händen, mit wirrem Haar und Bart, aber aufgerichtet und fast herausfordernd. Hinter ihm erblickte man einen Gendarmen und in einiger Entfernung befand sich eine andere Gruppe, die aus dem Maire, Herrn Deroche, zwei Persönlichkeiten, wahrscheinlich dem Untersuchungsrichter und seinem Aktuar, und endlich von Frau Loisy gebildet wurde, die das Gesicht in ihr Taschentuch preßte und verzweifelnd schluchzte. Eine Sekunde später erschien auch der Abbe Lambquin, der sehr rot und aufgeregt aussah.
Sobald Gabriele erschien, lief ihr Frau Loisy entgegen.
Ach, wie danke ich Ihnen, daß Sie mitgekommen sind. Ich hatte vergessen, es Ihnen sagen zu lassen, und nun kann auch Abel kommen. Die Herren wollen nicht glauben, daß mein Mann nicht allein bleiben kann und er will nur Abel um sich haben. Doch Sie, Gabriele, können meinen Sohn vertreten, auf einen Augenblick wenigstens, denke ich.
Auf dem Spieltisch lag ein Gewehr, eine Luxuswaffe, deren Lauf eingerostet war, und deren Kolben eine Silberplatte trug, mit dem Anfangsbuchstaben Georges Loisys.
Seien Sie überzeugt, gnädige Frau, daß wir lebhaften Anteil an ihrem Schmerz haben. Nicht aus törichter Laune bestehen wir aus die Anwesenheit Ihres Herrn Sohnes, doch sein Zeugnis erscheint uns dringend notwendig, um die offenbar falschen Behauptungen des Angeklagten zu widerlegen.
Kommen Sie also, sagte Frau Loisy zu Gabriele.
In dem Nebenzimmer saß Loisy unbeweglich in seinem Sessel ausgestreckt. Das Eintreten der Gendarmen, der unbekannten Gestalten, die ohne jede Vorsicht in den Garten eingedrungen waren, hatte eine, in Anbetracht seines empfindlichen Zustandes ganz erklärliche Unruhe bei ihm hervorgebracht. Doch ein Umstand hatte ganz besonders dazu beigetragen, seine Unruhe zu erhöhen und sein bereits erschüttertes Nervensystem zu reizen.
Abel, der mit dem Vater sprach, drehte der Tür den Rücken; als er sah, daß seine Züge sich verzerrten, hatte er erraten, daß etwas Ungewöhnliches vorgehe und hatte sich schnell umgedreht. Nahmen seine Träume Gestalt an, verwandelten sich seine Sinnestäuschungen in Wirklichkeit? Er hatte die Gendarmen gesehen und ein dumpfes, gräßliches Röcheln war seiner zusammengepreßten Kehle entschlüpft. Sein Vater betrachtete ihn, sah, wie sein Mund sich verzerrte, wie die Augen in ungeheurer Angst fast aus den Höhlen traten, und wie sein Körper bebte.
Abel, Abel, was hast du denn?
Er stieß die Worte mit heftiger Anstrengung seiner unbeweglichen Kiefer heraus. Doch schon war Abel auf ihn gestürzt, hatte seinen Arm ergriffen und ihn gezwungen, sich zu erheben. Dann stützte er ihn mit einer von der heftigen Nervenaufregung verdoppelten Kraft und schleppte ihn durch eine Seitenallee nach dem Hause. Sie waren durch eine Hintertür eingetreten, ohne bemerkt zu werden. Kaum waren sie in das Zimmer gelangt, so hatte Abel den Kranken in einen Sessel gestoßen, ihn sich selbst überlassen und war nach der Tür geeilt, wo er, sich zusammenkauernd, am ganzen Leibe zitternd, das Ohr an das Schlüsselloch gelegt hatte.

Auf Loisy hatte diese Angst eine so mächtige Rückwirkung gehabt, daß der Unglückliche, der nicht das Geringste verstand, ebenfalls am ganzen Leibe erbebte; er weinte und unartikulierte Laute entschlüpften seinen Lippen.
Aber so schweig doch, rief Abel brutal, indem er ihm mit heftiger Bewegung Schweigen gebot.
Der Gelähmte bekam Angst, fürchtete, einen Fehler begangen zu haben, und sagte, wie ein Kind, das man bestrafen will, mit leiser Stimme:
Abel, Abel, komm – ich bitte dich – ich bitte dich!
Abel lauschte. – Was ging auf der anderen Seite dieser Türfüllung vor. Er hörte dumpfe Schritte, dann Säbelrasseln. Da er kurzsichtig war, wußte er nicht, wieviel Personen anwesend waren. Den Wilddieb hatte er gar nicht gesehen. Die Stimmen drangen mit schnurrendem Laut zu ihm, denn eine Portiere, die man angebracht hatte, um den Wind vom Zimmer des Kranken abzuwehren, dämpfte den Schall. Die Minuten vergingen und er wußte noch immer nichts. Klagte man ihn vielleicht an, ohne daß er etwas davon wußte? Wie sollte er entfliehen?
Dann begriff er, daß seine Mutter gleich eintreten werde. Er trat lebhaft zurück und ging wieder zu seinem Vater, kniete vor ihm nieder, ergriff eine seiner Hände und legte sie sich auf den Kopf, als wolle er sich von ihm segnen lassen. Dann sagte er ganz leise zu ihm:
Ich muß hier bleiben, hörst du, ich darf dich nicht verlassen.
Frau Loisy trat ein. Sie sah das verstörte Gesicht ihres Gatten und fand in der Aufregung nicht mehr die Worte, die sie sagen mußte.
Loisy wiederholte mechanisch, ohne die Frage abzuwarten: Abel soll hier bleiben, er soll mich nicht verlassen, ich will es nicht, nein, nein.
Er weinte wieder und dicke Tränen fielen aus seinen schlaffen Lidern.
Nur für einen Augenblick, es sind Personen da, die Abel um eine Auskunft bitten wollen.
Nein, nein, wiederholte Loisy eigensinnig.
Abel hatte eine Bewegung gemacht, als ob er sich entfernen wollte. Doch die Hand des Vaters, die von seinen Haaren auf die Schulter geglitten war, hielt ihn, wenn auch nur schwach, zurück.
Kann man mich nicht entbehren, sagte Abel, du weißt, Vater will nicht, daß ich ihn verlasse.
Frau Loisy hatte nachgeben müssen und die Beamten nun gebeten, auf dieses Verhör zu verzichten, als Herr Bertemont und seine Tochter eintraten.
Loisy hatte gegen Gabriele niemals irgend welche Abneigung gezeigt. Wenn sie manchmal das Gefühl hatte, als wäre sie lästig, so trug nur Abel daran die Schuld. Sein kalter, harter Blick schien zu fragen, mit welcher Berechtigung sie sich seinem Vater aufdränge.
Frau Loisy nahm sie bei der Hand und kehrte in das Zimmer zurück. Ihre Rückkehr war so schnell und unerwartet erfolgt, daß Abel, der wieder das Ohr an das Schlüsselloch gelegt, keine Zeit gefunden hatte, zurückzutreten. Blaß und verstört erschien er in dem Rahmen der Tür. Frau Loisy hatte den Vorgang nicht bemerkt, der nur Gabriele aufgefallen war.
In seiner Ueberraschung, daß man ihn abgefaßt, trat Abel einen Schritt vor, und stand im Saal. Gabriele war schnell auf Loisy zugetreten, der sich diesmal ohne Widerrede in die Vertretung fügte.
Hier ist mein Sohn, meine Herren, sagte Frau Loisy.
Wir wissen, mein Herr, sagte der Beamte nun, welcher frommen Pflicht wir Sie entzogen haben, jedoch nur auf kurze Zeit. Sie werden wohl bereits erraten haben, daß es sich um das traurige Ereignis handelt, das dem Leben Ihres Bruders ein Ende gemacht hat. Wollen Sie sich das Gewehr ansehen und mir sagen, ob Sie es erkennen?
Mit heftiger Willensanstrengung hatte Abel seinem Gesicht Ruhe geboten und hatte auch seine Stimme zu bemeistern gewußt. Er beugte sich über das Gewehr, berührte es und antwortete:
Es ist das Gewehr meines Bruders.
Dasselbe, das er an jenem Tage bei sich trug?
Jawohl, mein Herr!
Dieser Punkt steht also fest. Uebrigens, fügte der Richter, sich an den Wilddieb wendend, hinzu, der völlig ruhig geblieben war, gestehen ja auch Sie es zu, daß es das Gewehr des Herrn Loisy ist, sagte der Beamte.
Ich habe das nie geleugnet, erwiderte Voisinot.
Warum versuchen Sie dann die Justiz hinters Licht zu führen?
Ich versuche gar nichts!
Doch, doch! Sie sagen, Sie haben das Gewehr am Ufer der Arvette, um 10 Uhr morgens gefunden. Nach den Feststellungen und dem Bericht des Arztes, der die Leiche des Ertrunkenen untersucht hat, ist der Tod aber erst gegen fünf bis acht Uhr abends eingetreten.
Ich weiß nichts von dem Bericht und weiß überhaupt nichts, ich sage, was ich weiß. Ich ging am Ufer der Arvette entlang, um, ich will es offen gestehen, – um Fallen zu stellen, das ist nun einmal mein Beruf, und ich erröte nicht darüber. Es war gegen zehn Uhr, vielleicht auch ein Viertel elf, ich kann es nicht genau wissen, denn ich habe keine Uhr; das Gewehr lag an der Erde, höchstens einen Meter vom Fluß entfernt. Ich bückte mich und erkannte das Gewehr des Herrn Georges.
Woher kannten Sie es denn?
O, er war kein stolzer Herr, der Herr Georges. Ich habe ihn mehr als einmal in das Gehölz geführt, ich habe sogar häufig mit ihm zusammen ein paar Schüsse abgefeuert.
Sie haben also die Waffe mitgenommen?
Damals habe ich mir allerdings gesagt, ich würde sie Herrn Georges zurückgeben. Ich hatte am nächsten Tage in Longpre zu tun, da wäre die Sache abgemacht. Es war doch nichts Böses dabei, daß ich das Gewehr mitnahm?
Sie haben es aber nicht zurückgebracht, sondern behalten!
Als ich erfuhr, daß Herr Georges ertrunken sei, – was mir, nebenbei bemerkt, sehr merkwürdig vorkommt, – habe ich lange, lange gezögert. Sie wissen ja, wie das ist. Man verschiebt es von einem Tag zum anderen. Kurz, das Gewehr war gut, – ich tat niemand einen Schaden, ich habe es behalten.
Herr Abel Loisy, sagte der Untersuchungsrichter, was halten Sie von dieser Erzählung?
Ich glaube, sagte Abel deutlich, daß Voisinot, ich kenne ihn auch, so ziemlich die Wahrheit sagt.
Was verstehen Sie unter – so ziemlich?
Ich verstehe darunter, daß wir uns nur nicht in der Stunde, in welcher das Gewehr gefunden worden, einig sind.
So! Und diese Stunde wäre nach Ihrer Ansicht?
Abends!
Worauf stützen Sie diese Behauptung?
Auf die sehr einfache Tatsache, daß ich morgens selbst meinen Bruder nach einer ganz anderen Richtung begleitet und ihn erst gegen neun Uhr verlassen habe, als er über die Felder nach Ville-Girard wanderte. Der Unfall ist also augenscheinlich bei seiner Rückkehr passiert. Bis dahin muß mein Bruder sein Gewehr bei sich gehabt haben.
Was haben Sie darauf zu erwidern? fragte der Richter den Wilddieb.
Was soll ich dazu sagen? Ich weiß, was ich weiß … Ich habe es um zehn Uhr morgens gefunden, das ist alles!
Ich begreife diesen Eigensinn nicht, entgegnete der Beamte in strengem Tone. Bedenken Sie, daß er Sie auf das schwerste belastet. Wer sagt uns, daß Sie nicht Herrn Georges Loisy ermordet haben, um ihm diese Waffe zu stehlen?
Ich! Ich sollte einen Menschen töten, der mir nie etwas zu Leide getan?
Ja, warum steifen Sie sich darauf …
Die Wahrheit zu sagen? Nur weil's die Wahrheit ist. Wenn man mir den Kopf auf den Block legte, ich könnte nicht das Gegenteil sagen. Ich glaube wirklich, andere haben mehr Interesse zu lügen, als ich …
Was will der Mensch mit diesen Worten sagen, rief Abel wütend. Was kümmert es mich, ob mein armer Bruder morgens oder abends gestorben ist. Herr Richter, fragen Sie doch diesen Kerl, auf welcher Seite er das Gewehr meines Bruders gefunden hat.
Sie hören, was hier gefragt wird, sagte der Richter, wollen Sie darauf antworten?
Weshalb nicht, versetzte Voisinot, der, obwohl er der Angeklagte war, weit kaltblütiger erschien, als der Zeuge. Das Gewehr lag auf der linken Seite, auf der Seite des Gehölzes.
Das heißt, fuhr Abel fort, auf der Longpre entgegengesetzten Seite. Ich erwähne das ausdrücklich, damit der Herr Richter richtig versteht.
Er glaubte sich sehr stark und Herr seiner selbst. Seine Stimme klang trocken, hart und zuweilen zornig. Was er jetzt mit lauter Stimme sagte, war die Beweisführung, die ihm die Schlaflosigkeit wohl hundert Mal zugeflüstert hatte.
Na, ja, gewiß, das ist nicht schwer zu verstehen, versetzte Voisinot.
Schwerer zu verstehen wäre es, fuhr Abel fort, daß mein Bruder um neun Uhr morgens die Arvette passiert haben, darin ertrunken sein soll, und sein Gewehr trotzdem ganz allein auf dem anderen Ufer angelangt sein sollte.
Es trat eine kurze Pause ein.
Dieses so klare Argument hatte auf alle Eindruck gemacht; er hatte sogar Voisinot überrumpelt. Doch Bertemont und vor allem Thomas, der im Hintergrunde des Zimmers stand, hatte bei der spöttischen Art, in der Abel seine Erklärungen abgab, ein eigentümlich peinliches Gefühl, man möchte fast sagen, Widerwillen empfunden.
Indes fuhr Abel fort:
Es steht also fest, daß Georges von Ville-Girard kam; da ich ihn um neun Uhr morgens auf dem Wege dahin verlassen habe, so ist es falsch, daß das Gewehr um zehn Uhr an der Böschung gefunden worden ist.
Aber wer sagt Ihnen denn, daß er nicht gleich zurückgekommen ist? rief Voisinot. Aber wozu denn überhaupt streiten, ich habe doch gute Augen. Es war zehn Uhr morgens, ich weiß es ganz genau.
Tatsächlich glaubte die Justiz nicht an Voisinots Schuld. Und doch lag in dieser eigensinnigen Lüge etwas Seltsames, Geheimnisvolles, das notwendigerweise eine ernstere Anklage zur Folge haben müßte. Der Richter fühlte sich unsicher, und dieser Eigensinn verletzte ihn.
Sie beharren also auf Ihrer ersten Erklärung? sagte er zu Voisinot.
Die Sache langweilt mich schließlich, rief der Unglückliche. Ja, und hundertmal ja … Ich lüge nicht, sondern dieser da …
Damit zeigte er mit seiner gefesselten Hand auf Abel.
Frau Loisy trat schnell dazwischen.
Ich bitte Sie um Verzeihung, Herr Richter. Doch wir haben den Beweis, daß mein armer Sohn um achteinhalb Uhr abends gestorben ist.
Was ist das für ein Beweis?
Seine Uhr, sie ist um halb neun Uhr stehen geblieben.
Sie ist nie aufgezogen worden?
Niemals!
Zeigen Sie uns doch die Uhr gefälligst.
Frau Loisy ging an den Eichenschrank, der an einer der Wände stand und öffnete eine Schublade, in welche noch ein innerer Kasten eingefügt war. Sie ließ eine kleine Feder spielen, nahm die Uhr heraus und legte sie dem Richter hin.
Das ist allerdings ausschlaggebend, sagte der Beamte. Herr Abel hat uns eben erklärt, er habe seinen Bruder um neun Uhr morgens verlassen. Diese Stunde wäre also acht, bezw. neun Uhr abends.
Denn, wenn mein Bruder sofort zurückgekehrt wäre, fügte Abel eifrig hinzu, so wäre er nicht vor zehneinhalb Uhr an die Stelle gelangt, wo man seine Leiche gefunden hat, und seine Uhr ging sehr gut, denn er hatte sie morgens in meinem Beisein mit der Kirchenuhr verglichen.
Als er nach der Stoppelwiese ging! rief Voisinot, man kommt aber gar nicht an der Kirche vorüber …
Nein, aber man hört sie schlagen, versetzte Abel.
Voisinot zuckte die Achseln. Da er sich in den Händen der Justiz wußte, so mußte er vorsichtig sein, sonst hätte er wohl noch etwas anderes erwidert.
Herr Aktuar, sagte der Richter, haben Sie die Aussage des Herrn Abel Loisy aufgeschrieben? Fügen Sie die letzten Argumente hinzu, die für uns ausschlaggebend sind.
Abel machte unwillkürlich eine Bewegung des Stolzes. Er hob das Haupt und blickte jedermann fest, fast herausfordernd ins Gesicht. Er hatte die Prüfung überstanden und sie alle getäuscht.
Seine Erklärung wurde ihm vorgelesen.
Er hörte sie aufmerksam an, unterzeichnete sie und bemühte sich, daß seine Handschrift recht klar und deutlich erschien.
Der Richter entschuldigte sich höflich bei Frau Loisy und fügte einige teilnehmende Worte hinzu; dann führten die Gendarmen ihren Gefangenen fort.
Abel sagte nur: Jetzt will ich meinen Vater wieder aufsuchen.
Als er an seiner Mutter vorbeiging, zog sie ihn an ihre Brust und küßte ihn auf die Haare.
Erwarten Sie mich hier, sagte sie zu Herrn Bertemont, ich werde Ihnen Gabriele zurückbringen.
Der ehemalige Notar blieb mit Thomas allein.
Dieser hatte sich während der ganzen Szene, die sich eben abgespielt, ruhig verhalten. Jetzt drehte er den Kopf zu Herrn Bertemont und sagte:
Mein Herr, verzeihen Sie, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, aber die Sache ist mir nicht klar.
Was wollen Sie damit sagen, Thomas, sagte Bertemont erstaunt, ebenso verwundert über die Bemerkung selbst, als über das Zusammentreffen der Worte mit seinen eigenen Gedanken.
Hören Sie, Herr Bertemont, das Gewehr ist am andern Ufer der Arvette gefunden worden. Herr Abel sagt, das wäre ein Beweis, daß Herr Georges von Ville-Girard gekommen wäre. Dann hätte er es also, bevor er die Arvette überschritt, am Ufer niedergelegt. Das hat doch aber keinen Verstand!

Das ist richtig, sagte Herr Bertemont. Wenn er aber vom anderen Ufer kam, so ist es noch weniger zu verstehen, daß das Gewehr auf der Seite lag, wo Voisinot es gefunden hat.
Wenn er nun aber nicht allein war!
Thomas!
Gabriele trat wieder in das Zimmer.
Lieber Vater, ich bin bereit.
Einen Augenblick, bitte, sagte Thomas mit leiser Stimme. Hören Sie mich an, alle beide. Ich weiß, Sie haben Herrn Georges geliebt, ich liebte ihn ebenfalls. Ich sage Ihnen, wäre er allein nach dem Ufer der Arvette gekommen, so hätte er sie mit seinem Gewehr passiert; dann hätte man das Gewehr im Wasser gefunden und nicht am Ufer.
Nun, sagte Gabriele, und ihr Herz krampfte sich schmerzlich zusammen.
Herr Bertemont setzte sie schnell von der Aussage Voisinots in Kenntnis.
Aber Thomas hat ja recht.
Und ich sage, fuhr Thomas fort, daß Voisinot nicht lügt, wenn er behauptet, das Gewehr um 10 Uhr morgens gefunden zu haben. Warum will man durchaus, daß Herr Georges abends gestorben ist.
Sind Sie dessen auch sicher?
Wie kommt es, daß ihm niemand begegnet, ja, daß ihn nicht einmal jemand bemerkt hat. Ich sage Ihnen, er ist morgens gestorben.
Ja, aber Abel, sagte Herr Bertemont …
Herr Abel mag sagen, was er will, um ihn kümmere ich mich nicht. Er behauptet, sagte Thomas heftig, Herrn Georges erst um neun Uhr an der Stoppelwiese verlassen zu haben. Nun denn, das ist nicht wahr, knurrte er, und stieß die Worte hervor, die ihm schon lange auf den Lippen brannten, es ist nicht wahr, ich weiß es!
Hüten Sie sich!
Ja, ja, ich schweige ja schon, namentlich hier, ich darf ja doch nicht mehr darüber sagen, aber es drückt mir die Brust ein.
Sie vergessen die Uhr, sagte Bertemont und deutete aus dieselbe, die auf dem Tische liegen geblieben war.
Gabriele nahm sie in die Hand.
Allerdings dreiviertel neun.
Es kommt nur darauf an, ob morgens oder abends.
In diesem Augenblick trat Abel ein. Er sah die Uhr in Gabrielens Hand, lief auf sie zu, riß sie ihr aus der Hand, und warf sie wieder auf den Tisch und rief:
Warum rühren Sie das an?
Man gab ihm keine Antwort. Die drei Zuschauer dieser an sich unbedeutenden und doch im Grunde so schrecklichen Szene wechselten einen bedeutsamen Blick und verließen das Zimmer, ohne Abel anzusehen.
Kaum waren sie hinaus, als Thomas sich entfernte.
Herr Bertemont rief ihn zurück, der Diener schien nicht zu hören.
Was will er tun? fragte der Notar seine Tochter.
Ich weiß es nicht, versetzte diese und fügte dann, den Gedanken laut aussprechend, der sie schon gequält hatte, hinzu: So hat dieser Abel also gelogen, die ganze Zeit gelogen.