
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wie vielleicht diese Wissenschaft studirt werden solle.
Wir kommen nun zu der schweren Frage: wie die Physiognomik, diese würkliche, diese nützliche Wissenschaft, studiret werden soll? wie man lernen soll, diese vielbedeutende Natursprache zu verstehen?
Es ist sehr schwer, diesen Unterricht in Regeln zu fassen. Es ist unmöglich, alles das, was das Auge des geübten Beobachters wahrnimmt, mit Worten auszudrücken. Es verhält sich bey dieser Wissenschaft gerade, wie bey der Mahlerey und Tonkunst. Der Mahler und Tonkünstler kann Schönheiten wahrnehmen, empfinden, und mit der anschauendsten Ueberzeugung erfüllet seyn, daß es Schönheiten sind; aber vielleicht kann er sie einem andern weder empfindbar machen, noch auch ihm Anleitung geben, wie er lernen müsse sie zu empfinden.
Indessen giebt es doch gewisse allgemeine Regeln, die freylich nicht zu Augen werden, aber doch als Brillen gebraucht werden können; Regeln, die sich angeben und mittheilen lassen.
Laßt uns also einen Versuch machen, wie vielleicht der Beobachtungsgeist bey dieser Wissenschaft zu Werke gehen sollte. Aber wir wollen es ja nicht vergessen, einmal, daß der größte Theil dieser Kunst dem Genie ganz allein überlassen bleiben muß; und dann, daß auch die Regeln, die hier angegeben werden, bloße Versuche, und zwar blos Versuche sind, die allgemeinen Regeln der Beobachtungskunst auf die Gesichtsbildung, oder das Aeußerliche des Menschen, anzuwenden.
Um aber auch hierinn uns weniger zu verwirren, müssen wir den oben erwähnten Unterschied der empyrischen und philosophischen Physiognomik nicht aus dem Gesichte verlieren. Wir müssen noch hinzu thun, daß die empyrische Physiognomik sich wieder in die confuse und klare; die philosophische oder theoretische in die physische und metaphysische zertheilt.
Ehe ich zur Sache schreite, erlaube man mir, noch eine Anmerkung zu machen. Es ist sehr wichtig, daß man die logischen Regeln der Beobachtungs- und Erfahrungskunst, und überhaupt den Geist der wahren Philosophie, von dieser Wissenschaft nicht trenne, sondern daß man sich ganz davon leiten lasse. Gar zu leicht würde man sich sonst in eben so lächerliche und abgeschmackte, als schädliche und unmoralische Charlatanerien verlieren. Es ist dieses ein so sehr gemeiner Fehler beynahe aller und insonderheit der ältern Verfasser von der Physiognomik, daß man sich nicht sehr verwundern darf, warum man die ganze Wissenschaft für lächerlich und chimärisch erkläret hat. Ohne beygefügten Grund, ohne den Gang ihrer Beobachtung anzuzeigen, ohne die Beobachtung selbst genau genug zu bestimmen, begnügen sich die meisten Verfasser, und vorzüglich Herr Peuschel, einer der neuesten, ihre Kennzeichen, oder wohl gar ihre Vorbedeutungszeichen anzugeben, und ins Publicum hinein zu werfen, wie der Charlatan von der Marktbühne seine Pakete.
Folianten müßte man freylich schreiben, wenn man alle Regeln für alle besonderen Charaktere, nemlich die physiologischen, medicinischen, moralischen u.s.f. nach der empyrischen und philosophischen Physiognomik aus einander setzen wollte. Man erwarte also von mir weiter nichts, als einige Beyspiele.
Da die confuse empyrische Physiognomik anders nichts ist, als der unerkennbare Totaleindruck, den das Aeußerliche eines Menschen auf uns macht, so kann für diese eigentlich keine Erlernungsregel gegeben werden. Denn sobald ich Regeln dazu gäbe, so bezögen sich diese entweder auf die besondern einzelnen Züge, die zusammen einen charakteristischen Eindruck machen; oder auf die Vergleichung dieses ganzen Aeußerlichen mit dem ganzen Aeußerlichen anderer Menschen; mithin wieder auf angebliche Bestimmungen. So bald aber diese Bestimmungen angeblich werden, so gehören die Regeln, welche sich auf die Erlernung oder Kenntniß derselben beziehen, dann schon zur klaren empyrischen Physiognomik.
Auf diese also werden sich vornemlich die Beyspiele beziehen, durch die ich mit furchtsamer Hand es wagen will, den Gang der Erlernung dieser Wissenschaft einigermaßen zu bezeichnen. Wir müssen nemlich allererst bey dem anfangen, was gewiß und zuverläßig ist.
Wir müssen folglich die Extrema oder höchsten Punkte und Zeichen vor allen Dingen uns bekannt machen, und wohl einzuprägen suchen.
Wir müssen das Feste von dem Weichen, das Haftende von dem Zufälligen wohl unterscheiden.
Wir müssen beobachten und wieder beobachten, vergleichen und wieder vergleichen; und lange mit unsern Entscheidungen und unserm Urtheile zurückhalten.
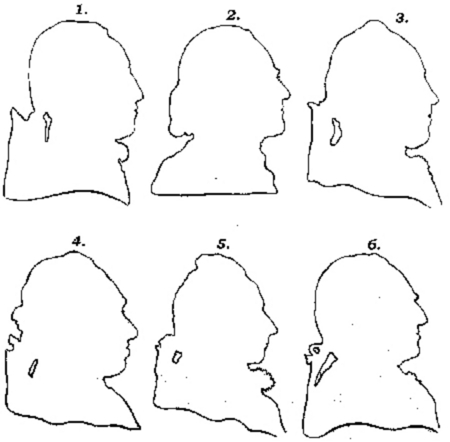
Sechs männliche Silhouetten zur Prüfung des physiognomischen Genies.
»Und was hälst du von dem Knaben 5?«
Folgendes Beispiel mag diese Regeln beweisen und anschaulich machen.
Ich will die Merkmale der Dummheit und eines durchdringenden Verstandes erforschen.
Ich gehe also, um die erste zu finden, in ein Thorenhospital, wo ich eine Sammlung von Menschen finde, deren Bestimmung nicht ist, daß sich ihre Verstandesfähigkeiten in diesem Leben entwickeln sollen; hier weiß ich nun gewiß, daß ich mit Thoren aller Arten umgeben bin. Ich begnüge mich nicht, mich nur dem confusen Eindrucke zu überlassen, den die verschiedene Natursprache der verschiedenen Dummheit auf mich macht. Ich frage mich also: was haben diese dem Scheine nach unglückselige Menschen Charakteristisches in ihrem Aeußerlichen? wo mögen vornemlich die Kennzeichen ihrer so vorzüglichen, so unzweifelhaften Dummheit ihren Sitz haben? worinn unterscheiden sie sich von andern, und insonderheit weisen Menschen?
Ich fange an bey der ganzen Statur überhaupt, ich frage: Ist sie proportionirt? Ist sie es nicht? Wo ist der Hauptsitz der Disproportion? Worinn unterscheiden sie sich im Ganzen von andern Menschen? Aber das ist noch lange nicht genug. Ich durchgehe mit meinen Beobachtungen Theil vor Theil an ihrem Körper. Ich vermuthe zum voraus, daß von der Beschaffenheit, Lage, und Größe des Gehirns vielleicht viel abhängen möchte. Ich vermuthe, daß die äußere Figur des Hirnschädels sich nach dieser Beschaffenheit, Lage, und Größe werde geformet haben; denn ich weiß, daß das beinigte Wesen, woraus er bestehet, anfangs sehr weich, und gleichsam nur eine aus rohrförmigen Fasern gespannte Pergamenhaut gewesen; daß sogar noch in dem Schädel eines Erwachsenen inwendig merkbare Eindrücke der Pulsadern anzutreffen sind. Ich weiß auch, wie viel Verletzungen und Pressungen des Hirnschädels bey alten, insonderheit aber bey jungen Personen in Absicht auf ihre Verstandesfähigkeiten würken können, u.s.f. Dies bringt mich vielleicht auf die Vermuthung, daß ich etwa mein erstes Augenmerk auf die festen Theile der Hirnschale richten müsse. Ich finde sogleich, daß ich von vorne her mit meiner Beobachtung nicht wohl zurechte komme, und daß sich das Besondere, das darinn seyn möchte, zwar auch bemerken, aber nicht so leicht behalten, vielweniger anschaulich bestimmen läßt. Ich richte mich also gegen das Profil, und finde wenigstens so viel, daß sich dieses mit leichter Mühe nachzeichnen, und also viel leichter vergleichen läßt.
Ich fange also an, mir die Profile von der Stirne einzuprägen: und indem ich diese sehe, so glitscht meine Beobachtung zugleich über das ganze Gesicht herunter, und es will mich dünken, daß der Eindruck von ihrer Dummheit stärker und lebhafter bey mir werde. Ich fahre also fort; ich nenne, oder welches besser ist, ich zeichne mir die ganzen Profile; und wenn ich einige gezeichnet habe, so fange ich an zu vergleichen. Ich lege meinen Bleystift beyseite, und versuche es, diese Linien mit Worten und Namen zu bezeichnen. Ich werde zum Exempel sagen: diese Stirne ist zu kurz, und zugleich so platt, das Haar so tief darüber herabgewachsen; jene ist zwar hoch und groß, aber sie ist zu glatt, kahl, oder so und so empor gefurcht; so und so gewölbt, so häutig, u.s.f. Ich werde sagen, diese Augenbraunen sind so wild und waldicht hervorragend, jene so hoch über den Augen, so haarlos, so weit von einander entfernt. Sodann komme ich an die Augen. Die einen sind so klein, das obere Augenlied so tief überhängend, das untere so wurstförmig; die Adern dort so weit offen, so weiß, so hervorragend. Die Nase ist so aufgedumpft, so fleischicht, jene so hervorstehend groß und breit; und eine andere so stumpf gegen die untere Lippe, wie eine Section von einem Zirkel. Die Entfernung von der Nase zur Lippe ist auch bey einigen sonderbar genug; die obere Lippe ist zu fleischicht, zu überhängend, die Zähne so sichtbar, die untere Lippe entweder so schief, oder so niederhängend und offen; ich kann mich nicht erwehren, die unaussprechliche Selbstgenügsamkeit mit einem kleinen Lächeln anzusehen, welche so augenscheinlich auf diesen Lippen schwebt. Das Kinn ist bey dem einen so hoch, so gerade, so fleischicht, so plump.
Nun beobachte ich noch den Hals, den hintern Theil des Kopfes, die Haare, die Arme, und die Hände; nicht die Linien der Hände, welche in der Träumerwissenschaft, die Chiromantie heißt, so allbedeutsam sind, und nicht nur den ganzen Charakter bezeichnen, sondern auch das geheime Archiv von den Schicksalen des Menschen enthalten sollen. Der Umriß, die Plumpheit, und Nervenlosigkeit der Hände sind ein Gegenstand meiner Beobachtung; so wie die Beine, die Stellung der Füße, die entweder parallel oder gegen einander eingekehrt stehen; und endlich der Gang.
Nun suche ich in jedem, oder doch in einigen, diejenigen Partheyen aus, welche mich am entscheidendsten dünken. Ich frage mich Theil für Theil; ich bedecke erstlich mit der Hand den Untertheil, dann den Obertheil des Gesichts; ich schließe aus, und sage: dieser Zug scheint nicht charakteristisch zu seyn; jener auch nicht; aber der da; oder dann alle zusammen. Ich bemerke mir diese vorzüglich; ich bemerke auch insonderheit das Aehnliche dieser Physiognomien; das Aehnliche von vorne her, das Aehnliche im Profile, das Aehnliche im Gange, das Aehnliche im ganzen Aeußerlichen.