
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
[Frankfurt a. d. Oder, Anfang 1800]
Inliegenden Brief bin ich entschlossen morgen abend Ihrem Vater zu übergeben. Ich fühle, seit gestern abend, daß ich meinem Versprechen, nichts für meine Liebe zu tun, das ein Betrug Ihrer würdigen Eltern wäre, nicht treu bleiben kann. Vor Ihnen zu stehen, und nicht sprechen zu dürfen, weil andere diese Sprache nicht hören sollen, Ihre Hand in der meinigen zu halten und nicht sprechen zu dürfen, weil ich mich diese Sprache gegen Sie nicht erlauben will, ist eine Qual, die ich aufheben will und muß. Ich will es daher erfahren, ob ich Sie mit Recht lieben darf, oder gar nicht. Ist das letzte, so bin ich entschlossen, das Versprechen, welches ich Ihrem Vater in den letzten Zeilen meines Briefes gebe, auszuführen. Ist es nicht, so bin ich glücklich – Wilhelmine! Bestes Mädchen! Habe ich in dem Briefe an Ihren Vater zu kühn in Ihre Seele gesprochen? Wenn Ihnen etwas darin mißfällt, so sagen Sie es mir morgen, und ich ändere es ab.
Ich sehe, daß das neue Morgenlicht meines Herzens zu hell leuchtet, und schon zu sehr bemerkt wird. Ohne diesen Brief könnte ich Ihrem Rufe schaden, der mir doch teurer ist als alles in der Welt. Es komme nun auch, was der Himmel über mich verhängt, ich bin ruhig bei der Überzeugung, daß ich recht so tue.
Heinrich Kleist.
N. S. Wenn Sie morgen einen Spaziergang nicht abschlagen, so könnte ich von Ihnen erfahren, was Sie von diesem Schritte urteilen und denken. – Von meiner Reise habe ich, aus Gründen, die Sie selbst entschuldigen werden, nichts erwähnt. Schweigen Sie daher auch davon. Wir verstehn uns ja.
*
[Frankfurt a. d. Oder, Anfang 1800]
[Der Anfang fehlt.] . . . sichtbar die Zuversicht von Ihnen geliebt zu werden? Atmet nicht in jeder Zeile das frohe Selbstbewußtsein der erhörten und beglückten Liebe? – Und doch – wer hat es mir gesagt? Und wo steht es geschrieben?
Zwar – was soll ich aus dem Frohsinn, der auch Sie seit gestern belebt, was soll ich aus den Freudentränen, die Sie bei der Erklärung Ihres Vaters vergossen haben, was soll ich aus der Güte, mit welcher Sie mich in diesen Tagen zuweilen angeblickt haben, was soll ich aus dem innigen Vertrauen, mit welchem Sie in einigen der verflossenen Abende, besonders gestern am Fortepiano, zu mir sprachen, was soll ich aus der Kühnheit, mit welcher Sie sich jetzt, weil Sie es dürfen, selbst in Gegenwart andrer mir nähern, da Sie sonst immer schüchtern von mir entfernt blieben – ich frage, was soll ich aus allen diesen fast unzweifelhaften Zügen anderes schließen, was anderes, Wilhelmine, als daß ich geliebt werde?
Aber darf ich meinen Augen und meinen Ohren, darf ich meinem Witze und meinem Scharfsinn, darf ich dem Gefühle meines leichtgläubigen Herzens, das sich schon einmal von ähnlichen Zügen täuschen ließ, wohl trauen? Muß ich nicht mißtrauisch werden auf meine Schlüsse, da Sie mir selbst schon einmal gezeigt haben, wie falsch sie zuweilen sind? Was kann ich im Grunde, reiflich überlegt, mehr glauben, als was ich vor einem halben Jahre auch schon wußte, ich frage, was kann ich mehr glauben, als daß Sie mich schätzen und daß Sie mich wie einen Freund lieben?
Und doch wünsche ich mehr, und doch möchte ich nun gern wissen, was Ihr Herz für mich fühlt. Wilhelmine! Lassen Sie mich einen Blick in Ihr Herz tun. Öffnen Sie mir es einmal mit Vertrauen und Offenherzigkeit. So viel Vertrauen, so viel unbegrenztes Vertrauen von meiner Seite verdient doch wohl einige Erwiderung von der Ihrigen. Ich will nicht sagen, daß Sie mich lieben müßten, weil ich Sie liebe; aber vertrauen müssen Sie sich mir, weil ich mich Ihnen unbegrenzt vertraut habe. – Wilhelmine! Schreiben Sie mir einmal recht innig und herzlich. Führen Sie mich einmal in das Heiligtum Ihres Herzens das ich noch nicht mit Gewißheit kenne. Wenn der Glaube, den ich aus der Innigkeit Ihres Betragens gegen mich schöpfte, zu kühn und noch zu übereilt war, so scheuen Sie sich nicht es mir zu sagen. Ich werde mit den Hoffnungen, die Sie mir gewiß nicht entziehen werden, zufrieden sein. Aber auch dann, Wilhelmine, wenn mein Glaube gegründet wäre, auch dann scheuen Sie sich nicht, sich mir ganz zu vertrauen. Sagen Sie es mir, wenn Sie mich lieben – denn warum wollten Sie sich dessen schämen? Bin ich nicht ein edler Mensch, Wilhelmine?
Zwar eigentlich – – ich will es Ihnen nur offenherzig gestehen, Wilhelmine, was Sie auch immerhin von meiner Eitelkeit denken mögen – eigentlich bin ich es fest überzeugt, daß Sie mich lieben. Aber, Gott weiß, welche seltsame Reihe von Gedanken mich wünschen lehrt, daß Sie es mir sagen möchten. Ich glaube, daß ich entzückt sein werde, und daß Sie mir einen Augenblick, voll der üppigsten und innigsten Freude bereiten werden, wenn Ihre Hand sich entschließen könnte, diese drei Worte niederzuschreiben: ich liebe Dich.
Ja, Wilhelmine, sagen Sie mir diese drei herrlichen Worte; sie sollen für die ganze Dauer meines künftigen Lebens gelten. Sagen Sie sie mir einmal und lassen Sie uns dann bald dahin kommen, daß wir nicht mehr nötig haben, sie uns zu wiederholen. Denn nicht durch Worte aber durch Handlungen zeigt sich wahre Treue und wahre Liebe. Lassen Sie uns bald recht innig vertraut werden, damit wir uns ganz kennen lernen. Ich weiß nichts, Wilhelmine, in meiner Seele regt sich kein Gedanke, kein Gefühl in meinem Busen, das ich mich scheuen dürfte Ihnen mitzuteilen. Und was könnten Sie mir wohl zu verheimlichen haben? Und was könnte Sie wohl bewegen, die erste Bedingung der Liebe, das Vertrauen zu verletzen? – Also offenherzig, Wilhelmine, immer offenherzig. Was wir auch denken und fühlen und wünschen – etwas Unedles kann es nicht sein, und darum wollen wir es uns freimütig mitteilen. Vertrauen und Achtung, das sind die beiden unzertrennlichen Grundpfeiler der Liebe, ohne welche sie nicht bestehen kann; denn ohne Achtung hat die Liebe keinen Wert und ohne Vertrauen keine Freude.
Ja, Wilhelmine, auch die Achtung ist eine unwiderrufliche Bedingung der Liebe. Lassen Sie uns daher unaufhörlich uns bemühen, nicht nur die Achtung, die wir gegenseitig für einander tragen, zu erhalten, sondern auch zu erhöhen. Denn dieser Zweck ist es erst, welcher der Liebe ihren höchsten Wert gibt. Edler und besser sollen wir durch die Liebe werden, und wenn wir diesen Zweck nicht erreichen, Wilhelmine, so mißverstehen wir uns. Lassen Sie uns daher immer mit sanfter menschenfreundlicher Strenge über unser gegenseitiges Betragen wachen. Von Ihnen wenigstens wünsche ich es, daß Sie mir offenherzig alles sagen, was Ihnen vielleicht an mir mißfallen könnte. Ich darf mich getrauen alle Ihre Forderungen zu erfüllen, weil ich nicht fürchte, daß Sie überspannte Forderungen machen werden. Fahren Sie wenigstens fort, sich immer so zu betragen, daß ich mein höchstes Glück in Ihre Liebe und in Ihre Achtung setze; dann werden sich alle die guten Eindrücke, von denen Sie vielleicht nichts ahnden, und die ich Ihnen dennoch innig und herzlich danke, verdoppeln und verdreifachen. – Dafür will ich denn auch an Ihrer Bildung arbeiten, Wilhelmine, und den Wert des Mädchens, das ich liebe, immer noch mehr veredlen und erhöhen.
Und nun noch eine Hauptsache, Wilhelmine. Sie wissen, daß ich bereits entschlossen bin, mich für ein Amt zu bilden; aber noch bin ich nicht entschieden, für welches Amt ich mich bilden soll. Ich wende jede müßige Stunde zum Behufe der Überlegung über diesen Gegenstand an. Ich wäge die Wünsche meines Herzens gegen die Forderungen meiner Vernunft ab; aber die Schalen der Waage schwanken unter den unbestimmten Gewichten. Soll ich die Rechte studieren? – Ach, Wilhelmine, ich hörte letzthin in dem Naturrechte die Frage aufwerfen, ob die Verträge der Liebenden gelten könnten, weil sie in der Leidenschaft geschehen – und was soll ich von einer Wissenschaft halten, die sich den Kopf darüber zerbricht ob es ein Eigentum in der Welt gibt, und die mir daher nur zweifeln lehren würde, ob ich Sie auch wohl jemals mit Recht die Meine nennen darf; Nein, nein, Wilhelmine, nicht die Rechte will ich studieren, nicht die schwankenden ungewissen, zweideutigen Rechte der Vernunft will ich studieren, an die Rechte meines Herzens will ich mich halten, und ausüben will ich sie, was auch alle Systeme der Philosophen dagegen einwenden mögen. – Oder soll ich mich für das diplomatische Fach bestimmen? – Ach, Wilhelmine, ich erkenne nur ein höchstes Gesetz an, die Rechtschaffenheit, und die Politik kennt nur ihren Vorteil. Auch wäre der Aufenthalt an fremden Höfen kein Schauplatz für das Glück der Liebe. An den Höfen herrscht die Mode, und die Liebe flieht vor der unbescheidnen Spötterin. – Oder soll ich mich für das Finanzfach bestimmen? – Das wäre etwas. Wenn mir auch gleich der Klang rollender Münzen eben nicht lieb und angenehm ist, so sei es dennoch. Der Einklang unsrer Herzen möge mich entschädigen, und ich verwerfe diesen Lebensweg nicht, wenn er zu unserm Ziele führen kann. – Auch noch ein Amt steht mir offen, ein ehrenvolles Amt, das mir zugleich alle wissenschaftlichen Genüsse gewähren würde, aber freilich kein glänzendes Amt, ein Amt, von dem man freilich als Bürger des Staates nicht, wohl aber als Weltbürger weiterschreiten kann – ich meine ein akademisches Amt. – Endlich bleibt es mir noch übrig die Ökonomie zu studieren, um die wichtige Kunst zu lernen, mit geringen Kräften große Wirkungen hervorzubringen. Wenn ich mir diese große Kunst aneignen könnte, dann Wilhelmine, könnte ich ganz glücklich sein, dann könnte ich, ein freier Mensch, mein ganzes Leben Ihnen und meinem höchsten Zwecke – oder vielmehr, weil es die Rangordnung so will – meinem höchsten Zwecke und Ihnen widmen.
So stehe ich jetzt, wie Herkules, am fünffachen Scheidewege und sinne, welchen Weg ich wählen soll. Das Gewicht des Zweckes, den ich beabsichte, macht mich schüchtern bei der Wahl. Glücklich, glücklich, Wilhelmine, möchte ich gern werden, und darf man da nicht schüchtern sein, den rechten Weg zu verfehlen? Zwar ich glaube, daß ich auf jedem dieser Lebenswege glücklich sein würde, wenn ich ihn nur an Ihrer Seite zurücklegen kann. Aber, wer weiß, Wilhelmine, ob Sie nicht vielleicht besondere Wünsche haben, die es wert sind, auch in Erwägung gezogen zu werden. Daher fordere ich Sie auf, mir Ihre Gedanken über alle diese Pläne, und Ihre Wünsche, in dieser Hinsicht, mitzuteilen. Auch wäre es mir lieb von Ihnen zu erfahren, was Sie sich wohl eigentlich von einer Zukunft an meiner Seite versprechen? Ich verspreche nicht unbedingt den Wunsch zu erfüllen, den Sie mir mitteilen werden; aber ich verspreche bei gleich vorteilhaften Aussichten denjenigen Lebensweg einzuschlagen, der Ihren Wünschen am meisten entspricht. Sei es dann auch der mühsamste, der beschwerdenvollste Weg. Wilhelmine, ich fühle mich mit Mut und Kraft ausgerüstet, um alle Hindernisse zu übersteigen; und wenn mir der Schweiß über die Schläfe rollt und meine Kräfte von der ewigen Anstrengung ermatten, so soll mich tröstend das Bild der Zukunft anlächeln und der Gedanke mir neuen Mut und neue Kraft geben: ich arbeite ja für Wilhelmine.
Heinrich Kleist.
*
Frankfurt a. d. Oder, den 30. Mai 1800
Liebe Wilhelmine. Die wechselseitige Übung in der Beantwortung zweifelhafter Fragen hat einen so vielseitigen Nutzen für unsre Bildung, daß es wohl der Mühe wert ist, die Sache ganz so ernsthaft zu nehmen, wie sie ist, und Dir eine kleine Anleitung zu leichteren und zweckmäßigeren Entscheidungen zu geben. Denn durch solche schriftlichen Auflösungen interessanter Aufgaben üben wir uns nicht nur in der Anwendung der Grammatik und im Stile, sondern auch in dem Gebrauch unsrer höheren Seelenkräfte; und endlich wird dadurch unser Urteil über zweifelhafte Gegenstände festgestellt und wir selbst auf diese Art nach und nach immer um eine und wieder um eine interessante Wahrheit reicher.
Die Antwort auf meine erste Frage ist, ihrem Sinne nach, ganz so, und die Antwort auf meine zweite Frage, ihrem Sinne nach, vielleicht noch besser, als ich sie selbst gegeben haben würde. Nur in der Einkleidung, in der Anordnung und in der Ausführung beider Entscheidungen ließe sich einiges anführen, das zu tadeln wäre.
Das behalte ich aber unseren mündlichen Unterhaltungen bevor, und begnüge mich, Dir hier bloß den Weg vorzuzeichnen, den ich selbst bei der Beantwortung einer ähnlichen Frage einschlagen würde.
Gesetzt, Du fragtest mich, welcher von zwei Eheleuten, deren jeder seine Pflichten gegen den andern erfüllt, am meisten bei dem früheren Tode des andern verliert; so würde alles, was in meiner Seele vorgeht, ohngefähr in folgender Ordnung aneinander hangen.
Zuerst fragt mein Verstand: was willst Du? das heißt, mein Verstand will den Sinn Deiner Frage begreifen. Dann fragt meine Urteilskraft: worauf kommt es an? das heißt, meine Urteilskraft will den Punkt der Streitigkeit auffinden. Zuletzt fragt meine Vernunft: worauf läuft das hinaus? das heißt, meine Vernunft will aus dem Vorangehenden das Resultat ziehen.
Zuerst stellt sich also mein Verstand den Sinn Deiner Frage deutlich vor, und findet, daß Du Dir zwei Eheleute denkst, deren jeder für den andern tut, was er seiner Natur nach vermag; daß Du also voraussetzest, jeder verliere bei dem Tode des andern etwas, und daß Du endlich eigentlich nur wissen willst, auf wessen Seite das Übergewicht des Verlustes befindlich ist.
Nun stellt sich meine Urteilskraft an die Quelle der Streitigkeit, und fragt: was tut denn eigentlich jeder der beiden Eheleute, seiner Natur nach, für den andern; und wenn sie dieses gefunden hat, so vergleicht sie das, was beide für einander tun, und bestimmt daraus, wer von beiden am meisten für den andern tut. Da findet nun die Urteilskraft zuerst, daß der Mann nicht bloß der Mann seiner Frau, sondern auch noch ein Bürger des Staates, die Frau hingegen nichts als die Frau ihres Mannes ist; daß der Mann nicht bloß Verpflichtungen gegen seine Frau, sondern auch Verpflichtungen gegen sein Vaterland, die Frau hingegen keine andern Verpflichtungen hat, als Verpflichtungen gegen ihren Mann; daß folglich das Glück des Weibes zwar ein wichtiger und unerläßlicher, aber nicht der einzige Gegenstand des Mannes, das Glück des Mannes hingegen der alleinige Gegenstand der Frau ist; daß daher der Mann nicht mit allen seinen Kräften für seine Frau, die Frau hingegen mit ihrer ganzen Seele für den Mann wirkt; daß die Frau, in der Erfüllung der Hauptpflichten ihres Mannes, nichts empfängt, als Schutz gegen Angriffe auf Ehre und Sicherheit, und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens, der Mann hingegen, in der Erfüllung der Hauptpflichten seiner Frau, die ganze Summe seines häuslichen, das heißt überhaupt, alles Glückes von ihr empfängt; daß zuletzt der Mann nicht immer glücklich ist, wenn es die Frau ist, die Frau hingegen immer glücklich ist, wenn der Mann glücklich ist, und daß also das Glück des Mannes eigentlich der Hauptgegenstand des Bestrebens beider Eheleute ist. Aus der Vergleichung dieser Sätze bestimmt nun die Urteilskraft, daß der Mann bei weitem, ja unendlich mehr von seiner Frau empfängt, als die Frau von ihrem Manne.
Nun übernimmt die Vernunft das letzte Geschäft, und zieht aus jenem letzten Satze den natürlichen Schluß, daß derjenige, der am meisten empfängt, auch am meisten verlieren müsse, und daß folglich, da der Mann unendlich mehr empfängt, als die Frau, er auch unendlich mehr bei dem Tode derselben verlieren müsse, als die Frau bei dem Tode ihres Mannes.
Auf diesem Wege wäre ich also durch eine Reihe von Gedanken, deren jeden ich, ehe ich mich an die Ausführung des Ganzen wage, auf einem Nebenblatte aufzuschreiben pflege, auf das verlangte Resultat gekommen und es bleibt mir nun nichts übrig, als die zerstreuten Gedanken in ihrer Verknüpfung von Grund und Folge zu ordnen und dem Aufsatze die Gestalt eines abgerundeten, vollständigen Ganzen zu geben.
Das würde nun ohngefähr auf diese Art am besten geschehen:
»Der Mann ist nicht bloß der Mann seiner Frau, er ist auch ein Bürger des Staates; die Frau hingegen ist nichts, als die Frau ihres Mannes; der Mann hat nicht bloß Verpflichtungen gegen seine Frau, er hat auch Verpflichtungen gegen sein Vaterland; die Frau hingegen hat keine andern Verpflichtungen, als Verpflichtungen gegen ihren Mann; das Glück des Weibes ist zwar ein unerlaßlicher, aber nicht der einzige Gegenstand des Mannes, ihm liegt auch das Glück seiner Landsleute am Herzen; das Glück des Mannes hingegen ist der einzige Gegenstand der Frau; der Mann ist nicht mit allen seinen Kräften für seine Frau tätig, er gehört ihr nicht ganz, nicht ihr allein, denn auch die Welt macht Ansprüche auf ihn und seine Kräfte; die Frau hingegen ist mit ihrer ganzen Seele für ihren Mann tätig, sie gehört niemandem an, als ihrem Manne, und sie gehört ihm ganz an; die Frau endlich, empfängt, wenn der Mann seine Hauptpflichten erfüllt, nichts von ihm, als Schutz gegen Angriff auf Ehre und Sicherheit, und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens, der Mann hingegen empfängt, wenn die Frau ihre Hauptpflichten erfüllt, die ganze Summe seines irdischen Glückes; die Frau ist schon glücklich, wenn es der Mann nur ist, der Mann nicht immer, wenn es die Frau ist, und die Frau muß ihn erst glücklich machen. Der Mann empfängt also unendlich mehr von seiner Frau, als umgekehrt die Frau von ihrem Manne.
Folglich verliert auch der Mann unendlich mehr bei dem Tode seiner Frau, als diese umgekehrt bei dem Tode ihres Mannes. Die Frau verliert nichts als den Schutz gegen Angriffe auf Ehre und Sicherheit, und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens; das erste findet sie in den Gesetzen wieder, oder der Mann hat es ihr in Verwandten, vielleicht in erwachsenen Söhnen hinterlassen; das andere kann sie auch als Hinterlassenschaft von ihrem Manne erhalten haben. Aber wie will die Frau dem Manne hinterlassen, was er bei ihrem Tode verliert? Er verliert die ganze Inbegriff seines irdischen Glückes, ihm ist, mit der Frau, die Quelle alles Glückes versiegt, ihm fehlt alles, wenn ihm eine Frau fehlt, und alles, was die Frau ihm hinterlassen kann, ist das wehmütige Andenken an ein ehemaliges Glück, das seinen Zustand noch um so trauriger macht.«
—————
Ich füge jetzt hier noch eine Frage bei, die auf ähnlichem Wege aufgelöset werden könnte: Sind die Weiber wohl ganz ohne allen Einfluß auf die Staatsregierung?
H. K.
*
[Frankfurt a. d. Oder, Frühjahr bis Sommer 1800]
[1]
1. Wenn jemand einen Fehler, von welchem er selbst nicht frei ist, an einem anderen tadelt, so hört man ihm oft antworten: du machst es selbst nicht besser und tadelst doch andere; – Ich frage: darf man darum nie einen Fehler an anderen tadeln, weil man ihn selbst beging?
2. Was für ein Unterschied ist zwischen rechtfertigen und entschuldigen?
3. Wenn beide, Mann und Frau, für einander tun, was sie ihrer Natur nach vermögen, wer verliert von beiden am meisten, wenn einer zuerst stirbt?
4. Eine Frau kann sich die Achtung und das Vertrauen ihres Mannes erworben haben, ohne sein Interesse zu besitzen. Wodurch gewinnt und erhält sie sich dieses?
[2]
Frage.
Eine Frau, die achtungswürdig ist, ist darum noch nicht interessant. Wodurch erwirbt und erhält sich nun wohl eine Frau das Interesse ihres Mannes?
Antwort.
Es ist mit dem Interesse wie mit allen Dingen dieser Erde. Es ist nicht genug, daß der Himmel sie erschaffen hat, er muß sie auch unterhalten, wenn sie fortdauern sollen. Und nichts bedarf der Nahrung, der sorgfältigsten, mehr, als das rätselhafte Ding, das sich erzeugt, wir wissen nicht wie, und oft wieder verschwindet, wir wissen nicht wie – das Interesse.
Interesse erwecken, und es sich selbst überlassen, heißt einem Kinde das Leben geben, und es sich selbst überlassen. Das eine stirbt wie das andere dahin, nicht, weil man ihm etwas Schädliches zufügt, sondern weil man ihm nichts zufügt.
Aber das Kind ist nicht so ekel in der Ernährung, als das Interesse. Das Kind begnügt sich mit einer Nahrung, das Interesse will immer eine ausgesuchte, verfeinerte, wechselnde Nahrung. Es stirbt, wenn man ihm heute und morgen vorsetzt, was es schon gestern und vorgestern genoß.
Denn nichts ist dem Interesse so zuwider, als Einförmigkeit, und nichts ihm dagegen so günstig, als Wechsel und Neuheit. Daher macht uns das Reisen so vieles Vergnügen, weil mit den immer wechselnden Standorten auch die Ansichten der Natur immer wechseln, und daher hat überhaupt das Leben ein so hohes, ja das höchste Interesse, weil es gleichsam eine große Reise ist und weil jeder Augenblick etwas Neues herbeiführt, uns eine neue Ansicht zeigt oder eine neue Aussicht eröffnet.
Nun ist aber nichts so fähig, eine immerwechselnde Gestalt anzunehmen, als Talente. Die Tugend und die Liebe tragen ihrer Natur nach immer nur ein Gewand, und dürfen es ihrer Natur nach, nicht wechseln. Talente hingegen können mit Form und Einkleidung unaufhörlich wechseln und gefallen vielleicht eben nur darum weil sie das können.
Daher wird eine Frau, die sich das Interesse ihres Mannes erhalten will, ihre Talente, wenn sie von der Natur damit beschenkt ist, immer ausbilden und üben müssen, damit der Mann immer bei ihr den Genuß des Schönen finde, den er nie ganz entbehren kann, und den er sonst bei Fremden suchen müßte. Denn Tugend und Liebe begründen zwar das Familienglück, aber nur Talente machen es wirklich anziehend. Dabei ist nicht eben notwendig, daß die Talente der Musik, des Zeichnens, des Vorlesens etc. bis zur Vollkommenheit ausgebildet sind, wenn nur überhaupt der Sinn für das wahre Schöne dabei herrschend ist.
[3]
Frage.
Was ist wünschenswerter, auf eine kurze Zeit, oder nie glücklich gewesen zu sein?
Antwort.
Wenn man den Zustand dessen, der ein Glück verlor, mit dem Zustande dessen vergleicht, der nie ein Glück genoß, so schwanken die Schalen unter den Gewichten fast gleicher Übel und es ist schwer die Frage zu entscheiden. Doch scheint es, als ob sich die Waage auf der Seite des letztern neigte.
Wer einst an den Brüsten des Glückes den goldnen Traum des Lebens träumte, der streckt zwar, wenn ihn das Schicksal mit rauher Stimme weckt, wehmütig die Arme aus nach den göttlichen Gestalten, die nun auf immer entfliehen, und sein Schmerz ist um so größer, je größer das Glück war, dessen er genoß; aber ihm ist doch aus dem Füllhorne des Segens, das von oben herab sich öffnet, auch ein Blümchen zugefallen, das ihn selbst in der Erinnerung noch erfreuen kann, wenn es gleich längst verblüht ist. Ihm sind doch die Ansprüche, die er an dies Leben zu machen hatte, nicht ganz unerfüllt geblieben, nicht mit allen seinen Forderungen ist er von der großen Erbschaft abgewiesen worden, welche der Himmel den Kindern der Erde vermacht hat, nicht murren wird er mit dem Vater der Menschen, der ihn von seiner Liebe nicht ausschloß, nicht mit bitterm Groll seine Geschwister beneiden, die mit ihm nur zu gleichen Teilen gingen, nicht zürnen auf den Genuß seines Glückes, weil er nicht ewig währte, so wie man dem Frühlinge nicht zürnt, weil er kurz ist, und den Tag nicht verwünscht, weil ihn die Nacht ablöset. Mutiger und sicherer als wenn er nie auf hellen Pfaden gewandelt wäre, wird er nun auch die dunkeln Wege seines Lebens durchwandeln und in der Erinnerung zuweilen mit wehmütiger Freude die bemoosten Ruinen seines ehemaligen Glückes besuchen, um das Herbstblümchen der Weisheit zu pflücken.
Aber wem von allen seinen brennenden Wünschen auch nicht der bescheidenste erfüllt wurde, wer von jenem großen Vermächtnis, von dessen Überfluß alle seine Brüder schwelgen, auch nicht einmal den Pflichtteil erhalten hat, der steht da wie ein verstoßner Sohn, ausgeschlossen von der Liebe des Allvaters, der sein Vater nicht ist – und die Schale, auf welcher sein Zustand ruht, neigt sich tief gegen die Schale des andern. –
[4]
1. Wenn der Mann sein brutales Recht des Stärkern mit den Waffen der Gewalt gegen die Frau ausübt, hat nicht auch die Frau ein Recht gegen den Mann, das man das Recht des Schwächern nennen könnte, und das sie mit den Waffen der Sanftmut geltend machen kann?
2. Was knüpft die Menschen mehr mit Banden des Vertrauens aneinander, Tugenden oder Schwächen?
3. Darf die Frau niemandem gefallen, als dem Manne?
4. Welche Eifersucht stört den Frieden in der Ehe?
Damit indessen nicht immer bloß Dein Verstand geübt wird, liebe Wilhelmine, sondern auch andere Seelenkräfte, so will ich auch einmal Deiner Einbildungskraft eine kleine Aufgabe geben. Du sollst mir nämlich die Lage beschreiben, die Deinen Erwartungen von dem künftigen Glücke der Ehe am meisten entsprechen könnte. Du kannst dabei Deiner Einbildungskraft freien Lauf lassen, den Schauplatz des ehelichen Glückes ganz nach Deinen Begriffen vom Schönen bilden, das Haus ganz nach Deiner Willkür ordnen und einrichten, die Geschäfte bestimmen, denen Du Dich am liebsten unterziehen würdest, und die Vergnügungen nennen, die Du Dir oder mir oder andern am liebsten darin bereiten möchtest.
[5]
Fragen.
1. Darf man jeden irrigen Grundsatz anderer Menschen bekämpfen, oder muß man nicht unschädliche Grundsätze dulden und ehren, wenn an ihnen die Ruhe eines Menschen hangt?
2. Darf man wohl von einem Menschen immer mit unerbittlicher Strenge die Erfüllung seiner Pflichten verlangen, oder kann man nicht schon mit ihm zufrieden sein, wenn er seine Pflichten nur immer anerkennt und den guten Willen, sie zu erfüllen, nie verliert?
3. Darf der Mensch wohl alles tun, was recht ist, oder muß er sich nicht damit begnügen, daß nur alles recht sei, was er tut?
4. Darf man sich in dieser Welt wohl bestreben, das Vollkommene wirklich zu machen, oder muß man sich nicht begnügen, nur das Vorhandne vollkommner zu machen?
5. Was ist besser, gut sein oder gut handeln?
—————
Wenn ein Mädchen gefragt wird, was sie von einer zukünftigen Ehe fordert, um am glücklichsten darin zu sein, so muß sie zuerst bestimmen,
1. welche Eigenschaften ihr künftiger Gatte haben soll, ob er an Geist und Körper außerordentlich, oder gewöhnlich, und in welchem Grade er dies sein soll etc., ferner ob er reich, vornehm etc.
2. welch ein Amt er bekleiden soll, ob ein militärisches, oder ein Zivilamt, oder gar keines.
3. wo der Schauplatz der Ehe sein soll, ob in der Stadt, oder auf dem Lande, und wie er in einem dieser Fälle seinen einzelnen Bestimmungen nach beschaffen sein soll, ob er im Gebirge, oder in der Ebene, oder am Meere liegen soll etc.
4. wie das Haus selbst eingerichtet sein soll, ob groß und prächtig, oder nur geräumig, bequem etc. etc.
5. ob Luxus in der Wirtschaft herrschen soll, oder Wohlstand etc.
6. welche Geschäfte sie führen will, welche nicht etc.
7. welche Vergnügungen in dem Hause herrschen sollen, ob geräuschvolle, oder stille, prächtige oder edle, moderne oder sinnreiche etc. etc.
8. welchen Grad von Herrschaft sie darin führen und welchen sie ihrem Gatten überlassen will?
9. Wie ihr Gatte sich überhaupt gegen sie betragen soll, ob schmeichelnd oder wahr, demütig oder stolz; ob er im Hause lustig, oder froh oder ernst sein soll; ob er sie außer dem Hause mit Eklat ehren soll, oder ob es genug sei, wenn dies zu Hause im Stillen geschieht; ob überhaupt außer dem Hause vor den Menschen viel geschehen müsse, oder ob es nicht genug sei, ganz im Stillen desto mehr zu genießen?
—————
Da das Ganze nichts als ein Wunsch ist, so hat die Phantasie ihren uneingeschränkten Spielraum, und darf sich an keine Fessel der Wirklichkeit binden. –
*
Berlin, den 14. August 1800
Noch am Abend meiner Ankunft an diesem Orte melde ich Euch, daß ich gesund und vergnügt bin, und bin darum so eilig, weil ich fürchte, daß Ihr, besonders an dem letztern, zweifelt.
Denn eine Reise, ohne angegebnen Zweck, eine so schnelle Anleihe, ein ununterbrochenes Schreiben und am Ende noch obenein Tränen – das sind freilich Kennzeichen eines Zustandes, die dem Anschein nach, Betrübnis bei teilnehmenden Freunden erwecken müssen.
Indessen erinnere Dich, daß ich bloß die Wahrheit verschweige, ohne indessen zu lügen, und daß meine Erklärung, das Glück, die Ehre, und vielleicht das Leben eines Menschen durch diese Reise zu retten, vollkommen gegründet ist.
Gewiß würde ich nicht so geheimnisreich sein, wenn nicht meine beste Erkenntnis mir sagte, daß Verheimlichung meines Zweckes notwendig, notwendig sei.
Indessen Du, und noch ein Mensch, Ihr sollt beide mehr erfahren, als alle übrigen auf der Welt, und überhaupt alles, was zu verschweigen nicht notwendig ist.
Dabei baue ich aber nicht nur auf Deine unverbrüchliche Verschwiegenheit (indem ich will, daß das Scheinbar-Abenteuerliche meiner Reise durchaus versteckt bleibe, und die Welt weiter nichts erfahre, als daß ich in Berlin bin und Geschäfte beim Minister Struensee habe, welches zum Teil wahr ist), sondern auch auf Deine feste Zuversicht auf meine Redlichkeit, so daß selbst bei dem widersprechendsten Anschein Dein Glaube an dieselbe nicht wankt.
Unter diesen Bedingungen sollst Du alles erfahren, was ich sagen kann, welches Du aber ganz allein nur für Dich behalten und der Welt nichts anderes mitteilen sollst, als daß ich in Berlin bin. Ich glaube, daß das Vortreffliche meiner Absicht, die Ausbreitung dieses Satzes, selbst wenn er zuweilen eine Lüge sein sollte, entschuldigt und rechtfertigt.
Ich suche jetzt zunächst einen edeln, weisen Freund auf mit dem ich mich über die Mittel zu meinem Zwecke beraten könne, indem ich mich dazu zu schwach fühle, ob ich gleich stark genug war, den Zweck selbst unwiderruflich festzustellen.
Wärst Du ein Mann gewesen – o Gott, wie innig habe ich dies gewünscht! – Wärst Du ein Mann gewesen – denn eine Frau konnte meine Vertraute nicht werden, – so hätte ich diesen Freund nicht so weit zu suchen gebraucht, als jetzt.
Ergründe nicht den Zweck meiner Reise, selbst wenn Du es könntest. Denke, daß die Erreichung desselben zum Teil an die Verheimlichung vor allen, allen Menschen beruht. Für jetzt wenigstens. Denn einst wird es mein Stolz und meine Freude sein, ihn mitzuteilen.
Grüße W. v. Z. Sie weiß so viel, wie Du, aber nicht viel mehr. – Schicke mir doch durch die Post meine Schrift, über die Kantische Philosophie, welche Du besitzest, und auch die Kulturgeschichte, welche Auguste hat; aber sogleich.
Ich kehre nicht so bald wieder. Doch das alles behältst Du für Dich. Du sollst jedesmal den Ort erfahren, wo ich bin; Du wirst von diesem Vertrauen keinen Gebrauch machen, der der Erreichung meines Zweckes hinderlich wäre.
Sei ruhig. Sei ganz ruhig. – Wenn auch die Hülle des Menschen mit jedem Monde wechselt, so bleibt doch eines in ihm unwandelbar und ewig: das Gefühl seiner Pflicht.
Dein treuer Bruder Heinrich.
N. S. Deine Aufträge werden morgen besorgt werden. – – Du mußt auf alle Adressen an mich immer schreiben, daß der Brief selbst abgeholt werden wird.
*
An das Stiftsfräulein Wilhelmine v. Zenge, Hochwürden und Hochwohlgeboren zu Frankfurt a. O.
Berlin, den 16. August 1800
Mein liebes, teures Herzensminchen, sei nicht böse, daß Du so spät diesen Brief erhältst. Gestern hielten mich viele Geschäfte vom Schreiben ab – doch das ist eine schlechte Entschuldigung. Kein Geschäft darf mich von der Erfüllung der Pflicht abhalten, meinem lieben, treuen Mädchen zur bestimmten Zeit Nachricht von mir zu geben. Nun, verzeihe diesmal. Wenn ich jetzt diese Zeilen auf die Post gäbe, so fändest Du freilich bei Deiner Rückkehr von Tamsel einen Brief von mir vor; aber kann man 7 Zeilen einen Brief nennen? Laß mich also lieber noch ein Weilchen mit Vertrauen und Innigkeit mit Dir plaudern.
Mit welchen Empfindungen ich Frankfurt verlassen habe – ach, liebes Mädchen, das kann ich Dir nicht beschreiben, weil Du mich doch nicht ganz verstehen würdest. Als ich mich von Dir trennte, legte ich mich noch ins Bett, und lag da wohl noch 1½ Stunde, doch mit offnen Augen, ohne zu schlafen. Als ich im Halbdunkel des Morgens abfuhr, war mirs, als hörte ich ein Geräusch an dem einen Fenster Eures Saales. Mir fuhr ein schneller Gedanke durch die Seele, ob Du das wohl sein könntest. Aber Du warst es nicht, ob ich gleich eine brennende Sehnsucht hatte, Dich noch einmal zu sehen. Der Wagen rollte weiter, indessen mein Auge immer noch mit rückwärtsgewandtem Körper an das geliebte Haus hing. Mir traten Tränen ins Auge, ich wünschte herzlich zu weinen, aber ich bin schon zu lange davon entwöhnt.
Auf meiner ganzen Reise nach Berlin ist der Gedanke an Dich nur selten, sehr selten aus meiner Seele gewichen. Ich bin überzeugt, daß wenn man die Augenblicke der Zerstreuung zusammenrechnen wollte, kaum eine kleine Viertelstunde herauskommen würde. Nichts zerstreute mich, nicht das wirklich romantische Steinhöffel (ein Gut des Hofmarschalls Massow), wo gleichsam jeder Baum, jeder Zweig, ja selbst jedes Blatt nach einer entworfenen Idee des Schönen gepflanzt, gebogen und geordnet zu sein scheint; nicht der emporstrebende Rauch der Feueressen am Schlosse, der mich an die Anstalten erinnerte mit welchen man eine königliche Familie hier empfangen wollte; nicht der ganze königliche Troß, der, in eine Staubwolke gehüllt, vor mir dahin rollte; nicht die schöne, bereits fertige Chaussee von Friedrichsfelde nach Berlin, auf welcher ich jetzt nicht ohne Freude, aber, wenn ich sie gebaut hätte, nicht ohne Stolz gefahren wäre; selbst nicht die brennende Hitze des Tages, die mir auf den Scheiteln glühte, als ob ich unter der Linie wäre, und die so sehr sie auch meinen Körper erschlaffte, doch meinen Geist nicht in seiner liebsten Beschäftigung, in der Erinnerung an Dich stören konnte.
Als ich hinein fuhr in das Tor im Halbdunkel des Abends, und die hohen weiten Gebäude anfänglich nur zerstreut und einzeln umher lagen, dann immer dichter und dichter, und das Leben immer lebendiger, und das Geräusch immer geräuschvoller wurde, als ich nun endlich in die Mitte der stolzen Königsstadt war, und meine Seele sich erweiterte um so viele zuströmende Erscheinungen zu fassen, da dachte ich: wo mag wohl das liebe Dach liegen, das einst mich und mein Liebchen schützen wird? Hier an der stolzen Kolonnade? dort in jenem versteckten Winkel? oder hier an der offnen Spree? Werde ich einst in jenem weitläufigen Gebäude mit vierfachen Reihen von Fenstern mich verlieren, oder hier in diesem kleinen engen Häuschen mich immer wieder finden? Werde ich am Abend, nach vollbrachter Arbeit, hier durch dieses kleine Gäßchen, mit Papieren unter dem Arm zu Fuß nach meiner Wohnung gehen, oder werde ich mit Vieren stolz durch diese prächtige Straße vor jenes hohe Portal rollen? Wird mein liebes Minchen, wenn ich still in die Wohnung treten will, mir von oben herab freundlich zuwinken, und auf dieser dunkeln Treppe mir entgegenkommen, um früher den Kuß der Liebe auf die durstenden Lippen zu drücken, oder werde ich sie in diesem weiten Palast suchen und eine Reihe von Zimmern durchwandern müssen, um sie endlich auf dem gepolsterten Sofa unter geschmückten und geschminkten Weibern zu finden? Wird sie hier in diesem dunkeln Zimmer nur den dünnen Vorhang zu öffnen brauchen, um mir den Morgengruß zuzulächeln, oder wird sie von dem weitesten Flügel jenes Schlosses her am Morgen einen Jäger zu mir schicken, um sich zu erkundigen, wie der Herr Gemahl geschlafen habe? – – Ach, liebes Minchen, nein, gewiß, gewiß wirst Du das letzte nicht. Was auch die Sitte der Stadt für Opfer begehrt, die Sitte der Liebe wird Dir gewiß immer heiliger sein, und so mag denn das Schicksal mich hinführen, wohin es will, hier in dieses versteckte Häuschen oder dort in jenes prahlende Schloß, eines finde ich gewiß unter jedem Dache, Vertrauen und Liebe.
Aber, unter uns gesagt, je öfter ich Berlin sehe, je gewisser wird es mir, daß diese Stadt, so wie alle Residenzen und Hauptstädte kein eigentlicher Aufenthalt für die Liebe ist. Die Menschen sind hier zu zierlich, um wahr, zu gewitzigt, um offen zu sein. Die Menge von Erscheinungen stört das Herz in seinen Genüssen, man gewöhnt sich endlich in ein so vielfaches eitles Interesse einzugreifen, und verliert am Ende sein wahres aus den Augen.
Carln sprach ich gleich gestern morgen, aß bei ihm zu Mittag, er bei mir zu Abend. Ich grüßte Kleisten auf der Promenade, und ward durch eine Einladung zu heute Abend gestraft, denn dies ist wider meinen Plan. Mein erster Gang war zu Struensee, er war, was ich bloß fürchtete, nicht gewiß wußte, nicht zu Hause. Du brauchst dies nicht zu verschweigen. Struensee kommt den 26. wieder und dann werde ich ihn sprechen. Das ist gewiß. Du kannst sagen, daß ich so lange hier bleiben werde, welches jedoch nicht wahr ist. Du wirst die Wahrheit erfahren. – Mein zweiter Gang war zu Beneken, den ich aber heute wiederholen muß, weil er nicht zu Hause war. – Mein dritter war in den Buchladen, wo ich Bücher und Karten für Ulriken, den Wallenstein von Schiller – Du freust Dich doch; – für Dich kaufte. Lies ihn, liebes Mädchen, ich werde ihn auch lesen. So werden sich unsre Seelen auch in dem dritten Gegenstande zusammentreffen. Laß ihn nach Deiner Willkür auf meine Kosten binden und schreibe auf der innern Seite des Bandes die bekannte Formel: H. v. K. an W. v. Z. Träume Dir so mit schönen Vorstellungen die Zeit unsrer Trennung hinweg. Alles was Max Piccolomini sagt, möge, wenn es einige Ähnlichkeit hat, für mich gelten, alles was Thekla sagt, soll, wenn es einige Ähnlichkeit hat, für Dich gelten.
Gestern abend ging ich in das berühmte Panorama der Stadt Rom. Es hat indessen, wie es scheint, seinen Ruhm niemandem zu danken, als seiner Neuheit. Es ist die erste Ahndung eines Panoramas (Panorama ist ein griechisches Wort. Für Dich ist es wohl weiter nichts, als ein unverständlicher Klang. Indessen damit Du Dir doch etwas dabei denken kannst, so will ich es Dir, nach Maßgabe Deiner Begreifungskraft, erklären. Die erste Hälfte des Wortes heißt ohngefähr so viel wie: von allen Seiten, ringsherum; die andere Hälfte heißt ohngefähr: sehen, zu Sehendes, Gesehenes. Daraus magst Du Dir nun nach Deiner Willkür ein deutsches Hauptwort zusammensetzen.) Ich sage, es ist die erste Ahndung eines Panoramas, und selbst die bloße Idee ist einer weit größeren Vollkommenheit fähig. Denn da es nun doch einmal darauf ankommt, den Zuschauer ganz in den Wahn zu setzen, er sei in der offnen Natur, so daß er durch nichts an den Betrug erinnert wird, so müßten ganz andere Anstalten getroffen werden. Keine Form des Gebäudes kann nach meiner Einsicht diesen Zweck erfüllen, als allein die kugelrunde. Man müßte auf dem Gemälde selbst stehen, und nach allen Seiten zu keinen Punkt finden, der nicht Gemälde wäre. Weil aber das Licht von oben hinein fallen und folglich oben eine Öffnung sein muß, so müßte um diese zu verdecken, etwa ein Baumstamm aus der Mitte sich erheben, der dick belaubte Zweige ausbreitet und unter dessen Schatten man gleichsam stünde. Doch höre, wie das alles ausgeführt ist. Zu mehrerer Verständlichkeit habe ich Dir den Plan beigelegt.
Am Eingange wird man höflichst ersucht, sich einzubilden, man stünde auf den Ruinen des Kaiserpalastes. Das kann aber wirklich, wenn man durch einen dunkeln Gang hinaufgestiegen ist bis in die Mitte, nicht ohne große Gefälligkeit geschehen. Man steht nämlich auf tüchtigen Fichtenbrettern, welche wie bekannt, mit dem carrarischen Marmor nicht eben viele Ähnlichkeit haben. Aus der Mitte erhebt sich ein vierkantiger Pfahl, der eine glatte hölzerne Decke trägt, um die obere Öffnung zu verdecken. Was das eigentlich vorstellen soll, sieht man gar nicht ein; und um die Täuschung vollends mit dem Dolche der Wirklichkeit niederzubohren, hangen an jeder Seite des Pfahles vier niedliche Spiegel, die das Bild des Gemäldes auf eine widerliche künstliche Art zurückwerfen. Der Raum für die Zuschauer ist durch eine hölzerne Schranke begrenzt, die ganz an die Barrieren der Luftspringer oder Kunstreiter erinnert. Drüber hin sieht man zunächst weiß und rot marmorierte Leinwand in gestaltlosen Formen aufgehängt und gestützt, und vertieft und gehoben, was denn, wie Du Dir leicht denken kannst, nichts weniger als die durch den Zahn der Zeit zerknirschten Trümmer des Kaiserpalastes vorstellen soll. Nächst diesem Vordergrunde, folgt eine ohngefähr 3 Fuß hohe im Kreise senkrecht umhergestellte Tapete, mit Blättern, Gesteinen, und Trümmern bemalt, welches gleichsam den Mittelgrund, wie auf unsern Theatern, andeutet. Denke Dir dann im Hintergrunde, das eigentliche Gemälde, an einer senkrechten runden Wand, denke Dir einen inwendig bemalten runden Turm, und Du hast die ganze Vorstellung des berühmten Panoramas.
Der Gegenstand des Gemäldes ist interessant, denn es ist Rom. Aber auch dieser ist zuweilen schlecht ausgeführt. Die Natur selbst, bilde ich mir ein, hat es wenigstens gewiß besser gemacht. Das ist eine Fülle von Gegenständen, ein Reichtum von Schönheiten und Partien, deren jede einzeln einen Ort interessant machen würde. Da sind Täler, Hügel, Alleen, heilige Haine, Grabmäler, Villen, Ruinen, Bäder, Wasserleitungen (nur kein Wasser selbst), Kapellen, Kirchen, Pyramiden, Triumphbögen, der große ungeheure Zirkus und das prächtige Rom. Das letzte besonders tut sein möglichstes zum Betrug. Der Künstler hat grade den Moment des Sonnenunterganges gut getroffen, ohne die Sonne selbst zu zeigen, die ein Felsen (Numro 1) verbirgt. Dabei hat er Rom, mit seinen Zinnen und Kuppeln so geschickt zwischen der Sonne und dem Zuschauer situiert, daß der melancholische dunkle Azurschleier des Abends, der über die große Antike liegt, und aus welchem nur hin und wieder mit heller Purpurröte die erleuchteten Spitzen hervorblitzen, seine volle Wirkung tut. Aber kein kühler Westwind wehte über die Ruinen, auf welchen wir standen, es war erstickend heiß in dieser Nähe von Rom, und ich eilte daher wieder nach Berlin, welche Reise diesmal nicht beschwerlich und langwierig war. –
Soeben tritt ein bewaffneter Diener der Polizei zu mir herein, und fragt mich, ob ich, der ehemalige Lieut. v. K., mich durch Dokumente legitimieren könne. Gott sei Dank, dachte ich, daß du nicht ein französischer oder polnischer Emigrierter bist, sonst würde man dich wohl höflichst unverrichteter Sache wieder zum Tore hinaus begleiten. Wer weiß ob er nicht dennoch nach Frankfurt schreibt, um sich näher nach mir zu erkundigen. Denn der seltsame militärisch-akademische Zwitter schien ihm doch immer noch ein Anomalon (Ausnahme von der Regel) in dem Bezirk seiner Praxis zu sein. –
Soeben komme ich von Beneken zurück und bringe meiner Schwester Wilhelmine gute Nachrichten. Gib ihr einliegenden Zettel. – Zu welchen Abscheulichkeiten sinkt der Mensch hinab, wenn er nichts als seinen eignen Vorteil im Auge hat. Pfui! Lieber alles verlieren, als durch solche Mittel gewinnen. Mein armes Minchen hatte auch ein besseres Schicksal verdient. Das sind die Folgen eines einzigen unseligen Entschlusses! – Werden wir wohl noch einmal uns scheiden? Statt dieser zärtlichen Briefe gerichtliche Klagen und Vorwürfe aufschreiben? In diesen wohlwollenden Herzen einst Haß und Rache nähren? Mit diesen getreuen Kräften einst wechselseitig uns in Schande und Elend stürzen? – Werden wir uns scheiden? – Wir nicht, mein liebes Mädchen. Aber einer wird uns freilich scheiden, einer, der auch schwarz aussehen soll, wie man sagt, ob er gleich kein Priester ist. Doch der scheidet immer nur die Körper.
Als ich von Beneken zurück kam, begegnete ich Neddermann, zierlich geputzt, in Schuhen, triefend von Schweiß. Wo kommen Sie her, mein Freund? – Aus dem Examen. –
—————
Ich eile zum Schlusse. Lies die Instruktion oft durch. Es wäre am besten wenn Du sie auswendig könntest. Du wirst sie brauchen. Ich vertraue Dir ganz, und darum sollst Du mehr von mir erfahren als irgend einer.
Mein Plan hat eine Änderung erlitten, oder besser, die Mittel dazu; denn der Zweck steht fest. Ich fühle mich zu schwach ganz allein zu handeln, wo etwas so Wichtiges aufs Spiel steht. Ich suche mir daher jetzt, ehe ich handle, einen weisen, ältern Freund auf, den ich Dir nennen werde, sobald ich ihn gefunden habe. Hier ist er nicht, und in der Gegend auch nicht. Aber er ist – – soll ich Dir den Ort nennen? Ja, das will ich tun! Ulrike soll immer nur erfahren, wo ich bin, Du aber, mein geliebtes Mädchen, wo ich sein werde. Also kurz: Morgen geht es nach – – – – Pasewalk. Pasewalk? Ja, Pasewalk, Pasewalk. Was in aller Welt willst du denn dort? – Ja, mein Kind, so fragt man die Bauern aus! Begnüge Dich mit raten, bis es für Dich ein Glück sein wird, zu wissen. In 5 oder höchstens 7 Tagen bin ich wieder hier, und besorge meine Geschäfte bei Struensee. Dann ist die Reise noch nicht zu Ende – Du erschrickst doch nicht? Lies Du nur fleißig zur Beruhigung meine Briefe durch, wie ich Deine Aufsätze. Und schreibe mir nicht anders, als bis ich Dir genau andeute, wohin? Auch mußt Du immer auf Deine Briefe schreiben: selbst abzuholen. Morgen denke ich hier einen Brief von Dir zu finden. Jetzt aber mußt Du gleich wieder schreiben, und zwar so, daß der Brief den 22. spätestens in Berlin eintrifft. Sei klug und verschwiegen. Restés fidèle.
Dein Freund H. K.
N. S. Carl kommt mir nicht von der Seite und zerbricht sich den Kopf, was ich vorhabe. Ich werde ihm das Versprechen abnehmen, nicht zu erforschen, was ich will. Unter dieser Bedingung will ich ihm versprechen, daß er immer von Dir erfahren soll, wo ich bin. Das kannst Du ihm dann schreiben, doch weiter nichts. Du kannst auch sagen, daß ich in Berlin bei Carln wohne. Sollte er auf Urlaub nach Fr. kommen, so bin ich ausgezogen, nach Potsdam gegangen, wie Ihr wollt, nur immer Ihr beide einstimmig. Wenn Carl nur sieht, daß Du alles weißt, so wird er nicht erstaunen und sich verwundern, welches ich in alle Fälle gern vermeiden möchte. Hilf mir meinen Plan so ausführen, liebes Mädchen, Dein Glück ist so gut dabei interessiert, ja vielleicht mehr noch, als das meinige. Das alles wirst Du einst besser verstehen. Lebe wohl. Predige nur in allen Deinen Briefen Carln Verschwiegenheit vor. Er soll gegen niemanden viel von mir sprechen, und dringt einer auf ihn ein, antworten, er wisse von nichts. Adieu. Adieu. In 3 Tagen folgt ein zweiter Brief.
(Nimm immer die Karte von Deutschland zur Hand und siehe zu, wo der Ort liegt, in welchem ich mich befinde.) – Der erste, dem Du das Gedicht von Schiller leihst, muß Ulrike sein.
*
An das Stiftsfräulein Wilhelmine v. Zenge
Hochwürden und Hochwohlgeboren zu Frankfurt a. O.
Pasewalk, den 20. August 1800
Mein teures liebes Mädchen. Kaum genieße ich die erste Stunde der Ruhe, so denke ich auch schon wieder an die Erfüllung meiner Pflicht, meiner lieben, angenehmen Pflicht. Zwar habe ich den ganzen Weg über von Berlin nach Pasewalk an Dich geschrieben, trotz des Mangels an allen Schreibmaterialien, trotz des unausstehlichen Rütteln des Postwagens, trotz des noch unausstehlicheren Geschwätzes der Passagiere, das mich übrigens so wenig in meinem Konzept störte, als die Bombe in Stralsund Carln XII. in dem seinigen. Aber das Ganze ist ein Brief geworden, den ich Dir nicht anders als mit mir selbst und durch mich selbst mitteilen kann, denn, unter uns gesagt, es ist mein Herz. Du willst aber schwarz auf weiß sehen, und so will ich Dir denn mein Herz so gut ich kann auf dieses Papier malen, wobei Du aber nie vergessen mußt, daß es bloße Kopie ist, welche das Original nie erreicht, nie erreichen kann.
Ich reisete den 17. morgens um 8 Uhr mit der Stettiner bedeckten Post von Berlin ab. Deinem Bruder hatte ich das Versprechen abgenommen, weder das Ziel noch den Zweck meiner Reise zu erforschen, und hatte ihm dagegen das Versprechen gegeben, durch meine Vermittelung immer von Dir den Ort meines Aufenthaltes zu erfahren. Diesen kannst Du ihm denn auch immer mitteilen, es müßten denn in der Folge Gründe eintreten, welche mir das Gegenteil wünschen lassen. Das werde ich Dir aber noch schreiben.
Ich hatte am zweiten Abend vor meiner Abreise bei Kleisten gegessen, und obgleich die Tafel gar nicht überflüssig und leckerhaft gedeckt war, so hatte ich doch gleichsam in der Hitze des Gesprächs mit sehr interessanten Männern mehr gegessen, als mir dienlich war. Ich befand mich am andern Tage und besonders in der letzten Nacht sehr übel, wagte aber die Reise, welche notwendig war, doch, und der Genuß der freien Luft, Diät, das Rütteln des Wagens, vielleicht auch die Aussicht auf eine frohe Zukunft haben mich wieder ganz kuriert.
– Ich habe auch deinen lieben Wittich in Berlin gesehen und gesprochen, und finde, daß mir mein ehemaliger Nebenbuhler keine Schande macht. Ich habe zwar bloß sein Äußeres, seine Rüstung, kennen gelernt, aber es scheint mir, daß etwas Gutes darunter versteckt ist. Ich würde aber dennoch den Kampf mit ihm um Deine Liebe nicht scheuen. Denn obgleich seine Waffen heller funkeln als meine, so habe ich doch ein Herz, das sich mit dem besten messen kann; und Du, hoffe ich, würdest entscheiden, wie es recht ist.
Von meiner Reise läßt sich diesmal nichts sagen. Ich bin durch Oranienburg, Templin, Prenzlow hierhergekommen, ohne daß sich von dieser ganzen Gegend etwas Interessanteres sagen ließe, als dieses daß sie ohne alles Interesse ist. Das ist nichts, als Korn auf Sand, oder Fichten auf Sand, die Dörfer elend, die Städte wie mit dem Besen auf ein Häufchen zusammengekehrt. Denn rings um die Mauern ist alles so rein und proper, daß man oft einen Knedelbaum vergebens suchen würde. Es scheint als ob dieser ganze nördliche Strich Deutschlands von der Natur dazu bestimmt gewesen wäre, immer und ewig der Boden des Meeres zu bleiben, und daß das Meer sich gleichsam nur aus Versehn so weit zurückgezogen und so einen Erdstrich gebildet hat, der ursprünglich mehr zu einem Wohnplatz für Walfische und Heringe, als zu einem Wohnplatz für Menschen bestimmt war.
Diesmal mußt Du also mit dieser magern Reisebeschreibung vorlieb nehmen. Ich hoffe Dir künftig interessantere Dinge schreiben zu können. – Und nun zu dem, worauf Du gewiß mit Deiner ganzen Seele gespannt bist, und wovon ich Dir doch nur so wenig mitteilen kann. Doch alles, was jetzt für Dich zu wissen gut ist, sollst Du auch jetzt erfahren.
Du kannst doch Deine Lektion noch auswendig? Du liesest doch zuweilen meine Instruktion durch? Vergiß nicht, liebes Mädchen, was Du mir versprochen hast, unwandelbares Vertrauen in meine Liebe zu Dir, und Ruhe über die Zukunft. Wenn diese beiden Empfindungen immer in Deiner Seele lebendig wären, und durch keinen Zweifel niemals gestört würden, wenn ich dieses ganz gewiß wüßte, wenn ich die feste Zuversicht darauf haben könnte, o dann würde ich mit Freudigkeit und Heiterkeit meinem Ziele entgegen gehen können. Aber der Gedanke – Du bist doch nur ein schwaches Mädchen, meine unerklärliche Reise, diese wochenlange, vielleicht monatelange Trennung – – o Gott, wenn Du krank werden könntest! Liebes, teures, treues Mädchen! Sei auch ein starkes Mädchen! Vertraue Dich mir ganz an! Setze Dein ganzes Glück auf meine Redlichkeit! Denke Du wärest in das Schiff meines Glückes gestiegen, mit allen Deinen Hoffnungen und Wünschen und Aussichten. Du bist schwach, mit Stürmen und Wellen kannst Du nicht kämpfen, darum vertraue Dich mir an, mir, der mit Weisheit die Bahn der Fahrt entworfen hat, der die Gestirne des Himmels zu seinen Führern zu wählen, und das Steuer des Schiffes mit starkem Arm, mit stärkerm gewiß als Du glaubst, zu lenken weiß! Wozu wolltest Du klagen, Du, die Du das Ziel der Reise, und ihre Gefahr nicht einmal kennst, ja vielleicht Gefahren siehst, wo gar keine vorhanden sind? Sei also ruhig! So lange der Steuermann noch lebt, sei ruhig! Beide gehen unter in den Wellen, oder beide laufen glücklich in den Hafen; kann sich die Liebe, die echte Liebe, ein freundlicheres Schicksal wünschen?
Eben damit Du ganz ruhig sein möchtest, habe ich Dir, die einzige in der Welt, alles gesagt, was ich sagen durfte, nichts, auch das mindeste nicht vorgelogen, nur verschwiegen, was ich verschweigen mußte. Darum, denke ich, könntest Du wohl auch schon Vertrauen zu mir fassen. Das meinige wird von Dir nie wanken. Ich habe zwar am Sonntage keinen Brief gefunden, ob Du mir gleich versprochen hattest, noch vor Deiner Reise nach Tamsel an mich zu schreiben; aber ich fürchte eher, daß Du Deine Gesundheit, als Deine Liebe zu mir verloren hättest, ob mir gleich das erste auch schrecklich wäre. – Liebes Mädchen, wenn Du krank sein solltest, und ich erfahre dies in Berlin, so bin ich in zwei Tagen bei Dir. Aber ich fürchte das nicht – o weg mit dem häßlichen Gedanken!
Ich komme zu einer frohen Nachricht, die Dir gewiß auch recht froh sein wird. Denn alles was mir zustößt, sei es Gutes oder Böses, auch wenn Du es gar nicht deutlich kennst, das trifft auch Dich, nicht wahr? Das war die Grundlage unseres Bundes. Also höre! Mein erster Plan ist ganz vollständig geglückt. Ich habe einen ältern, weisern Freund gefunden, grade den, den ich am innigsten wünsche. Er stand nicht einen Augenblick an, mich in meinem Unternehmen zu unterstützen. Er wird mich bis zu seiner Ausführung begleiten. Nun bist Du doch ruhig? Du weißt doch mit welcher Achtung ich und Ulrike von einem gewissen Brokes sprach, den wir auf Rügen kennen gelernt haben? Der ist es. – Gott gebe, daß mir die Hauptsache so glückt, dann sind niemals zwei glücklichere Menschen gewesen, als Du und ich. – Aber das alles behältst Du für Dich. Das habe ich niemandem anvertraut, als der Geliebten. Das Fräulein von Zenge weiß es aber nicht anders, als daß ich in Berlin bin, und so darf es auch kein anderer anders von ihr erfahren. Grüße Vater und Mutter und beide Familien von dem Herrn von Kleist der in Berlin ist. Da treffe ich auch wirklich wieder den 24. August ein, doch halte ich mich dort nicht lange auf. Ich empfange bloß einen Brief von Dir, den ich gewiß aufzufinden hoffe, und spreche mit Struensee; dann geht es weiter, wohin? das sollst Du erfahren, ich weiß es selbst noch nicht gewiß. Du sollst dann überhaupt mehr von dem Ganzen meiner Reise erfahren; doch Dein Brief, den ich in Berlin erhalten werde, wird bestimmen – wie viel. Wenn ich mit ganzer Zuversicht auf Dein Vertrauen und Deine Ruhe rechnen kann, so lasse ich jeden Schleier sinken, der nicht notwendig ist.
Dein treuer Freund H. K.
*
Coblentz bei Pasewalk, den 21. August 1800
Du vergißt doch nicht, daß ich Dir allein meinen Aufenthalt mitteile, und daß er aus Gründen jedem andern Menschen verschwiegen bleiben muß? Ich habe ein unumschränktes Vertrauen zu Dir, und darum verschweige ich Dir nichts, was zu verschweigen nicht notwendig ist. Vertraue auch mir, und tue keinen eigenmächtigen Schritt, der üblere Folgen haben könnte, als Du glaubst. Elisabeth ehrte die Zwecke Posas, auch ohne sie zu kennen. Die meinigen sind wenigstens gewiß der Verehrung jedes edeln Menschen wert.
Ich habe mich hier mit Brokes vereinigt. Er hat mit mir denselben Zweck, und das könnte Dich noch ruhiger machen, wenn Dich die Unerklärlichkeit meiner Reise beunruhigen sollte. Brokes ist ein trefflicher junger Mann, wie ich wenige in meinem Leben gefunden habe. Wir werden beide gemeinschaftlich eine Reise machen – nicht zu unserm Vergnügen, das schwöre ich Dir; wie hätte ich Dich so um Deine liebsten Freuden betrügen können? – Nein. Vielmehr es liegt ein sehr ernster Zweck zum Grunde, der uns wahrscheinlich nicht eher ein ganz ungestörtes Vergnügen genießen lassen wird, als bis er erreicht ist. Die Mitwissenschaft eines Dritten war unmöglich, wenigstens stand es nicht in meiner Willkür über das Geheimnis zu schalten; sonst würde meine edelste Schwester gewiß auch meine Vertraute geworden sein.
Ich baue ganz auf Dein Vertrauen zu mir und auf Deine Verschwiegenheit. Wenn ich das nicht darf, Ulrike, so schreibe es mir nach Berlin, und ich ergreife andere Maßregeln. Nur in der festen Zuversicht auf Deine unwandelbare Treue wirst Du immer von mir den Ort erfahren, an welchen mich die Bahn unsers Zweckes führt. Täuschen wirst Du mich nicht. Du wirst meine gerechte Forderungen erfüllen, auch ohne es versprochen zu haben. Denn alles was wenige tun würden, erwarte ich von Dir.
Ich bleibe hier in Coblentz bis morgen. Ich treffe d. 24. in Berlin ein. Dahin mußt Du mir gleich nach Empfang dieses Briefes schreiben, wenn Du mir die Freude machen willst, von Deiner Hand zu sehen, was Du von meinem Vorhaben denkst. Ich habe alles Hiesige von Dir gegrüßt. Alles läßt Dich wieder grüßen. Ich habe der Gräfin den Wallenstein zurückgelassen, weil sie es wünschte. Sie wird ihn Dir bei ihrer Durchreise durch Frankfurt überliefern. Du kannst das Buch als ein Geschenk von mir betrachten, denn sein Inhalt muß nicht gelesen, sondern gelernt werden. Ich bin begierig ob Wallenstein den Carlos bei Dir verdrängen wird. Ich bin unentschieden.
Adieu. Grüße alles von mir aus Berlin. Die Gräfin Eickstedt wird zwar, wenn sie in Frankfurt ist, von mir und meiner Gegenwart in Coblentz erzählen; allein Du kannst alsdann sagen, ja, Du wüßtest es, ich hätte Dich aber gebeten, es zu verschweigen. So wünschte ich, daß Du es mit allem machen möchtest, was von meiner Reise entdeckt werden sollte. Hilf mir meinen Plan ausführen, liebes Ulrikchen, er verdient es. Adieu.
Heinrich.
– N. S. Weißt Du, daß das Turnier in Schwedisch-Pommern beim Gf. v. Falkenstein in Consages sein wird?
*
Coblentz bei Pasewalk, den 21. August 1800
Weil doch die Post vor morgen abend nicht abgeht, so will ich noch ein Blättchen Papier für Dich beschreiben, und wünsche herzlich daß die Lektüre desselben Dir nur halb so viel Vergnügen machen möge, als mir das Geschäft des Schreibens. Du wirst zwar nun ein paarmal vergebens auf die Post schicken, und das Herzchen wird mit jeder Stunde stärker und stärker zu klopfen anfangen; aber Du mußt vernünftig werden, Wilhelmine. Du kennst mich, und, wie ich hoffe, doch gewiß im Guten. Daran halte Dich. Du kennst überdies immer den Ort meines Aufenthaltes, und von dem Zwecke meiner Reise weißt Du doch wenigstens so viel, daß er vortrefflich ist. Unser Glück liegt dabei zum Grunde, und es kann, welches eine Hauptsache ist, nichts dabei verloren, doch alles dabei gewonnen werden. Also beruhige Dich für immer, was auch immer vorfallen mag. Wie leicht können Briefe auf der Post liegen bleiben, oder sonst verlorengehen; wer wollte da gleich sich ängstigen? Geschrieben habe ich gewiß, wenn Du auch durch Zufall nicht eben sogleich den Brief erhalten solltest. Damit wir aber immer beurteilen können, ob unsere Briefe ihr Ziel erreicht haben, so wollen wir beide uns in jedem Schreiben wechselseitig wiederholen, wie viele Briefe wir schon selbst geschrieben und empfangen haben. Und so mache ich denn hiermit unter folgender Rubrik den Anfang:
| Abgeschickt | Empfangen |
| Von Berlin den 1. Brief. |
– – – – |
Ich hoffe, daß ich auch bald die andere Rubrik werde vollfüllen können. – Und noch eins. Ich führe ein Tagebuch, in welchem ich meinen Plan täglich ausbilde und verbessre. Da müßte ich mich denn zuweilen wiederholen, wenn ich die Geschichte des Tages darin aufzeichnen sollte, die ich Dir schon mitgeteilt habe. Ich werde also dieses ein für allemal darin auslassen, und die Lücken einst aus meinen Briefen an Dich ergänzen. Denn das Ganze hoffe ich wird Dir einst sehr interessant sein. Du mußt aber nun auch diese Briefe recht sorgsam aufheben; wirst Du? Oder war schon dieses Gesuch überflüssig! Liebes Mädchen, ich küsse Dich.
Und nun zur Geschichte des Tages. – Ach, mein bestes Minchen, wie unbeschreiblich beglückend ist es, einen weisen, zärtlichen Freund zu finden, da wo wir seiner grade recht innig bedürfen. Ich fühlte mich stark genug den hohen Zweck zu entwerfen, aber zu schwach um ihn allein auszuführen. Ich bedurfte nicht sowohl der Unterstützung, als nur eines weisen Rates, um die zweckmäßigsten Mittel nicht zu verfehlen. Bei meinem Freunde Brokes habe ich alles gefunden, was ich bedurfte, und dieser Mensch müßte auch Dir jetzt vor allen andern, nach mir vor allen andern teuer sein. Ihm habe ich mich ganz anvertraut, und er ehrte meinen Zweck, sobald er ihn kannte, so wie ihn denn jeder edle Mensch, der ihn fassen kann, ehren muß. Ach, mein teures edles Mädchen, wenn auch Du meinen Zweck ehren könntest, auch selbst ohne ihn zu kennen! Das würde mir ein Zeichen Deiner Achtung sein, ein Zeichen, das mich unaussprechlich stolz machen würde. Niemals, niemals wirst Du mir einen so unzweideutigen Beweis Deiner Achtung geben können, als jetzt. Ach, wenn Du dies versäumtest – – Wirst Du? Oder war auch diese Erinnerung überflüssige Liebes Mädchen, ich küsse Dich wieder – –
Auch Brokes sieht ein, daß die Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Erfolges groß ist. Wenigstens, sagte er, ist keine Gefahr vorhanden, in keiner Hinsicht, und wenn ich nur auf Deine Ruhe rechnen könnte, so wäre ein Haupthindernis gehoben. Ich hatte über den Gedanken dieses Planes schon lange lange gebrütet. Sich dem blinden Zufall überlassen, und warten, ob er uns endlich in den Hafen des Glückes führen wird, das war nichts für mich. Ich war Dir und mir schuldig, zu handeln. »Nicht aus des Herzens bloßem Wunsche keimt« etc. – »der Mensch soll mit der Mühe Pflugschar« etc. etc. – das sind herrliche, wahre Gedanken. Ich habe sie so oft durchgelesen, und sie scheinen mir so ganz aus Deiner Seele genommen, daß Deine Schrift das übrige tut um mir vollends einzubilden, das Gedicht wäre von keinem andern, als von Dir. So oft ich es wieder lese fühle ich mich gestärkt selbst zu dem Größten, und so gehe ich denn fast mit Zuversicht meinem Ziele entgegen. Doch werde ich vorher noch gewiß Struensee sprechen, um mir auf jeden Fall den Rückzug zu sichern. – Brokes, der schon diesen Herbst zu einer Reise bestimmt hatte, wird mich begleiten. Also kannst Du noch um so ruhiger sein. Du mußt nichts als die größte Hoffnung auf die Zukunft in Deiner Seele nähren.
Hast Du auch Deine Freundin schon wieder gefunden? Die Clausius, oder die Koschenbahr? Herzlich, herzlich, wünsche ich es Dir. Wahre, echte Freundschaft kann fast die Genüsse der Liebe ersetzen – Nein, das war doch noch zu viel gesagt; aber viel, sehr viel kann ein Freund tun, wenn der Geliebte fehlt. Wenigstens gibt es keine anderen Genüsse, zu welchen sich die Liebe so gern herab ließe, wenn sie ihr ganzes Glück genossen hat und auf eine Zeitlang feiern muß, als die Genüsse der Freundschaft. Vor allen andern Genüssen ekelt ihr, wie dem Schlemmer vor dem Landwein wenn er sich in Champagner berauscht hat. Daher ist es mit einer meiner herzlichsten Wünsche, daß Du eine von diesen beiden Freundinnen recht lange bei Dir behalten mögest, wenigstens so lange, bis ich zurückkomme. Erzähle ihr immerhin von mir, wenn sie Dir von dem ihrigen erzählt hat; denn das könnt ihr Weiber doch wohl nicht gut lassen, nicht wahr? Aber sei klug. Was ich Dir vertraue, Dir allein, das bleibt auch in Deinem Busen vor allen andern verschlossen. Laß Dich nicht etwa in einer zärtlichen Stunde verleiten mehr zu erzählen, als Du darfst. Minchen, Du weißt es nicht, wie viel an Deine Verschwiegenheit hangt. Dein Glück ist auch dabei im Spiel; also sorge für Dich und mich zugleich, und befolge genau, ohne Einschränkung, ohne Auslegung, wörtlich worum ich Dich herzlich und ernsthaft bitte. Kannst Du Dir den Genuß einige von meinen Briefen Deiner lieben Freundin mitzuteilen, nicht verweigern, so zeige ihr frühere Briefe, aber diese nicht; wenigstens daraus nichts, aus welchem sich nur auf irgend eine Art mein wirklicher Aufenthalt erkennen ließe. Denn dieser muß vor allen Menschen verschwiegen bleiben, außer vor Dir und Ulriken.
Doch ich wollte Dir ja die Geschichte des Tages erzählen und komme immer wieder zu meinem Plane zurück, weil mir der unaufhörlich im Sinne liegt. Du bist aufs Innigste mit meinem Plane verknüpft, also kannst Du schließen, wie oft ich an Dich denke. Denkst Du wohl auch so oft an mich? – – Doch zur Sache.
Weil, wie gesagt, die Post, die mich und Brokes nach Berlin führen soll, erst morgen abend abgeht (denn dieselbe Post trennt sich in Prenzlow und bringt Dir diesen Brief nach Frankfurt), so beschloß ich mit Brokes so lange auf seinem bisherigen Wohnort zu verweilen. Dies ist Coblentz, ein Landgut des Grafen von Eickstedt, der die Güte hatte, mich einladen zu lassen. Seine Gemahlin hatte ich auf Rügen kennen gelernt. Wir bestellten die Post in Pasewalk nach Berlin und fuhren den 20. nachmittags um 2 Uhr von dort ab.
Ich fand in der Nähe von Coblentz weite Wiesen, mit Graben durchschnitten, umgeben mit großen reinlich gehaltenen Wäldern, viel junges Holz, immer verzäunt und geschlossen, ausgebesserte Wege, tüchtige Brücken, viele zerstreute Vorwerke, massiv gebaut, fette zahlreiche Herden von Kühen und Schafen etc. etc. Die Vorwerke hießen: Augustenhain, Peterswalde, Carolinum, Carolinenburg, Dorotheenhof etc. etc. Wo nur eine Tür war, da glänzte auch ein Johanniterkreuz, auf jedem Dache, auf jedem Pfahle war es vielfach aufgepflanzt. Als ich vor das Schloß fuhr, fand ich, von außen, zugleich ein uraltes und nagelneues Gebäude, zehnmal angefangen, nie vollendet, heute nach dieser Idee, über das Jahr nach einer andern, hier ein Vorsprung, dort ein Einschnitt, immer nach dem Bedürfnis des Augenblicks angebaut und vergrößert. Im Hause kam mir die alte würdige Gräfin freundlich entgegen. Der Graf war nicht zu Hause. Er war mit einigen andern Damen nach Augustenhain gefahren. Indessen ich lernte ihn doch noch in seinem Hause kennen, noch ehe ich ihn sah. Dunkle Zimmer, schön möbliert, viel Silber, noch mehr Johanniterkreuze, Gemälde von großen Herren, Feldmarschälle, Grafen, Minister, Herzoge, er in der Mitte, in Lebensgröße, mit dem Scharlachmantel, auf jeder Brust einen Stern, den Ordensband über den ganzen Leib, an jeder Ecke des Rahmens ein Johanniterkreuz. Wir gingen, Brokes und ich, nach Augustenhain. Ein ordentlicher Garten, halb französisch, halb englisch, schöne Lusthäuser, Orangerien, Altäre, Grabmäler von Freunden, die vornehme Herren waren, ein Tempel dem großen Friedrich gewidmet; große angelegte Waldungen, weite urbargemachte, ehemals wüste, jetzt fruchtbare Felder, viele Meiereien, Pferde, Menschen, Kühe, schöne nützliche Ställe auf welchen aber das Johanniterkreuz nie fehlte – – – – Wenn man die Schnecke an ihrer Muschel erkennen kann, rief ich, so weiß ich auch wer hier wohnt.
Ich hatte es getroffen. Ich fand Ökonomie und Liberalität, Ehrgeiz und Bedürfnis, Weisheit und Torheit in einem Menschen vereinigt, und dieser war kein andrer als der Gr. v. Eickstedt.
————
Liebes Mädchen, ich werde abgerufen, und kann Dir nun nicht mehr schreiben. Lebe wohl. In Berlin finde ich einen Brief von Dir, und wenn er mir recht gefällt, recht vernünftig und ruhig ist, so erfährst Du viel Neues von mir. Adieu.
H. K.
*
Berlin, den 26. August 1800
Mein liebes Ulrickchen. Es steht eine Stelle in Deinem Briefe, die mir viele Freude gemacht hat, weil sie mir Dein festes Vertrauen auf meine Redlichkeit, selbst bei den scheinbar widersprechendsten Umständen, zusichert. Du wirst finden daß ich dessen bedarf. Ich teile Dir jetzt ohne Rückhalt alles mit, was ich nicht verschweigen muß. Ich reise mit Brockes nach Wien. Ich werde manches Schöne sehen, und jedesmal mit Wehmut daran denken, wie vergnügt Du dabei gewesen wärest, wenn es möglich gewesen wäre, Dich an dieser Reise Anteil nehmen zu lassen. Doch das Schöne ist diesmal nicht Zweck meiner Reise. Unterlasse alle Anwendungen, Folgerungen, und Kombinationen. Sie müssen falsch sein, weil Du mich nicht ganz verstehen kannst. Halte Dich bloß an das, was ich Dir gradezu mitteile. Das ist buchstäblich wahr.
Du bietest mir Deine ferneren Dienste an. Ich werde davon Gebrauch machen, ohne Deine Freundschaft zu mißbrauchen. Du wirkst unwissend zu einem Zwecke mit, der vortrefflich ist. Ich stehe daher nicht an, Dich um eine neue Gefälligkeit zu ersuchen. Oder eigentlich ist es Brockes, für den ich etwas erbitte.
Brockes reisete mit mir von Coblentz ab, und nannte der Eickstädtschen Familie kein anderes Ziel seiner Reise als Berlin. Du darfst der Gräfin Eickstädt, wenn Du sie in Frankfurt sprichst, diesen Glauben nicht benehmen. Brockes hatte einen Wechsel von 600 Rth., auf einen Bankier in Schwerin gestellt. Es war zu weitläufig, das Geld sich von Schwerin her schicken zu lassen. Er nahm ihn also nach Berlin mit, um ihn bei dem hiesigen mecklenburgischen Agenten umzusetzen. Der aber war verreiset und kein andrer hiesiger Bankier kennt Brockes. Er hat nun also doch von hier aus nach Schwerin schreiben müssen. Wir dürfen uns aber in Berlin nicht länger verweilen. Das Geld könnte frühstens in 4 Wochen in Wien sein. Wir bedürfen dies aber gleich, nicht um die Reisekosten zu bestreiten, sondern zu dem eigentlichen Zwecke unsrer Reise. Ferner würde der Mecklenburgische Bankier dadurch erfahren, daß Brockes in Wien ist, welches durchaus verschwiegen bleiben soll. Uns bleibt also kein anderes Mittel übrig als unsre einzige Vertraute, als Du. Wir ersuchen Dich also, wenn es Dir möglich ist, 100 Dukaten nach Wien zu schicken, und zwar an den Studenten Buchholz, denn so heißt Brockes auf dieser Reise. Das müßte aber bald geschehen. Auch müßte auf der Adresse stehen, daß der Brief selbst abgeholt werden wird. Nun höre die Bedingungen. Du erhältst dies Geld auf jeden Fall, Du magst in unsere Bitte willigen oder nicht, in spätestens 3 Wochen von Schwerin. Brockes hat nämlich auf meine Versicherung, daß Du gewiß zu unserm Zwecke mitwirken würdest, wenn es Dir möglich wäre, bereits nach Schwerin geschrieben, an den mecklenburgischen Minister Herrn von Brandenstein. Dieser wird in Schwerin das Geld heben und es Dir nach Frankfurt schicken. Sollte es Dir also nicht möglich gewesen sein, uns früher mit Geld auszuhelfen, so schicke uns wenigstens das empfangne Geld sogleich nach Wien unter untenstehender Adresse. Solltest Du aber schon aus eigenen Mitteln uns 100 Dukaten überschickt haben, so behältst Du die empfangenen 60 Fr.dor, und Brockes wird sich mit Dir bei unserer Zurückkunft berechnen wegen des Agios. Sollte bei dem zu empfangenden Gelde zugleich ein Brief von Brandenstein an Brokes vorhanden sein, so darfst Du diesen unter der Adresse: an Brokes nicht nachschicken, sondern Du kannst ihn erbrechen und bei Dir behalten, und uns nur den Inhalt melden.
Brokes heißt nicht Buchholz sondern Bernhoff. Die Adresse also ist:
An
den Studenten der Ökonomie
Herrn Bernhoff
Wohlgeboren
zu Wien
(selbst abzuholen)
————
Willst Du mich mit einem Brief erfreuen, so ist die Adresse:
An
den Studenten der Mathematik
Herrn Klingstedt
Wohlgeb.
zu Wien
(selbst abzuholen)
————
Ich brauche doch nicht zu wiederholen, daß niemand dies alles erfahren darf? Niemand weiß es als Du und W. Z., wird es also verraten, so ist einer von Euch unfehlbar der Verräter. Doch wer dürfte das fürchten?
Ich werde Dir gleich von Wien aus schreiben. Ich komme sobald unser Geschäft beendigt ist, nach Frankfurt zurück, und dies geschieht auf jeden Fall vor dem 1. November. Fragt jemand nach uns, so heißt es, ich wäre verreiset, etwa ins Erzgebirge.
Nun bitte ich noch um einige Gefälligkeiten. Ich will meine Kollegia in Frankfurt bezahlen von dem Gelde, welches ich den 1. Oktober von Dames empfangen soll.
| Madihn | 10 Rth. | Kalau | 10 Rth. | |
| und noch den Preis eines Buches, dessen Wert ich nicht kenne. | Mit Wünschen werde ich selbst sprechen. Grüße ihn gelegentlich. Auch Hüllmann. Überhaupt alle. | |||
| Huth | 15 Rth. | |||
| Hüllmann | 15 Rth. | |||
Sei ruhig. Adieu. H. K.
*
An das Stiftsfräulein Wilhelmine v. Zenge
Hochwürd. u. Hochwohlgeb. zu Frankfurt
Leipzig, den 30. August (und 1. September) 1800
Mein liebes Minchen. Erst will ich Dir das Notwendige, nämlich den Verlauf meiner Reise erzählen, und dann zusehen, ob mir noch zu andern vertraulichen Gedanken Zeit übrig bleibt. Woran ich aber zweifle; denn jetzt ist es 8 Uhr abends, und morgen früh 11 Uhr geht es schon wieder fort von hier. –
Am Abend vor meiner Abreise von Berlin schickte die Begerow zu uns, und ließ uns ersuchen zu ihr und der Löschbrandt zu kommen. (Du mußt wissen, daß die Löschbrandt mir ihre Ankunft in Berlin zuvor gemeldet und mich um meine Unterstützung gebeten hatte, welche ich ihr aber abschlagen mußte) Ich konnte für diesen Abend nicht, weil ich schon ganz ausgezogen und mit meinem Briefe an Dich beschäftigt war. Weil ich aber doch noch am andern Morgen zu Struensee gehen mußte, ehe ich abreisete, so beschloß ich auch meine Schwester noch einmal zu sehen. Doch höre, wie dies ablief.
Ganz wehmütig umarmte sie mich, mit der Äußerung, sie hätte nicht geglaubt mich noch einmal zu sehen. Ich verstand gleich den eigentlichen Sinn dieser Rede, und gegen Dich will ich ganz ohne Rückhalt sprechen, denn wir verstehen uns. Mit Tränen in den Augen sagte sie mir, meine ganze Familie, besonders Tante Massow, sei höchst unruhig, und alle fürchteten, ich würde nie wieder nach Frankfurt zurückkehren. So sehr mich dies auch innerlich schmerzte, so blieb ich doch anfänglich äußerlich ruhig, erzählte ihr, daß ich vom Minister angestellt sei, daß ich ja Tanten mein Wort gegeben und noch nie in meinem Leben ehrlos gehandelt hätte. Aber das alles half doch nur wenig. Sie versprach zwar, selbst ruhig zu sein und auch Tanten zu beruhigen; aber ich bin doch überzeugt, daß sie noch immer heimlich dasselbe Mißtrauen in mir hegt.
Und nun urteile selbst, Wilhelmine, welch ein abscheuliches Gerücht während meiner Abwesenheit in Frankfurt von mir ausgebreitet werden kann! Du und Ulrike, Ihr seid die beiden einzigen, die mich davor retten könnt. Ulrike hat mir einige vortreffliche Briefe geschrieben, von Dir hoffe ich das Beste. Auf Euch beide beruht mein ganzes Vertrauen. So lange Ihr beide ruhig und sicher seid, wird es die Welt auch sein. Wenn Ihr beide aber mir mißtrauet, dann freilich, dann hat die Verleumdung freien Spielraum, und mein Ruf wäre dahin. Meine baldige Rückkehr würde zwar dies alles wieder vernichten und meine Ehre wiederherstellen; aber ob ich zwei Menschen, die mich so tief entehrten, dann selbst noch würde ehren können, das ist es, was ich bezweifeln muß. – Aber ich fürchte das nicht. – Wenn ich nur bald einen Brief von Dir erhalten könnte, um zu erfahren, wie Du meine Erklärung, daß ich nach Wien reisen würde, aufgenommen hast. – Aber ich hoffe, gut. – Doch höre weiter.
Ich reisete den 28. früh 11 Uhr mit Brokes in Begleitung Carls von Berlin ab nach Potsdam. Als ich vor Linkersdorfs Hause vorbeifuhr, ward es mir im Busen so warm. Jeder Gegenstand in dieser Gegend weckte irgendwo in meiner Seele einen tiefen Eindruck wieder auf. Ich betrachtete genau alle Fenstern des großen Hauses, aber ich wußte im voraus, daß die ganze Familie verreiset war. Wie erstaunte ich nun, wie froh erstaunte ich, als ich in jenem niedrig-dunkeln Zimmer, zu welchem ich des Abends so oft geschlichen war, Louisen entdeckte. Ich grüßte sie tief. Sie erkannte mich gleich, und dankte mir sehr, sehr freundlich. Mir strömten eine Menge von Erinnerungen zu. Ich mußte einigemal nach dem einst so lieben Mädchen wieder umsehen. Mir ward ganz seltsam zu Mute. Der Anblick dieses Mädchen, das mir einst so teuer war, und dieses Zimmer, in welchem ich so viele Freude empfunden hatte – – – Sei ruhig. Ich dachte an Dich und an die Gartenlaube, noch ein Augenblick, und ich gehörte wieder ganz Dir.
In Potsdam wohnten wir bei Leopolden. Ich sprach einiges Notwendige mit Rühlen wegen unseres Aufenthaltes in Berlin. Dies war die eigentliche Absicht unseres Verweilens in Potsdam. Rühle hat bereits um seinen Abschied angehalten und hofft ihn noch vor dem Winter zu erhalten. Weil noch vor Einbruch der Nacht einige Zeit übrig war, so nutzten wir diese Brockes flüchtig durch Sanssouci zu führen. Am andern Morgen früh 4 Uhr fuhr ich und Brokes wieder ab.
Die Reise ging durch die Mark – – also gibt es davon nichts Interessantes zu erzählen. Wir fuhren über Treuenbritzen nach Wittenberg und fanden, als wir auf der sächsischen Grenze das Auge einigemal zurück auf unser Vaterland warfen, daß dieses sich immer besser ausnahm, je weiter wir uns davon entfernten. Nichts als der Gedanke, mein liebstes Wesen darin zurückzulassen, machte mir die Trennung davon schwer.
In Wittenberg wäre manches Interessante zu sehen gewesen, z. B. Doktor Luthers und Melanchthons Grabmale. Auch wäre von hier aus die Fahrt an der Elbe entlang nach Dresden sehr schön gewesen, Aber das Vergnügen ist diesmal nicht Zweck unsrer Reise, und ohne uns aufzuhalten, fuhren wir gleich weiter, die Nacht durch nach Leipzig (über Düben).
Hier kamen wir den 30. (heute) früh um 11 Uhr an. Unser erstes Geschäft war, uns unter unsern neuen Namen in die Akademie inskribieren zu lassen, und wir erhielten die Matrikeln, welche uns zu Pässen verhelfen sollen, ohne alle Schwierigkeit. Weil aber die Post erst morgen abgeht, so blieb uns der Nachmittag noch übrig, den wir benutzten, die schönen öffentlichen Anlagen rund um diese Stadt zu besehen. Gegen Abend gingen wir beide ins Schauspiel, nicht um des erbärmlichen Stückes Abällino willen, sondern um die Akteurs kennen zu lernen, die hier sehr gelobt wurden. Aber wir fanden auch eine so erbärmliche Vorstellung, und dabei ein so ungesittetes Publikum, daß ich wenigstens schon im 2. Akt das Haus verließ. Ich ging zu Hause um Dir zu schreiben und erfülle jetzt in diesem Augenblick mein Versprechen und meine Pflicht. Aber ich bin von der durchwachten Nacht so ermüdet und daher, wie Du auch an diesem schlechten Briefe merken wirst, so wenig aufgelegt zum Schreiben, daß ich hier abbrechen muß, um mich zu Bette zu legen. Gute Nacht, liebes Mädchen. Morgen will ich mehr schreiben und vielleicht auch etwas Besseres. Gute Nacht.
den 1. September
Diesesmal empfange ich auf meiner Reise wenig Vergnügen durch die Reise. Zuerst ist das Wetter meistens immer schlecht, auch war die Gegend bisher nicht sonderlich, und wo es doch etwas Seltneres zu sehen gibt, da müssen wir, unser Ziel im Auge, schnell vorbeirollen. Wenn ich doch zuweilen vergnügt bin, so bin ich es nur durch die Erinnerung an Dich. Vorgestern auf der Reise, als die Nacht einbrach, lag ich mit dem Rücken auf dem Stroh unsers Korbwagens, und blickte grade hinauf in das unermeßliche Weltall. Der Himmel war malerisch schön. Zerrissene Wolken, bald ganz dunkel, bald hell vom Monde erleuchtet, zogen über mich weg. Brokes und ich, wir suchten beide und fanden Ähnlichkeiten in den Formen des Gewölks, er die seinigen, ich die meinigen. Wir empfanden den feinen Regen nicht, der von oben herab uns die Gesichter sanft benetzte. Endlich ward es mir doch zu arg und ich deckte mir den Mantel über den Kopf. Da stand die geliebte Form, die mir das Gewölk gezeigt hatte, ganz deutlich, mit allen Umrissen und Farben im engen Dunkel vor mir. Ich habe mir Dich in diesem Augenblick ganz lebhaft und gewiß vollkommen wahr, vorgestellt, und bin überzeugt, daß an dieser Vorstellung nichts fehlte, nichts an Dir selbst, nichts an Deinem Anzuge, nicht das goldne Kreuz, und seine Lage, nicht der harte Reifen, der mich so oft erzürnte, selbst nicht das bräunliche Mal in der weichen Mitte Deines rechten Armes. Tausendmal habe ich es geküßt und Dich selbst. Dann drückte ich Dich an meine Brust und schlief in Deinen Armen ein. –
Du hast mir in Deinem vorigen Briefe geschrieben, Dein angefangner Aufsatz sei bald fertig. Schicke ihn mir nach Wien, sobald er vollendet ist. Du hast noch viele Fragen von mir unbeantwortet gelassen und sie werden Dir Stoff genug geben, wenn Du nur denken und schreiben willst.
Unser Reiseplan hat sich verändert. Wir gehen nicht über Regensburg, sondern über Dresden und Prag nach Wien. Dieser Weg ist näher und in Dresden finden wir auch einen englischen Gesandten, der uns Pässe geben kann. Ich werde Dir von Dresden aus wieder schreiben.
| Empfangen | Abgeschickt |
| 2 Briefe | den 1. aus Berlin 2. aus Pasewalk 3. aus Berlin 4. aus Berlin und diesen aus Leipzig. |
Lebe wohl, liebes Mädchen. Ich muß noch einige Geschäfte abtun. In zwei Stunden reise ich ab nach Dresden.
Dein treuer Freund Heinrich
124 563
Klingstedt
N. S. Was wird Kleist sagen, wenn er einst bei Dir Briefe von Klingstedt finden wird?
————
Mein Geschäft ist abgetan und weil noch ein Stündchen Zeit übrig ist, ehe die Post abgeht, so nutze ich es, wie ich am besten kann, und plaudre mit Dir.
Ich will Dir umständlicher die Geschichte unsrer Immatrikulation erzählen.
Wir gingen zu dem Magnifikus, Prof. Wenk, eröffneten ihm wir wären aus der Insel Rügen, wollten kommenden Winter auf der hiesigen Universität zubringen; vorher aber noch eine Reise ins Erzgebirge machen und wünschten daher jetzt gleich Matrikeln zu erhalten. Er fragte nach unsern Vätern. Brokes Vater war ein Amtmann, meiner ein invalider schwedischer Kapitän. Er machte weiter keine Schwierigkeiten, las uns die akademischen Gesetze vor, gab sie uns gedruckt, streute viele weise Ermahnungen ein, überlieferte uns dann die Matrikeln und entließ uns in Gnaden. Wir gingen zu Hause, bestellten Post, wickelten unsre Schuhe und Stiefeln in die akademischen Gesetze und hoben sorgsam die Matrikeln auf.
Nimm doch eine Landkarte zur Hand, damit Du im Geiste den Freund immer verfolgen kannst. Ich breite, so oft ich ein Stündchen Ruhe habe, immer meine Postkarte vor mir aus, reise zurück nach Frankfurt, und suche Dich auf des Morgens an Deinem Fenster in der Hinterstube, Nachmittags an dem Fenster des unteren Saales, gegen Abend in der dunkeln Laube, und wenn es Mitternacht ist in Deinem Lager, das ich nur einmal flüchtig gesehen habe, und das daher meine Phantasie nach ihrer freiesten Willkür sich ausmalt.
Liebes Mädchen, ich küsse Dich – – Adieu. Ich muß zusiegeln. Ich habe auch an Tante und Ulrike geschrieben.
Dein Heinrich.
*
An Fräulein Wilhelmine von Zenge Hochwohlgeb. zu Frankfurt a. d. O.
Dresden, den 3. September 1800, früh 5 Uhr
(und 4. September)
Gestern, den 2. September spät um 10 Uhr abends traf ich nach einer 34stündigen Reise in diese Stadt ein.
Noch habe ich nichts von ihr gesehen, nicht sie selbst, nicht ihre Lage, nicht den Strom, der sie durchschneidet, nicht die Höhen, die sie umkränzen; und wenn ich schreibe, daß ich in Dresden bin, so glaube ich das bloß, noch weiß ich es nicht.
Und freilich – es wäre wohl der Mühe wert, sich davon zu überzeugen. Der Morgen ist schön. Lange wird mein Aufenthalt hier nicht währen. Vielleicht muß ich es morgen schon wieder verlassen. Morgen? das schöne Dresden? Ohne es gesehen zu haben? Rasch ein Spaziergang –
Nein – und wenn ich es nie sehen sollte! Ich könnte Dir dann vielleicht von hier gar nicht schreiben, und so erfülle ich denn lieber jetzt gleich meine Pflicht.
Ich will durch diese immer wiederholten Briefe, durch diese fast ununterbrochene Unterhaltung mit Dir, durch diese nie ermüdende Sorgfalt für Deine Ruhe, bewirken, daß Du zuweilen, wenn das Verhältnis des Augenblicks Dich beklommen macht, wenn fremde Zweifel und fremdes Mißtrauen Dich beunruhigen, mit Sicherheit, mit Zuversicht, mit tiefempfundnem Bewußtsein zu Dir selbst sagen mögest: ja, es ist gewiß, es ist gewiß, daß er mich liebt!
Wenn Du mir nur eine Ahndung von Zweifel hättest erblicken lassen, gewiß, mir würde Deine Ruhe weniger am Herzen liegen. Aber da Du Dich mit Deiner ganzen offnen Seele mir anvertraut hast, so will ich jede Gelegenheit benutzen, jeden Augenblick ergreifen, um Dir zu zeigen, daß ich Dein Vertrauen auch vollkommen verdiene.
Darum ordne ich auch jetzt das Vergnügen, diese schöne Stadt zu sehen, meiner Pflicht, Dir Nachricht von mir zu geben, unter; oder eigentlich vertausche ich nur jenes Vergnügen mit einem andern, wobei mein Herz und mein Gefühl noch mehr genießt.
Mein Aufenthalt wird hier wahrscheinlich nur von sehr kurzer Dauer sein. Soeben geht die Post nach Prag ab und in 8 Tagen nicht wieder. Uns bleibt also nichts übrig als Extrapost zu nehmen, sobald unsre Geschäfte bei dem englischen Gesandten abgetan sind. Daher will ich Dir so kurz als möglich den Verlauf meiner Reise von Leipzig nach Dresden mitteilen.
Als wir von Leipzig abreiseten (mittags d. 1. September), hatten wir unser gewöhnliches Schicksal, schlechtes Wetter. Wir empfanden es auf dem offnen Postwagen doppelt unangenehm. Die Gegend schien fruchtbar und blühend, aber die Sonne war hinter einen Schleier von Regenwolken versteckt und wenn die Könige trauern, so trauert auch das Land.
So kamen wir über immer noch ziemlich flachen Lande gegen Abend, nach Grimma. Als es schon finster war, fuhren wir wieder ab. Denke Dir unser Erstaunen, als wir uns dicht vor den Toren dieser Stadt, plötzlich in der Mitte eines Gebirges sahen. Dicht vor uns lag eine Landschaft, ganz wie ein transparentes Stück. Wir fuhren auf einem schauerlich schönen Wege, der auf der halben Höhe eines Felsens in Stein gehauen war. Rechts der steile Felsen selbst, mit überhangendem Gebüsch, links der schroffe Abgrund, der den Lauf der Mulde beugt, jenseits des reißenden Stromes dunkelschwarze hohe belaubte Felsen, über welche in einem ganz erheiterten Himmel der Mond heraufstieg. Um das Stück zu vollenden lag vor uns, am Ufer der Mulde, auf einem einzelnen hohen Felsen, ein zweistockhohes viereckiges Haus, dessen Fenster sämtlich, wie absichtlich, erleuchtet waren. Wir konnten nicht erfahren, was diese seltsame Anstalt zu bedeuten habe, und fuhren, immer mit hochgehobnen Augen, daran vorbei, sinnend und forschend, wie man bei einem Feenschlosse vorbeigeht.
So reizend war der Eingang in eine reizende Nacht. Der Weg ging immer am Ufer der Mulde entlang, bei Felsen vorbei, die wie Nachtgestalten vom Monde erleuchtet waren. Der Himmel war durchaus heiter, der Mond voll, die Luft rein, das Ganze herrlich. Kein Schlaf kam in den ersten Stunden auf meine Augen. Die Natur und meine brennende Pfeife erhielten mich wach. Mein Auge wich nicht vom Monde. Ich dachte an Dich, und suchte den Punkt im Monde, auf welchem vielleicht Dein Auge ruhte, und maß in Gedanken den Winkel den unsre Blicke im Monde machten, und träumte mich zurück auf der Linie Deines Blickes, um so Dich zu finden, bis ich Dich endlich wirklich im Traume fand.
Als ich erwachte waren wir in Waldheim, einem Städtchen, das wieder an der Mulde liegt. Besonders als wir es schon im Rücken hatten und das Gebirgsstädtchen hinter uns im niedrigen Tale lag, von buschigten Höhen umlagert, gab es eine reizende Ansicht. Wir fuhren nun immer an dem Fuße des Erzgebirges oder an seinem Vorgebirge entlang. Hin und wieder blickten nackte Granitblöcke aus den Hügeln hervor. Die ganze Gebirgsart ist aber Schiefer, welcher, wegen seiner geblätterten Tafeln, ein noch wilderes zerrisseneres Ansehn hat, als der Granit selbst. Die allgemeine Pflanze war die Harztanne; ein schöner Baum an sich, der ein gewisses ernstes Ansehn hat, der aber die Gegend auf welcher er steht meistens öde macht, vielleicht wegen seines dunkeln Grüns, oder wegen des tiefen Schweigens das in dem Schatten seines Laubes waltet. Denn es sind nur einige wenige, ganz kleine Vögelarten, die, außer Uhu und Eule, in diesem Baume nisten.
Ich ging an dem Ufer eines kleinen Waldbachs entlang. Ich lächelte über seine Eilfertigkeit, mit welcher er schwatzhaft und geschmeidig über die Steine hüpfte. Das ruht nicht eher, dachte ich, als bis es im Meere ist; und dann fängt es seinen Weg von vorn an. – Und doch – wenn es still steht, wie in dieser Pfütze, so verfault es und stinkt.
Wir fanden dieses Gebirge wie alle, sehr bebaut und bewohnt; lange Dörfer, alle Häuser 2 Stock hoch, meistens mit Ziegeln gedeckt; die Täler grün, fruchtbar, zu Gärten gebildet; die Menschen warm und herzlich, meistens schön gestaltet, besonders die Mädchen. Das Enge der Gebirge scheint überhaupt auf das Gefühl zu wirken und man findet darin viele Gefühlsphilosophen, Menschenfreunde, Freunde der Künste, besonders der Musik. Das Weite des platten Landes hingegen wirkt mehr auf den Verstand und hier findet man die Denker und Vielwisser. Ich möchte an einem Orte geboren sein, wo die Berge nicht zu eng, die Flächen nicht zu weit sind. Es ist mir lieb, daß hinter Deinem Hause die Laube eng und dunkel ist. Da lernt man fühlen, was man in den Hörsälen nur zu oft verlernt.
Aber überhaupt steht der Sachse auf einem höhern Grad der Kultur, als unsre Landleute. Du solltest einmal hören, mit welcher Gewandtheit ein solches sächsisches Mädchen auf Fragen antwortet. Unsre (maulfaulen) Brandenburgerinnen würden Stunden brauchen, um abzutun, was hier in Minuten abgetan wird. Auch findet man häufig selbst in den Dörfern Lauben, Gärten, Kegelbahnen etc. so, daß hier nicht bloß, wie bei uns, für das Bedürfnis gesorgt ist, sondern daß man schon einen Schritt weiter gerückt ist, und auch an das Vergnügen denkt.
Mittags (d. 2.) passierten wir Nossen und zum drittenmale die Mulde, die hier eine fast noch reizendere Ansicht bildet. Das östliche Ufer ist sanft abhangend, das westliche steil, felsig und buschig. Um die Kante eines Einschnittes liegt das Städtchen Nossen, auf einem Vorsprung, dicht an der Mulde, ein altes Schloß. Rechts öffnet sich die Aussicht durch das Muldetal nach den Ruinen des Klosters Zelle.
In diesem Kloster liegen seit uralten Zeiten die Leichname aller Markgrafen von Meißen. In neuern Zeiten hat man jedem derselben ein Monument geben wollen. Man hat daher die Skelette ausgegraben, und die Knochen eines jeden möglichst genau zusammengesucht, wobei es indessen immer noch zweifelhaft bleibt, ob jeder auch wirklich den Kopf bekommen hat, der ihm gehört.
Gegen Abend kamen wir über Wilsdruf, nach den Höhen von Kesselsdorf; ein Ort, der berühmt ist, weil in seiner Nähe ein Sieg erfochten worden ist. So kann man sich Ruhm erwerben in der Welt, ohne selbst das mindeste dazu beizutragen.
Es war schon ganz finster, als wir von den Elbhöhen herabfuhren, und im Mondschein die Türme von Dresden erblickten. Grade jener vorteilhafte Schleier lag über die Stadt, der uns, wie Wieland sagt, mehr erwarten läßt, als versteckt ist. Man führte uns durch enge Gassen, zwischen hohen meistens fünf- bis sechsstöckigen Häusern entlang bis in die Mitte der Stadt, und sagte uns vor der Post, daß wir am Ziele unsrer Reise wären. Es war ½11 Uhr. Aber da die Elbbrücke nicht weit war, so eilten wir schnell dahin, sahen rechts die Altstadt, im Dunkel, links die Neustadt, im Dunkel, im Hintergrunde die hohen Elbufer, im Dunkel, kurz alles in Dunkel gehüllt, und gingen zurück, mit dem Entschluß, wiederzukehren, sobald nur die große Lampe im Osten angesteckt sei.
————
Liebes Minchen. Soeben kommen wir von dem engl. Ambassadeur, Lord Elliot zurück, wo wir Dinge gehört haben, die uns bewegen, nicht nach Wien zu gehen, sondern entweder nach Würzburg oder nach Straßburg. Sei ruhig, und wenn das Herzchen unruhig wird, so lies die Instruktion durch, oder besieh Deine neue Tasse von oben und unten.
Diese Veränderung unseres Reiseplans hat ihre Schwierigkeiten, die jedoch nicht unüberwindlich sind; besonders wegen Deiner Briefe, die ich in Wien getroffen haben würde. Doch ich werde schon noch Mittel aussinnen, und sie Dir am Ende dieses Briefes mitteilen.
Übrigens bleibt alles beim alten. Ich gehe nicht weiter, als an einen dieser Orte, und kehre zu der einmal bestimmten Zeit, nämlich vor dem 1. November gewiß zurück, wenn nicht vielleicht noch früher.
Denke nicht darüber nach, und halte Dich, wenn die Unmöglichkeit, mich zu begreifen, Dich beunruhigt, mit blinder Zuversicht an Deinem Vertrauen zu meiner Redlichkeit, das Dich nicht täuschen wird, so wahr Gott über mich lebt.
Einst wirst Du alles erfahren, und mir mit Tränen danken.
Täglich werde ich Dir schreiben. Ich reise morgen von hier wieder ab, und werde Tag und Nacht nicht ruhen. Aber ein Stündchen werde ich doch erübrigen, Dir zu schreiben. Mehr kann ich jetzt für Deine Ruhe nicht tun, liebes, geliebtes Mädchen.
Abends um 8 Uhr
Ich habe den übrigen Teil des heutigen Tages dazu angewendet, einige Merkwürdigkeiten von Dresden zu sehen, und will Dir, was ich sah und dachte und fühlte, mitteilen.
Dresden hat enge Straßen, meistens 5 bis 6 Stock hohe Häuser, viel Leben und Tätigkeit, wenig Pracht und Geschmack. Die Elbbrücke ist ganz von Stein, aber nicht prächtig. Auf dem Zwinger (dem kurfürstl. Garten) findet man Pracht, aber ohne Geschmack. Das kurfürstliche Schloß selbst kann man kaum finden, so alt und rußig sieht es aus.
Wir gingen in die berühmte Bildergalerie. Aber wenn man nicht genau vorbereitet ist, so gafft man so etwas an, wie Kinder eine Puppe. Eigentlich habe ich daraus nicht mehr gelernt, als daß hier viel zu lernen sei.
Wir hatten den Nachmittag frei, und die Wahl, das grüne Gewölbe, Pilnitz, oder Tharandt zu sehen. In der Wahl zwischen Antiquität, Kunst und Natur wählten wir das letztere und sind nicht unzufrieden mit unsrer Wahl.
Der Weg nach Tharandt geht durch den schönen Plauenschen Grund. Man fährt an der Weißritz entlang, die dem Reisenden entgegen rauscht. Mehr Abwechselung wird man selten in einem Tale finden. Die Schlucht ist bald eng, bald breit, bald steil, bald flach, bald felsig, bald grün, bald ganz roh, bald auf das Fruchtbarste bebaut. So hat man das Ende der Fahrt erreicht, ehe man es wünscht. Aber man findet doch hier noch etwas Schöneres, als man es auf diesem ganzen Wege sah.
Man steigt auf einen Felsen nach der Ruine einer alten Ritterburg. Es war ein unglückseliger Einfall, die herabgefallenen Steine weg zu schaffen und den Pfad dahin zu bahnen. Dadurch hat das Ganze aufgehört eine Antiquität zu sein. Man will sich den Genuß erkaufen, »wärs auch mit einem Tropfen Schweißes nur«. Du bist mir noch einmal so lieb geworden, seitdem ich um Deinetwillen reise.
Aber die Natur hat zuviel getan, um mißvergnügt diesen Platz zu verlassen. Welch eine Fülle von Schönheit! Wahrlich, es war ein natürlicher Einfall, sich hier ein Haus zu bauen, denn ein schönerer Platz läßt sich schwerlich denken. Mitten im engen Gebirge hat man die Aussicht in drei reizende Täler. Wo sie sich kreuzen, steht ein Fels, auf ihm die alte Ruine. Von hier aus übersieht man das Ganze. An seinem Fuße, wie an den Felsen geklebt, hangen zerstreut die Häuser von Tharandt. Wasser sieht man in jedem Tale, grüne Ufer, waldige Hügel. Aber das schönste Tal ist das südwestliche. Da schäumt die Weißritz heran, durch schroffe Felsen, die Tannen und Birken tragen, schön gruppiert wie Federn auf den Köpfen der Mädchen. Dicht unter der Ruine bildet sie selbst ein natürliches Bassin, und wirft das verkehrte Bild der Gegend malerisch schön zurück.
Bei der Rückfahrt sah ich Dresden in der Ferne. Es liegt, vieltürmig, von der Elbe geteilt, in einem weiten Kessel von Bergen. Der Kessel ist fast zu weit. Unzählige Mengen von Häusern liegen so weit man sieht umher, wie vom Himmel herabgestreut. Die Stadt selbst sieht aus, als wenn sie von den Bergen herab zusammengekollert wäre. Wäre das Tal enger, so würde dies alles mehr konzentriert sein. Doch auch so ist es reizend.
Gute Nacht, liebes Mädchen. Es ist 10 Uhr, morgen früh muß ich Dir noch mehr schreiben und also früh aufstehen. Gute Nacht.
den 4. September, morgens 5 Uhr
Guten Morgen, Minchen. Ich bin gestern bei meiner Erzählung zu rasch über manchen interessanten Gegenstand hinweggegangen und ich will das heute noch nachholen.
In der Mitte des Plauenschen Grundes krümmt sich das Tal und bildet da einen tiefen Einschnitt. Die Weißritz stürzt sich gegen die Wand eines vorspringenden Felsens und will ihn gleichsam durchbohren. Aber der Felsen ist stärker, wankt nicht, und beugt ihren stürmischen Lauf.
Da hangt an dem Einschnitt des Tales, zwischen Felsen und Strom, ein Haus, eng und einfältig gebaut, wie für einen Weisen. Der hintere Felsen gibt dem Örtchen Sicherheit, Schatten winken ihm die überhangenden Zweige zu, Kühlung führt ihm die Welle der Weißritz entgegen. Höher hinauf in das Tal ist die Aussicht schauerlich, tiefer hinab in die Ebene von Dresden heiter. Die Weißritz trennt die Welt von diesem Örtchen und nur ein schmaler Steg führt in seinen Eingang. – Eng sagte ich, wäre das Häuschen? Ja freilich, für Assembleen und Redouten. Aber für 2 Menschen und die Liebe weit genug, weit hinlänglich genug.
Ich verlor mich in meinen Träumereien. Ich sah mir das Zimmer aus, wo ich wohnen würde, ein anderes, wo jemand anderes wohnen würde, ein drittes, wo wir beide wohnen würden. Ich sah eine Mutter auf der Treppe sitzen, ein Kind schlummernd an ihrem Busen. Im Hintergrunde kletterten Knaben an dem Felsen, und sprangen von Stein zu Stein, und jauchzten laut –
In dem reizenden Tale von Tharandt war ich unbeschreiblich bewegt. Ich wünschte recht mit Innigkeit Dich bei mir zu sehen. Solche Täler, eng und heimlich, sind das wahre Vaterland der Liebe. Da würden wir Freuden genossen haben, höhere noch als in der Gartenlaube. Und wie herrlich müßte einmal ein kurzes Leben in der idealischen Natur auf Deine Seele wirken. Denn tiefe Eindrücke macht der Anblick der erhabenen edlen Schöpfung auf weiche, empfängliche Herzen. Die Natur würde gewiß das Gefühl und den Gedanken in Dir erwecken; ich würde ihn zu entwickeln suchen und selbst neue Gedanken und Gefühle bilden. – O, einst müssen wir einmal beide eine schöne Gegend besuchen. Denn da erwarten uns ganz neue Freuden, die wir noch gar nicht kennen.
So erinnert mich fast jeder Gegenstand durch eine entfernte oder nahe Beziehung an Dich, mein liebes, geliebtes Mädchen. Und wenn mein Geist sich einmal in einer wissenschaftlichen Folgereihe von Gedanken von Dir entfernt, so führt mich ein Blick auf Deinen Tobaksbeutel, der immer an dem Knopfe meiner Weste hangt, oder auf Deine Handschuh, die ich selten ausziehe, oder auf das blaue Band, das Du mir um den linken Arm gewunden hast, und das immer noch, unaufgelöst, wie das Band unserer Liebe, verknüpft ist, wieder zu Dir zurück.
————
| Abgeschickt | Empfangen | ||||
| den | 1. | Brief aus | Berlin | Zwei Briefe, nur zwei, aber zwei herrliche, die ich mehr Berlin als einmal durchgelesen habe. Wann werde ich wieder etwas von Deiner Hand sehen? | |
| 2. | " | Pasewalk | |||
| 3. | " | Berlin | |||
| 4. | " | Berlin | |||
| 5. | " | Leipzig | |||
| und diesen aus Dresden. | |||||
Wegen der nun folgenden Instruktion will ich mich kurz fassen. Ich habe Ulriken das Nötige hierüber geschrieben und sie gebeten Dir ihren Brief mitzuteilen. Mache Du es mit Deinen Briefen, wie sie es mit dem Gelde machen soll. Schreibe gleich nach Würzburg in Franken. Sei ruhig. Lebe wohl. Morgen schreibe ich Dir wieder. In 5 Minuten reise ich von hier ab.
Dein treuer Freund Heinrich.
(Diese Korrespondenz wird Dir vieles Geld kosten. Ich werde das ändern, so viel es möglich ist. Was es Dir doch kostet, werde ich Dir schon einst ersetzen.)
*
An das Stiftsfräulein Wilhelmine von Zenge, Hochwürden und Hochwohlgb. zu Frankfurt a. d. Oder, frei bis Berlin. [Berlin abzugeben bei dem Kaufmann Clausius in der Münzstraße.]
Öderan im Erzgebirge, den 4. Septbr. 1800, abends 9 Uhr (und 5. September)
So heißt der Ort, der mich für diese Nacht empfängt. Er ist zwar von Dir nicht gekannt, aber er sorgt doch für Deine Wünsche wie für einen alten Freund. Denn er bietet mir ein Stübchen an, ganz wie das Deinige in Frankfurt; und ich werde nicht einschlafen, ohne tausendmal an Dich gedacht zu haben.
Unsere Reise ging von Dresden aus südwestlich, immer an dem Fuße des Erzgebirges entlang, über Freiberg nach Oederan. Die ganze Gegend sieht aus wie ein bewegtes Meer von Erde. Das sind nichts als Wogen, immer die eine kühner als die andern. Doch sahen wir noch nichts von dem eigentlichen Hochgebirge. Bei Freiberg gingen wir wieder über denselben Strom, den wir schon bei Nossen auf der Reise nach Dresden passiert waren; welches aber nicht die Mulde ist. In dem Tale dieses Flusses liegt das Bergwerk. Wir sahen es von weitem liegen und mich drängte die Begierde, es zu sehen. Aber mein Ziel trat mir vor Augen, und in einer halben Stunde hatte ich Freiberg schon wieder im Rücken.
Hier bin ich nun 6 Meilen von Dresden. Brokes wünscht hier zu übernachten, aus Gründen, die ich Dir in der Folge mitteilen werde. Ich benutzte noch die erste Viertelstunde, um Dir an einem Tage auch noch den zweiten Brief zu schreiben. Mein letzter Brief aus Dresden ist auch vom 4., von heute. Du sollst an Nachrichten von mir nicht Mangel haben. Aber diese Absicht ist nun erfüllt, und eigentlich bin ich herzlich müde. Also gute Nacht, liebes Mädchen. Morgen schreibe ich mehr.
Chemnitz, den 5. September, morgens 8 Uhr
Wie doch zwei Kräfte immer in dem Menschen sich streiten! Immer weiter von Dir führt mich die eine, die Pflicht, und die andere, die Neigung, strebt immer wieder zu Dir zurück. Aber die höhere Macht soll siegen, und sie wird es. Laß mich nur ruhig meinem Ziele entgegen gehen, Wilhelmine. Ich wandle auf einem guten Wege, das fühle ich an meinem heitern Selbstbewußtsein, an der Zufriedenheit, die mir das Innere durchwärmt. Wie würde ich sonst mit solcher Zuversicht zu Dir sprechen? Wie würde ich sonst Dich noch mit inniger Freude die Meinige nennen können? Wie würde ich die schöne Natur, die jetzt mich umgibt, so froh und ruhig genießen können? Ja, liebes Mädchen, das letzte ist entscheidend. Einsamkeit in der offnen Natur, das ist der Prüfstein des Gewissens. In Gesellschaften, auf den Straßen, in dem Schauspiele mag es schweigen, denn da wirken die Gegenstände nur auf den Verstand und bei ihnen braucht man kein Herz. Aber wenn man die weite, edlere, erhabenere Schöpfung vor sich sieht, – ja da braucht man ein Herz, da regt es sich unter der Brust und klopft an das Gewissen. Der erste Blick flog in die weite Natur, der zweite schlüpft heimlich in unser innerstes Bewußtsein. Finden wir uns selbst häßlich, uns allein in diesem Ideale von Schönheit, ja dann ist es vorbei mit der Ruhe, und weg ist Freude und Genuß. Da drückt es uns die Brust zusammen, wir können das Hohe und Göttliche nicht fassen, und wandeln stumpf und sinnlos wie Sklaven durch die Paläste ihrer Herren. Da ängstigt uns die Stille der Wälder, da schreckt uns das Geschwätz der Quelle, uns ist die Gegenwart Gottes zur Last, wir stürzen uns in das Gewühl der Menschen um uns selbst unter der Menge zu verlieren, und wünschen uns nie, nie wiederzufinden.
Wie froh bin ich, daß doch wenigstens ein Mensch in der Welt ist, der mich ganz versteht. Ohne Brokes würde mir vielleicht Heiterkeit, vielleicht selbst Kraft zu meinem Unternehmen fehlen. Denn ganz auf sein Selbstbewußtsein zurückgewiesen zu sein, nirgends ein paar Augen finden, die uns Beifall zuwinken – und doch recht tun, das soll freilich, sagt man, die Tugend der Helden sein. Aber wer weiß ob Christus am Kreuze getan haben würde, was er tat, wenn nicht aus dem Kreise wütender Verfolger seine Mutter und seine Jünger feuchte Blicke des Entzückens auf ihn geworfen hätten.
Die Post ist vor der Türe, adieu. Ich nehme diesen Brief noch mit mir. Er kömmt zwar immer weiter von Dir ab und später wirst Du ihn nun erhalten. Aber das Porto ist teuer, und wir beide müssen für ganzes Geld auch das ganze Vergnügen genießen.
Noch einen Gedanken – –. Warum, wirst Du sagen, warum spreche ich so geheimnisreiche Gedanken halb aus, die ich doch nicht ganz sagen will? Warum rede ich von Dingen, die Du nicht verstehn kannst und sollst? Liebes Mädchen, ich will es Dir sagen. Wenn ich so etwas schreibe, so denke ich mich immer zwei Monate älter. Wenn wir dann einmal, in der Gartenlaube, einsam, diese Briefe durchblättern werden, und ich Dir solche dunkeln Äußerungen erklären werde, und Du mit dem Ausruf des Erstaunens: ja so, so war das gemeint – –
Lungwitz, um ½11 Uhr
O welch ein herrliches Geschenk des Himmels ist ein schönes Vaterland! Wir sind durch ein einziges Tal gefahren, romantisch schön. Da ist Dorf an Dorf, Garten an Garten, herrlich bewässert, schöne Gruppen von Bäumen an den Ufern, alles wie eine englische Anlage. Jeder Bauerhof ist eine Landschaft. Reinlichkeit und Wohlstand blickt aus allem hervor. Man sieht aus dem Ganzen, daß auch der Knecht und die Magd hier das Leben genießen. Frohsinn und Wohlwollen spricht uns aus jedem Auge an. Die Mädchen sind zum Teil höchst interessant gebildet. Das findet man meistens in allen Gebirgen. Wahrlich, wenn ich Dich nicht hätte, und reich wäre, ich sagte à dieu à toutes les beautés des villes. Ich durchreisete die Gebirge, besonders die dunkeln Täler, spräche ein von Haus zu Haus, und wo ich ein blaues Auge unter dunkeln Augenwimpern, oder bräunliche Locken auf dem weißen Nacken fände, da wohnte ich ein Weilchen und sähe zu ob das Mädchen auch im Innern so schön sei, wie von außen. Wäre das, und wäre auch nur ein Fünkchen von Seele in ihr, ich nähme sie mit mir, sie auszubilden nach meinem Sinn. Denn das ist nun einmal mein Bedürfnis; und wäre ein Mädchen auch noch so vollkommen, ist sie fertig, so ist es nichts für mich. Ich selbst muß es mir formen und ausbilden, sonst fürchte ich, geht es mir, wie mit dem Mundstück an meiner Klarinette. Die kann man zu Dutzenden auf der Messe kaufen, aber wenn man sie braucht, so ist kein Ton rein. Da gab mir einst der Musikus Baer in Potsdam ein Stück, mit der Versicherung, das sei gut, er könne gut darauf spielen. Ja, er, das glaub ich. Aber mir gab es lauter falsche quiekende Töne an. Da schnitt ich mir von einem gesunden Rohre ein Stück ab, formte es nach meinen Lippen, schabte und kratzte mit dem Messer bis es in jeden Einschnitt meines Mundes paßte – – und das ging herrlich. Ich spielte nach Herzenslust. –
Zuweilen bin ich auf Augenblicke ganz vergnügt. Wenn ich so im offnen Wagen sitze, der Mantel gut geordnet, die Pfeife brennend, neben mir Brockes, tüchtige Pferde, guter Weg, und immer rechts und links die Erscheinungen wechseln, wie Bilder auf dem Tuche bei dem Guckkasten – und vor mir das schöne Ziel, und hinter mir das liebe Mädchen – – und in mir Zufriedenheit – dann, ja dann bin ich froh, recht herzlich froh.
Wenn Du einmal könntest so neben mir sitzen, zur Linken, Arm an Arm, Hand in Hand, immer Gedanken wechselnd und Gefühle, bald mit den Lippen, bald mit den Fingern – ja das würden schöne, süße herrliche Tage sein.
Was das Reisen hier schnell geht, das glaubst Du gar nicht. Oder ist es die Zeit, die so schnell verstreicht? Fünf Uhr war es als wir von Oederan abfuhren, jetzt ist es ½11, also in 5½ Stunde 4 Meilen. Jetzt geht es gleich weiter nach Zwickau. Wir fliegen wie die Vögel über die Länder. Aber dafür lernen wir auch nicht viel. Einige flüchtige Gedanken sind die ganze Ausbeute unsrer Reise.
Sind Sie in Dresden gewesen? – »Ja, durchgereist.« – Haben Sie das grüne Gewölbe gesehen? – »Nein.« – Das Schloß? – »Von außen.« – Königsstein? – »Von weitem.« – Pillnitz, Moritzburg? – »Gar nicht.« – Mein Gott, wie ist das möglich? – »Möglich? Mein Freund, das war notwendig.«
Weil wir eben von Dresden sprechen – da habe ich Dir einige Ansichten dieser Gegend mitgeschickt. So kannst Du Dir deutlicher denken, wo Dein Freund war. Bei Dresden, rechts, der grüne Vordergrund, das ist der Zwinger. Nein – Eigentlich der Turm, an den der grüne Berg und die grüne Allee stößt, das ist der Zwinger, d. h. der kurfürstliche Garten. Auf diesem grünen Berge stand ich und sah über die Elbbrücke. – Das Stück von Tharandt ist schlecht. Tausendmal schöner hat es die Natur gebildet, als dieser Pfuscher von Künstler. Übrigens kann es doch meine Beschreibung davon erklären. Der höchste Berg in der Mitte, wo die schönsten Sträucher stehen, da stand ich. Die Aussicht über den See ist die schönste. Die andern beiden sind hier versteckt. – Das dritte Stück: die Halsbrücke zu Freiberg kaufte ich ebenfalls zu Dresden in Hoffnung sie in natura zu sehen. Aber daraus ward nichts, nicht einmal von weitem.
Adieu, in der nächsten Station noch ein Wort, und dann wird der Brief zugesiegelt und abgeschickt.
Zwickau, 3 Uhr nachmittags
Jetzt habe ich das Schönste auf meiner ganzen bisherigen Reise gesehen, und ich will es Dir beschreiben.
Es war das Schloß Lichtenstein. Wir sahen von einem hohen Berge herab, rechts und links dunkle Tannen, ganz wie ein gewählter Vordergrund; zwischen durch eine Gegend, ganz wie ein geschlossnes Gemälde. In der Tiefe lag zur Rechten am Wasser das Gebirgsstädtchen; hinter ihm, ebenfalls zur Rechten, auf der Hälfte eines ganz buschigten Felsens, das alte Schloß Lichtenstein; hinter diesem, immer noch zur Rechten ein höchster Felsen, auf welchem ein Tempel steht. Aber zur Linken öffnet sich ein weites Feld, wie ein Teppich, von Dörfern, Gärten und Wäldern gewebt. Ganz im Hintergrunde ahndet das Auge blasse Gebirge und drüber hin, über die höchste matteste Linie der Berge, schimmert der bläuliche Himmel, der Himmel im Norden, der Himmel von Frankfurt, der Himmel, der mein liebes Minchen beleuchtet, und beschützen möge, bis ich es einst wieder in meine Arme drücke.
Ja, mein liebes Mädchen, das ist ein ganz andrer Stil von Gegend, als man in unserm traurigen märkischen Vaterlande sieht. Zwar ist das Tal, das die Oder ausspült, besonders bei Frankfurt sehr reizend. Aber das ist doch nur ein bloßes Miniatürgemälde. Hier sieht man die Natur gleichsam in Lebensgröße. Jenes ist gleichsam wie die Gelegenheitsstücke großer Künstler, flüchtig gezeichnet, nicht ohne meisterhafte Züge, aber ohne Vollendung; dieses hingegen ist ein Stück, mit Begeisterung gedichtet, mit Fleiß und Genie auf das Tableau geworfen, und aufgestellt vor der Welt mit der Zuversicht auf Bewunderung.
Dabei ist alles fruchtbar, selbst die höchsten Spitzen bebaut, und oft bis an die Hälfte des Berges, wie in der Schweiz, laufen saftgrüne Wiesen hinan. –
Aber nun muß ich den Brief zusiegeln. Adieu. Schreibe mir doch ob Vater und Mutter nicht nach mir gefragt haben; und in welcher Art. Aber sei ganz aufrichtig. Ich werde ihnen flüchtige Gedanken, die natürlich sind, nicht verdenken. Aber bleibe Du standhaft, und verlasse Dich darauf, daß ich diesmal besser für Dich, und also für Deine Eltern sorge, als je in meinem Leben.
Adieu – Oder soll ich Dir noch einmal schreiben von der nächsten Station? Soll ich? – Es ist 3 Uhr, um 6 sind wir in Reichenbach – ja es sei. – Aber für diesen Brief, für dieses Kunststück einen 8 Seiten langen Brief mitten auf einer ununterbrochenen Extrapost-Reise zu schreiben, dafür, sage ich, mußt Du mir auch bei der Rückkehr entweder – einen Kuß geben, oder mir ein neues Band in den Tobaksbeutel ziehen. Denn das alte ist abgerissen.
Aber nun will ich auch einmal etwas essen. Adieu. In Reichenbach mehr. –
Geschwind noch ein paar Worte. Der Postillion ist faul und langsam, ich bin fleißig und schnell. Das ist natürlich, denn er arbeitet für Geld, und ich für den Lohn der Liebe.
Aber geschwind – Ich bin in die sogenannte große Kirche gewesen, hier in Zwickau. Da gibt es manches zu sehen. Zuerst ist der Eindruck des Innern angenehm und erhebend. Ein weites Gewölbe wird von wenigen und doch schlanken Pfeilern getragen. Wir sehen es gern, wenn mit geringen Kräften ausgewirkt wird, was große zu erfordern scheint. Ferner war zu sehn ein Stück von Lucas Cranach, mit Meisterzügen, aber ohne Plan und Ordnung, wie die durchlöcherten und gefärbten Stücke, die an den Türen der Bauern, Soldaten und Bedienten hangen; doch das kennst Du nicht. Ferner war zu sehn, ein Modell des heiligen Grabes zu Jerusalem aus Holz geschnitzt etc. etc.
Dabei fällt mir eine Kirche ein, die ich Dir noch nicht beschrieben habe; die Nickolskirche zu Leipzig. Sie ist im Äußern, wie die Religion, die in ihr gepredigt wird, antik, im Innern nach dem modernsten Geschmack ausgebaut. Aus der Kühnheit der äußeren Wölbungen sprach uns der Götze der abenteuerlichen Goten zu; aus der edeln Simplizität des Innern wehte uns der Geist der verfeinerten Griechen an. Schade daß ein – – – ich hätte beinah etwas gesagt, was die Priester übelnehmen. Aber das weiß ich, daß die edeln Gestalten der leblosen Steine wärmer zu meinem Herzen sprachen, als der hochgelehrte Priester auf seiner Kanzel.
Reichenbach, abends 8 Uhr
Nur zwei Dinge möchte ich gewiß wissen, dann wollte ich mich leichter, über den Mangel aller Nachrichten von Dir trösten: erstens ob Du lebst, zweitens, ob Du mich liebst. Oder nur das erste; denn dies, hoffe ich, schließt bei Dir, wie bei mir, das andere ein. Aber am liebsten fast möchte ich wissen, ob Du ganz ruhig bist. Wenn Du nur damals an jenem Abend in der Gartenlaube nicht geweint hättest, als ich Dir einen doppelsinnigen Gedanken mitteilte, von dem Du gleich den übelsten Sinn auffaßtest. Aber Du versprachst mir Besserung, und wirst Dein Wort halten und vernünftig sein. Wie sollte es Dich einst reuen, Wilhelmine, wenn Du mit Beschämung, vielleicht in kurzem, einsähest, Deinem redlichsten Freunde mißtraut zu haben. Und wie wird es Dich dagegen mit innigem Entzücken erfüllen, wenn Du in wenigen Wochen, den Freund, dem Du alles vertrautest, und der Dich in nichts betrog, in die Arme schließen kannst.
Adieu, liebes Mädchen, jetzt schließe ich den Brief. In der nächsten Station fange ich einen andern Brief an. Es werden doch Zwischenräume von Tagen sein, ehe Du den folgenden Brief empfängst. Vielleicht empfängst Du sie auch alle auf einmal. – Aber was ich in der Nacht denken werde weiß ich nicht, denn es ist finster, und der Mond verhüllt. – Ich werde ein Gedicht machen. Und worauf? – Da fielen mir heute die Nadeln ins Auge, die ich einst in der Gartenlaube aufsuchte. Unaufhörlich lagen sie mir im Sinn. Ich werde in dieser Nacht ein Gedicht auf oder an eine Nadel machen. Adieu. Schlafe wohl, ich wache für Dich.
H. K.
N. S. Soeben höre ich, daß der Waffenstillstand zwischen Kaiserlichen und Franzosen morgen, den 6., aufhört. Wir reisen grade den Franzosen entgegen, und da wird es was Neues zu sehen geben. Wenn nur die Briefe nicht gehindert werden! Aber Briefe an Damen – die Franzosen sind artig – ich hoffe das Beste. Fürchte nichts für mich.
*
[Würzburg, 9. oder 10. September 1800]
[Der Anfang fehlt] – – – Werde ich nicht bald einen Brief von Dir erhalten? meine liebe, teure, einzige Freundin! – Wenn Du in so langer Zeit krank geworden sein solltest – wenn Du vielleicht gar nicht mehr wärst – o Gott! Dann wären alle Opfer, alle Bemühungen dieser Reise umsonst! Denn Liebe bedarf ich – und wo würde ich so viele Liebe wiederfinden? Für Dich tat ich, was ich nie für einen Menschen tat. – Du würdest mich inniger, treuer, zärtlicher, dankbarer, als irgend ein Mädchen geliebt haben. – O Gott! das wäre schrecklich! Schreibe, schreibe bald. Täglich besuche ich die Post. Bald muß ich Nachricht von Dir erhalten, oder meine so lange erhaltene Ruhe wankt. – Schreibe mir nur immer nach Würzburg. Ich bleibe hier, bis ich von Dir Nachricht erhalten habe, ich könnte sonst nicht ruhig weiter reisen. Vielleicht, ja wahrscheinlich reise ich auch gar nicht weiter. Adieu.
*
An das Stiftsfräulein Wilhelmine von Zenge Hochwürd. und Hochwohlgeb. zu Frankfurt a. d. Oder – frei bis Leipzig.
Würzburg, den 11. (und 12.) September 1800
Mein liebstes Herzensmädchen, o wenn ich Dir sagen dürfte, wie vergnügt ich bin – Doch das darf ich nicht. Sei Du auch vergnügt. Aber laß uns davon abbrechen. Bald, bald mehr davon.
Ich will Dir von etwas anderm vorplaudern.
Zuerst von dieser Stadt. Auch diese liegt ganz im Grunde, an einer Krümmung des Mains, von kahlen Höhen eingeschlossen, denen das Laub ganz fehlt und die von nichts grün schimmern, als von dem kurzen Weinstock. Beide Ufer des Mains sind mit Häusern bebaut. Nr. 1 in dem beigefügten – Gekritzel (denn Zeichnung kann man es nicht nennen) ist die Stadt auf dem rechten Mainufer, und wir kamen von dieser Seite, von dem Berge a herab in die Stadt. Nr. 2 ist die Stadt auf dem linken Mainufer, das sogenannte Mainviertel mit der Zitadelle. Das Ganze hat ein echt katholisches Ansehn. Neun und dreißig Türme zeigen an, daß hier ein Bischof wohne, wie ehemals die ägyptischen Pyramiden, daß hier ein König begraben sei. Die ganze Stadt wimmelt von Heiligen, Aposteln und Engeln, und wenn man durch die Straßen geht, so glaubt man, man wandle durch den Himmel der Christen. Aber die Täuschung dauert nicht lang. Denn Heere von Pfaffen und Mönchen, buntscheckig montiert, wie die Reichstruppen, laufen uns unaufhörlich entgegen und erinnern uns an die gemeinste Erde.
Den Lauf der Straßen hat der regelloseste Zufall gebildet. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Würzburg durch nichts, von der Anlage des gemeinsten Dorfes. Da hat sich jeder angebaut, wo es ihm grade gefiel, ohne eben auf den Nachbar viele Rücksicht zu nehmen. Daher findet man nichts als eine Zusammenstellung vieler einzelnen Häuser, und vermißt die Idee eines Ganzen, die Existenz eines allgemeinen Interesses. Oft ehe man es sich versieht ist man in ein Labyrinth von Gebäuden geraten, wo man sich den Faden der Ariadne wünschen muß, um sich heraus zu finden. Das alles könnte man der grauen Vorzeit noch verzeihen; aber wenn heutzutage ganz an der Stelle der alten Häuser neue gebaut werden, so daß also auch die Idee, die Stadt zu ordnen, nicht vorhanden ist, so heißt das ein Versehen verewigen.
Das bischöfliche Residenzschloß zeichnet sich unter den Häusern aus. Es ist lang und hoch. Schön kann man es wohl nicht nennen. Der Platz vor demselben ist heiter und angenehm. Er ist von beiden Seiten durch eine Kolonnade eingeschlossen, deren jede ein Obelisk ziert. – Die übrigen Häuser befriedigen bloß die gemeinsten Bedürfnisse. Nur zuweilen hebt sich über niedrige Dächer eine Kuppel, oder ein Kloster oder das höhere Dach eines Domherrn empor.
Keine der hiesigen Kirchen haben wir so schön gefunden, als die Kirche zu Eberach, die ich Dir in meinem vorigen Briefe beschrieb. Selbst der Dom ist nicht so geschmackvoll und nicht so prächtig. Aber alle diese Kirchen sind von früh morgens bis spät abends besucht. Das Läuten dauert unaufhörlich fort. Es ist als ob die Glocken sich selbst zu Grabe läuteten, denn wer weiß, ob die Franzosen sie nicht bald einschmelzen. Messen und Hora wechseln immer miteinander ab, und die Perlen der Rosenkränze sind in ewiger Bewegung. Denn es gilt die Rettung der Stadt, und da die Franzosen für ihren Untergang beten, so kommt es darauf an, wer am meisten betet.
Ich, mein liebes Kind, habe Ablaß auf 200 Tage. In einem Kloster auf dem Berge 2 bei b, hinter dem Zitadell, lag vor einem wundertätigen Marienbilde ein gedrucktes Gebet, mit der Ankündigung, daß wer es mit Andacht läse, diesen Ablaß haben sollte. Gelesen habe ich es; doch da es nicht mit der gehörigen Andacht geschah, so werde ich mich doch wohl vor Sünden hüten, und nach wie vor tun müssen, was recht ist.
Wenn man in eine solche katholische Kirche tritt, und das weitgebogene Gewölbe sieht, und diese Altäre und diese Gemälde – und diese versammelte Menschenmenge mit ihren Gebärden – wenn man diesen ganzen Zusammenfluß von Veranstaltungen, sinnend, betrachtet, so kann man gar nicht begreifen, wohin das alles führen solle. Bei uns erweckt doch die Rede des Priesters, oder ein Gellertsches Lied manchen herzerhebenden Gedanken; aber das ist hier bei dem Murmeln des Pfaffen, das niemand hört, und selbst niemand verstehen würde, wenn man es auch hörte, weil es lateinisch ist, nicht möglich. Ich bin überzeugt, daß alle diese Präparate nicht einen einzigen vernünftigen Gedanken erwecken.
Überhaupt, dünkt mich, alle Zeremonien ersticken das Gefühl. Sie beschäftigen unsern Verstand, aber das Herz bleibt tot. Die bloße Absicht, es zu erwärmen, ist, wenn sie sichtbar wird, hinreichend, es ganz zu erkalten. Mir wenigstens erfüllt eine Todeskälte das Herz, sobald ich weiß, daß man auf mein Gefühl gerechnet hat.
Daher mißglücken auch meist alle Vergnügungen, zu welchen große Anstalten nötig sind. Wie oft treten wir in Gesellschaften, in den Tanzsaal, ohne mehr zu finden, als die bloße Anstalt zur Freude, und treffen dagegen die Freude selbst oft da an, wo wir sie am wenigsten erwarteten.
Daher werde ich auch den schönsten Tag, den ich vor mir sehe, nicht nach der Weise der Menschen, sondern nach meiner Art zu feiern wissen.
Ich kehre zu meinem Gegenstande zurück. – Wenn die wundertätigen Marienbilder einigermaßen ihre Schuldigkeit tun, so muß in kurzem kein Franzose mehr leben. Wirksam sind sie, das merkt man an den wächsernen Kindern, Beinen, Armen, Fingern etc. etc. die um das Bild gehängt sind; die Zeichen der Wünsche, welche die heilige Mutter Gottes erfüllt hat. – In kurzem wird hier eine Prozession sein, zur Niederschlagung der Feinde, und, wie es heißt, »zur Ausrottung aller Ketzer«. Also auch zu Deiner und meiner Ausrottung –
Ich wende mich jetzt zu einer vernünftigen Anstalt, die ich mit mehrerem Vergnügen besucht habe, als diese Klöster und Kirchen.
Da hat ein Mönch die Zeit, die ihm Hora und Messe übrig ließen, zur Verfertigung eines seltnen Naturalien-Kabinetts angewendet. Ich weiß nicht gewiß, ob es ein Benediktinermönch ist, aber ich schließe es aus dieser nützlichen Anwendung seiner Zeit, indem die Mönche dieses Ordens immer die fleißigsten und arbeitsamsten gewesen sind.
Er ist Professor bei der hiesigen Universität und heißt Blank. Er hat, mit Unterstützung des jetzigen Fürstbischofs, eines Herrn von Fechenbach, eine sehenswürdige Galerie von Vögeln und Moosen in dem hiesigen Schlosse aufgestellt. Das Gefieder der Vögel ist, ohne die Haut, auf Pergament geklebt, und so vor der Nachstellung der Insekten ganz gesichert. – Verzeihe mir diese Umständlichkeit. Ich denke einst diese Papiere für mich zu nützen.
Schon der bloße Apparat ist sehenswürdig und erfordert einen fast beispiellosen Fleiß. Da sind in vielen Gläsern, in besondern Fächern und Schränken, Gefieder aller Art, Häute, Holzspäne, Blätter, Moose, Samenstaub, Spinngewebe, Schilfe, Wolle, Schmetterlingsflügel etc. etc. in der größten Ordnung aufgestellt.
Aber dieser Vorrat von bunten Materialien hat den Mann auf eine Spielerei geführt. Er ist weiter gegangen, als bloß seine nützliche Galerie von Vögeln und Moosen zu vervollkommnen. Er hat mit allen diesen Materialien, ohne weiter irgend eine Farbe zu gebrauchen, gemalt, Landschaften, Blumenbuketts, Menschen etc. etc., oft täuschend ähnlich, das Wasser mit Wolle, das Laub mit Moose, die Erde mit Samenstaub, den Himmel mit Spinngewebe, und immer mit der genausten Abwechselung des Lichtes und des Schattens. – Die besten von allen diesen Stücken waren aber, aus Furcht vor den Franzosen, weggeschickt. –
+ Ich werde Dir in der Folge sagen, was das bedeutet.
den 12. September
Was Dir das hier für ein Leben auf den Straßen ist, aus Furcht vor den Franzosen, das ist unbeschreiblich. Bald Flüchtende, bald Pfaffen, bald Reichstruppen, das läuft alles buntscheckig durcheinander, und fragt und antwortet, und erzählt Neuigkeiten, die in 2 Stunden für falsch erklärt werden.
Der hiesige Kommandant, General D'Allaglio, soll wirklich im Ernst diese Festung behaupten wollen. Aber sei ruhig. Es gilt bloß die Zitadelle, nicht die Stadt. Auch diese ist zwar befestigt, aber sie liegt ganz in der Tiefe, ist ganz unhaltbar, und für sie, sagt man, sei schon eine Kapitulation im Werke. Nach meiner Einsicht ist aber die Zitadelle ebenso unhaltbar. Sie ist nach der Befestigungskunst des Mittelalters erbaut, das heißt, schlecht. Es war eine unglückliche Idee hier eine Festung anzulegen. Aber ursprünglich scheint es eine alte Burg zu sein, die nur nach und nach erweitert worden ist. Schon die Lage ist ganz unvorteilhaft, denn in der Nähe eines Flintenschusses liegt ein weit höherer Berg, der den Felsen der Zitadelle ganz beherrscht. Man will sich indessen in die Kasematten flüchten, und der Kommandant soll geäußert haben, er wolle sich halten, bis ihm das Schnupftuch in der Tasche brennt. Wenn er klug ist, so zündet er es sich selbst an, und rettet so sein Wort und sein Leben. Indessen ist wirklich die Zitadelle mit Proviant auf 3 Monate versehn. Auch soll viel Geschütz oben sein – doch das alles soll nur sein, hinauf auf das Zitadell darf keiner. Viele Schießscharten sind da, das ist wahr, aber das sind vielleicht bloße Metonymien.
Besonders des Abends auf der Brücke ist ein ewiges Laufen hinüber und herüber. Da stehn wir denn in einer Nische, Brokes und ich, und machen Glossen, und sehen es diesem oder jenem an, ob er seinen Wein in Sicherheit hat, ob er sich vor der Säkularisation fürchtet oder ob er den Franzosen freundlich ein Glas Wein vorsetzen wird. Die meisten, wenigstens von den Bürgern scheinen die letzte Partie ergreifen zu wollen. Das muß man ihnen aber abmerken, denn durch die Rede erfährt man von ihnen nichts. Du glaubst nicht, welche Stille in allen öffentlichen Häusern herrscht. Jeder kommt hin, um etwas zu erfahren, niemand, um etwas mitzuteilen. Es scheint als ob jeder erst abwarten wollte, wie man ihm kommt, um dann dem andern ebenso zu kommen. Aber das ist eben das Eigentümliche der katholischen Städte. Da hängt man den Mantel, wie der Wind kommt.
Soeben erfahre ich die gewisse Nachricht, daß der Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit verlängert ist, also schließe ich diesen Brief, damit Du so frühe als möglich diese frohe Nachricht erhältst, die unsre Wünsche reifen soll. Adieu. Bleibe mir treu. Bald ein mehreres. Dein Freund Heinrich.
*
Ihro Hochwohlgeborn und Hochwürden dem Stiftsfräulein Wilhelmine von Zenge in Frankfurt an der Oder – frei bis Berlin [Duderstädt]
Würzburg, den 13. (–18.) September 1800
Mädchen! Wie glücklich wirst Du sein! Und ich! Wie wirst Du an meinem Halse weinen, heiße innige Freudentränen! Wie wirst Du mir mit Deiner ganzen Seele danken! – Doch still! Noch ist nichts ganz entschieden, aber – der Würfel liegt, und, wenn ich recht sehe, wenn nicht alles mich täuscht, so stehen die Augen gut. Sei ruhig. In wenigen Tagen kommt ein froher Brief an Dich, ein Brief, Wilhelmine, der – – Doch ich soll ja nicht reden, und so will ich denn noch schweigen auf diese wenigen Tage. Nur diese gewisse Nachricht will ich Dir mitteilen: ich gehe von hier nicht weiter nach Straßburg, sondern bleibe in Würzburg. Eher als Du glaubst, bin ich wieder bei Dir in Frankfurt. Küsse mich, Mädchen, denn ich verdiene es.
Laß uns tun, als ob wir nichts Interessanteres mit einander zu plaudern hätten, als fremdartige Dinge. Denn das, was mir die ganze Seele erfüllt, darf ich Dir nicht, jetzt noch nicht, mitteilen.
Also wieder etwas von dieser Stadt.
————
Eine der vortrefflichsten Anstalten, die je ein Mönch hervorbrachte, ist wohl das hiesige Julius-Hospital, vom Fürstbischof Julius, im 16. Jahrhundert gestiftet, von dem vorletzten Fürstbischof Ludwig um mehr als das Ganze erweitert, veredelt und verbessert. Das Stammgebäude schon ist ein Haus, wie ein Schloß; aber nun sind noch, in ähnlicher Form, Häuser hinzugebaut worden, so daß die vordere Fassade 63 Fenster hat, und das Ganze ein geschloßnes Viereck bildet. Im innern Hofe ist ein großer Brunnen angelegt, hinten befindet sich ein vortrefflicher botanischer Garten, Badehäuser, ein anatomisches Theater und ein medizinisch-chirurgisches Auditorium.
Das Ganze ist ein Produkt der wärmsten Menschenliebe. Jedes Gebrechen gibt, wenn es ganz arm ist, ein Recht auf unbedingte kostfreie Aufnahme in diesem Hause. Die Wiederhergestellten und Geheilten müssen es wieder verlassen, die Unheilbaren und das graue Alter findet Nahrung, Kleidung und Obdach bis ans Ende des Lebens. Denn nur auf gänzliche Hülflosigkeit ist diese Anstalt berechnet, und wer noch auf irgend eine Art sich selbst helfen kann, der findet hier keinen Platz, weil er ihn einem Unglücklichern, Hülfsbedürftigern nehmen würde.
Dabei ist es besonders bemerkenswürdig und lobenswert, daß die religiöse Toleranz, die nirgends in diesem ganzen Hochstift anzutreffen ist, grade hier in diesem Spital, wo sie so nötig war, Platz gefunden hat, und daß jeder Unglückliche seine Zuflucht findet in dieser katholischen Anstalt, wäre es auch ein Protestant oder ein Jude.
Das Innere des Gebäudes soll sehr zweckmäßig eingerichtet sein. Ordnung wenigstens und Plan habe ich darin gefunden. Da beherbergt jedes Gebäude eine eigne Art von Kranken, entweder die medizinische oder chirurgische, und jeder Flügel wieder ein eignes Geschlecht, die männlichen oder die weiblichen. Dann ist ein besonderes Haus für Unheilbare, eines für das schwache Alter, eines für die Epileptischen, eines für die Verrückten etc. Der Garten steht jedem Gesitteten offen. Es wird in großen Sälen gespeiset. Eine recht geschmackvolle Kirche versammelt täglich die Frommen. Sogar die Verrückten haben da ihren vergitterten Platz.
Bei den Verrückten sahen wir manches Ekelhafte, manches Lächerliche, viel Unterrichtendes und Bemitleidenswertes. Ein paar Menschen lagen übereinander, wie Klötze, ganz unempfindlich, und man sollte fast zweifeln, ob sie Menschen zu nennen wären. Dagegen kam uns munter und lustig ein überstudierter Professor entgegen, und fing an, uns auf lateinisch zu harangieren, und fragte so schnell und flüchtig und sprach dabei ein so richtiges, zusammenhangendes Latein, daß wir im Ernste verlegen wurden um die Antwort, wie vor einem gescheuten Manne. In einer Zelle saß, schwarz gekleidet, mit einem tiefsinnigen, höchst ernsten und düstern Blick, ein Mönch. Langsam schlug er die Augen auf uns, und es schien, als ob er unser Innerstes erwog. Dann fing er, mit einer schwachen, aber doch tönenden und das Herz zermalmenden Stimme an, uns vor der Freude zu warnen und an das ewige Leben und an das heilige Gebet uns zu erinnern. Wir antworteten nicht. Er sprach in großen Pausen. Zuweilen blickte er uns wehmütig an, als ob er uns doch für verloren hielte. Er hatte sich einst auf der Kanzel in einer Predigt versprochen und glaubte von dieser Zeit an, er habe das Wort Gottes verfälscht. Von diesem gingen wir zu einem Kaufmann, der aus Verdruß und Stolz verrückt geworden war, weil sein Vater das Adelsdiplom erhalten hatte, ohne daß es auf den Sohn forterbte. Aber am Schrecklichsten war der Anblick eines Wesens, den ein unnatürliches Laster wahnsinnig gemacht hatte – Ein 18jähriger Jüngling, der noch vor kurzem blühend schön gewesen sein soll und noch Spuren davon an sich trug, hing da über die unreinliche Öffnung, mit nackten, blassen, ausgedorrten Gliedern, mit eingesenkter Brust, kraftlos niederhangendem Haupte – Eine Röte, matt und geädert, wie eines Schwindsüchtigen, war ihm über das totenweiße Antlitz gehaucht, kraftlos fiel ihm das Augenlid auf das sterbende, erlöschende Auge, wenige saftlose Greisenhaare deckten das frühgebleichte Haupt, trocken, durstig, lechzend hing ihm die Zunge über die blasse, eingeschrumpfte Lippe, eingewunden und eingenäht lagen ihm die Hände auf dem Rücken – er hatte nicht das Vermögen die Zunge zur Rede zu bewegen, kaum die Kraft den stechenden Atem zu schöpfen – nicht verrückt waren seine Gehirnsnerven aber matt, ganz entkräftet, nicht fähig seiner Seele zu gehorchen, sein ganzes Leben nichts als eine einzige, lähmende, ewige Ohnmacht – O lieber tausend Tode, als ein einziges Leben wie dieses! So schrecklich rächt die Natur den Frevel gegen ihren eignen Willen! O weg mit diesem fürchterlichem Bilde –
Nicht ohne Rührung und Ehrfurcht wandelt man durch die Hallen dieses weiten Gebäudes, wenn man alle diese großen, mühsamen, kostspieligen Anstalten betrachtet, wenn man die Opfer erwägt, die sie dem Stifter und den Unterhaltern kostet. Die bloße Erhaltung der ganzen Anstalt beträgt jährlich 60 000 fl. Damit ist zugleich eine Art von chirurgischer Pepiniere verknüpft, so daß bei dem Hospital selbst die künftigen Ärzte desselben gebildet werden. Lehrer sind die praktischen Ärzte, wie Seybold, Brünningshausen etc.
Aber wenn man an den Nutzen denkt, den diese Anstalt bringt, wenn man fragt, ob mit so großen Aufopferungen auf einem minder in die Augen fallenden Wege nicht noch weit mehr auszurichten sein würde, so hört man auf, diese an sich treffliche Anstalt zu bewundern, und fängt an, zu wünschen, daß das ganze Haus lieber gar nicht da sein möchte. Weit inniger greift man in das Interesse des hülflosen Kranken ein, wenn man ihn in seinem Hause, mit Heilung, Kleidung, Nahrung, oder statt der beiden letzten Dinge mit Geld unterstützt. Ihn erfreut doch der stolze Palast und der königliche Garten nicht, der ihn immer an seine demütigende Lage, an die Wohltat, die er nie abtragen kann erinnert; aller dieser Anschein von Pracht wird schwerlich mehr, als den Kranken und sein Gefühl durch den bittern Kontrast mit seinem Elende noch mehr drücken. Es liegt eine Art von Spott darin, erst ganz hilflos werden zu müssen um königlich zu wohnen – – Eigentlich weiß ich mich nicht recht auszudrücken. Aber ich bin gewiß, daß gute, stille, leidende Menschen weit lieber im Stillen Wohltaten annehmen, als sie hier mit prahlerischer Publizität zu empfangen. Auch würde wirklich jedem Kranken leichter geholfen werden, als hier, wo bei dem Zusammenfluß so vieles Elendes Herz und Mut sinken. Besonders die Verrückten können in ihrer eignen Gesellschaft nie zu gesundem Verstande kommen. Dagegen würde dies gewiß bei vielen möglich sein, wenn mehrere vernünftige Leute, etwa die eigne Familie, unter der Leitung eines Arztes, sich bemühte den Unglücklichen zur Vernunft zurückzuführen. Man könnte einwerfen, daß dies alles mehrere Kosten noch verursachen würde, aber man bedenke nur daß die bloße Einrichtung dieser Anstalt Millionen kostet, und daß dies alles dann nicht nötig wäre. – Indessen so viel ist freilich wahr, daß die ganze Wohltat dann nicht so viel Ansehen hätte. Daß doch immer auch Schatten sich zeigt, wo Licht ist!
den 14. September
Nirgends kann man den Grad der Kultur einer Stadt und überhaupt den Geist ihres herrschenden Geschmacks schneller und doch zugleich richtiger kennen lernen, als – in den Lesebibliotheken.
Höre was ich darin fand, und ich werde Dir ferner nichts mehr über den Ton von Würzburg zu sagen brauchen.
»Wir wünschen ein paar gute Bücher zu haben.« – Hier steht die Sammlung zu Befehl. – »Etwa von Wieland.« – Ich zweifle fast. – »Oder von Schiller, Goethe.« – Die möchten hier schwerlich zu finden sein. – »Wie! Sind alle diese Bücher vergriffen? Wird hier so stark gelesen?« – Das eben nicht. – »Wer liest denn hier eigentlich am meisten?« – Juristen, Kaufleute und verheiratete Damen. – »Und die unverheirateten?« – Sie dürfen keine fordern. – »Und die Studenten?« – Wir haben Befehl ihnen keine zu geben. – »Aber sagen Sie uns, wenn so wenig gelesen wird, wo in aller Welt sind denn die Schriften Wielands, Goethes, Schillers?« – Halten zu Gnaden, diese Schriften werden hier gar nicht gelesen. – »Also Sie haben sie gar nicht in der Bibliothek?« – Wir dürfen nicht. – »Was stehn denn also eigentlich für Bücher hier an diesen Wänden?« – Rittergeschichten, lauter Rittergeschichten, rechts die Rittergeschichten mit Gespenstern, links ohne Gespenster, nach Belieben. – »So, so.« –?
Nach Vergnügungen fragt man hier vergebens. Man hat hier nichts im Sinn als die zukünftige himmlische Glückseligkeit und vergißt darüber die gegenwärtige irdische. Ein elender französischer Garten, der Huttensche, heißt hier ein Rekreationsort. Man ist aber hier so still und fromm, wie auf einem Kirchhofe. Nirgends findet man ein Auge, das auf eine interessante Frage eine interessante Antwort verspräche. Auch hier erinnert das Läuten der Glocken unaufhörlich an die katholische Religion, wie das Geklirr der Ketten den Gefangnen an seine Sklaverei. Mitten in einem geselligen Gespräche sinken bei dem Schall des Geläuts alle Knie, alle Häupter neigen, alle Hände falten sich; und wer auf seinen Füßen stehen bleibt, ist ein Ketzer.
den 15. September
Meine liebe, liebste Freundin! Wie sehnt sich mein Herz nach einem paar freundlicher Worte von Deiner Hand, nach einer kurzen Nachricht von Deinem Leben, von Deiner Gesundheit, von Deiner Liebe, von Deiner Ruhe! Wie viele Tage verlebten wir jetzt getrennt von einander und wie manches wird Dir zugestoßen sein, das auch mich nahe angeht! Und warum erfahre ich nichts von Dir? Bist Du gar nicht mehr? Oder bist Du krank? Oder hast Du mich vergessen, mich, dem der Gedanke an Dich immer gegenwärtig blieb? Zürnst Du vielleicht auf den Geliebten, der sich so mutwillig von der Freundin entfernte? Schiltst Du ihn leichtsinnig, den Reisenden, ihn, der auf dieser Reise Dein Glück mit unglaublichen Opfern erkauft und jetzt vielleicht – vielleicht schon gewonnen hat? Wirst Du mit Mißtrauen und Untreue dem lohnen, der vielleicht in kurzem mit den Früchten seiner Tat zurückkehrt? Wird er Undank bei dem Mädchen finden, für deren Glück er sein Leben wagte? Wird ihm der Preis nicht werden, auf den er rechnete, ewige innige zärtliche Dankbarkeit? – Nein, nein – Du bist für den Undank nicht geschaffen. Ewig würde Dich die Reue quälen. Tausend Ursachen konnten verhindern, daß Briefe von Dir zu mir kamen. Ich halte mich fest an Deine Liebe. Mein Vertrauen zu Dir soll nicht wanken. Mich soll kein Anschein verführen. Dir will ich glauben und keinem andern. Ich selbst habe ja auch bestellt, daß alle Briefe in Bayreuth liegen bleiben sollten. Andere konnten zwar einen andern Weg über Duderstadt nehmen – indessen ich bin ruhig. Schon vor 4 Tagen habe ich nach Bayreuth geschrieben, mir die Briefe nach Würzburg zu senden – heute war noch nichts auf der hiesigen Post, aber morgen, morgen, – oder übermorgen, oder – –
Und was werde ich da alles erfahren! Mit welchen Vorgefühlen werde ich das Kuvert betrachten, das kleine Gefäß das so vieles in sich schließt! Ach, Wilhelmine, in sechs Worten kann alles liegen, was ich zu meiner Ruhe bedarf. Schreibe mir: ich bin gesund; ich liebe Dich, – und ich will weiter nichts mehr.
Aber doch – Nachrichten von Deinen redlichen Eltern und überhaupt von Deinen Geschwistern. Ist alles wieder gesund in Eurem Hause? Schläft Mutter wieder unten? Hat Vater nicht nach mir gefragt? – Was spricht man überhaupt von mir in Frankfurt? – Doch das wirst Du wohl nicht hören. Nun, es sei! Mögen sie sprechen, was sie wollen, mögen sie mich immerhin verkennen! Wenn wir beide uns nur ganz verstehen, so kümmert mich weiter kein Urteil, keine Meinung. Jedem will ich Mißtrauen verzeihen, nur Dir nicht; denn für Dich tat ich alles, um es Dir zu benehmen. – Verstehst Du die Inschrift der Tasse? Und befolgst Du sie? Dann erfüllst Du meinen innigsten Wunsch. Dann weißt Du, mich zu ehren.
Vielleicht erhalte ich auch den Aufsatz von Dir – oder ist er noch nicht fertig? Nun, übereile Dich nicht. Ein Frühlingssonnenstrahl reift die Orangenblüte, aber ein Jahrhundert die Eiche. Ich möchte gern etwas Gutes, etwas Seltenes, etwas Nützliches von Dir erhalten das ich selbst gebrauchen kann; und das Gute bedarf Zeit, es zu bilden. Das Schnellgebildete stirbt schnell dahin. Zwei Frühlingstage – und die Orangenblüte ist verwelkt, aber die Eiche durchlebt ein Jahrtausend. Was ich von Dir empfange soll mehr als auf zwei Augenblicke duften, ich will mich seiner erfreuen mein Lebenlang.
Ja, Wilhelmine, wenn Du mir könntest die Freude machen, immer fortzuschreiten in Deiner Bildung mit Geist und Herz, wenn Du es mir gelingen lassen könntest, mir an Dir eine Gattin zu formen, wie ich sie für mich, eine Mutter, wie ich sie für meine Kinder wünsche, erleuchtet, aufgeklärt, vorurteillos, immer der Vernunft gehorchend, gern dem Herzen sich hingebend – dann, ja dann könntest mir für eine Tat lohnen, für eine Tat –
Aber das alles wären vergebliche Wünsche, wenn nicht in Dir die Anlage zu jedem Vortrefflichen vorhanden wäre. Hineinlegen kann ich nichts in Deine Seele, nur entwickeln, was die Natur hineinlegte. Auch das kann ich eigentlich nicht, kannst nur Du allein. Du selbst mußt Hand an Dir legen, Du selbst mußt Dir das Ziel stecken, ich kann nichts als Dir den kürzesten, zweckmäßigsten Weg zeigen; und wenn ich Dir jetzt ein Ziel aufstellen werde, so geschieht es nur in der Überzeugung, daß es von Dir längst anerkannt ist. Ich will nur deutlich darstellen, was vielleicht dunkel in Deiner Seele schlummert.
Alle echte Aufklärung des Weibes besteht zuletzt darin, vernünftig über die Bestimmung ihres irdischen Lebens nachdenken zu können. Über den Zweck unseres ganzen ewigen Daseins nachzudenken, auszuforschen, ob der Genuß der Glückseligkeit, wie Epikur meinte, oder die Erreichung der Vollkommenheit, wie Leibniz glaubte, oder die Erfüllung der trocknen Pflicht, wie Kant versichert, der letzte Zweck des Menschen sei, das ist selbst für Männer unfruchtbar und oft verderblich. Wie können wir uns getrauen in den Plan einzugreifen, den die Natur für die Ewigkeit entworfen hat, da wir nur ein so unendlich kleines Stück von ihm, unser Erdenleben, übersehen? Also wage Dich mit Deinem Verstande nie über die Grenzen Deines Lebens hinaus. Sei ruhig über die Zukunft. Was Du für dieses Erdenleben tun sollst, das kannst Du begreifen, was Du für die Ewigkeit tun sollst, nicht; und so kann denn auch keine Gottheit mehr von Dir verlangen, als die Erfüllung Deiner Bestimmung auf dieser Erde. Schränke Dich also ganz für diese kurze Zeit ein. Kümmre Dich nicht um Deine Bestimmung nach dem Tode, weil Du darüber leicht Deine Bestimmung auf dieser Erde vernachlässigen könntest.
den 18. September 1800
Als ich so weit gekommen war, fiel mir ein, daß wohl manche Erläuterungen nötig sein möchten, um gegen Deine Religionsbegriffe nicht anzustoßen. Zugleich sah ich, daß dieser Gegenstand zu reichhaltig war für einen Brief, und entschloß mich daher Dir einen eignen Aufsatz darüber zu liefern. Den Anfang davon macht der beifolgende dritte Bogen. Laß uns beide, liebe Wilhelmine, unsre Bestimmung ganz ins Auge fassen, um sie künftig einst ganz zu erfüllen. Dahin allein wollen wir unsre ganze Tätigkeit richten. Wir wollen alle unsre Fähigkeiten ausbilden, eben nur um diese Bestimmung zu erfüllen. Du wirst mich, ich werde Dich darin unterstützen, und daher künftig in diesem Aufsatze fortfahren.
Wie ich auf die Idee des Ganzen gekommen bin, das wirst Du in der Folge leicht erraten. – Wie ich auf den Gedanken gekommen bin, Dich vor religiösen Grübeleien zu warnen, das will ich Dir hiermit sagen. Nicht weil sie etwa von Dir sehr zu befürchten wären, sondern darum, weil ich eben grade in einer Stadt lebe, wo man über die Andacht die Tätigkeit ganz vergißt, und auch darum, weil Brokes mich umgibt, der unaufhörlich mit der Natur im Streit ist, weil er, wie er sagt, seine ewige Bestimmung nicht herausfinden kann, und daher nichts für seine irdische tut. Doch darüber in der Folge mehr.
Jetzt muß ich schließen. Ich wollte warten bis ich doch endlich von Dir einen Brief empfangen haben würde, um dies Dir zu melden, aber vergebens. Liebe Wilhelmine! – Sei ruhig. Ich bleibe Dir herzlich gut, in der festen Überzeugung, daß Du auch mir noch herzlich gut bist, – wenn Du noch lebst. – O meine Hoffnung! – Sei ruhig. Mache keine Anstalten wegen der Briefe. Wenn ich in 3 Tagen keinen erhalte, so schicke ich selbst einen Laufzettel zurück. Denn geschrieben hast Du gewiß. Lebe wohl.
Dein Heinrich.
den 18. nachmittags
Ich möchte gern diesen Brief noch zurückhalten bis morgen, denn morgen hoffe ich doch gewiß einen Brief zu erhalten. Aber ich habe schon seit 6 Tagen keinen Brief an Dich abgeschickt, und Deiner Ruhe ist doch wohl nicht recht zu trauen. – Mädchen! Mädchen!
Weißt Du was? Es ist möglich, daß grade über Bayreuth die Briefe so unglücklich gehen. Schreibe mir geschwind einen, und adressiere ihn über Duderstadt nach Würzburg. Vielleicht glückt das besser.
Wenn ich denke, daß auch Du alle meine Briefe nicht erhalten haben könntest, und mich für untreu hieltest, indessen ich doch mit so inniger Treue an Dich hing – o Gott!
Auch von Ulriken habe ich noch nichts empfangen. Sage ihr dies. Aber noch soll sie keinen Laufzettel schicken.
Und nun noch eine Neuigkeit. Der Waffenstillstand war gestern schon wieder verflossen. Hier erwartet man nun täglich die Franzosen. Es heißt aber, daß mehrere Kaiserliche heranrücken. Die Festung soll nach wie vor behauptet werden. Sei Du aber ganz ruhig über mich. Diese Veränderung hat jetzt keinen Einfluß mehr auf die Erfüllung meines Plans, den ich fast schon erfüllt nennen kann. Doch muß ich noch einige Zeit hier bleiben und werde aber bei dem Kriege nichts als ein neutraler Zuschauer sein. Adieu. Ich küsse die liebe Hand, die ich einst mein nennen werde.
Dein Freund H. K.
| Abgeschickt | Empfangen | ||||
| den | 1. | Brief aus | Berlin | 2 Briefe. | |
| 2. | " | Pasewalk | |||
| 3. | " | Berlin | |||
| 4. | " | Berlin | |||
| 5. | " | Leipzig | |||
| 6. | " | Dresden | |||
| 7. | " | Reichenbach | |||
| 8. | " | Bayreuth | |||
| 9. | " | Würzburg | |||
| 10. | " | Würzburg | |||
*
An die Frau von Kleist, geborene von Zenge, Hochwohlgeb., zu Berlin.
Würzburg, den 19. (–23.) September 1800
Und immer noch keine Nachrichten von Dir, meine liebe Freundin? Gibt es denn keinen Boten, der eine Zeile von Dir zu mir herübertragen könnte? Gibt es denn keine Verbindung mehr zwischen uns, keine Wege, keine Brücken? Ist denn ein Abgrund zwischen uns eingesunken, daß sich die Länder nicht mehr ihre Arme, die Landstraßen, zureichen? Bist Du denn fortgeführt von dieser Erde, daß kein Gedanke mehr herüberkommt von Dir zu mir, wie aus einer andern Welt? – Oder ist doch irgend ein Unhold des Mißtrauens zwischen uns getreten, mich loszureißen von Deinem Herzen? Und ist es ihm geglückt, wirklich geglückt –? Wilhelmine! Bin ich Dir nichts mehr wert? Achtest Du mich nicht mehr? Hast Du sie schon verdammt, diese Reise, deren Zweck Du noch nicht kennst? – Ach, ich verzeihe es Dir. Du wirst genug leiden durch Deine Reue – ich will Dich durch meinen Unwillen nicht noch unglücklicher machen. Kehre um, liebes Mädchen! Hast Du Dich aus Mißtrauen von mir losreißen wollen, so gib es jetzt wieder auf, jetzt, wo bald eine Sonne über mich aufgehen wird. Wie würdest Du, in kurzem, herüberblicken mit Wehmut und Trauer zu mir, von dem Du Dich losgerissen hast grade da er Deiner Liebe am würdigsten war? Wie würdest Du Dich selbst herabwürdigen, wenn ich heraufstiege vor Deinen Augen geschmückt mit den Lorbeern meiner Tat? Das würdest Du nicht ertragen – Kehre um, liebes Mädchen. Ich will Dir alles verzeihen. Knüpfe Dich wieder an mich, tue es mit blinder Zuversicht. Noch weißt Du nicht ganz, wen Du mit Deinen Armen umstrickst – aber bald, bald! Und Dein Herz wird Dir beben, wenn Du in meines blicken wirst, das verspreche ich Dir.
Hast Du noch nie die Sonne aufgehen sehen über eine Gegend, zu welcher Du gekommen warst im Dunkel der Nacht? – Ich aber habe es. Es war vor 3 Jahren im Harze. Ich erstieg um Mitternacht den Stufenberg hinter Gernrode. Da stand ich, schauernd, unter den Nachtgestalten wie zwischen Leichensteinen, und kalt wehte mich die Nacht an, wie ein Geist, und öde schien mir der Berg, wie ein Kirchhof. Aber ich irrte nur, so lange die Finsternis über mich waltete. Denn als die Sonne hinter den Bergen heraufstieg, und ihr Licht ausgoß über die freundlichen Fluren, und ihre Strahlen senkte in die grünenden Täler, und ihren Schimmer heftete um die Häupter der Berge, und ihre Farben malte an die Blätter der Blumen und an die Blüten der Bäume – ja, da hob sich das Herz mir unter dem Busen, denn da sah ich und hörte, und fühlte, und empfand nun mit allen meinen Sinnen, daß ich ein Paradies vor mir hatte. – Etwas Ähnliches verspreche ich Dir, wenn die Sonne aufgehen wird über Deinen unbegreiflichen Freund.
Zuweilen – Ich weiß nicht, ob Dir je etwas Ähnliches glückte, und ob Du es folglich für wahr halten kannst. Aber ich höre zuweilen, wenn ich in der Dämmerung, einsam, dem wehenden Atem des Westwinds entgegen gehe, und besonders wenn ich dann die Augen schließe, ganze Konzerte, vollständig, mit allen Instrumenten von der zärtlichen Flöte bis zum rauschenden Kontra-Violon. So entsinne ich mich besonders einmal als Knabe vor 9 Jahren, als ich gegen den Rhein und gegen den Abendwind zugleich hinaufging, und so die Wellen der Luft und des Wassers zugleich mich umtönten, ein schmelzendes Adagio gehört [zu] habe[n], mit allem Zauber der Musik, mit allen melodischen Wendungen und der ganzen begleitenden Harmonie. Es war wie die Wirkung eines Orchesters, wie ein vollständiges Vaux-hall; ja, ich glaube sogar, daß alles was die Weisen Griechenlands von der Harmonie der Sphären dichteten, nichts Weicheres, Schöneres, Himmlischeres gewesen sei, als diese seltsame Träumerei.
Und dieses Konzert kann ich mir, ohne Kapelle, wiederholen so oft ich will – aber so bald ein Gedanke daran sich regt, gleich ist alles fort, wie weggezaubert durch das magische: disparois!, Melodie, Harmonie, Klang, kurz die ganze Sphärenmusik.
So stehe ich nun auch zuweilen an meinem Fenster, wenn die Dämmerung in die Straße fällt, und öffne das Glas und die Brust dem einströmenden Abendhauche, und schließe die Augen, und lasse seinen Atem durch meine Haare spielen, und denke nichts, und horche – O wenn du mir doch einen Laut von ihr herüberführen könntest, wehender Bote der Liebe! Wenn du mir doch auf diese zwei Fragen: lebt sie? liebt sie (mich)? ein leises Ja zuflüstern könntest! – Das denke ich – und fort ist das ganze tönende Orchester, nichts läßt sich hören als das Klingeln der Betglocke von den Türmen der Kathedrale.
Morgen, denke ich dann, morgen wird ein treuerer Bote kommen, als du bist! Hat er gleich keine Flügel, um schnell zu sein, wie du, so trägt er doch auf dem gelben Rocke den doppelten Adler des Kaisers, der ihn treu und pünktlich und sicher macht.
Aber der Morgen kommt zwar, doch mit ihm niemand, weder der Bote der Liebe, noch der Postknecht des Kaisers.
Gute Nacht. Morgen ein mehreres. Dir will ich schreiben, und nicht eher aufhören, als bis Du mir wenigstens schreibst, Du wolltest meine Briefe nicht lesen.
Es ist 12 Uhr nachts. Künftig will ich Dir sagen, warum ich so spät geschrieben habe. Gute Nacht, geliebtes Mädchen.
den 20. September
Wenn ich nur wüßte, ob alle meine Briefe pünktlich in Deine und in keines andern Menschen Hände gekommen sind, und ob auch dieser in die Deinigen kommen wird, ohne vorher von irgend einem Neugierigen erbrochen worden zu sein, so könnte ich Dir schon manches mitteilen, was Dir zwar eben noch keinen Aufschluß, aber doch Stoff zu richtigen Vermutungen geben würde. Immer bei jedem Briefe ist es mir, als ob ich ein Vorgefühl hätte, er werde umsonst geschrieben, er gehe verloren, ein andrer erbreche ihn, und dergleichen; denn kann es nicht meinen Briefen gehen, wie den Deinigen? Und wie würdest Du dann zürnen über den Nachlässigen, Ungetreuen, der die Geliebte vergaß, sobald er aus ihren Mauern war, unwissend, daß er in jeder Stadt, an jedem Orte an Dich dachte, ja, daß seine ganze Reise nichts war als ein langer Gedanke an Dich? – Aber wenn ich denke, daß dieses Papier, auf das ich jetzt schreibe, das unter meinen Händen, vor meinen Augen liegt, einst in Deinen Händen, vor Deinen Augen sein wird, dann – küsse ich es, heimlich, damit es Brokes nicht sieht, – und küsse es wieder das liebe Papier, das Du vielleicht auch an Deine Lippen drücken wirst – und bilde mir ein, es wären wirklich schon Deine Lippen. – Denn wenn ich die Augen zumache, so kann ich mir einbilden, was ich will.
Ich will Dir etwas von meinem hiesigen Leben schreiben, und wenn Du etwas daraus erraten solltest, so sei es – Denn ich schicke diesen Brief nicht eher ab, als bis ich Nachrichten von Dir empfangen habe, und folglich beurteilen kann, ob Du diese Vertraulichkeit wert bist, oder nicht.
Zuerst muß ich Dir sagen, daß ich nicht während dieser ganzen Zeit in dem Gasthofe gewohnt habe, der mich bei meiner Ankunft empfing. Sobald ich sicher war, nicht nach Straßburg reisen zu dürfen, so sah ich voraus, daß ich mich nun hier wohl einige Wochen würde aufhalten müssen, und mietete mir daher, mit Brokes, ein eignes Quartier, um dem teuren Gasthofe zu entgehen.
Denn ob ich gleich im ganzen die Kosten dieser Reise nicht gescheut habe, ja selbst zehnmal so viel, und noch mehr, ihrem Zwecke aufgeopfert haben würde, so suchen wir doch im einzelnen unsre Absicht so wohlfeil als möglich zu erkaufen. Indessen ob wir gleich beide die Absicht haben, zu sparen, so verstehen wir es doch eigentlich nicht, weder Brokes, noch ich. Dazu gehört ein ewiges Abwägen des Vorteils, eine ewige Aufmerksamkeit auf das geprägte Metall, die jungen Leuten mit warmem Blute meistens fehlt, besonders wenn sie auf Reisen das große Gepräge der Natur vor sich sehen. Indessen jede Kleinigkeit, zu sehr verachtet, rächt sich, und daher bin ich doch fest entschlossen, mich an eine größere Aufmerksamkeit auf das Geld zu gewöhnen. Recht herzlich lieb ist es mir, an Dir ein ordnungsliebendes Mädchen gefunden zu haben, das auch diese kleine Aufmerksamkeit nicht scheut. Wir beide wollen uns darin teilen. Rechnungen sind doch in größern Ökonomien notwendig. Im Großen muß sie der Mann führen, im Kleinen die Frau. Ordnung ist nicht ihr einziger Nutzen. Wenn man sich täglich die Summe seines wachsenden Glückes zieht, so mehrt sich die Lust, es zu mehren, und am Ende mehrt sich das Glück wirklich. Ich bin überzeugt, daß mancher Tausende zurücklegte, weil ihm die Berechnung des ersten zurückgelegten Talers, den er nicht brauchte, und der ihm nun wuchern soll, Freude machte.
Doch ich komme zurück. – Wir sind also aus unserm prächtigen Gasthofe ausgezogen, in ein kleines, verstecktes Häuschen, das Du gewiß nicht finden solltest, wenn ich es Dir nicht bezeichnete. Es ist ein Eckhaus, auf drei Seiten, ganz nahe, mit Häusern umgeben, die finster aussehen, wie die Köpfe, die sie bewohnen. Das möchte man, bis auf die Tonne des Diogenes, wohl überhaupt finden, daß das Äußere der Häuser den Charakter ihrer Bewohner ausdrückt. Hier z. B. hat jedes Haus eine Menge Türen, und es könnte da vieles einziehen; aber sie sind verschlossen bis auf eine, und auch diese steht nur dem Seelsorger (oder ) und wenigen andern offen. Ebenso haben die Häuser einen Überfluß von Fenstern, ja, man könnte sagen, die ganze Fassade sei nichts als ein großes Fenster, und da könnte denn freilich genug Tageslicht einfallen; aber dicht davor steht eine hohe Kirche oder ein Kloster, und es bleibt ewig Nacht. Grade ohngefähr wie bei den Besitzern. – Unser Zimmer ist indessen ziemlich hell. Wir haben das Eckzimmer mit 4 Fenstern von zwei Seiten. In Rom war ein Mann, der in Wänden von Glas wohnte, um die ganze Stadt zum Zeugen aller seiner Handlungen zu machen. Hier würde ganz Würzburg ein Zeuge der unsrigen sein, wenn es hier nicht jene jesuitischen Jalousien gäbe, aus welchen man füglich hinaus sehen kann, ohne daß von außen hinein gesehen werden könnte.
Jetzt, da wir so ziemlich alles gesehen haben in dieser Stadt, sind wir viel zu Hause, Brokes und ich, und lesen und schreiben, wobei mir meine wissenschaftlichen Bücher, die ich aus Frankfurt mitnahm, nicht wenig zustatten kommen. Von der Langenweile, die ich nie empfand, weiß ich also auch hier nichts. Langeweile ist nichts als die Abwesenheit aller Gedanken, oder vielmehr das Bewußtsein ohne beschäftigende Vorstellungen zu sein. Das kann aber einem denkenden Menschen nie begegnen, so lange es noch Dinge überhaupt für ihn auf der Welt gibt; denn an jeden Gegenstand, sei er auch noch so scheinbar geringfügig, lassen sich interessante Gedanken anknüpfen, und das ist eben das Talent der Dichter, welche ebensowenig wie wir in Arkadien leben, aber das Arkadische oder überhaupt Interessante auch an dem Gemeinsten, das uns umgibt, heraus finden können. Wenn wir weiter nichts zu tun wissen, so treten wir ans Fenster, und machen Glossen über die Vorbeigehenden, aber gutmütige, denn wir vergessen nicht, daß, wenn wir auf der Straße gehn, die Rollen getauscht sind, und daß die kritisierten Schauspieler dann kritisierende Zuschauer geworden sind, und umgekehrt. Besonders der Markt an den Sonnabenden ist interessant, die Anstalten, die nötig sind, den Menschen 8 Tage lang das Leben zu fristen, der Streit der Vorteile, indem jeder strebt, so wohlfeil zu kaufen und so teuer zu verkaufen als möglich, auch die Frau an der Ecke, mit einer Schar von Gänsen, denen die Füße gebunden sind, um sich, wie eine französische Mamsell mit ihren gnädigen Fräulein, denen oft noch obenein die Hände gebunden sind, etc. etc.
Unser Wirt heißt übrigens Wirth, und wir befinden uns in diesem doppelten Wirtshause recht wohl. Uns bedient ein Mädchen, mit einer holden Freundlichkeit, und sorgt für uns, wie für Brüder, bringt uns Obst, ohne in allem Ernste Geld zu nehmen, usf. Und wenn uns die Menschen gefallen, die uns grade umgeben, so gefällt uns die ganze Menschheit. Keine Tugend ist doch weiblicher, als Sorge für das Wohl anderer, und nichts dagegen macht das Weib häßlicher und gleichsam der Katze ähnlicher als der schmutzige Eigennutz, das gierige Einhaschen für den eignen Genuß. Das läßt sich freilich verstecken; aber es gibt eine himmlische Güte des Weibes, alles, was in ihre Nähe kommt, an sich zu schließen, und an ihrem Herzen zu hegen und zu pflegen mit Innigkeit und Liebe, wie die Sonne (die wir darum auch Königin nennen, nicht König) alle Sterne, die in ihren Wirkungsraum schweben, an sich zieht mit sanften unsichtbaren Banden, und in frohen Kreisen um sich führt, Licht und Wärme und Leben ihnen gebend – aber das läßt sich nicht anlernen. – – – –
Gute Nacht, Wilhelmine. Es ist wieder 12 Uhr nachts.
den 23. September
Endlich, endlich – ja Du lebst, und liebst mich noch! Hier in diesem Briefe ist es enthalten, in dem ersten, den ich seit 3 Wochen von Dir erhielt. Es ist Deine Antwort auf meinen Dresdner Brief:
| Abgeschickt | Empfangen | ||||
| den | 1. | Brief aus | Berlin | 3 Briefe. | |
| 2. | " | Pasewalk | |||
| 3. | " | Berlin | |||
| 4. | " | Berlin | |||
| 5. | " | Leipzig | |||
| 6. | " | Dresden | |||
| 7. | " | Reichenbach | |||
| 8. | " | Bayreuth | |||
| 9. | " | Würzburg | |||
| 10. | " | Würzburg | |||
| 11. | " | Würzburg | |||
| und diesen 12. | |||||
Deine Briefe aus Wien werden nun wohl auch bald eintreffen.
Daß Du nach Berlin gegangen bist, ist mir herzlich lieb, wenn Du dort mehr Beruhigung zu finden hoffst, als in Frankfurt; sei vergnügt, denn jetzt darf Dir der Erfolg meines Unternehmens keine Sorge mehr machen. Aber sei auch vernünftig, und kehre ohne Widerwillen nach dem Orte zurück, an dem Du doch noch lange ohne mich wirst leben müssen. Honig wohnt in jeder Blume, Freude an jedem Orte, man muß nur, wie die Biene, sie zu finden wissen. Und wo kann sie sichrer für Dich blühen, als da, wo einst der Schauplatz unsrer ersten Liebe war, und wo auch Deine und meine Familie wohnt? – Doch darüber werde ich Dir noch mehr schreiben. Jetzt nutze diese Veränderung Deines Wohnortes so gut Du kannst. Auf eine kurze Zeit kann Berlin gefallen, auf eine lange nicht, mich nicht – Du müßtest denn bei mir sein, denn das habe ich noch nicht versucht.
Adieu. Halte Dein Wort, und kehre zur bestimmten Zeit wieder nach Frankfurt zurück. Ich werde es auch tun. Lebe wohl und freue Dich auf den nächsten Brief, denn wenn nicht alles mich täuscht, so – –
H. K.
*
An Fräulein Wilhelmine v. Zenge Hochwohlgeb. zu Frankfurt a. Oder.
Würzburg, den 10. (und 11.) Oktober 1800
Liebe Wilhelmine! Du denkst gewiß heute an mich, so wie ich den ganzen 18. August an Dich dachte, nicht wahr? – O mit welcher Innigkeit denke ich jetzt auch an Dich! Und welch ein unbeschreiblicher Genuß ist mir diese Überzeugung, daß unsere Gedanken sich gewiß jetzt in diesem Augenblicke begegnen! Ja, mein Geburtstag ist heute, und mir ist, als hörte ich die Wünsche, die heute Dein Herz heimlich für mich bildet, als fühlte ich den Druck Deiner Hand, der mir alle diese Wünsche mit einemmale mitteilt. Ja sie werden erfüllt werden alle diese Wünsche, sei davon überzeugt, ich bin es. Wenn uns ein König ein Ordensband wünscht, heißt das nicht ihn uns versprechen? Er selbst hat die Erfüllung seines Wunsches in seiner Hand – Du auch, liebes Mädchen. Alles was ich Glück nenne, kann nur von Deiner Hand mir kommen, und wenn Du mir dieses Glück wünschest, ja dann kann ich wohl ganz ruhig in die Zukunft blicken, dann wird es mir gewiß zuteil werden. Liebe und Bildung das ist alles, was ich begehre, und wie froh bin ich, daß die Erfüllung dieser beiden unerläßlichen Bedürfnisse, ohne die ich jetzt nicht mehr glücklich sein könnte, nicht von dem Himmel abhangt, der, wie bekannt, die Wünsche der armen Menschen so oft unerfüllt läßt, sondern einzig und allein von Dir.
Du hast doch meinen letzten Brief, den ich am Anfange dieses Monats schrieb, und den ich einen Hauptbrief nennen möchte, wenn nicht bald ein zweiter erschiene, der noch wichtiger sein wird – Du hast ihn doch erhalten? Vielleicht hast Du ihn in diesen Tagen empfangen, vielleicht empfängst Du ihn in diesem Augenblicke – O wenn ich jetzt neben Dir stehen könnte, wenn ich Dir diesen unverständlichen Brief erklären dürfte, wenn ich Dich vor Mißverständnisse sichern könnte, wenn ich jede unwillige Regung Deines Gefühls gleich in dem ersten Augenblick der Entstehung unterdrücken dürfte – Zürne nicht, liebes Mädchen, ehe Du mich ganz verstehst! Wenn ich mich gegen Dich vergangen habe, so habe ich es auch durch die teuersten Opfer wieder gut gemacht. Laß mir die Hoffnung daß Du mir verzeihen wirst, so werde ich den Mut haben Dir alles zu bekennen. Höre nur erst mein Bekenntnis an, und ich bin gewiß, daß Du dann nicht mehr zürnen wirst.
Ich versprach Dir in jenem Briefe, entweder in 8 Tagen von hier abzureisen, oder Dir zu schreiben. Diese Zeit ist verstrichen, und das erste war noch nicht möglich. Beunruhige Dich nicht – meine Abreise kann morgen oder übermorgen und an jedem Tage erfolgen, der mir etwas Nochzuerwartendes überbringt. In der Folge werde ich mich deutlicher darüber erklären, laß das jetzt ruhen. Jetzt will ich mein Versprechen erfüllen und Dir, statt meiner, wenigstens einen Brief schicken. Sei für jetzt zufrieden mit diesem Stellvertreter, bald wird die Post mich selbst zu Dir tragen.
Aber von unserm Hauptgegenstande kann ich Dir jetzt noch nicht mehr schreiben, denn ich muß erst wissen, wie Du jenen letzten Brief aufgenommen hast. Also von etwas anderem.
————
In meiner Seele sieht es aus, wie in dem Schreibtische eines Philosophen, der ein neues System ersann, und einzelne Hauptgedanken auf zerstreute Papiere niederschrieb. Eine große Idee – für Dich, Wilhelmine, schwebt mir unaufhörlich vor der Seele! Ich habe Dir den Hauptgedanken schon am Schlusse meines letzten Briefes, auch schon vorher auf einem einzelnen Blatte mitgeteilt. Du hast ihn doch noch nicht vergessen? – –
Ich ersuchte Dich doch einst mir aufzuschreiben, was Du Dir denn eigentlich von dem Glücke einer künftigen Ehe versprächst! – Errätst Du nicht, warum? Doch wie kannst Du das erraten! – Ich sehe mit Sehnsucht diesem Aufsatz entgegen, den ich immer noch nicht von Wien erhalten habe. Sein erstes Blatt, das Du mir mitteiltest, und das mir eine unaussprechliche, aber bittersüße Freude gewährte, scheuchte mich aus Deinen Armen und beschleunigte meine Abreise. Weißt Du wohl noch mit welcher Bewegung ich es am Tage vor unsrer Trennung durchlas, und wie ich es unruhig mit mir nach Hause nahm – und weißt Du auch was ich da, als ich allein war mit diesem Blatte, alles empfand? Es zog mein ganzes Herz an Dich, aber es stieß mich zugleich unwiderruflich aus Deinen Armen – Wenn ich es jetzt wieder lesen werde, so wird es mich dahin zurückführen. Damals war ich Deiner nicht würdig, jetzt bin ich es. Damals weinte ich, daß Du so gut, so edel, so achtungswürdig, so wert des höchstens Glückes warst, jetzt wird es mein Stolz und mein Entzücken sein. Damals quälte mich das Bewußtsein, Deine heiligsten Ansprüche nicht erfüllen zu können, und jetzt, jetzt – Doch still!
Jetzt, Wilhelmine, werde auch ich Dir mitteilen, was ich mir von dem Glücke einer künftigen Ehe verspreche. Ehemals durfte ich das nicht, aber jetzt – o Gott! Wie froh macht mich das! – Ich werde Dir die Gattin beschreiben, die mich jetzt glücklich machen kann – – und das ist die große Idee, die ich für Dich im Sinne habe. Das Unternehmen ist groß, aber der Zweck ist es auch. Ich werde jede Stunde, die mir meine künftige Lage übriglassen wird, diesem Geschäfte widmen. Das wird meinem Leben neuen Reiz geben, und uns beide schneller durch die Prüfungszeit führen, die uns bevorsteht. In fünf Jahren, hoffe ich, wird das Werk fertig sein.
Fürchte nicht, daß die beschriebene Gattin nicht von Erde sein wird, und daß ich sie erst in dem Himmel finden werde. Ich werde sie in 5 Jahren auf dieser Erde finden und mit meinen irdischen Armen umschließen – Ich werde von der Lilie nicht verlangen, daß sie in die Höhe schießen soll, wie die Zeder, und der Taube kein Ziel stecken, wie dem Adler. Ich werde aus der Leinwand kein Bild hauen, und auf dem Marmor nicht malen. Ich kenne die Masse, die ich vor mir habe, und weiß, wozu sie taugt. Es ist ein Erz mit gediegenem Golde und mir bleibt nichts übrig, als das Metall von dem Gestein zu scheiden. Klang und Gewicht und Unverletzbarkeit in der Feuerprobe hat es von der Natur erhalten, die Sonne der Liebe wird ihm Schimmer und Glanz geben, und ich habe nach der metallurgischen Scheidung nichts weiter zu tun, als mich zu wärmen und zu sonnen in den Strahlen, die seine Spiegelfläche auf mich zurückwirft.
Ich selbst fühle wie matt diese Bildersprache gegen den Sinn ist, der mich belebt – – O wenn ich Dir nur einen Strahl von dem Feuer mitteilen könnte, das in mir flammt! Wenn Du es ahnden könntest, wie der Gedanke, aus Dir einst ein vollkommnes Wesen zu bilden, jede Lebenskraft in mir erwärmt, jede Fähigkeit in mir bewegt, jede Kraft in mir in Leben und Tätigkeit setzt! – Du wirst es mir kaum glauben, aber ich sehe oft stundenlang aus dem Fenster und gehe in 10 Kirchen und besehe diese Stadt von allen Seiten, und sehe doch nichts, als ein einziges Bild – Dich, Wilhelmine, und zu Deinen Füßen zwei Kinder, und auf Deinem Schoße ein drittes, und höre wie Du den kleinsten sprechen, den mittleren fühlen, den größten denken lehrst, und wie Du den Eigensinn des einen zu Standhaftigkeit, den Trotz des andern zu Freimütigkeit, die Schüchternheit des dritten zu Bescheidenheit, und die Neugierde aller zu Wißbegierde umzubilden weißt, sehe, wie Du ohne viel zu plaudern, durch Beispiele Gutes lehrst und wie Du ihnen in Deinem eignen Bilde zeigst, was Tugend ist, und wie liebenswürdig sie ist – – Ist es ein Wunder, Wilhelmine, wenn ich für diese Empfindungen die Sprache nicht finden kann?
O lege den Gedanken wie einen diamantenen Schild um Deine Brust: ich bin zu einer Mutter geboren! Jeder andere Gedanke, jeder andere Wunsch fahre zurück von diesem undurchdringlichen Harnisch. Was könnte Dir sonst die Erde für ein Ziel bieten, das nicht verachtungswürdig wäre? Sie hat nichts was Dir einen Wert geben kann, wenn es nicht die Bildung edler Menschen ist. Dahin richte Dein heiligstes Bestreben! Das ist das einzige, was Dir die Erde einst verdanken kann. Gehe nicht von ihr, wenn sie sich schämen müßte, Dich nutzlos durch ein Menschenalter getragen zu haben! Verachte alle die niederen Zwecke des Lebens. Dieser einzige wird Dich über alle erheben. In ihm wirst Du Dein wahres Glück finden, alle andern können Dich nur auf Augenblicke vergnügen. Er wird Dir Achtung für Dich selbst einflößen, alles andere kann nur Deine Eitelkeit kitzeln; und wenn Du einst an seinem Ziele stehst, so wirst Du mit Selbstzufriedenheit auf Deine Jugend zurückblicken, und nicht wie tausend andere unglückliche Geschöpfe Deines Geschlechts die versäumte Bestimmung und das versäumte Glück in bittern Stunden der Einsamkeit beweinen.
Liebe Wilhelmine, ich will nicht, daß Du aufhören sollst, Dich zu putzen, oder in frohe Gesellschaften zu gehen, oder zu tanzen; aber ich möchte Deiner Seele nur den Gedanken recht aneignen, daß es höhere Freuden gibt, als die uns aus dem Spiegel, oder aus dem Tanzsaale entgegen lächeln. Das Gefühl, im Innern schön zu sein, und das Bild das uns der Spiegel des Bewußtseins in den Stunden der Einsamkeit zurückwirft, das sind Genüsse, die allein unsere heiße Sehnsucht nach Glück ganz stillen können.
Dieser Gedanke möge Dich auf alle Deine Schritte begleiten, vor den Spiegel, in Gesellschaften, in den Tanzsaal. Bringe der Mode, oder vielmehr dem Geschmack die kleinen Opfer, die er nicht ganz mit Unrecht von jungen Mädchen fordert, arbeite an Deinem Putze, frage den Spiegel, ob Dir die Arbeit gelungen ist – aber eile mit dem allen, und kehre so schnell als möglich zu Deinem höchsten Zwecke zurück. Besuche den Tanzsaal – aber sei froh, wenn Du von einem Vergnügen zurückkehrst, wobei nur die Füße ihre Rechnung fanden, das Herz aber und der Verstand den Pulsschlag ihres Lebens ganz aussetzten, und das Bewußtsein gleichsam ganz ausgelöscht war. Gehe in frohe Gesellschaften, aber suche Dir immer den Bessern, Edleren heraus, den, von dem Du etwas lernen kannst – denn das darfst Du in keinem Augenblicke Deines Lebens versäumen. Jede Minute, jeder Mensch, jeder Gegenstand kann Dir eine nützliche Lehre geben, wenn Du sie nur zu entwickeln verstehst – doch von diesem Gegenstande ein andermal mehr.
Und so laß uns denn beide, Hand in Hand, unserm Ziele entgegen gehen, jeder dem seinigen, das ihm zunächst liegt, und wir beide dem letzten, nach dem wir beide streben. Dein nächstes Ziel sei, Dich zu einer Mutter, das meinige, mich zu einem Staatsbürger zu bilden, und das fernere Ziel, nach dem wir beide streben, und das wir uns beide wechselseitig sichern können, sei das Glück der Liebe.
Gute Nacht, Wilhelmine, meine Braut, einst meine Gattin, einst die Mutter meiner Kinder!
den 11. Oktober
Ich will aus diesem Briefe kein Buch machen, wie aus dem vorigen, und Dir daher nur kurz noch einiges vor dem Abgange der Post mitteilen.
Ich finde jetzt die Gegend um diese Stadt weit angenehmer, als ich sie bei meinem Einzuge fand; ja ich möchte fast sagen, daß ich sie jetzt schön finde – und ich weiß nicht, ob sich die Gegend verändert hat, oder das Herz, das ihren Eindruck empfing. Wenn ich jetzt auf der steinernen Mainbrücke stehe, die das Zitadell von der Stadt trennt, und den gleitenden Strom betrachte, der durch Berge und Auen in tausend Krümmungen heran strömt und unter meinen Füßen weg fließt, so ist es mir, als ob ich über ein Leben erhaben stünde. Ich stehe daher gern am Abend auf diesem Gewölbe und lasse den Wasserstrom und den Luftstrom mir entgegen rauschen. Oder ich kehre mich um, und verfolge den Lauf des Flusses bis er sich in die Berge verliert, und verliere mich selbst dabei in stille Betrachtungen. Besonders ein Schauspiel ist mir sehr merkwürdig. Gradeaus strömt der Main von der Brücke weg, und pfeilschnell, als hätte er sein Ziel schon im Auge, als sollte ihn nichts abhalten, es zu erreichen, als wollte er es, ungeduldig, auf dem kürzesten Wege ereilen – aber ein Rebenhügel beugt seinen stürmischen Lauf, sanft aber mit festem Sinn, wie eine Gattin den stürmischen Willen ihres Mannes, und zeigt ihm mit edler Standhaftigkeit den Weg, der ihn ins Meer führen wird – – und er ehrt die bescheidne Warnung und folgt der freundlichen Weisung, und gibt sein voreiliges Ziel auf und durchbricht den Rebenhügel nicht, sondern umgeht ihn, mit beruhigtem Laufe, seine blumigen Füße ihm küssend –
Selbst von dem Berge aus, von dem ich Würzburg zuerst erblickte, gefällt es mir jetzt, und ich möchte fast sagen, daß es von dieser Seite am schönsten sei. Ich sahe es letzthin von diesem Berge in der Abenddämmerung, nicht ohne inniges Vergnügen. Die Höhe senkt sich allmählich herab und in der Tiefe liegt die Stadt. Von beiden Seiten hinter ihr ziehen im halben Kreise Bergketten sich heran, und nähern sich freundlich, als wollten sie sich die Hände geben, wie ein paar alte Freunde nach einer lange verflossenen Beleidigung – aber der Main tritt zwischen sie, wie die bittere Erinnerung, und sie wanken, und keiner wagt es, zuerst hinüber zu schreiten, und folgen beide langsam dem scheidenden Strome, wehmütige Blicke über die Scheidewand wechselnd –
In der Tiefe, sagte ich, liegt die Stadt, wie in der Mitte eines Amphitheaters. Die Terrassen der umschließenden Berge dienten statt der Logen, Wesen aller Art blickten als Zuschauer voll Freude herab und sangen und sprachen Beifall, oben in der Loge des Himmels stand Gott. Und aus dem Gewölbe des großen Schauspielhauses sank der Kronleuchter der Sonne herab, und versteckte sich hinter die Erde – denn es sollte ein Nachtstück aufgeführt werden. Ein blauer Schleier umhüllte die ganze Gegend, und es war, als wäre der azurne Himmel selbst hernieder gesunken auf die Erde. Die Häuser in der Tiefe lagen in dunkeln Massen da, wie das Gehäuse einer Schnecke, hoch empor in die Nachtluft ragten die Spitzen der Türme, wie die Fühlhörner eines Insektes, und das Klingeln der Glocken klang wie der heisere Ruf des Heimchens – und hinten starb die Sonne, aber hochrot glühend vor Entzücken, wie ein Held, und das blasse Zodiakallicht umschimmerte sie, wie eine Glorie das Haupt eines Heiligen – –
Vorgestern ging ich aus, einen andern Berg von der Nordseite zu ersteigen. Es war ein Weinberg, und ein enger Pfad führte durch gesegnete Rebenstangen auf seinen Gipfel. Ich hatte nicht geglaubt, daß der Berg so hoch sei – und er war es vielleicht auch nicht, aber sie hatten aus den Weinbergen alle Steine rechts und links in diesen Weg geworfen, das Ersteigen zu erschweren – – grade wie das Schicksal oder die Menschen mir auf den Weg zu dem Ziele, das ich nun doch erreicht habe. Ich lachte über diese auffallende Ähnlichkeit – liebes Mädchen, Du weißt noch nicht alles, was mir in Berlin, und in Dresden, in Bayreuth, ja selbst hier in Würzburg begegnet ist, das alles wird noch einen langen Brief kosten. Damals ärgerte ich mich ebenso über die Steine, die mir in den Weg geworfen wurden, ließ mich aber nicht stören, vergoß zwar heiße Schweißtropfen, aber erreichte doch, wie vorgestern, das Ziel. Das Ersteigen der Berge, wie der Weg zur Tugend, ist besonders wegen der Aussicht, die man eben vor sich hat, beschwerlich. Drei Schritte weit sieht man, weiter nicht, und nichts als die Stufen, die erstiegen werden müssen, und kaum ist ein Stein überschritten, gleich ist ein andrer da, und jeder Fehltritt schmerzt doppelt, und die ganze Mühseligkeit wird gleichsam wiedergekaut – – aber man muß an die Aussicht denken, wenn man den Gipfel erstiegen hat. O wie herrlich war der Anblick des Maintales von dieser Höhe! Hügel und Täler und Wasser, und Städte und Dörfer, alles durcheinander wie ein gewirkter Fußteppich! Der Main wandte sich bald rechts bald links, und küßte bald den einen, bald den andern Rebenhügel, und wankte zwischen seinen beiden Ufern, die ihm gleich teuer schienen, wie ein Kind zwischen Vater und Mutter. Der Felsen mit der Zitadelle sah ernst auf die Stadt herab, und bewachte sie, wie ein Riese sein Kleinod, und an den Außenwerken herum schlich ein Weg, wie ein Spion, und krümmte sich in jede Bastion, als ob er rekognoszieren wollte, wagte aber nicht in die Stadt zu gehen, sondern verlor sich in die Berge –
Aber keine Erscheinung in der Natur kann mir eine so wehmütige Freude abgewinnen, als ein Gewitter am Morgen, besonders wenn es ausgedonnert hat. Wir hatten hier vor einigen Tagen dies Schauspiel – o es war eine prächtige Szene! Im Westen stand das nächtliche Gewitter und wütete, wie ein Tyrann, und von Osten her stieg die Sonne herauf, ruhig und schweigend, wie ein Held. Und seine Blitze warf ihm das Ungewitter zischend zu und schalt ihn laut mit der Stimme des Donners – er aber schwieg der göttliche Stern, und stieg herauf, und blickte mit Hoheit herab auf den unruhigen Nebel unter seinen Füßen, und sah sich tröstend um nach den andern Sonnen, die ihn umgaben, als ob er seine Freunde beruhigen wollte – Und einen letzten fürchterlichen Donnerschlag schleuderte ihm das Ungewitter entgegen, als ob es seinen ganzen Vorrat von Galle und Geifer in einem Funken ausspeien wollte – aber die Sonne wankte nicht in ihrer Bahn, und nahte sich unerschrocken, und bestieg den Thron des Himmels – – und blaß, wie vor Schreck, entfärbte sich die Nacht des Gewölks, und zerstob wie dünner Rauch, und sank unter den Horizont, wenige schwache Flüche murmelnd – –
Aber welch ein Tag folgte diesem Morgen! Laue Luftzüge wehten mich an, leise flüsterte das Laub, große Tropfen fielen mit langen Pausen von den Bäumen, ein mattes Licht lag ausgegossen über die Gegend, und die ganze Natur schien ermattet nach dieser großen Anstrengung, wie ein Held nach der Arbeit des Kampfes – Doch ich wollte ja kein Buch machen und will nur kurz und gut schließen. Schreibe mir, ob Du mir verzeihen kannst, und schicke den Brief an Carln, damit ich ihn bei meiner Ankunft in Berlin gleich empfange. Dann sollst Du mehr hören.
*
Berlin, den 27. Oktober 1800
Mein liebes, bestes Ulrickchen, wie freue ich mich wieder so nahe bei Dir zu sein, und so froh, o ich bin es nie in meinem Leben herzlich gewesen, ich konnte es nicht, jetzt erst öffnet sich mir etwas, das mich aus der Zukunft anlächelt, wie Erdenglück. Mir, mein edles Mädchen, hast Du mit Deiner Unterstützung das Leben gerettet – Du verstehst das wohl nicht? Laß das gut sein. Dir habe ich, nach Brokes, von meiner jetzigen innern Ruhe und Fröhlichkeit, das meiste zu danken, und ich werde das ewig nicht vergessen. Die Toren! Ich war gestern in Potsdam, und alle Leute glaubten, ich wäre darum so seelenheiter, weil ich angestellt würde – o die Toren!
Du möchtest wohl die einzige sein auf dieser Erde, bei der ich zweifelhaft sein könnte, ob ich das Geheimnis aufdecken soll, oder nicht? Zweifelhaft, sagte ich; denn bei jedem andern bin ich entschieden, nie wird es aus meiner Seele kommen. Indessen die Erklärung wäre sehr weitläufig, auch bin ich noch nicht ganz entschieden. Ich weiß wohl, daß Du nicht neugierig bist, aber ohne Teilnahme bist Du auch nicht, und Deiner möchte ich am wenigsten gern kalt begegnen. Also laß mich nur machen. Wir werden uns schon einst verstehen. Für jetzt und immer bleibe verschwiegen über alles.
Nach Frankfurt möchte ich jetzt nicht gern kommen, um das unausstehliche Fragen zu vermeiden, da ich durchaus nicht antworten kann. Denn ob ich gleich das halbe Deutschland durchreiset bin, so habe ich doch im eigentlichsten Sinne nichts gesehen. Von Würzburg über Meinungen, Schmalkalden, Gotha, Erfurt, Naumburg, Merseburg, Halle, Dessau, Potsdam nach Berlin bin ich (47 Meilen) in fünf Tagen gereist, Tag und Nacht, um noch vor dem 1. November hier zu sein.
Brokes ist nicht in Paris, sondern in Dresden, und das darum, weil bis auf den heutigen Tag die 100 Dukaten von Wien nicht angekommen sind. Wir haben aber in Würzburg die nötigen Anstalten getroffen. Sie werden nach Dresden geschickt werden.
Sei so gut und gib Zengen, der auf Urlaub kommen wird, den versiegelten Schlüssel vom Büro; er wird die Sorge übernehmen, alle meine Sachen herzuschaffen.
Ich werde auch etwas Geld in Frankfurt vom Vormunde übrig haben, das sei so gut und schicke mir gleich.
Ich sträube mich nach so vielen Bitten noch eine an Dich zu wagen, aber ich sehe mich wirklich gezwungen dazu, indem ich keinen andern Ausweg weiß. Hältst Du indessen diese Bitte für unbescheiden, so betrachte sie lieber als nicht geschehen und bleibe mir nur gut. Du hast genug für mich getan, um mir wohl einmal etwas abzuschlagen, und ich ehre Dich zu herzlich, als daß das nur eine Ahndung von Unwillen bei mir erwecken könnte.
Die Reise und besonders der Zweck der Reise war zu kostbar für 300 Rth. Brokes hat mir mit fast 200 Rth. ausgeholfen. Ich muß diese Summe ihm jetzt nach Dresden schicken. Er hat zu unaussprechlich viel für mich getan, als daß ich daran denken dürfte, diese Verpflichtung nur einen Augenblick zu versäumen. Du weißt daß ich selbst über mein Vermögen nicht gebieten kann, und Du errätst das übrige. Ich bin in einem Jahre majorenn. Diese Summe zurückzuzahlen wird mich nie reuen, ich achte mein ganzes Vermögen nicht um das, was ich mir auf dieser Reise erworben habe. Also deswegen sei unbesorgt. Antworte mir bald hierauf. Wenn mir diese kleine Unbequemlichkeit abgenommen wird, so wird es mir Mühe kosten, zu erdenken, was mir wohl auf der ganzen Erde zu meiner Zufriedenheit fehlen könne. Das wird mir wohl tun nach einem Leiden von 24 Jahren.
Grüße alles, alles und lebe wohl. Dein Bruder Heinrich.
N. S. Hast Du die Musik von Zengen erhalten? Sie kostet 1 Rth. 8 Gr. Von Leopold habe ich 2 Fr.dor empfangen, der Rest wäre also 11 Rth. Diese ziehe ab von dem Gelde, das Du mir schicken wirst, wenigstens von meinem eignen Gelde. Wegen des Agio auf die Louisdors wird Brokes noch schreiben.
N. S. Sollte Tante gern in mein Büro wollen, wegen der Wäsche, so sorge doch auf eine gute Art dafür, daß der obere Teil, worin die Schreibereien, gar nicht geöffnet werde.
*
Ew. Exzellenz ersuche untertänigst um die Erlaubnis, den Sitzungen der technischen Deputation beiwohnen zu dürfen, damit ich in den Stand gesetzt werde, aus dem Gegenstande der Verhandlungen selbst zu beurteilen, ob ich mich getrauen darf, mich dem Kommerz- und Fabrikenfache zu widmen.
Der ich mit der vollkommensten Hochachtung verharre
Berlin, d. 1. November 1800.
Ew. Exzellenz untertänigster
Kleist
ehemals Lieutenant im Reg. Garde.
*
Berlin, den 13. November 1800
Liebe Wilhelmine, o Dein Brief hat mir eine ganz außerordentliche Freude gewährt. Dich so anzuschmiegen an meine Wünsche, so innig einzugreifen in mein Interesse – o es soll Dir gewiß einst belohnt werden! Grade auf diesem Lebenswege, wo Du alles fahren läßt, was doch sonst die Weiber reizt, Ehre, Reichtum, Wohlleben, grade auf diesem Wege wirst Du um so gewisser etwas anderes finden, das doch mehr wert ist als das alles – Liebe. Denn wo es noch andere Genüsse gibt, da teilt sich das Herz, aber wo es nichts gibt als Liebe, da öffnet sich ihr das ganze Wesen, da umfaßt es ihr ganzes Glück, da werden alle ihre unendlichen Genüsse erschöpft – ja, gewiß, Wilhelmine, Du sollst einst glücklich sein.
Aber laß uns nicht bloß frohen Träumereien folgen – Es ist wahr, wenn ich mir das freundliche Tal denke, das einst unsre Hütte umgrenzen wird, und mich in dieser Hütte und Dich und die Wissenschaften, und weiter nichts – o dann sind mir alle Ehrenstellen und alle Reichtümer verächtlich, dann ist es mir, als könnte mich nichts glücklich machen, als die Erfüllung dieses Wunsches, und als müßte ich unverzüglich an seine Erreichung schreiten – – Aber die Vernunft muß doch auch mitsprechen, und wir wollen einmal hören, was sie sagt. Wir wollen einmal recht vernünftig diesen ganzen Schritt prüfen.
Ich will kein Amt nehmen. Warum will ich es nicht? – O wie viele Antworten liegen mir auf der Seele! Ich kann nicht eingreifen in ein Interesse, das ich mit meiner Vernunft nicht prüfen darf. Ich soll tun was der Staat von mir verlangt, und doch soll ich nicht untersuchen, ob das, was er von mir verlangt, gut ist. Zu seinen unbekannten Zwecken soll ich ein bloßes Werkzeug sein – ich kann es nicht. Ein eigner Zweck steht mir vor Augen, nach ihm würde ich handeln müssen, und wenn der Staat es anders will, dem Staate nicht gehorchen dürfen. Meinen Stolz würde ich darin suchen, die Aussprüche meiner Vernunft geltend zu machen gegen den Willen meiner Obern – nein, Wilhelmine, es geht nicht, ich passe mich für kein Amt. Ich bin auch wirklich zu ungeschickt, um es zu führen. Ordnung, Genauigkeit, Geduld, Unverdrossenheit, das sind Eigenschaften die bei einem Amte unentbehrlich sind, und die mir doch ganz fehlen. Ich arbeite nur für meine Bildung gern und da bin ich unüberwindlich geduldig und unverdrossen. Aber für die Amtsbesoldung Listen zu schreiben und Rechnungen zu führen – ach, ich würde eilen, eilen, daß sie nur fertig würden, und zu meinen geliebten Wissenschaften zurückkehren. Ich würde die Zeit meinem Amte stehlen, um sie meiner Bildung zu widmen – nein, Wilhelmine, es geht nicht, es geht nicht. Ja ich bin selbst zu ungeschickt mir ein Amt zu erwerben. Denn zufrieden mir wirklich Kenntnisse zu erwerben, bekümmert es mich wenig, ob andere sie in mir wahrnehmen. Sie zur Schau aufstellen, oder zum Kauf ausbieten, wäre mir ganz unmöglich – und würde man denjenigen wohl begünstigen, der den Stolz hat, jede Gunst zu entbehren, und der durch keine andere Fürsprache steigen will, als durch die Fürsprache seiner eignen Verdienste? – Aber das Entscheidendste ist dieses, daß selbst ein Amt, und wäre es eine Ministerstelle, mich nicht glücklich machen kann. Mich nicht, Wilhelmine – denn eines ist gewiß, ich bin einmal in meinem Hause glücklich, oder niemals, nicht auf Bällen, nicht im Opernhause, nicht in Gesellschaften, und wären es die Gesellschaften der Fürsten, ja wäre es auch die Gesellschaft unsres eignen Königs – – und wollte ich darum Minister werden, um häusliches Glück zu genießen? Wollte ich darum mich in eine Hauptstadt begraben und mich in ein Chaos von verwickelten Verhältnissen stürzen, um still und ruhig bei meiner Frau zu leben? Wollte ich mir darum Ehrenstellen erwerben und mich darum mit Ordensbändern behängen, um Staat zu machen damit vor meinem Weibe und meinen Kindern? Ich will von der Freiheit nicht reden, weil Du mir schon einmal Einwürfe dagegen gemacht hast, ob Du zwar wohl gleich, wie alle Weiber, das nicht recht verstehen magst; aber Liebe und Bildung sind zwei unerläßliche Bedingungen meines künftigen Glückes – – und was könnte mir in einem Amte davon zuteil werden, als höchstens ein karger, sparsamer Teil von beiden? Wollte ich an die Wissenschaften gehen, so brächte mir der Sekretär einen Stoß voll Akten, und wollte ich einen großen Gedanken verfolgen, so meldete mir der Kammerdiener, daß das Vorzimmer voll Fremden stehe. Wollte ich den Abend bei meinem Weibe zubringen, so ließe mich der König zu sich rufen, und um mir auch die Nächte zu rauben, müßte ich in die Provinzen reisen und die Fabriken zählen. O wie würde ich den Orden und die Reichtümer und den ganzen Bettel der großen Welt verwünschen, wie würde ich bitterlich weinen, meine Bestimmung so unwiederbringlich verfehlt zu haben, wie würde ich mir mit heißer Sehnsucht trocknes Brot wünschen und mit ihm Liebe, Bildung und Freiheit – Nein, Wilhelmine, ich darf kein Amt wählen, weil ich das ganze Glück, das es gewähren kann, verachte.
Aber darf ich mich auch jedem Amte entziehen? – Ach, Wilhelmine, diese spitzfündige Frage haben mir schon so viele Menschen aufgeworfen. Man müsse seinen Mitbürgern nützlich sein, sagen sie, und darin haben sie recht – und darum müsse man ein Amt nehmen, setzen sie hinzu, aber darin haben sie unrecht. Kann man denn nicht Gutes wirken, wenn man auch nicht eben dafür besoldet wird? O ich darf nur an Brokes denken –! Wie vieles Gute, Vortreffliche, tut täglich dieser herrliche Mensch. – Und dann, wenn ich einmal auf Kosten der Bescheidenheit die Wahrheit reden will – habe ich nicht auch während meiner Anwesenheit in Frankfurt unter unsern Familien manches Gute gestiftet –? Durch untadelhaften Lebenswandel den Glauben an die Tugend bei andern stärken, durch weise Freuden sie zur Nachahmung reizen, immer dem Nächsten, der es bedarf, helfen mit Wohlwollen und Güte – ist das nicht auch Gutes wirken; Dich, mein geliebtes Mädchen, ausbilden, ist das nicht etwas Vortreffliches? Und dann, mich selbst auf eine Stufe näher der Gottheit zu stellen – – o laß mich, laß mich! Das Ziel ist gewiß hoch genug und erhaben, da gibt es gewiß Stoff genug zum Handeln – – und wenn ich auch auf dieser Erde nirgends meinen Platz finden sollte, so finde ich vielleicht auf einem andern Sterne einen um so bessern.
Aber kann ich jedes Amt ausschlagen; das heißt, ist es möglich? – Ach, Wilhelmine, wie gehe ich mit klopfendem Herzen an die Beantwortung dieser Frage! Weißt Du wohl noch am letzten Abend den Erfolg unsrer Berechnungen? – Aber ich glaube doch immer noch – ich habe doch noch nicht alle Hoffnung verloren – – Sieh, Mädchen, ich will Dir sagen, wie ich zuerst auf den Gedanken kam, daß es wohl möglich sein müsse. Ich dachte, Du lebst in Frankfurt, ich in Berlin, warum könnten wir denn nicht, ohne mehr zu verlangen, zusammen leben? Aber das Herkommen will, daß wir ein Haus bilden sollen, und unsere Geburt, daß wir mit Anstand leben sollen – o über die unglückseligen Vorurteile! Wie viele Menschen genießen mit wenigem, vielleicht mit einem paar hundert Talern das Glück der Liebe – und wir sollten es entbehren, weil wir von Adel sind? Da dachte ich, weg mit allen Vorurteilen, weg mit dem Adel, weg mit dem Stande – gute Menschen wollen wir sein und uns mit der Freude begnügen, die die Natur uns schenkt. Lieben wollen wir uns, und bilden, und dazu gehört nicht viel Geld – aber doch etwas, doch etwas – und ist das, was wir haben, wohl hinreichend? Ja, das ist eben die große Frage. O wenn ich warten wollte, bis ich mir etwas erwerben kann, oder will, o dann bedürften wir weiter nichts als Geduld, denn das ist mir in der Folge gewiß. – Laß mich ganz aufrichtig sein, liebes Mädchen. Ich will von mir mit Dir reden, als spräche ich mit mir selbst. Gesetzt Du fändest die Rede eitel, was schadet es? Du bist nichts anders als ich, und vor Dir will ich nicht besser erscheinen, als vor mir selbst, auch Schwächen will ich vor Dir nicht verstecken. Also aufrichtig und ohne allen Rückhalt.
Ich bilde mir ein, daß ich Fähigkeiten habe, seltnere Fähigkeiten, meine ich – Ich glaube es, weil mir keine Wissenschaft zu schwer wird; weil ich rasch darin vorrücke, weil ich manches schon aus eigener Erfindung hinzugetan habe – und am Ende glaube ich es auch darum, weil alle Leute es mir sagen. Also kurz, ich glaube es. Da stünde mir nun für die Zukunft das ganze schriftstellerische Fach offen. Darin fühle ich, daß ich sehr gern arbeiten würde. – O da ist die Aussicht auf Erwerb äußerst vielseitig. Ich könnte nach Paris gehen und die neueste Philosophie in dieses neugierige Land verpflanzen – doch das siehst Du alles so vollständig nicht ein, als ich. Da müßtest Du schon meiner bloßen Versicherung glauben, und ich versichere Dir hiermit, daß wenn Du mir nur ein paar Jahre, höchstens sechs, Spielraum gibst, ich dann gewiß Gelegenheit finden werde, mir Geld zu erwerben.
Aber so lange sollen wir noch getrennt sein –? Liebe Wilhelmine, ich will auch hierin ganz aufrichtig sein. Ich fühle, daß es mir notwendig ist, bald ein Weib zu haben. Dir selbst wird meine Ungeduld nicht entgangen sein – ich muß diese unruhigen Wünsche, die mich unaufhörlich wie Schuldner mahnen, zu befriedigen suchen. Sie stören mich in meinen Beschäftigungen – auch damit ich moralisch gut bleibe, ist es nötig – Sei aber ganz ruhig, ich bleibe es gewiß. Nur kämpfen möchte ich nicht gern. Man muß sich die Tugend so leicht machen als möglich. Wenn ich nur erst ein Weib habe, so werde ich meinem Ziele ganz ruhig und ganz sicher entgegen gehen – aber bis dahin – o werde bald, bald, mein Weib.
Also ich wünsche es mit meiner ganzen Seele und entsage dem ganzen prächtigen Bettel von Adel und Stand und Ehre und Reichtum, wenn ich nur Liebe bei Dir finde. Wenn es nur möglich ist, daß wir so ohne Mangel beieinander leben können etwa sechs Jahre lang, nämlich bis so lange, wo ich mir etwas zu erwerben hoffe, o dann bin ich glücklich.
Aber ist dies möglich –? O du gutes, treffliches Mädchen! Ist es möglich, so ist es nur durch Dich möglich. Hätte mich mein Schicksal zu einem andern Mädchen geführt, das nicht so anspruchslos und genügsam wäre, wie Du, ja dann müßte ich diesen innigsten Wunsch unfehlbar unterdrücken. Aber auch Du willst nichts, als Liebe und Bildung – o beides sollst Du von mir erhalten, von dem ersten mehr selbst als Du fordern wirst, von dem andern so viel ich geben kann, aber beides mit Freuden. Ich erwarte mit Sehnsucht Deine Berechnung. Du kannst das alles besser prüfen als ich. Aber laß Dich nicht verführen von Deiner Liebe. Sei karg gegen mich, aber nicht gegen Dich. Nein, ich schwöre Dir, ich will Dich mit dieser scheinbaren Selbstverleugnung nicht an Edelmut übertreffen. Setze also nicht vergeblich Edelmut an Edelmut, das würde unser beiderseitiges Interesse verwirren. Laß uns wahr sein, ohne geschraubte Tugend. Wenn ich weniger verlange, als Du, so ist das keine Selbstverleugnung, die mir ein Opfer kostet. Ich fühle, daß ich wirklich wenig bedarf, und mit wahrer Freude würde ich selbst manches entbehren, um Dich damit froher zu machen. Das ist mein Ernst, Wilhelmine, also laß mir diese Freude. Überfluß wirst Du nicht verlangen, aber an dem Notwendigen, darf es Dir niemals fehlen, o niemals, denn das würde mich selbst unglücklich machen. Also sei nicht karg gegen Dich in der Berechnung. Fordere lieber mehr als Du brauchst, als weniger. Es steht ja doch immer in der Folge bei Dir, mir zufließen zu lassen, was Du übrig hast, und dann werde ich es gewiß immer gern von Dir annehmen. Ist es unter diesen Bedingungen nicht möglich, daß wir uns bald vereinigen – nicht möglich, nun denn, so müssen wir auf günstigere Zeiten hoffen – aber dann ist die Aussicht dunkel, o sehr dunkel – und das Schrecklichste wäre mir, Dich betrogen zu haben, Dich, die mich so innig liebte – o weg mit dem abscheulichen Gedanken.
Indessen ich weiß doch noch ein Mittel, selbst wenn unser Vermögen Deiner Berechnung nicht entspräche. Es ist dieses, mir durch Unterricht wenigstens jährlich ein paar hundert Taler zu erwerben. Lächle nicht und bemühe Dich nur ja, alle Vorurteile zu bekämpfen. Ich bin sehr fest entschlossen, den ganzen Adel von mir abzuwerfen. Viele Männer haben geringfügig angefangen und königlich ihre Laufbahn beschlossen. Shakespeare war ein Pferdejunge und jetzt ist er die Bewunderung der Nachwelt. Wenn Dir auch die eine Art von Ehre entgeht, so wird Dir doch vielleicht einst eine andere zuteil werden, die höher ist – Wilhelmine, warte zehn Jahre und Du wirst mich nicht ohne Stolz umarmen.
Mein Plan in diesem Falle wäre dieser. Wir hielten uns irgendwo in Frankreich auf, etwa in dem südlichen Teile, in der französischen Schweiz, in dem schönsten Erdstriche von Europa – und zwar aus diesem Grunde, um Unterricht dort in der deutschen Sprache zu geben. Du weißt, wie überhäuft mit Stunden hier bei uns die Emigrierten sind; das möchte in Frankreich noch mehr der Fall sein, weil es da weniger Deutsche gibt, und doch von der Akademie und von allen französischen Gelehrten unaufhörlich die Erlernung der deutschen Sprache anempfohlen wird, weil man wohl einsieht, daß jetzt von keinem Volke der Erde mehr zu lernen ist, als von den Deutschen. Dieser Aufenthalt in Frankreich wäre mir aus 3 Gründen lieb. Erstlich, weil es mir in dieser Entfernung leicht werden würde, ganz nach meiner Neigung zu leben, ohne die Ratschläge guter Freunde zu hören, die mich und was ich eigentlich begehre, ganz und gar nicht verstehen; zweitens, weil ich so ein paar Jahre lang ganz unbekannt leben könnte und ganz vergessen werden würde, welches ich recht eigentlich wünsche; und drittens, welches der Hauptgrund ist, weil ich mir da recht die französische Sprache aneignen könnte, welches zu der entworfnen Verpflanzung der neuesten Philosophie in dieses Land, wo man von ihr noch gar nichts weiß, notwendig ist. – Schreibe mir unverhohlen Deine Meinung über dieses. – Aber daß ja niemand etwas von diesem Plane erfährt. Wenn Du nicht mein künftiges Weib wärest, so hätte ihn vor der Ausführung kein Mensch von mir erfahren. – Lerne nur auf jeden Fall recht fleißig die französische Sprache. – Wie Vater zur Einwilligung zu bringen ist, davon ein andermal. – Ist das alles nicht ausführbar, so bleibt uns, bis zum Tode, eins gewiß, nämlich meine Liebe Dir, und Deine Liebe mir. Ich wenigstens gebe nie einem andern Mädchen meine Hand, als Dir.
Und nun muß ich schließen. Ich kann jetzt nicht mehr so lange Briefe schreiben, als auf der Reise, denn jetzt muß ich für Dich und mich arbeiten. Und doch habe ich Dir noch so vieles zu sagen, z. B. über Deine Bildung. O wenn ich bei Dir wäre, so wäre das alles weit kürzer abgemacht. Ich wollte Dir bei meiner Anwesenheit in Frankfurt vorschlagen, ob Du Dir nicht ein Tagebuch halten wolltest, nämlich ob du nicht alle Abend aufschreiben wolltest, was Du am Tage sahst, dachtest, fühltest etc. Denke einmal darüber nach, ob das nicht gut wäre. Wir werden uns in diesem unruhigen Leben so selten unsrer bewußt – die Gedanken und die Empfindungen verhallen wie ein Flötenton im Orkane – so manche Erfahrung geht ungenutzt verloren – das alles kann ein Tagebuch verhüten. Auch lernen wir dadurch Freude aus uns selbst entwickeln, und das möchte wohl gut sein für Dich, da Du von außen, außer von mir, wenige Freude empfangen wirst. Das könntest Du mir dann von Zeit zu Zeit mitteilen – aber Du müßtest Dich darum nicht weniger strenge prüfen – ich werde nicht hart sein – denke an Deine Verzeihung meines Fehltritts. – Ich werde Dir auch in meinen Briefen alles mitteilen, was mir begegnet. – Adieu. Ich küsse Dein Bild.
H. K.
*
An das Stiftsfräulein Wilhelmine von Zenge Hochwürden und Hochwohlgeb. zu Frankfurt an der Oder.
Berlin, den 16. (und 18.) November (und Zusatz vom 30. Dez.) 1800
Für Wilhelminen
Man erzählt von Newton, es sei ihm, als er einst unter einer Allee von Fruchtbäumen spazieren ging, ein Apfel von einem Zweige vor die Füße gefallen. Wir beide würden bei dieser gleichgültigen und unbedeutenden Erscheinung nicht viel Interessantes gedacht haben. Er aber knüpfte an die Vorstellung der Kraft, welche den Apfel zur Erde trieb, eine Menge von folgenden Vorstellungen, bis er durch eine Reihe von Schlüssen zu dem Gesetze kam, nach welchem die Weltkörper sich schwebend in dem unendlichen Raume erhalten.
Galilei mußte zuweilen in die Kirche gehen. Da mochte ihm wohl das Geschwätz des Pfaffen auf der Kanzel ein wenig langweilig sein, und sein Auge fiel auf den Kronleuchter, der von der Berührung des Ansteckens noch in schwebender Bewegung war. Tausende von Menschen würden, wie das Kind, das die schwebende Bewegung der Wiege selbst fühlt, dabei vollends eingeschlafen sein. Ihm aber, dessen Geist immer schwanger war mit großen Gedanken, ging plötzlich ein Licht auf, und er erfand das Gesetz des Pendels, das in der Naturwissenschaft von der äußersten Wichtigkeit ist.
Es war, dünkt mich, Pilâtre, der einst aus seinem Zimmer den Rauch betrachtete, der aus einer Feueresse wirbelnd in die Höhe stieg. Das mochten wohl viele Menschen vor ihm auch gesehen haben. Sie ließen es aber dabei bewenden. Ihm aber fiel der Gedanke ein, ob der Rauch, der doch mit einer gewissen Kraft in die Höhe stieg, nicht auch fähig wäre, mit sich eine gewisse Last in die Höhe zu nehmen. Es versuchte es und ward der Erfinder der Luftschiffahrtskunst.
Colomb stand grade an der Küste von Portugal, als der Wind ein Stück Holz ans Ufer trieb. Ein andrer, an seiner Stelle, würde dies vielleicht nicht wahrgenommen haben und wir wüßten vielleicht noch nichts von Amerika. Er aber, der immer aufmerksam war auf die Natur, dachte, in der Gegend, von welcher das Holz herschwamm, müsse wohl ein Land liegen, weil das Meer keine Bäume trägt, und er ward der Entdecker des 4. Weltteiles.
In einer holländischen Grenzfestung saß seit langen Jahren ein Gefangener. In dem Gefängnisse, glaubt man, lassen sich nicht viele interessante Betrachtungen anstellen. Ihm aber war jede Erscheinung merkwürdig. Er bemerkte eine gewisse Übereinstimmung in dem verschiedenen Bau der Spinngewebe mit der bevorstehenden Witterung, so daß er untrüglich das Wetter vorhersagen konnte. Dadurch ward er der Urheber einer höchst wichtigen Begebenheit. Denn als in dem französischen Kriege Holland unter Wasser gesetzt worden war, und Pichegru im Winter mit einem Heere über das Eis bis an diese Festung vordrang, und nun plötzlich Tauwetter einfiel und der französische Feldherr, seine Armee vor dem Wassertode zu retten, mit der größten Eilfertigkeit zurückzukehren befahl, da trat dieser Gefangene auf und ließ dem General sagen, er könne ruhig stehen bleiben, in 2 Tagen falle wieder Frost ein, er stehe mit seinem Kopfe für die Erfüllung seiner Prophezeiung – – und Holland ward erobert. –
Diese Beispiele mögen hinreichend sein, Dir, mein liebes Mädchen, zu zeigen, daß nichts in der ganzen Natur unbedeutend und gleichgültig und jede Erscheinung der Aufmerksamkeit eines denkenden Menschen würdig ist.
Von Dir werde ich freilich nicht verlangen, daß Du durch Deine Beobachtungen die Wissenschaften mit Wahrheiten bereicherst, aber Deinen Verstand kannst Du damit bereichern und tausendfältig durch aufmerksame Wahrnehmung aller Erscheinungen üben.
Das ist es, liebes Mädchen, wozu ich Dir in diesem Bogen die Anleitung geben will.
Mir leuchtet es immer mehr und mehr ein, daß die Bücher schlechte Sittenlehrer sind. Was wahr ist sagen sie uns wohl, auch wohl, was gut ist, aber es dringt in die Seele nicht ein. Einen Lehrer gibt es, der ist vortrefflich, wenn wir ihn verstehen; es ist die Natur.
Ich will Dir das nicht durch ein langes Geschwätz beweisen, sondern lieber durch Beispiele zeigen, die wohl immer, besonders bei Weibern, die beste Wirkung tun möchten.
Ich ging an jenem Abend vor dem wichtigsten Tage meines Lebens in Würzburg spazieren. Als die Sonne herabsank war es mir als ob mein Glück unterginge. Mich schauerte wenn ich dachte, daß ich vielleicht von allem scheiden müßte, von allem, was mir teuer ist.
Da ging ich, in mich gekehrt, durch das gewölbte Tor, sinnend zurück in die Stadt. Warum, dachte ich, sinkt wohl das Gewölbe nicht ein, da es doch keine Stütze hat? Es steht, antwortete ich, weil alle Steine auf einmal einstürzen wollen – und ich zog aus diesem Gedanken einen unbeschreiblich erquickenden Trost, der mir bis zu dem entscheidenden Augenblicke immer mit der Hoffnung zur Seite stand, daß auch ich mich halten würde, wenn alles mich sinken läßt.
Das, mein liebes Minchen, würde mir kein Buch gesagt haben, und das nenne ich recht eigentlich lernen von der Natur.
Einen ähnlichen Trost hatte ich schon auf der Hinreise nach W. Ich stand nämlich mit dem Rücken gegen die Sonne und blickte lange in einen lebhaften Regenbogen. So fällt doch, dachte ich, immer ein Strahl von Glück auf unser Leben, und wer der Sonne selbst den Rücken kehrt und in die trübe Wetterwolke schaut, dem wirft ihr schönres Bild der Regenbogen zu.
In jener herrlichen Nacht, als ich von Leipzig nach Dresden reisete, dachte ich mit wehmütiger Freude: am Tage sehn wir wohl die schöne Erde, doch wenn es Nacht ist sehn wir in die Sterne.
O es gibt Augenblicke, wo uns solche Winke der Natur, wie die freundliche Rede eines Lehrers, entzücken können.
den 18. November
Bemühe Dich also von jetzt an, recht aufmerksam zu sein, auf alle Erscheinungen, die Dich umgeben. Keine ist unwichtig, jede, auch die scheinbar unbedeutendste, enthält doch etwas, das merkwürdig ist, wenn wir es nur wahrzunehmen wissen. Aber bestrebe Dich, nicht bloß die Erscheinungen wahrzunehmen, sondern auch etwas von ihnen zu lernen. Frage bei jeder Erscheinung entweder: worauf deutet das hin? und dann wird die Antwort Dich mit irgend einer nützlichen Lehre bereichern; oder frage wenigstens, wenn das nicht geht: womit hat das eine Ähnlichkeit? und dann wird das Auffinden des Gleichnisses wenigstens Deinen Verstand schärfen.
Ich will Dir auch dieses durch einige anleitende Beispiele erläutern.
Daß Du nicht, wie das Tier, den Kopf zur Erde neigst, sondern aufrecht gebaut bist und in den Himmel sehen kannst – worauf deutet das hin; – beantworte mir einmal das.
Du hast zwei Ohren und doch nur einen Mund. Mit den Ohren sollst Du hören, mit dem Munde sollst Du reden. – Das hältst Du wohl für etwas sehr Gleichgültiges? Und doch läßt sich daraus eine höchst wichtige Lehre ziehen. Frage Dich einmal selbst, worauf das hindeutet, daß Du mehr Ohren hast als Münder? – Troschke könnte die Antwort gebrauchen.
Du allein singst nur einen Ton, ich allein singe auch nur einen Ton; wenn wir einen Akkord hören wollen, so müssen wir beide zusammen singen. – Worauf deutet das hin?
Wenn Du spazieren gehst und in die Sonne blickst, so wenden Dir alle Gegenstände ihre Schattenseite zu – Eine Lehre möchte sich daraus nicht ziehen lassen, aber ein sehr interessantes Gleichnis. Also frage Dich einmal: womit hat das eine Ähnlichkeit?
Ich ging letzthin in der Nacht durch die Königsstraße. Ein Mann kam mir entgegen mit einer Laterne. Sich selbst leuchtete er auf den Weg, mir aber machte er es noch dunkler. – Mit welcher Eigenschaft des Menschen hat diese Blendlaterne Ähnlichkeit?
Ein Mädchen, das verliebt ist, und es vor der Welt verbergen will, spielt in Gegenwart ihres Geliebten gewöhnlich mit dem Fächer. Ich nenne einen solchen Fächer einen Telegraphen (zu deutsch: Fernschreiber) der Liebe. – Warum?
Der Sturm reißt den Baum um, aber nicht das Veilchen, der leiseste Abendwind bewegt das Veilchen, aber nicht den Baum. – Womit hat das eine vortreffliche Ähnlichkeit?
Solche und ähnliche Fragen wirf Dir, mein liebes Minchen, selbst recht oft auf und suche sie dann zu beantworten. An Stoff zu solchen Fragen kann es Dir niemals fehlen, wenn Du nur recht aufmerksam bist auf alles, was Dich umgibt. Kannst Du die Frage nicht gleich beantworten, so glaube nicht, daß die Antwort unmöglich sei; aber setze die Beantwortung aus, denn unangenehm darfst Du Dir diese Beschäftigung nicht machen, die unserm ganzen Leben großen Reiz geben, die Wichtigkeit aller uns umgebenden Dinge erhöhen und eben dadurch für uns höchst angenehm werden kann. Das heißt recht eigentlich unsern Verstand gebrauchen – und dazu haben wir ihn doch?
Wenn Dir aber die Antwort gelingt, so zeichne den ganzen Gedanken gleich auf, in einem dazu bestimmten Hefte. Denn festhalten müssen wir, was wir uns selbst erworben haben – auch will ich Dir in der Folge noch einen andern Grund sagen warum es gut ist, wenn Du das aufschreibst.
Also von heute an mußt Du jeden Spaziergang bedauern oder vielmehr bereuen, der Dich nicht wenigstens um 1 Gedanken bereichert hätte; und wenn gar ein ganzer Tag ohne solche moralische Revenüen vergeht, und wenn gar ganze Wochen ohne solche Einkünfte verstreichen, – dann – dann – – Ja, mein liebes Minchen, ein Kapital müssen wir haben, und wenn es kein Geld ist, so muß es Bildung sein, denn mit dem Körper können wir wohl darben, aber mit dem Geiste müssen wir es niemals, niemals – und wovon wollen wir leben, wenn wir nicht bei Zeiten sammeln?
Widme Dich also diesem Geschäft so oft als möglich, ja bei der Arbeit selbst. Dadurch wird recht eigentlich die Arbeit veredelt, wenn sie nicht nur unsern Körper sondern auch unsern Geist beschäftigt. Daß dieses allerdings möglich sei, wirst Du bei einiger Betrachtung leicht finden.
Wenn Dir beim Stricken des Strumpfes eine Masche von der Nadel fällt, und Du, ehe Du weiter strickst, behutsam die Masche wieder aufnimmst, damit nicht der eine aufgelöste Knoten alle die andern auflöse und so das ganze künstliche Gewebe zerstört werde – welche nützliche Lehre gibt Dir das für Deine Bildung, oder wohin deutet das?
Wenn Du in der Küche das kochend-heiße Wasser in das kühlere Gefäß gießest, und die sprudelnde Flüssigkeit, indem sie das Gefäß ein wenig erwärmt, selbst dadurch abgekühlt wird, bis die Temperaturen (Wärmegrade) in beiden sich ins Gleichgewicht gesetzt haben – welche vortreffliche Hoffnung ist daraus für uns beide, und besonders für mich zu ziehen, oder worauf deutet das hin?
Ja, um Dir ein Beispiel von der gemeinsten Beschäftigung zu geben – wenn Du ein schmutziges Schnupftuch mit Wasser auswäschst, welches Buch kann Dir eine so hohe, erhabene Lehre geben, als diese Arbeit? Bedürfen wir mehr als bloß rein zu sein, um mit der schönsten Farbe der Unschuld zu glänzen?
Aber die beste Anleitung, Dich im Selbstdenken zu üben, möchte doch wohl ein nützliches Buch sein, etwa Wünschs kosmologische (weltbürgerliche) Unterhaltungen, das ich Dir geschenkt habe. Wenn Du das täglich ein Stündchen in die Hand nähmest, so würdest Du davon einen doppelten Nutzen haben. Erstens, die Natur selbst näher kennen zu lernen, und dann Stoff zu erhalten, um eigne Gedanken anzuknüpfen.
Nämlich so: Gesetzt Du fändest darin den Satz, daß die äußere (vordere) Seite des Spiegels nicht eigentlich bei dem Spiegel die Hauptsache sei, ja, daß diese eigentlich weiter nichts ist, als ein notwendiges Übel, indem sie das eigentliche Bild nur verwirrt, daß es aber hingegen vorzüglich auf die Glätte und Politur der inneren (hinteren) Seite ankomme, wenn das Bild recht rein und treu sein soll – – welchen Wink gibt uns das für unsere eigne Politur, oder wohin deutet das?
Oder gesetzt Du fändest darin den Satz, daß zwei Marmorplatten nur dann unzertrennlich aneinander hangen, wenn sie sich in allen ihren Punkten berühren. Womit haben die Marmorplatten Ähnlichkeit?
Oder, daß die Pflanze ihre Nahrung mehr aus der Luft und dem Regen, also mehr aus dem Himmel ziehen muß, als aus der Erde, um zu gedeihen – welche zarte Pflanze des Herzens muß das auch?
Bei jedem solchen interessanten Gedanken müßtest Du also immer fragen, entweder: wohin deutet das, wenn man es auf den Menschen bezieht? oder: was hat das für eine Ähnlichkeit, wenn man es mit dem Menschen vergleicht? Denn der Mensch und die Kenntnis seines ganzen Wesens muß Dein höchstes Augenmerk sein, weil es einst Dein Geschäft sein wird, Menschen zu bilden.
Gesetzt also, Du fändest in diesem Buche, daß die Luftsäure (eine Luftart) sich aus der Fäulnis entwickele und doch auch vor der Fäulnis sichere; so müßtest Du nun fragen, welche Ähnlichkeit hat das wohl, wenn man es in irgend einer Hinsicht mit dem Menschen vergleicht? Da wirst Du leicht finden, daß sich aus dem Laster des Menschen etwas entwickele, das davor sichert, nämlich die Reue.
Wenn Du liesest, daß die glänzende Sonne keine Flecken habe, wenn man sie nicht mühsam mit dem Teleskop aufsuche, um sie zu finden – welch eine vortreffliche Lehre gibt uns das?
O letzthin ward ich plötzlich durch einen bloßen Anblick zurückgeführt im Geiste durch anderthalb Jahre in jene Zeit, wo wir noch unempfindlich neben einander wohnten, unbewußt, daß wir uns einst so nahe verwandt sein würden. Ich öffnete nämlich das Schubfach meines Tisches, in welchem mein Feuerzeug, Stahl und Stein lag. Da liegen sie nebeneinander, dachte ich, als ob sie zu einander nicht gehörten, und wenden einander ihre kalten Seiten zu, und noch läßt sich der Funke nicht ahnden, der doch in beiden schlummert – – Aber jetzt umschließe ich Dich innig mit meinem warmen Herzen, mein liebes, liebes Minchen – o der erste Funke fing Feuer – vielleicht wäre er doch erloschen, aber Du hast es wohl verstanden, ihn zur Flamme anzufachen – o erhalte sie in der Glut, mein eignes Glück hängt daran, aber von Dir nur hängt es ab. O wache, wie die Vestalinnen, über die heilige Flamme, daß sie nicht erlösche, lege von Zeit zu Zeit etwa ein neues erworbenes Verdienst hinzu, und schlafe nie ein auf den Stufen – o dann wird die Flamme ewig lodern und beide, uns beide, erwärmen.
Und nun lebe wohl. – Doch ich wollte Dir ja noch einen andern Grund sagen, warum es gut wäre, Deine eigenen Gedanken aufzuschreiben. Er ist dieser. Du weißt daß ich mich jetzt für das schriftstellerische Fach bilde. Ich selbst habe mir schon ein kleines Ideenmagazin angelegt, das ich Dir wohl einmal mitteilen und Deiner Beurteilung unterwerfen möchte. Ich vergrößere es täglich. Wenn Du auch einen kleinen Beitrag dazu liefertest, so könntest Du den Stolz haben, zu einem künftigen Erwerb auch etwas beizutragen. – Verstehst Du mich? –
Und nun adieu. Ich danke Dir für die 6 Fr.dor. In kurzem erhältst Du sie wieder. Schreibe mir bald, und besonders schicke mir bald die Berechnung. Adieu.
H. K.
N. S. Weißt Du wohl, daß Brokes ganz unvermutet angekommen ist, und den Winter bei uns wohnen wird? – O hättest Du auch bei Dir eine Freundin, die Dir das wäre, was dieser Mensch mir! Ich bin sehr vergnügt, und muß Dich herzlich küssen. Adieu.
[Zusatz vom 30. Dez. 1800:]
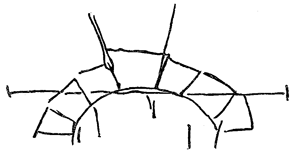
[Frankfurt a. d. O.,] den 30. Xbr 1800,
am vorletzten Tage im alten Jahrhundert.
*
Berlin, den 22. November 1800
Liebe Wilhelmine. Deinen Brief empfing ich grade, als ich sinnend an dem Fenster stand und mit dem Auge in den trüben Himmel, mit der Seele in die trübe Zukunft sah. Ich war nicht recht froh, – da glaubte ich durch Deinen Brief aufgeheitert zu werden – aber Du schreibst mir, daß auch Dich die Zukunft beunruhigt, ja daß Dich diese Unruhe sogar krank macht – o da ward ich ganz traurig, da konnte ich es in dem engen Zimmer nicht mehr aushalten, da zog ich mich an, und lief, ob es gleich regnete, im Halbdunkel des Abends, durch die kotigen Straßen dieser Stadt, mich zu zerstreuen und mein Schicksal zu vergessen.
Liebe Wilhelmine! Wenn diese Stimmung in uns herrschend wird, so werden wir die Zeit der Geduld, die uns das Schicksal auferlegt, sehr unglücklich durchleben.
Wenn ich mir ein Glück dachte, das unsere Herzen, das meinige wenigstens, ganz ausfüllen könnte, wenn dieses Glück nicht ganz erreichbar ist, wenn die Vorschläge zu seiner Erreichung Dir unausführbar scheinen, ist denn darum alles verloren? Noch habe ich die Laufbahn in dem Fabrikwesen nicht verlassen, ich wohne den Sitzungen der technischen Deputation bei, der Minister hat mich schriftlich eingeladen, mich anstellen zu lassen, und wenn Du darauf bestehst, so will ich nach zwei Jahren drei Jahre lang reisen und dann ein Amt übernehmen, das uns wohl Geld und Ehre, aber wenig häusliches Glück gewähren wird.
Liebe Wilhelmine, vergißt Du denn, daß ich nur darum so furchtsam bin, ein Amt zu nehmen, weil ich fürchte, daß wir beide darin nicht recht glücklich sein würden? Vergißt Du, daß mein ganzes Bestreben dahin geht, Dich und mich wahrhaft glücklich zu machen? Willst Du etwas anderes, als bloß häusliches Glück? Und ist es nicht der einzige Gegenstand meiner Wünsche, Dir und mir dieses Glück, aber ganz uneingeschränkt, zu verschaffen?
Also sei ruhig. Bei allem was ich unternehmen werde, wird mir immer jenes letzte Ziel vorschweben, ohne das ich auf dieser Erde niemals glücklich sein kann, nämlich, einst und zwar so bald als möglich, das Glück der Ehe zu genießen.
Glaubst Du nicht, daß ich bei so vielen Bewegungsgründen, mich zu einem brauchbaren Mann zu bilden, endlich brauchbar werden werde? Glaubst Du nicht, daß ich Kräfte genug sammeln werde, einst Dich und mich zu ernähren? Glaubst Du nicht, daß ich mir, bei der vereinten Richtung aller meiner Kräfte auf ein einziges Ziel, endlich ein so bescheidnes Glück, wie das häusliche, erwerben werde?
Daß Dir die Trennung von Deiner Familie so schmerzhaft scheint, ist natürlich und gut. Es entspricht zwar meinen Wünschen nicht, aber Du weißt, warum meine Wünsche gegen die Deinigen immer zurückstehen. Mein Glück ist freilich an niemanden gebunden, als bloß an Dich – indessen daß es bei Dir anders ist, ist natürlich und ich verzeihe es Dir gern.
Aber der Aufenthalt bei T[ante] M[assow] und die Verknüpfung unsrer Wirtschaft mit der ihrigen, würde uns doch so abhängig machen, uns so in ein fremdes Interesse verflechten, und unsrer Ehe so ihr Eigentümliches, nämlich eine eigne Familie zu bilden, rauben, daß ich Dich bloß an alle diese Übel erinnern zu brauchen glaube, um Dich zu bewegen, diesen Vorschlag aufzugeben.
Dagegen könnte ich bei meiner Majorennität das ganze Haus selbst übernehmen und bewirtschaften, woraus mancher Vorteil vielleicht entspringen könnte. Ich könnte auch in der Folge ein akademisches Lehramt in Frankfurt übernehmen, welches noch das einzige wäre, zu dem ich mich gern entschließen könnte. Du siehst also, daß noch Aussichten genug vorhanden sind, um ruhig zu sein.
Also sei es, liebes Mädchen. O inniger, heißer, kannst Du gewiß eine baldige Vereinigung nicht wünschen, als ich. Beruhige Dich mit diesen Wünschen, die gewiß Deine guten Fürsprecher sind. Sie werden meine Tätigkeit unaufhörlich spornen, sie werden meine Kräfte nie erschlaffen, meinen Mut nie sinken lassen, und endlich mich zu dem glücklichen Tage führen – o Wilhelmine! – –
Auf Weihnachten möchte ich wohl nach F. kommen – Du siehst es doch gern? Ich bringe Dir dann etwas mit. Adieu.
Dein ewig treuer Freund H. K.
*
Berlin, den 25. November 1800
Liebe Ulrike. Die überschickten 260 Rth. habe ich erhalten und wünsche statt des Dankes herzlich, für so viele mir erfüllten Wünsche, Dir auch einmal einen der Deinigen erfüllen zu können.
Ich habe jetzt manches auf dem Herzen, das ich zwar allen verschweigen muß, aber doch Dir gern mitteilen möchte, weil ich von Dir nicht fürchten darf, ganz mißverstanden zu werden.
Indessen das würde, wenn ich ausführlich sein wollte, einen gar zu langen Brief kosten, und daher will ich Dir nur ganz kurz einige Hauptzüge meiner jetzigen Stimmung mitteilen.
Ich fühle mich nämlich mehr als jemals abgeneigt, ein Amt zu nehmen. Vor meiner Reise war das anders – jetzt hat sich die Sphäre für meinen Geist und für mein Herz ganz unendlich erweitert – das mußt Du mir glauben, liebes Mädchen.
So lange die Metallkugel noch kalt ist, so läßt sie sich wohl hineinschieben in das enge Gefäß, aber sie paßt nicht mehr dafür, wenn man sie glühet – fast so wie der Mensch nicht für das Gefäß eines Amtes, wenn ein höheres Feuer ihn erwärmt.
Ich fühle mich zu ungeschickt mir ein Amt zu erwerben, zu ungeschickt es zu führen, und am Ende verachte ich den ganzen Bettel von Glück zu dem es führt.
Als ich diesmal in Potsdam war, waren zwar die Prinzen, besonders der jüngere, sehr freundlich gegen mich, aber der König war es nicht – und wenn er meiner nicht bedarf, so bedarf ich seiner noch weit weniger. Denn mir möchte es nicht schwer werden, einen andern König zu finden, ihm aber, sich andere Untertanen aufzusuchen.
Am Hofe teilt man die Menschen ein, wie ehemals die Chemiker die Metalle, nämlich in solche, die sich dehnen und strecken lassen, und in solche, die dies nicht tun – Die ersten, werden dann fleißig mit dem Hammer der Willkür geklopft, die andern aber, wie die Halbmetalle, als unbrauchbar verworfen.
Denn selbst die besten Könige entwickeln wohl gern das schlummernde Genie, aber das entwickelte drücken sie stets nieder; und sie sind wie der Blitz, der entzündliche Körper wohl entflammt, aber die Flamme ausschlägt.
Ich fühle wohl, daß es unschicklich ist, so etwas selbst zu sagen, indessen kann ich nicht leugnen, daß mir der Gedanke durch die Seele geflogen ist, ob es mir nicht einst so gehen könnte?
Wahr ist es, daß es mir schwer werden würde, in ein Interesse einzugreifen, das ich gar nicht prüfen darf – und das muß ich doch, wenn ich bezahlt werde?
Es wäre zwar wohl möglich, daß ich lernen könnte, es wie die andern zu machen – aber Gott behüte mich davor.
Ja, wenn man den warmen Körper unter die kalten wirft, so kühlen sie ihn ab – und darum ist es wohl recht gut, wenn man fern von den Menschen bleibt.
Das wäre auch recht eigentlich mein Wunsch – aber wie ich das ausführen werde, weiß ich noch nicht, und nie ist mir die Zukunft dunkler gewesen als jetzt, obgleich ich nie heitrer hineingesehen habe als jetzt.
Das Amt, das ich annehmen soll, liegt ganz außer dem Kreise meiner Neigung. Es ist praktisch so gut wie die andern Finanzämter. Als der Minister mit mir von dem Effekt einer Maschine sprach, so verstand ich ganz natürlich darunter den mathematischen. Aber wie erstaunte ich, als sich der Minister deutlicher erklärte, er verstehe unter dem Effekt einer Maschine, nichts anders, als das Geld, das sie einbringt.
Übrigens ist, so viel ich einsehe, das ganze preußische Kommerzsystem sehr militärisch – und ich zweifle, daß es an mir einen eifrigen Unterstützer finden würde. Die Industrie ist eine Dame, und man hätte sie fein und höflich aber herzlich einladen sollen, das arme Land mit ihrem Eintritt zu beglücken. Aber da will man sie mit den Haaren herbei ziehn – ist es ein Wunder, wenn sie schmollt? Künste lassen sich nicht, wie die militärischen Handgriffe erzwingen. Aber da glaubt man, man habe alles getan, wenn man Messen zerstört, Fabriken baut, Werkstühle zu Haufen anlegt – Wem man eine Harmonika schenkt, ist der darum schon ein Künstler? Wenn er nur die Musik erst verstünde, so würde er sich schon selbst ein Instrument bauen. Denn Künste und Wissenschaften, wenn sie sich selbst nicht helfen, so hilft ihnen kein König auf. Wenn man sie in ihrem Gange nur nicht stört, das ist alles, was sie von den Königen begehren. – Doch ich kehre zur Hauptsache zurück.
Ich werde daher wahrscheinlich diese Laufbahn nicht verfolgen. Doch möchte ich sie gern mit Ehren verlassen und wohne daher, während dieses Winters, den Sessionen der technischen Deputation bei. Man wollte mir dies zwar anfänglich nicht gestatten, ohne angestellt zu sein, und der Minister drohte mir sogar schriftlich, daß wenn ich mich jetzt nicht gleich anstellen ließe, sich in der Folge für mich wenig Aussichten zeigen würden. Ich antwortete aber, daß ich mich nicht entschließen könnte, mich in ein Fach zu werfen, ohne es genau zu kennen, und bestand darauf, diesen Winter den Sessionen bloß beizuwohnen, ohne darin zu arbeiten. Das ward mir denn endlich, unter der Bedingung, das Gelübde der Verschwiegenheit abzulegen, gestattet. Im nächsten Frühjahr werde ich mich bestimmt erklären.
Bei mir ist es indessen doch schon so gut, wie gewiß, bestimmt, daß ich diese Laufbahn nicht verfolge. Wenn ich aber dieses Amt ausschlage, so gibt es für mich kein besseres, wenigstens kein praktisches. Die Reise war das einzige, das mich reizen konnte, so lange ich davon noch nicht genau unterrichtet war. Aber es kommt dabei hauptsächlich auf List und Verschmitztheit an, und darauf verstehe ich mich schlecht. Die Inhaber ausländischer Fabriken führen keinen Kenner in das Innere ihrer Werkstatt. Das einzige Mittel also, doch hinein zu kommen, ist Schmeichelei, Heuchelei, kurz Betrug – Ja, man hat mich in diese Kunst zu betrügen schon unterrichtet – nein, mein liebes Ulrikchen, das ist nichts für mich.
Was ich aber für einen Lebensweg einschlagen werde –? Noch weiß ich es nicht. Nach einem andern Amte möchte ich mich dann schwerlich umsehen. Unaufhörliches Fortschreiten in meiner Bildung, Unabhängigkeit und häusliche Freuden, das ist es, was ich unerläßlich zu meinem Glücke bedarf. Das würde mir kein Amt geben, und daher will ich es mir auf irgend einem andern Wege erwerben und sollte ich mich auch mit Gewalt von allen Vorurteilen losreißen müssen, die mich binden.
Aber behalte dies alles für Dich. Niemand versteht es, das haben mir tausend Erfahrungen bestätigt.
»Wenn du dein Wissen nicht nutzen willst, warum strebst du denn so nach Wahrheit?« So fragen mich viele Menschen, aber was soll man ihnen darauf antworten? Die einzige Antwort die es gibt, ist diese: weil es Wahrheit ist! – Aber wer versteht das?
Darum will ich jetzt so viel als möglich alle Vertrauten und Ratgeber vermeiden. Kann ich meine Wünsche nicht ganz erfüllen, so bleibt mir immer noch ein akademisches Lehramt übrig, das ich von allen Ämtern am liebsten nehmen würde.
Also sei auch Du so ruhig, mein liebes Ulrikchen, als ich es bin, und denke mit mir, daß wenn ich hier keinen Platz finden kann, ich vielleicht auf einem andern Sterne einen um so bessern finden werde.
Adieu. Lebe wohl und sei vergnügt auf dem Lande.
Dein treuer Bruder
Heinrich.
N. S. Sage Minetten, daß ich vergebens Löschbrandten täglich erwarte. Er hat nämlich versprochen zu mir zu kommen, wenn er sich mit seinem Advokaten beratschlagt hätte. Noch ist er aber nicht erschienen. Ich habe ihn bisher nicht aufsuchen wollen, um Minettens Sache nicht den Anschein zu geben, als ob sie dringend wäre. Indessen heute will ich es doch versuchen ihn aufzusuchen. In seinem Hause ist er niemals zu finden.
*
An das Stiftsfräulein Wilhelmine v. Zenge Hochwürden und Hochwohlgeboren zu Frankfurt a. O.
Berlin, den 29. (und 30.) November 1800
Liebe, beste Wilhelmine, ich küsse Dich in Gedanken für Deinen lieben, trefflichen Brief. O wenn ich doch bei Dir wäre und Dich an meine Brust drücken könnte –! Ach, man sollte, um ruhig zu sein, daran gar nicht denken. Aber wer kann das –?
Ganz außerordentlich habe ich mich über Deinen Brief gefreut, und über tausend Dinge in ihm, teils über die Antworten auf meine Fragen, teils über Deine erb- und eigentümlichen Gedanken, auch darum, daß Du meine Vorschläge zu Deiner Bildung so gern erfüllst, aber ganz besonders, daß Du diesen Vorschlag so gut verstanden hast. Nutzen und Vergnügen sind gewiß selten so innig verknüpft, als in dieser Beschäftigung, wo man gleichsam mit der Natur selbst spricht, und sie zwingt, auf unsre Fragen zu antworten. Ihre nützliche Seite konnte Dir nicht entgehen, aber daß Du auch Vergnügen daran findest, das ist es, was mich besonders freut, weil es meine Hoffnung, daß in Dir mehr als das Gemeine enthalten sein möchte, immer mehr und mehr bestätigt. O auch mir sind es die liebsten Stunden, in welchen ich die Natur frage, was recht ist, und edel und gut und schön. Täglich widme ich, zur Erholung, ein Stündchen diesem Geschäfte, und denke niemals ohne Freude an den Augenblick (in Würzburg) wo ich zum erstenmal auf den Gedanken kam, auf diese Art bei der großen Lehrmeisterin Natur in die Schule zu gehen.
Deine Antworten auf meine Fragen haben durchgängig den Sinn getroffen, und ich will nur, Deinem Wunsche gemäß, Deine erb- und eigentümlichen Gedanken prüfen.
Zuerst freut es mich überhaupt, daß Du das Talent besitzest, wahrzunehmen. Das, mein liebes Kind, ist kein gemeines Talent. Sehen und hören usw. können alle Menschen, aber wahrnehmen, das heißt mit der Seele den Eindruck der Sinne auffassen und denken, das können bei weitem nicht alle. Sie haben nichts als das tote Auge, und das nimmt das Bild der Natur so wenig wahr, wie die Spiegelfläche des Meeres das Bild des Himmels. Die Seele muß tätig sein, sonst sind doch alle Erscheinungen der Natur verloren, wenn sie auch auf alle Sinne wirkten – und es freut mich, daß diese erste Bedingung, von der Natur zu lernen, nämlich, jede ihrer Erscheinungen mit der Seele aufzufassen, so gut bei Dir erfüllt ist.
Ganz vortrefflich, besonders dem Sinne nach, ist der Gedanke, daß es bei dem Menschen, wie bei dem Spiegel, auf seine eigne Beschaffenheit ankommt, wie fremde Gegenstände auf ihn einwirken sollen. Das ist vielleicht der beste Gedanke, den jemals ein Mädchen vor dem Spiegel gehabt hat. Aber nun, mein liebes Kind, müssen wir auch die Lehre nutzen, und fleißig an dem Spiegel unserer Seele schleifen, damit er glatt und klar werde, und treu das Bild der schönen Natur zurückwerfe. Wie mancher Mensch würde aufhören, über die Verderbtheit der Zeiten und der Sitten zu schelten, wenn ihm nur ein einzigesmal der Gedanke einfiele, ob nicht vielleicht bloß der Spiegel, in welchen das Bild der Welt fällt, schief und schmutzig ist? Wie oft stand nicht vielleicht ein solcher Mensch schon vor dem Spiegel, der ihm die lehrreiche Warnung zurief, wenn er sie verstanden hätte – ja wenn er sie verstanden hätte! –!
Auch recht gut, dem Sinne nach, sind die beiden andern Gedanken, obschon nicht von einem so eingreifenden Interesse. Ich will Dir daher bloß einiges über ihre Darstellung mitteilen.
Du fragst, warum das Tier so schnell, der Mensch so langsam sich ausbilde? Die Frage ist doch allerdings sehr interessant. Zur Antwort möchte überhaupt schon der allgemeine Grundsatz dienen, daß die Natur immer um so viel mehr Zeit braucht, ein Wesen zu bilden, je vollkommner es werden soll. Das findet sich selbst im Pflanzenreiche bestätigt. Die Gartenpflanze braucht ein paar Frühlingsmorgen, die Eiche ein halbes Jahrhundert, um auszuwachsen. Du aber vergleichst, um die Antwort zu finden, den Menschen mit einer vollstimmigen Sonate, das Tier mit einer eintönigen Musik. Dadurch möchtest Du wohl nicht ausgedrückt haben, was Du Dir eigentlich gedacht hast. Eigentlich hast Du wohl nicht den Menschen, sondern seine Bestimmung mit der Sonate vergleichen wollen, und dann wird das Gleichnis allerdings richtig. Nämlich er ist bestimmt, mit allen Zügen seines künstlichen Instruments einst jene große Komposition des Schöpfers auszuführen, indessen das Tier, auf seiner Rohrpfeife, nichts mehr als den einzigen Ton hören lassen soll, den sie enthält. Daher konnte dies freilich seine geringfügige Bestimmung früher erreichen, als der Mensch seine unendlich schwere und mannigfaltige – nicht wahr, das wolltest Du sagen?
Bei einem Bilde oder einem Gleichnis kommt es überhaupt auf möglichst genaue Übereinstimmung und Ähnlichkeit in allen Teilen der beiden verglichnen Gegenstände an. Alles, was von dem einen gilt, muß bei dem andern irgend eine Anwendung finden. Willst Du Dich einmal üben ein recht interessantes Gleichnis heraus zu finden, so vergleiche einmal den Menschen mit einem Klavier. Da müßtest Du dann Saiten, Stimmung, den Stimmer, Resonanzboden, Tasten, den Spieler, die Noten etc. etc. in Erwägung ziehen, und zu jedem das Ähnliche bei dem Menschen herausfinden.
Auch gibt es noch verschiedene andere Mittel, auf eine leichte und angenehme Art Deinen Scharfsinn in dem Auffinden des Ähnlichen zu prüfen. Schreibe Dir z. B. auf verschiedene Blätter folgende Fragen auf, und wenn Du die Antwort gefunden hast, diese darunter. Z. B. Was ist lieblich? Ein Maitag; eine Fürsichenblüte; eine frohe Braut etc. etc. – Was ist erhebend? Ein Sonnenaufgang; ein Choral am Morgen (ich denke an die schönen Morgen, wenn ich in unsrem Garten arbeitete, und der Choral der Hoboisten aus dem Eurigen zu mir herüberscholl) – Was ist furchtbar? Ein herannahendes Gewitter; das Kräuseln der Wellen für den Seemann etc. etc. – Was ist rührend? Reden bei der Leiche; ein Sonnenuntergang; Unschuld und Einfalt; Fleiß und Dürftigkeit etc. etc. – Was ist schrecklich? Blitz und Schlag in einem Augenblick; des Nachbars Haus oder gar die eigne Treppe in Flammen etc. etc. – Was ist niederschlagend? Regen am Morgen einer entworfnen Lustpartie; Kälte in der Antwort, wenn man herzlich und warm fragte; ein schlechtes Kleid, wenn die Gesellschaft es bemerkt; eine Grobheit, die uns aus Mißverständnis zugefügt wird, etc. etc. – Was ist anbetungswürdig? Christus am Kreuz; eine Unschuld in Ketten, ohne Klagen und Tränen; ein unerschrocknes Wort vor dem Tribunal blutbegieriger Richter oder, wie Schiller sagt, Männerstolz vor Königsthronen etc. etc. – Was ist tröstend? In den Himmel zu sehen; ein herrenhutischer Kirchhof; eine Erbschaft für den traurenden Neffen; ein Licht in der Nacht für den Verirrten. – Was ist lächerlich? Im Mondschein über den Schatten eines Laternenpfahles zu springen, in der Meinung es sei ein Graben; die ersten Versuche eines Kindes zu gehen (aber auf weichem Grase); ein ungeschickter Landjunker, der aus Liebe tanzt. – Was ist unerträglich? Geschwätz für den Denker; Trostgründe für den Leidenden; Windstille unter der Linie etc. etc. – Was ist Erwartung erregend? Ein Pfeifen im Walde; ferne Kanonenschüsse im Kriege; das Klingeln zum Aufziehn des Vorhangs im Theater etc. etc. – Was ist einladend? Eine reife Fürsiche; eine aufgeblühte Rose; ein Mund wie eine Kirsche etc. etc. – Was ist verführerisch? Schmeicheleien, und zwar für jeden, denn wer sich auch nicht gern schmeicheln hört, der nimmt doch nicht übel, wenn man ihm dies sagt etc. etc. – Was ist abschreckend? Keine Antwort; ein großer Hund, der uns in die Beine springt, wenn wir in ein Haus treten. – Was ist Zutrauen erweckend? Keine Umstände; auch wenn man mir eine Pfeife Tabak anbietet etc. etc. – Was ist majestätisch? Ein Sonnenaufgang über dem Meer; ein englisches Admiralsschiff, das mit vollem Winde segelt; ein Wasserfall; ein fernes Gebirge etc. etc. etc. etc. – – – – Genug, genug, genug. Auf diese Art kannst Du durch eine Menge von Antworten Deinen Verstand schärfen und üben. Das führt uns dann um so leichter ein Gleichnis herbei, wenn wir einmal grade eins brauchen.
O mein liebes Minchen, wie weitläufig ist es, dies alles aufzuschreiben – o wenn wir einst vereint sein werden, und Du neben mir sitzest, und ich Dich unterrichte, und jede gute Lehre mir mit einem Kusse belohnt wird – – o weg, weg mit diesen Bildern – und doch ist es das einzige was ich für diese Erde wünsche – und doch ist es ein so bescheidner Wunsch – und doch nicht zu erfüllen? und warum nicht? O ich mag gar nicht daran denken, sonst verwünsche ich Stand, Geburt und die ganze elende Last von Vorurteilen – Aber ich hoffe. O meine Hoffnung ist das einzige, was mich jetzt froh macht – Gute Nacht, ich gehe zu Bette mit meiner Hoffnung. Ich küsse Dein Bild, gute Nacht, gute Nacht – –
den 30. November
Guten Morgen, guten Morgen, liebe, liebe, liebe Wilhelmine! Es ist recht heiterer, frischer Wintermorgen, und ich bin selbst sehr heiter und wäre ganz glücklich, wenn, wenn, wenn – – – Adieu. Ich küsse Dich von Herzen. Bleibe mir immer treu, und so lange uns auch das Schicksal äfft, liebe mich doch nie kälter, als in dieser schönen Periode unsrer Liebe. Ach kalte Liebe ist so gut wie keine – Adieu, adieu. Schreibe mir bald wieder, und überhaupt recht oft, Du weißt nicht, wozu das gut ist. Adieu. Deine 6 Fr.dor will ich Dir wiedergeben, bestimme nur ob ich sie Dir oder der Randow schicken soll. Sei herzlich für diese Gefälligkeit gedankt, und rechne auf mich in allen ähnlichen und nicht ähnlichen Fällen. Adieu, adieu, adieu.
*
[Frankfurt a. d. Oder, Dezember 1800]
Mein liebes Ulrikchen, ich bin auf 8 Tage in Frankfurt, aber nicht so vergnügt, als wenn Du hier wärest. Ich mußte mir diese Zerstreuung machen, weil mich das Brüten über die schwangere Zukunft wieder ganz verstimmt hatte. In meinem Kopfe sieht es aus, wie in einem Lotteriebeutel, wo neben einem großen Lose 1000 Nieten liegen. Da ist es wohl zu verzeihen, wenn man ungewiß mit der Hand unter den Zetteln herumwühlt. Es hilft zwar zu nichts, aber es entfernt doch den furchtbaren Augenblick, der ein ganzes Lebensgeschick unwiderruflich entscheidet. Mehr als einmal bin ich nahe gewesen mich endlich geduldig in ein Amt zu fügen, bei dem doch viele Männer, wie sie es sagen, froh sind; und am Ende könnte man sich selbst mit dem Apollo trösten, der auch verdammt ward, Knechtdienste auf Erden zu tun. Aber immer noch reizt mich mein früheres, höheres Ziel, und noch kann ich es nicht (wie viele es können) verächtlich als unerreichbar verwerfen, ohne vor mir selbst zu erröten. Das Schlimmste bei dieser Ungewißheit ist, daß niemand mir raten kann, weil ich mich keinem andern ganz erklären kann. – Schreibe Du mir doch ein paar Worte nach Berlin. Adieu. Grüße Schönfeld und Frau, Onkel und Tante Pannwitzens etc.
N. S. Kannst Du mir nicht Nachricht geben, wo sich wohl jetzt meine Kulturgeschichte befindet?