
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Jahob Großmann zu Grindelwald und Margrita Dällenbach.
Gemalt von Joseph Reinhard von Luzern 1790.
(Aus der Sammlung des hist. Museums.)
Kleid des Mannes: Rock schwarz mit blauem Futter; Weste und Hosen weißwollen; Strümpfe weiß mit blauem Strumpfband.
Kleid des Mädchens: Das die Stirne bis über die Brauen hinunter bedeckende Gebilde scheint eine Art Kappe zu sein und ist aus buntgeblumtem Stoff, durch ein Sammelband nach unten abgeschlossen; die Haar-Flechten, die um den ganzen Hinterkopf gehen, sind über diese Kappe geführt. Göller mit dem Halstüchlein schwarz; rote Schnürchen verzieren die Sammet-Bänder, die das Bruststück des Mieders mit dem Achsel- und Rückenteil verbinden. Das Mieder ist vorn mit gelben kleinen Halbmonden bestickt; seine Schnüre sind rot. Schürze weiß mit breiten roten und schmalen blauen Streifen. Rock hellblau mit roter Einfassung. Strümpfe weiß mit blauen eingestrickten Verzierungen.

ine einzige Kunst hat von jeher der Bauer selbständig geübt: den Bau seines Hauses. 1 Drum sind, wie Rosegger sagt, die Bauernhäuser das Abbild der Volksseele. Das erwahrt sich in ganz hervorstechender Weise am Grindelwaldnerhaus. Während die Fremdengasthäuser und übrigen dem Verkehr dienenden Gebäude Maß und Schnitt von Architekten zentraler Orte empfangen und aus dem Rahmen des Talschaftscharakters heraustreten, bewahrt das bäuerliche Haus alter und neuer Zeit seinen immer gleichen, scharf ausgeprägten Stil. Die Ausgeprägtheit steht im Einklang mit der Zielbewußtheit des Bauens. Alle G’hälter (oder G’chälter) der Talschaft suchen in ganz eigener Weise einer schwierigen dreifachen Aufgabe gerecht zu werden. Zunächst muß ihre Solidität den Unbilden des Klimas (Schneedruck, Föhn, Erdrutsche, Wassergrößen) in deren höchstem Ausmaß trotzen. Sodann muß ihre Zweckmäßigkeit insofern den Bedürfnissen der winterlichen Milchindustrie gerecht werden, als namentlich das uralte «Feuerhaus» ( S. 460) immer noch seinen geeigneten Platz beansprucht, indes die Scheune, sowie der Gwand- oder Chleiderspịịher und das Waschhaus ihren eigenen Platz in der Nähe des Hauses angewiesen erhalten. 2 Endlich trachten die neuern Häuser mit ihrer stets vermehrten Wohnlichkeit bescheidenere Ansprüche fremder Sommergäste zu befriedigen.

Der Speicher neben dem Haus. — Der Kirschbaum als Hausfreund.
Die Geschlossenheit der hiedurch bestimmten Bauweise bewahrt sich durch alle die Rührigkeit hindurch, mit welcher in Grindelwald durch eine beträchtliche 432 Anzahl einheimischer Zimmermeister und sonst auch Maurermeister ’bu̦wwen wird. Bloß zwischen 1888 und 1900 stieg, trotzdem inzwischen der Brand von 1892 im ganzen 114 Gebäude verzehrte, die Zahl der Wohnhäuser von 518 auf 558. Die bis 1906 noch gestiegene Zahl ist aus dem Straßerschen Plan am Ende dieses Buches zu ersehen. Derselbe veranschaulicht zugleich die Ausdehnung des ständig bewohnten Grindelwalds, welche von Ost nach West zwei gute Wegstunden beträgt. An den seitlichen Gehängen derselben aber schließen sich an die ständig besiedelten die temporär bewohnten Gebäude bis hinauf aufs Faulhorn (2683 m) an. Wird in der Höhe aus naheliegenden Gründen so lang als möglich nur ’bị̈eßd ( S. 426 ff.), so schị̈ị̈red mu̦ und hụụsed mu̦ im ständig bewohnten Gebiet alle Jahre. Daher die zahlreiche Benennung «alter» und «neuer» Gebäude. Einen Ort bi’m oder ze’m nï̦wwen Hụụs finden wir schon seit 1603 als Gegensatz ze’m oder bi’m aalten Hụụs. 3 Die Zwischenstufen bilden da und dort e̥s nï̦wwe̥lli chß oder nï̦wwe̥lle̥nds Hụụs. Zählebig aber trotzt noch lange jeglichem U nwätter recht manches «uralte» Hụụse̥lli. So eins auf dem Stutz, 4 das auf 1555 zurückgeht. Gleich einem guten alten Heidenhụụs 433 wehren sie jeglichen Anschein des Zerfalls von sich ab, wie dieser dagegen einem alte n Ggŏdel (Lotterhütte) oder einem alte n T’hämpel (so hieß etwa der 1906 durch einen Neubau ersetzte ehemalige Gemeindespital) anhaftet. Zuweilen erhöhen bessere alte Gebäude ihr Ansehen noch durch den Nimbus historischer Erinnerung. Mit offiziellen Bezeichnungen wie Pfaar- oder Pfruendhụụs, Talhụụs ( S. 14), 5 Zehnderhụụs, 6 und mit solennen wie Grääfihụụs 7 ( S. 511) konkurrieren Namen wie bi oder bi’m Engels-, 8 Fä̆slers-, 9 Ruedihụụs. 10 Können freilich schon diese nur dem sehr Lokalkundigen etwas besagen, so auch Bezeichnungen wie bi’m Bru̦nnihụụs, 11 bi’m verbru̦nn’nen Hụụs, 12 z’Underhị̈ị̈s’ren, 13 bi’m obren Hị̈ị̈sli 14 und gar bloßes bi’m Hị̈ị̈sli. 15

Das Spiiherli im Tal als Gwandspiiher.
Der größte Gehalt auch in dieser Richtung liegt schließlich im Wort Hụụs und seiner Sippe selbst. Während freilich seine Grundbedeutung («das Bergende») 16 im heutigen Sprachgefühl erloschen ist, entfalten sich aus ihm zwei andere Vorstellungskreise. An die Gestalt des Aufbaus ist zunächst gedacht bei g’hị̈ị̈se̥lled («g’hụ̈̆slet», 17 quadrillé, kleine Quadrate zeigend, welche farbig oder reliefartig sich abheben wie z. B. beim rootg’hị̈ị̈se̥lle̥ten Năse nlumpen). Mit Würfeln baut das Kind Hụụse̥lle̥ni oder richtet es hohe Säulen auf: es hụụse̥lled, und die Würfel selber tïe n si ch hị̈ị̈se̥llen. Gelingt dies ohne Einsturz: welch ein Stolz und lauter Jubel! Von daher heißt es auch unter Erwachsenen: e̥s hed ’mu̦ si ch g’hị̈ị̈se̥lled, d. h. es ist ihm gelungen, er hat Glück gehabt. «Hụụse̥llen» wird dann auch vom Spiel des Kindes überhaupt gesagt; dieses spielt und vertreibt sich damit die Zeit: es tued mid ’mu̦ 434 sälber umha hụụse̥llen. Und zwar spielt es mit irgend welcher Hụụse̥lru̦stu̦g, das Mädchen insbesondere mit dem Mämmi- oder Hụụseltŏtsch: der schmucklos selbstgefertigten Puppe. Solches Spiel erhält das Kind aber auch dem Haus und seiner Umgebung anhänglich: g’hị̈ị̈sig (vgl. auch S. 376) und g’choorsam, ist zudem die beste Vorübung auf das hŭ̦shaltren, hụ̆shăben, hụ̆shäblen, hụ̆shä̆be̥llen der allzeit geschäftigen Hausfrau, sowie zum haushälterischen Charakter eines Hụụsmaan. 18

Weschhiisli.
Mehr Anteil an der Grundbedeutung hat die gegenwärtige Mundart sich in «heim» bewahrt. Sein Begriff des «Lagers» setzte sich fort in der Transportfähigkeit 19 des einzelnen Hauses als fahrender Habe. Leichte Transportfähigkeit wird noch 1785 auch für Grindelwaldnerhäuser bezeugt, 20 und sie reflektiert sich nur zu bemerkbar in der oft überaus schlechten, wohl auch ganz fehlenden Fundamentierung. Gerade das mitwandernde Lager war aber in den Zeiten der Eroberungszüge das einzige, was «sichere und sorgenlose Ruhe» 21 gewährte; und das spiegelt sich noch heute bedeutungsvoll wieder in dem Unterschied, womit der im Dinghụụs (Miethaus) Wohnende bloß u̦m oder e̥m zuehigeid («wiederum hinzugeht»), während der Hausbesitzer gä̆gen hei m zue geid und sich dort daheimme n fühlt, es dort heimli ch (heimelig, traulich) 22 oder gä̆big (angenehm) findet.
Stellen wir uns nun zu näherer Betrachtung vor eines unserer echten Grindelwaldnerhäuser! Ein Vergleich seiner Orientierung mit der aller andern lehrt uns, wie möglichst alle gäg’ d’Lï̦tschĭ̦na ahi 435 g’sehn: ihre Giebelfront oder Stirn schaut von den Berggehängen herunter dem Talgrund zu. Man will offenbar seine Häuser haben, wa si ch uehi oder obsi ch chehrren und damit den Unterbau des treppenhohen Wohnstocks durch ein Erdgeschoß ( S. 436 f.) unmöglich machen. Gäbe es bloß sunnenhalb Häuser, so würde dies zu der Folgerung führen, die Front kehre sich grundsätzlich der Su̦nne n zue. Allein die schattenhalb gelegenen Häuser (also von Wärgistal, Itramen und Tschingelberg) chehrre n si ch von der Su̦nnen ab, chehrren der Su̦nnen de n Rï̦gg, um talwärts schauen zu können. Je näher man sich dem Talgrund fühlt, destomehr weiß man sich auch daheim und bi ’ n Lị̈ị̈tten. Die nebelreichen Gestade der Lütschine freilich meidet man nach Möglichkeit und siedelt sich bloß in deren erträglicher Bịịlĭ̦hi an. (Diese «Beilichkeit», Nähe, bedeutet mittelst der Fügung «i n ’ner Bịịlihi» svw. annähernd, ungefähr; auch zeitlich svw. bald. 23 )

Stammhaus der Häsler zu Horbach.
Phot. v. Holzgang.
Nehmen wir nun — zunächst von außen — ein echtes und normales Grindelwaldnerhaus, wie unsere Aufnahmen zweier Häuser (zu Horbach und am Endwääg) es darstellen, genauer in Augenschein. Es ist ein 436 mittelgroßes und rein bäuerlich eingerichtetes Gebäude; also weder ein kleines Hịịsli mit Stụ̆ba und Gä̆de̥lli, noch auch ein ganz großes mit drei Stuben in der Front, wie es deren in Grindelwald wohl kaum ein halbes Dutzend gibt. Ganz u̦f der Sịịte n lassen wir so einen vielleicht gar hŭ̦glos (unüberlegt) 23a an die Hand genommenen Flickbau mit spätern seitlichen Vergrößerungen, durch welche die ursprüngliche Anmut eines echten Grindelwaldnertyps manchmal, ja gewöhnlich, zu Schaden kommt. 24 Als solcher Typ gilt uns e̥s Hụụs mid zwo Stŭ̦binen und zwo Loibinen drụ̆ụ̆f und zwo Summerloibinen dran und dem Vortach hinnadraan — wie der Grindelwaldner selbst es kurz und treffend beschreibt. Dazu gehört noch, daß es e̥s Holzhụụs ist, d. h, im Oberbau ganz und gar aus Holz besteht. 25

Westseite eines Bauernhauses uf der Gärwi.
Phot. v. Holzgang.
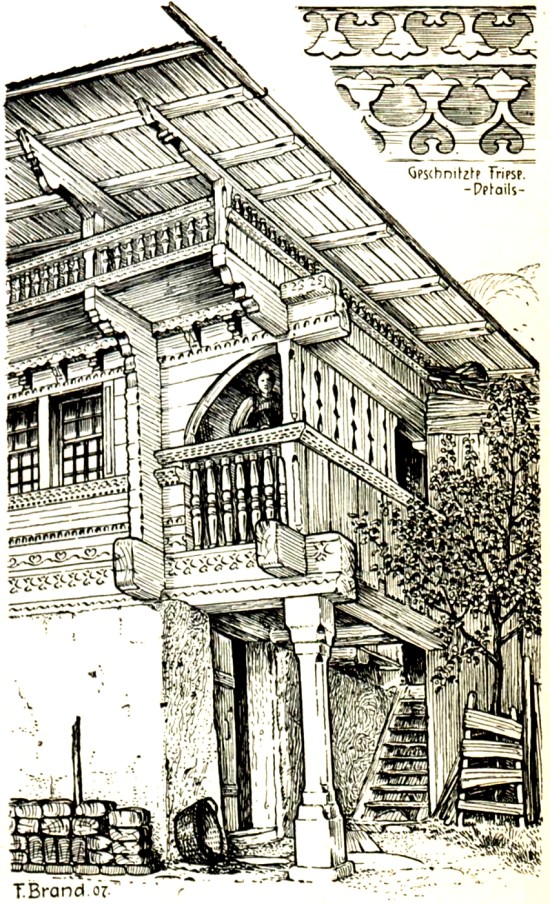
Am Endweg.
Nur der Unterbau, das Chällerg’schoos, ist (mit Ausnahmen, s. Abb. S. 438) gemauert und weiß getüncht. Das Hauptmaterial hierzu liefern Du̦ftsteina. Tuff 26 baut an der nördlichen Talseite ganze 438 Felsen auf und findet sich an Stellen wie am Alpwääg in sehr schöner Qualität vor. Auf sein reiches Vorkommen deuten: das Du̦ftli 27 als Name des mittlern Dorfteiles, der nach jüngerm Sprachgebrauch sich sogar bis zum «Bären» erstreckt; uf Duft 28 und z’ Tuffbach, 29 letzteres seit 1326 verurkundet, 30 und das 1361 31 und 1363 32 genannte «güetli uf der Tuftfluo»; vgl. auch i’ n tuftigen Brunnen ( S. 158). Aus Tuff bestehen die Grindelwaldnerkirche und der Meiringer Kirchturm, aus Tuff so viele hübsch begrünte Umfassungsmauern, aus ihm ehemals auch viele Trockenmauern als Unterbau, und Außentreppen, sowie noch heute die Saaß als Ecksteinersatz an kleine Gehältern, wo nicht solchen Saaßi aus großen Saaßsteinen sich beschaffen lassen. Mit g’stampfetem Tuft oder auch mit Schlemmtuff — Schlaargituft — werden die Holzgeschirre g’fä̆ged; und es ist charakteristisch, daß im alten Grindelwald bloß solches Scheuern mit Tuff mittelst des eigenen Duftlumpens oder allenfals mittelst eines alten Fï̦̆rfueßes als Fägers die Bezeichnung «fä̆gen» tragen durfte. Mit andern Reinigungsmitteln ward g’flääted, wie noch im Oberwallis «giflẹẹtigu̦d» oder «flẹẹt gimacht». Aber mehr: auch die Stŭ̦beswendeni oder wenigstens die Bịịstaal der zur Küche führenden Türe, sowie diese selbst, wurden ehemals mit g’nitschetem Tuff g’fä̆gd und dadurch zugleich geweiht, damit sie stattlicher aussähen. Die Masse wurde von Tu̦ftwịịblinen, z. B. dem Tu̦ft-Elsi von Duftbach und sonst innerhalb Grindelwalds wịịtna (weithin) verhausiert; und zu den in Grindelwald so beliebten Neckereien (vgl. S. 59) 439 gehörte es auch, Einfältige mit schweren Tuffladungen zum Verhausieren behufs ähnlicher Stubenverschönerung sogar ga n Rrăme̥lli: nach Interlakens erstklassigen Gasthöfen zu schicken. Neben den (im Tuftstampf zermalmten) Tuff und mehr und mehr an seine Stelle trat der Plaander oder Plander ( plan de Troyes, der Kreidegrund der Maler).

D’s aalte Chälengertschen Huus.
(Das Erdgeschoß aus Holz.)
Spuren im Lauchbühl und hinter Wärgistal deuten darauf, daß man einst auch hier wie in den verschiedenen Chalchofen 33 Kalk gebrannt hat. Der Chalch und das Sand als Materialien zum Pflaster (Mörtel) sehen sich nun auch hier durch Wätterchalch (hydraulischen Kalk) oder durch Zịmänt ersetzt, wo es die g’eggete n Steina (Quadern) für Mauerwerke und Therassi zu ersetzen gilt. Für die kunstlose B’setzi vor Ställen dagegen sind immer noch Blatti (rohe flache Felsstücke) und ander Schëpf gut genug.
Das wenig oder gar nicht eingegrabene Chällergschoos gibt in der Regel zwe Chäll’ra ab. Doch wird wenigsten einer mehr und mehr zur Chällerstŭ̦ben eingerichtet, die als Wohnung, als Werkstatt oder als Krambude dient.

G’welbd-Chällers-Tireni.
(Kellertüren mit rundbogigem Sturz.)
Der hölzerne Aufbau ist, wie bei jedem echt grindelwaldnischen Gehalt auch neuern Datums, ein Blockbau, 34 und zwar ein Gwättbŭ̦w. 35 Es kreuzen oder schneiden sich, we nn mu̦ gwätted, die 12 cm dicken Bohlen oder Flẹcki an den Ecken, und das freie Ende ragt um 18 cm über die Hauswand hinaus vor. Ein mittleres dieser G’wätti: das Mittelg’wätt, deutet die Einteilung des Vorderraums in je zwei S tu̦bi oder Loibi an. Der Gwättbau bietet einen so trefflichen Schutz gegen Windstöße, daß, wenn einer hed gfluehed, daß ’s in alle n Gwätte n g’chrachched old g’chroosed hed, man schon von einer ordentlichen Kraftleistung sprechen darf. Einen anmutigern 440 Eindruck erweckt jedenfall der Anblick einer durch solche Gwätti vertikal gegliederten Hausfront. — Berg’wätted werden gleich den Flẹcken auch die Bẹnder, indem man sie an ihren Fügungsstellen chlăffed: um halbe Holzstärke ịị nsaaged.
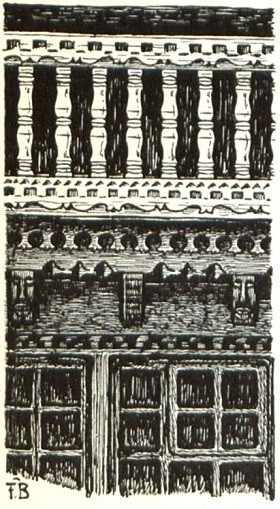
Details von der Hausfront uf der Gärwi.

Diese Bẹnder, welche Balkenvierecke bilden, geben die Grundlagen der beiden Stockwerke oder Hëëhinen: der Stŭ̦benhëëhi und der Loïbenhëëhi ab. Die erstere Hëëhi ruht auf den Mụụrbẹndren, welche ganz besonders genau im Wịịhel (rechten Winkel) und im Seihel (Senklot) liegen müssen, wenn der Aufbau tadellos erfolgen soll. Ist dies geschehen, su̦ hed der Zimmermaan a nfḁ n gspanneds, und das ụụfrichten oder ụụfbụwwen kann beginnen. Gleichzeitig kommen dabei immer Solidität und Zier auf ihre Rechnung. Die Bänder, welche jedes Stockwerk beginnen und abschließen, springen in ihrer Holzstärke von 15 cm im Gwätt bis um 20 cm vor. Sie tun dies mittelst ihrer (meist schmucklos gelassenen, selten zu Tŏgglen ausgeschnitzten) Köpfe, Bandchëpf, Bandgrinda geheißen. Mehr noch als hiedurch, werden die Stockwerke nach außen abgehoben durch den Fï̦rsatz. Das ist eine Vorkragung des Obergeschosses, mittelst welcher dieses um 4 bis 5 cm über das Untergeschoß hinausragt. Der Fïrsatz trägt einen ausgeschnitzten Bogenfries, ein Kremä́nzel; er ist ụụsg’kremänzleta. Besondere Kunst (s. S. 441 die Frontzier des Zuhauses zum alten «Adler» und S. 511 dieses selbst) wendete man früher hieran, wenn — allerdings höchst selten — der Vorzug fehlte. Das ist eine Galerie, welche sich in einer Breite von etwa 70 cm vor den Fenstern des zweiten Stockes der ganzen Hausfront entlang hinzieht und ein mehr oder weniger kunstreich ausgesägtes oder aus gedrechselten 441 Säulchen ( Spindlen) bestehendes Brettergeländer dem Beschauer zukehrt. Ihren ästhetischen Eindruck faßt man etwa in die Worte: d’s Hụụs zăhmed ab dem Vorzug; äs gsehd minder wilds fï̦rha. Einen praktischen Vorzug des Vorzugs erblickt dagegen die Hausfrau darin, daß mu̦ dert gar chätzers gä̆big cha nn d’Windli trëchchnen.

Geschnitzter Fries an der Hausfront.
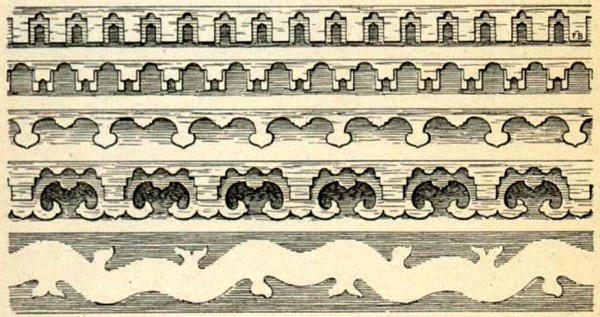
Geschnitzter Fries an der Front eines Hauses.
(Aus Gimmelwald.)
In obiger Folge zwischen den Fensterreihen.
(Weiterer Fassadenschmuck siehe
S. 499.)
Außer den beiden Fï̦̆rsẹtzen, welche nach oben und außen die beiden Stockwerke abheben, tragen zur waagrechten Gliederung der Hausfront noch die Sinzenbrï̦sti bei. Die Sinzenbrust ist ein Gesimsband unterhalb jeder Fensterreihe; sie wird geschmückt mit Stabwerk und Bogenfries; auch sonst ist sie im oft recht bemerkenswerter Weise g’kremänzle̥ti. Da die Stockwerke der ältern Häuser nĭ̦de̥rri sind, würden die keineswegs zur Zimmerdecke hinaufreichenden Pfẹifter ihren hohen Gesamteindruck des Heimlichen und A nmmïetigen ganz verfehlen, wenn sie nicht in den Wohnstuben zu vieren gruppiert Licht und Luft ausgiebig hereinfluten ließen. Nur neuere Gebäude, auf deren Wohnlichkeit auch im Sommer Bedacht zu nehmen ist, regulieren 442 den Lichtzutritt mittelst Bälken (Fensterladen), Schăle̥sịịbälken ( jalousies), die dann auch den winterlichen Vorpfẹistren der Wohnstube nicht zu weichen brauchen. Holzstabgitter — Chrị̈ị̈z — oder Fellbalken an ältern Gebäuden (an recht alten, wie auf dem Einlagebild sogar zum Aufklappen, unna ueha li̦tzen) dienen der Sicherheit. Jene tun dies gelegentlich auch vor einem der gut angeordneten und geformten Ggu̦gginen (Gucklöcher ohne Glasverschluß).

Kremänzel: Reich ausgeschnittener Fries ( Firsatz) an der Giebelwand und unter dem Vorzug.
Zum außerordentlich anmutigen Überblick einer Fensterreihe trägt heute namentlich von innen die Kremoone n-B’schlecht (aus Cremona) mit den elfenbeinschwarzen Griffen bei. Das ist indes eine Neuerung, welche gleich ihren Vorgängerinnen: der spănische n B’schlecht ( l’espagnolette) und dem ihre voraufgehenden Stoosrĭ̦gel die alten echt grindelwaldnischen Fï̦ï̦rrịịbra (senkrecht drehbaren Riegelchen) verdrängt hat. Die schmalen Rămi sodann (der Fensterrahmen heißt die Răma, Pfẹisterrăma) gestatten ein leichtes Ausheben aus den Pfẹisterlï̦chchren und den sie einfassenden Pfẹisterg’reisen. Fleißig gereinigt oder ’bbutzd und mittelst des die Schmelzwasser auffangenden Sinze nchä̆nels an der Innenseite der Pfẹisterwand auch in ihrer Umgebung sauber erhalten, 443 lassen sie selbst ungeöffnet deutlich ze’r Schịịben ụụsi g’sehn. Letzteres wäre namentlich dann erwünscht, wenn ein Vorübergehender, auf uneheliche neben ehelichen Kindern anspielend, boshaft bemerken wollte: ze n andrer Lị̈ị̈te n Pfẹistre n g’seejje n ’ru̦ den n o ch no ch ụụsi.

Vorzug mit Spindel-Gitterstäben.
Nur schmale, (bisweilen geschnitzte) Pfẹisterpfësten unterbrechen die stattliche Reihe. Anderwärts spricht man hierbei von der Stu̦u̦d oder dem Stï̦̆dli. So heißt aber in Grindelwald irgend ein senkrecht stehender Stützbalken, und demgemäß sagt man von einem, der bildlich eine gute Stütze verloren hat: däm ist en gueti Stu̦u̦d dänna choon!
Das Weghobeln einer lästig vorspringenden Braauen (Kante) heißt technisch faasen, volkstümlich aber brääwen, im Hasli: «spä̆rmịịlen». Bildlich bedeutet si ch erbrääwen und umgedeutet: si ch erbrääveren oder si ch erbreveren svw. «seine Ecken und Schärfen» abschleifen, «gehobelter» oder manierlicher werden.

Schwaartach.
444 Die Gwätti der Hausfront setzen sich oben in schön geschweifter Form zu einer Länge von beinahe 1½ m (5 Fuß) fort und tragen damit die behufs weiterer Ausladung auf ihnen ruhenden Dachbẹnder, sowie die First samt ihren zwei Nebenfirsten. Die letztern heißen Zuefi̦rsti. Diese ausladenden Gwätti und die genannten fünf Dachbalken bilden zusammen die Dachschï̦tz oder die First-Esla. Die Firstbalken ihrerseits verbinden das Giebeldreieck der Front mit demjenigen der fensterlosen Hinderwand. Auf ihnen ruhen die Dachsparren oder Răfen. Diese tragen an der Frontseite, soweit das Dach vorspringt, die Dachverschalung oder die Welbi, über dem Hausinnern die Underlatti. Über diese kommen, wo es sich um das ältere Schwaartach handelt, die dicken und u nb’schnätzeten ( S. 184) Schwaarschindli in drei- bis vierfacher Lage derart übereinander, daß die frei herausragenden Enden jeder Reihe, die Chrä̆gen, ni̦d meh wa n vier Zol le n schießen (12 cm Breite der untern Reihe unbedeckt lassen). Damit die Schindeln nicht abrutschen, muß das Dach läägs oder g’läägs, d. h. wenig steil sein. Die Höhe der Giebeldreiecke beträgt genau den fünften Teil der Hausbreite, was eine Steigung von 40% mit sich bringt. Über die ganze Länge des Daches kommen dann, etwa 70 cm 445 auseinander, die Uberlatti, welche an den Dachrändern durch je einen O rtlăden verbunden sind. Die «Überlatten» und damit die Schindeln der Schwardächer sind mit Dachsteinen von ein bis zwei Zentner Schwere ịị ng’lădnu̦ («b’schwaaret», beschwert), um nicht vom Föhn entführt zu werden. Der vorderste Dachstein auf der First heißt der Vëge̥llistein.
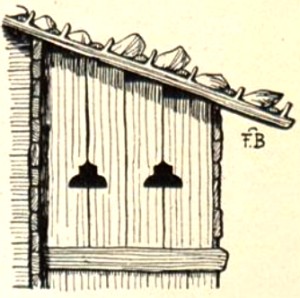
Verschlag mit Ggugginen (Guck- u. zugleich Zuglöchern.)
So gefällig proportioniert sich nun dieses wenig steile Dach über der mäßigen Heejji (Höhe) des ältern Hauses ausnimmt, und so malerisch diese «zäntnerige n Tachnĕgel» sich namentlich im Bilde präsentieren: unpraktisch ist das Schwaartachch immerhin. Es behält die Schneelast zu lange, trocknet nach Regen zu langsam ab und erfụụled schneller. Das neuere Năgeltachch ersetzt sich daher die Ii nllădug der Dachsteine samt Überlatten und Ortladen mit Schindlennä̆glen und darf dank dieser Vereinfachung steiler oder rëëster werden, mehr Steilheit oder Roost bekommen. (Eine Stelle an Bußalp mit sehr steiler Doppelabdachung heißt die Hŏhrëësti.) 36 Starke Ịịsenbẹnder verbinden behufs Föhnschutzes (vgl. jedoch S. 120) das Nageldach mit dem Unterbau.
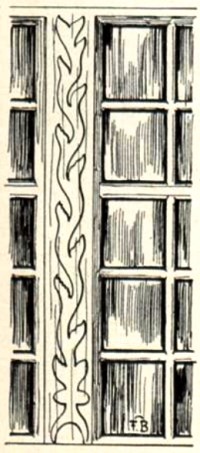
Geschnitzter Fensterpfosten.
An Stelle des Tachtroïfs tritt der Tachchä̆nel mit dessen Auslauf, der Tachzŭ̦ben. Vornen hat das Haus vi̦i̦l Schopf ( S. 414) oder Vorschopf (bis 2 m), daß ’s de n Rä̆gen ni̦d i n d’Pfẹister rïehrri oder daß ’s d’s Wätter (den Regen) ni̦d zuehi schmeizi. Die (fensterlose) Hinterwand hat weniger Schopf, weil sie vor Wätterschmeiß geschützt ist durch einen Anbau. Derselbe dient in der Regel als Holzschäre̥m 446 oder zu Schweineställen und heißt Vortachch. Seine eigene einseitige Bedachung wird Ei nschilt, Abdächler oder Pultdach genannt. — Ganz vereinzelt trägt da und dort ein neueres Haus einen Dachgiebel an der Front; dieses «Tschäpp» schützt vermeintlich gegen den Föhn.

Das Vortach
(Holzschopf oder Schweinekoben hinter dem Haus).
Bedeutet «Roost» ursprünglich nur den Grad der Steilheit, so kam der Abroost dazu, alles zu bezeichnen, was von der Äbe nwand uehi geid: das Giebeldreieck. Ähnlich konkret wird ja der Winkel zum Wịịhel: die Neigung zweier Linien zum halb eingeschlossenen Raum; und der Schïïrsgĭ̦bel, Hụụsgĭ̦bel oder einfach Gĭ̦bel wird aus seiner frühern Gleichlegung mit dem «Gipfel» 37 zum Eingang irgend welcher Art: zur Türöffnung ( S. 296), zum Einschlupf einer Schneehöhle der Knaben usw. Zur Zeit der blühenden Pferdezucht war mancher Schịịrsgĭ̦bel als Ịị nfahrt für Heufuder nach unterbernischer Art eingerichtet. Heute erinnern diese Giebelfelder nicht nur, sondern auch ganze Wẹndi (Wände) von Scheunen an landwirtschaftlichen Betrieb durch die Chŏrennä̆gel ( S. 269). Denn an diesen hängen nicht bloß Chŏre nschëib (ein Schoib besteht aus etwa drei bis vier Hampfe̥llen), sondern auch ganze Reische̥lli (s̆s̆) oder Reigle̥ti (Reihen) mit Strouwbẹndren gebundener Hampfe̥lle n von Flax, Fĭ̦selstrouw 447 ( S. 265), Härdepfelstụ̆ụ̆den vor ihrer Verwendung zum Trocknen.
Mit diesen Giebeln und Wänden wetteifert zuweilen das Dach auf der Schattseite an bunter Garnitur. Da wächst zwar nicht die Hauswurz als Sempervivum «tectorum»; wohl aber bergen sich im Miesch die Wurzeln zweimetriger Ahoren und Grotzlinen, worin füglich Tachrëëkli (Dachrotschwänzchen) nisten und zwitschern können. Drei solcher Fichtchen stehen noch wohlerhalten auf einem Hausvordach u̦f Tu̦ft. Vielleicht wurde ihre Stammmutter anläßlich der Ụụfrichti (Hausbaufest) an ihren luftigen und lustigen Standort hingepflanzt.

In einer Summerloiben.
An beiden Langseiten des Hauses gewahren wir die ungefähr zwei Meter breiten Su̦mmerloibi, welche nicht bloß die Wohnlichkeit des Gebäudes ungemein erhöhen, sondern im Bedarfsfall sich zu Zimmerchen einwanden lassen. Jedenfalls zur Verbringung von allerlei Geräten sind die obre n Summerloibi ganz ịị n’tä̆fe̥lle̥tu, während die untern über ihrer niedrigen Brüstung der Freiluft vollen Zutritt gewähren. Zutritt erhält auf ihnen auch der Mensch, der ins Haus will; und zwar zeigt der Haupteingang allerlei baulich interessante Modifikationen: hier einen doppelten Aufstieg, und in der Mitte ein Tablar zum Herunterhängenlassen 448 gastlich einladender Loibennä̆ge̥llinen ( S. 260); dort ein Peristyl mit Freitreppe; am dritten Ort einen ausgeweiteten Vorraum, den eine Türe absperrt usw. Da erlangen auch wir Einlaß ins Hausinnere bis hinauf zur Loiben anderer Art ( S. 456 f.).

An der Schonegg.
(Im Hintergrund die Viescherwand.)
Zuvor jedoch kehren wir noch einmal vor die Front zurück. Hier fesselten uns gleich anfangs die hübschen Frakturbuchstaben über der obern Fensterreihe, welche von dem nußbraun nachgedunkelten Ton des Fichtenholzes sich so vorteilhaft abheben. Die von Zeit zu Zeit stattfindende Hauswäsche mit den kleinen Handfeuerspritzen hat freilich manchenorts diese Inschrifti zum Verblassen gebracht, so daß sie neben dem ụụsg’kremänzlete n Zïïg ( S. 441 f.) nicht mehr zur Geltung gelangen. Erst an neueren Gebäuden im Bereich des Fremdenzuges lebten allmählich wieder Inschriften auf, welche nicht bloß den Bauherrn, den Zimmermeister und das Baujahr namhaft machen, sondern auch etwas von der Denkweise der ersten Bewohner offenbaren. Aus alter Zeit von 1598 läßt sich die Inschrift entziffern:
Durk Kristan von Almen hargestalt.
Alzit ist är in Gottes Gwaldt.
Witzige Wendung gibt diesem Gedanken das Sprüchlein:
Diß Haus steht in Gottes Gwalt,
Ist vornen new und hinden alt.
Und hätt uns Spiis und Lohn nid gruwwen,
Wir hätten’s no lan scheener buwwen.

Ganze Länge einer Laubenbrüstung.
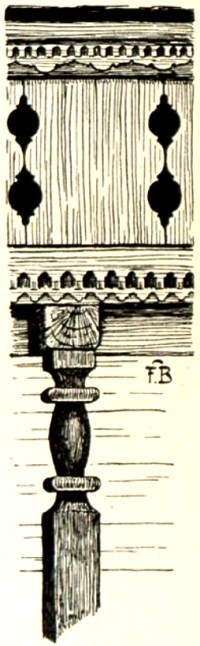
Sommerlaubepfosten.
(Uf der Gärwi.)
Ein verwandtes erzählt:
Tausend achthundert achtzig und acht,
Da hab ich diese Schiir gemacht.
Hätt mir der Schwager das Geld vorg’streckt,
So hätt ich sa mit Zieglen deckt.
Zum frommen Wunsche kehren zurück die so verschieden gefaßten Sprüche:
Als man zalt tausend achthundert niin,
Ward diese Schier gebuwen fiin
Von Christian Bohren wohlbekannt,
Dermalen wohnhaft auf dem Sand.
Gott b’hiet das Vieh, das Heu, die Saaten
Und lasse alles wohlgeraten.
Dieses kleine Schweizerhaus,
Das hier an der Straße steht,
Mir der liebe Gott beschütze,
Das es nicht zu Grunde geht.
Eine auch auf Melkstühlen und (abgekürzt) auf Käsbrettern ( S. 402) wiederkehrende Aufschrift moralisiert:
Wiechs Loib und Gras
Wie Niid und Has,
So läbte mengi Chuh des bas.
Aus berufener Feder stammen die neuern Inschriften gegenüber der Kirche:
Stark und schmuck das Schweizerhaus —
Das Beste: die Freiheit schaut heraus.
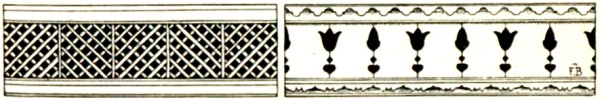
Loibetäfel. / Laubenbrüstungen.
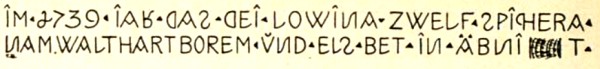
Speicherinschrift im Holewang.

Summerloibestäga mit Bluemmenbeichli.
Und am benachbarten Talhaus:
Ein Schulhaus bin ich, von Menschen gebaut.
Gott stellte ein größeres her! Da schaut
Ein Musterschulhaus: das Grindelwaldtal.
Da setzt euch hinein und lernt einmal.
Wir bringen zum Vergleich einige Sprüche aus dem Lötschental. 38
(In) diesem wilden Tal, wo der Schne in Hafer felth
Wagst das Beste Gras, so man findet in der Wält.
Deo gratias
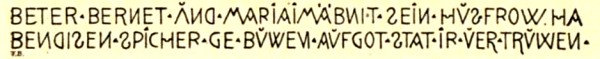
Speicherinschrift. (Wärgistal.)
Hier buw ich nach meinem Sin
Ob ich schon nicht iemand gefelig bin.
Däm es nicht gefalt,
Där denck, Er hab es nicht bezahlt.
D.B.Z.M.
In dem 1884 abgebrannten Dorf Wyler:
Du verwelktes braunes Blatt auf meinem Schoß,
Was willst du mitten im Sommer sagen?
Noch ist dein Leben jung, die Freude groß,
Und fröhlich siehst du jeden Morgen tagen.
Wie lange währt’s, und herbstlich kalter Hauch
Knickt die Blätter und die Menschen auch.
Bald wird auch dir das letzte Stündlein schlagen.
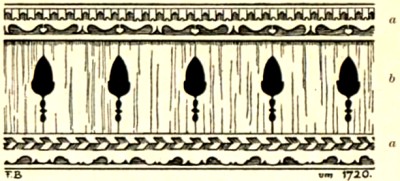
Loibetäfel:
a Geschnitzte und b ausgesägte Lauben-Brüstung.
1
Sohnrey 101.
2
Vgl.
Gauchat (im «Archiv» S. 351).
3
H 2.
4
E 2.
5
G 3.
6
D 2.
7
F 3.
8
E 3.
9
H 2.
10
D 3.
11
E 2.
12
H 2.
13
H 2.
14
C 4.
15
D 3; E 4.
16
Kluge 158.
17
Lf. 177.
18
Vgl. dagegen «Ghusme»
Lf. 179.
19
Hoops 510; vgl.
Meringer 71 ff.
20
Museum 2, 773.
21
Kluge 162.
22
Lf. 167-170.
23
Vgl. Note 26.
23a
Altes
hugjan (erhalten in Hugo, Hug, Hügli) ist unser «denken».
24
Vgl. dagegen
Lf. 180.
25
Anders
Lf. 240.
26
Pokorny, Mineralogie 126.
27
F 3.
28
E 2.
29
E 2.
30
Font. 5, 513.
31
Habsb. 2
a, 579.
32
Font. 8, 536 f.
33
Lf. 183.
34
Gladbach 2, 23.
35
Vgl.
Lf. 136-186.
36
Die Ablautgruppe
risch, rasch, rösch ist im Altdeutschen (
Graff 2, 548;
mhd. WB. 2, 1, 555 f.) nur i .S. v. «rasch» belegt. Leicht aber vereinigt sich auch hier mit der zeitlichen (und modalen) Anwendung die räumliche i. S. v. rasch ansteigend. Aus «röösch» und «rööscht» (mit dem so häufigen Anwachs) konstruierte sich dann die Fachtechnik, im Anklang an ein Homonym, einen «Roost». An die «rööschi Frau» des Unterlandes gemahnt fz. «
gai» aus ahd.
gâhi gâh, jäh, worin sich in ähnlicher Weise zeitlich-modale und räumliche Vorstellung mischen. Man denke an
gääj = jähzornig und an «gääis Glück», an den «jähen Absturz» und einen
gääjja Chehr (jähe Wegbiegung).
37
Z. B.
Rebmann; vgl.
Kluge 139. 140.
38
Zum Teil nach einer gütig mitgeteilten Sammlung des Herrn Pfarrer Alexander Imhof in Blatten. Vgl. auch
Goms 62 f.
Grịịse̥lli ch gwundrig, wie unser Beruf uns macht, laden wir uns als Käsekäufer ein Găbe̥lli auf den Rücken und wandern durch tiefen Schnee dem entlegenen Winterhaus eines behäbigen alten Ehepaares zu. Wir tï̦ppe̥llen an der Haustüre. Stille bleibt’s auch auf wiederholtes leises Pochen. Wir haben also Zeit, eine kleine «Betrachtung vor einer Türe» anzustellen. Zunächst belehrt uns eine Probe, daß wir ungehindert eintreten könnten; und wir wissen bereits, daß man zwar nicht in der Umgebung des Dorfes, wohl aber in den ụụßendï̦i̦r chigen Orten Tür und Tor und Kisten und Kasten bei Tag und 452 Nacht u nbschlosse n laad. 1 Die der Gegenwart (nicht der Vergangenheit) zum Ruhm gereichende Seltenheit eigentlicher Diebstähle lehrt, mit welch scharfen Sinnen und leistungsfähigen Gliedern Langfinger es zu tun bekämen. Nur der Spịịherschlu̦ssel spielt seine sehr wichtige Rolle. So manches antiquarisch interessante Schloos ist daher eigentlich nur zur Zierde da und kann vor Laube ( S. 456) und Stall füglich durch den schräg in den Pfosten eingeschobenen Loibennăgel oder Stallnăgel ersetzt werden, wenn nicht durch den Holzrĭ̦gel, der waagrecht in einer Chlaffe n läuft. Hauptsache ist ja, daß bei Winterkälte Tür und Fenster gut p’hellsen (füllen), in ihre G’reis passen und fest schließen: daß die Türe b’hä̆bi, das Fenster b’hä̆bs ist. Will man im Gegenteil, daß e̥s A nwärd (ein wenig) Luft einströme, daß man von Raum zu Raum alles vernehme u. s. w., so läßt man e̥s Pfẹister áchcharrs, e n Tï̦ï̦r áchcharri, en Balken áchcharra 2 (ein wenig offen, entr’ouvert.) Es geschieht dann wohl, daß bei Windzug alle drei in ein rụụggen geraten, ähnlich dem rụụggen (kollern) im Leib. Es rührt daher, daß die Spangi in den Chlë̆fen (Türangeln) trocken laufen. Das Lehnwort Angel braucht man bloß in der bekannten Redensart vom schwä̆be n zwí̦sse n Tï̦ï̦r und Angel («zwischen Stuhl und Bank»). Boshaft Witzige wenden diese etwa auf die «Mauerblümchen» des Tanzbodens an, welche als Bịịstaalkăriga («Türpfostenkarle») immer d’s Bịịstaal hein, daß’s nid umghịji, und nur von Biistaaljaaggi old vo n Wwandhansli Schrịịs g’hä̆ben hein. Wer indes an diesen kunstlosen Bauteilen allzu eingehende Studien machen wollte, könnte als Großgewachsener leicht vergessen, si ch e n chlịịn ịị nz’haan (sich zu bücken) und infolgedessen mit der obern Türleiste unliebsame Bekanntschaft machen: deṇ Grind a’n Obertï̦rler aa nrrïehrren oder a n’ mmu̦ aa nchoon. Nicht unangebracht ist daher die gelegentliche Mahnung: «Gä̆ben Sie Acht, Madamm, daß Sie nicht dän Kopf anschie̥ßen!» — Überdies dürfte ein heimlicher Beobachter mutmaßen, ihm fählli’s im Obertï̦rler («im Oberstübchen»).
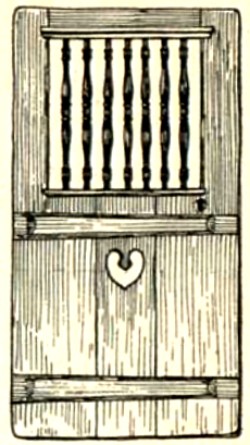
Haustor.
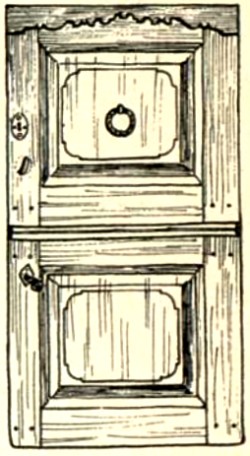
Außenseite.
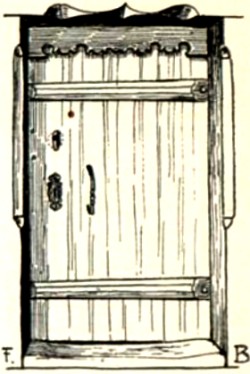
Innenseite.
Haustüre.
Wie nun aber der Blick auf die stark abgetretene Schwelle: die abtschaarget, zergrappet, abg’rälle̥t Schwella fällt, kommt uns plötzlich in den Sinn, warum wir immer noch keinen Beischeid erhalten. Hätten wir uns doch sogleich erinnert, daß der alte Grindelwaldner mid dem Schueh a n d’Schwella g’chlopfed heed, um sich anzumelden! Diese anscheinende Roheit hatte ihre guten Gründe. Ein genauerer Blick auf die obere Hälfte der Tür, vor welcher wir stehen, belehrt uns nämlich, daß wir es hier mit einem Hụụstoor alter Einrichtung 453 zu tun haben. Das zeigt uns die Reihe ausgeschweifter (anderwärts gedrechselter) senkrechter Stäbe: Spränzla, welche die Bretterfüllung (oder die spätere Verglasung) ersetzen und im Sommer, ja selbst auch an milderen Wintertagen, für Luft und Licht direkten Durchtritt in die Küche gestatten. Denn während dieses «Haustor» als Vortüre in der Regel zue ist, bleibt zu besagter Zeit die innere Tür: die Hụụstï̦ï̦r, offen. So zeigt sie dem Beschauer ihren nach außen gekehrten Bau als g’stämmti Tï̦ï̦r mit Füllungen und Friesen, während sie die küchenwärts gerichtete einfachere Fügung als Lịịste ntï̦ï̦r nun gegen die Wand kehrt. Spätere Bauten ersparten sich diese Doppeltüren, ersetzten sie aber bis unlängst gerne durch die horizontale Trennung der Haustüre in eine obri und undri Tï̦ï̦r. 3
Am kalten Wintermorgen ist natürlich bei den alten Leutchen auch d’Hụụstï̦ï̦r zue. Gleichwohl brauchen wir unsere energischere Anmeldungsart nicht zu wiederholen. Denn nicht lange, so dreht sich die innder Tï̦ï̦r indertsi ch, die ụụßer ụssertsi ch ụụf. Und da wir von der Alp her ein guter Bekannter sind, erwidert der herausgetretene Alte unser wohlüberlegtes Guete n Tag gä̆b e wch Gott! mit einem ganz heimeligen Danki (danke) Gott! —: Lohn e̥ wch’s Gott! fügt das alsbald zum Ehemann sich gesellende b’satzd (oder b’setzd: wohlbeleibte) Mütterchen hinzu. Wĭ̦ĭ̦l ier ị̈ị̈ ns ḁ lsó na ch altem Brụụch d’Zịịt g’wịịsd (oder g’wĭ̦sen) heid, so mieße n mmier e wch tẹich wohl o ch ḁ lsó umhi lohnen! Ganz angeheimelt bestellen wir einen Gruß von unsern Quartiergebern und hören die Erwiderung: Ja? So grïeß si e Gott oo ch und den Bŏten oo ch! 454 Aber, fährt der trauliche Alte fort, e n sältsḁna Gast! Mier siin e̥ wch ja scho n llang wartend (erwartend) g’sịịn! 4 Das gesprächige Mütterchen aber wartet uns auf mit den lustigen Empfangsformeln: Wär ist gstorben? (da du wohl als Leichenbitter kommen mußt?) oder: eh, wolltist du stärben? (und hast uns zuvor noch ein äußerst wichtiges Anliegen vorzutragen?) Ja schalkhaft verzieht es den Mund und haspelt spassig die sprichwörtliche Erkundigungsformel herunter, welche von einem außerordentlich neugierigen Handwerker her in ganz Grindelwald die Runde macht: Wa chụụ nnst har? Wa wolltist hin? Wăs hei n s’ de̥r g’seid, wăs ’sëllist sä̆gen? Was hest in däm Seckli? Was treist in däm Hu̦ttli? Jetz aber is’ ’s gnueg! schließt es ab. Chë̆mid grad ei ns inha! Lä̆big old no ch ehnder! («flink oder noch eher»). Wir suchen nach Gelegenheit, die Schuhe zu reinigen. Oh, butzid e̥ wch nu̦mmḁn nid ab! tönt es unter hellem Lachen weiter. Butzid e wch den n ab, wen n er ụụsi gangid! Old nä̆hmid deṇṇ grad den Bä̆se n mmid e̥ wch inha! Mier hein dräckigi Wịịti g’nueg. Mier hein de nn f rịị n en Aa nrrichti (oder f rịị n e n Mmustrug)! Mier hei n jetz denn flu̦gs g’loibd, es gäb Schlangi u nd Chrotti! Es ist hotzelocht, Hooggis uber Booggis! Es versteid 5 nịịd, da ḁ lso ụụfz’rụụmmen, we nn mmu̦ së̆ve̥l Pu̦rß 6 heed! Die schrịịßen ei’m meh fï̦̆rha, wa n mmu̦ mag dänna tuen. Übrigens, we nn mmu̦ nu̦mmḁ n mmag g’hŏhlen («sich durchhöhlen»), das s mu, inhi mag!
Wischen u wäschen
Gid mer nid z’ässen,
U’d der Fäger in der Hand
Gid mer nid d’s Gwand,
Wir haben bereits die Erwiderung eingeübt: I ch rụụmmen e̥ wch ni̦d ụụf, mier hein daheimme n gnueg. Dies ist uns um so leichter geworden, da wir solche chinesenmäßige — mitunter auch etwa renommierende oder doch nach Komplimenten fischende — Selbstherabsetzung auch von andern Gegenden her kennen, wo man gerade des unerbittlichsten «Peinlich reinlich» sich befleißigt. Zu demselben erzieht von selber das Umgehen mit der äußerst empfindlichen Milch, und die hier erworbene andere Natur kommt auch den nächstverwandten Lebensgebieten, sonderlich dem des Kochens und Essens, zugute. Aus Teller und Tasse auch des seitab hausenden Einsiedlers darfst du getrost essen und 455 trinken — sorge nur, daß nicht du ihm eklig werdest! (Vgl. S. 395.) Alle Augenblicke wird in Küche und Alphütte das Hendwääsch; (s̆, Waschgeschirr) in Anspruch genommen, wird g’wäschen (s̆s̆) und g’schwẹichd (gespült). Welch ein gründliches Riebeln und Bürsten des Alpzị̈ị̈gs am Lägerbrunnen, der sein spiegelhelles Wasser in mächtig geschwungener Parabel in den außgemeißelten Riesenfichtenstamm dahinwirft! Dieses eifrige Hantieren muskulöser Männerarme, nicht gestört durch noch so manchen vielleicht auch ungewaschenen Witz, der sich über den Bịịßer des Stummelpfeifchens hinausdrängt, macht auf den Neuling einen ganz eigenartigen Eindruck. Aber auch den energisch aufstrebenden jungen Sommerbergwirt sehen wir die schwere Rückenlast ablegen, unter heiterem Witzwort an einen der zahlreichen Gäste sich den Schweiß von der Stirne wischen und alsbald in der Küche Handlangerdienste verrichten. Wie elegant hantiert er mit Abwäschhu̦del und Handlumpen, mit Harnisch (oder Harnischblätz) und Wï̦rzlifä̆ger ( S. 285)! Jetzt greift er schleunig zum bi̦rhigen Bä̆sen und zum Schmălbä̆se̥lli, zu Ggĭ̦sterschụụflen und Ggĭ̦sterhu̦tten, um das Ggĭ̦ster auf den Ggĭ̦sterhof zu verbringen, also z’wischen (s̆s̆) und überhaupt ụụfz’ruummen, i n d’Egge n z’rụụmmen, ụsazg’eggnen. Wir wissen aber, daß auch in seiner Winterwohnung Or dnug ist und keineswegs alls dï̦r ch enandre n wie n e̥s Ärbsmues.

Das Stubestiirschiibli oder Gguggi.
(Guckloch oben in der Türe.)
ca. 6 cm Durchmesser.
Kaum nun sind wir eingetreten, so haben sich zwei andere Besuche genaht — sehr verschiedenartige: es ist en großa Underschi̦i̦d under ’nen. Ein Epigone des durch seine Unverschämtheit unsterblichen Ggŭ̦ggi ist gleich bis vor d’Stŭ̦bestï̦ï̦r vorgerückt und schaut dï̦r ch d’s Stŭ̦bestï̦ï̦rschịịbli inha (das sonst vorzugsweise die Mutter zur heimlichen Beobachtung der Kinder benützt), wär drĭ̦ n sịịg. Unser Gastgeber tritt hinaus, und der Eindringling faad eppḁs an, uf den Esten umha tanzen: er «streckt die Fühlhörner aus», um die Stimmung gegen ihn zu erforschen. Zur Kürze gemahnt, brooted e̥r: redet um etwas herum, das sich als e̥s Almuesen zu erraten gibt. Die Mutter erhält Auftrag, ein Stück Brot und Käse zu bringen; aber ungïetig (lästig) mundfertig mueted der Unverschämte weiter (bettelt verblümt). Das macht unsern Mann endlich mu̦tschiga (unwirsch wie einen «bissig» gewordenen Mu̦tsch, S. 423), so daß er zu einer barschen Abfertigung sich anschickt: ne n churz abspiised. Das pariert der Schlaue, indem 456 er mu̦ jäämmerli ch underg’sehd u nd seid: Eeh, han i ch di ch toïba g’machd? Was han i ch de̥r z’heißes g’gässen, daß d’e n settiga Grind reisist? Gib du me̥r jetz um de̥r Gotts Willen no ch e̥s Mụtschli! Antwort: Ja nu! wịịl d’ seist: de̥r Gotts Willen, su̦ muest ei ns haan! (Mißbrauchst du Gottes Namen, so hast du’s zu verantworten. 7 ) Auf sein Dank heigid! aber wird der Unverschämte mit der traditionellen Formel verschickd: Da hesch nịịd z’danken! Das mag’s nịd erlịịden. 8 Noch einmal hatte unser Mann die Unverschämtheit triumphieren lassen; allein er entschloß sich — är hed de n Chnopf g’machd —, es nie mehr zu tun: ’mu̦ d’s Keisi 9 gään. War doch die Frechheit allen Witzes des alten Ggu̦ggi bar! Einmal bei einem Bauer zu Gaste, ergriff der den aufgetischten halben Mu̦tsch und fragte: Chan n i ch dḁrvo n jetz abhauwe n, wa i ch wil l? — «Ei nmmḁl wohl!» — Ja, su̦ wil l i ch am liebsten daheimen dḁrvon abhauwen. Zum Lohn für den Witz durfte er den Käse behalten. — Ganz anders das tschi̦tter Wịịbli, das mit sehr anständigem Benehmen g’rĕsëënts, entendant raison — ohne zu betteln naht, aber gar gern seine Spịịs ( S. 382) entgegennimmt. Gerührt dankt es: Bhïet e̥ wch der lieb Gott Lịịb u nd Seel und Hụụs und Hein u nd d’s Veh und alls was e̥r heid, und welli Gott, daß e̥r nịịd dẹs minder heigid! So tued’s grịịse̥lli aa nwenden (sich befleißen), und unter freundlichem Das welli Gott wird sein B’hïet e̥ wch Gott erwidert.
Jetz weid ier teich o h eṇ gueta Handel tuen! heißt es nun zu uns mit lächelndem Blick auf unser Găbe̥lli. So chë̆mid ier jetzeṇ grad sälber uehi i n d’Loïba gan ụ̆ụ̆slä̆sen was e wch gfalld! Mit der Loiben ist eine (selten zwei) der drei Gemächer über den Stuben gemeint. Dort birgt der Bauer seine Milchprodukte, ( S. 405.)
Aus der schattigen Laubhütte 10 (vgl. die «Gartenlaube») hervorgegangen, ist mit der Zeit die Laube ähnlich dem Saal und Gaden, der flachländischen Scheune und bisweilen dem Speicher unter das Dach des Hauses gezogen worden. Dem Nidwaldner ist das «Läibli» ein einfenstriges Zimmerchen, dem Zürcher die «Läwbe n» ein Korridor, 11 dem Grindelwaldner die Loiba sowohl die Su̦mmerloiba in vorn ( S. 447) beschriebener Gestalt, als die jetzt zu betretende «Laube» als Obergemach über je einer Stube.
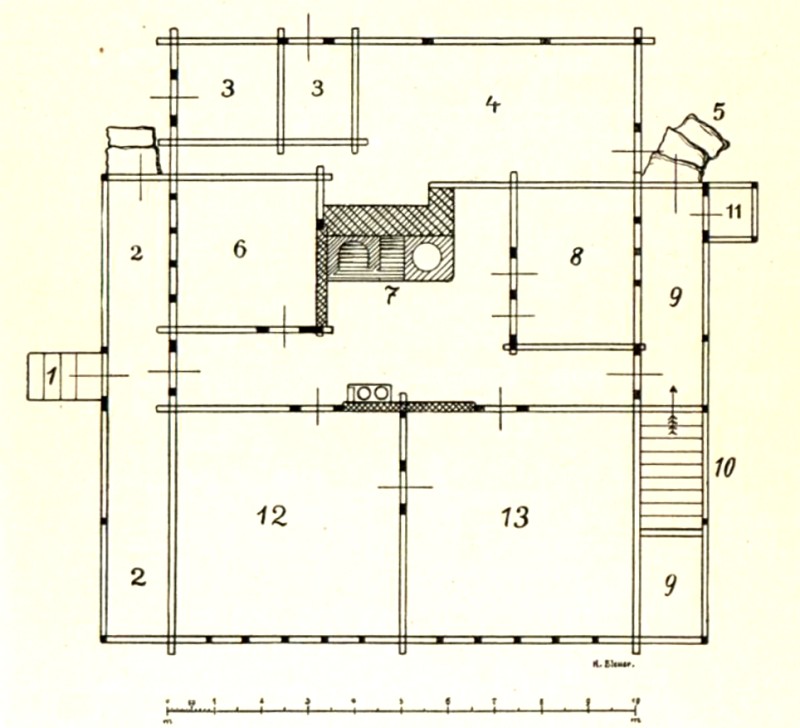
Grundriß des Bleuer-Hauses im Moos.
1 Stäga. 2 Summerloiba. 3 Siwställ. 4 Vortach. 5 Stägli. 6 Hinna-uusa-Stibli. 7 D’s Gsodchessi u. d’Fiirblatta. 8 D’s Chuchistibli. 9 Summerloiba. 10 Stäga. 11 D’s Hiisli (Abort). 12 Die (uußer) Stuba. 13 Die innder oder ander Stuba (Näbetstuba).
457 Nicht ohne Selbstgefühl öffnet uns der Mann die Chääsloiba. Da liegen die linden und da stotzen (stehen) die trochchenen Chääsle̥ni ab der Alp und die Mu̦tschle̥ni vom Chääsëfe̥lli ( S. 458) auf den Stĕlinen ( S. 404), welche eine ganze Längswand oder beide garnieren. Aihe nfäßle̥ni und allenfalls Chŏre nstandle̥ni ( S. 270) vervollständigen das Mobilar. Wir sind bald Handels einig, und nur der berufsmäßige Gwunder läßt uns noch in die gleich niedrige und roh gezimmerte Gwandloiba einen Blick werfen. Versagt ist uns ein solcher wegen absichtlichen Lichtmangels in das fịịster Leïbli oder Fleischleïbli über dem Hinna-ụụsi-stï̦bli. Denn die am obre n Soller hängenden Späcksịịti, Hammi, Lí̦dle̥ni nebst anderm 458 dï̦rrem old g’reïkdem Fleisch sind zum Wohl und Besten des Eigners lichtscheue Dinge.
Si mießen alli fiister haan,
Denn cheme d’Guege minder draan.
Die Loïbestï̦̆re̥ni schließen sich, und über den Loibeṇgang schreitend, tappen wir uns über die schmale, finstre Loibe nstä̆ga wieder in die Küche hinunter.
In derselben sehen wir uns erst jetzt um, und das Mütterchen kommt unserer Neugierde hell auflachend zu Hülfe. Das da ist d’s Stä̆genhụụsi, wa n er jetzeṇ grad sịịd ahachoon. Und das Egge̥lli da ist d’s Chu̦chchistï̦bli old d’Chĕbia (vgl. S. 421) fï̦̆r G’wundernăsi. Und hie ḁ lsó am Brandmị̈ị̈rli hei n me̥r bis fäären (letztes Jahr) o ch no ch nu̦mmḁn en altvätrischi gmụụreti, ei nlï̦chchrigi Chunst g’hä̆ben. Aber sie ist ụụs’brennti g’ṣịin und ist z’lest (zuletzt) zertrooled. Duḁ hei me̥r duḁ dĭ̦si zweilï̦chchrigi Ịịse nchunst, wa jetzen da ist, g’choifd u nd laan dartuen. Die ziehd jetz besser! Wen n i ch n̦ummḁ n Ggaffë machen, su̦ wird der Ofen in der Stŭbe n g’fị̈ị̈rheißa, das s er tschụụsled! Wen n i ch albḁ vi̦i̦l u nd lang chochchen, su̦ tuen i ch denn de n Su̦mmerzug ụụf u nd laa d’Wẹrmi dï̦r ch d’s Chĕmi ụụf. Su̦st wurdi in der Stuben nu̦mmḁ n z’heis s.
Aber jetzen achtid ei ns hie an der hindre n Wand! Da hei n me̥r no ch es altvätt’risches Ịị ng’richt: e n Fị̈ị̈rblatta und e̥s Chääsëfe̥lli und e n Gsŏdŏfen, alls nä̆b’nenandren. Sëli chß ist ’nen jetz i’n nï̦wwen Hị̈ị̈s’ren nï̦mme̥ gued. Aber i ch bigähre n ’s glịịch (gleichwohl) no ch nid lan ụsi z’rụụmmen. Gäbigs is’ ’s doch no ch, we nn mu̦ im Summer, wa mu̦ d’Wẹrmi in der Stuben nid nëëtig heed, uf der Fịịrblatten in der Bei npfanne n (Pfanne mit drei Beinen) cha nn Ggaffẹ machen; old we nn mu̦ den äärigen Hăfen (aus Erz, Bronze) chan n a n d’Hääli (Aufhängekette, crèmaillère, S. 417) hẹihen u nd d’s Garte nzị̈ị̈g ( S. 262) dadrĭ̦ n chochchen. Grăd der Äärbsfĭ̦sel ( S. 263) wird nu̦mmen in ’em äärigen Hăfe n rächt gued! U nd we nn mu̦ de n Winter dï̦ï̦r ch e̥s Trëpfli Milch z’chääsen heed, gi bd’s e̥ s 12 si ch o ch besser, we nn mu̦ d’Milch im Chesse̥lli am Turner da chan n u̦f d’s Chääsë̆fe̥lli rï̦cken, wa n we nn mu̦ sa in em Chunsthăfen in der Chunst sol l chääsen. U nd der Gsŏdŏfen mit dem ịị ngmụụrete n hundertu nddrịịßglịịtrige Chessi, där ist nid nu̦mmḁn gä̆biga fïr de n Sï̦wwe n z’g’sŏden; där verstelld ei’m grad e̥s Wëschhụụs (s̆). Da cha nn mu̦ d’Wesch (s̆s̆) sieden, u nd d’Wäsche̥rri (s̆s̆: Wäscherinnen) hed mu̦ denn grăd in der Chuchchi und’r’ den Oïgen; und de nn miëße n s’ eppḁs tuen u nd tërffen ni̦d 459 alliwịịl nu̦mmḁ n tä̆tschen. Ja gloibid’s nu̦mmḁn, i ch tị̈ị̈scheti (s̆s̆) mị ns altvättrisch Fï̦ï̦rhụụs no ch lang ni̦d an en nï̦wmëdischi (s̆s̆) Chuchchi! Was s’ in e’r sëlhen gueds wissen aa nz’reisen, bringen i ch hie o ch alls z’wä̆gen. U nd we nn mi ch d’r Att eppḁ ei ns hinder d’s chïechle n reised, su̦ bringen i ch hie so gueti 13 us dem Fị̈ị̈r (vgl. S. 461) a ls dert. I ch b’chennen meṇ’gs fï̦̆sigs Wịịb in e’r heerenochte n Chuchchi, wa den n no ch lang nid Fïetri gääbi under mi ch fï̦r d’s chïechlen. Äs chunnd denn drŭ̦f aan, ob mu̦ newwḁs chenni und newwḁs dḁrzue heigi. Ier heid d’Aihe nfäßle̥ni doch g’sehn e̥m erst, wa e̥r sịịd i n d’Loiba g’sịịn?

Alte Bauernküche.
(Drei offene Feuerstellen,
Fiirblatti.)
Die alte Küche spitzt sich fast im ihrer ganzen Ausdehnung nach dem zweiten Stock hinauf viereckig zu, und eine Öffnung an der Spitze dieser Pyramide läßt uns unmittelbar den blauen Himmel erblicken. Wir haben es mit dem alten holzige n Chĕmi, Holzchĕmi zu tun, welches vortrefflich ziehd, aber außerordentlich chaalts ist. Das Mittelstück, die Chemiglogga, nimmt fast den halben Laubengang in Beschlag. Über das Dach hinaus ragt der Chemihals und kann von der Küche aus mittelst des Chemitechchels (Abbildung S. 446) geöffnet oder gegen Wind, Regen und Schnee abgesperrt werden. Die zwei Asnibeïmle̥ni mitten im Chemi nehmen Fleischstäcken auf, an welchen das Fleisch zum reïken g’hẹichd wird. Dies vollzieht sich hier weniger gut als in den alten abzuglosen Roïchchuchchinen, 460 besser immerhin als in den sonst weit vorzuziehenden gemauerten Kaminen. Diese unterstehen nun der Feuerpolizei, während die Holzkamine von den Hausbewohnern mittelst Trooslenbäsen ( S. 169) selber gereinigt werden. Unberufene Zuschauer bekommen dabei etwa ihr unwillkommenes Teil ab über Gesicht und Gewand. Daher heißt einen ausspotten oder beschimpfen: uber einen ụụs rueßen. Den einst ungebahnten Weg des Rußes zeigt die niedrige Rueßloïba über den vorhin beschriebenen Lauben an. In neuern Gebäuden wird sie durch den Estrich ersetzt.
Die Rußlaube erinnert an die Küche 14 oder Herdstatt 15 als ursprüngliches «Haus»: das Herdhaus 16 der Baugeschichte. Noch bei Mannsgedenken hieß auch in Grindelwald die Küche d’s Fị̈ị̈rhụụs, ja kurzweg d’s Hụụs. 17 War man in der Stube, so schickte man ein Kind nach der Küche: gang ŭ̦ŭ̦si i n d’s Hụụs u nd reich me̥r das und das; also ganz analog, wie der Feuerraum der Alphütte d’Hïtta ist ( S. 415 f.).
Hier pflegt ja der Mensch sein «ältestes Haustier» 18 das Feuer — neben dem Wasser als heilige Himmelsgabe bei hochbegabten alten Kulturvölkern verehrt. Noch der heutige Volksglaube bietet Anklänge an die einstige Perserreligion, wenn es heißt: Wär i n d’s Fị̈ị̈r spï̦̆wd, uberchunnd e̥s rụụdigs Mụụl; nu̦mmḁn der Tị̈ị̈fel tueds. 19 Buebe n, wa i n d’s Hirte nfị̈ị̈r brï̦nzlen, tïen dem Tị̈ị̈fel Wasser und Holz ii nttraagen. Ganz eigentümlich mutet aus alter Zeit, welcher jeder Gedanke an Holzersparnis so ferne lag, die Mahnung an, man solle das Wasser nicht unnütz brodeln lassen. Chochched d’s Wasser im Hụụs, so ist d’s Unglï̦ck vor dem Hụụs. Was man heute als lässige Vergeudung von Zeit und Material tadelt, war einst entweihendes Herunterziehen des Feuers in die Knechtschaft menschlicher Willkür und Laune, Trägheit und Sünde statt in den Dienst des strikten Lebensbedarfs.
Für alle an ihm begangene Leichtfertigkeit rächt sich aber das Feuer auch — nicht ohne warnende Vorboten. Wen n bi ’nem Hụụs z’bu̦wwen der erst Tŭ̦bel ( S. 427) bi’m ii nschlaa n rroichned, su̦ verbri̦nnd d’s Hụụs. 20 Das Feuer «entrafft sich der Fessel» wie in dem furchtbaren Schadenfeuer von 1892 ( S. 121). Sonst sind allerdings die Brandfälle so äußerst selten, daß eine Örtlichkeit die Bezeichnung bi’m verbrunn’nen Hụụs 21 als Eigennamen tragen kann. Ist freilich einmal ein Brand ausgebrochen, dann ist das Gebäude meist hoffnungslos 461 verloren, und in der Regel bringd mu̦ nịịd u̦s dem Fị̈ị̈r. Das heißt (wie nịịd u̦s der Schlacht bringen) auch bildlich: dies Unternehmen glückt nicht ( S. 459) oder rentiert nicht. Die seit 1892 neu organisierte Feuerwehr ( S. 121) mit ihren vierzehn Fị̈ị̈rleïffren, ihrem Hydrantennetz, der großen Dorfspritzen, den ebenfalls fahrbaren Spilstatt-, Schluecht- und Mättenbärgspritzen und den zum Tragen oder charre n von Hand eingerichteten Spritzchen von ụụßendï̦ï̦r chigen Orten muß sich in der Regel auf Rettung der Nachbargebäude beschränken. Und auch dies ist nur möglich, wenn Brunnen und Bäche gestatten, jeweils bis zum Abrueff härzhaft Wasser z’gään. Mehr erwirkt auch hier das Verhüten des Unheils speziell durch die sechs Fị̈ị̈rg’schauer, wa dem Rueß na ch gaan.

Bi’m Wiibertrost am Ofen.
Schadenfeuer kann entstehen durch; vorsätzliches aa nstecken eines Gebäudes; durch leichtfertiges bụ̆be̥llen (daß Bụ̆bi der Kindersprache ist Feuer und Licht); durch, Selbstentzündung — e ntbri̦nnen — gärenden Futters; höchst selten durch Blitzschlag: we nn d’s Wätter schießd.
Dem «e ntbrinnen» steht gegenüber das transitive e ntbrennen (das oberhaslische «empfẹngen» 22 ) von Brennmaterial für Licht, Speisebereitung und Wärme. Man entbrennt Zï̦nthëlzleni, entbrennt das Licht, die Lantäärna. Man macht e̥s Ịị nfị̈ị̈r oder tued ịị nfị̈ị̈ren behufs 462 Heizung; und man machd e̥s Fị̈ị̈re̥lli oder e̥s Aa nfị̈ị̈rli, man tued aa nfị̈ị̈ren oder reïken auf dem Kochherd. Zu solchem Geschäft bedarf es natürlich einer gewissen Reife. Dás Meite̥lli da ist no ch z’gääjs (wird zu früh beansprucht) 23 oder ist no ch z’jungs fï̦r nes Aa nfị̈ị̈rli z’machen. Es bedarf schon einiger Kraft zum baarten: zum Schnitzeln eines Bartes (am Scheit hängen bleibender Späne), womit besonders unbri̦nnigi Schịịter zu rascherem Brennen gebracht werden. Wie leicht kann auch ein unsorglich gehandhabtes Streichholz noch hintendrein in gefahrbringender Weise Feuer fangen! Es brinnd a n d’s Hëlzli: es ist eine Gefahr vorhanden, und mir wird angst und bange.
E teil hein gääre g’schichti Chind.
Nid, daß ’s’nen grad a d’s Helzli brinnd,
Daß ihru Chind uf diser Ärden
Just selle Staatsminister wärden.
Doch usw.
24
Oder das Kind kann de n Spaa n llaṇ gaan, weil er an die Finger brennt, und damit die Übertragung auf einen Menschen veranlassen, der bei Übermacht hindernder Umstände von einem angefangenen Werk die Hand lassen muß. Die schlecht verhehlte Unzufriedenheit unter Eheleuten hinwieder, von denen nur eins erbt, kleidet sich in die Rede: Es geid gẹng ḁ lsó g’nietig, nummḁ n mid éi’m Spaa n z’fị̈ị̈ren. Ferner will d’s Fị̈ị̈r sachkundig unterhalten sein. In gegebenen Augenblicken mues mu̦ eppḁs aa nllĕgen (Holz zulegen), sonst brinnd’s schlächtli ch; d’s Fị̈ị̈r sẹngd si ch (senkt sich; im Hasli: «singged») unter leisem Zischen; e̥s vergeid, und d’Glued ist am tooden, sie tooded. Bald wieder loodred das Feuer und treid Sprangen ( S. 397) old Flaammen dï̦r ch de n Luft. Die Flamme heißt der Flaammen 25 und ist éin Wort mit der Bezeichnung des schwellenden Euters ( S. 390) als Parallelbildung zur Sippe von lat. flāre = blasen. Die gut mundartliche fachliche Vertretung von «Flamme» aber ist Glanz. Das Feuer glanzed, glanzed ụụf, glanzed häälụụf; und weh, wenn gar etwa siedendes Fett Feuer fängt: wenn der Schmutz aa nfaad glanzen! Es bedarf dann des Humors eines richtigen Grindelwaldners, um nach solchem Erlebnis Schaden und Schrecken unter dem Wettevorschlag vergessen zu lassen, e̥s vermëgi niemḁ n d’Fị̈ị̈rblatta mid Anke n z’salben, wan äär. Bloße Heiterkeit dagegen erweckt es, wenn die kleine Kochkünstlerin Rueßflecke 463 abkriegt: si ch b’räämd, so ernst hinwieder die Rede von einem klingt, der vermutlich Frevel an den Eltern abbüßt: där hed si ch g’wiß a’n Elt’re n b’räämd!

Winterarbeit.
Sowohl absichtliches wie ungewolltes Leuchten heißt zï̦nten. Vgl. ei’m heim oder dänne zï̦nten. Auch z. B. ein Gewehrschuß zï̦nted im Dunkeln; die grell und heiß scheinende Sonne aber zï̦nted zuehi ( S. 364). — Obwohl es um 1828 im Amt Interlaken fünf Eele̥ni (Ölmühlen 26 ) zum ëëlen von Flaxsaamen gab, zog man dem Flachssamenöl noch lange, ja auf der Alp bis um 1850, die Hărzfeißti oder den Lichtschmutz vor. Das war eine Mischung aus einem Teil Tannenharz und drei Teilen Butter und diente übrigens auch als treffliches Schuehsalb. Im offenen Tä̆gel hed mu̦ sḁ nid so lịịcht ụụshịjd u nd versĭ̦wwed wie das Öl, welches zudem stark rauchte und rußte und schlecht leuchtete. Erst als das Räpsëël aufkam, wich der Harzfeißtitä̆gel dem Eeltä̆gel. Dieser letztere ist denn auch gemeint, wenn es von einem blindstärne nvoll Betrunkenen 464 heißt: är hed aber e n Tä̆gel! är hed e n Tä̆gel g’lăden! Der Tägel erleuchtet auch die Stalllantärna, sowie der eigene Mịjeltä̆gel das Mịjellantä̆re̥lli im Stall. 27 Auch beim Gebrauch des Repsöls mußte man sehr häufig die rasch verkohlte Dochtspitze entfernen: de n Chŏlen abstrịịhen, was beim Brennen von Betrool nicht mehr der Fall ist. Mehr und mehr aber gewinnt nun d’s eläktrisch Liecht Eingang, und man erlegt gerne achtzehn Franken fï̦r nes Trähtli volls oder fï̦r n es Lämpli (Glühlicht) von sechzehn Kerzen.
Vom Licht zur Wärme!
Der bereits S. 419 angezogene Stubenofen war früher der rohe, ungeschlachte, in Brusthöhe errichtete würfelförmige, aus Bruchstein und Mörtel aufgemauerte Stockŏfen, in welchen man ganze Klötze, ja Wurzelstöcke u ng’schĭ̦tten ( S. 185) vom Herd her einschieben konnte. Er ist nun doch fast überall durch den Trittŏfen ersetzt. Der Ofe ntritt erst macht ihn beinah zum Ideal eines Stubenwärmers. Kommt dazu noch das Ofe nllooch (im Lötschental: die «Ofe nschlopfa») an der Ofenmauer, ferner das auf zwei Seiten herumgehende Ofenbẹichli und parallel gehend unter ihm das Schuehbẹichli zum Aufstützen der Schuhe und Ausruhen der Füße, so ist die Bequemlichkeit des Emmentalerofens 28 wenigstens zum Teil erreicht. Was ihn davon besonders unterscheidet, ist das fehlende Hinüberreichen in die Nebenstube und der Aufbau aus den fast einzig nah erreichbaren Ofenblatten aus dem Fụ̆ụ̆lblatte nlooch zwischen Hertenbühl und Waldspitz, also aus dem Tonschiefer des Faulhorngehänges. Diese Öfen sind wenig präsentabel, doch leicht und auf die Dauer heizbar; bloß mittelst leichter Platte auf Tï̦tschĭ̦nen als Ofenbeinen ruhend, könnten sie aber bei einiger Überheizung leicht springen, ja zertroolen. Besser gemahnen an den Emmentaler Ofen die Ofe nstengleni zum Trocknen von Kleinwäsche.
Höchst selten führt, wie in unserm Einlageblatt, ein Ofe nstä̆ge̥lli vom Stufenofen aus durch das Ofe nlooch in die Chääsloiba ( S. 457) hinauf. Wenn die Vermutung nicht von kompetenter Seite bestritten würde, so möchte man in diesem Stä̆gelli den in alter Zeit gewöhnlichen Vorläufer des Stä̆genhụụsi ( S. 458) erblicken, wie hinwieder an des letztern Platz in neuern Gebäuden die Außentreppen in hübscher Parallele von Stock zu Stock führen. Die untere, oder seltener von dreien die unterste, leitet vom Unterbau mit dessen ebenerdigen Zimmern, Werkstätten oder Krambuden ( S. 439) über dem nunmehr eingegrabenen Keller auf die untere Sommerlaube. Die zweite Treppe geht zur obern Sommerlaube 465 und mittelst ihrer in das obere Stockwerk, welches dank seiner größern Hëëjji aus einer bloßen Loibenhëëhi ( S. 440) zu einer Stŭ̦benhëëhi vorrückt. Über eine dritte Außentreppe gelangt man bisweilen zu einem ebenfalls noch sehr wohnlichen Dachraum. An der Front hat nun der Vorzug ( S. 440) weder Sinn noch Raum mehr. Um so stattlicher wachsen sich die Pfeisterpfësten zu Lịịbwẹndlinen aus. ( Ụụslịịben ist auzfüllen.) Die beiden Frontstuben aber werden in neuester Bauweise durch einen dï̦ï̦r chgänden Gang, welcher das alte, schmale Gẹngli zwischen Haustür und Küche ersetzt, von letzterer und dem Hinderstï̦bli old Hinnaụụsi-stï̦bli und Küche getrennt. Der Typus des Grindelwaldner Hauses ( S. 436) wird durch diese vermehrte Bewohnbarkeit und Wohnlichkeit im wesentlichen nicht verändert. Es ist also einerlei, ob wir jetzt im betretenen alten Haus in der einzigen, oder in einem neuern Haus in einer der beiden Stubenhëëhinen die Wohnstube betreten.
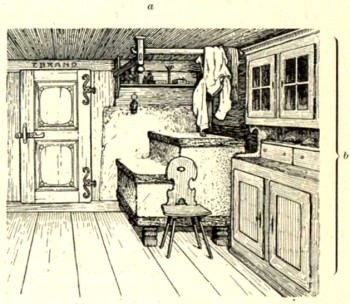
Winkel einer alten
Bauernstube;
darin:
a d’s
Ofenbeichli und ein
Ofestengli;
b der
Glasschaft oder
G’schirrschaft.
Es ist dies die Stŭ̦ba schlechthin, welche dank ihrer Fensterreihe ( S. 441) e n lụụte̥ri (helle) und liechti (lichte) Stu̦ba zu heißen wohl verdient. Die ander Stube oder Näbe ntstuba, etwa auch von jener inndren als die ụ̆ụßri unterschieden, ist ziemlich gleich eingerichtet und in neuern Gebäuden nun auch von ganz oder annähernd gleicher Größe. In ältern Häusern dagegen ist sie meist nur schmal und erinnert da und dort bei ungewöhnlicher Raumbeschränkung fast an einen angebauten Verschlag: eppḁs Zueha’buwwe ns oder eppḁs Gä̆dmers (vgl. S. 410); in diesem Fall spricht man von einem Găden. Heimeliger klingt bei entsprechender Ausstattung der Name Stŭ̦be̥lli.
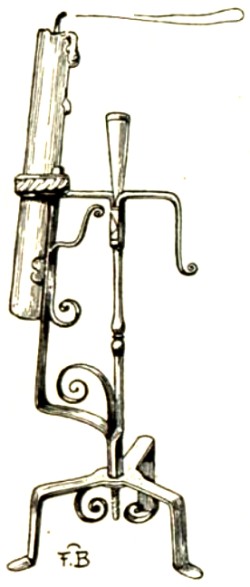
Schmiedeiserner
Kerzenhalter.
Vom 16. bis weit ins
18. Jahrhundert hinein gebraucht.
466 Als Teile der Stube benennt man eigens: die vier Stubeswendi, 29 der ober Soller oder der ober Boden (Zimmerdecke), der under Soller, Stụ̆be nsoller, Boden, Stŭ̦benbŏden. 30 Das Einlegen dieser Sëller nennt der Zimmermann sëlle̥rren. Charakteristisch ist auch hier wie im Emmental 31 der (dem Tĭ̦liboïm des Stalles entsprechende) Underzug, das «Band» des Oberhasli und die mit eingeschnitzten Sprüchen zuweilen äußerst hübsch gezierte «Bi̦nna» (Binde) des Oberwallis. Der Bŏden hinwieder figuriert in allerlei Redensarten und Bildern. Wer hartnäckig etwas behauptet, stelld z’Bŏden oder hed z’Bŏden. Wer erregt mit dem Fuß aufstampft, springd z’Boden. Wer heftig schimpfend einem zugesetzt hat, där ist vor däm gued z’Bode n gsprungen. «Das wirst du mir gelten lassen (müssen)», heißt: Das muest me̥r z’Bode n llaan! Wer eine glückliche Ehe geschlossen hat, ist mit dem hịịraten gued z’Bŏde n choon.
Dem «Tschüepe nlăde n» des Emmentals 32 entspricht die Scheiba oder der Scheibe nladen: er dient dazu, einen neuen Zimmerboden im Maßstab seines Austrocknens nach und nach fest zu schließen, so daß er strẹng z’sä̆meṇ geid. Die Scheibe ist zum Behuf allmählichen Eintreibens — fĭ̦r naahiz’scheiben — keilartig zugespitzt: fï̦rspitzi, oder technisch gesprochen: scheibzï̦̆gi g. Wenn dieses Füllbrett hartnäckig si ch b’steckd, so hat es seinen Dienst geleistet: 467 der Bŏde n b’schịịbd gued, är ist gued g’scheibe̥ta. So «beschäubt» man auch einen andern Gegenstand, der eines Verschlusses irgendwelcher Art bedarf; und wer seinen Posten behaupten, gleichsam dessen Blößen decken will, muß achten, was er b’scheibi oder b’schịịbi. B’schŏben wird buchstäblich auch z. B. die Flasche mit dem Papịịr- old Pantoffel-Schĭ̦bel, der Brunnentrog mit dem Trogschĭ̦bel.
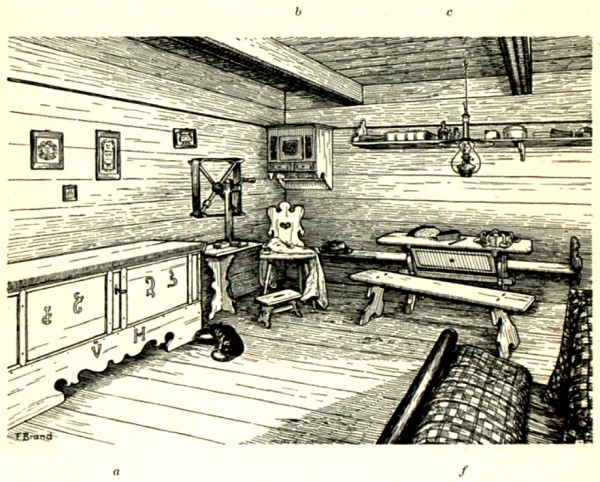
Bauernstube zur Veranschaulichung
a des G’wandchasten; b des Wandschäftli; c des Bieherbaich; d des Chriiztiisch (mit gekreuzten Beinen); e des lenge Stiehlli; f wie mu g’fiirstet betted. (Der Anzug der Bettdecke aus Cheltsch.)
Von Zimmerteilen, welche niet- und năgelfest mit dem Hause verbunden sind — z. B. der Pfẹisterstuehl, der mit dem Wandstuehl an einer fensterlosen Nachbarseite im Egge n zuehi fix verbunden ist, sowie an beiden Enden samt ihm durch Esla (Esel) gestützt wird — ist im Bauernhause der Hụụsraad oder das Mŏbe̥liár schwer zu trennen. Selbst ein hier allfällig nötiges zï̦glen (vgl. dagegen S. 308) würde übrigens sehr vereinfacht durch den gut altschweizerischen 33 Verzicht auf allerlei Ru̦stug u nd Plunder (Krimskrams), der doch bald wegen Nichtgebrauchs 468
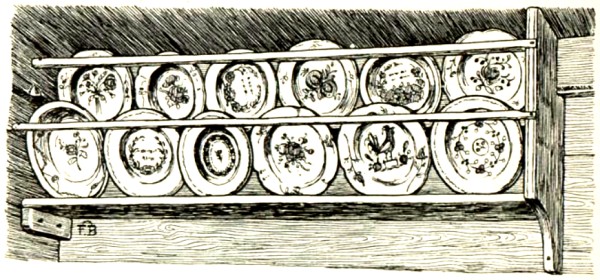
Blatteschaft.
(Geschirrbank in der Wohnstube.)
von Guege n zerbohrd (vom Wurmfraß befallen), oder verwu̦rgged (zerknüllt, zerknittert) oder zerfächchlled (ausgetrocknet und zerfallen), oder erbrŏded (vermodert) aussähe. Nicht wenige antiquarisch wertvolle Stücke sind in letzter Zeit ins historische Museum Berns gewandert und stellen allerdings dort mehr vor als im schlichten Bauernhause. Eine kunstvolle Schăbä́lla bildet kein Assortiment zum schmucklosen lẹnge n Stuehl, dem bestimmungsgemäß der Lä̆nen (die Lehne) fehlt, zum Stïehlli oder Schä̆me̥lli, zum Tä̆gel-, Bïeher-, Ofenbẹichli an je einer Wand, zum Plampi (hängenden Kinderstühlchen) mit beweglichen Chrŭ̦glen als Spielzeug. Einen Chrị̈ị̈ztịịsch ferner, dessen kunstvoll geschnitzte, sich kreuzende Beine gnappen (wackeln), müßte man eigentlich, aus der spaßhaften Vorschrift Ernst machend, mid ’nem Fị̈ị̈ffränkler underlĕgen. Das würde ja übrigens zu dem kostbaren festtäglichen Tischlachchen und zu dem reichen Inhalt stimmen, welchen der Tischchasten birgt. In der Regel freilich sind besonders Tisch und Bett sehr einfach. Der Madrátzen ersetzt erst jetzt allmählich den viel wärmern Strouw- und darüber gebreiteten Sprï̦wwersack, auf welchem noch heute die echten alten, auch reichen Grindelwaldner schlafen. Daß sie’s ó ch hätten, beweisen sie mit dem alljährlichen, ja oft halbjährlichen anders ịị nstoßen, wozu nur das beste, tüchtig durchsonnte Stroh auserlesen wird. Der Sprïwersack aber muß leider auch hier häufig dem so ungesunden Fäder-Underbett weichen, dessen Füllung zweiter Güte gelegentlich vor Prallheit nä̆ben ụụsa stotzed. Auf das beidseitig ahigsteckt oder ahigschoppet Lị̆ nlachche n folgt das Hoi pte nchï̦ssi. Der Anzug desselben, die Hoi ptchï̦̆ßzieha, kehrte bei der alten Art zu betten die schönfarbig gestreifte Seite: die ’zeichnet Siita tagsüber nach oben; vor 469 Bettgang aber hed mu̦ d’s Chï̦ssi g’chehrd, um die Muster eigener Webekunst tunlichst zu schonen. Als dann die zịịßleten (gestreiften) oder gar weißen, sowie die ’bill deten, d. h. mit reliefartig erhöhter ( ụ̆ụ̆fg’woorffner) Zeichnug geschmückten Tappe̥ni (das Tapp̦̆i: le tapis 34 ) aufkamen, hatten freilich die Ausübung und Schaustellung häuslicher Kunst keinen Sinn mehr. Unter der Techchi (Fädertechchi) breitet man für ältere Personen eine Wulltechchi und für Gliedersüchtige wohl dazu ein Schafhärden ( S. 95).
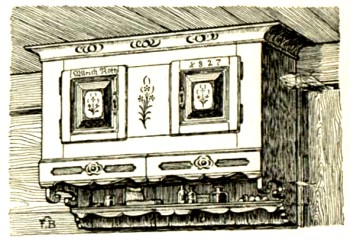
Bemaltes Wandschäftli.
Ein ebenso geschätzter Bettwärmer ist aber etwa ein gehätscheltes Enkelkind, zu welchem es nach dem Abendessen heißt: gang a nfḁn nĭ̦der und tue mer de n Tu̦pf wärmen! Dieser «Tu̦pf» ist die eingedrückte Stelle mitten im Bett, welche nachher, ohne das schlafende Kind z’b’u̦ nrïewwen, der oder die wärmebebürftige Alte in Beschlag nimmt. Das gesamte Bett samt Gestell heißt noch heute gelegentlich Gụụtschi. Das echte alte Gŭ̦tschi aber war ein an die Wand gebautes — a ng’năglets — Gestell ohne Anstrich noch sonstige Zier. Was es dagegen auszeichnete, waren so hohe Beine, daß auch der Großgewachsene, wenn er zu Bette wollte, entweder als ganz respektabler Turner e n Ggu̦mp nään oder aber einen Kasten als Vorstufe heranrücken mußte. So bis um 1850, in Vorsaßen teilweise noch heute. 34a Das so hohe Bett bot tagsüber Raum für das auf Rädchen untergeschobene Understoosgụụtschi (das Gu̦tschibett der Walliser, das Gụtschli der Lauener) für größere Kinder. Zu kurzer Tagesruhe der Erwachsenen dient das Rue wgụ̆tschi oder Rue wbett ohne Lehne, allmählich jedoch ersetzt durch das (immer noch einfache) Kănăbee der Grindelwaldner, das «Kanabett» der Lötschentaler. Belangreicher ist der Tausch des Bettkorbes für Säuglinge an die alte Wăga (Wiege), das Wăgi oder das Wăge̥lli, worin das arme junge Hirn 35 zum Schlaf gezwungen wurde. Erst 470 dann, meinte man, tiej’s dem Chind im Hoi ptli weh, we nn mŭ̦ die läär Wăga wĕgi.
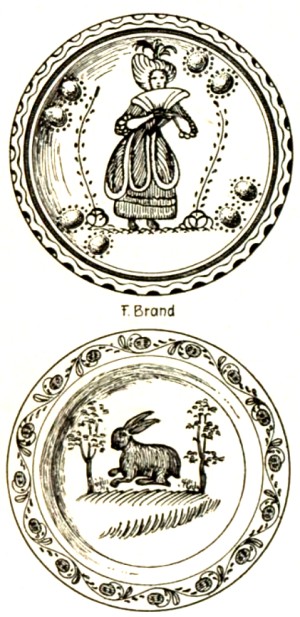
Blättleni.
Irdene Platten mit bunter Bemalung; die obere aus Heimberg (um 1800), die untere aus dem Simmental (Ende 18. Jahrhundert).
Der bereits als Vorstufe zum Gụtschi erwähnte «Trog» 36 oder vielmehr Chăsten (vgl. die Örtlichkeit bim Chaste nstein 37 und die Kastensteinhöhle am Schreckhorn), sowie das Chaste̥lli repräsentieren die anspruchloseste Nützlichkeit. Gleicherweise tun dies der gewöhnlihe Schaft (Keiderschrank), der Chuchchischaft und das kleine Chlä̆bschäftli an der Küchenwand. Ein kleines, oft recht zierliches Chlä̆b- oder Wandschäftli, fest an die Wand genagelt, fehlte früher keiner Bauernstube. Es barg d’s Gäld u nd d’Gschrifti, und das Schlï̦sseli dazu trug meistens d’r Att am Gäldseckel angebunden im Hŏse nsack. Sehr viele dieser Wandschäftle̥ni haben nun dem Bị̈ị̈roo, also der Mode weichen müssen. Größere Sorgfalt verwendet man an den Blatte nschaft oder doch das Blatte nschäftli zum Aufstellen der Paradeteller. Heute ein Ganzes für sich darstellend, bildete der Blatte nschaft sonst auch etwa das Mittelstück eines kunstreich geschnitzten und bemalten Bŭ̦ffet, welches dem «Buffe̥rt» des Emmentals 38 entsprach. Ein solches Buffet ziert nunmehr das historische Museum in Bern. Noch heute vereinigen sich Gŏmŏda, Bị̈ị̈roo und Glasschäftli übereinander zum Bị̈ị̈roo (Bureau) im weitern Sinne. Zu seiner Rechten oder Linken hängt wohl die Schwarzwälderuhr oder irgend ein anderes Zịịt (das «Zịịtgreis» des Wallis), trotz seinem Alter immer noch wertvoller, als eine schlechte Taschenuhr: eine Chä̆fermï̦̆li. Platz findet an heller Wand der Spiegel, dessen Verwandtschaft mit speculari u. a. auch im spieglen und spienzlen (anlockend halb versteckt sehen lassen) 471 sich reflektiert.

Bluemti Butälle,
Chindbettifläscha
(22 cm hoch).
Das rotviolette, platte Dorfgutterli ist Iseltwalder-Gebläse a. d. 18. Jhd.; die bunte bemalte weiße Flasche gehört der Mitte des 19. Jahrhunderts an.

D’s Dorfgutterli
oder d’
Dorfgutterra
(10 cm hoch).
Gegenstand eines solchen «spienzlen» ist zumal die daneben hängende Gụggisbärg-Pfịịffa (Weggen- oder «Chamme npfịịffa»), 39 womit auch der Grindelwaldner e n junga Stolz und en alti G’wăhnheit übt. Aus den fünfräppigen irdenen oder häärdige n Pfịịfen dagegen, als den profiitlichisten, hat man nach beliebtem Rätsel z’erstist ’zŏgen, was ’s eine n g’chosted hed. Ein geschnitzter Schuehlëffel, das Strähltäschli (s̆s̆) und Bï̦rste ntäschli gemahnen an Toilette, aber auch an deren Störung durch bï̦rstig Bonzen (händelsüchtige Kerle), wa enanderen erbï̦rsten.
Ein Blick in die Küche erinnert zunächst an die Bebürfnisse der Ässen (des Mundes). Da paradieren die Suppe nschï̦̆ßla mit ebenflächiger und der Suppe nchopf, der Chopf, das Chopfli mit bauchiger Wand. 40 Wie diese, können auch die Chachtla (Kachel) und das Chachte̥lli (Tasse) samt dem Ggaffẹblättli (Untertasse) und dem Suppenblättli 472 (irdenen Teller) Gegenstand einer kleinen Kunstausstellung werden. Das danken sie beispielsweise den Reißen, womit sie g’reißed sind. Der Reiß ist ein Ring kunstreich gruppierter gemalter Linien oder Tupfen, langer, schmaler Streifen, z. B. auch als Anzeiger des gewesenen Höhenstandes einer abfärbenden Flüssigkeit: äs blịịbd e n Rreiß z’rugg. In Reißen heißen übereinander gelagerte schmale Bänder an der Winteregg. Ebenso vgl. z. B.: e n roota Hăfen u nd wịịß Reißa drum.

Krug aus Steingut mit plastischer Ornamentik.
24 cm hoch. Deutsche Herkunft: 17. Jhd.
Alle diese Geräte sind, gleich dem Ggaffẹchrueg («Chrụụsi») von gewöhnlichem Ton. Zu Porzellan versteigt sich auch der Reiche nicht; nur wo vornehmelndes Gehaben eingerissen ist, da geid alls purze̥lịịnig zue und har. Fast lediglich zur Parade dienen das zĭ̦n nig Täller und die zĭ̦nig Ggaffẹtie̥ra; im Alltagsgebrauch wird Zinn durch Eisenblech ersetzt, oder aber durch Holz, wie beim Salz-, Wasser-, Milchnapf. Gefässe zum Übergießen haben einen Ausflußschnabel: den Zoiggen, dessen Abgang an mu̦tten Geräten gleich dem Fehlen der Handhä̆bi den häßlichen Eindruck der Verwahrlosung erweckt. Die ehemals (noch um 1760) in Iseltwald bestehende Glashütte brachte auch nach Grindelwald manches Stück, das nunmehr als sehenswerte Antiquität neben die gewöhnliche Pŭ̦tä́lla ( bouteille) sich stellt. Wir bemerken die Flágoona (Weinflasche), das Ggŭ̦tterli und insbesondere das S. 471 aufgeführte Dorfgŭ̦tterli, die Wẹnte̥lla und das Wẹnte̥lli (s. v. w. plattgedrücktes Busenfläschchen) den jetzt noch zum darmässen von Saatzwiebeln gebrauchten Schoppe nmịjel. Flüchtig wie die Glasgeräte berühren wir hier Pfanni, Chelli und Hä̆fen aus Eisen — ịịsnig —, aus Erz — äärig — oder Bronze (woraus der Bru̦ns als der Siedetopf des Lötschentals besteht). Früher sagte man auch hier: ịịsin, holzin, äärin: en ịịsina Ring, en äärina Hăfen, es holzi ns Hefti. Rasch erwähnt seien auch Chrụụdmässer, Chrụụdbri̦tt und Gnịịpli zur Bearbeitung von Spinat und Mangold, der Härdepfelstungger oder -stämpfel; die Rëësti- oder Härdepfelhächchla und Raafhächchla zum schịịblen der Siedekartoffeln, der Weißrüben; der Härdepfel- 473 Chääs-, Zuckerrĭ̦ber; die Härdepfelmï̦̆li 41 und der ähnlich gebaute Chirsmuesstuehl (s. Abbildung S. 504). Ebenso flüchtig seien hergezählt: das Theerichterli ( la passoire); der Lëffel und die Găbla oder (in Itramen) der Gä̆bel, beide früher auch hier in der Riigle n 42 verwahrt; das Mässer in seinen Wertabstufungen von dem mit Schildchrott oder Schildplatt besetzten Zierstück herunter zum Schnitzer mit scharfer Lä̆me̥llen ( la lame, Klinge) bis zum allzeit verderpden fünfräppigen Rolli, Rollihĕgel, Rollipaggel.

Raucherphilosophie.
Als Gegenstück zu den Haussprüchen versparten wir bis ans Ende des «Innern» die kurze Erwähnung des Zimmerschmucks. Welch ein Gegensatz auch hier zwischen heute und ehedem! Da unterbrach nichts Kahlheit der schwarzen Stubenwände, als einmal die hinter Glas und Rahmen verwahrte Zahlungsaufforderung, die ein behäbiger Bauer irrtümlicherweise zugestellt erhalten hatte. Porte̥ree und Maale̥ni (Gemälde) an der Wand, Maalibïechle̥ni und Nippsachen auf dem Tisch, Nï̦̆wjahrswï̦nsch und andere kaligraphische Künste wie z. B. die Initialen unseres Buches reden von altem natürlichen Kunstgeschmack, der eben jetzt von mancher Seite her durch billige Darreichung guter, ja feiner Bilder in verständige Schulung genommen wird. Denken wir nur an den ungemeinen künstlerischen Aufschwung der Kalender, die den alten Spott: är ist e n lleida, är gääb es Brattŭ̦gmaali, immer mehr Lügen strafen; an die Bestrebungen der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft: 43 an die Bernerkirche mit ihrem «Säemann» und dessen schönen Prämienbildern.
1
Vgl.
Odenwald 158.
2
Gute Beispielsammlung:
GlM. 103.
3
Vgl.
Lf. 205.
4
Im Unterland: warte sii; vgl. nhd. liegen haben und liegen bleiben und überhaupt den Übergang des Partizips der Gegenwart zum Infintiv.
5
Nützt.
6
Hier Kinder; vgl.
S. 346.
7
Vgl. Gerocks: «Es reut mich nicht».
8
Pas de quoi! Don’t mention it! Niente! usw.
9
Gelegenheitswort, gebildet aus kei(n)s = kein Mal, vgl. ei(n)s = ein Mal.
10
Mhd. WB. 1, 1048;
Kluge 227.
11
Bei Spleiß (des
Amos Comenius Sprachen-Tür, 1667) 75 ein «Vorhaus».
12
Beitrag zu Note 26,
S. 294.
13
Ergänze: Chiechleni.
14
Lusern 46 f.
15
Habsb. Pf. 351.
16
Meringer 8-10.
17
Zu
Gauchat (im «Archiv»
S. 351).
18
Berd. 3, 49.
19
Rothenb. 20.
20
Vgl.
Lf. 203.
21
H 2.
22
Mit dieser analogischen Faktitivbildung aus «empfangen» vgl. «eini fehren» aus «fahren»:
Lf. (278) 636.
23
Vgl. das zu «wohl» Bemerke
S. 400.
24
Str. GlM. 40.
25
Der Flamm:
Rebm. 13.
26
Ök. fol. 29 F 13.
27
Lf. 305.
28
Lf. 227-229.
29
Wand wird seit Mehringers Festgabe für Richard Heinzel (Halle, 1898) nicht mehr davon hergeleitet, daß man an ihr «wenden» (erwinden) müsse, sondern vom korbgeflechtartig «gewundenen» Holzgerüst mit Lehmfüllung, wie die balkanische Bauart sie noch heute zeigt.
30
Man bemerke den feinen Unterschied zwischen der Zusammensetzung mit
s als Bindelaut (vom Genitiv der Maskulina analogisch auf die Feminina übertragen) und derjenigen ohne solches
s. Jene ist primär, diese sekundär. Man sagt genuin mundartlich Garte
shaag, aber im Lehnwort Garte(n)zuun; man sagt Stube
sboden wie Hitte
stiir zur wesentlichen Unterscheidung von jedem andern Boden, jeder andern Türe; aber man sagt höchstens verdeutlichend (und hier auch pleonastisch) Stube(n)soller (vgl.
solarium Platz zum Sonnen), weil eigentlich bloß der «ober Soller» einer ausdrücklichen Heraushebung bedarf. Von hier aus rechtfertigen sich auch so gute alte Bildungen wie Gerechtigkeit
sgasse, wie
G’meind
sbresidänt und Gemeind
spräsident gegenüber banal-pedantischen Neuerungen wie «Gemeind
epräsident», «Gemeind
eschreiber», «Halt
estelle» (in Zürich), vor deren Klang ein Jakob Grimm sich die Ohren zuhalten würde.
31
Lf. 198.
32
Lf. 198. 603.
33
Bern V. 525 f.
34
Die Endung des Lehnworts als Deminutivsilbe aufgefaßt.
34a
Ebenso im Lötschentaler Wohnhaus.
35
Vgl. dagegen
Odenwald 169.
36
Lf. 313.
37
B 2.
38
Lf. 315.
39
Lf. 469.
40
Die
cuppa, coupe verbleibt im Oberland auch als «Kopf» im Bedeutungskreis des Gefässes, ohne auf die Hirn-«Schale» und danach auf den Kopf (das «Hoipt» des Oberlandes) sich überzutragen.
41
Vgl.
Lf. 507.
42
Lf. 515.
43
Vgl. «Bund» 1904, 12; Echo vom Emmental und
EvG. in verschiedenen Artikeln.
Des Mannes Haus ist die Welt, die Welt der Frau ist das Haus. Auch den Mann weisen indes Wintertage, die nicht an Arbeit im Walde gewendet werden können, an häusliche Beschäftigung. Und deren gibt es im Oberland, wo nach alter Tradition jeder sein eigener Handwerker sein muß, genug. Schon der fleißig beanspruchte Zĭ̦gstuehl beweist es. Auch Zĭ̦gmä̆sser und Saaga, die zweihändige Ax und das einhändige Schnätzbielti sind für Bearbeitung von lindem wie zääjjem Holz allzeit zur Hand. Besonders die Alp-, Wasch- und Traggeräte werden meistenteils sälber g’macht. Irgendwo wird sicher in diesem Augendblick an ’em nï̦wwe n Mälchstuehl g’schnätzed. Nebenan muß ein Handbräntlitechchel seines Dienstes entlassen und für die erste Not durch ein gitterartiges Chrị̈ị̈z aus kleinen Spălinen oder Hëlzlinen ersetzt werden, damit nicht beim Tragen die wallende Flüssigkeit ụụsaggoitschi oder e̥s sḁ ụụsschlääj. Dies andere Gefäß ist nicht mehr bhääbs, sondern ist durchlässig geworden, ist zerlächchneds; mu̦ mues ’s g’schwellen oder z’g’schwalle n tuen (im Hasli: z’b’hăbe n tuen). Jetzt sind die zum mehrfachen Binden um den Tụtel gelegten tannenen Schlëßlireiiffa mit den Schlë̆ßlĭ̦nen: den so elegant gefertigten Bindestellen, locker. Oder der untere, vorspringende Teil der Umfassung: der Frëësch (Frosch) muß wegen Fäulnis ab’zŏge n (weggeschnitten) werden. Die Mälchtra da hed en u nmmu̦glichi Handdu̦wwa (die Handdaube mit der Öffnung zum Anfassen ist lästig unbequem) 1 , und auch die andern Tu̦wwi ( douves) sind altersschwach. Nur die Gepsi, welche auf den Gepse nlatten der Chuchchistĭ̦bliswand entlang stolze Parade machen, sịn no ch gued im G’reiß.
So kommt der Mann auch zu Hause nie vor d’Arbeit ụụsi. Und an allem, was er in die Hand nimmt, bestätigt sich das alte Urteil: der Oberländer weis s mu̦ en Art und eṇ Gattug z’gään. Er weiß es auf gefällige und praktische Art anzustellen. Drum hat er ja auch die Holzschnitzerei als Hausarbeit aus den bescheidenen Anfängen eines Geisbueben ( S. 328) zu der gegenwärtigen Blüte gebracht, und Grindelwald reiht sich den Schnitzlerorten Brienz, Meiringen, Interlaken, Lauterbrunnen nicht umwürdig an. 2 Schade nur, daß der herrliche Marmor 3 über dem untern Gletscher eine gewerbsmäßige Ausbeute nicht lohnt.
475 Besonders freilich ist im Winter das Haus die Welt der Frau und Tochter. Es klingt wie ein Märchen aus alten Zeiten und ist dafür eine um so interessantere Tatsache, daß noch im Jahr 1907 im reichern wie im ärmern Grindelwaldner-Bauernhause eine hiezu angelernte Tochter für sämtliche Familienglieder das Alltags- und selbst das gewöhnlichere Sonntagsgewand verfertigt, indes eine zweite Tochter für den Hausbedarf spinnt, eine dritte strickt und flickt, die vierte den Haushalt besorgt. Alle Attributte der Weiblichkeit: Nadel und Spindel und Kochlöffel finden also hier noch ihre Vertretung. Besonders gilt dies vom zweiten und im Mittelalter einzig genannten Symbol, mit welchem sogar die Weltgeschichte beginnen durfte. 4
Wir können also den Gï̦rben noch in seiner vollen Tätigkeit betrachten, was wir freilich unter Verweisung auf « Lützelflüh» 5 hier in aller Kürze tun. Wie im Emmental, konnte man früher auch in Grindelwald gelegentlich e̥s Manne nvolch, wohl gar ein hochgewachsenes: e n lẹnga Gï̦rben, spinnen sehen. Ja diese Mannsperson lebte vielleicht in ganz glücklichen Umständen, war gued u̦f de n Seitnen. Man muß nämlich wissen, daß der Seiten (die Saite), welcher am Gï̦rbe nraad doppelt umläuft, in der Regel bloß aus Ịịse nfăden statt aus Schafdarm besteht umd deshalb durch häufiges Reißen viel Unannehmlichkeiten bringt. Durch die Trätta und den Trätte nchnächt in Bewegung gesetzt, bringt die Saite den Wirten und die von ihm im Aa ntraagi («Anträ̆gli») eingeschlossene Spi̦nndla (den «Spuelen») in vervielfachte Umdrehung. Hŭ̦be̥lli um Hŭ̦be̥lli gesponnenen Garns füllen die Spindel, welche alsdann das Abrachchli (ä́br-) heißt. Zwei Abrachchle̥ni ergeben auf dem Haspel, welcher nur selten ein Zellhaspel mit Umgangzeller ist, einen Strangen. (Das Verhältnis zwischen Zettel und Einschlag wird durch Wägung festgestellt.) Den Strangen verschnürt oder vermachd, underhäspled man mittelst der Underhä́spleten. Dies geschieht mittelst des Faden-Endes: des Trooms oder Trë̆mlis. Wer im Unrecht ist, ist am lätze n Troom, und wer nie zu seinem Vorteil gelangt, chunnd niemals a n d’s Troom.
Fehlgriffe im Spinnen sind noch strenger verpönt als im Emmental. Wer hindr’ de n Fingren aa nsetzd, dem soll man das verfehlte Garn um die Finger wickeln und in Brand stecken. Ebenso scharf wird bedroht, wer de n Traadel dị̈r ch d’Chụụchla uehi laad, wer ein Pu̦lggi 476 («Chnü̦lz»: schlecht gedrehte grobe Strecke) oder gegenteils einen Chräämmer (eine zu dünn geratene, daher abreißende und durch neues Einspinnen mangelhaft verbesserte Strecke) ins Garn bekommt.
Die fleißige Spinnerin und auch jede sonst immerfort beschäftigte Person hat nach kurzen Zwischenpausen je und je wieder frisch a ng’chụụchleds, und die Arbeit geht nicht so bald aus: mu̦ hed gẹng g’nueg a ng’chụụchleds. Man muß darum auch gelegentlich eine getroffene Verabredung widerrufen lassen: mu̦ heig jetz no ch su̦st eppḁs a ng’chụụchleds, oder: scho n vĭ̦l z’vi̦i̦l a ng’chụ̆ụ̆chled’s, e̥s sịg ei’m newwa n grăd nịd gä̆bigs. Und ist gerade kein Gespinst zur Hand, so dient der Chụụchle nstuehl rasch als Träger der waagrecht laufenden Gare nwinden. Oder das Spinnrad dient zum zwirnen von Nähfaden oder Strickgarn, wobei der Hä̆ber, Spindlenhä̆ber die erforderliche Anzahl Spulen aufgesteckt erhält. Gewöhnlich aber ist für den größeren Teil des Winters buchstäblich und bildlich g’nueg Rịịsti a n der Chụụchlen.
Die Rịịsti 6 besteht aus den schön geordneten langen Gespinstfasern, welche in der Hand des Hechlers zurückbleiben, nachdem die verwirrten Fasern vorab weggestreift und als Chụ̆ụ̆der in verschiedenen Abstufungen zu eigenen Büscheln geformt worden. Wird nämlich zunächst ein Bündel gebrochenen Flachses an der Blütenseite oder am Tolden ergriffen und durch die Hechel gezogen, so bleibt in dieser der Tolde nchụ̆ụ̆der stecken und wird abgehoben, um zu grober Seilerware ( Hewseil, Ggŭ̦ntelseil u. dgl.) verarbeitet zu werden. Wird jetzt der nämliche Büschel Flax nochmals doppelseitig, also am Dolden und am Storden durchgezogen, so erhält man deṇ guete n Chụder, aus dessen Gewebe, dem Chụ̆ụ̆dertuech, der starke Chụderschlŭ̦fi ( S. 484) und die Uberhŏsi des Hirters für die winterliche Männerarbeit geschneidert werden. Die alsdann in der Hand des Hechlers zurückbleibende Flaxrịịsti gibt das lịịnig oder fläxig Tuech, als das für den bäuerlichen Gebrauch feinste. Die Reaktion gegen eine Unbill lautet daher grindelwaldnisch: das ist deṇṇ grŏbs fï̦r lịịnigs! Das zääjst Tuch dagegen ist das im engern (und unterländisch ausschließlichen) Sinn so geheißene rịịstiga aus der Hajfrịịsti. Das ist u nzerhịjli chß! Was aus dieser Hajfrịịsti als verrworren ausgesondert wird, gibt das sehr grobe, aber bei Gliedersucht geschätzte hẹiffig Tuech (die «g’chnopfeti Waar» des Lötschental). Die in der Hanfhechel 477 zurückbleibende U nspunni liefert, gleich dem Dolde nchụụder, Seilerware.
Bezieht sich also grindelwaldnisches «Rịịsti» auf beiderlei Gespinst, so war dies in alter Zeit 7 ebenso beim Ausdruck Wäärch der Fall. Heute ist Wäärch auch dem Grindelwaldner bloß noch Hanf, und er unterscheidet am stehenden Gespinst d’s grooß und d’s chlịịn old d’s under Wäärch; jenes hohe wird zuerst obenab ausgerauft, dieses niedrige folgt als «Stü̦mplete n» nach. Beide Gespinste liefern eben das Material zum «wirken» des Kleides, zum «Werk» im engsten Sinne. 8 Flax ist speziell das zu flechtende, 9 während «Hanf», Hawf oder Hajf, aus « cánna-bis», die «Hanf-Nessel» 10 bedeutet. Die letztere wird damit der Brennnessel — Nĕßla — gegenübergestellt, deren äußerst feines und starkes Gewebe 11 man einst auch auf der Alp zu schätzen wußte. Hießen doch die Chäästïeher der alten Sennen Nesseltïeher und wahrte man sich deren Vorzüge sorgsam damit, daß man sie nach dem gewöhnlichen Auswaschen in heißer Schotte in kaltem Wasser durchspülte. Dadurch wurde ihr z’sä̆me nstäppen verhütet. Unter Beiseitelassung der Nessel wird aber bis zur Gegenwart bloß noch g’hajffed und g’flaxed oder Flax g’machd. An alten Hanfbau erinnern sogar Flur und Ortsnamen wie der alt Hajf hinter Itramen, die Hajfmatta, der Ort am Hanfgarten oder «zem Henffeler» in Gündlischwand (1335) 12 und «in der Hanferren» zu Äschi (1309). 13 Auch der «Hargarten» wie z. B. zu Gümligen und (1305) zu Mörswil 14 fehlt als älterer Ausdruck für Flaxne̥rra nicht. Diese dagegen ist nur in Gweren-Entis Weltreise 15 «dokumentiert»; da erscheint nämlich der Thunersee als «eṇ großi, mächtigi Flaxnerra» 16 (vgl. S. 265). Die Gefährdung freilich, welche der u nzịịtig Schnee beiden Gespinsten bringt, und die ertötende Konkurenz der so vielfach, vorteilhaften Baumwolle lassen ihren Anbau derart zurückgehen, daß selbst die Hajfsaat (die Hoifse̥t der Burglauener und die «Hawßet» des Unterlandes) ganz, der Flaxsaammen (die «Lise̥t» des Obenwallis) größtenteils zuehag’choifd werden muß, um der Pflege von Vieh 17 zu dienen. Die 478 ehemals ausgedehnten Flaxspreiteni zum reezen oder rooßen 18 sind ebenso am Verschwinden, wie vorlängst die Blewwen (vgl. die Blewwa in der Nähe des Mettenbergfußes, die «weyd bei der Bläüwen» 1744), 19 die «matten zer Blöiwon» bei Därligen 1360, 20 verewigt im Geschlechtsnamen Blewwer, Bleuer, «Blöwer» 1355. 21 Auf diesen Bleewen hatte man den zertingle̥te n Flax, der seine Dingla vom Bast zu sondern anfing, mit Blu̦wwlen (Knüppeln) bearbeitet, wie man auch einen Menschen «bläut» oder flaxed. Dann verrichtete die Rịịbi, vielleicht früher auch ein Gebäude im Rịịbigäßli seinen Dienst. Später wurde zur Ersetzung des Bläuens das bekannte rä̆tschen a ng’reised. Das G’rätsch, die Rätscha, das rätschen, wovor der Schweigsame sich hütet, «feiert» auch hier seine bekannte Bildlichkeit, und ebenso bildlich kann ein zugrunde Gerichteter under d’Rätscha g’hịjen. Das buchstäblich unter diese gefallene Gespinst, der Rätischhund, wird zum Abschluß der «Brächcheten» 22 aus den Dinglen herausgelesen und als Seilerware no ch g’rätschhunded.
Zum Glück für die heimische Gewandindustrie läßt sich trotz ebenfalls enormem Rückgang die Schafzucht nicht so gründlich wie die Gespinstkultur aus der Alpwirtschaft ausschalten. Noch vor Flachs und Hanf fügt sich daher die Wolla in die winterliche Tagesordnung ein. Und lieber, als das selbstproduzierte neue Wollzeug mit Ru̦pf («Hudelrupf») zu vermehren, wird man von Uri (Wassen) wịịßi Wolla lă n choon. Den Zettel für alle im Haus gefertigten Gewebe liefert die Bou mwolla (Baumwolle), obschon diese hier oben niemals Gegenstand einer Industrie werden könnte. Die einzige Manipulation, die man am rohen bou mwolligen Zettelgarn etwa vornimmt, ist das rëëtlen. Man färbt es mittelst einer Lauge aus Erlenrinde, deren Braun man mittelst Zusatzes von Brasilie nspäänen oder Sịịde nspäänen (Fernambuk) dem Rot nähert, 23 oder sogar nur mittelst Rëëtel (Rötel: derbem Roteisenstein). Man ersetzt sich durch solche Rŏst-Färbung einigermaßen die teure Tï̦rrggengăren-Färbung, welche in frühern Jahrhunderten ein einheimischer Färwer ausübte. Etwas luxuriöser schickte man die selbstgewobenen Stoffe in die Buntdruckerei: mu̦ hed’s la n trï̦cken (wie man auch in der Buchdruckerei trïckt). Im bescheidenem Maßstab verarbeitete man vor Jahren mittelst Handweberei durch einen Zürcher Sịịdenheer importiertes Sịịdengare̥n. Grindelwald zählte noch 1895 dreißig (Lauterbrunnen 63) Seidenwebstühle 24 und verkehrte 479 dieserhalb mit der Ferggerịị, dem Fergger in Wilderswil; mu̦ hed g’f’ergged. Da aber solche Handweberei nur als Unterbietung gegen die ostschweizerische Maschinenindustrie bestehen konnte, mußte sie mit unglaublichen Hungerlöhnen 25 und obendrein nicht ohne Gefährdung der Solidität 26 arbeiten. Sie konnte sich daher noch viel weniger auf die Dauer halten als die doch so gediegene einheimische Fabrikation des Frutigtuches oder Oberländertuches. 27
Um so schätzenswerter ist die im Haus für den eigenen und nachbarlichen Bedarf betriebene Weberei und Verarbeitung des Halblịịn aus baumwollenem oder noch besser: rịịstigem Zettel und wollenem Einschlag ( Ịị ntraag). 28 Wie herzgewinnend der Anblick eines hablichen Bauernpaars und seiner stattlichen Söhne und Töchter, welche Tag für Tag allesamt i n wwä̆hrschaftem Halblịịn dahar chë̆men, der gewöhnliche Sonntagsstaat der Töchter nur mit einigem Besatz von Seiden- und Sammetbändern, der der Söhne durch das blendend weiße Hemd ausgezeichnet! Nur am Nichtbauer übersieht man hier das Tragen des ganz wollenen Guettuechs. Wer dagegen als Standesgenosse in Pomp und Pracht leben wollte, von dem würde es in kurzem heißen: där chunnd im Guettuech dahar! (Vgl. pu̦rze̥lịịnig, S. 472).
Wie über den Halblein, weiß man in Grindelwald auch noch über den Schï̦rlitz Bescheid. Es ist, wie im alten Emmental, 29 aus Rịịsti gefertigtes Tuch, aber in Grindelwald speziell für Bettg’wand bestimmt. Er wird in der Weise vierträttig (vierschäftig) gewoben, daß sie die farbigen Einschlagsstreifen — Zeihen oder Zịịßi — alle vier Trätti und Geschirrflügel einzeln, für die glatten Zwischenstrecken deren je zwei miteinander auf- und abgehen. Das Tuch wird demgemäß dickbë̆digs oder dicks.
Die Hausfrau begibt sich also zu der nicht weit entfernten Wï̦̆bri (Weberin; Wä̆ber sind ungefähr so selten wie Spinner es waren). Es ist eine noch junge Person, deren Mutter und deren beide Groosi (Großmütter; Einzahl: die Groosa der Großvater ist der Groosi, Mehrzahl: Groosiga) and schon Wï̦̆bre̥ni gewesen sind. Die haben wahrlich — das sell mu̦ wissen! — meṇ’gs Wŭ̦bb gwä̆ben! (Früher sagte man auch hier g’wŏben, kehrte aber zu der normalen Biegung zurück.) 30 Auch unsere junge Weberin wu̦bi oder wu̦b ( tisserait) 31 soger zur 480 Sommerszeit, wenn da nicht die reiche Feldarbeit ein wä̆ben im ältern weitern Sinn erforderte. Altes weben ist nämlich svw. die Glieder bewegen, mit ihnen «hin und her fahren»; mu̦ wi̦bd z. B. auch noch beim Schwimmen. (Vgl. die Formel «leben und weben» 32 .)
Die Hausfrau frägt etwa: «Welltid ie̥r (oder bei Bekanntschaft von Jugend auf: welltist du̦) so gued sịịn und ịịs (uns) eppa fï̦r zä̆che n Spreite̥ni Schï̦rlitz wä̆ben!» (Die Spreiti besteht aus einem Deckbett und einem Kissenanzug.) Antwort: Ja, wen n i ch gsund blịịben u nd ’s eppa nịịd anders gi bd, denn gi bd das e̥s schon eppa. — «Nu̦ n gued! Was gloibid e̥r jetz, wi vi̦i̦l Zettel mïeße n mer denn eppa da haan?» — (Die Weberin rechnet vor, wie viel, und fährt weiter:) Sol l i ch breiti Zeihe n mmachen? Old sol l i ch schmal zeichnen u nd de nn d’Zeihen nẹẹher z’sä̆me n mmachen? Ie̥r wißd ja, sŭ̦mi 33 hein de nn llieber schmali Zeihen usw.
Eine andere und bekanntere Art Bettzeug ist das «kölnische Tuch»: der Chëltsch. Als vornehmster gilt der blaustreifige. Der rotstreifige ist teurer, weil in der Farbe haltbarer, aber gröber und wurde deshalb ehemals in Häusern, wo man auf Selbstunterscheidung von den harchoon’ne n Lịịten hielt, als Bättelwësch (s̆s̆) mißachtet: er bätte̥lled (gemahnt an Bettel). Sehr zierlich nimmt sich der ei ntraagig oder traagig Chëltsch aus, d. h. Kölnergewebe mit Farbstreifen von der Breite eines Fadenbüschels am Zettelbaum: einer Traagen. 34 Eine andere Zeichnug erhält g’gä̆ßleds Tuech (z. B. für Tischlachchen) durch gleichfarbige, aber gröbere Einschlagfäden. — Wie der Schï̦̆rlitz vierschäftig, war ehedem das ganzwollene Frauenrocktuch gleich dem braven Haslituech und der Zwĭ̦lhen (dem Zwillich) drịịträttig. Zu erwähnen bleibt noch das G’schï̦tzel oder das g’schï̦tzlet Tuech. Zu diesem Stoffe nimmt man braunen Baumwollzettel. Der Ịị ntraag bringt jeweils auf zwei Schï̦tz (Einschüsse) von Baumwolle irgend welcher Farbe zwei Einschüsse von ungefärbter Wolle. Wirft man, um ein kühleres Kleid zu bekommen, nur einen statt der zwei Schüsse wu̦lligs Gare̥n ein, so entsteht nicht G’schï̦tzel oder g’schï̦tzlet’s Tuech, sondern Schï̦tzeltuech oder Schu̦tztuech. Beiderlei Stoffe werden präßd statt gewalkt.
Zum Weben nun muß zunächst die Spuele̥rra (das Spulrad) ihre Dienste leisten, um erst das Zettelgarn auf die Spuelspindli und sodann auch das Einschlaggarn — den Ịị ntraag — auf die Spïele̥ni, Schifflispïele̥ni zu verbringen. Dabei gilt es gleed 481 (häufig nacheinander), mit Geduld und Geschick manchen verworrne n, verhu̦rsche̥ten (s̆s̆) oder verhï̦rsche̥te n Strangen ụụfz’fĭ̦slen, z’e ntwärren. Das gilt auch bildlich:
Wär sell es Tschuppli Chinder b’schuelen,
Hed viil verworre’s Ziig am Spuelen.
35
Nun gilt es, den Zettel zu besorgen. Dies geschieht mittelst der Zetti oder des «Zettihaspels». Es ist dies der «Weerpfen» oder das «Wäärpfli» des Lötschentals, während in Grindelwald die Wärpfa oder das Wärpfli das am Zettelbaum geordnete Garn bedeutet. Auch eine Aufgabe, ein Vorhaben hed mu̦ u̦f der Zetti. Eine besondere Aufmerksamkeit erfordert die Fadenkreuzung: der Scheid (die «Rispi», 36 die «Scheitliga» des Lötschentals, die «Garn-scheere» Lüneburgs usw.). Am Webstuhl oder Gstị̈edel, wie auch ein häßliches Weibsbild heißt (vgl. die «Stuedla» des Lötschentals, «dat Wewtau» oder «Wewstell» Lüneburgs usw.), gilt es nun weitere Proben abzulegen, in welchem Maße mŭ̦ chënn Gidu̦lt nähn. Auch schon das kleine primitive Bendergstïedel erfordert solche. Denn wie häufig zerschletzd es einen Zettelfaden (oder dieser selber zerschletzd), namentlich wenn das Gare̥n sehr reins (dünn) ist, und die Weberin muß jenen mittelst des Wi̦brichnopfs 37 reitlen! Nach Maßgabe des vorgerückten Gewebes sodann müssen die Dämpli, die beiden Glieder des Spannstabs vorwärts gesteckt werden: mu̦ mues nahi tämplen, ohne das Ende zu verstächen. Zuweilen geschieht dies dennoch und macht das Ende wertlos. Drum lautet der Satz «das Rechte, Beste kommt erst noch» grindelwaldnisch: das ist bloß d’s Endi vom Guettuech. (Dieses Ende ist übrigens auch andersfarbig und wird vom Schneider entfernt.) Mittelst der B’strịịhi («Schlichti», welche auch für die Federkissen dient), 38 muß ferner Stück um Stück des rịịstige n Zettels geglättet werden.
Bis 1907 auf der nunmehr eingegangenen Walhi zu Duftbach g’walhed und an der Walhirămen getrocknet, kommt das Wolltuch gleich anderm Stoff der Schneiderin des Hauses in die Hände. (Obschon «walken» mit «wallen» etymologisch nichts zu tun hat, sagt doch der Grindelwaldner im Sinn des letztern Wortes z. B. beim Anblick eines geblähten Rindes: es walhed i n ’mmu̦. Nach einem ähnlichen walhen sind auch, die Walhilï̦chcher im Ịịschmeer benannt. Es sind dies große Trichter von unergründeter Tiefe, welche sich das zusammenfließende Gletscherwasser an geeigneter Stelle ausfrißt, und in 482 die es alsdann hinunterkreiselt, um unter dem Gletscher den weitern Weg sich zu bahnen.) 39
Wie mẹn’gs Făde ntrëëlli (Fadenspule), wie mẹn’gs Chlu̦mmli oder Chlụmme̥lli (Faden- oder Garnknäuel) wird den Winter durch von der Schneiderin verbraucht! Dabei hed alls Făden (ist geschickt und gescheit gemacht), 40 was aus ihren Händen hervorgeht. Nichts ist bloß grŏbjä̆nisch ’pfụ̆ụ̆ted oder g’schnu̦rpfd. Nirgends heißt es, wie bildlich auch von liederlicher Akkordarbeit: Stich wịịt u nd fï̦rd’re n d’Lị̈ị̈t! («Läng Sti̦i̦ch, heit enandere n!») Ach wo es bloß zu bị̈eßen (flicken) oder etwas ịị nz’bị̈eßen (einzunähen) gibt, z. B. e̥n Dï̦nni old en brëëda Blätz in altem Gewand, oder einen ụụfg’fä̆sre̥ten (zerfaserten) Hosensaum, wird exakt gearbeitet. Will der bejahrte Vater etwas altmodisch haben: einen Fŏre̥m aus Knochen statt des neuern Hosenknopfes, oder Häftle̥ni und Ringle̥ni am Hemdkragen: auch dieses «Problem» wie andere ungleich schwierigere sucht die Schneiderin mit Glück z’e nthäftlen. Wenn dann einmal ein etwas einfältiger Mensch: e n Llä̆tsch Zukunftsträume ausspinnt und sie ihn, wenn er sich aufdringlich macht, ein wenig verbẹndled, am Bẹndli heed, so mag ihr das Übermütchen schon ein wenig hingehen.
Schen wir nun ein bißchen zu, wie diese Hände, die im Winter nääjjen und im Sŭ̦mmer määjjen, im Frühling die Mistgabel, im Sommer die Sense und im Herbst den Karst führen, in der Stube nebst äußerst beschränkten andern Mitteln die Schääri und die Naadla handhaben.
Da kommen zuerst die Bedürfnisse des Säuglings an die Reihe. Bis vor kurzem hat man die Wickelkinder so allgemein g’fääsched (s̆s̆), ii ng’fääsched, daß grị̈ị̈selli ch fääschen noch jetzt «verzärteln» bedeutet. Das Fääsch (s̆) bestand der Hauptsache nach aus dem Brịịsi. Das Brịịsi war ein etwa fußbreites, zugespitztes Stück Linnen, das um den Bauch und dann, Arme und Beine mit einwickelnd, über Schultern und Füße geschlungen wurde. So hat man noch vor einem Dutzend von Jahren die arme, lebende Mumie ịị ng’mu̦mme̥lled, ịị n’bịịtled oder ịị’gï̦rted, schon damit, we nn’s «anders Wätter» g’gään heed («bei der kleinen Majestät Tauwetter eingetreten ist»), die frischen Windeln 483 sich bequem unterschieben lassen und das Kind sich nicht entblöße. Hauptsächlich allerdings sollten g’fääscheti (s̆s̆) Chind grẹẹder waxen, gsch trakteri Glĭ̦der uberchoon als rationell gepflegte Säuglinge. Welche Befreiung, wenn das Fääsch an die losere Einwicklung ins Goïmmertechche̥lli und an das Schlï̦̆fe̥lli (vgl. Schlŭ̦fi S. 484) getauscht wurde! Und welche Emanzipation brachte sodann das erste Rocke̥lli, wenn auch der darüber gebreitete Seïfermantel die Unmündigkeit noch genugsam kennzeichnete!
Als erstes Zeichen der Mannheit 41 gelten die Hŏsi mit den sogleich (ohne Vorstufe, wie für städtische Knaben) auf die Schuhe hinunterreichenden Beinigen. Dazu gehörten bei den alten Balkenhŏsen der Hŏsbalken statt des Schlitzes, sowie nunmehr die Obenahiseck zum ịị nstooßen von Năse nlumpen und Rollihĕgel ( S. 473). Aber welche Abkühlung des Selbstgefühls, wenn mit der Rute ’drewd (gedroht) wird: aha, e̥s geid de̥r den n uber d’Hosi! Möglich allerdings, daß da der Junge, ehe man sich’s versieht, Reißaus nimmt: abhŏsed oder abpfi̦tzd. Aber wie, wenn er auch einst als Ehemann sein anderes Mittel zur Wahrung des Hausfriedens weiß!
Hed d’Frau statt diine d’Hosi aa:
Gällt, Maa, su cha sie d’s Schaaf
42
denn haa!
Du bruuchst, i meine, sälber kei’s.
Warum? Du bist ja sälber eis!
43
Die rechte Mannheit verurkunden übrigens am Älpler die zum Stall- und Hüttendienst über das sonstige Gewand angezogenen Uberhŏsi oder Hirterhŏsi aus Chụdertuech oder Zwi̦lhen, wenn nicht der Hirterplụụsen oder der Burgunder, wohl auch der eigene Hirterschlŭ̦fi. Samt den Hirterschuehnen oder Hirterholzbëdnen bilden sie ein ganz stolzes Berufsinsigne. — Die heutige Weste heißt das Schĭ̦lĭ̦ ( gilet; im Oberhasli: «der» Schĭ̦lĭ̦). Die Westentasche: das Schilisecki birgt u. a. am Sonntag die Uhr an angemessener Kette. Früher wurden manchmal in die Uoxli̦chcher Ärmel eingefügt. Ein solches Ermelschili stand jedoch nur dem einigermaßen Beleibten, stattlich Aussehenden gut; über seinen hagern Träger spottete man: är g’sehd grăd ụụs, wie n e n Mụheim in e’m Ermelchili. (Der Muheim ist die Grille: S. 199.) Da während der ganzen milderen Zeit des Jahres nur die Weste über das Hemd angezogen wurde, so gehörten zu diesem Kleidungsstück die Ärmel häufig, der Rücken aus grobem Zwillich immer. Sein Hauptdienst bestand im 484 schützenden Umgürten der Lenden. Dies letztere Wort 44 ist zwar im Grindelwaldnischen durch Wĭ̦lhe̥ni ersetzt; allein der Fluß der Wortbildung hat auch hier erhaltend gewirkt, und man nannte die Weste den Länder, das Länderli. Zum Kirchweg und zu andern Ausgängen wurde behufs Deckung des unansehnlichen Rückens über den Länder der óber Länder angezogen: ein farbig gestreiftes Tuchstück ohne Ärmel und ohne Zusammenschluß nach vorn. Ihn ersetzt nunmehr der jackettenartige Schlŭ̦fi. Die Bequemlichkeit dieses Kleides brachte ihm die Übertragung erst auf einen gä̆bigen, gutherzigen, dann aber auch gutmütig einfältigen und deshalb zu bemitleidenden Menschen: eṇ gueta Schlŭ̦fi, en arma Schlŭ̦fi. Von einem solchen erzählt man etwa: Är heig de n Stäcken a’n Schlufisack g’heichd, und darna ch heig er umhi a nfaan umhawalpen, umhaglanggen oder «heltiruarschen» (wankend gehen). Man redet aber auch im Sinn des Festkleides vom Su̦nntăgschlufi, vom Hochzịịtschlufi. Neben dem Schlufi kennt man den Chi̦ttel (Bauernfrack), und ei’m und’r de n Chittelfäcke n staan bedeutet ungefähr: einem «unter den Bart stehen». Dem Gehrock hinwieder entspricht der Aṇ’glees, das Aṇ’gleesi. Es war eine für ihre Zeit stark gestutzte Abart des Uberrocks, der bis auf die Knöchel hinunterreichte.
Der hier auffällig vermiedene Name «Chŭ̦tta» gilt in Lauterbrunnen dem Frauenrock. Dieser heißt im Lötschental als Alltagsgewand der «Tschoop», als Festgewand der «Rock». In Grindelwald ist der Rock überhaupt das den Mittel- und Unterleib kleidende weibliche Übergewand, zum Unterschied von demjenigen für Oberleib und Arme: dem einst sonntäglichen, jetzt bloß noch zur Tracht ( S. 489 f.) getragenen Rëckli und dem werktäglichen Mantli alter Mode, dem Jagg oder dem Plụụsen moderner Kleidung. Der Rock besteht für den winterlichen Alltag aus selbstgewobenem Halblein, im Sommer aus G’schï̦tzel oder g’schï̦tzletem Tuech ( S. 480). Das G’schïtzel oder auch der Halbḷịin liefern insbesondere das ober Glŏschli (s̆s̆), beliebiger Stoff das undra. Beide Gewänder dürfen als Insignien der Weiblichkeit ja nicht unerwähnt bleiben. 45 Hat doch das Eheweib, welches das Regiment führt, dem Maa n d’s Gloschli g’gään u nd ’mmu̦ d’Hŏsi g’nu̦u̦n, und erklärt der bloß noch als Prokurist seiner Frau rechtskräftig Handelnde, är gsehj oder är jụ chzi der Mueter ze’m Gloschlischli̦tz ụụs. Zwischen beide Unterröcke schieben sich für den Sonntag das Gorsee und das Gstäältli aus Baumwolle oder Barchent. Über das Korset kommt, wenn die Trägerin ein bequem 485 sitzendes, nur lose anliegendes Gewand vorzieht, der faltig geschnittene Plụụsen oder das ebensolche Su̦mmerjaggli aus Grétona, Pị̆ggee, Mŭ̦sselina, Flŏnä̆lla, old aber Sịịda. Knapper oder loser anliegend, tritt dafür im Winter der halbleinene und gefütterte Jăgg, bei alten Frauen das Mantli, ein und bildet mit dem gleichstoffigen Rock die eigentliche Aa nllĕgi. Zum winterlichen Ausgang kommt darüber, an Platz der veralteten Schălen ( shawl) und der ebensolchen Pellerinen, das Schággett samt Chrăgen aus Schéwiott ( cheviot) oder Guettuech, sofern den Kragen nicht heute der engländermäßige Belz ersetzt.
Heimeliger sieht sich das sommerliche Ausgehkleid an. Über Hals und Brust legt sich, den gestrickten Underschlŭ̦fi oder das ebensolche Underlịịbli bedeckend, das Lịịbli. Es wird in altmodischer Leidtracht durch das große schwarzwollene Halstuech ersetzt, welches sich die Trägerin über Brust und Nacken schlingt und vorne einfach oder uber’s Chrịịz einschlägt. Zum Lịịbli aber und den Lịịblichette̥llinen, welche nunmehr wie unterländisch auch Gëllerchette̥lle̥ni heißen, gehört das Mieder: das Wĕßli. Im solchem Weßli geht man ohni Ermla z’Chilhen. Es besteht aus glattem oder ụụsgstoch’nem Săme̥t und ist nun auch mit den dem Unterland abgesehenen silbernen Brusthẹften besetzt. Zwischen Weßli und Lịịbli hervor sticht das Mänte̥lli (Vorhemdchen). Im Feierkleid für Abendmahl, Taufe und Hochzeit werden Weßli und weites Hemd (s. unten) durch das Rëckli ersetzt.
Der zum Festkleid gehörende Schurz ist nunmehr meist seiden. Sonst aber war oder ist es ein ’glanderierta Schurz aus Rịịsti, worin blaue und rote Zeichen abwechseln. Diese Zeichen sind entweder ununterbrochene Striche ( Zịịßi), oder aber Reihen von zierlich verschiedenfarbig sich abhebenden Quadrätchen, die sich aus einiger Entfernung wie Kettchen ausnehmen. Solch ein Chette̥llischurz paßt besonders gut zum g’faaldne n Rock aus tiefschwarzem Kaschmir oder Merino. Derselbe will jetzt ebenfalls durch englische Gewandung verdrängt werden.
Der nämlichen Tendenz weicht nun auch mehr und mehr das «im Litz gaan»: das Tragen des wịịten Hemmli mit weiten und auf der Oberseite steif geplätteten Ärmeln. Das an seinen Platz tretende ẹng Hemmli verbirgt sich unter dem Obergewand und kann daher aus einer beliebigen Sorte Parchet bestehen, oder nun auch aus Bou mwolle ntuech, dessen Aufkommen seinerzeit als gewaltige Neuerung galt. Noch angehende Fünfziger erzählen, wie sie als Knaben und 486 Jünglinge mit Hemden aus Chụụdertuech samt haften gebliebenen Dinglen ( S. 478) sich die Haui wund gerieben. Das Underhemmli (Unterteil des Hemdes) mag noch heute aus solchem Chụụdertuech oder sonst unscheinbarem Stoffe bestehen. Das nämliche gilt vom Knaben- und Männerhemd. Hauptsache ist bei diesem, daß zum Ausgehen die fläxigen Brï̦sti und die am Hemd haftenden Chrä̆gen, sowie die Ermla oder wenigstens die under’ dem Schlŭ̦fi fï̦rha guckenden Handbẹndla oder Brăßla (der Brassel ist le bracelet) recht gstaag seien. Das ist heute mit dem Chŏhlịịsen oder Steinịịsen (Plätteisen, welches mit Hofzkohlen oder mit durchglühter eiserner Füllung heißes gmachd wird) unschwer zu erreichen; und der alte Bauer, der nach aufgefrischter amerikanischer Mode d’s Hemmli hinna ịị ntued, erhält damit eine tadellos schimmernde Brust. Wie schwer war das hingegen noch vor einem Menschenalter, wo man (auch im Oberhasli und anderwärts) bloß mit dem hölzernen runden Lëffel, Nịịdle nlëffel die Bügelkunst zu üben wußte! Da blieb das Hemd lampigs, die sich Abmühende mochte als noch so gstags Wịịbli ihren Willen, e̥s gstăgs Hemmli z’wägz’bringen, durchzusetzen versuchen.
Zu ihrem Troste konnte es allerdings dienen, daß erst recht das schimmernd steife Hemd jedes an ihm geschehene verungasten (verderben) und dräcken (beschmutzen) gleichsam höhnisch zur Schau stellt. Wie schön stimmt auch zu einem recht auffälligen Pflaars oder Pflaartschlig am Ärmel ein Si̦lch (Kotstriemen) am Gewandsaum! Wartet dann die Hausfrau ohne Not mit dem z’linde n tuen oder ịị nllegen (einweichen) des verunglückten Stücks bis zur üblichen großen Ụụstăg- und Herbstwësch (s̆s̆), so wird es natürlich um so u nwäschiger (s̆s̆). Sie hatte, um billigeres Linnen zu erhalten, das Baumwolltuch rouw’s eingekauft und, um gleichwohl wäschigs (s̆s̆) Tuech zu bekommen, es in hübsch ausgebreiteten Stücken auf natürlichem Wege sälber ’pleikd.
Wahrend wir uns über alles dies im Bauernhaus orientieren, ist grad der Schuehmacher uf der Stëër. Es ist ein vielbeschäftigter Nachbar, der im Sommer seine Alpgeschäfte besorgen muß und bloß im Winter schuejed. Geduldig hat man auf ihn gewartet, obschon die Schueh, welche er letzten Winter gefertigt hat, ob der harten Arbeit in Wald und Feld beinahe oder ganz zu Schlappschuehnen, Schlaarpischuehnen, Schlaarplĭ̦gen, Schlopfĭ̦gen, Läärpschlĭ̦gen, Tschaarggen, Tschaarggligen ausgetreten sind. Sie waren allerdings gleich den Tääplen (alten Filzschuhen) noch zur Not brauchbar. Ja sie ließen sich sogar noch als Holzmaß im Walde anwenden. 487 Gab doch einer die Erklärung ab, er sei, um einen Stamm zu messen, dru̦ber g’läärpschliged und es si̦gen drịịßg vo n sịịne n Tschaargglige n gsịịn. Sonst ist freilich der Tschargg und der Tschaargglig auch en hi nlääßiga Mentsch, z. B. ein Weibsbild, an welchen sich einer e n Schueh volla nimmd. 46 Schließlich käme es also dazu, daß auch die reiche Familie sich, vor des Oberländers Augen mit dem Merkmal äußerster Armut beladen und barfues oder allenfalls in blu̦tte n Fïeßen, d. h. in bloßen Fï̦rfießen (Fußteilen des Strumpfes) gehen müßte. Doch da langte der Ersehnte an. Seiner Hẹndschen (Handschuhe) und Stooshẹndschen (Mịịtle̥ni, mitaines) entledigte er sich schleunig, und aus der Hu̦tten legte er sịị n Wäärchzị̈ị̈g Stï̦ck fï̦r Stï̦ck vor sich hin auf das Wäärchbẹichli. Da kommen zuerst e n Tschu̦ppe n (größere Anzahl) Ggnịppi (Klingen) und Alsi. Die Alsa (in Interlaken «Aalĭ̦ssen») ist die Ahle. 47 Hinter Wärgistal heißt Alsa ein idyllisch gelegenes Plätzchen, seit dem Burenkrieg der «Spionskop» der Skifahrer. Es folgen die Năgelalsa, die Räspa (Lederfeile), Stiftzanga, Lochzanga (schafft die Löcher zum Durchziehen des Schuehbẹndels, womit man den Schuh b’hefted), die Bstächzanga (zum Einklemmen des Leders), die Falzzanga (um den Schaft über den Leist z’zwicken, ụụfz’zwicken oder ụụfz’zwäcken). Der Strịịchchnochchen stülpt ein Riesterstück in die Naht zwischen Sohle und Überleder; der Fu̦mmel glättet die Sohlenränder; das Ablaaßmässer schneidet den obern Sohlenrand glatt; die Glettschĭ̦na glättet Sohlen und Nähte. Der Leisthaaggen zieht den Leist heraus; die Chnewhälftra leistet die Dienste des Spannriemens, und beim năglen dient die Ịịse nsŏhle, der Bschlăgstock oder Bschlăgfues.
Für das nötige Trähtgaren oder Trääggare n zu Spettdrähten (Pechdrähten) haben die Bauersleute selbst fï̦ï̦rg’sehn (vorgesorgt.). Denn sie wollen nicht g’năgle̥d Schueh, sondern g’nääjt Schueh und zwar fläschnäätig (s̆) oder Bäächschueh: Schuhe, bei welchen Oberleder und Sohle außen zusammengenäht sind, statt innen wie beim Răhme nschueh. Da bei den fläschnäätigen Schuhen die Sohlen ringsum weit vorstehen, sagt man spaßweise, si heige n z’ringendum Su̦mmerloïbi. Auch das Lederklopfen (verschieden von d’Sŏhlichlopfen, d. i. Reißaus nehmen) wurde dem Schuster abgenommen. Auf hẹrtholzigem Totzen wurde mit dem eigenen schweren Läderchlopfhammer die ganze oder halbe aus der Gärwi 48 geholte Haut geklopft. 488 Dafür bekam freilich der Schuhmacher beim Bauer andere Arbeit. Der letztere ließ die Tierhaut vom Gerber nur e nthaaren; der Schuhmacher glättete dann die Innenseite und übergoß sie darauf mit dem gesamten geschmolzenen Talg des geschlachteten Rindes. So sịị n d’Schueh fast ni̦d z’zerhịje n g’sịịn; die mangelnde Eleganz aber konnte für solche, die den Vorhalt des «Geizes» nicht scheuten, durch das gịịgen oder gịxen (quietschen) ersetzt werden. Schon Kinder sind überglücklich, wenn der Schuhkünstler ihnen verspricht: Wenn e̥r loibi sịịd, su̦ will i ch e̥ wch Gịịx dri n tuen. Der nicht Eitle dagegen hält mehr auf Dauerhaftigkeit seines Schuhwerks und erinnert sich u. a. des Spruches: We nn mu̦ d’Schueh (erst) a’ n Fïeße n salbed, so wird mu̦ vergäßli ch. Mit wegwerfendem das gi bd me̥r nid Schuehsalb! ist er sogar imstande, einen Dank abzulehnen.
So wenig der Oberländer barfuß geht, so häufig sieht man beide Geschlechter kleinere Ausgänge barhaupt verrichten; auch Kinder entledigt man mehr und mehr der ängstlichen Verhüllung des Kopfes. Die erste Kopfbedeckung war und ist ja auch der Schäre̥m, der Wätterhuet, Wättertschä̆bi, Tschä̆bi, das Huetchleid aus weicher Wolle, die ohne Schaden jegliche Form annimmt. Nur der gstaag (steife) Hut kann sackermäntisch verwullhueted werden. Der praktische Zweck des «Scherms» wird vor allem durch den breiten Schopf erreicht. Einen andern Zweck kann der hohe Gu̦gel haben. Ihr Nastuch bargen die alten Grindelwaldner oben im zusammengeschnürten Futter des Zilinderhutes aus schwarzgefärbtem Stroh, womit sie zur Kirche gingen. Hohe Feiertage aber und namentlich Hochzeitstage wurden mittelst billiger «Seidenhüte» geehrt, wie etwa noch Junge deren zum Mummenschanze tragen. Der nämlichen Belustigung dient ein da und dort vorgefundener geschnitzter Holzhut. Die heutige Kopfbededung bietet nichts Eigenes mehr; am wenigsten tun dies natürlich die Hị̈et und Hị̈eteni der Hị̈etle̥rren, welche als Modisten hị̈etlen. Schimpft der Walliser über die Kosten des Modenwechsels («der Wịịbergrind chostet es Zịịtrind» 49 ), so spottet der Grindelwaldner über dessen Raschheit: E n lloiba Grindelwaldpapa ist dem Wịịbli und de n Mmeitschinen uf Hinderlachen gan Hị̈et choị̈ffen. U̦f dem Hei mwääg ist ’mu̦ en Bikannta e̥bchoon und hed mid mu̦ wellen dorfen. Aber ị̈ị̈sa Papa hed gseid: I ch han ni̦d Zịịt z’dorfen! I ch han Hị̈et g’choị̈fd, und da mues i ch pressierren, sụst sịịn die us der Mŏde n, wen n i ch hei m chu̦men. (Grindelwalds zwei Hutgeschäfte bestanden damals noch nicht.)

Im Reckli.
Gemalt von R. Münger.
Wohl noch nie ist dagegen geschimpft oder gespottet worden über 489 die Spitzlihụụbi, obwohl die bloßen Seidenspitzen daran über zwanzig Franken kosten. Und zwar ist an diesem Preis kein Zwischenhandel beteiligt. Gleich vor dem «Adler» und wieder vor dem Spitzlerhï̦ttli am Wetterhornsträßchen ti̦ntled, angelernt durch die verewigte Frau Pfarrer Stauffer aus dem Hotel Staubbach, geschickt und emsig je eine Lauterbrunner Spitzle̥rra oder Spitzlifrau mit zwei angehenden Spitzelmeidschinen. Jeder Vorwurf der Verschwendung muß aber auch schweigen schon angesichts unserer Bilder auf und zu S. 490. Und wer erst weiß, daß Hụụba und Rëckli sich bisweilen auf drei und mehr Glieder vererben, erblickt vollends im Anzug der Matronen einer Abendmahlsprozession, eines Leichengeleites keine Spur von Eitelkeit. Auch den Sămet des Haubenbodens, welch erstern übrigens in der altmodischen, bloß das Gesicht freigebenden Chindshụụben Wolltuch oder Häkelarbeit ersetzte, tadelt kein noch so sparsamer Hụụsmaan. Oder sähe er lieber eine ’tị̈echleti Kirchgängerin aus dem Pest- und Trauerjahr 1669? 50 Vollends nach der Haubenträgerin auf unserm Farbenbild wird gerade der unerbittlich am Alten hängende Träger einer gestrickten Kappe mit lätz u rächt g’lĭ̦smetem Bort ( S. 491), oder einer Tä̆tsch- old Schëpflichappen als Prototyp der heutigen Sportskappe, oder einer Pụụren- old Pï̦schelchappen (s̆s̆, Zipfelmütze) am allerwenigsten als Cato censorius hinschauen.

Tintlen (Spitzen klöppeln).
Bmk. zugleich die Haartracht.
Die Haube samt den fliegend und bebändert getragenen Haarzöpfen der Jungfrauen ist ja auch das einzige, dafür um so intakter erhaltene und wertvollere Erbteil der alten Grindelwaldnertracht. Sonst sei, heißt es, diese seit einem Dutzend Jahren noch gründlicher als selbst in Interlaken durch die städtische Mode ersetzt worden. In den oben erwähnten und andern Einzelheiten hat auch englische Touristenfrauentracht derart sich eingebürgert, daß selbst Einheimische bisweilen Landestöchter mit Fremden verwecheln. Die Klage über Einreißen städtischer Kleidungsweise 490 übrigens ebenso alt 51 wie nutzlos. Um so bedeutungsbewußter wird bei gegebenen Anlässen d’Tracht fïrha g’nu̦u̦n: Rëckli und Hụụba ersetzen das gewöhnliche Sunntaggwand.

Im Reckli.
Durch letztern Ausdruck sticht noch die alte umfassende Bedeutung von G’wand durch: alles, was man sich zu Trutz und Schutz und Putz um den Leib «windet» oder winden kann. Es gehört also dazu schon das Bettg’wand und die Leibwäsche, mittelst deren man zur Zeit der zwei Jahreswäschen am Gwandseil, gestützt durch die Gwandstaagli und gekrönt durch das Großdutzend aufgesteckter G’wandgä̆be̥llinen (Waschkluppen) temporäre Ausstellungen veranstalten kann. Im «Gewandhaus» (Zeughaus) hängt des Deutschen soldatische Rüstung, und als Kleidung unterscheidet der Grindelwaldner das Manneṇg’wand, das Wịịbeṇg’wand, das Chindsg’wendli. «Gwand» aber und «Laken» bildeten in alter Sprache gewissermaßen konzentrische Kreise; das Lachchen war der weitere. Es gab ein reise- oder reitlachen, ein badlachen und hemdelachen (Art Hemd), ein houbetlachen (Kopftuch), ein banc- oder stuollachen neben dem Tischlachchen, ein deckelachen und chussilachen neben dem Lii nlachchen usw. 52 «Gewobenes» 53 scheint wie hier, so auch in «Kleid», B’chleidu̦g, B’chleidu̦gli die Grundbedeutung zu sein. In engstem Sinn dagegen ist die Aa nllĕgi oder für Kinder das Aa nllẹge̥lli G’wánd ein «Anzug» aus einem und demselben Stoff, mit Ausschluß also der Fuß- und Kopfbedeckung. 491 Für «Gewand» selbst aber sagten die alten Grindelwaldner in der noch nicht herabgesetzten Bedeutung 54 das G’hï̦̆del. Sie redeten selbst vom Su̦nntagg’hï̦̆del und hielten es, wenn Geld in Frage kam, für g’schịịder, ’s a n d’s Ghï̦̆del z’gään wan dem Tokter. Wenigstens für Hu̦del aber neigt der Sprachgebrauch ganz zur ungünstigern Bedeutung. Hat die schwarze Wäsche sich angehäuft, so mangleti mu̦ d’Hŭ̦dla z’linde n z’legen; alt Hudla gibt es beständig hier zu flicken, dort wegzuräumen. Ein neues Gewand wird nicht durch viele gleichartige in seltenen Gebrauch gesetzt, sondern nahi ụụfg’hu̦dled, bis es dem Hŭ̦dler: dem Lumpensammler verfällt.

Lätz u rächt g’lismeti Chappa.
Ganz parallel gehen übrigens der Hoi ptlumpen (das ordinäre Kopftuch der Frauen und auch schon der kleinen Mädchen) und der Năse nlumpen (der Schnị̈ị̈zlumpen der Gomser, der Schnị̈ị̈zlụụder der Hasler und der Schnị̈ị̈zer speziell der Gadmer) neben dem Lumpen als Lappen, und der «Sonntagsfetzen» 55 neben dem Fetzen der Schriftsprache. Die moralischen Übertragungen Hu̦del, Lu̦mp, Fëtzel bieten nichts Neues, wie dagegen die Adjektivbildung g’hŭ̦del. G’Hŭ̦del Hosi und überhaupt das g’hŭ̦del Gwand oder das G’schlëtter kennzeichnen eine Person, welche sich nachlässig kleidet, dahar chu̦nnd z’gschlëtteren, z’schlëde̥llen, z’schlŏde̥llen, zschlŏden, schlotteracht dahar chu̦nnd und daher ein G’schlëtter, eine Schlŏda, ein Mănĕve̥rli 56 zu heißen verdient. Höchst bezeichnend ist aber dem Bauer schlŏde̥llen und schlëdellen zugleich ein ụụfg’mï̦tzled’s Zurschautragen von Firlefanz. Es ist der nämliche Älpler, der in witziger Selbstpersiflage, wenn er das Melkgewand anzieht, erklärt, är welli mid dem Hŭ̦del de n Fëtzel tecken. Es ist dies die schon S. 454 berührte Art von Äußerung des Selbstbewußtseins, womit 492 der Mühlebacher gleich sehr von armseligem tschääggerlen, von filzigem g’mịggerig und gnappocht dahar choon, wie von Nachlässigkeit und von Eitelkeit eben berührter Art sich ferne hält. Damit ist nicht geleugnet, daß das an sich gesunde Urteil auch etwa irre gehe und nach dem Bild auf S. 321 gelegentlich all i’ṇ glịịhen Napf mälhi. Nachäffen der Krinolinen mit Weidengerten, der Tournüren mit Strohpolstern und der Spinnentaillen mit si ch ịịngï̦ï̦rten bis zur Atemnot hat nichts zu tun mit geschmackvoller Anbringung eines schlangenartig gewundenen Wure̥mli̦tzi am Rocksaum, eines Bande̥lli (Stück Samtschnur) auf der Schulter, eines Lị̆sreeli oder Lị̆sree ( liséré) an einer Seitennaht. Selbst das staffierren mit imitierten Pollen (Korallen), Bärgroosen und Edelwịịß und anderseits den Anzug des Stotzchrăgenheer tadelt der Objektive erst, wenn noch vor ihm der Wuchs des Leibes, der Stand des Trägers und der Bestand der Kasse dagegen Einspruch erhoben. Er weiß, daß das löbliche simpel und ei nfach daharchoon ein Grundsatz ist, der in unzählige persönliche Anforderungen von Fall zu Fall sich auseinanderlegt. Wie man in weitgehender Parallele für den Leib mit seinen Gliedern und für die Leibeshülle mit ihren Teilen sich der nämlichen Ausdrücke bedient, 57 so prägt nach dem alten Worte «wie sich’s wandelt außen, wandelt sich’s auch innen», selbst das Seelenleben sich in der Gewandung ab; die Art, sich zu betragen, entspricht der Art, sich zu tragen. Nicht zufällig ist der Sprache wâtlîch und waartlich zugleich kleidsam und wohlanständig (vgl. bien séant), und gilt u nwaartlich von häßlichem Gehaben. Fĭ̦sig ist dem Grindelwaldner, wer in beiderlei Sinn etwas auf sich selber hält.
1
Vgl. «ummuglich»
S. 388.
2
v. Tav. 111.
3
Baltz. 1, 108 f.
4
Die Berge standen bereits da, «als Eva span und Adam hackt’ im Morgenland» (
Rebm. 6). Vgl. das «Kunkellehen»
S. 539, und «Schwert- und Spillmagen»
Lf. 371.
5
369-375.
6
Im Untersched von der unterländischen Riisten (geordnete Langfasern des Hanfs; vgl. dagegen
mhd. WB. 2, 1, 729) erscheint die «Riisti» als eigentliches Substantiv des Tätigkeitserfolgs; vgl. reist (fertig) zu reisen (herrichten, zuwege bringen), aa(n)reisen.
7
Vgl.
Habsb. 1, 308; 2
a, 26. 28 f. und ö.
8
«Werg» ist später aus «Werk» differenziert, etwa wie «Beet» aus «Bett» u. dgl.
9
Ahd.
flachs oder
flass konnte daher z. B. auch den Docht bedeuten. Die Stelle Jes. 42, 3 = Matth. 12, 20 lautet in den
Fragm. theot. 5, 1 (Braune ahd. Leseb. 154, 4):
riuchantan flas ni leschit (den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen).
10
Hoops 472.
11
Vgl.
Lf. 376.
12
Font. 6, 208;
Reg. 66.
13
F. 4, 359.
14
F. 4, 237.
Haro, har, Genitiv
harwes ist Flachs.
15
Gw. Rs. 3.
16
Ähnlich spotteten die alten Alemannen über die (keltischen) Bojer, sie seien auf einem Eroberungszuge über ein blühendes Flachsfeld geschwomnen, das sie für einen See hielten. (Vgl. Birlingers Alemannia I.)
17
Vgl.
S. 345 und
Lf. 360.
18
Vgl.
Lf. 363 f. Wie noch im Oberwallis (
Goms 77), wendete man in trockenen Jahren in Grindelwald die Wasserröste an.
19
Moos.
20
Font. 8, 344.
21
F. 8, 89.
22
Vgl. über diese
Lf. 364 f.
23
Lötsch. 112.
24
Demme 16.
25
Ebd. 17.
26
Vgl.
Bern V. nach Pfarrberichten 1764.
27
Vgl.
Demme 21 mit
JG. AB. 1, 157. 169; Zigst. 2, 179.
28
Dieser «Halblein» ist der alte
wiffling (
mhd. WB. 3, 626), der Berwer oder Berwart (
berbicinus? aus
vervex:
Habsb. 2
b, 275), die Beiderwand des
Odenwalds (V. 81).
29
Vgl.
Lf. 378.
30
Mhd.
wibe wap wâben gewëben (
WB. 3, 611) geht nach dem Typus «geben»; allein ein Schwanken zwischen «wab» und «wob» und das Überwiegen des letztern zog «gewoben» und damit Umsprung zum Typus «fliegen» nach sich.
31
Hier also verbleibt es beim Ursprung.
32
Bekanntestes Beispiel: Ap. Gesch. 17, 28.
33
Sumi = einige;
sums = einiges; vgl. engl.
some.
34
Lf. 381 f.
35
GlM. 40.
36
Lf. 393.
37
Lf. 387.
38
Lf. 308.
39
ÄFG. 137.
40
Eigentlich: Man weiß doch auch, was es sein soll; es ist in seinem Wesen gegen alles andere scharf abgegrenzt. Denn «Faden» steht hier noch in seiner Grundbedeutung gleich «Klafter», woraus die von «Umspannung mit beiden Armen» als Maß und als Abgrenzung, Abzäunung («Ehfaden») sich herleitet. Vgl.
Kluge 96;
mhd. WB. 3, 201 («
diu vade» im Unterschied von «
dër vadem»).
41
Vgl.
JG. AB. 1, 20.
42
Als Schwingerpreis.
43
Str. Sänger 151.
44
Urverwandt mit
lumbus (
Kluge 235) und Lummel.
45
Vgl.
Lf. 400.
46
Vgl.
Lf. 401. Über das Simplex vgl.
S. 182.
47
Ahd. (
Graff 1, 224 f.)
alansa, alunsa, alnsa, alsa (mit dem Werkzeug-Suffix wie in
seg-ansa Sense) neben
ala, Ahle; vgl.
Kluge 6.
48
F 3.
49
Goms 102.
50
GlM. 19.
51
Pfarrberichte v. 1764;
Wyß 624.
52
Graff 2, 156-159;
mhd. WB. 1, 923 bis 925.
53
Kluge 200.
54
Die
hadara (
Graff 4, 812) und der
hader, hadel, huder, hudel (
mhd. WB. 1, 608. 724) gehen zurück auf die Bedeutung locker, lose (
Kluge 149).
55
Kluge 105.
56
Die «Manöver» (Truppenübungen) nach ehemaliger Weise als «Spektakel», lustige Schaustellung aufgefaßt und in der Verkleinerung persönlich gedeutet.
57
Man denke nur an Liib und Liibli, Kragen (Hals) und Kragen,
col und Göller, Mieder und Mutter (
Kluge 257), Arm und Ermel, Bein und Hosenbein, Fuß und Firfues,
caput = Haupt und Kabut, Kapuze,
capellus capello chapeau Tschäbi usw.
Tẹich ei nmmḁl oo ch, Elisi, jetz mues Bŏhre n-Chru̦sti 1 no ch si ch sälber chostierren! Sịị n Jungfrau 2 ist newwḁ n fịr ne n Schu̦tz: fîr vierzä̆he n Tag old drịị Wuchchi gan Uri. Chu̦mm, mier wei n ’mu̦ grăd ei ns găn uberd’s z’Morge n 3 loï̆ffen u nd mu̦ e n chlịịn i n d’Pfanna g’sehn! — «Obächt? 4 Das wird me̥r f rịị n es G’chëëch 5 sịịn i n sịịm Hụụshalt!» — O, hab nid Chummer, där wird mu̦ schon eppḁs rächts z’ässen aa nrreisen. — «Ei nmmḁl wohl schị̈er! Eppa e̥s 493 gschmorreds G’chëëch 6 voṇ gester naaha!» — Meinst, där heigi denn nịịd wa n schlächt alt Rästen und tiej’s dä n Wwääg dï̦r chhi nstächchen? 7 — « Z’eerstist! 8 Es ist, wie von Alters dahar der Walser 9 seid: nịịd g’hä̆bed’s ist bald gikochu̦ds. D’Jungfrau hed ja gseid, sie welli denn eppḁs Chosts mid’rḁ nään, und sie ist wóhl ni̦d dieja, wa schlächti Ru̦stu̦g ịị np’hackd.» — Ho, är wird u̦f d’s wenigist Här depfla chochchen old Reesti machen. — «Ja, da mues e̥r doch z’erst d’Härdepfla sieden, old ‹g’schwellen›, wie s’ im Nĭ̦derland 10 ahi sä̆gen, wie we nn sie si wellti machen u̦u̦fz’gaan wie d’Sịwbohni vor dem setzen. Aber weis aär ächt dee nn, we nn s’ lind sịịn?» — Da laa ß du ihnen nu̦mmḁ n mmachen! Är wird si schŏ n g’hëërre n plŏde̥rren (plŭ̦de̥rren 11 ) und brï̦̆sẹllen (brŭ̦slen) und g’sehd’s doch, we nn s’ zersprunge n sịịn. — «Ja ja, das wird mie̥r es schëë n’s Gsood gään! e̥s Sï̦wg’sood! Där tued allwääg 12 d’Här depfla churz e̥ nwägg 13 i’ n G’sŏdhăfen old i’ n d’s G’sŏdchessi, wie we nn’s fịr d’Fähdle̥ni wää r u nd laad si̦ denn da ḁ lsó umha g’sŏden; ja ja, er g’sŏded si̦ nu̦mmḁn, dä r Gsŏdi, was er ist!» — I ch gloïben gẹng, Meidschi, we nn «Gsŏdi» e n schëënna Năme n wää r, su̦ welltist du ganz gääre n G’sŏda heißen; old nịịd? (Verlegenheitspause.) Weist was? Mier gaan jetz grăd ei ns ganz u nsich tlichu̦ vor sịịs Hụụs, wie we nn me̥r vo̥rbịị wellten, u nd rị̈effen aṇgänds ze’r Chu̦chchisti̦i̦r inhi zue’mmu̦, ob d’Milch schon erwallni sịịgi, old ob er sa heig laan uberghịjen. Ob me̥r ei ns tëërffe n chŏn găn achten? — «O hättist me̥r das der ehrder Tag 14 gseid! I ch biṇ grăd e̥m eerst (grad vorhi n, grad bloß, ụ nllangist) 15 ze’r Groose n gsịịn wägen...»
Ja so! Wägen dẹr 16 Gschicht? Drum bist ḁ lsó aa n’trï̦ckd’s 17 g’sịịn! Aber das Dinge̥lli chajst du d’s Naa chmaal rege̥lie̥rren, 18 we nn d’Groosa umhi ze d’s Jaagge̥lli’s Bänze n chunnd. Die geid ja all Tä̆tsch (all Pott) 19 dert anhi, v’lĭ̦cht 20 scho n mmor gen umhi. Mẹngist 21 geid s’ 22 zwĭ̦ren 23 im Tag, und we nn s’ ei ns ei n Tag ubersprungen hed, su̦ geid s’ morne̥sti 24 drịị Mal. «Ei nmmḁl eppḁ dick ( dick und dick 25 ), das ist wahr!» — Ja ja, gleed, 26 daß gleeder nịịd nï̦tzti, — «Aber du geist ja oo ch eppigen ei ns, 27 und dás de nn no ch 494 mĭ̦thĭ̦ n, old wie s’ in Luuterbrunne n sä̆gen: mĭ̦kdi.» — Eh nu̦ n, wä̆gen dér Sach, wa mier am verwichchne n Sunntăg desse n Rreed g’hä̆ben hein! Eppḁ ḁ lsó uber und uber ei ns gaan i ch dert anhi, ei nmmḁl wohl! Aber jetz gang und leg ei ns dịịn eeltra Chette̥llischurz aan u nd chum! Du chajst denn dịịs G’schichte̥lli gẹng no ch vor der Groosen eräfe̥rren; 28 das hed no ch alliwịịl sịị n Zịịt, u nd we nn’s erst d’s Jahr 29 wää r. Gang mie̥r aan 30 no ch hĭ̦nḁd, 31 we nn d’Groosa g’grächeti ist z’lŏsen. 32 — «Old z’Hand, 33 wie albḁn 34 ịịsa Groosi g’seid hed.» — Aber bi mịị’m Bsinne n seid niemmḁ n meh ḁ lsó. Aber jetz wei n me̥r gaan! — (Unterwegs): «Aber schmeck 35 ei ns! U nd lŏs, wie’s tschụụsled! Äär hed d’s Schmalz la n z’heißes wärden, där Lappi! U nd wie’s sprätzled! Grăd ḁ lsó wie ịịsi tannige n Schịịter im Fị̈ị̈r. Äär wird eppa wellen ụụfbrụụhen, was mu̦ sị n Jungfrau, die Chăfla, 36 hed la n vergaan. 37 Sie hed d’s ganz Zịịt nu̦mmḁ n g’chăfled, 38 und Summerszịịts wollt sie nummḁn am Schatteṇ groppen. Z’lest un d am End hed s’ no ch hẹrt 39 vor dem lẹngste n Tag welle Fĭ̦sel stecken, där Tschaargg! Duḁ hed äär ’rḁ grad bloß gseid, sie sell jetz nu̦mmḁ n lu̦gg laan 40 dḁrmid, sie chënnti ĭ̦hra sust no ch ubertúen, und das verstandi 41 jetzen nịị-mmeh. Wohl, da hätt i ch duḁmaal anders zue ’ra gseid! I ch hätt ’ra fï̦r ei ns und alli 42 gseid: Das chan n i n d’Harr 43 ḁ lsó ni̦d gaan! Ja, derra hätt i ch gseid, wie tị̈ị̈r u nd wie spaat!» 44 — Ach, was willt! D’s Manne nvolch ist fï̦̆r áan 45 ḁ lsó! Sie 46 si n lappig u nd tappig. Hinna bi̦ deersch 47 un d naa ch dĭ̦ naa ch (bị lẹngem) g’seh n s’ de nn g’wohnli ch, wie s’s hätte n selle n machen. Aber es zweit’s Mal mache n s’ ’s éinist 48 umhi glịịch. Es sëllt ’nen ä̆ben darnḁ ch gaan; 49 old ni̦i̦d? — «A waß! I ch mag nịịd g’hëërren! Es Manne nvolch ist alliwịịl wịịlweihigs u nd zipfelsinnigs, 50 es wịịled mu̦ si ch gleed. Es ist d’s lenggwịịligst Wä̆se n, wa ’s in der Wäld chaṇ n gään!» — U nd mid Chrusti albḁn hurtig e̥s Rastli (e̥s Wịịltschi, e̥s Bitzli) z’brichten, das ist o ch gar schrecke̥lli ch lẹngzịịtig, old? Das hed si ch bi däm lẹnggwịịlige n Maan eppa no ch nie g’wịịled u nd gwịịled! (Vor Chrustis Haustüre): Grïeß Gott! old eppḁ schoṇ gueten Aaben d? Es ist ja scho lang vo’ n Zwelfen dänna! Du bist, meinnen i ch, e̥s Bitze̥lli e̥ n spatlochtiga! 495 Aber das ist jetz grad gued; jetz chënnen mier chŏṇ găn achten, ob nịịd brännti 51 old aanbrännti 52 old aanbraati 53 bi n ee wch, old jetzen: bi n dier? — «‹He frịịli ch! Alls ist g’schehn. Da chënnd ie̥r grăd inha choon und ei ns d’Pfanna schăben u nd d’s andra den Hăfen bu̦tzen!›» — Soo, das hätt no ch sịị n Bscheid! 54 — «‹Eh jjaa! d’s Gschaab ist den n ew’s. Das chënnd ie̥r grăd ḁ lsó warms ässen old mi̦d e̥ wch hein nään, wä̆ders das s e̥r grăd weid.›» — Dank héigist; aber mier nähmeṇ grăd lieber eppḁs Bessers. — «E n chlịị n von ewwem z’Morge n, wen n ier welltid so gued sịịn». — «‹Das cha nn’s schoṇ gään, warum nịịd! Da heid e̥r a nfḁn e̥s Blättli Suppa.›»

Aus Itramen.
«Potz, die ist heißi!» — «‹Ja, die ist allwääg u̦f dem Fị̈ị̈r gsịịn! Aber wartid, ier chënnd sḁ laa n chuelen, und i ch will e̥ wch u̦ssen 55 e n tolla Bitz Chääs braaten. Da ist vom fäärdrigen, 56 und das da nï̦̆wwa Geis...›» — «Aber wie weid ier das jetz aa nfaan?» — «‹He, i ch tuen e̥ n tẹich bääjjen, ḁ lsó wie mu̦ d’Schweiffla 57 bääjd am offe̥nne n Fị̈ị̈r, old mier-aan, wie mu̦ albḁn in der Pestzịịt hed Brod ’bääjd ze’m ässen.›» — He nu̦ n, su̦ zeig jetz, mier wei n ’se̥ụ 58 grḁd ei ns fekken! 59 Sä̆, 60 Elsi, da hest o ch en Bitz! — «I ch chan n en niid! 61 Är hed ḁlsó en Bitz (Abbitz), 62 old, wie albḁn d’r Att hed gseid: där Mang ist me̥r z’wider. U nd denn ist mier där aalt Chääs alla z’starha, 63 i ch ha n ’se̥ṇ gääre n frischa.» — «‹He nu̦ n, sŭ̦ nimm, old nämid da von der Suppen, sie hed jetz g’chueled. Da ist Wasser, ier wärdid doch will’s Gott, o ch eppḁ d’Händ wäsche n vor dem ässen! (Lachen). I ch will u̦ssen den Härdepfle n schaalten, i ch fï̦rchte n’ru̦.›» — «Ich chchann die 64 Suppa nni̦d brụụhen! 65 Die ist mir denn hinggä̆ge n 496 z’luemi. 66 Sie ist ja ganz schlëëdi 67 u nd leete̥rri! 68 U nd denn heid ier me̥r ja no ch e n b’schleezta 69 ( uberschleezta) Lëffel g’ään!» — Eh, du hest ja g’sehn, är hed nen̦ grad frischa i n d’Suppa g’stï̦tzd. Chru̦sti, Chru̦sti, da chajst umhi eppḁs chï̦sten! 70 Es schịịnd, es well si ch hị̈ị̈t aber alls fecken! 71 Das da ist wóhl en bëësi, die wollt si ch fecken. 72 — «‹Sie ist e n schlimmi, das han i ch glịịchanhi (bi Zịịten, blëtzli ch, flŭgs, raß 73 ) g’merkd! U nd scho n, sịịt i ch sḁ d’s erst Mal ha n g’sehn, han i denn u nd denn ei ns (denn u nd denn, dennen) 74 bịḁ mme̥r sälber ’tẹichd: die cha nn meh wa n Chääs un d Brod ässen!›» — Das hest jetz aber o ch aụgänds (glii ch, im Schwi̦ck) 75 g’sehn, was sie im Si̦i̦n n heed. Sie tued jetz nu̦mmḁn ḁ lsó eige nllich und ehrlos 76 und mängled 77 alls u nd laad’s staan, fï̦r z’achten, was d’a n ’ra mëgist lịịden. — «‹Das wird sịịn, i ch han me̥r das darnaa ch 78 o ch g’seid.›» — «Ja, Băsa, mid däm chụụst du mier nu̦mmḁ n schier z’g’schnäll (z’gleitig, z’schwind)! Du welltist jetz nu̦mmḁ n, daß der Chru̦sti so ring so ring 79 a ls mu̦gli ch eṇ gueti Meinug vo n mme̥r uberchääm. Aber das geid nid so lingig!» — «‹Mier wei n jetz das u̦f der Sịịte n llaan! Nimm du jetze n, Zị̈ị̈si. 80 Du tuest denn ni̦d nu̦mmḁ n so in der Suppen umha geidellen 81 und dran umha trääschen 82 und dran mäwse̥llen 83 und am Lëffel sï̦rpflen und schlu̦rpfen und tschu̦rggen wie n es Chind am Sụụger, 84 und we nn d’ an es Brëëse̥lli Brod graatist, ḁ lsó g’schnoisig tuen und dran umha schnaaren und rällen, 85 das s ’s ụụsg’sehd wie n es Mụụse nggräll.›» — Neei, gwi ß gwi ß ni̦i̦d, Chru̦sti! I ch nähm ’ra grị̈ị̈se̥lli ch gäären, sie schmeckd ja so gued! Aber mi ch hungred u nd tï̦rsted wääger nid schŏn umhi! I ch ha n scharpf g’morgned 86 und es Chachte̥lli Ggaffee old v’licht zwei dru̦u̦f g’nu̦u̦n u nd jetze n sịịtna 87 no ch von dịị’m b’raatne n Chääs g’gässen. Weist, där fuehred! — «‹Eh nu̦ n, su̦ machen i ch der e n Schwarza! Nŭmmḁn e n Schluck fï̦r ahiz’schweihen! Wolltist n e̥n mid Chï̦̆mi 88 und Zucker wie mier albḁ, we nn me̥r i’ n Wald gaan? I ch han de̥r ja us d’s 497 Steinbille n-Rŭ̦bis Chrị̈ị̈terbuech 89 schon ei ns dä n Satz g’lä̆sen: 90 Kaffee macht den Leib gering, 91 hurtig und den Geist wachtbar.›» — Ja ja, i ch bsinne n mi ch! Aber jetz mag i ch ’se̥n doch ni̦i̦d. — «‹Aber Thee? Old von däm brụụne n Ggaffee, 92 wa di ch ḁ lsó gued hed ’dụụchd, weist no ch? D’s Wasser ist erwalle ns; sä̆g nŭmmḁn härzhaft!›» — Mier lịịd jetz an allem nịịd, Chrŭsti. — «‹U nd wen n i ch Ggaffewịịßes nähmm, Zị̈ị̈si?›» — «Was welltid e̥r ächt denn aa nrreisen?» -«‹He, i ch schï̦tte̥ti halb Milch und halb Wasser uber d’s bloß Bulver.›» — «Ohni Schĭ̦ggoree?» — «‹Ei nmmḁl wohl! aber mid ’nem Brịịse̥lli Salz dran!›» — «Aha, Chïejjerggaffee, wie n en albḁ Peter u̦f der Alp machd? Er seid albe̥n: sëli chß Wasser ist cheibisch gueds.» — «‹Und wie machd er’s deen?›» — «Eh, er leid de n Wellhansli 93 uber d’Fị̈ị̈rgrueba u nd hẹicht d’s Milchchesse̥lli draan.» — «‹An ’e̥m Looch, old wie?›» — «Ier Bëësa! Tẹich am Hienne nllä̆tsch, 94 wa z’obrist an der halben Hiennen 95 aa ng’machta ist. Da tued er d’Milch z’wellen, 96 un d ḁ lsó erwallni (g’fị̈ị̈rigi) schï̦tted är sḁ uber d’s Bulver.» —

E warma Ofen ist doch heimliha.
«‹Dä n Wääg! U nd wen n i ch jetz fï̦r d’s Wasser Milch nähmm und fï̦r d’Milch Nịịdla? Du weist richtig, Zị̈ị̈si, im ganzen Grindelwald chann nu̦mmḁn éini gueta Ggaffee machen.›» — «Eh jja, d’Nịịdla!» — Die wä r me̥r jetze n z’festi! 97 — «U nd mmier scho n d’Milch! I ch chënnti’s nid haan, wie die alte n Pụụrelïït, wa geng nach’m z’Morgen no ch e̥s Chachte̥llii Milch nään.» — Old gar e̥s Blättli Suppa! — «‹Kei n Wịịn?›» — Oh, där chunnd wundersälten u̦f de n Ti̦i̦sch! Eppḁ an e’m Festtag u nd bsunders fï̦r d’Gotti und d’Gëttiga 98 an ’er Chindbetti macht mu̦ e̥s Wäärmli. — «‹Es Wäärmli, was ist das eige ntli ch?›» — Mu̦... — «Oh, Băsa, i ch will ’mu̦’s schon ä̆schblizierren! Mu̦ schlaad e̥s Tschu̦ppli Eier ụụs, wie meh wie lieber, u nd rïehrd s’ grïïsli ch lang. De nn tued mu̦ glịịchvi̦i̦l dï̦rri Broodwïrfe̥lle̥ni im Anken brụụ n rëësten u nd schlaad d’Eier dri̦i̦n. Denn siedet mu̦ e n chlịị n Wasser u nd Zucker z’sämen u nd machd wịịßa Wịị n mid däm Eierwä̆sen u nd Zuckerwasser z’sä̆men heißa.» — Ja, u nd we nn mmu̦ wi̦l l, cha nn mu̦ o ch eppḁs Saffe̥re̥ts 99 dra n tuen. — «‹Sol l de̥r grăd ḁ lsó ei ns aa nrreise n, wie s’ albḁn hein deụ Ggaffee g’machd fï̦r d’s Nï̦wjahr old fï̦r epper Chranks?›» — «Ja, wie hei n sie ’s o ch g’machd ohni Ggaffee! Eh mị n Troost u nd Läbe ntaag!»
«‹Das hed mịịn Änigroosa meṇgist verzelld. Da sịịge n s’ am 498 Morgen nïechter a n d’Arbeit, uf d’s Land old gan hirten, und d’s Mueti hed si ch im Winter z’em Chụụder g’setzt. 100 We nn mu̦ ist schlächt worden, su̦ hed’s ’mu im Pfänni e n chlịị n Milch g’wärmed, u nd d’s Manne nvolch hed en Bitz Chääs mid mu̦ g’nu̦u̦n.
Drum seid mŭ̦ däm no ch jetz eppḁ d’Spiis 101 old Morge ntspịịs. Mu̦ hed v’licht o ch eppa Suppa g’machd und dér Morge ntsuppen ó ch 102 Morge ntspịịs g’seid. Sëlhi Morge ntspịịs hed mu̦ daheimmen eppa um nịịni̦ g’ässen. Vo’ n Fremden hed mu̦ duḁ 103 de n Ggaffee g’lehrd b’chennen und hed ’sen óch aa nfaan nään u nd hed duḁ richtig nịị-meh g’morg ntspịịsed; mu̦ hed duḁ mit dem Ggaffee trịịhe n d’s tĭ̦sche̥niere n (s̆) 104 g’lehrd. Nu̦mmḁ n tued mu̦ das de nn schon am Morgen um fịịfi old säxi im Summer und um säxi old letzli ch 105 halbi sĭ̦bni im Winter. Dḁrmid ist due d’s z’Morgen i’ n Vormittag ụsi g’rị̈ckd, u nd wa mu̦ hed aa ng’fangen, 106 um achti old nịịni i’ n ’s z’Nịịnị 107 u̦f d’Wịịti ụsi z’bringen, is’ ’s duḁ mit dem z’morgnen endle̥fi old zwëlfi worden.›» — «De nn chunnd im Winter um vieri, aber im Summer schon um halbi drịị old drii ’s z’Aaben d.» — U nd we nn mu̦ scharpf z’aabned’s heed, su̦ mag mu̦’s denn wohl erlịịden bis ze’m z’Nacht. U nd we nn mu̦ z’nachtned’s heed u nd mïeda ist, su̦ geid mu̦ ä̆ben nĭ̦der. Aber z’erst 499 ni̦mmen i ch no ch e̥s Chachte̥lli volls vo n frischem Bu̦lver. Miṇ Gott, wie hei n si e ’s albḁn o ch aa ngg’reised, wa d’s Ggaffe trịịhen hie ist ụụfchoon! Sŭ̦mi hein die ung’rëësteten Bohni gsotten und ḁ lsó welle n Ggaffee machen. Andri hein Bohni g’rëësted u nd d’s heiß Wasser uber die ganzen Bohni g’schï̦tted. Die Tĭ̦fige̥rren hei n gwißt, das s mu̦ d’Bohni sëllt mahlen, aber die meisten hei n kei n Mĭ̦hli g’hä̆ben; den n hei n ’s Bohni in en Hŭ̦del p’hackd u nd mid ’nem Hammer g’ni̦tsched.
«Ja, aber we nn mier hei n z’Schuel mïeßen, da hei n mmier ni̦d nu̦mmḁ n ze’n Ässe n’s Maalen eppḁs ’brụụchd. Mier hein ï̦’ ns zwissen inhi sälber Mählte̥ni gmachd; mier hei n G’chï̦̆fel g’gässen old Bohni g’rĭ̦fled.» — «‹Wie ist newwa das e̥s Wä̆sen?›» — «Eh, da hei n mmier schon im Herbst Sï̦wbohni 108 grïennu̦ u nd frischu̦ ụụsg’fĭ̦sled u nd...» — «‹Das wird mier f rịị n e̥s G’chooch...›» 109 — «Ni̦d e̥s G’chooch un d ni̦d 110 e̥s G’chëëch 111 hed’s g’gään! E n selhi G’schicht dḁrmid z’verfïehrren hätte n mier de̥kei n Zịịt g’hä̆ben! Mier hein die Bohni albḁn ei ns ’ddërrd u nd ’braaten, das ist chï̦rzer 112 500 gmachd’s gsịịn. Denn hed e̥s jeders es Hampfe̥lli i n d’Schuel g’nụụn un d dḁrzwissen inhi dra n g’rĭ̦fled, bis nịị-mmeh g’sịịn ist. Denn hed mụ dem Mueti dï̦rr Chirsi g’heisched (s̆s̆), old hed vo’m Herbst naha no ch dï̦rri Mählberre̥ni 113 g’hä̆ben. Und da hed gẹng eppḁ ei ns d’s andra g’fräägd: hest du S’chĭ̦fel im Sack?» — «‹G’hëërst jetz, Zị̈ị̈si, wie mu̦’s mache n mues s, daß’ s ei’m nid weich wird von ei’m Mähli ze’m andren? Chan i ch nid e inmmḁl dier eppḁs anerbieten?›» — Wääger, wääger ni̦i̦d, Chrusti, und desse n sollst du froh u nd z’frĭ̦de n sịịn. Denn, weist, i ch bi n von u ng’sä̆gnete n Lị̈ị̈ten 114 har, wa daheimmen nie gued u nd gnueg z’ässen und z’sụụffen 115 hein. U nd wenn i ch bi dïer ei ns a nfieng, da wellt i ch denn eṇ gueti Stund lang mid Gnu̦u̦s ässen u nd mi ch an dịị’m G’chëëch tĭ̦tschen 116 wie d’Chind, wa an der Nịịdlen ĭ̦hri Schnä̆be̥lle̥ni wetzen. — «Sä̆g ni̦d z’vi̦i̦l, Băsa! e̥s machd me̥r ganz Angst. Chrusti chënnti ja gloïben...» — Ja ja, e̥s ist ḁ lsó! Das geid bi n ị̈ị̈s deṇ ganze n Tag an e̥s inhischoppen und wu̦rggen und wu̦rsten und inhi mu̦llen. 117 Es ist gued, das s i ch mịịn dicka Hoi ptlumpen um haan, su̦st wurdist schon achten, ob i ch nid o ch ḁ lsó e n Mu̦lli 118 sịịg. U nd ze’m mu̦llen g’hëërd de nn rrichtig d’s ahischweihen: d’s schlu̦rpfen und d’s schmatzen und d’s schlappen... 119 — «Schwịịg doch, Băsa, de̥r ch Gotts Willen!» — ... wie d’Fädsche̥ni und d’s laffen und d’s läffe̥lle n wie d’Chatzi... —
«‹Gued jetzen! mu̦ meinti su̦st, was d’ fï̦r n en aalti Chä̆sche̥lla u nd Chä̆fe̥lla 120 sịịgist. Setzid ier e wch jetz no ch n chlịịn, u nd wịịl 121 i ch ĭ̦sse n, tïed ier me̥r e n chlịị n von dĭ̦sem und däm b’richten, wïe n i ch’s sëlli chochchen, das s i ch doch o ch epp’ umhi eppḁs g’rächts heigi. Nu̦mmḁṇ gẹng Brod u nd Ggaffee mag i ch newwḁ n ni̦i̦d, u nd d’s Brod wïrd me̥r alliwịịl ḁ lsó hẹrts wie ne n Tu̦rbenbitz, b’sunders, wen n i ch da ḁ lsó e n vierpfïndigi Mï̦tscha 122 choïffen.›» — «He, choiffid es bätzigs Mï̦tschli 123 old es grëësers Mï̦tschli, wiss’d e̥r, ei ns von denen nï̦̆de̥rre n Tä̆tschbrëtlinen.» — «‹Die chënne n mier gstŏhle n wärden! Da chief 124 i ch no ch grad ehnder bi’n Grä̆belwịịbline n, wa am Ụụfsä̆ge̥t 125 feil hein, ḁ lsó e̥ṇ Ggrä̆belheer old e̥s Ggrä̆belwịịbli 126 old e n Lä̆bschịịba 127 old su̦st eppḁs Ggrä̆bels old 501 G’schnääpers, 128 wie’s d’Zuckerbecken aa nrreisen. Da ist mier denn alba von ’em frischen Brëëtli d’Chappa 129 ( d’s Aanhoui) u nd d’s Weggli old d’s Bï̦ppi, 130 wie d’Chind ’mu̦ sä̆gen, no ch lieber. Aber de nn wird’s me̥r blëtzli ch steinherts. Es ist deṇṇ graad wie die aalteṇ gäärstige n 131 Chuehe̥ni old Chuehibrod...›» — Ja, derru̦ han i ch als Chind o ch no ch g’gässen! Sie hei n mi ch schreckli ch gued dụụchd; warum? Der Gäärstenbeck hed s’ gar gued g’wißt z’hĕbinen (z’heblen, z’hĕben). U nd we nn mu̦ mi ch na ch Chueheni hed ze’r Mï̦li g’schickd, so han i ch u̦f dem Wääg allimal ei ns më̆gen. Sie sịị n fï̦r mi ch grăd gsịịn wie d’Ankfeimchueche̥ni, 132 wa ’mu̦ fịịfi hätti chënnen an en Naadla stecken. — «‹He ja, wie’s die Alte n ghä̆ben hein mit de n wịịßen Brëëtlinen, wa mu̦ bi’ n Chlosterherre n z’Hinderlachchen hed mïeßen gă n rreihen 133 und in Hu̦tten inhaferggen und am Sunntag na ch der Bredig u̦f dem Frịịthof choïffen, we nn mu̦ ei ns fï̦r Chranki hed wellen. Aber wie machen i ch’s mid mịị’m Brod?›» — «Eh! wie d’Walser, wa i ch es Jahr biḁ ne n ’diened haan!» — «‹Wie deen?›» — «Die bachchen ĭ̦hru̦ Roggenbrod sälber un d nummḁ n zwĭ̦ren im Jahr, und doch blịịbd’s ’nen besser und chị̈stiger 134 wa n ’s ‹Bị̈ị̈telbrod› 135 und d’s ‹Wịịßbrod› vo’m Beck.» — Aha! die mache ns d’ru̦m v’licht wie ị̈ị̈sa Ätti u̦f der Alp. Där hed apart e̥s sụụfers Chaste̥lli mid ’mu̦ g’fergged, wa obna und u̦nna chlịịnni Li̦chchle̥ni 136 ghä̆ben heed. Da hed äär d’s Brod inhi ’taan u nd b’schlossen, das s niemmḁn hed dru̦ber chënne n wan äär. Aber wen n epper zue ’mmu̦ choon ist, denn hed er’s fï̦rha g’gään u nd g’seid: Nä̆hmid, was e̥r nu̦mmḁ n mëgd, aber lääd me̥r bi’m Sackermä́nt de̥kei ns Brëëse̥lli umha llĭ̦gen! Aber weist was, Chrusti? Wiil mer jetzeṇ grăd ḁ lsó am ụụsbroote n 137 sịịn, su̦ wil l i ch de̥r no ch meh bb’richten am heiligen Aaben d? — «also i n vier Tăge n!» — we nn d’ de nn zue n is willt choṇ ga n d’Milchbrochcha ässen. Elisi, du geist denn na ch wịịßes Brod! 138 Mier hei n ja jetz fịịf Becken iṇ Grindelwald deṇ Gletschren bịị, und wär weis s, wie vi̦i̦l Brodablaagi. Du chajst gaan, ze wäm d’ willt, mier a n ze’m... (forschender Blick). — «‹Aber mịịn Haagge nllëffel 139 wirden i ch mï̆eße n mid me̥r nään; i ch weiß ni̦i̦d, fï̦r wän ier ewwa dritta g’sparta heid.›» — Oh, dä n laan du̦ nu̦mmḁ n rïewig daheimmen! — «Aber 502 und de nn d’s Chŏsi, Băsi, wa du̦ gẹng vo n ’mmu̦ bbrichtist?» — Gidult, Meidschi! Das chunnd denn na ch’m Nïwjahr, wenn der Gä̆bel und der Chï̦nig g’chalb’red’s hein u nd d’Hïender umhi aa nfää n llĕgen. — «‹Wie ist newwḁ das e̥s Wä̆sen dármid?›» —
«He, da nimmd mu̦» — «‹wie i n d’s Elisis Chochbuech, wa n i ch ei ns fï̦r n e n Rëësti han ụụfgschlăge ns g’sehn›» — «ier Bëësa! mu̦ nimmd (i ch will’s jetz grad ä̆xbrä̆ß ḁ lsó bbrichten) frischi Chïehmilch u nd tued die wellen. We nn s’ erwallni ist, tued mu̦ lind’s Brod» — «‹ dekeiṇ Gru̦sta?›» — «neei, Chrusti! nu̦mmḁ n vom linden inna ụụsa, dri̦ n rïehrren, e n Vierlig 140 u̦f zwee n Liter. Wenn das z’säme ng’chochcheds ist, su̦ schlaad mu̦ fịịf Eier» — «‹wie mẹn’g’s?›» — «eh, fịịfi! dri̦n ụụs u nd tued en halba Liter gueti Nịịdla drŭ̦ber.» — «‹Eh, d’s Herrschaft! das ist ja n e̥s Ässe n wie jung Mị̈ị̈s!›» — U nd fuehrigs! Das vermachd deen! Aber no ch e̥s Brịịse̥lli Salz draan hest vergässen, Meidschi. — «Aber und de nn d’Ankfeimchuehe̥ni z’Wiehnachten? Da wollt dẹich Chru̦sti o ch dḁrvon haan, old wollt er ’se̥n ächt sälber machen?» — «‹Eh, es ist ums fecke n z’tuen! Sägid ier nu̦mmḁ n, wie!›» — Jä, hest e̥s Brätzel-Ịịsen? — «‹Oh, eppa umha in ’e̥m Ggrï̦mpelgä̆dmer...›» — wird wohl ei ns sịịn! e̥s sëll ja su̦st in je gl ihem Hụu̦s ei ns sịịn. Weist was: chumm du̦ denn z’Wiehnachten oo ch! Da mache n mier’s deṇṇ grad na ch d’s Änigroosis Manier. D’s gäärstig Mähl mïeße me̥r de nn richtig 141 jetz eppa umha trachte n z’choiffen. De nn mmache n mier Gäärste nchuehe̥ni u nd tïen Ankfeim 142 dri̦i̦n, daß, we nn mu̦ mit der Fụụst u̦f de n Ti̦i̦sch schlaad, ḁ lsó es Chuehi vor Mï̦rwi zertrooled. So mu̦rwi u nd so sprï̦tzigi hei n sĭ̦ sĭ̦ albḁ gmachd. Scho n we nn mu̦ ei’m de n Rï̦gg 143 hed dänna g’nu̦u̦m, is’ ’s zerfahren.
«Aber moor gen, Băsa, wa’s Sunntăg ist u nd Chrusti im Na chmittag fu̦rt wollt, was hed er dénn?» — «‹Oh, das ist flu̦gs g’rächched’s! Da machen i ch me̥r Brodschni̦tti u nd Ggaffee, und dármid hăn i ch g’gässe ns.›» — Das gi bd ja richtig weniger z’tue n wan eppḁ Epfel- old Bĭ̦re nchïechle̥ni, old Schlị̈ị̈ffe̥rle̥ni old Chrïge̥lle̥ni — «old Grăswï̦re̥m, old Chnewchïechle̥ni, wa mu̦ an der Făsnḁcht 144 machd.» — «‹Und den n is’ ’s no ch besser, wan e n Tanggel, wa wollt e n Tä̆tsch 145 heißen.›» — «Oh, das machd ei’m, wa nịịd dḁrvo n b’chennd, nid vi̦i̦l! B’sunders, we nn mu̦ ei ns cha nn g’schẹnten, wie ị̈ị̈s’s Brïederli, wa alba g’sungen heed, weist no ch wie?» — 503
Wem iisi Mueter chiechled,
Su bin i’ra nie wiit,
U wenn i’ra eis erwitschen,
Su gid s’mier mit dem Schiit.
[oder: Su chitzled sa der Giit.]
U wenn i’ra gan ga chlagen,
Es tiej mer griisli weh,
Su nimmd si mi bi’m Chragen
[oder: Su nimmd si d’Ofengabla]
U ggid mer no viil meh.
«Aber wär nid cha nn chïechlen, chan n o ch ni̦d Brịị machen, daß d’s Mähl ni̦d g’chnŭ̦blebs 146 blịịbd.» — Da gi bd’s den n en alta tumma G’spaß; mu̦ seid von eppḁs, wa ni̦d z’machen ist: 147 den Brịị tecken u nd b’stẹndig stëërren. 148 «Aber wär nid chan n Brịị machen, chan n o ch nid Pălä́nten, 149 und das ist fï̦r beedi schaad.» — «‹Aber wie machid ier de nn d’s Meis?›» — Aha, ä̆ben, du seist jetz Meis; frïejjer ist das Wort vi̦i̦le Lị̈ị̈ten nid chï̦nd’s gsi̦i̦n. Ei’m, wa verbbrichted heed, da sig Eina Totz uber Meis 150 trooled, hed en andra g’rị̈efd, ob äär denn nid chënni sä̆gen: Totz uber Pălänten! Und en Andra, wa bi’m Chräämmer e̥s Gï̦̆ntli 151 Schulden hed welle n b’săhlen, hed ’mu̦ bi’m ablä̆sen im Bïechli dri̦i̦ n g’redt: Pălänte n wohl, die bin de̥r schuldig, aber Meis, old wie du̦ da lăferist, bi’m Tonnder dekei n Vierlig! — «‹Aber en andra, ganz en aalta Einsidler, heig von beeden Nä̆men bloß eina g’hëërd sä̆gen. U nd wa n er ei ns heigi des Zị̈ị̈gs g’chochched, heig n en newwer g’fräägd, was är da chochchi. Duḁ heigi där g’seid: Pălänten old Stŭ̦dänten, i ch weiß nid, wä̆ders. Mu̦ tued’s ei nmmḁl mid Chääsmilch aa nsï̦de̥rren. Aber ist denn das ḁ lsó rächt g’sịịn?›» — Da gib du̦ ’mu̦ u̦mhi B’scheid, Elisi! — «Eh neei! Wenn ier ru̦ ze’m tische̥nierre n wolltid haan, su̦ mïeßt ier si am Aaben d mid chochchigem Wasser» — old no ch besser mid g’fị̈ị̈riger Milch — «anbriejjen u nd Salz und e n Milchlëffel volla Si̦melmähl dra n tuen, u nd s’ tecken. Deṇṇ gaa n s’ ụụf uber d’Nacht. Am Morge n tued mu̦ sĭ̦ denn i n Schmalz 152 und Anken braaten u nd tued, we nn mu̦s heed, no ch es Ei draan.» — «‹Aah! Drum ist das im Wallis ḁ lsó gued g’sịịn ze’m z’Morgen am Sunntag! U nd b’sunders, we nn s’ denn no ch hein Nịịdla d’ru̦ber g’schï̦tted u nd mu̦ das na ch der Suppen hed ze’n Härdepflen u nd ze’im Chääs g’gässen, su̦ hätt de̥kei n Mensch dem Fleisch eppḁs naa chg’fräägd, we nn’s scho n wä r da gsịịn. Ḁ lsó 504 scharpf fuehred das!›» — E n chlịịn besser, wan u̦f der Alp, we nn mu̦ mues gă n lischnen 153 old brụụhen 154 un d nu̦mmḁṇ grad, we nn mu̦ hed de n Zï̦̆ger ụụsag’nu̦u̦n, es băr chaalt g’sotten Härdepfla im Fị̈ị̈re wärmed. — «Oh, under der Alp hei n si ’s denn umhi besser, we nn d’s Wịịbe rvolch im Ụụstăg Garte nzị̈ị̈g u nd Siwstị̈̆de̥ller 155 und im Herbst Rïeble̥ni u nd sụụr Epfla z’sä̆me n chochched.» — «‹Old es Stu̦nggis von Härdepflen und Epflen und Bi̦re n wie i’ n chlịịnne n Kantëënen!›» 156 — Aber dï̦rr Bĭ̦ri mid blääjter Nịịdle n sị n wóhl no ch besser! — «Und Gomfitị̈ị̈rra, mache n s’ die nid oo ch? U nd Heitimues? 157 U nd Grịịflenbrịị? 158 Das ist eppḁ gued, we nn d’Berre̥ni sụụfer zsä̆me ng’läs’ni sịịn u nd nid zertrŏse̥ti u nd verschmaarse̥ti u̦s dem Wald chëmen, daß alls ei ns G’schmaars u Gschmŭ̦sel ist.» —
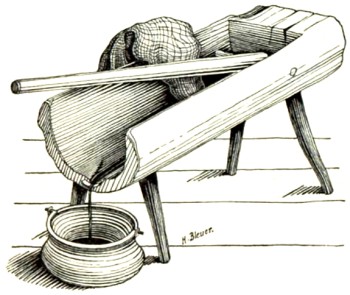
Chirsmuesstuehl.
U nd Chịrsmues? Dịị’s Mueti hed ja o ch g’chĭ̦rsmuesed old churz g’seid: g’muesed. — «‹Wie machid mu̦ denn das?›» — Mu̦ wärmed d’Chirsi (ohni Wasser) in der Pfannen u nd tued su in dä n Chirsmuessack, wa en El le n lẹnga und obennahe en Halbel len breita und u̦nna spitza ist. Mu̦ hed ne n frị̈ejer o ch ’brụụchd fï̦r d’s Hụṇ’g u̦s de n Wăbe n z’ziehn. Mit dem Chirsmuesstuehl 159 cha nn mu̦ d’s Saft alls sụụfer ụụstrï̦cken. De nn chunnd d’s Saft in ’em Chupferchesse̥lli fịịf old säx Stund uber Glued (ohni Fị̈ị̈r) u nd wird b’stẹndig gstëërrd. U̦sse n wịịl mu̦’s machd, g’hịjd mu̦ en Bitz Späck i n d’s Saft, daß ’s nid anhẹihi; 160 u nd de nn wird’s dicks u ziehnd’s, daß es si ch laad mit dem Mässer strịịhen. De nn tued mu̦ das Zị̈ị̈g i n Chirsmueshăfen u nd schï̦tted Rhụụm old heißa Anke n d’ru̦ber, daß ’s lẹnger gued blịịbd. — «‹Mier ist de nn richtig e̥s Äärbsmues old e̥s Mues vo n Fleisch und Hăber no ch lieber.›» — Jä, da g’sehd mu̦ umhi: jungs 505 Fleisch und alts Fleisch tïen 161 nid z’sä̆me n sieden. Du weist, Elisi, was das wollt sägen. — «Eh ja: daß die alten und die junge n Lị̈ị̈t in gar mẹngem nid z’säme n passen.» — Das ist ze’m Bịịspi̦i̦l o ch der Faal, wenn der Alt e n Spaarer ist und hụụse n wollt und der Jung eṇ Gị̈ị̈der, wa gẹng wëllti ab der Wurst nään, 162 fï̦rs mit den Andren nŏbel z’gään. — «‹Es ist wohl eppa besser, we nn mu̦ si ch nid an eppḁs nï̦w’s laad, wa mu̦ doch ni̦d versteid, und wa ei’m nịịd versteid. 163 Da tẹihen i ch gẹng an dän Bueb, wa sịị n Att mid ’mu̦ ga n Thun ahi ist. Dert hed d’r Att im Wirtshụụs en Gast g’sehn eppḁs ässen, wa n äär ’mu̦ kein Năme n gwißd heed. Är hed g’fräägd, u nd sie hei n mu̦ g’seid, das sịịge n ’braate n Chrẹbsen. Är hed bifŏhlen, sie sëlle n ’mu̦ o ch es baar bringen. Sie hein n e̥ṇ gued ’dụụchd, un d är hed ei nmmḁl sị’m Suhn o ch eina i n sịị’s Blätte̥lli g’leid. Aber där hed n e n wịịt vo n ’mmu̦ dänna gstooßen u nd gseid: Neinis bi’m Tonnder ni̦i̦d, Atti! Friß du die Guege n sälber u nd ggi b mmie̥r eppḁs von Här depflen!›»
1
Christian.
2
Haushälterin, Magd.
3
Mittagsmahl:
S. 498.
4
ób ächt? = wirklich?
5
Ein rechtes Durcheinander.
6
Lang in der Pfanne herumgezogene und unschmackhaft gewordene Speise.
7
Es so aushalten.
8
Am wahrscheinlichsten.
9
Walliser.
10
Unterland.
11
Die gelegentliche Synonymenhäufung entspricht der Tendenz, in diesen Abschnitt sonst unanbringbare wertvolle Idiotismen einzuflechten.
12
Jedenfalls.
13
Kurzerhand.
14
Tags vorher.
15
Alles svw. «soeben».
16
Dieser.
17
«Angedrückt»:
pressé, pressiert.
18
Das nächste Mal.
19
«Alle Augenblicke».
20
Vielleicht.
21
Manchmal.
22
Bemerke s’ =
illa, sa =
illam.
23
Zweimal.
24
Am Tag darauf.
25
Häufig.
26
In rascher Abfolge sich wiederholend; vgl.
GlM. 95.
27
Hie und da.
28
Wiederholen.
29
Über Jahr.
30
Was «mir an» (an mir) liegt = meinetwegen.
31
Diesen Abend, diese Nacht.
32
Bereit zu hören.
33
S. 376.
34
Jeweils.
35
Rieche.
36
Plaudertasche.
37
Unbrauchbar werden.
38
Geplappert.
39
Ummittelbar.
40
Ablassen.
41
Nütze
42
Ergänze: Mal.
43
Auf die Länge.
44
Im Emmental: Wi alt u wi tüür.
45
In der Regel; aber auch: künftig.
46
Constructio ad sensum.
47
Nachträglich, hintendrein. Mit «
bi des» vgl. «indes(sen)».
48
Gleichwohl.
49
Nach Verdienen ergehen.
50
Launisch.
51
Nämlich Milch.
52
Suppe.
53
Feste Speise.
54
Guten Sinn.
55
Mittlerweile, unterdessen; vgl.
GlM. 95.
56
Letztjährigen.
57
Hagringe:
S. 259.
58
Wie fz.
en:
S. 299.
59
Kosten.
60
Da! nimm!
tiens!
61
Ergänze: eßbar finden (
S. 120).
62
Üblen Beigeschmack.
63
«Zu stark»: zu scharf.
64
Diese, solche.
65
Genießen (
frui:
S. 238).
66
Zu wenig gewürzt.
67
Fade.
68
Ohne Geschmack.
69
In Gebrauch genommenen und nicht gereinigten.
70
Merken und «sich hinter die Ohren schreiben».
71
Nichts wolle gelingen.
72
Sich als «böse» erweisen.
73
Alles «svw. bald»; auch «plötzlich» ist = «bald»; vgl. z. B.
är hed es Chind, bletzli zwei.
74
Ebenfalls = bald.
75
Sofort, sogleich.
76
Wählerisch, «schnäderfrääsig».
77
Appetitlos im Mund herumwälzen.
78
Nachher, nachmals.
79
Die Bedeutungsentwicklung vom mhd.
ringe und
geringe: leicht und damit behende, mit keiner Mühe verbunden und darum rasch, schnell (abverbial und attributiv), schließlich: ohne Gewicht und Wichtigkeit, «gering»: vgl.
Kluge 135.
80
Susanna.
81
Plätschernd umrühren.
82
Nicht damit fertig werden.
83
Ungefähr wie Note 76.
84
Saugzapfen.
85
Nagen.
86
Bien dîné.
87
Seither.
88
Kümmelgeist.
89
Kräut. 103.
90
Vorgelesen.
91
Beitrag zu Note 79.
92
Cacao.
93
Holzstab als Milchkesselträger.
94
Masche.
95
Am tragenden Halbring.
96
Bringt, veranlaßt sie zum Sieden.
97
Zu substantiell.
98
Patinnen und Paten.
99
Safran.
100
S. 476.
101
S. 382.
102
Ebenfalls.
103
Aldann, nachmals; nämlich etwa um 1860.
104
Déjeuner.
105
Spätestens (
last-ly).
106
Vgl. dieses plastisch gebliebene «angefangen» mit dem mechanisierten
aa(n)faan, afan, afen (augmentlos wie «funden», «laan» = lassen = gelassen usw.).
107
Neunuhrbrot.
108
S. 263.
109
Kocherei,
cuisage.
110
Weder — noch.
111
Gemüse.
112
Eher.
113
S. 188.
114
Starken Essern.
115
Zu trinken:
S. 257.
116
Sich’s dran wohl sein lassen.
117
Immer neu nachschiebend den Mund übervoll stopfen.
118
Person a) mit allzeit gestopftem und daher des Sprechens unfähigem Mund; b) mit Pausbacken; c) von beschränkter Intelligenz. In Frutigen: der Moli.
119
S. 343.
120
Plaudertasche.
121
Wiil und
wil vermischen sich.
122
Schwarzbrotlaib von 2 kg.
123
Milchbrötchen für einen Batzen (zehn Rappen).
124
I chifi (emmenthalisch: i chüf), i sieg, i miechi:
j’achèterais, je dirais, je ferais.
125
Alt für Schulexamen.
126
Bachwerkfiguren.
127
Lebkuchen.
128
Kleinkram.
129
Der Anschnitt.
130
Der knorrige Kohlensäureaustrieb.
131
Aus Gerstenmehl mit allfälligem Zusatz von getrockneten und fein zerriebenen Kartoffeln, wohl auch von gebratenen und zu Mehl zerklopften Ackerbohnen. Solches Brot buk man noch vor 30-40 Jahren. Das
«churz» und buchstäblich «schwarze» Brot schmeckte natürlich derb, aber sehr gut.
132
S. 396.
133
Wyß 620.
134
Schmackhafter.
135
Aus gebeuteltem Mehl.
136
Löchelchen.
137
Ausplaudern.
138
Der Akkusativ enthält das in «nach» mitgedachte «holen gehen».
139
S. 393.
140
1/
8 kg.
141
Allerdings.
142
Bodensatz zerlassener Butter.
143
«Rücken», Anbruch (Anschnitt).
144
Lf. 508 ff.
145
Pfannkuchen.
146
Knollig.
147
Vgl. Sägemähl zusammenknüpfen u. dgl.
148
Umrühren.
149
Ergänze: kochen. Man bemerke auch die Umdeutung der weiblichen Einzahl von «Palänta» als Mehrzahl.
150
Kopfüber:
S. 178.
151
Petit compte.
152
S. 340.
153
S. 283.
154
S. 284.
155
Löwenzahn.
156
Z. f. hd. Ma. 3, 38;
Lf. 506.
157
S. 190.
158
190.
159
S. 473.
160
Auf dem Boden ansitze.
161
Bemerke diese Pluralformen des Präsens im Indikativ, Konjunktiv und Imperativ mit Umlaut, gegründet auf die Otfriedischen (fränkischen) Formen
duen, duet, duent usw. (Braune, ahd. Gr. S. 265). Sie sind unterbernisch auch in’s Supin vorgedrungen:
z’tüe(n).
162
Vom angelegten Kapital zehren.
163
Nützt.

Das Plampi, Chindsplampi.
(Kinderschaukel mit beweglichen Spielkugeln.)
Aus 1. Hälfte 19. Jhd.