
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Kiebitzhof, Ende Februar.
Bester Peter!
Dies ist der erste Brief, den ich Dir als Gutsbesitzer schreibe. Ich fange nämlich an mich zu fühlen. Donnerwetter noch 'mal: Jetzt bin ich doch was! Ich habe ein Dach über meinem Kopfe, und das ist mein Dach; ich habe Wald und Feld und Wiesen im Umkreis meines Blickes, und das ist mein Land. Sogar der Schnee, der jetzt darauf liegt, bild' ich mir ein, ist mein Schnee, und der graue Himmel darüber her ist mein Himmel, und wenn der Sturm in mein Gebiet fegt, thu' ich sehr pikirt und drohe mit der Gutspolizei.
Es ist ein wunderbares Gefühl, auf Eigenem zu stehen. Das allein ist fester Stand. Und wenn ich in einem Prachtpalast wohne: ich habe doch das Gefühl, nur der Geduldete zu sein. Aber im eigenen Hause, das im eigenen Garten steht, der im eigenen Gelände liegt, – Du, da kriegt man ein Wohlgefühl, ein Freiheitsgefühl, da ist es, als würde Alles stark und stolz ich sicher in uns, und wir spielen innerlich ein Bischen mit Szepter und Krone und Stern, wenn's auch bloß die Mistgabel, der Dungeimer und die Kuhkette ist.
Wem bin ich Vasall? Der Erde, die ich beackere. Wem beuge ich mich? Dem Himmel, bei dem die Herrschaft über mein Land ist. Woran glaube ich? An den Keim, der im Korne ist. Was ist mein Gesetz? Daß ich mich rühren muß. Was ist meine Lust und mein Lohn? Dasselbe!
Halt! Daß Du mir diesen Brief keinem Landwirth zeigst! Er würde sich den agrarischen Bauch halten vor Lachen und würde von den neuen Besen reden, die gut fegen, und würde Dir eine Kehrseite meiner Medaille zeigen, daß Du zurückschaudern würdest. Denn das habe ich auf Besuchen bei meinen Nachbarn bemerkt: Wer nicht als Grünling in der Oekonomie gelten will, muß brav schimpfen auf die Oekonomie. Das ist so eine Art Gesundheitsregel, glaub' ich, und man scheint sich sehr wohl dabei zu befinden.
Bei mir ist der Ueberschwang wohl erklärlich. Ich, ein Bibliotheksbeamter, schüttle plötzlich den Bücherschimmel von mir, lüfte meine pergamentisch angestockte Seele und blase mit jedem Athemstoße meine Lunge rein von Moderstaub. Da läßt sich's denken, wie hoch mir die Brust geht. Anfangs war mir's, als flögen die gelbgrauen Bazillen der Buchstabenwelt sichtbarlich von mir, wenn der Hauch aus meinem Munde ging, und mir war es völlig zu Mute wie einem Rekonvaleszenten, der zum ersten Male die dumpfe Krankenstube verlassen und reine Luft athmen darf. Mir wurde sogar etwas schwach davon, und ich fragte mich: wirst du soviel Gesundheit auch aushalten?
Die Krankheit wird den Stadtmenschen ja fast zum Bedürfniß, und es ist kein Zufall, daß sich so viele Leute mit Krankheiten interessant zu machen versuchen und mit diesem Versuche Erfolg haben.
Und im Grunde bin ich doch noch Stadtmensch, natürlich. Das zeigt sich vor Allem in der stark skizzenhaften Art, wie ich die Landwirthschaft betreibe. Wenn nicht das tüchtige Paar Hans Jörg und Christiane wäre, es sähe sehr übel aus um den Kiebitzhof. Ich throne zwar, aber die Beiden regieren. Gottlob, daß es Winter ist. Hätte ich die Herrschaft von Kiebitzhof im Frühjahr oder Sommer antreten müssen, – ohpopoi, sagten die Griechen.
Christiane scheint übrigens von der Tante auf den Mahnposten kommandirt zu sein. Wäre sie klassisch gebildet, sie würde mir zum Morgenkaffee feierlich zurufen: Herr, gedenke der Heirath. So kleidet sie denselben Gedanken etwa in folgende Worte: »Jo, do wär nu wingstens a Frau gutt!« oder »Später gitt's wohl besser, wenn a Frau do is«. Wenn ich dann sage: »'s kommt keine Frau, Christiane!« dann zieht sie bloß ihren Mund breit und grinst verschmitzter, als ich es ihr jemals zugetraut hätte.
Soviel ist gewiß: für voll werde ich in meiner Unbeweibtheit nicht angesehen, und es sieht ganz so aus, als duldete man diesen Zustand nur in der ganz bestimmten Voraussetzung, daß ich ihm über kurz oder lang ein Ende machen werde.
Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß mich das nicht im Mindesten berührt. Ich werde den Leuten zeigen, daß es auch so geht und daß ich Niemand beiße, auch wenn ich keine Frau habe. Denn das ist ganz besonders merkwürdig: weil ich keine Frau habe, betrachten mich die Leute in erster Linie auch mit scheuen Augen und als ein bedenkliches Stück Mensch. Ich habe was Monströses für sie, und es fehlt ihnen die rechte Brücke zu mir. Aber das wird sich schon noch geben. Es ist nur das Ungewohnte. Du siehst: wo die Macht beginnt, und habe sie auch nur ein ganz kleines Bereich, wie in meinem Falle, da beginnt auch ein gewisser Zwang von unten nach oben. Ich bin den wenigen Leuten auf Kiebitzhof der »Herr«, und diese guten Leute, die ganz unberührt von den Emanzipationsideen ihrer Standesgenossen in den großen Städten sind, erblicken in mir ohne Widerspruch denjenigen, der ihre Geschicke leitet; sie gehören mir, sind mir in ihrer Seele noch hörig, ohne daß das verbrieft und versiegelt wäre; sie wissen das gar nicht anders. Aber: ich gehöre auch ihnen. Das empfinden sie natürlich nicht klar, und das formuliren sie sich nicht als eine rechtliche Forderung, die sie an mich haben, aber das steht bei ihnen als selbstverständliche Voraussetzung fest.
Ein patriarchalisches Verhältniß ist auch thatsächlich anders gar nicht zu denken. Wo die gegenseitige Zugehörigkeit ein Loch kriegt, fängt das Verhältniß vom »Arbeitgeber« und »Arbeitnehmer« an, dasjenige Verhältniß, aus dem, wie mir scheint, das sozialdemokratische Begehren ganz von selbst erwächst. Deshalb... aber um Gottes Willen, wo gerathe ich hin! Ich wollte doch wahrhaftig keine sozialpolitischen Ideen zum Besten geben. Ich setzte mich nur hin, mit Dir zu plaudern, weil ich mich offen gestanden, schon ein Bischen langweile, und weil ich Dir gerne einen kleinen Einblick in die Empfindungen geben wollte, die mich jetzt, wenn nicht beherrschen so doch beschäftigten. Ich bin, es kurz auszudrücken, in einer Art von Mauser. Halb noch Stadt- und Bibliotheksmensch, halb aber auch schon Landmensch, Freiluftmensch. Viel weniger Grübler und Kritiker als bisher, aber doch noch nicht ganz Zugreifer, Schaffer, – Bauer.
Dreierlei liegt vor mir: entweder zurück in die Stadt, natürlich nicht mehr als Gelehrsamkeitsbeamter, aber vielleicht als eine Art lebendiger »Beobachter an der Spree« (Du verstehst mich!); oder: stillbeschieden hier geblieben, Kiebitzhofbauer, Schollensasse (wobei ich aber nicht die Perspektive geistigen Stillstandes und die Verabschiedung aller literarischen und künstlerischen Neigungen vor Augen habe); und schließlich: ein Leben auf der Grenzscheide: bald Besuch hier, bald Besuch da, Commis-Voyageur einer zwiespältigen Lebenskunst zwischen zwei Stationen.
Ich werde mich für Nummer Zwei, für das gute Mittelstück entscheiden, ich werde kiebitzen. Berlin mit seinem gräulichen, stillosen, unorganischen Parvenucharakter, diese Stadt des großschnauzigen Talmithums und des schnellfertigen Absprechens, in der sich die paar wirklichen Berliner (ein prächtiger Schlag) am unwohlsten fühlen, lockt mich nicht. Dort wohnen müssen, ist ein Unglück, dort wohnen wollen ist eine unbegreifliche Verirrung. Von Zeit zu Zeit einmal in seinem Getriebe unterzutauchen, sich die Sturzwellen seines vielgestaltigen Lebens über Brust und Kopf gehen zu lassen, während man sich sonst dem lauten und leeren Getriebe klüglich fern hält und seine Seele procul negotiis aussömmert, wäre vielleicht ein annehmbarer Compromißvorschlag, aber doch nur für solche, die von Natur aus halb und halb sind und an der modernen Fahrigkeit leiden, die man Nervosität heißt. Ich habe den kleinen Verdacht, daß ein solches Nomadenleben ohne rechten Heimpunkt eine Seelenunstätigkeit erzeugt, die kaum geeignet ist, einen Charakter zur richtigen Reise zu bringen, aus der allein was Rechtschaffenes werden kann. Dos moi pu sto, – das gilt nicht blos für die Mechanik, das gilt auch für die Lebenskunst. Wenigstens für uns, bei denen das Zünglein der Lebenswaage schon hinüberschwankt in die stille Gegend, wo langsam der Pfad sich in's Dunkel verliert.
Holla! Peter, gieb mir einen Rippenstoß! Nimm' mich bei den Ohren, Peter, wie einen Sextaner! Setz' mich Einen runter in Deiner Werthschätzung!
Du hast's doch gemerkt? –:
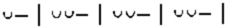
.... wo langsam der Pfad sich in's Dunkel verliert.... Erkennst Du das Paradigma:
Wenn der Hund mit der Wurst über'n Spucknapf springt...?
Peter, – es verselt!
Das ist, beim Himmel, bedenklich, und Du wirst lange Dein knabenerzieherisches Haupt schütteln, wenn Du vernimmst, daß ich jetzt des Oefteren von ganzen Schwärmen zappeliger Daktylen, Anapäste, Trochäen und ähnlichen Gelichters überfallen werde, das ich längst aus meiner reinen Seele vertrieben wähnte, seitdem ich zum letzten Male mit brandfuchsischem Fanatismus skandirt hatte:
| Ach Eines, Eines weiß ich nur gewiß: Es ist mein Herz voll eitel Bitterniß. |
Du hattest damals die Güte, darauf »Verschiß« zu reimen und mich einen Ganzen trinken zu lassen.
Beim Hohen Kösener! – es waren doch schöne Zeiten, als wir die dunkelrothen Mützen trugen und jeden Finken für ein zweifelhaftes Subjekt hielten. Was für wundervolle dumme Jungen sind wir gewesen! Wie köstlich undifferenziert, lebfrisch aus einem Gusse, – ein Bischen landsknechtshaft roh und bedenklich alkoholbeflissen, aber jedennoch: so glücklich, so derb glücklich.... Ich fürchte, heute sieht's in den Corps nicht mehr so glückhaft aus.
Nun aber Schluß! Ich, so gerne ich mich als überzeugten laudator temporis acti bekenne, will denn doch nicht vergessen, daß ich jetzt eigentlich erst zu leben beginne, denn jetzt erst bin ich ja frei geworden.
Wollen sehen, was mit seiner Freiheit anfangen wird
| Dein stets getreuer |
|
| Pankraz. |