
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wenn wir einen Blick auf unser Landvolk werfen, so sehen wir, dass überall eine einzelne Persönlichkeit sich aus der Gruppe der Gaugenossen hervorhebt, welcher in allerlei Nöthen und Gebresten des Leibes und nicht selten auch der Seele das allgemeine Vertrauen entgegengetragen wird. »Er kann mehr, wie Brodessen,« lautet in Deutschland die ständige Redensart und es ist damit für jeglichen Eingeweihten deutlich ausgesprochen, dass demselben, ganz abgesehen von einem höheren Wissen und Können, auch noch übernatürliche Kräfte innewohnen und dass er mit übernatürlichen Gewalten in unmittelbarer Beziehung steht. Ganz das Gleiche finden wir auch bei den Naturvölkern, nur dass hier ganz offen zu Tage tritt, was in unserer modernen Volksmedicin mehr oder weniger verstohlen sein Dasein fristet. Damit ist es nun natürlicher Weise aber nicht ausgeschlossen, dass man in Kleinigkeiten sich selber hilft, und es wird uns dieses von den Eingeborenen Süd-Australiens auch noch besonders bestätigt. Wenn aber Jagor von den Igorroten der Philippinen und von Rosenberg von den Mentavej- und Aaru-Insulanern und von den Einwohnern von Dorej an der Südwestküste von Neu-Guinea berichtet, dass es besondere Aerzte bei ihnen nicht gäbe, sondern dass ein Jeder sich selber hilft, so müssen wir hierfür wohl doch erst noch eine genauere Bestätigung abwarten. Es widerspricht das so sehr der menschlichen Natur, und wir sehen selbst bei den culturell so tief stehenden Australnegern einen wohl ausgebildeten ärztlichen Stand, so dass es mir doch der Wirklichkeit mehr zu entsprechen scheint, wenn wir annehmen, dass es den genannten Reisenden zufälliger Weise nur an der günstigen Gelegenheit gemangelt hat, die Aerzte in Funktion treten zu sehen, und dass sie desshalb auf einen gänzlichen Mangel derselben irrthümlich geschlossen haben. Es widerlegt sich übrigens nach wenigen Absätzen von Rosenberg schon selber, wenn er von den Doresen sagt:
»Priester giebt es nicht, wohl aber Zauberer, welche Beschwörungen machen, Zaubereien verrichten und Kranke heilen.«
Deutlicher kann das Vorkommen eines besonderen ärztlichen Standes doch wirklich kaum bestätigt werden.
Bei den Weddah, den wilden Ureinwohnern von Ceylon, gehen Paul und Fritz Sarasin so weit, dass sie ihnen überhaupt jegliche Spur medicinischer Kenntnisse absprechen und dass die Fälle, die das Gegentheil beweisen, ihre Erklärung darin fänden, dass hier der Verkehr mit Tamilen und Singhalesen den Weddah diese Kenntnisse übermittelt habe. Auch hier liegt wahrscheinlich ein Irrthum vor; denn gerade die angeführten Maassnahmen (Benutzung von Rinden und Auflegen von Blättern), welche den Beweis dafür liefern sollen, dass die Weddah sie von den Tamilen und Singhalesen erlernt haben, stellen so elementare Gedankengänge dar, dass wir sie bei den verschiedensten, auch ganz tiefstehenden Naturvölkern wiederfinden und dass wir daher, wie mir scheinen will, durchaus nicht genöthigt sind, sie bei den Weddah als etwas von anderswoher Ueberliefertes anzusehen. Denn auch dem primitivsten menschlichen Geiste wohnen diese Gedankengänge inne.
Die Krankheiten werden, wie wir oben ausführlich erörtert haben, überwiegend als veranlasst durch überirdische Wesen angesehen. Es ist in Folge dessen ganz naturgemäss und logisch, dass man Hülfe und Heilung in Krankheitsfällen nur von solchen Menschen zu erwarten berechtigt ist, welche in den Besitz von übernatürlichen Kräften gelangt sind, welche im Stande sind, mit den betreffenden Geistern, seien es nun Gottheiten, Ahnengeister oder Dämonen, in unmittelbaren Verkehr zu treten, ihren Willen und ihre Absichten zu erforschen, ihren Zorn zu besänftigen und ihren Unwillen zu versöhnen, oder auch sie zu bannen, sie zu verjagen und ihrer Herr zu werden. Nun ist die Krankheit nicht das einzige Ungemach, das dem Menschen zustossen kann. Man will aber vor jeglichem Unglück geschützt sein, man will Erfolg und Gedeihen in seinen Unternehmungen haben, Segen im Landbau, reiche Beute auf der Jagd, Glück im Kriege, und in Folge dessen muss man ernstlich bemüht sein, mit den überirdischen Gewalten, den Segenbringenden sowohl als auch den Verderblichen, in gutem Einvernehmen zu verharren. Der eigenen Kraft vertraut man nicht. Wiederum bedarf man dazu einer mächtigeren Mittelsperson, und da kommen nun natürlicher Weise in erster Linie wieder diejenigen Personen in Betracht, deren übernatürliche Fähigkeiten, deren Beziehungen zum Reiche der Geister Allen bereits hinreichend bekannt sind.
So erklärt es sich in einfacher Weise, dass wir bei den Naturvölkern ausserordentlich häufig die ärztlichen und die priesterlichem Funktionen in denselben Händen sehen. Es ist der Arzt, der die priesterlichen Verrichtungen übernimmt, oder der Priester, welcher die Kranken heilt; denn die Behandlung der Kranken wird zum Gottesdienst und strenge, rituelle Vorschriften sind mit ihr verbunden. Der Verkehr mit den Geistern ist im Sinne der Naturvölker ja ein Gottesdienst. Denn auch die Dämonen können segenbringend wirken, wenn man sie sich zu verbinden vermag, damit sie dem Feinde Verderben bringen. Und der Arzt und Priester, der sie hierzu veranlasst, wird auf diese Weise gleichzeitig auch zum Zauberer. Und zum Seher und Wahrsager wird er, wenn ihm die Geisterwelt die Zukunft offenbart, ihm die Jagdgründe anzeigt, wo dem hungernden Volke sich reiche Nahrung bietet, und ihn vorhersehen lässt, ob ein geplanter Eroberungszug dem Stamme zum Glück ausschlagen wird, oder zum Verderben. Diese Funktionen sehen wir daher dauernd sich durch einander schieben und die Reisenden melden uns medicinisches Wirken bald vom Arzte, bald vom Priester, bald vom Wahrsager und vom Zauberer. Und für gewöhnlich sind das immer die gleichen Persönlichkeiten, welche bald in der einen, bald in einer der anderen Funktionen von den Berichterstattern belauscht werden konnten.
Zwei Ausdrücke sind es namentlich, mit welchen wir die Träger dieser verschiedenartigen Funktionen bezeichnet finden. Das eine Mal werden sie Schamanen genannt, das andere Mal Medicin-Männer. Der erstere Ausdruck entstammt den nordasiatischen Völkerschaften, der letztere ist bekannter Maassen den nordamerikanischen Indianern entnommen, welche mit dem französischen Worte médecine alles bezeichneten, was von ihnen als unbegreiflich und übernatürlich angesehen wurde. Die übrigen Ausdrücke, die wir wohl noch antreffen, wie Doctor, Zauberer, Hexer, Gaukler und Taschenspieler sind dagegen verschwindend und jedenfalls um Vieles ungeeigneter.
Entsprechend den in das öffentliche und private Leben tief eingreifenden Verpflichtungen, welche ihren Händen anvertraut sind, ist die Stellung der Medicin-Männer im Allgemeinen eine besondere, bevorzugte und angesehene.
Dass sie im Volke wenig in Ansehen stehen, ist sicherlich eine grosse Ausnahme. von Rosenberg berichtet dieses von Andai an der Nordwestküste Neu-Guineas. Auch was derselbe Autor von der Insel Nias angiebt, dass dort die Aerzte leben und arbeiten, wie jeder Dorfbewohner, und dass sie keinesweges ein höheres Ansehen geniessen, das ist mindestens ungebräuchlich.
Für gewöhnlich ist, wie gesagt, ihr Ansehen und ihr Einfluss sehr gross. Sie finden bei den Zulu, wenn sie auf der Wanderung sind, überall eine gute Aufnahme; sie werden bei den Dacota-Indianern stets mit der grössten Ehrfurcht behandelt und mit den besten Dingen versehen, sie sind bei den Ipurina-Indianern und bei den Australnegern von Victoria die einflussreichsten Personen des Stammes. In Liberia sind sie die Rathgeber der regierenden Häupter in Kriegs- und Friedenszeiten. In Victoria sind sie die ausschlaggebenden Personen in der Vertheilung des Landes, in Gippsland ordnen sie die Wanderungen und Versammlungen des Stammes an. Höchst einflussreich ist auch ihre Stellung bei den von Serpa Pinto besuchten Ganguella-Negern in Caquingue, obgleich bei diesen die Medicin-Männer, die Wahrsager und die Zauberer gesonderte Stände bilden. Viele heilige Handlungen dürfen hier nur in der Gegenwart des Medicin-Mannes vorgenommen werden, und in Fragen von Wichtigkeit gilt seine Stimme mehr sogar, als diejenige des Wahrsagers. Er spricht seine Entscheidung aber niemals aus, »ohne vorher gewisse Ceremonien zu veranstalten, die sogenannten medicinischen Gebräuche, zu denen er bald Pflanzen, bald Menschen- oder Thierblut verwendet.«
Das allerhöchste Maass von Ansehen, das der Medicin-Mann geniessen kann, berichtet Turner von einer bestimmten Gegend von Samoa. Hier wurde ein alter Mann als die Incarnation des Gottes Taisumalie (d. h. die sanft anschwellende Fluth) angesehen, der als Medicin-Mann in der Familie wirkte. Die Nachbarn zogen ebenfalls in ihren Krankheiten zu ihm. Sein Hauptmittel war, den befallenen Theil mit Oel zu reiben und dann mit äusserster Kraft seiner Stimme fünf Mal das Wort Taisumalie zu schreien und so ihn fünf Mal zu rufen, dass er komme und heile. Wenn das geschehen war, wurde der Kranke entlassen, um die Heilung abzuwarten. Trat die Genesung ein, so gab die Familie hierfür ein Fest, goss für den Gott eine Schale voll Kawa auf die Erde, dankte für die Heilung und die Gesundheit und betete, dass er fortfahren möge, seinen Rücken zum Schutze ihnen zuzukehren, sein Antlitz aber gegen die Feinde der Familie.
Die Kranken bringen den Medicin-Männern ein unbedingtes Zutrauen entgegen; das finden wir im malayischen Archipel, sowie durch ganz Amerika und Australien. Aber kein Vertrauen wird bei den Zulu in einen Arzt gesetzt, welcher sich einer Fettleibigkeit zu erfreuen hat.
Mit grosser Genugthuung rühmten die Eingeborenen von Victoria in einem Falle, in welchem der Medicin-Mann einen scheinbar Sterbenden durch schleunige Zurückbringung des ihm gestohlenen Nierenfettes geheilt hatte, »wie schnell ein Arzt ihres Volkes eine Krankheit heilen könne, welche ein weisser Arzt für unheilbar betrachte.«
Wir sehen, die Einbildung ist es, oder wie man heute sagen würde, die Auto-Suggestion, welche hei den Naturvölkern allerlei Krankheiten entstehen lässt, und durch die geschickt ausgeführte Suggestion ihrer Medicin-Männer werden sie geheilt.
Die Medicin-Männer der Chippeway- und der Winnebago-Indianer werden auch bei den Nachbarstämmen als besonders erfahren und leistungsfähig angesehen, und von Liberia berichtet Büttikofer, dass in einzelnen Krankheiten selbst Weisse, die bei den europäischen Aerzten keine Hülfe gefunden hatten, sich der Behandlung der eingeborenen Medicin-Männer anvertraut hatten und von ihnen geheilt worden waren.
Bei den Indianer-Völkern müssen die Medicin-Männer auch geschickte Taschenspieler sein; bei den nordwestlichen Stämmen wenigstens müssen sie, bevor sie die Krankenbehandlung beginnen, stets erst ein interessantes Zauberstück ausführen, um den staunenden Zuschauern ihre übernatürliche Macht zu beweisen. In Annam werden sie als ungebildet, aber als sehr energisch bezeichnet.
Ihr intimer Verkehr mit der Geisterwelt begabt die Medicin-Männer aber auch mit ganz besonderen Fähigkeiten. Sie können das Leben bringen, aber auch den Tod, und diese überirdische Kraft wird ihnen selbst nicht selten zum Verhängniss. Allerlei wunderbare Dinge weiss man sich von dem übernatürlichen Verkehre der Medicin-Männer mit der Geisterwelt zu berichten, und sorgsam sind die Aerzte darauf bedacht, diesem Glauben bei dem Volke hinreichende Nahrung zu geben. In Victoria behaupten sie, dass sie alle Dinge über und unter der Erde kennen, sie behaupten, dass sie Alles wissen, und sie beschreiben den Stammesgenossen nicht selten, was bei irgend einem fernen Stamme zur Zeit gemacht wird. Die Meewocs in Central-Californien glauben, dass ihre Medicin-Männer auf der Spitze eines Berges sitzen können, fünfzig Meilen weit von einem Manne, den sie zu vernichten wünschen, und dass sie den Tod desselben dadurch herbeizuführen im Stande sind, dass sie mit ihren Fingerspitzen ein magisches Gift ihm entgegenschnellen. Bei den Indianern Süd-Californiens befehlen sie den Elementen, blicken in die Zukunft und vermögen sich nach ihrem Belieben zu verwandeln.
Wenn bei den Dacota-Indianern der Arzt längere Zeit ohne Praxis ist, so hat er grosse Unbequemlichkeiten von der Unruhe der Geister in ihm zu erdulden. Um die Geister zu beruhigen nimmt er bisweilen Blut aus dem Arme irgend einer Person und trinkt dasselbe. So ist es denn kein Wunder, dass auch Furcht die zagenden Gemüther befällt, wenn sie dem Medicin-Mann gegenübertreten. Wer ihn bei den Klamath-Indianern zu einem erkrankten Familiengliede ruft, der bleibt vor der Thür der Hütte stehen, welche voll ist der überirdischen Wesen. Die Männer in Victoria fürchten sich, sie anzutasten, und fügen sich daher allen ihren Anforderungen; die Weiber zittern vor ihnen, weil sie sie verwunden, ihnen das Nierenfett rauben, sie unfruchtbar machen und ihre Kinder tödten könnten. Die Sahaptin-Indianer sterben häufig aus Furcht vor des Medicin-Mannes bösem Blick, und auch bei den Wascow-Indianern wird geglaubt, dass, gegen wen er seine grässlichen Blicke schleudert, dem sicheren Tode verfallen sei. Man muss daher in ihrer Gegenwart sein Haupt abwenden oder verbergen, um ihren erzürnten Blicken zu entgehen. »Wenn einer von dem Gedanken erfasst ist,« berichtet Alvord, »dass er von einem Medicin-Manne schrecklich angeblickt worden ist, so siecht er dahin, zehrt ab, oft verweigert er zu essen und stirbt durch Verhungern und Melancholie.«
Auch die Schamanen der sibirischen Volksstämme geniessen beim Volke ein ganz besonderes Ansehen; aber sie sind, wie Radloff sagt, vielmehr gefürchtet als geliebt.
Die alten Peruaner hatten nach von Tschudi zwei Arten von Priesterärzten, die Sonkoyox und die Kamaska. Der erstere Name bezeichnet »die Muthigen«, oder »die ein Herz haben«, der letztere Name bedeutet »die Fähigen«, oder »die Geschickten«.
Missionar Johl in Emdiseni-Petersberg in Kafferland giebt an, »dass die Kaffern von einem igqira ( Kafferdoktor) meinen, derselbe reite des Nachts auf einem Pavian herum und behexe die Leute und das Vieh.« »Er hat den impundulu, den die Kaffern fürchten. Er soll ein Vogel des Donners sein, etwa gleich dem ishulogu. Dann aber meinen die Heiden, es sei ein Traum ( ipupa), oder umgekehrt, der ipupa sei der ishologu oder impundulu, der die Leute des Nachts beschleiche und ihnen allerlei des Nachts ins Ohr sage.«
Als der Missionar den Zauberdoktor fragte: Sage mir, was ist impundulu? da antwortete er: »Das kann ich nicht; das ist ein Ding, welches kein Ding ist, welches die Heiden fürchten. Man sagt, es ist der Blitz. Ich habe das Ding aber noch nicht gesehen.«
Bei den Mincopies auf den Andamanen wird dem Medicin-Manne, dem Ôko-pai-ad (d. h. Träumer) die Fähigkeit zugeschrieben, durch Träume mit den guten und bösen unsichtbaren Mächten in Verbindung zu stehen, und ebenso die Geister der Verstorbenen oder derjenigen Leute, welche krank sind, zu sehen.
In Victoria führen die Medicin-Männer ein absonderliches Leben, um den Glauben an ihre überirdische Gewalt rege zu erhalten; »sie essen getrennt und zu ungewöhnlichen Zeiten, sie schlafen, wenn die Anderen wachen, und sie behaupten, lange Wanderungen zu unternehmen, wenn die Anderen im Lager alle im Schlafe liegen. Selten jagen und fischen sie, oder thun irgend eine Arbeit. Sie machen eigenthümliche Geräusche in der Nacht, wandern fort und suchen ihr Volk zu erschrecken. Durch ihre Klugheit und Verschmitztheit und durch ihre Geschicklichkeit, den Zufall zu benutzen, indem sie Wache halten, wenn die Anderen schlafen, erhalten sie sich ein Uebergewicht über die Mitglieder ihres Stammes und sie verstehen es, angenehm zu leben und Vortheil von ihrer fremdartigen Lebensweise zu ziehen.«
Die Baksa der Kirgisen haben in ihrem Benehmen etwas Affektirtes und Unnatürliches. Einer derselben, welchen Radloff sah, führte stets fromme Redensarten im Munde. »Bei jeder Handlung, die er unternahm, wie Trinken, Niedersetzen u. s. w., seufzte er ein lautes » Bismillah« (Im Namen Gottes) vor sich hin, und jeder Rede, die er that, fügte er ein » Wallahi, Billahi« (»Bei Gott«) hinzu, was bei den Kirgisen nur einige ganz alte Leute zu thun pflegen. Mancher Baksa soll immer einen geistig Gestörten nachahmen, und stets Grimassen schneiden, als ob er, wenn er auch nicht die Beschwörung ausführt, von bösen Geistern besessen sei.«
Den Tháy pháp der Annamiten ist eine besondere Diät vorgeschrieben. Sie dürfen kein Fleisch vom Büffel oder vom Hunde geniessen und sie müssen sich des Genusses einer kleinen Pflanze ( rau giâp cá) mit herzförmigen Blättern enthalten, welche einen Geruch nach Fischen hat.
Die Ganga, d. h. die Medicin-Männer der Loango-Neger, dürfen nur an bestimmten Plätzen Wasser trinken und dieses auch nur zu ganz bestimmten Stunden des Tages oder der Nacht. Ihre dem Fetisch vermählte Frau muss ihnen dasselbe herbeiholen. Ihr Küchenzettel ist ein sehr beschränkter, da sie eine Anzahl von Vierfüsslern und Fischen auch nicht einmal mit ihren Augen erblicken dürfen. Vielfach leben sie von Wurzeln und Kräutern, jedoch ist ihnen rohes Thierblut zu trinken erlaubt. Alles was die Fetischfrau des obersten Ganga bei Tage erblickt hat, muss sie des Nachts ihrem Gatten berichten, weil sie sonst in Krankheit verfallen und die Zauberkraft des Fetischs verderben würde.
Die Funktionen des Medicin-Mannes sind nicht nur auf das männliche Geschlecht beschränkt: wir finden es bei den Naturvölkern weit verbreitet, dass auch die Weiber den ärztlichen Beruf ergreifen. Das wird uns berichtet von den Aschanti, von den Negern in Loango und in Lubuku und von den Zulu, ferner von Bali, Borneo und Selebes, von Australien, sowie von vielen nordamerikanischen Indianer-Stämmen. Auch in Sibirien können Weiber die Schamanenwürde erlangen. In Nord-Californien und bei den Creek-Indianern sollen sie sogar zahlreicher sein, als die männlichen Aerzte. Bei den Dacota finden sie sich neben den männlichen Aerzten in jedem Dorfe, Bei den Central-Californiern hingegen ist weiblichen Personen die ärztliche Praxis untersagt.
Auf den Aaru-lnseln, auf Leti, Moa und Lakor, bei den Koniagas in Nordwest-Amerika, bei den Pimas in Mexico und bei den Central-Mexicanern scheinen diese weiblichen Aerzte den männlichen gegenüber sich nicht in einem Zustande der Gleichberechtigung zu befinden, sondern mehr eine Rolle zu spielen, wie bei uns die kurpfuschenden alten Weiber. Sie werden übrigens auch wirklich hier in den Berichten immer als » alte Weiber« bezeichnet, und von Sumatra wird gesagt, dass sie mehr Hebammen wären. Auch die Kirgisen pflegen sich, bevor sie den Medicin-Mann rufen, den Händen alter Weiber anzuvertrauen.
Die voll anerkannten weiblichen Aerzte haben bei den Waskow-Indianern aber doch nicht das gleiche Ansehen, wie die Medicin-Männer; sie sind nicht so sehr gefürchtet und sie haben nicht wie diese willkürliche Gewalt über Leben und Tod. In Vancouver hat man ebenfalls das Institut der weiblichen Aerzte, jedoch werden dieselben den Medicin-Männern zweiten Ranges gleichgeachtet und nur bei geringen Krankheiten gerufen. Vor ihren Geschlechtsgenossinnen haben die weiblichen Aerzte aber doch mancherlei voraus. Bei den Aschanti scheinen sie vor und nach der Hochzeit die Erlaubniss zu haben, ihre Gunst an Jeden zu verschenken, der ihnen beliebt. Bei den Topantunuasu in Central-Selebes dürfen sie nicht heirathen. Sie repräsentiren einen besonderen höheren Stand und sie werden von ihrem Dorfgenossen unterhalten. In Central-Amerika ist nur ihnen der Zutritt zum Schwitzhause gestattet, der den gewöhnlichen Weibern streng untersagt ist.
Es liegen uns einige Angaben vor über das numerische Verhältniss des ärztlichen Standes. Paulitschke schreibt: »Aerzte giebt es in grosser Anzahl in Harrâr und es ist diese Stadt auch bei den Galla als der Sitz der höheren Medicin geachtet,«
Auch in Bali finden sie sich in grosser Menge, und in Annam sind sie in den westlichen Provinzen zahlreich, namentlich in Chaudoc und Hatien. Als zahlreich werden sie auch bei den Winnebago-Indianern erwähnt, sowie bei den alten Maya-Völkern. Bei den Karaya und Ipurina in Brasilien finden sich in jedem Dorfe mehrere. Bei den Dacota werden 5 bis 25 männliche und weibliche Aerzte in jedem Dorfe angegeben. In Nias hat jedes Dorf von einiger Bedeutung je einen eigenen männlichen und einen weiblichen Arzt, während kleinere, die nahe bei einander liegen, diese Personen meist gemeinsam besitzen. Im westlichen Borneo sollen die Zauberärzte selten sein. Selten sind sie auch bei den Süd-Australiern in der nächsten Nachbarschaft des Port Lincoln; der berühmte Kukuta-Stamm im Nordwesten soll aber sehr viele solche Medicin-Männer besitzen.
Das Verhalten der Collegen unter einander finden wir durchaus nicht überall gleich. Die Einrichtung der Consultationen in zweifelhaften und besonders schwierigen Fällen ist ihnen keineswegs unbekannt, und daraus folgt, dass auch eine gemeinsame Behandlung vorkommt.
Bei den Mosquito-Indianern pflegen die Aerzte bei Epidemien zu consultiren und sich ihre wichtigen Träume gegenseitig mitzutheilen. Der Thây-pháp der Annamiten ruft für die Behandlung seine Collegen herbei und präsidirt dann den für die Heilung nothwendigen Ceremonien. Von den Niassern schreibt Modigliani: »Und wie bei uns in schweren und zweifelhaften Krankheiten mehrere Aerzte zur Consultation gerufen werden, so werden bei den Niassern jedesmal mehrere Erè zum Kranken geladen, weil, wenn einer von ihnen einen Bela (Geist) zum Beschützer hat, der mächtiger und geschickter ist, als derjenige, welcher die anderen Magier beschützt, sich der Kranke jedenfalls besser befinden könne.«
In Victoria, wo die Consultationen ebenfalls gebräuchlich sind, waren in einem bestimmten Falle neun weibliche Aerzte gemeinsam zu der Behandlung zusammengekommen.
Bei den Loango-Negern sind Consultationen mehrerer Medicin-Männer ebenfalls gebräuchlich, und wenn dieselben in ihren Ansichten nicht übereinstimmen, so wird ein älterer als Superarbiter herbeigerufen, dessen Ausspruch dann entscheidend ist.
Auch bei den Persern sind Consultationen eine ganz gewöhnliche Erscheinung. Polak sagt:
»Erkrankt ein Grosser des Reichs, so haben viele Personen ein Interesse daran, zu wissen, ob er bald wieder genesen, oder ob er das Zeitliche segnen werde. Sie Alle schicken desshalb ihren Arzt zu dem Kranken, selbst der Schah den Seinigen, und diese oft sehr zahlreiche ärztliche Versammlung hält zur anberaumten Stunde eine Consultation. Nachdem durch die Diener Nargileh und Kaffee herumgereicht worden, wird die Sitzung eröffnet. Der Reihe nach tritt Jeder an das Lager des Patienten, fühlt mit wichtiger Miene dessen Puls, indem er dabei gewöhnlich einige Redensarten von der Anamnese und dem Status praesens fallen lässt, und erkundigt sich genau, was für Speisen, besonders welche Suppe der Kranke am Tage vorher zu sich genommen, ob er Saures oder Süsses genossen habe. Hierauf entspinnt sich zunächst unter den Anwesenden ein hitziger Kampf, inwiefern die Krankheit als eine »heisse« oder als eine »feuchte« zu classificiren sei.«
Bei einer grossen Meinungsverschiedenheit liess der Patient (in diesem Falle der Grossvezier selber) die Aerzte in den Garten führen. Sie lagerten sich auf einem dicken Filzteppich und wurden mit Thee, Kaffee und Nargileh gestärkt. »Uebrigens nahm die Debatte ihren Fortgang. Mancher schleppte dicke Folianten herbei und suchte seine Ansicht Schwarz auf Weiss zu begründen. In der Hitze des Gefechts fielen auch mitunter scharfe Worte, die man jedoch dem Eifer für das Wohl der » Ersten Person« zu Gute hielt.« Der Kranke liess dann einen Priester höheren Ranges rufen, welcher feierlich den Koran aufschlug und aus diesem die Entscheidung fällte, welcher der sich gegenüberstehenden Ansichten vom Patienten Folge zu geben sei.
Aber auch eine zweite Eigenart moderner Civilisation ist leider den Naturvölkern ebenfalls nicht fremd geblieben, das ist der Brodneid und die Herabsetzung und Verdächtigung des concurrirenden Collegen.
So gewinnen die Medicin-Männer der Australneger Victorias ihren Einfluss »durch grosses Selbstlob, unermüdliches Schwatzen und manche geschickte Herabsetzung Anderer.«
Diese Herabsetzung geht bisweilen so weit, dass dem Patienten sogar die Tödtung des Concurrenten angerathen wird. So pflegen bei den Sahaptin-Indianern, wenn Jemand ärztlich behandelt wird, Rivalen oft die Furcht der Patienten zu erregen, damit der behandelnde Arzt getödtet werde. Auch bei den Stämmen in Oregon drängt sich wohl ein anderer Arzt an den Kranken heran und fragt ihn, warum es ihm nicht gut ginge. »Vielleicht arbeitet Dein Arzt an Dir mit seinem unheilbringenden Zauber.« Wenn dann der Kranke seinen Verwandten hiervon Anzeige macht, so wird der behandelnde Arzt dein Tode nicht entrinnen.
Den Indianern in Britisch-Columbien ist die Aufreizung zum Morde eines ärztlichen Rivalen ebenfalls nicht fremd. Aber hier geschieht es nur in Folge des Selbsterhaltungstriebes. Denn der Arzt, dem ein Patient gestorben ist, sucht die Angehörigen desselben zu überreden, dass der böse Einfluss eines missgünstigen Concurrenten dieses traurige Schicksal verursacht habe. So entgeht er der Rache und jener wird getödtet.
Die Ausnahmestellung, welche die Aerzte unter ihrem Volke einzunehmen pflegen, zeigt sich bisweilen auch bereits durch die äussere Erscheinung ihrer Wohnung an. Die Hütten der Medicin-Männer bei den Klamath-Indianern in Oregon sind z. B. dadurch kenntlich, dass an ihnen ein Fuchsfell als Berufszeichen befestigt ist, das sie an einer schräggestellten Ruthe baumeln lassen. In West-Borneo liegen vor dem Hause der Aerzte gewöhnlich zwei kleine, rohe Baumstämme mit ausgeschnittenen und gefärbten Schlangenköpfen an den Enden. Dieselben scheinen die Hantu (Geister) vorstellen zu sollen. Bisweilen geben die Medicin-Männer diesen Ungeheuern zu fressen, und sie wissen dann die Speisen mit solcher Geschwindigkeit verschwinden zu lassen, dass das Volk fest davon überzeugt ist, dass wirklich die Geister die ihnen vorgesetzte Mahlzeit verzehrt hätten.
Die Wohnungen von den Medicin-Männern der Betschuanen sind nach Holub daran kenntlich, dass sich in ihnen Fussdecken befinden, welche aus dem Fell der gefleckten Hyäne (Hyäna crocata) gearbeitet sind. Auf diesen halten sie ihre Sprechstunden ab.
Die Medicin-Männer der Annamiten haben in ihrer Wohnung mindestens zwei oft sehr kümmerliche Altäre. Der eine ist den Geistern geweiht, der andere den oberen Gottheiten der Sekte. Die Altäre bestehen aus einem Tisch, über welchem die Tafel mit dem Namen des Meisters dieses Standes aufgehängt ist, mit einer Inschrift, welche nach dem Geburtsjahre des Medicin-Mannes, des Tháy pháp, wechselt. Davor sind einige Gefässe mit Opfergaben aus Blumen und Früchten bestehend aufgestellt, ferner ein Kohlenbecken, Rasseln, Räuchergefässe und Trommeln. Zu den Seiten stehen Leuchter und eine Unzahl von Lanzen und von Flaggen. Ausserdem befinden sich dort die Tafeln von Kindern, welche der Tháy pháp von bösen Geistern befreit hat, und welche die Eltern nicht in ihren Häusern aufbewahren können, weil dieselben ungeeignet sind. Dahinter bemerkt man eine Art von vierseitigem Brunnen, welcher die Hölle darstellt; hier müssen die Soldaten des Medicin-Mannes. d. h. die ihm dienstbaren Geister ihre Widersacher hineintauchen. Vor der Tafel stehen in bestimmter Reihenfolge kleine Puppen, welche diese dienstbaren Geister vorstellen, und deren jede ihren besonderen Namen hat; es können fabelhafte Wesen sein, oder auch historische Persönlichkeiten, Helden der Sekte u. s. w.
In Marokko, Tunis und Tripolis sieht man die Heilkünstler, wie Quedenfeldt berichtet, auf den Märkten in der Oeffnung ihres kleinen, Gitûn genannten, dachförmigen Wanderzeltes sitzen. Ein Paar geschriebene Bücher, seine Reiseapotheke, bestehend in einigen Gläsern fragwürdigen Inhalts, sowie die Glüheisen nebst Kohlenbecken und Handblasebalg, sowie eine grosse Scheere, einige Messer, ein Tintenfass und eine Rohrfeder bilden die Ausrüstung.
Von der Wohnung der persischen Aerzte finden wir bei Polak die folgende Schilderung.
»Entweder in seinem Hause oder im nächsten Bazar hat der Arzt einen Laden ( Mahkemeh), wo er die ihn besuchende Kundschaft empfängt. Der Boden ist mit einer Rohrmatte oder mit Filz bedeckt; in Schränken an den Wänden steht eine Anzahl Schachteln, Krüge und Flaschen mit europäischen Etiketten versehen und mit Latwergen, Pillen und Elixiren gefüllt.«
Es wird gewiss nicht ohne Interesse sein, auch über die Honorarverhältnisse dieser wilden Collegen, sowie über ihre Vermögenslage einiges in Erfahrung zu bringen. Wir haben bei den Australnegern in Victoria bereits gesehen, dass die Medicin-Männer sich nicht bei den Arbeiten ihres Stammes betheiligen. Sie benutzen vielmehr in geschickter Weise die abergläubische Furcht ihrer Stammesgenossen und lassen sich durch deren Gaben und Geschenke erhalten. Das kann man aber eigentlich nicht auffassen als ein ärztliches Honorar. Ein solches müsste doch immerhin für direkte, ärztliche Hülfsleistungen gegeben worden sein. Solche unregelmässige Gaben müssen wir aber allerdings ebenfalls dem Einkommen der Medicin-Männer hinzurechnen. Die australischen Aerzte erhalten übrigens auch noch besondere Geschenke bei der Behandlung von Krankheiten. Bei der Honorarfrage treffen wir vielfach den Grundsatz, dass überhaupt nur dann bezahlt wird, wenn die ärztliche Behandlung von Erfolg gekrönt war. Das ist z. B. der Fall bei den Zulu, bei den Annamiten, bei den Koniagas in Nordwest-Amerika und bei den Creek-Indianern. Auf den Aaru-Inseln und in Alaska muss ein vorausbezahlter Preis wieder zurückgezahlt werden, wenn der Kranke nicht am Leben bleibt.
Bei den Isthmus-Indianern richtet sich der Preis der Behandlung je nach der Schwere des Krankheitsfalles. Die alten Mayas brachten ihren Aerzten bereits Geschenke, wenn sie sie zum Kranken riefen. Auch bei den Creek-Indianern sind Geschenke gebräuchlich, und wenn der Arzt die Behandlung fortsetzen soll, so müssen dieselben täglich wiederholt werden. Als ganz besonders erwünschte Gabe wird hier ein Hund als Opferthier betrachtet. Ausserdem erhält er aber als Honorar eine reichliche Gabe an Häuten und Vieh. Die Dacota-Indianer pflegen ihren Arzt freigebig vorauszubezahlen. Die Medicin-Männer der Natal-Kaffern haben den Gebrauch, wohl gewitzigt dadurch, dass es Sitte ist, nur zu bezahlen, wenn der Kranke geheilt wurde, sich eine Summe von zehn Schilling im Voraus geben zu lassen unter dem Vorwande, dass sie hierfür Medicin kaufen müssten. Für die vollendete Kur erhalten sie ausserdem noch einen Ochsen. Auch bei den Aerzten der Perser wird gegen die Empfangnahme des Receptes sogleich das ärztliche Honorar entrichtet.
In Liberia ist die Hülfe des Arztes billig, aber es müssen allerlei Opfergaben gegeben werden, welche theils vergraben, theils im Flusse versenkt werden müssen; einen Theil derselben aber muss der Patient dem Arzte übergeben, damit sie »verkauft« würden. Diese behält der Arzt dann für sich. Reis und ein weisses Huhn spielen dabei eine grosse Rolle. Billig ist auch der malayische Arzt in Sumatra, der für wenige Scheidemünze seine Kunst zum Besten giebt. Etwas theurer wird schon die Sache auf der Insel Keisar, wo dem Medicin-Manne die Hälfte des Opferthieres zukommt. Gewöhnlich ist ein Schaf für das Opfer ausersehen. Bei den Betschuanen und bei den Xosa-Kaffern wird von dem Arzte bald eine Ziege, bald ein oder mehrere Ochsen als Opferthier gefordert, an denen er natürlicher Weise einen hervorragenden Antheil hat. Holub sagt von den Betschuanen, dass der Medicin-Mann fleissig schweisstreibende Mittel verordnet. Er weist dabei den Kranken an, »sich in seinen besten Kaross (Fellmantel) oder in eine gekaufte Wolldecke zu hüllen; und nachdem das Mittel seine Schuldigkeit gethan hat, erscheint der Doctor, um den Kaross oder die Decke mit dem Schweisse, dem transpirirten Krankheitsstoffe »einzugraben«, d. h. sie in Besitz zu nehmen, während der Kranke froh ist, den Grund seines Uebels aus dem Hause entfernt zu wissen. Der Patient würde es nie wagen, dieselbe zurückzufordern, sollte er auch nach seiner Genesung die Frau Doctorin mit seinem Schakalmantel in den Strassen des Dorfes herumstolziren sehen.«
Der Baksa der Kirgisen erhält als Lohn die besten Stücke vom Opfermahle und das Fell des geschlachteten Thieres. Reiche Leute geben aber noch Extrageschenke, ein lebendes Schaf oder einen neuen Rock.
In Annam wird das ärztliche Honorar vorher ausbedungen. Die Cur ist nicht unter 20 Piaster, und reiche Leute pflegen noch viel mehr zu bezahlen und den Arzt ausserdem noch mit Kleidern zu beschenken. Zu den für die Heilung nothwendigen Opferceremonien sind bestimmte Tücher erforderlich, welche dem Medicin-Manne und seinem Gehülfen verbleiben. Für den Ersteren sind sie roth, für den Letzteren weiss. Sie dürfen zu irgend welchen häuslichen Zwecken benutzt werden, aber Hosen darf sich der Arzt nicht daraus fertigen lassen; das wäre eine Unehrerbietigkeit gegen die Geister.
Ueber die Honorare der Aerzte in Siam berichtet Bastian nach einem siamesischen Manuscripte: »Nach ärztlicher Taxe muss der aus einer Krankheit genesene Patient den Reis der Satisfaction geben, und an Geld für die Kosten der Arzeneien zwei Bath (Tikal) zahlen, sowie sechs Salüng zur »Sühne«. Ausserdem wird eine Schüssel mit Confect und ein Schweinskopf zugefügt.«
Die Aerzte des Königs erhalten je nach ihrem Range einmal im Jahre das Gehalt in Kauris zugemessen und zwar der Vornehmste fünf Pfund (400 Tikal), die Nächsten drei Pfund »und so im Verhältniss abwärts bis zu fünf Tamlüng (20 Tikal).«
Ueber die älteren Zeiten in Japan erhalten wir durch Wernich folgenden Bericht: »Gesetzlich war der Arzt ganz rechtlos; er durfte kein Honorar fordern, sondern er war ganz auf die Grossmuth der Kranken angewiesen, die ihr ›Geschenk‹, wie es noch bis in die Jetztzeit heisst, willkürlich bemessen durften. Der 32. Abschnitt aus den hundert Gesetzen des Iye-Yasu, des Gründers der letzten Siogun-Dynastie, spricht sich darüber aus, wie folgt:
›Weil die Menschen dieser Welt nicht von Krankheiten frei sein können, haben die Weisen des Alterthums voll Mitleid die Heilkunde geschaffen. Wenn deren Jünger nun auch die Krankheiten geschickt heilen und Erfolge haben, so dürft ihr ihnen doch keine grossen Einkünfte verleihen, denn sie würden im Besitze derselben nothwendiger Weise ihren Beruf vernachlässigen. Ihr sollt ihnen aber, so oft sie eine Cur gemacht haben, eine der Grösse ihres Erfolges entsprechende Belohnung geben.‹
»Das dürftige Honorar ist etwa das zwei- bis vierfache des Medicamentenpreises, der dem Arzte ebenfalls erstattet wurde; für Beides aber hatte er sich höflich zu bedanken. Es galt für unanständig, das Geschenk zu unterlassen, doch existirte kein Rechtstitel, der dem Arzte beim Eintreiben seiner Forderung behülflich gewesen wäre. Consultirte der Kranke den Arzt in dessen Hause, so hatte er ihm überhaupt nur die Medicin zu bezahlen.«
Bei den Ganguella-Negern wird die Kur als kostspielig bezeichnet.
Theuer ist die ärztliche Behandlung auch bei den Negern von der Loango-Küste. Hier muss der Medicin-Mann erst untersuchen, welcher in den Fetisch eingeschlagene Nagel die betreffende Krankheit verursacht hat. Das kostet Geld. Diesen Nagel muss er dann herausziehen und dem Fetisch die Wunde heilen. Das kostet abermals Geld. Dann erst kann er daran denken, nun auch den Patienten wiederherzustellen; und hierfür muss natürlicher Weise nun wiederum eine Zahlung geleistet werden.
Auf den Aaru-Inseln erklärt bisweilen der Arzt, dass die Krankheit darin ihre Ursache habe, dass die Vorfahren des Erkrankten den Vorfahren eines bestimmten anderen Arztes etwas schuldig geblieben sind. Diese Schuld lässt sich dann der jetzt behandelnde Arzt von dem Kranken dreifach oder vierfach bezahlen.
Ganz besonders theuer scheinen die Aerzte der Indianer zu sein. Bei den Central-Californiern und den Winnebagos wird von den erpressendsten Forderungen gesprochen. Ein Nord-Californier forderte ein Pferd als Honorar, und die Dacota-Indianer geben oft ein Pferd für eine ganz kleine Hülfsleistung und sind bereit, Alles was sie besitzen und was sie auf Credit bekommen können, hinzugeben, damit der Arzt sie behandele. Ein Arzt der Navajó in Arizona erhielt für eine neun Tage währende grosse Heilceremonie ein sehr reichliches Geschenk an Pferden und ausserdem für sich und alle seine Gehülfen für die ganze Zeit Nahrung in Hülle und Fülle, bestehend aus Suppe, Maisbrei, Getreidekuchen und Hammelbraten. Dem Arzte während der Zeit der Behandlung auch das Essen zu liefern ist übrigens auch bei den Sioux-Indianern und bei den Niassern der Gebrauch. Die Letzteren müssen ausserdem noch viele Hühner und Schweine opfern und dadurch werden in Nias die Krankheiten so kostspielig, dass man nicht selten Leute trifft, welche ihr ganzes Vermögen erschöpft haben oder sogar in Sklaverei gerathen sind, um die Schulden zu bezahlen, in welche sie sich gestürzt hatten, um sich die Hülfe der Medicin-Männer zu verschaffen.
Bei den Zulu reisen geschickte Aerzte von Ort zu Ort durch das Land und bleiben häufig durch Monate, oder selbst Jahre lang unterwegs. Als reiche Leute, im Besitze grosser Viehheerden pflegen sie dann nach Hause zurückzukehren.
Die ärztlichen Visiten sind bei diesen Völkern aber auch von besonders langer Dauer, so z. B. in Sumatra. Die Winnebago-Aerzte widmen sich ihrem Patienten Tag und Nacht, und die Aerzte der alten Maya verliessen ihren Kranken erst, wenn er geheilt oder gestorben war. Bei den Medicin-Männern der Indianer dauern die ärztlichen Ceremonien häufig Tage lang, und an jedem dieser einzelnen Tage ist der Medicin-Mann in angestrengtester Thätigkeit. Aehnliches ist auch von den Australiern, sowie von den Kirgisen und von den Süd-Afrikanern zu berichten.
Es hat aber doch auch seine Schattenseiten, bei den Naturvölkern die ärztliche Praxis auszuüben. Dass unter Umständen, wenn die Behandlung keinen Erfolg hatte, die im Voraus gegebene Bezahlung wieder zurückerstattet werden musste, das haben wir bereits gesehen. Auch eine Entschädigungssumme muss bisweilen den Hinterbliebenen noch entrichtet werden, z. B. bei den Indianern in Britisch-Columbien.
Aber man traut, wie bereits oben erwähnt worden ist, den Medicin-Männern auch die Fähigkeit zu, durch ihre Zauberkräfte den Tod zu bringen. Wenn ihnen daher der Kranke stirbt, so macht man sie für seinen Tod verantwortlich. In Sumatra suchen sich dann die Medicin-Männer herauszureden und sagen, die Geister waren dem Kranken nicht geneigt. Die Twana-, Chemakum- und Klallam-Indianer behaupten dann, dass mehrere Dämonen von dem Kranken Besitz ergriffen hätten, und dass nur jeder einzeln zu vertreiben sei. Die Dacota-Indianer schieben den Misserfolg auf die Sünden des Volkes. Auch die Ipurina-Indianer und die Eingeborenen von Victoria und Süd-Australien wissen sich zu helfen und behaupten, dass ein Zauberer eines feindlichen Stammes, welcher mächtiger ist, als sie, ihnen die Kur vereitelt habe. Die Mosquito-Aerzte umgeben den Kranken mit allerlei Verboten, deren unschuldige Uebertretung durch Vorübergehende ihnen bei unglücklicher Behandlung eine erwünschte Ausrede bietet,
Die Haidah und die Columbianer jedoch, sowie die Californier und die Creek- und Oregon-Indianer lassen nicht mit sich spassen. Stirbt der Kranke, so hat des Medicin-Mannes Zauber ihn getödtet und desshalb muss dieser ebenfalls getödtet werden. Ja die Nord-Californier gehen so weit, dass wenn auch der Gestorbene überhaupt nicht ärztlich behandelt worden ist, man den Tod desselben dennoch den Medicin-Männern in die Schuhe schiebt und den ersten Besten derselben tödtet, dessen man habhaft werden kann. Gewöhnlich ist es ein Medicin-Mann eines anderen Stammes, und für die Tödtung desselben sind sie dann verpflichtet, ein Reugeld zu bezahlen. Alvord berichtet aus Oregon:
»Alle Ermordungen unter ihnen, von denen ich erfahren konnte, geschahen in dieser Weise, und drei Aerzte wurden in den letzten vier Monaten bei verschiedenen Stämmen, nicht über 40 Miles von hier entfernt, getödtet.« So kann es uns nicht wundern, zu vernehmen, dass der Medicin-Mann der Nord-Californier zuweilen doch sich weigert, die Behandlung zu übernehmen, obgleich man ihm die hohe Honorarforderung bewilligt hat. Und in Annam verlassen manchmal die Aerzte ihre Kranken, um sich einer späteren Verantwortlichkeit zu entziehen, bisweilen allerdings auch, weil sie bei einer etwaigen Heilung des Kranken die Rache der Geister zu fürchten haben, von denen sie den Patienten befreiten.
Auch von den Kindern der Tháy pháb glaubt man, dass sie in Folge dieses Ingrimms der Dämonen entweder überhaupt bald sterben oder schwächlich und elend sind, und dass, wenn der Arzt einen Pockenkranken heile, die Pocken auf seine Kinder übergehen.
Selbst bei den Persern findet man, wie Polak berichtet, noch ganz ähnliche Anschauungen:
»Wenn ein Patient unter der Behandlung des Arztes stirbt, so verliert Letzterer nicht nur allen Anspruch auf Honorar, sondern man legt ihm auch direct die Schuld an der eingetretenen Auflösung zur Last; denn es herrscht die Ansicht, dass ohne Zuthun des Arztes der Kranke nicht gestorben wäre. Sobald daher ein Krankheitsfall tödtlich zu enden droht, pflegen die Aerzte sich zurückzuziehen, wodurch dem Kranken und seiner Familie gewissermaassen officiell angekündigt wird, dass das Ende nahe sei. Macht unglücklicher Weise der Arzt, weil er nicht weiss, dass der Kranke bereits verschieden ist, noch einen Besuch im Hause so kann er leicht in Gefahr kommen, von den Weibern und dem Gesinde thätlich misshandelt zu werden. Aus diesem Grunde unterhält jeder practische Arzt in der Umgebung seiner gefährlichen Patienten Spione, die ihn sofort von dem unglücklichen Ausgang in Kenntniss setzen.«
Das Amt des Medicin-Mannes in Oregon ist, wie Alvord richtig sagt, »ein gefährliches, aber auch ein machtvolles und geehrtes Gewerbe, und weil dieser Beruf mit Gefahr ausgeführt wird, so erhält er, wie der Soldatenstand, hierdurch einen besonderen Reiz. Sicher ist, dass ich nicht erfahren habe, dass die Gewohnheit, die Aerzte zu tödten, bei irgend einem Stamme dazu geführt habe, die Novizen von diesem Stande zurückzuschrecken.«
Wir haben oben bereits gesehen, dass die Thätigkeit der Aerzte auch bei den Naturvölkern keine unumstrittene ist. Haben sie doch in nicht wenigen Fällen ihren Ruhm und ihre Arbeit in ganz ähnlicher Weise wie bei uns mit einer Anzahl alter Weiber zu theilen. Aber auch männliche Curpfuscher tauchen auf, und wenn z. B. in Dorej auch noch »erfahrene Leute« um Rath gefragt werden, so steht das doch kaum auf einer anderen Stufe.
Bei den Persern gehört eine gewisse Summe medicinischer Kenntnisse zu dem Wissensschatze jedes Gebildeten. »Darum fehlen medicinische Bücher auch in keiner Hausbibliothek. Durch die Lectüre derselben verleitet, halten sich viele Laien für berufen, bei Krankheitsfällen in der Familie mitzusprechen und ärztlichen Rath zu ertheilen. Selbst Damen glauben sich zur Verordnung von Heilmitteln berechtigt.«
Bei den Mincopies auf den Andamanen übernimmt nicht selten die Ehegattin oder eine andere Verwandte die Behandlung des erkrankten Mannes.
Auch bei den alten Peruanern liess sich das gemeine Volk »in der Regel von alten Weibern curiren, oder Einer gab dem Anderen irgend einen Rath oder Heilmittel aufs Gerathewohl, so dass die Epidemien schrankenlos wüthen und ihre zahllosen Opfer dahinraffen konnten.«
In Alaska macht man allerdings mit dem Curpfuscher nicht viel Federlesens. Hat hier ein Unberufener Jemanden behandelt, und ist derselbe der Krankheit erlegen, so wird der selbstbewusste Curpfuscher ohne Gnade umgebracht.
Man wird hiermit aber nicht verwechseln dürfen, dass es bei manchen Volksstämmen wirklich verschiedene Kategorien von Aerzten giebt. Obenan in dieser Beziehung stehen ohne allen Zweifel die Xosa-Kaffern, bei denen Kropf nicht weniger als acht verschiedene Arten von »Doctoren« aufzählt. Allerdings haben zwei derselben mit der Heilkunde eigentlich nichts zu thun: es bleiben, wenn wir von diesen absehen, aber immerhin doch noch sechs Arten übrig. Bisweilen allerdings sind mehrere dieser Arten in derselben Person vereinigt. Für gewöhnlich aber handelt es sich wirklich um differente Persönlichkeiten.
Der erste derselben ist der Amagqira oluxa, d. h. wörtlich » Doctor des Spatens«, wobei man sich »zum Wurzelgraben« zu ergänzen hat. Wir würden also sagen »Kräuterärzte«. »Sie haben eine grosse Kenntniss von heilbringenden Kräutern gegen Krankheiten und besonders gegen die Bisse der giftigen Schlangen und anderen Gewürms. Sie geben nur Medicin und beschuldigen nicht der Zauberei, sondern sie meinen, die Krankheit käme von dem Uhili, der sich im Wasser aufhält.«
Als zweite Gruppe müssen wir die » Doctoren des Zumachens, des Verstopfens« hinstellen. Dieselben gehören gleichzeitig auch der ersten Gruppe an. Sie verstopfen das Herz eines Menschen, der sich häufig Hexereien zu Schulden kommen liess, »damit er nicht an solche Sachen denke. Sie geben einem solchen Medicin und waschen ihn, wofür der gedocterte Mann eine Kuh schlachten und Vieh für seine Cur bezahlen muss, versteht sich, nur wenn Heilung erfolgt ist.«
Die dritte Gruppe bilden die Amagqira wokupata, welche durch Auflegen von Kuhdünger die in den Körper des Patienten hineingezauberten Fremdkörper und Thiere herausziehen.
Es folgen dann die Amagqira awokumbulula, welche dadurch den Kranken heilen, dass sie die Zaubermittel, mit welchen ihm seine Krankheit angehext wurde, herausriechen.
Die fünfte Gruppe wird oft durch die gleichen Leute wie die vorigen vertreten. Es sind die Isanuse oder Amagqira abukali, d. h. » die scharfen Doctoren«. Ihres Amtes ist es, denjenigen herauszuriechen, der die schadenbringende Hexerei ausgeführt hat. »Die dabei stattfindende Versammlung und Ceremonie heisst Umhlahlo, ein politisches Werkzeug der Häuptlinge, um sich von irgend einem einflussreichen Mann, der ihnen im Wege steht, zu befreien.«
Die sechste Gruppe endlich wird repräsentirt durch den Amagqira awokukafula, welcher auch Amatola genannt wird. »Er hat das grosse nationale Opfer beim Auszuge in den Krieg darzubringen, um durch dieses und Amulete die Krieger unverwundbar zu machen. Diese Leute haben einen einträglichen, aber auch sehr gefährlichen Beruf.« Denn wenn ihre schützenden Amulete nicht die erwartete Wirkung gehabt haben, so werden sie getödtet, sobald man ihrer habhaft wird.
Wenn uns diese Fülle des Heilpersonales im ersten Augenblick auch etwas überraschend vorkommen mag, so möchte ich doch hier wiederum eine Parallele aus der deutschen Volksmedicin beibringen. Nach Fossel ist nämlich das Bauernvolk der Steiermark selbst noch den Xosa-Kaffern über. Denn in die ärztliche Praxis theilen sich: 1. der Bauerndoctor (Harnbeschauer), 2. die Doctorin, 3. die Hebamme, 4. der Bruchrichter (Beinbruchdoctor), 5. der Chirurgus, 6. der Zahnreisser, 7. der Schmied, 8. der Abdecker, 9. die Aderlass- und Schröpf-Männer und Weiber, 10. der Abbeter, 11. der Krämer, 12. der Apotheker, 13. der Pfarrer. Aber Alle kommen erst dann an die Reihe, wenn der eigene oder der Familienrath zu der Behandlung nicht mehr ausreichen will.
Wir sehen hier in den Beispielen von der Steiermark und den Xosa-Kaffern sich bereits Spezialitäten im ärztlichen Stande herausbilden. So etwas lässt sich aber auch anderwärts nachweisen. So hat man nach von Rosenberg auf Nias weibliche Aerzte, welche sich nur mit Frauenkrankheiten abgeben, und ganz etwas Aehnliches besteht bei den Loango-Negern.
Von der Insel Bali schreibt Jacobs:
»Personen, welche sich mit der Heilkunde beschäftigen, sowohl männliche als weibliche, findet man unter den Baliërn in grosser Anzahl und Verschiedenheit, ja man hat sogar Personen, die sich speciell mit einer einzigen Krankheit beschäftigen, beispielsweise eine Specialität für Bauchkrankheiten. Seine hauptsächlichste Thätigkeit besteht im Reiben und Kneten des Bauches der Kranken und zwar allein bei aufgetriebenem Leibe, Colica flatulenta, Ascites und bei Hernia inguinalis. Diarrhöe, Dysenterie und andere Darmkrankheiten behandelt er aber nicht.«
Ein sehr ausgebildetes Specialistenwesen finden wir auch an der Loango-Küste. Hier hängt dasselbe damit zusammen, dass ganz bestimmte Fetische die Heilung bestimmter Krankheiten bewirken. Da nun diese Fetische aber verschiedenen Zauberpriestern unterthan sind, so muss man sich in einem Krankheitsfälle an denjenigen Ganga um Hülfe wenden, dem der heilende Fetisch für die betreffende Krankheit dienstbar und zu Willen ist. Auf Samoa hat nach George Turner »jegliche Krankheit ihren besonderen Arzt«.
In Koetei auf Borneo finden sich ausser den männlichen und weiblichen Aerzten auch noch Personen, welche zu Heilzwecken die Geister und Halbgötter in sich aufzunehmen vermögen, damit dieselben dann durch sie handeln können. In Annam hat man neben dem durch Beschwörungen heilenden Tháy pháp auch noch den Tháy ngãi, einen Zauberer, welcher Krankheiten verursachen kann, dieselben dann aber auch wieder gegen entsprechende Bezahlung heilt. Die Siamesen haben ebenfalls mehrere Arten der Aerzte ( Mo), die Mo Luang, die Aerzte des Königs, die Mo Khong Chao, die Aerzte des Adels, und die Mo Rasadon, die Aerzte des Volkes. Dazu gesellen sich die Krankheitsbeschwörer. Bei den Narrinyeri in Süd-Australien scheinen zwei Arten von Aerzten zu existiren, deren Thätigkeit aber im Ganzen eine ähnliche ist. In Liberia finden wir den Kräuterdoctor neben dem Zauberarzt, und in Lubuku in Afrika fungirt neben dem Medicin-Manne ein besonderer Beschneider.
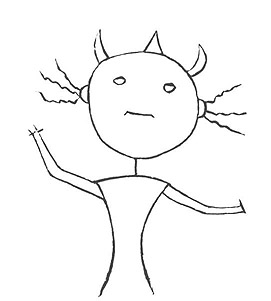
Fig. 15. Midç; nach einem Musikbrett der Chippeway-Indianer. Nach Hoffman.
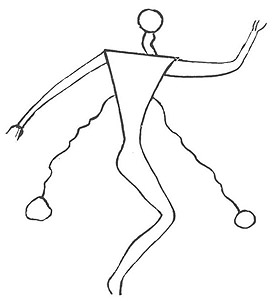
Fig. 16. Midç, dessen Herz mit Kenntniss von den heiligen Medicinen der Erde erfüllt ist. Nach einem Musikbrett der Chippeway-Indianer. Nach Hoffman.
Bei den nordamerikanischen Indianer-Stämmen treten vier Arten von Aerzten auf. Der eigentliche Arzt in unserem Sinne ist der Muskeke-winince. Neben ihm fungirt der Jossakeed oder Jes' akkid, der Hellseher, welcher ausser anderen Dingen auch die Ursache der Erkrankung und das zur Herstellung nothwendige Heilmittel anzugeben vermag. Vornehmer wie sie beide ist der Midç, der durch übernatürliche Mittel heilende Medicin-Mann (Fig. 15, 16). Diese Midç bieten eine der allermerkwürdigsten Erscheinungen dar. Sie bilden eine geschlossene Gesellschaft mit geheimen Erkennungszeichen, welche von den südlichen Staaten Nord-Amerikas bis in die nördlichen Provinzen verbreitet ist. Die Gesellschaft, Midç' wiwin genannt, ist eine Art Geheimbund. Sie hat vier Grade, deren jeder seine besonderen Geheimnisse besitzt, die von den Mitgliedern auf das Sorgsamste gewahrt werden. Wenige Auserwählte nur erreichen den höchsten Grad. Auch Weiber können nach Erfüllung der notwendigen Vorbereitungen Midç werden. Bisweilen werden grössere Ceremonien aufgeführt, welche mit dem Namen Medicin-Tänze bezeichnet zu werden pflegen (Fig. 17). Von weither strömen dazu die Mitglieder des Ordens zusammen. Es handelt sich dabei entweder um die feierliche Aufnahme von neuen Candidaten in den Orden, oder um die zauberhafte Heilung eines Kranken, der dann die Kosten des Festes zu tragen hat.
Die vierte Gruppe der indianischen Aerzte repräsentiren die Wabeno. Es ist das eine wenig angesehene Abart der Midç-Gesellschaft, die sich meist aus solchen Individuen rekrutirt, welche bei den Midç keine Aufnahme gefunden haben. Ihre Feierlichkeiten finden Nachts gegen die Zeit des Morgengrauens statt, wovon sie ihren Namen erhalten haben sollen.

Fig. 17. Medicin-Tanz der Winnebago-Indianer. Nach Schoolcraft.
Die Karoks in Californien haben nach Mason zwei Arten von Schamanen, die Wurzel-Aerzte, welche mit Trinken und Umschlägen behandeln, und die bellenden Aerzte, welche die Krankheit heraussaugen. Die Letzteren, meistentheils Weiber, heulen wie ein Hund vor dem Patienten und bellen Stunden lang.
Von den Sonkoyox und den Kamaska der alten Peruaner ist bereits weiter oben die Rede gewesen; sie beschäftigten sich nicht mit dem gemeinen Volke, sondern sie practicirten nur in den höheren Gesellschaftsschichten, bei den höheren Beamten, den Priestern, den Adligen und den Inka.
Bei den Kirgisen muss der Baksa seine Thätigkeit mit dem Mulla theilen, welcher mit Koransprüchen die Krankheiten behandelt. In einem uigurischen Liede des 11. Jahrhunderts wird der Kam oder Mukasim, der Schamane, dem Arzte, gegenübergestellt:
»Soll der
Kam Dir aber nützen,
Musst Du, Herr, ihm Alles glauben;
Seine Worte liebt der Arzt nicht,
Er entfernt von
Mukasim sich.«
In Indien ist es der Hakim (Barbier), der Jurrah und der Baidja, welche sich in die Praxis theilen. In Persien geniessen das höchste Ansehen die Haekim taebib, die gelehrten Aerzte. Ganz ähnlich, wie bei uns im Mittelalter, befassen sie sich nicht mit der Chirurgie. Diese ist dem Dscherah vorbehalten, von welchem man erwartet, dass er nicht schreiben kann. Als Schröpfer, Brenner, Rasirer und Masseur schliesst sich ihnen der Dallak an, und endlich kommen noch die Gliedereinrenker, die Schikeste-baend, welche ähnlich wie bei unseren Bauern ganz ungebildeten Standes sind. Aber eine Art von Specialisten haben wir noch zu erwähnen, das sind die Augenärzte, die Kehâl. Diese haben es verstanden, den Ruf ihrer Geschicklichkeit bis nach China auszubreiten. Uebrigens haben auch die Marokkaner eine besondere Zunft der Augenärzte.

Fig. 18. Maske des Medicin-Mannes der Atna-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach einem Aquarell.
Bei den alten Japanern unterschied man zwischen den Volksärzten und den Fürstenärzten. »Beide Kategorien hatten schon in der Art, wie sie für die Recrutirung ihres Standes sorgten, vielleicht nur das Gemeinsame, dass für beide die Söhne von Aerzten das Hauptmaterial abgaben. Bereits der sonst erforderliche Nachwuchs ist aber in seiner Abstammung ein grundverschiedener. Während für die Volksärzte derselbe aus den unteren der Samurai-Kaste subordinirten Classen der Ackerbauer, Handwerker und Kaufleute herkam, treten in die Zahl der Fürstenärzte diejenigen Samurai-Söhne ein, welche wegen körperlicher und geistiger Gebrechen untauglich zur Erlernung des Kriegerhandwerks waren und von ihren Vätern, als der Nachfolge im eigenen edlen Berufe unwürdig, der Versorgung durch den niedrigeren Beruf übergeben wurden. Hierbei concurrirte dann der Priesterstand gewissermaassen mit dem ärztlichen, indem jenem die imbecilen, geistig schwach beanlagten oder verwahrlosten, diesem diejenigen Söhne zufielen, welche verwachsen, hinkend oder sonst verunstaltet, nie unter den Kriegern hätten erscheinen dürfen. Dieser Art der Standeswahl war denn auch die Anschauung, die beide Kategorien von ihrem Berufe hatten, sehr entsprechend. Die Volksärzte, deren Väter noch einem der niedrigeren Stände angehört hatten, betrachteten ihren Eintritt in den freien Stand als eine Erhöhung und strebten derselben mit Eifer nach; die Fürstenärzte verfielen gewissermaassen einer Herabsetzung, wenn sie in ihren neuen Stand eintraten und betrachteten denselben ihr Leben lang als ein nothwendiges Uebel und als eine jeder weiteren besonderen Anstrengung unwürdige Sinecure.«
Es wurde weiter oben bei der Besprechung der ärztlichen Consultationen bereits darauf hingewiesen, dass bisweilen mehrere Aerzte gemeinsam die Behandlung des Patienten übernehmen. Aber auch abgesehen von dieser collegialen Unterstützung bedürfen die Aerzte nicht selten zu ihren therapeutischen Maassnahmen eines besonderen Hülfspersonales. Auch dieses müssen wir jetzt versuchen, kennen zu lernen. Bei der soeben erwähnten gemeinsamen Behandlung sahen wir es bisweilen, dass, ähnlich wie bei unseren chirurgischen Operationen, dem einen der Aerzte der Hauptantheil an der Behandlung zufällt, während die anderen, obwohl sie ihm gleichberechtigte Collegen sind, doch mehr eine Art von assistirenden Funktionen übernehmen. Das findet namentlich bei den Tháy pháp der Annamiten und bei den Heilceremonien der Midç bei den Indianern statt, von denen wir noch ausführlicher zu sprechen haben werden.

Fig. 19. Maske des Medicin-Mannes der Atna-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach einem Aquarell.
Vielfach dort, wo betäubende Musik eine wichtige Rolle bei der ärztlichen Behandlung spielt, erblicken wir besondere Musikanten in der Umgebung des Arztes. Entweder sind es seine Schüler und Eleven, oder es ist eine Art von dienendem Personale. Bisweilen aber hat es auch den Anschein, als wenn irgendwelche Stammesgenossen, z. B. die Freunde und Verwandten des Erkrankten, die Funktion der Musikanten übernehmen. So scheint es an der Loango-Küste der Fall zu sein, und auch bei den Ostjaken, und bei den Indianern von Britisch-Columbien und dem Washington-Territorium findet Aehnliches statt.
Aber auch in anderer Weise haben die Schüler den Medicin-Mann zu unterstützen, so z. B. in Annam bei den Opferungen, bei den Koniagas durch Mitrufen der Beschwörungen, und bei den Midç der Navajó-Indianer durch Herstellung der später noch zu erwähnenden Bilder auf dem geglätteten Erdboden der Medicinhütte. Ausserdem sind hier noch bestimmte junge Leute als sogenannte Läufer und Tänzer angestellt.
Bei den Tungusen lässt sich die Schamanin ihr Handwerkszeug von jungen Burschen vorantragen, während »junge Weiber und Dirnen ihr im Singen behülflich sein müssen.«
Der Arzt in Buru bedarf zuvor einer hellsehenden Frau, welche feststellt, durch was und auf welche Weise die Krankheit zu Stande gekommen ist, und ähnlich muss bei den Ganguella-Negern der Wahrsager zuerst entscheiden, ob Geister oder Zauberer die Krankheit verursacht haben. Erst wenn diese wichtige Frage entschieden ist, wendet man sich an den Arzt. Noch grösserer Hülfe bedarf in wichtigen Fällen der Medicin-Mann der Annamiten. Er selber ist des Lesens unkundig, und deshalb unterstützt ihn stets ein Schriftgelehrter, welcher die Beschwörungsformeln mit lauter Stimme vorliest. Ausserdem aber helfen ihm noch zwei Personen, von denen die eine hellsehend ist und über das Benehmen der beschworenen Geister Auskunft giebt, während der andere Assistent mit bestimmten Figuren hantiren muss, welche für die Ceremonie nothwendig sind. Wir kommen hierauf noch wieder zurück.

Fig. 20 Medicin-Mann der Basutho. Nach Photographie.
Einen wichtigen Gehülfen des ärztlichen Standes, namentlich in allen Leiden der Weiber, bilden, ganz ähnlich wie bei unserem Landvolke, die als Hebammen fungirenden Frauen. Ich gehe hier nicht näher darauf ein, da ich in meiner Bearbeitung des Werkes von Ploss: Das Weib in der Natur- und Völkerkunde ganz eingehend und ausführlich dieses umfangreiche Thema behandelt habe.
Die grosse Wichtigkeit der ärztlichen Maassnahmen, bei denen es sich um nichts Geringeres handelt, als mit den Göttern und Dämonen in directen Verkehr, ja nicht selten sogar in erbitterten Kampf zu treten, macht es wohl verständlich, dass der Medicin-Mann oder Schamane nicht in seiner alltäglichen bürgerlichen Erscheinung in eine so feierliche Handlung eintreten kann. Er bedarf dazu einer besonderen Ausschmückung, welche, abgesehen von der häufig recht phantastisch zusammengesetzten Amtstracht, nicht selten auch noch in grotesker Bemalung und bisweilen in grauenerregender Maskirung besteht. In einer Anzahl der uns zu Gebote stehenden Berichte ist nun allerdings von einer solchen Amtstracht nicht die Rede. Ob sie bei den betreffenden Völkerschaften wirklich nicht in Gebrauch ist, müssen wir natürlicher Weise dahingestellt sein lassen. Von den Medicin-Männern der Mabunde in Süd-Afrika sagt Holub allerdings, dass sie mit Ausnahme ihres hohen Alters durch keine besonderen Abzeichen kenntlich gemacht sind. Einige andere Volksstämme scheinen sich mit der Bemalung allein zu begnügen, während bei wieder anderen ausser der Bemalung auch noch die festliche Amtstracht in Anwendung kommt.

Fig. 21. Medicin-Mann der Atna-Indianer. Modell mit echter Ausrüstung. Vorderansicht. Museum f. Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.
Bei den Indianern von Britisch-Columbien führt Bancroft an, dass sie bei der Ausübung ihrer ärztlichen Funktionen »häufig grotesk bemalt« erschienen. Es hat hiernach also doch den Anschein, als wenn die Bemalung bei ihnen nicht ein unumgängliches Erforderniss wäre. Bei den Mosquito-Indianern fungiren die Sukias, »das Gesicht in grässlicher Weise bemalt.«
Der Medicin-Mann, der Kimbunda, bei den Negern in Lubuku bedient sich keiner besonderen Amtstracht; »er beschmiert sich höchstens mit rother oder weisser Pemba, wenn er seine Kuren ausführt.«
Die Bemalung des Medicin-Mannes beobachtete auch Bastian an der Loango-Küste. »Der Ganga hockte vor dem Kranken, damit beschäftigt, sich das Gesicht zu bemalen, roth die Nase, gelb die Stirn, schwarz die Backen, und wurde er in dieser Operation von seiner neben ihm sitzenden Frau unterstützt.«
Die höchste Vollkommenheit in der Ausbildung der Bemalung treffen wir aber bei der in so vielen Beziehungen merkwürdigen Midç-Brüderschaft der nordamerikanischen Indianer an. Hoffman hat uns ganz neuerdings hierüber genaue Aufklärungen gegeben und wir verdanken ihm die Farbenskizzen von nicht weniger als zehn verschiedenen Bemalungsarten des Gesichts, deren Farben und Muster sämmtlich ihre ganz bestimmte rituelle Bedeutung besitzen.

Fig. 22. Maske des Medicin-Mannes der Atna-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach einem Aquarell.
Ausser den Bemalungen kommt nun für die Medicin-Männer bei vielen Volksstämmen auch noch eine wirkliche Amtstracht hinzu, durch welche sie sich sofort von den übrigen um den Kranken beschäftigten Stammesgenossen unterscheiden. Bei den Ganga der Loango-Neger ist dieses Abzeichen der Würde eine Federmütze. Die Federn, aus denen dieselbe gefertigt wird, stammen von einem solchen Vogel, dessen Fleisch dem Medicin-Manne zu essen verboten ist.
Zauberärzte der Basutho sah Wangemann in Nord-Transvaal (Fig. 20). »Phantastische Gestalten, mit einem aus Muscheln und aufgeblasenen Schafblasen und anderem Zierrath wunderlich gestaltetem Kopfputz, am Leiber allerlei Zaubermittel, ein grosses Kuhhorn, angefüllt mit Medicin, ausserdem Antilopenhörner und kleine Büchschen, auch die Zauberwürfel.«
Holub macht von den Medicin-Männern der Betschuanen folgende Beschreibung: »Als Heilkünstler erkennt man sie in der Oeffentlichkeit an einem aus Pavianfell (Cynocephalus Babuin) verfertigten Mäntelchen. Manche tragen um den Hals an Schnüren oder Riemchen verschiedene Säugethier-, Vögel- und Reptilienknochen, doch immer auch vier, meist aus Elfenbein, zuweilen aus Horn geschnitzte, mit eingebrannten Zeichnungen versehene Stäbchen und Pflöckchen, welche Würfel darstellen und zur Diagnose benutzt werden.«
Die Altajer tragen nach Radloff bei dem Schamanisiren eine von der gewöhnlichen nicht sehr abweichend Tracht: »einen offenen Rock mit einem Brustlatze aus Thierfell und eine rothe Mütze mit einer Birkhuhnfeder. Die Schamanen der am nördlichen Altai wohnenden Schwarzwald-Tataren, der Schor und der Teleuten besitzen überhaupt keine bestimmte Tracht, sondern schamanisiren in ihrer gewöhnlichen Kleidung. Bei den Wald-Tungusen hingegen und anderen ost-sibirischen Völkerschaften ist das Schamanenkleid auf Rücken, Brust und an den Armen mit vielen eisernen Behängen in Form von allerlei Thiergestalten besetzt, die bei jeder Bewegung des Körpers durch Aneinanderschlagen ein starkes Geklapper hervorbringen.«

Fig. 23. Medicin-Mann der Atna-Indianer. Modell mit echter Ausrüstung. Hinteransicht. Museum f. Völkerkunde, Berlin. – Nach einem Aquarell.
Solch einen mit Eisenwerk behängten Schamanenrock mit dazugehörigem »gehörntem Kasket« fand Pallas bei den Kamaschinzen vor. Von den Sagajern sagt er, dass der Schamane sich nur durch seine Kopfbedeckung unterscheide. Dieselbe war gefertigt »von rothem Tuch, mit Fuchsfellen verbrämt, mit Schlangenköpfen besetzt, und oben mit einem Busch Eulenfedern, am Rande aber mit allerlei Streifen Zeug. Hermelinfellen und dergleichen geziert.«

Fig. 24. Mütze des Medicin-Mannes der Haidah-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. – Nach einem Aquarell.
Ein Schamane der Katschinzen, ein Anfänger, hatte noch keine Schamanenmütze. Er hatte, wie Pallas berichtet, »nur buntausgenähte lederne Strümpfe, und am Leibe einen engen ganz beschmutzten Kittel, von bunt gedrucktem baumwollenen Zeuge ( Kitaika) an, worauf über den Schultern ein rother Querlappen, wie ein Kragen, angemacht war, und von demselben 13 Bänder herabhingen ( Sysim). Die Bänder aber waren aus grünen, gelben, rothen, blauen, schwarzen und bunten, auch mit unechtem Golde durchwirkten seidenen und baumwollenen Läppchen also an einander gesetzt, dass keiner dem anderen gleich sahe.«
Eine sehr eigenartige Erscheinung bildet der Medicin-Mann der
Atna-Indianer (Fig. 21, 23), wenn er sich in seine Amtstracht geworfen hat. Die Schultern deckt der reich ornamentirte Mantel, dessen stilisirte Wolfs- und Vogelköpfe und grosse Augen in blauer, blassgelber und schwarzer Farbe einen phantastischen Eindruck hervorrufen. Gerade an der den
Nacken deckenden Stelle ist ein grosses Menschenantlitz mit offenem Munde und ungeheuren Zähnen aufgenäht (Fig. 23). Auf dem Kopfe trägt er eine Art von Helm oder die mit Fuchsfell verbrämte Mütze (Fig. 24). Das Gesicht wird durch eine bunte Holzmaske verdeckt, von denen eine ganze Garnitur ihm für die einzelnen Fälle zur Verfügung steht (Fig. 18, 19, 22, 26). Diese Masken stellen aber nicht die Dämonen der Krankheit dar. Um den Hals wird der weite Ring von Cedernbast gelegt, das besondere Abzeichen seiner Würde. Aber auch noch ein zweiter Halsring (Fig. 27) wird dem ersten hinzugefügt. An ihm hängt eine grosse Anzahl pfriemenartiger Knocheninstrumente, von denen eins oder mehrere die rohe Form einer Fischotter besitzen. Dieses
heilige Thier spielt als Schutz- und Hülfsgeist der Medicin-Männer eine ganz besonders wichtige Rolle. Die Pfriemen, welche die Fischotter darstellen, sind Amulete des Medicin-Mannes, während die anderen ihm als Kopfkratzer dienen (Fig. 28); denn er darf mit seinen Fingern sei
 nen Kopf nicht berühren.
nen Kopf nicht berühren.
Fig. 25. Medicin-Mann der Schwarzfuss-Indianer. Nach Catlin.
Um den Nacken ist eine Art von kurzer Pelzboa gelegt, welche jederseits in einen buntfarbigen Wolfskopf von Holz ausläuft. Ausserdem hat der Medicin-Mann sich noch allerlei Amulete in Holz, in Stein und in Knochen umgelegt, unter den Letzteren solche, die dazu dienen, des Patienten Seele zu halten. Es ist ein ornamentirter Knochen, der jederseits in einen geöffneten Thierrachen ausläuft.
Fausthandschuhe decken die Hände und um die Hüften ist ein schürzenartiger Gürtel gelegt, der ebenfalls mit einem Gesichte verziert ist; lange, schmale Lederstreifen hängen von ihm herab, und an ihrem freien Ende sind die hörnernen Hufe von Hirschen befestigt.

Fig. 26. Maske des Medicin-Mannes der Haidah-Indianer, ein Fabelthier vorstellend. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach einem Aquarell.
Von anderen nord-amerikanischen Indianern ist am bekanntesten die Tracht geworden, welche George Catlin bei dem Medicin-Manne der Schwarzfuss-Indianer am Yellowstone River angetroffen hatte (Fig. 25). Seine Skizze ist in viele volksthümliche Schriften übergegangen.
»Sein Kopf und Körper waren ganz mit der Haut eines gelben Bären bedeckt, dessen Kopf ihm als Maske diente, und dessen Klauen ihm auf die Handgelenke und die Knöchel herabreichten. Dieser Anzug ist das seltsamste Gemisch von Gegenständen des Thier- und Pflanzenreichs. An der Haut des gelben Bären, welcher hier selten vorkommt, daher als eine Ausnahme von der regelmässigen Ordnung der Natur und folglich als grosse Medicin betrachtet wird, sind Häute von mancherlei Thieren befestigt, die ebenfalls Anomalien oder Missbildungen und daher Medicin sind; ferner Häute von Schlangen, Fröschen und Fledermäusen, Schnäbel, Zehen und Schwänze von Vögeln, Hufe von Hirschen, Ziegen und Antilopen, mit einem Worte, etwas von Allem, was in diesem Theile der Welt schwimmt, fliegt oder läuft.«
Die Amtstracht eines Medicin-Mannes der Choctaw-Indianer wird uns bei Schoolcraft beschrieben:
»Er kam, gekleidet in die Felle wilder Thiere. Die Tatzen des Grizzly-Bären schmückten seinen Hals, die Tatzen vom Elenthier, der Wildkatze, dem Falken und Adler waren ebenfalls an verschiedenen Stellen der Gewandung befestigt. Die Helices der Ohren waren eingekerbt, wie eine Säge. Seine Ohren zierten Ringe von 3 Zoll im Durchmesser. In diesen herabhängenden Ringen waren kleine Muscheln lose befestigt, und ein mit Muscheln geschmückter Ring war auch in seiner Nase aufgehängt. Die Säume seiner Kleidung waren mit Muscheln befranzt, mit Schlangenzähnen und Klapperschlangenschwänzen.«
Die Anzüge, die Masken und die übrigen Gerätschaften der Medicin-Männer von Vancouver werden nach Jacobson nicht in seinem Hause aufbewahrt, sondern irgendwo in einem Gebüsch. Die Eingeborenen kennen den Versteck, aber sie wagen es nie, diese Sachen zu berühren.

Fig. 27. Halsring des Medicin-Mannes der Haidah-Indianer. Museum f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.
Von den Masken der Aerzte bei den Singhalesen haben wir im vierten Capitel bereits ausführlichen Bericht erstattet. Wir brauchen daher an dieser Stelle nicht wiederum darauf zurückzukommen.
Wenn der junge Candidat der Medicin in Persien ausgelernt zu haben glaubt, so »vertauscht er die Tatarenmütze mit dem Turban, lässt sich das Haupt ganz kahl scheeren, umgürtet seinen Leib mit einem breiten Shawl, in dem eine Rolle Papier und ein Tintenfass steckt, trägt einen hohen Stab und Pantoffeln von grünem Chagrinleder, geht mit gemessenen, pathetischen Schritten einher, spricht in salbungsvollem Tone, oder murmelt, während er einen grobkörnigen Rosenkranz durch die Finger gleiten lässt, arabische Gebetformeln. Durch die Strassen sieht man den Arzt gewöhnlich auf einem Maulthiere reiten, welches er zu diesem Zweck dem Pferde vorzieht.«
Der Baksa der Kirgisen trägt, im Gegensatze zu seinen ganz rasirten Stammesgenossen, nur die Mitte des Kopfes glatt rasirt, während er die Haare auf den Seiten des Kopfes etwa fünf Finger breit über den Schläfen und den Ohren stehen und ungefähr drei bis vier Zoll herabhängen lässt. In der Kleidung unterscheidet er sich nur dadurch, dass er ein etwas höheres Käpsel als die Uebrigen trägt und an demselben einen Federbüschel befestigt.
Wir müssen nun noch zu erfahren suchen, was bei den uncivilisirten Nationen für einen jungen Mann die Veranlassung abgiebt, sich dem ärztlichen Berufe zu widmen. Auch werden wir zu untersuchen haben, auf welche Weise seine wissenschaftliche und technische Ausbildung stattfindet und wann und unter welchen Bedingungen schliesslich seine Approbation erfolgt. Es tritt uns hierbei mehrfach die Angabe entgegen, dass der junge Mann sich deshalb dem medicinischen Studium zu widmen beschliesst, weil auch sein Vater dem ärztlichen Stande angehört, und diese Erblichkeit der ärztlichen Kunst lässt sich bisweilen durch mehrere Generationen verfolgen.
Solch eine Erblichkeit des ärztlichen Berufes finden wir bei den Zulu und den Betschuanen in Süd-Afrika, sowie bei den Japanern und bei einer Anzahl von Indianer-Stämmen, den Sahaptins, den Nez-Percéz, den Cayuse, den Walla Wallas und den Wascows. Die vier zuletzt genannten Nationen lassen aber auch bisweilen die Töchter den Beruf des Vaters erben. Hingegen treten, wie es den Anschein hat, nicht sämmtliche Kinder in des Vaters Fussstapfen, sondern der Vater trifft hierfür unter ihnen noch eine besondere Auswahl. Nach was für Grundsätzen er hierbei verfährt, und was für Umstände es sind, welche ihn in dieser Beziehung dem einen Kinde vor dem anderen den Vorzug geben lassen, das wird uns aber leider nicht berichtet.
Auch bei den sibirischen Völkern ist die Schamanenwürde erblich und sie geht auch hier bisweilen von dem Vater auf die Tochter über. »Das Charakteristische für das Schamanenthum, sagt Radloff, das diese Religionsrichtung von anderen unterscheidet, ist der Glaube an die enge Verbindung, die zwischen den jetzt lebenden Menschen und ihren längst verstorbenen Ahnen besteht. Der Glaube an die Kraft dieser Verbindung veranlasst eine ununterbrochene Verehrung der Vorfahren. Unter solchen Umständen konnte nur derjenige als Priester, als Schaman, auftreten und wirken, der in eine engere Verbindung mit seinen Vorfahren zu treten vermochte, oder mit anderen Worten, es war hier nur ein erbliches, den Familien angehöriges Schamanenthum möglich.«
Bei manchen Volksstämmen sind es gewisse Absonderlichkeiten der Geburt oder besondere Erlebnisse, welche dafür den Ausschlag geben, dass der junge Mensch sich dem ärztlichen Berufe widmet. So schreibt man in Liberia den Zwillingen ganz besondere Heilkräfte zu, und dieses ist die Ursache, warum die meisten von ihnen Aerzte werden. In Nias ergreifen die mit den Füssen voran Geborenen eine Specialität, nämlich die Behandlung der Verrenkungen, für deren Einrenkung man ihnen ganz besonders glückliche Prädispositionen zuschreibt. Ein Unfall mit glücklichem Ausgange war für einen Australneger in Victoria die Veranlassung, Arzt zu werden. Er sass auf dem hohen Aste eines Gummibaumes und sägte denselben ab, während er auf dem peripheren Ende ritt. Natürlicher Weise stürzte er schliesslich mit ihm herab. Aber er blieb unverletzt und das genügte, dass seine Landsleute ihn fortan als einen Medicin-Mann betrachteten.
Bei den Dieyerie in Süd-Australien werden diejenigen jungen Leute Aerzte, welche als Kinder den Teufel gesehen haben. Dieser Kutchie genannte Teufel erscheint den Betreffenden in einem beängstigenden Traume oder er belästigt sie als Alp. Die Lagergenossen sind dann überzeugt, dass der Teufel diesen Leuten erschienen sei und dass er ihnen die Macht und Fähigkeit mitgetheilt habe, Kranke zu heilen.
Wenn bei den nordamerikanischen Indianern zwei Personen gleichzeitig träumen, dass eins ihrer Kinder oder ein Freund sich in einem schlechten Gesundheitszustande befindet, dass etwas besteht, was ihn verhindere, weiter zu leben, so ist das ein Zeichen, dass er für den Orden der Midç ausersehen ist.
Die Eingeborenen von Victoria haben den Glauben, dass sich die Len-ban-morr, d. h. die Geister verstorbener Aerzte, diejenigen Leute aussuchen, welche sie zu Aerzten machen wollen. Sie treffen im Busche mit Solchem zusammen und unterweisen ihn in allen den Künsten und Kunstgriffen, welche ihm für seinen Beruf nothwendig sind, damit er grossen Einfluss in seinem Stamme gewinne.
Bei den Bilqula im nordwestlichen Canada ist die Würde des Medicin-Mannes ein freiwilliges Geschenk der Gottheit. Dieselbe lässt den Auserwählten in eine Krankheit verfallen, und während seines Leidens giebt ihm Snq einen Gesang, d. h. eine Beschwörungsformel, die er im tiefsten Geheimniss bewahren muss.
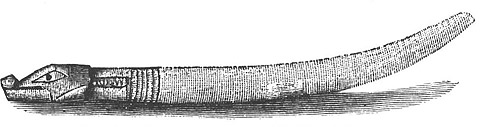
Fig. 28. Kopfkratzer des Medicin-Mannes der Haidah-Indianer. Museum für Völkerkunde, Berlin. – Nach Photographie.
Von den Xosa-Kaffern berichtet Kropf: »Der Doctor wird nach der Meinung der Kaffern durch übernatürliche Kraft zu seiner Kunst berufen und erlangt, wie er vorgiebt, seine Kenntniss von den medicinischen Eigenschaften der Pflanzen, der Hexen und Hexenmittel durch Offenbarung, die ihm die Geister zu Theil werden lassen. Der oder die Insanuse (meistens ein altes Weib) gelangt zu solchem Berufe durch seine oder ihre eigene Krankheit. Wenn solch ein betrügerisches, geschwätziges Weib krank wird, so sagt sie, sie könne die Kräfte des Wassers, der Erde, des Himmels, der Pferde u. s. w. sehen und werde dadurch in Unruhe versetzt. Diese ihre Aussage muss dann nebst der Krankheit dem Häuptling berichtet werden, damit dieser alles wisse. Die bereits promovirten Doctoren dieses Standes, die sich in dem Stamme befinden, werden zu Rathe gezogen, und wenn sie sich entscheiden, dass der Mann Beruf hat, so muss für ihn ein Stück Vieh zum Opfer gebracht werden. Darauf geht er einige Zeit in die Einsamkeit.«
Der zukünftige Schamane der sibirischen Volksstämme erhält, wie uns Radloff berichtet, »vom Vater nicht etwa Unterricht oder Unterweisung, auch bereitet er sich auf diesen Beruf nicht vor, nein, plötzlich kommt über ihn die Schamanenkraft, wie eine Krankheit, die den ganzen Menschen ergreift. Das durch die Kraft der Vorfahren zum Schamanen bestimmte Individuum fühlt plötzlich eine Mattigkeit und Abgespanntheit in den Gliedern, die sich durch ein heftiges Zittern kund thut. Es überfällt ihn ein heftiges, unnatürliches Gähnen, ein gewaltiger Druck liegt ihm auf der Brust, es drängt ihn plötzlich, heftige, unarticulirte Laute auszustossen, Fieberfrost schüttelt ihn, er rollt heftig mit den Augen, springt plötzlich auf und dreht sich wie besessen im Kreise herum, bis er schweissbedeckt niederstürzt und in epileptischen Zuckungen und Krämpfen sich am Boden wälzt. Seine Gliedmaassen sind ganz gefühllos, er ergreift, was ihm unter die Hände kommt, und verschluckt absichtslos Alles, was er mit den Händen gefasst hat, glühendes Eisen, Messer, Nadeln, Beile, ohne dass ihm durch dieses Verschlucken irgend welcher Schaden geschieht. Nach einiger Zeit giebt er das Verschluckte trocken und unversehrt von sich.«
Radloff hat, wie er angiebt, dieses allerdings nicht selber gesehen, aber sehr glaubwürdige Personen, welche Augenzeugen solcher Scenen gewesen sind, haben ihm dasselbe mitgetheilt.
Höchst absonderlich und phantastisch ist die Ansicht der Dacota-Indianer über die Entstehung ihrer Medicin-Männer.
» Dacota-Medicin-Männer treten nicht in die Existenz unter den gewöhnlichen Wirkungen der Naturgesetze, sondern nach ihrem Glauben erwachen diese Männer und Frauen zuerst in bewusster geistiger Existenz in der Form beschwingter Samen, so wie diejenigen der Distel, und sie werden durch den geistigen Einfluss der › Vier Winde‹ durch die Luftregionen geweht, bis sie gelegentlich zu dem Wohnort irgend eines Taku Wahan gebracht werden, von welchem sie in innige Gemeinschaft aufgenommen werden. Hier verbleiben sie, bis sie mit dem Charakter und den Fähigkeiten dieser Klasse von Göttern, deren Gäste sie zufällig sind, vertraut gemacht wurden, und bis diese sie selbst mit ihrem Geiste durchtränkt haben und sie bekannt geworden sind mit allen den Gesängen, Festen und Tänzen und Opferriten, welche die Götter für nöthig halten, den Menschen aufzuerlegen. Auf diese Weise gehen einige von ihnen durch eine Folge von Begeisterungen durch verschiedene Classen von Gottheiten, bis sie voll geheiligt und für die menschliche Incarnation vorbereitet sind. Besonders sind sie mit den unsichtbaren Wakan-Kräften der Götter begabt, ihrer Kenntniss und ihres Könnens und ihrem allgegenwärtigen Einfluss auf Geist, Instinkt und Leidenschaft. Sie sind unterrichtet, Krankheiten beizubringen und sie. zu heilen, verborgene Ursachen zu entdecken, Geräthschaften für den Krieg zu arbeiten und ihnen die Tomwan-Kraft der Götter mitzutheilen, und ferner eine solche Anwendung von Bemalungen zu machen, dass sie vor der Macht der Feinde zu schützen im Stande sind. Dieser Process der Inspiration wird bezeichnet als › Träumen von den Göttern‹. So vorbereitet, und ihre primitive Form behaltend, eilt der Halb-Gott wieder fort auf den Schwingen des Windes, über die Länge und Breite der Erde, bis er sorgfältig den Charakter und die Gebräuche aller verschiedenen Stämme der Menschen beobachtet hat; dann seinen Wohnort wählend, tritt er ein, ohne eine Mutter zu bekommen, und zu passender Zeit erscheint er unter den Menschen, um sein geheimnissvolles Vorhaben zu erfüllen, für das die Götter ihn bestimmt haben.«
Nach dem Glauben der Loango-Neger ist ihr erster Medicin-Mann ein Zauberer gewesen, der nach abgelegtem Geständniss, dass er die betreffende Erkrankung verursacht habe, dennoch dem über ihn verhängten Todesurtheil glücklich entging. Er erreichte dieses durch das Versprechen, die ihm bekannten Zaubermittel fortan zum Besten der Menschheit und nicht mehr zu ihrem Schaden in Anwendung zu bringen.
Dem Eintritt in das ärztliche Studium pflegen mancherlei körperliche und geistige Vorbereitungen vorherzugehen. Fasten und Beten, Waldeinsamkeit und Hallucinationen spielen dabei eine hervorragende Rolle. Durch Fasten und Beten erlangen die dem Bilqula benachbarten Stämme die ärztlichen Fähigkeiten. Durch frühzeitiges Fasten und Träumen muss sich der Indianer-Jüngling in Nord-Amerika zu der Candidatur für die Midç-Brüderschaft vorbereiten. Im Busche ist es, also in der Waldeinsamkeit, wo, wie wir sahen, bei den Australnegern der Geist des verstorbenen Medicin-Mannes dem von ihm ausgewählten Candidaten erscheint, um ihn in allem Nöthigen zu unterweisen. Der Candidat der Nez-Percéz muss sich in die Einsamkeit der Berge zurückziehen und er erhält daselbst von dem Wolfe die nöthige Anleitung. Bei den Ipurina-Indianern wird der junge Mann von seinem Lehrmeister in den Wald geschickt, und drei Monate lang muss er daselbst verweilen, strenge Diät haltend und hauptsächlich von bestimmten Blättern lebend. Seine Einsamkeit ist keine ganz vollkommene, denn ein Begleiter wird ihm mitgegeben, der ihn zu überwachen hat, damit er sich keinen Diätfehler zu Schulden kommen lasse. So lange harrt er im Walde aus, bis ihm die grosse Unze erscheint. Von dieser wird er entweder verschlungen, oder sie giebt ihm die vollständige Unterweisung in der ärztlichen Kunst, so dass er als ein fertiger Medicin-Mann in sein Heimathsdorf zurückkehrt.
Die zukünftigen Medicin-Männer der Waskows, der Cayuse und der Walla-Wallas beginnen ihre Candidatur bereits in dem 8. bis 10. Lebensjahre. Sie werden dann ausgesendet, um in einer Hütte oder auf der Erde zu schlafen. Hier erhalten sie dann die Besuche ihres guten Geistes Tamanoise, der ihnen in der Gestalt eines Bären, eines Büffels, eines Adlers oder irgend eines anderen wilden Thieres erscheint und ihnen wichtige Mittheilungen macht. Kehren sie am anderen Morgen zurück und haben sie keine Erscheinung gehabt, so muss in den nächsten Nächten der Versuch wiederholt werden und zwar unter strengstem Fasten, bis sich der Geist herablässt, zu erscheinen. Dann muss das Kind dem Arzte erzählen, was es gesehen und vernommen hat und dieser beginnt dann den Unterricht, wobei er das Kind zuerst unterweist, wie es diesen guten Geist herbeizurufen vermöge, damit er ihm in allen Unternehmungen den nöthigen Beistand angedeihen lasse.
Der zu der ärztlichen Candidatur zugelassene Xosa-Kaffer begiebt sich auf einige Zeit in die Einsamkeit und verweilt in seiner Hütte, ohne sich roth zu bemalen oder ein Rasirmesser an sein Haupt kommen zu lassen. Mit der Aussenwelt hält er keine Gemeinschaft, sondern er giebt sich ganz dem Unterrichte der Geister hin. Paviane, Leoparden und Schlangen, namentlich die fabelhafte Schlange Icanti und der Blitzvogel u. s. w. sind, wie die Leute glauben, sein Verkehr. Von ihnen träumt er und sie unterstützen ihn in seiner Arbeit. Er behauptet, dass die verstorbenen Häuptlinge mit Schilden ausgerüstet zu ihm kämen und mit ihm redeten. Er fängt in seiner Hütte an zu tanzen und sagt, dass ein Mann an seiner Beunruhigung Schuld sei; der Geist des Häuptlings habe ihm befohlen, denselben herauszuriechen. Kropf fügt hinzu: »ob die Krankheit wirklich oder simulirt ist, kann ich nicht sagen, genug, solcher Mann sieht ganz ausgemergelt aus.«
In Sumatra glauben die Leute, dass Jemand übernatürliche Eigenschaften, den Alemoe, sich anzueignen vermöge, mit welchem die Heilkraft, sowie Unverwundbarkeit und ungewöhnliche Vortheile im geschäftlichen Verkehre verbunden sind, wenn er Tage lang in einem Korbe sitzt, der von einem Balken des Hauses herabhängt. Dabei darf nur ein Minimum von Nahrung von ihm verzehrt werden und unter anhaltendem Singen von
»La iláha illa' llah«
muss er in seinem Herzen von den Geistern die Unverwundbarkeit erbitten. Beginnt der Korb zu schaukeln, so ist das der Beweis, dass nun der Geist in den Candidaten gefahren ist. Zur Probe wird er dann mit Lanzen und Schwertern gestochen und dann soll die Wunde sich schliessen und aufhören zu bluten, sobald der Verletzte mit der Hand darüber wischt.
Hungern und Fasten und Ueberreizungen des Nervensystems sind es also, welche die zukünftigen Medicin-Männer in Zustände versetzen, die an gewisse Formen der Hysterie erinnern und welche ohne allen Zweifel ganz nahe verwandt mit der Hypnose sind. Es werden uns noch mancherlei Beispiele, hiervon begegnen. Und so erscheint es auch natürlich, dass von Hause aus mit einem reizbaren Nervensysteme behaftete Individuen ganz besonders geeignet für die ärztliche Candidatur erscheinen. So sagt auch Ehrenreich von den Karayá-Indianern Brasiliens: »Zauberarzt kann jeder werden, der sich den dazu nothwendigen Kasteiungen unterzieht; nervös angelegte Individuen, Epileptiker u. s. w. sind natürlich besonders dazu geeignet.« Auch von einer Schamanin der Tungusen, deren persönliche Bekanntschaft Pallas machte, erzählten ihm die Leute, »dass sie als Mädchen lange Zeit in einer Art närrischer Melancholie gelebt habe.«
Es erklärt sich hierdurch vielleicht auch zum Theil, dass unter der Nachkommenschaft der Medicin-Männer wiederum für diesen Stand geeignete Individuen sich vorfinden. Denn in vielen Fällen wird doch wahrscheinlich die nervöse Reizbarkeit des Vaters sich auf eins oder mehrere seiner Kinder vererben und diesen so die Uebernahme des väterlichen Berufes um so mehr erleichtert sein.
Wenn diese Vorbereitungszeit, welche man vielleicht ganz passend als die Zeit der Berufung bezeichnen könnte, nun glücklich überstanden ist, dann beginnt in der Mehrzahl der Fälle nun erst der eigentliche Unterricht. Der Candidat schliesst sich an einen Medicin-Mann an, allein oder gemeinsam mit mehreren Genossen, und nun erhält er erst noch mancherlei Unterweisung, und durch die Assistenz bei seines Lehrherrn Heilproceduren wird er auch allmählich in die praktische Technik der Heilkunde eingeführt. So treffen wir denn auch nicht selten die Medicin-Männer, wenn sie ihre ärztliche Thätigkeit ausüben, von ihren Eleven begleitet, wobei sie auf die eine oder die andere Weise den mächtigen Meister unterstützen.
Von den Eré der Niasser wird es durch v. Rosenberg besonders betont, dass einige von ihnen die Fähigkeit besässen, ihre ärztlichen Kenntnisse auch Laien mitzutheilen und diese so zu Medicin-Männern heranzubilden. Nicht jeder Zauberarzt also kann einen Docenten abgeben; es scheinen dazu noch besondere geistige Veranlagungen nothwendig zu sein. Und hierbei spielt wahrscheinlich wohl nervöse Reizbarkeit eine hervorragende Rolle.
Der Ganga, der Zauberarzt der Loango-Neger, unterrichtet seinen Schüler hauptsächlich in der Herstellung der Milongo, d. h. der Zauber-Medicinen. Dann aber lernen sie auch das Prophezeien und eignen sich die Macht über einen bestimmten Fetisch an. Der Meister aber vermag mehreren Fetischen, oft bis zu zehn, zu gebieten. Bei einer ärztlichen Behandlung, welcher Bastian beiwohnte, sass der Student hinter seinem Lehrer und war emsig bemüht, alle die wilden und krampfhaften Bewegungen, welche dieser ausführte, genau in der gleichen Weise nachzumachen.
Das Amt der Medicin-Männer bei den Betschuanen ist, wie wir früher schon gesagt haben, erblich; doch werden, wie Emil Holub berichtet, auch wissbegierige junge Männer zu Doctoren herangebildet. »Der Aspirant hat als Honorar seinem Lehrer eine Kuh (gegenwärtig zumeist andere Objecte im gleichen Werthe), oder, falls derselbe in den Diamantfeldern Mali (Geld) verdient hat, 4-7 L. St. zu geben und wird darauf sofort in die Lehre genommen. Der medicinische Lehrcurs beginnt mit dem Ausgraben (das »Graben« bildet einen wichtigen Begriff und eine wichtige Manipulation bei vielen Ceremonien der Betschuanas) der Heilkräuter, wobei er von seinem Lehrmeister durch Wald und Flur geleitet, über die Species der Pflanzen, die zur Benutzung gelangenden Theile, sowie über die Jahres- und Tageszeit, zu welcher die Pflanze ausgegraben werden muss, belehrt wird. Die gesammelten Pflanzentheile werden sodann getrocknet, geröstet oder zerstampft und dann ein Pulver oder Absud derselben als Heilmittel erklärt, wobei gewisse Sprüche und Formalitäten bei der Zubereitung wie bei der Verabreichung zu beobachten sind, welche von den Aerzten bei der Behandlung wohlhabender Leute unter grossem Lärm inscenirt werden. Den letzten Lehrcurs bildet die Belehrung über das Werfen der » Dolós«, d. h. der Zauberwürfel.
Der Schüler des Tháy pháp in Annam muss einige Jahre einem Meister folgen. Er begleitet diesen und unterstützt ihn in der Ausübung seiner Funktionen. Er ordnet den Opfertisch und spielt während der Beschwörungsceremonien den Gong und die Rassel und lernt auf diese Weise die nothwendigen Maassnahmen.
Im Gegensatze zu den Schamanen des Altai-Gebietes muss der angehende Baksa der Kirgisen »von einem erfahrenen Mitgliede der Zunft unterrichtet werden, und erst nach längerem Zusammenleben ertheilt der Lehrmeister dem Schüler seinen Segen. Während der Lehrzeit begleitet der Schüler den Lehrer zu den Beschwörungen, ist ihm behülflich und übernimmt selbst einen Theil des Gesanges oder Rasselns mit dem Assa. Wenn zwei Baksa zusammenwirken, so ist immer der eine der Lehrer und der andere der Schüler.«
Bei der Midç-Brüderschaft muss der Candidat immer wieder seine während strengen Fastens ihn erfüllenden Träume dem Oberhaupte des Ordens mittheilen, und wenn diese Vorbedeutungen gute sind, so wird er aufgefordert, in seinen Vorbereitungen und Bestrebungen fortzufahren, bis man ihn für hinreichend vorbereitet für den Eintritt in die Brüderschaft hält. Dann wird er, durch ein Dampfbad geheiligt, einigen älteren Ordensbrüdern zur ferneren Ausbildung anvertraut, und von ihnen wird er in die grundlegenden Geheimnisse eingeweiht, welche die Kunst des Heilens und glücklichen Jagens, die Kraft der Beschwörungen und die Unschädlichmachung des Zaubers umfassen.
In seltenen Ausnahmefällen finden wir bei den Zulu Medicin-Männer, welche als Autodidakten zu betrachten sind. Auch von der oben bereits erwähnten Schamanin der Tungusen behaupteten dieses ihre Landsleute mit besonderem Stolze; jedoch traten Andere diesem entgegen und sie wussten auch den Schamanen namhaft zu machen, bei dem sie ihre Ausbildung erhalten hatte.
Von der ärztlichen Ausbildung in Persien sagt Polak: »Nur hier und da versammelt ein einzelner in Arabicis bewanderter Arzt einen kleinen Kreis von Schülern um sich, denen er privatim einige Capitel aus dem Canon der Abu Ali Sina ( Avicenna) und dessen Interpretation nach dem Schaereh-Asbab des Ibne Zekeriah mehr in sprachlicher, als in stofflicher Hinsicht unentgeltlich exponirt. In den allermeisten Fällen jedoch nimmt der angehende Mediciner ohne jede theoretische Vorbildung Dienste bei einem practischen Arzt und schreibt sich dessen Recepte ab.« Nach kurzer Zeit ist die Ausbildung vollendet.
Nach glücklich erfolgter Ausbildung und Vorbereitung folgt dann naturgemäss die Approbation des jungen Mediciners. Aber bei manchen Volksstämmen geht derselben noch ein besonderes Examen vorher.
Der kleine Candidat bei den Waskow-Indianern Canadas gilt schon von vornherein für durchgefallen, wenn er, aus der nächtlichen Einsamkeit zurückgekehrt, die Seinigen um Essen bittet.
An der Loango-Küste ziehen sich die Ganga zu gewissen Zeiten mit ihren Schülern in das Innere des Waldes zurück, um dieselben einzuweihen. Der Betretung dieses Waldes wird dann durch Verbotszeichen gewehrt. Nur die den Fetischen vermählten Frauen dürfen die Männer auf bestimmten Wegen besuchen.
Bei den Xosa-Kaffern muss der Candidat, wie oben erzählt, zur Vorbereitung einsam in seiner Hütte verweilen. Ist diese Zeit, für welche sie den Namen Ukutwasa, d. h. Neuwerden, gebrauchen, endlich vorüber, so treten die Aerzte zusammen, um auf Geheiss des Häuptlings den jungen Mann einem Examen zu unterwerfen, wozu der nächste schwere Krankheitsfall benutzt wird. Hier muss er zeigen, ob er im Stande ist, den Patienten wiederherzustellen, oder denjenigen, der gehext hat, herauszuriechen. Hat er das zuwege gebracht, so erfolgt seine Approbation in etwas absonderlicher Weise. Das Kraut oder die Wurzel, deren Eigenschaften die Geister ihm offenbart haben, wird in Stücke geschnitten und in Wasser gekocht. Diese Abkochung giesst ihm dann der vornehmste der Medicin-Männer über den Kopf, und diese Ceremonie beweist dem Volke, dass sie von jetzt ab in ihm eine geschickte und geeignete Persönlichkeit zu erblicken haben, um die Heilkunst oder die Kunst des Ausriechens von Hexereien auszuüben. Es kann dem Candidaten aber auch die Approbation verweigert werden. Dann muss er sich noch weiteren Unterricht urtheilen lassen und ist gezwungen, sich später noch einmal einer Prüfung zu unterziehen. Ein nochmaliges Durchfallen macht ihn jedoch untauglich für den ärztlichen Stand.
Wenn in Annam der junge Mediciner sich für fähig hält, selbständig zu practiciren, so macht er seinem Lehrmeister ein Geschenk, befragt die Gottheit durch Verbrennen eines an dieselbe gerichteten Gebetes, und wenn dann ein günstiger Tag ausgewählt ist, so wird ein Einführungsopfer dargebracht. Der Lehrmeister überreicht dem Candidaten dann ein Diplom, durch welches ihm die Herrschaft über eine gewisse Anzahl von Generalen und Soldaten übertragen wird. Unter diesen Truppen sind Geister zu verstehen. Gleichzeitig giebt er ihm das Handwerkszeug des zauberärztlichen Standes: eine Tafel, einen magischen Stab, ein Schwert, ein Gefäss, ein Tamtam und eine Glocke. Das Diplom überträgt dem neuen Meister das Recht, gleichzeitig aber auch die Verpflichtung, Krankheiten zu verjagen, um allgemeinen Frieden zu bitten, mit einem Worte sich für die Wohlfahrt des Volkes nützlich zu erweisen. Gleichzeitig wird ihm ein besonderer Name ertheilt, welcher nach seinem Geburtsjahre wechselt und für alle in demselben Jahre Geborenen der Gleiche ist.

Fig. 29. Holzfigur, den Schamanen-Candidaten darstellend. Golden ( Sibirien). Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.
Bei den Sibiriern sind es die Geister der Vorfahren selbst, welche dem jungen Candidaten die Approbation ertheilen. Wir haben oben bereits gesehen, wie sie ihn plötzlich in Krankheit verfallen lassen, um ihn für den Beruf des Schamanen vorzubereiten. »Alle diese Leiden, sagt Radloff, werden immer stärker, bis das so geplagte Individuum zuletzt die Schamanentrommel ergreift und zu schamanisiren beginnt. Dann erst beruhigt sich die Natur; die Kraft der Vorfahren ist in ihn übergegangen und er kann jetzt nicht anders, er muss schamanisiren.«
»Widersetzt sich der zum Schamanen Bestimmte dem Willen der Vorfahren, weigert er sich, zu schamanisiren, so setzt er sich schrecklichen Qualen aus, die entweder damit enden, dass der Betreffende entweder alle Geisteskraft überhaupt verliert, also blödsinnig und stumpf wird, oder dass er in wilden Wahnsinn verfällt und gewöhnlich sich nach kurzer Zeit ein Leides anthut oder im Paroxysmus stirbt.«
Alvord berichtet über die Approbation eines ärztlichen Candidaten bei den Indianer-Stämmen Oregons:
»Wenn der Novize die Mannbarkeit erreicht hat, so wird er in die heilige Profession in einem Medicin-Tanze eingeführt, welcher theilweise von religiösem Charakter ist oder eine Art von Gottesdienst für ihre Idole. Diese Idole sind die Geister verschiedener Thiere. Sie bewegen sich im Tanze, diese Thiere vorstellend, wie das Brüllen des Büffels und das Heulen des Wolfes. Ein interessanter Fall wurde mir, als im letzten Winter passirt, von einem Augenzeugen beschrieben. Der Novize wollte den Elch imitiren, der von seiner Jugend an der gute Geist und der Schutzgenius seines Lebens gewesen war. Zu bestimmten Jahreszeiten hat der Elch die Gewohnheit, sich im Schlamme zu wälzen. Der Indianer goss mehrere Eimer Wasser in eine vertiefte Stelle, in dem Ringe, in dem getanzt werden sollte, und nachdem er wie der Elch gepfiffen hatte, warf er sich nieder, um sich in der Lache zu wälzen. Während der Ceremonie der Einführung singen einige von den Hauptärzten gewisse Gesänge und Incantationen, und suchen durch bestimmte Vornahmen, welche dem Mesmerismus nicht unähnlich sind, den Candidaten in einen Schlaf zu versetzen. Wenn er aus diesem Schlafe erwacht, so wird er für fähig erklärt zu der Praxis in seinem erhabenen und mächtigen Berufe.«
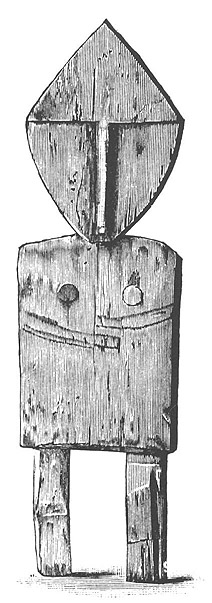
Fig. 30. Holzfigur, die Schamanen-Candidatin darstellend. Golden ( Sibirien). Mus. f. Völkerkunde, Berlin. Nach Photographie.
Bei den Golden in Sibirien muss der älteste Schamane, wenn Jemand die Schamanenwürde erlangen will, dessen Figur in ungefähr einem halben Meter Höhe in Holz schnitzen. Wenn die Figur vollendet ist, so hat der Candidat (Fig. 29) oder Candidatin (Fig. 30) die Schamanenwürde erlangt. Es scheint mir hierin eine versteckte Art von Approbationsrecht verborgen zu sein; denn wenn der Ober-Schamane die Candidaten nicht zulassen will, so braucht er ja nur ganz einfach die Vollendung der Figur zu unterlassen.
Die Candidatur für den Midç-Orden der nordamerikanischen Indianer währt, wie es scheint, nicht immer in allen Fällen die gleiche Zeit. Unterschiede in den Fähigkeiten der einzelnen Candidaten, vor allen Dingen aber auch Verschiedenheiten in ihren Vermögensverhältnissen scheinen hier eine wichtige Rolle zu spielen. Es muss der neu Einzuführende nämlich reiche Geschenke an Kleidung und Waffen als eine Art von Eintrittsgeld bezahlen, und bei dem Hinaufrücken in einen höheren Grad müssen immer grössere Gaben überliefert werden, so dass oft ein Jahre langes Sparen nothwendig wird, um das erwünschte Ziel zu erreichen. Ueber das Rituale der Einführung liegen uns ältere Nachrichten vor von Schoolcraft und ferner solche von W. J. Hoffman aus der allerjüngsten Zeit. Die Einführung wird zu einem grossen öffentlichen Feste des ganzen Stammes. Ausführliche Vorbereitungen gehen vorher. Dem besonderen Protector des Candidaten sendet Letzterer die Speisen zu einem Schmause zu, zu welchem er drei Collegen ladet. Diesen theilt er den Wunsch des Candidaten mit, rühmt ihnen seine Fähigkeiten, zählt ihnen die Einführungsgeschenke auf und gewinnt sie so zu seiner Unterstützung für die Ceremonien an dem feierlichen Tage. Nach der nöthigen Vorbereitung durch Fasten muss der Candidat nun mit seinen Meistern mehrere Tage ein Schwitzbad nehmen und zwar deren vier, wenn er vier Meister hat, und acht, wenn ihn acht Midç einführen sollen. In dem letzteren Falle dürfen dann zwei Schwitzbäder an einem Tage genommen werden. Beschwörungsgesänge und Unterweisung füllen die Zeit in der Schwitzhütte aus. Unterdess eilen Boten durchs Land, um die Ordensbrüder zum Feste zu laden. Ein mit Federn geschmückter Stock wird ihnen als Einladungszeichen übergeben. Diesen bringen sie zum Feste mit, und wer durch ernste Krankheit verhindert ist, zu erscheinen, der muss den Stock gleichsam als Quittung senden; wer aber ohne triftige Gründe ausbleibt oder zu spät zum Feste erscheint, der verfällt in eine hohe Strafe.
Beim Dorfe wird jetzt für das Einführungsfest an geeignetem Platze die Medicin-Hütte errichtet. Die Bezeichnung als Hütte ist eigentlich nicht genau; es ist nur eine rechteckige Einzäunung nach Art einer Hecke aus dichten Baumzweigen gebildet. An jeder Schmalseite ist in der Mitte eine Eingangsöffnung freigelassen. Ein Dach besitzt das Bauwerk nicht. Ein aufgerichteter Pfahl im Inneren der Hecke wird am Festtage mit den Geschenken des Candidaten behängt.
Bis zu dem angesetzten Tage haben die Geladenen sich versammelt und nach Landsmannschaften ihre Lager errichtet. Am Einführungstage selbst nehmen sie in der Umzäunung die ihnen angewiesenen Plätze ein. Die vier oder acht einführenden Midç kommen darauf im Gänsemarsche in den Festraum hinein (Fig. 31). Ihnen voran geht der Candidat mit den Geschenken an einer Stange; dabei singen sie:
»Sieh mich an! Sieh mich an! Sieh mich an!
Wie ich vorbereitet bin!«
Es werden dann allerlei Umgänge gemacht, Gesänge gesungen u. s. w. Aus dem reichen Ceremoniell kann nur Einzelnes herausgehoben werden. Einer der acht Midç hält eine Rede über die Kraft der Hülfsgeister ( Manidos), zu heilen und krank zu machen, eine Kraft, welche auch den Midçs gegeben ist und von Generation auf Generation übertragen wird. Dann folgt ein Umgang des Candidaten, der Jeden der Anwesenden einzeln begrüsst. Unter dem Gesange der Midç:
»Ich vermag einen Geist zu tödten mit meinem Medicin-Sack,
Gefertigt aus der Haut des männlichen Bären!«
kniet der Candidat auf einem Blanket nieder, die einführenden Midçs umwandern ihn, immer im Gänsemarsch, begrüssen ihn mit dem Titel » Nikanug«, d. h. » College«, und der Vorderste hält ihm den Medicin-Sack entgegen, als wenn es eine Büchse wäre, die er abfeuern wollte. Mit dem Rufe: » Ho ho ho ho! ho ho ho ho! ho ho! ho ho! ho!« thut er, als wenn er schösse. Der Candidat zittert und ist nur verwundet. Die acht Midç marschiren vorbei, der Nächste tritt an die Spitze und die Sache wird wiederholt. Jedesmal vermag der Schuss mit dem Medicin-Sack dem Candidaten nur eine Verwundung beizubringen. Beim achten Umgange tritt derjenige Midç an die Spitze des Zuges, der den zuvor im Gesange gefeierten Medicin-Sack aus Bärenfell trägt. Bevor er schiesst, hält er folgende Rede:
»Behalte diesen Medicin-Sack, welcher auf mich gekommen ist von meinem Grossvater durch meinen Vater; mein Vater sagte mir, dass ich niemals meinen Erfolg vermissen würde mit seiner Hülfe. Aber ich bin alt: helft mir, meine Brüder, dass ich die Kraft habe, zu schiessen, zu feuern auf diesen Mann, der hier auf seinen Knieen liegt: er hat ein rothes Zeichen an seinem Herzen; ich will gehen und auf dieses schiessen und meine Medicin wird nicht verfehlen, ihr Werk zu thun.«
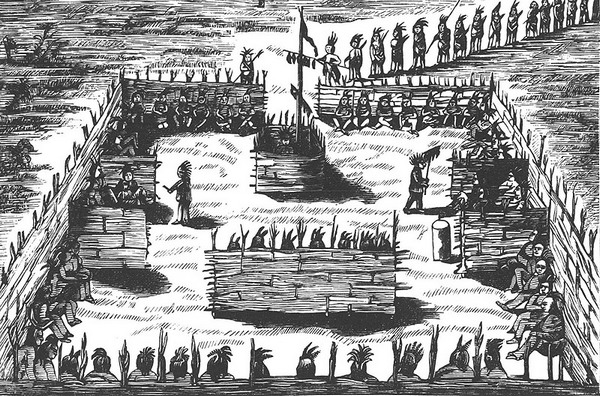
Fig. 31. Einführung eines Midç-Candidaten. Nach Schoolcraft.
Dann erfolgt der Schuss und der Candidat stürzt zu Boden, als wäre er todt.
Nun entsteht ein grosser Tumult, und unter dem Schall der Trommeln und Rasseln wird der die Geschenke tragende Pfosten umtanzt; die acht Midç werfen ihre Medicin-Säcke auf den Todten; dann richten sie ihn mit Anstrengung auf die Füsse und schreien ihn an: » Yâ ha! yâ ha!« Da erwacht der Todte; er erhält einen Heiltrunk und nun ist er wieder völlig gesund. Er begrüsst dann jeden Einzelnen mit dem Rufe Nikanug ( College) und singt darauf:
»Ich ebenfalls, ich bin ebenso, wie die Midç sind.«
Dann muss er den Medicinstein verschlucken, wovon wir später noch sprechen werden. Nun hat er das Recht, an den Midç-Schmäusen Theil zu nehmen, und um dies zu beweisen, nimmt er etwas Speise und vertheilt darauf mit kurzer Dankesrede die Geschenke an die acht einführenden Midç.
Nächstdem ist er noch verpflichtet, seine Midç-Kraft zu beweisen. Zu diesem Zwecke macht er acht Umgänge um den Festraum und streckt nach jedem einen der acht einführenden Midç durch einen Schuss mit dem Medicin-Sack todt zu Boden. Er ruft die Getödteten darauf in das Leben zurück und ein allgemeiner Medicin-Tanz beschliesst die Feier. Der Candidat ist nun eingeführt, aber der Unterricht wird danach noch fortgesetzt. Uebrigens finden sich je nach dem Indianer-Stamme bei diesen Einführungsfesten kleine Abweichungen.
Auch über das Lehensalter, in welchem die Medicin-Männer ihre ärztliche Praxis auszuüben beginnen, liegen uns vereinzelte Nachrichten vor. Die ersten Anfänge des ärztlichen Studiums werden, wie wir sahen, sehr häufig schon in frühem Knabenalter begonnen. Bei den Cayuse, den Walla-Walla und den Waskows in Oregon muss der Candidat erst die Mannbarkeit erreicht haben, ehe er als Novize eingeführt werden kann. Bei dem Dieyeri-Stamme in Süd-Australien wird es nicht für geeignet gehalten, dass die jungen Candidaten vor dem vollendeten zehnten Jahre die ärztliche Thätigkeit übernehmen; niemals aber dürfen sie practiciren, bevor die Beschneidung an ihnen ausgeführt ist,
Bei den Onkanagan in Britisch Columbien werden die Aerzte geschildert als »Männer, welche gewöhnlich schon den Meridian ihres Lebens überschritten haben«.
Die Medicin-Männer der Mabunde am Zambesi sind, wie Holub berichtet, nicht durch besondere Kennzeichen, sondern nur durch ihr hohes Alter von dem übrigen Volke zu unterscheiden.
So wie bei uns der practische Arzt wohl gern einmal seine Musse benutzt, um Krankenhäuser zu besuchen, Vorlesungen zu hören oder sich an wissenschaftlichen Cursen zu betheiligen, um hier und da ihm zum Bewusstsein gekommene Lücken in seinem Wissen und Können wiederum auszufüllen, so fühlen auch die Medicin-Männer bisweilen das Bedürfniss, ihre magische Heilkraft und ärztliche Kunstfertigkeit von Neuem wiederum zu stärken und zu kräftigen.
Die Medicin-Männer der Nez-Percéz-Indianer ziehen sich unter solchen Umständen von Neuem, ähnlich wie in ihrer Studienzeit, in die Berge zurück und pflegen dort Berathungen mit dem Wolfe. Die südcalifornischen Aerzte stärken sich durch den Verkehr mit übernatürlichen Wesen. Auch der Medicin-Mann der Klamath-Indianer in Oregon hat seinen übernatürlichen Lehrmeister. Gatschet schreibt darüber:
»Fussspuren, nicht grösser als diejenigen eines Baby, werden bisweilen in den höheren Bergen des Cascade Range gefunden. Die Indianer schreiben sie einem Zwerge zu, Namens Náhnías, dessen Körper allein von dem Beschwörer des Stammes gesehen werden kann. Der Zwerg giebt ihm seine Anweisung für die Heilung von Krankheiten oder Anderes und inspirirt ihn mit einer höheren Art von Kenntnissen.«
Darum besitzen die Klamath-Indianer auch einen Beschwörungsgesang » von dem Zwerge«.
Der Wer-raap der Australneger in Victoria wird von dem Lenba-moorr, dem Geiste des verstorbenen Medicin-Mannes, dem er seine Ausbildung zu verdanken hat, von Zeit zu Zeit besucht und er erhält von demselben Hülfe und Unterweisung. Bisweilen finden Nachts diese Besuche Statt und der gespenstige Gast theilt dann dabei dem Arzte mit, dass irgend eine bestimmte Person aus der Horde erkrankt sei und versorgt ihn mit den Mitteln, deren er zu der Behandlung bedarf.
Der Tháy pháp der Annamiten befehligt eine grosse Schaar von dienstbaren Geistern, welche er in militärischer Weise in Armeecorps und Regimenter getheilt hat. Scheint ihm sein Heer nicht stark genug, so begiebt er sich während hundert auf einander folgender Nächte um Mitternacht an einen einsamen Ort, wo er sich bei dem Scheine der Kerzen und bei dem Klange des Mô, Reis und Salz nach allen Himmelsrichtungen werfend, magischen Anrufungen überlässt. Diese Operation, welche zum Zweck hat, neue Truppen auszuheben, führt den Namen Luyên binh, oder in der Vulgärsprache Rù ma. Die Geister erscheinen dem Tháy pháp unter den erschrecklichsten Gestalten. Wenn er sich aber nicht schrecken lässt, so wird er schliesslich zu ihrem Herrn. Nun gehorchen sie seinen Befehlen und kämpfen für ihn gegen die bösen Geister. Dafür ernährt er sie und besoldet sie vollständig wie ein wirkliches Kriegsheer, aber mit Geld aus Papier.
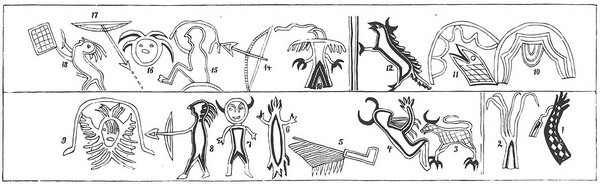
Fig. 32. Musikbrett der Wabeno der nordamerikanischen Indianer. Nach Schoolcraft.
Auch das Vorkommen medicinischer Lehrbücher wird uns von einzelnen Volksstämmen bestätigt. So erzählt van Hasselt, dass er sich in Alahanpandjang in Mittel- Sumatra mit vieler Mühe und grossen Kosten die Copie einer Handschrift über die Entstehung und die Heilung von Krankheiten verschafft habe, welche das Eigenthum eines berühmten eingeborenen Arztes war, der aus dem Manindjauischen stammte. Zum grössten Theile bestand dieses Lehrbuch in einer Aufzählung von bösen Geistern, durch welche die Krankheiten verursacht werden und von den langen, sinnlosen Beschwörungsformeln, welche hergesagt werden müssen, um den Einfluss dieser Dämonen zu brechen.
Jacobs fand bei den Eingeborenen von Bali eine Art von Heilmittellehre, welche den Namen Oesada führt. Auch hierin finden sich die für jede Krankheit nothwendigen Beschwörungsformeln, ausserdem aber auch viele inländische Recepte sowohl für innerlichen, als auch für äusserlichen Gebrauch. Auch von den Annamiten behauptet Landes, dass ihre Medicin-Männer Bücher besässen, in denen durch Wort und Bild die nothwendigen Beschwörungsceremonien zur Darstellung gebracht worden sind.
»Das medicinische Buch Khantharaxa, schreibt Bastian von Siam, handelt von den verschiedenen Krankheiten, und hat jeder derselben die Figur desjenigen Dämon oder Gottes beigefügt, dem Sühnopfer zu bringen sind. In den anatomischen Figuren der über das Massiren handelnden Bücher werden die Ansätze der Sen (Sehnen oder Nerven), die je nach dem Leiden zu berücksichtigen sind, mit Punkten bezeichnet. Die Mehrzahl der medicinischen Bücher wurden von den Eremiten verfasst.«
Bei den Harrarî fand Paulitschke Heilkräuterbücher, von deren einem er Einsicht nehmen konnte. Wiederholentlich hat sie die ägyptische Regierung durch Massenverbrennungen zu vernichten gesucht.
Ein Zauberarzt der Tamilen in Ceylon war des Leichenraubes beschuldigt worden. Eine bei ihm vorgenommene Haussuchung, von der schon in einem früheren Abschnitte die Rede war, hatte auch die Richtigkeit der Anklage bestätigt. Man fand bei dieser Gelegenheit auch eine Receptsammlung zur Herstellung schädlicher Mischungen und Gifte und ausserdem ein Manuscript mit Zauberzeichen und an » Siva den Vernichter« gerichteten Beschwörungsformeln »für alle nur denkbaren Fälle: um die Liebe eines Weibes zu verführen; um eine Entzweiung zwischen dem Gatten und der Gattin zu bewirken; um Abort hervorzurufen; um von einem Dämon besessen zu machen; um Krankheiten zu verursachen; um den Tod eines Feindes zu veranlassen. In der beträchtlichen Sammlung von Hausmitteln war unter den zahllosen Recepten, um Krankheiten zu verursachen, auch nicht ein einziges, um sie zu heilen.«

Fig. 33. Medicin-Hütte, vom grossen Geiste erfüllt. Von einem Musikbrett der Wabeno der nordamerikanischen Indianer. Nach Schoolcraft.
Sehr eigenthümlich und von hervorragendem ethnographischen Interesse sind gewisse Tafeln mit bildlichen Darstellungen, deren die Medicin-Männer der nordamerikanischen Indianer sich bedienen, und zwar sowohl die Midç, als auch die Wabeno. Sie werden mit dem Namen Musikbretter (Fig. 32) bezeichnet und sie enthalten einen zusammenhängenden Cyklus von bildlichen Darstellungen. Diese in bunten Farben hergestellten Bilder sind nicht von Schriftzeichen begleitet, und sie besitzen selber nicht etwa die Bedeutung einer Bilderschrift nach Art der ägyptischen Hieroglyphen. Jeder Bildercyklus gehört zu einer abgeschlossenen, rituellen Feier, zu einem Medicin-Tanze; jedes Bild stellt einen einzelnen Act des Medicin-Tanzes dar und erinnert den Medicin-Mann nicht allein daran, was er mit seinen Genossen in diesem Acte auszuführen hat, sondern es ruft in seinem Geiste auch das Erinnerungsbild wach für den ein für allemal feststehenden Gesang, welchen er in diesem Acte absingen muss. Bestimmte bildliche Darstellungen zeigen ihm an, dass in die feierliche Handlung eine Pause, ein Zwischenact, eingeschoben werden soll. Der Text für diese Gesänge ist ebenso, wie die Melodie, feststehend, und der Sänger muss beides vorher sicher auswendig gelernt haben, damit der Anblick der betreffenden Malerei ihm beides in die Erinnerung zurückruft. Eine ganz genaue Erläuterung des in Fig. 32 abgebildeten Musikbrettes wird im Anhang I bei der Erklärung der Abbildungen gegeben.
Es möge hier ein Beispiel gegeben werden: Wir sehen in der ersten Figur eines solchen Musikbrettes (Fig. 33) einen hohen Bogen, unter welchem sich ein grosser, breitbeinig stehender Vogel mit ausgebreiteten Flügeln befindet. Die Bedeutung dieses Bildes ist nun folgende: Der Bogen stellt den Festraum für den Medicin-Tanz dar, die sogenannte Medicin-Hütte. Sie ist ganz erfüllt mit der Gegenwart des grossen Geistes, welcher, wie versichert wird, mit Flügeln zu der Erde herabkam, um die Indianer in diesen Ceremonien zu unterrichten. Diese Bedeutung der Abbildung ist dem Midç ohne Weiteres verständlich und er weiss nun auch sofort, was er hierbei zu singen hat. Es lautet:
»Des grossen Geistes Hütte – ihr habt von ihr gehört – ich will sie betreten.«
Auch was rituell hierbei vorgeschrieben ist, wissen die Midç. Der Gesang wird wiederholt; ihr Führer schüttelt dabei die Rassel, und jedes Mitglied der Gesellschaft streckt flehend eine Hand gen Himmel. Alle stehen still, ohne zu tanzen; die Trommel wird bei diesem einleitenden Gesange nicht geschlagen.
Das Alles lehrt das eine Bild, natürlicher Weise aber nur für denjenigen, der genau in diese Geheimnisse eingeweiht ist und fest die feierlichen Gesangestexte im Kopfe hat. Ganz ebenso verhält es sich nun auch mit den folgenden Bildern, und für jede ihrer Ceremonien sind, wie gesagt, besondere Musikbretter vorhanden. In ihren Besitz zu gelangen ist natürlicher Weise sehr schwer. Auch für die Pausen in den Gesängen haben sie besondere gemalte Zeichen.
Die Medicin-Männer sind in ihrer Stellung und in ihrem Einflusse nicht alle einander gleich, wie wir bereits weiter oben bei der Besprechung der Concurrenz und des Brotneides gesehen haben. Ueberall wohl wird Alter, Geschick und Erfahrung den einen Arzt dem anderen überlegen erscheinen lassen. Und sicherlich wird der Meister wohl auch noch lange Zeit nach ihrer Approbation die Anerkennung seiner Schüler finden. Wir treffen aber auch ganz bestimmte Angaben darüber, dass bei einzelnen Völkern sich höherstehende Aerzte aus dem Kreise ihrer Collegen herausheben. Es wurde ja schon bei der Besprechung des ärztlichen Examens, das der Medicinal-Candidat der Xosa-Kaffern ablegen muss, darauf hingewiesen, dass schliesslich der »vornehmste« der examinirenden Aerzte dem glücklich bestandenen Examinanden zum Zeichen der Approbation die bestimmte Abkochung über den Kopf giessen muss.
Den vielen Zauberärzten der Loango-Küste steht der Ganga-Kunga vor. Er sendet die anderen Ganga, seine Schüler, zu Curen und Prophezeiungen aus. Seine Wohnung befindet sich ausserhalb des Dorfes am Waldessaum. Dort wird er von seinen Frauen bedient, deren vornehmste seine Mahlzeiten an einem abgelegenen Theile des Waldes zubereitet und dieselben dann, mit Palmblättern bedeckt, damit Niemandes Augen darauf fallen, ihm in die Hütte bringt, woselbst er das Mahl verzehrt, ohne von einem Fremden gesehen zu werden.
Wenn an der Loango-Küste bei einer ärztlichen Consultation der älteste Ganga, dessen Stimme bei Meinungsverschiedenheiten den Ausschlag giebt, herausfindet, dass einer der Medicin-Männer eine unrichtige Diagnose gestellt hat, so entzieht er ihm auf einige Zeit die Erlaubniss, die ärztliche Praxis auszuüben. Es ist das eine Disciplinargewalt, welche bei anderen Naturvölkern unbekannt zu sein scheint.
Auch bei den Schamanen in Sibirien haben wir Rangunterschiede zu verzeichnen, je nach der ihnen innewohnenden Kraft und Fähigkeit, bei ihren Beschwörungsceremonien in höhere Himmel einzudringen. Es giebt Schamanen, welche bis zum siebenten der siebzehn Himmel durchdringen können, während andere sich bis zum zehnten, ja einzelne sogar bis zum zwölften Himmel zu erheben vermögen. In besonders wichtigen Fällen werden die Letzteren oft aus weiten Entfernungen herbeigeholt.
Bei den Xosa-Kaffern begegnen wir ebenfalls einer sonst, wie es den Anschein hat, fast unbekannten Eigenthümlichkeit, nämlich eines besonderen Ehrentitels eines bestimmten Arztes. Es handelt sich um denjenigen Medicin-Mann, welcher dem Hofe des Königs zugetheilt ist. Derselbe führt den besonderen Titel: » Stab des Reiches.« Es giebt daselbst nach Kropf Häuptlinge, welche niemals ausgehen, ohne von einem Arzte begleitet zu sein.
Ueber die Rangverhältnisse der japanischen Aerzte lesen wir bei Wernich Folgendes: »Sehr selten, aber nicht ganz unerhört war es, dass Volksärzte, nachdem sie berühmt geworden waren, in den Rang der Fürstenärzte vorrückten; besonders scheint eine Ernennung solcher Volks- zu Siogun-Aerzten mehrmals stattgefunden zu haben. Alle Fürstenärzte waren in den Mechanismus der bestehenden Rangklassen eingefügt, so dass die niedrigsten Daimio-Aerzte hinter den berittenen und vor den Fuss-Samurais rangirten, welche die Daimios begleiteten. Höhere Daimio-Aerzte besassen eine der 15 bis 20 Rangstufen der Samurais, die höchsten gewöhnlich die vierte Rangstufe, welcher im Uebrigen die Leibwache der Fürsten angehörte. Die gewöhnlichen Daimio-Aerzte wurden zur 5. bis 7. Rangstufe gerechnet. Die Siogun-Aerzte standen in ganz ähnlichen Verhältnissen. Die wirklichen Leibärzte zählten zum reichsunmittelbaren, kleinen Adel, besassen ein Schloss und ein kleines Gut und waren dem Siogun direct unterthan. Unter den verschiedenen Rangelassen der Siogun-Aerzte scheint ein lebhaftes Avancement stattgefunden zu haben, auch genossen sie den Vorzug, durch besondere Titel für ihre Verdienste ausgezeichnet zu werden, deren Verleihung etwa der des Professorentitels an Künstler und Gelehrte bei uns analog war. Die Mikado-Aerzte endlich hatten den höchsten Rang unter den Aerzten; es gab ihrer etwa 50, darunter 20 höhere und ein ganz hoher, der grosse Einkünfte hatte und sogar eine Art von Disciplinargewalt über seine Collegen ausübte. Die Fürstenärzte bildeten so eine Art wohlgegliederter Hierarchie, die auf ihre Berufsgenossen aus dem Volk hoch herabblicken konnten; denn jeder Samurai stand den Volksclassen wie der Herr den Dienern gegenüber.«
Die Krone in Bezug auf dieses Titelwesen müssen wir aber den Siamesen zuerkennen. Wir sahen ja schon, dass sie ausser ihren Zauberärzten drei verschiedene Arten der Mo, der eigentlichen Aerzte haben, diejenigen des Königs, die der Adligen und die des Volkes. Von den Mo Luang, den königlichen Aerzten, werden einige zu Chao Krom ernannt; andere erhalten den Titel Palat Krom, noch andere werden Phra-Luang oder Khun-mûm oder Phantavai. Das sind also nicht weniger als fünf verschiedene Titelklassen. Dazu kommen nun noch die zu Begierungsdiensten ausgehobenen Phrai Phon Luang, welche in der Medicinal-Behörde einen um den anderen Monat in ihrer Arbeit abwechseln. »Sie müssen die Magazine der Arzneien bewahren und andere sind beauftragt, Heilkräuter zu sammeln.«
Im Allgemeinen hören wir nichts darüber, was denn ein Medicin-Mann unternimmt, wenn er selber einmal von Krankheit befallen wird; ob solch ein Erkrankter dann nach der bekannten Aufforderung handelt: Arzt, hilf Dir selber!
Nur einmal sind wir der Angabe begegnet, dass die Aerzte, die Kunkie, von dem Dieyerie-Stamme in Süd-Australien, wenn sie erkranken, sich einen anderen Kunkie herbeirufen lassen, um von diesem geheilt zu werden.
Wenn nun die Tage des Medicin-Mannes erfüllt sind und er aus diesem irdischen Leben scheidet, so ist es wohl nicht sehr zu verwundern, dass wir hier und da auch noch besonderen mystischen Anschauungen über sein Verhalten nach dem Tode begegnen. Von einer derselben haben wir bereits gesprochen. Es war der Glaube der Australneger von Victoria, dass der Geist eines verstorbenen Medicin-Mannes als Len-ba-moorr weiter existire, im Walde neue Schüler heranbilde und diesen auch noch später in ihrer ärztlichen Thätigkeit helfend und berathend zur Seite stehe. Die Medicin-Männer der Dacota-Indianer kehren nach ihrem Tode in die Wohnung desjenigen Gottes zurück, der sie bei Lebzeiten beseelt hatte. Darauf durchlaufen sie eine neue Incarnation, um einer anderen Generation zu dienen, entsprechend dem Willen der sie beherrschenden Gottheit. Vier Incarnationen (vier ist die heilige Zahl) haben sie auf diese Weise durchzumachen; dann kehren sie in ihr ursprüngliches Nichts zurück.
Wenn auch der Ipurina-Indianer Nichts über das Fortleben seines Medicin-Mannes nach dem Tode zu erzählen weiss, so ist doch auch hier das Sterben desselben von Fabel und Aberglauben umrankt. Diese Leute sind nämlich fest davon überzeugt, dass die Seelen ihrer sterbenden Medicin-Männer im Feuer zu dem Himmel auffahren.