
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Leser dieser Tagebuchblätter werden jetzt, von der Länge der Reise ermüdet, das Buch beiseite legen wollen. Draußen aber in der frischen, freien Luft von Ta tsien lu war keine Müdigkeit zu verspüren. Ich war beileibe noch nicht von dem wilden Nomadenleben gesättigt. Es gelüstete mich auch nicht im mindesten, auf einer der bequemen oder wenigstens verhältnismäßig bequemen und sicheren chinesischen Heerstraßen nach Hause zu ziehen. Der Frühling hatte ja eben wieder begonnen. Das Wintereis der tibetischen Flüsse und Bäche war geschwunden, alle Knospen sprangen. Hoch hinauf prangten Wiesen und Weiden in saftigstem Grün, und tausend bunte Blumen säumten die sprudelnden, kristallklaren Quellen. Da mag ein anderer an die Heimat denken! Gerade um diese Zeit ist es in Tibet am herrlichsten. Auch fehlte mir noch zur Abrundung meiner osttibetischen Eindrücke die ganze Länge der ethnographischen Grenze gegen die Provinzen Se tschuan und Kan su, und überdies warteten droben in Lan tschou fu die Sammlungen, die photographischen Platten und Notizblätter der Hoang ho- und Tschang tang-Reise, die an die Küste gebracht werden wollten.
Die Provinz Se tschuan ist auf allen unseren Karten sehr weit nach Westen greifend eingezeichnet, und große Teile Osttibets sind dadurch als chinesisches, bzw. setschuanesisches Land in Anspruch genommen; Plätze, an die der chinesische Handelsmann und Handwerker nur unter Lebensgefahr gelangt, erscheinen dadurch ebenso setschuanesisch wie die fruchtbare und dicht besiedelte Reisebene von Tscheng tu fu. Tatsächlich gibt aber die Ausdehnung der in den Karten eingetragenen Westgrenze dieser Provinz nur den Bereich des Interessengebiets des Gouvernements von Tscheng tu fu wieder, des Beamten, der zugleich das politische Bindeglied zwischen Peking und Lhasa ist. Die Frage, wie und wo heute die eigentliche, die sprachliche, ethnographische und völkische Grenze zwischen Tibetern und Chinesen verläuft, wird dadurch nicht berührt und war bis dahin in unserer Literatur offen geblieben.
Nach der Bretschneider- und Stieler-Karte wie auch nach den russischen Generalstabskarten, die das Beste zusammengetragen hatten, was bis dahin bekannt geworden war, sah es zwar aus, als sei alles Land im Norden von Ta tsien lu so ziemlich durchforscht, und doch hatten erst v. Rosthorn und Armand David kurze Notizen darüber gebracht. Chinesische Fluß- und Wegekarten hatten die Grundlagen der Karten gebildet, und beim näheren Zusehen zeigten sich die Gebirge zwischen den großen Flüssen nach Gutdünken der Kartographen aufgetragen. Wenige Fragen bei ortskundigen Eingeborenen genügten, um festzustellen, daß in bezug auf Orts- und Stammesnamen auf allen Karten große Unsicherheit, um nicht zu sagen, Verwirrung herrschte, und daß eine Reise dorthin mich rasch in terram incognitam bringen werde. In den Missionen in Ta tsien lu war von dem Lande im Norden der Stadt nur bekannt, daß man es »Kin tschuan« heiße, daß das Kin tschuan, die »Täler der Goldflüsse«, wegen seiner tiefen Schluchten äußerst schwer zu bereisen sei, und daß dort eine besondere Sprache gesprochen werde, die weder Chinesisch noch Tibetisch sei. Der Wunsch, diese Gegenden noch zum Schlusse zu besuchen, wurde immer lebhafter und lebhafter.
Als aber meine Hsi ning-Mannschaft erfuhr, daß ich einen neuen Zug in ihr gefürchtetes Tibeterland unternehmen wolle, da schüttelten sie sich, als ob sie eine gewaltige Gänsehaut überriesle. Mit glühendsten Farben malten sie mir alle Herrlichkeiten und lukullischen Genüsse der Großstadt Tscheng tu fu an die Wand. Ich sollte um's Himmels willen doch mit ihnen in die Ebene gehen. Für alle Hsi ning- und Lan tschou-Leute ist die Umgebung von Tscheng tu fu das Gelobte Land, das freilich die wenigsten von ihnen je einmal zu Gesicht bekommen. Als ich mich standhaft zeigte und meine Begleiter einsahen, daß ich mich nicht überzeugen ließ, wurde ich um Lösung der Verträge gebeten. Um keinen Preis wollten sie sich den Schrecken einer neuen Tibetreise unterziehen. Ich war genötigt, neues Personal anzuwerben. Und wieder gab es selbstverständlich Chinesen in Hülle und Fülle, die ihre Dienste anboten. Bald stellte sich täglich ein Dutzend neuer Bewerber bei mir vor. Alle aber verstanden keinen tibetischen Dialekt. Es waren Bauernsöhne oder Kuli vom »Unterland«, die gewohnt waren, auf den schlechtesten Fußwegen die schwersten Lasten zu tragen – meine stolzen Hsi ning-Leute nannten sie daher »lü tse«, Lastesel –, und alle waren ohne jede Ahnung von dem Lande, in das sie sich anheischig machten, mit mir zu gehen; keiner hatte auch nur den leisesten Begriff von den Mühsalen des »Ts'ao ti«. Sinnlos, wie Eintagsfliegen ins Licht, stürzten sie sich auf jeden in Aussicht stehenden Lohn.
Endlich bot sich als Dolmetscher für die Kin tschuan-Sprache ein Tibeter an, der aus Hsü tsching am mittleren großen Goldfluß stammte und seit einigen Jahren in Ta tsien lu lebte, so daß er nun sowohl seine Muttersprache von Kin tschuan beherrschte, als auch das in Ta tsien lu gesprochene Hochtibetisch, das mit dem Dialekt von Lhasa fast identisch ist, daneben aber auch bereits etwas Chinesisch erlernt hatte. Er nannte sich in der Stadt Ta tsien lu Yang, stammte jedoch von den freien Höfen und dem Geschlecht der Langgo in Kin tschuan. In seinem Heimatsdialekt nannten sie ihn »Brdyal«, ein Vorname, der in Kin tschuan häufig ist, und dem im Hochtibetischen vielleicht »ndschukdyal« entspricht, d. h. der im Drachenjahr geborene »dyal«. Außer ihm hatte ich noch zwei Dawo-Tibeter in Dienst genommen, die sich »Dardyi« und »Skewliu« nannten, kräftige Gestalten, die mich durch ihre Lebhaftigkeit und Geschmeidigkeit anzogen, die aber leider außer ihrem Heimatsdialekt von Dawo nur ganz schlecht Hochtibetisch und gar nicht Chinesisch sprachen.
Am 2. Juni verließ ich Ta tsien lu durch das Nordtor auf der Straße, die über Tai ning nach Dawo führt. Man reist ziemlich geradeaus nach Norden und folgt einem gewaltigen Trogtal, dessen steile Seitenhänge mit dichten Wäldern bestockt sind. In der Talsohle windet sich ein Bach von mäßiger Größe hin und her, und nur dann und wann unterbricht eine winzige Häusergruppe die Einsamkeit. Ich reiste sehr langsam, schonte nach Möglichkeit meine Tiere, die sich in der Stadt leider nur wenig hatten erholen können, erfreute mich an dem rosaweißen Blütenmeer der Rhododendren, die die Berge übergossen, und kam am dritten Tage an den Fuß des Da po schan.
Mit meiner Begleitung war ich noch nicht gut eingespielt. Wir verstanden uns oft schlecht und falsch, und die beiden Dawo-Leute waren gewalttätige Gesellen. Auch Brdyal verstand kein Wort, wenn sie sich in ihrer Dawo-Sprache unterhielten. Den Soldaten und die »Ban tsch'ai de«, die mir die Mandarinen mitgegeben hatten, bekam ich selten einmal zu Gesicht. Als ich am Morgen des zweiten Tages aus dem Zelt trat, brachten die beiden Dawo-Leute einen stattlichen gesattelten Bastardyak daher, den sie im Busch gefunden haben wollten. Nach einiger Zeit kamen die Besitzer, zum Glück Landsleute aus Dawo und Bekannte meines Skewliu und Dardyi. Meine beiden Biedermänner preßten ihnen aber trotzdem 3 Rupien als Finderlohn für das Tier ab, und als ich mir eine abfällige Bemerkung hierüber zu machen erlaubte, brummten sie mich bärbeißig an, als verstände ich nichts von ihren Sitten. Später brachten meine Diener und die Polizeisoldaten ganz gegen meinen Willen Ula-Lasttiere daher, die sie irgendwo in einem Lager geholt hatten, ohne daß ich darum wußte, weil ich ihnen zu langsam reiste. Während ich einigen Fasanen nachspürte, wurde mit nervöser Hast meine Bagage von meinen Tieren gerissen und auf die Ula geladen. Ich sah böse Geister, die ich mir gerufen, war aber ratlos, wie ich mein eigener Herr werden sollte, ohne daß sie mir an der nächsten Bergecke davonliefen.
5. Juni. Das Wetter blieb regnerisch wie die ganzen Tage zuvor. Wir mußten einen vollen Tag die Zelte hüten. Schnee und Regen peitschten ohne Unterlaß gegen meine Baumwollstoffwände. Wir waren in eine dichte Nebelwolke gehüllt, und kein Fleckchen in meinem Zelt blieb trocken. Die Soldaten verschwanden endgültig, über die Kälte und meine Reise schimpfend und fluchend. Erst nach acht Tagen ließen sie sich wieder zum Empfang ihres Trinkgelds bei mir sehen.
6. Juni. Die große Straße, die von Ta tsien lu nach Tai ning führt, geht östlich des hohen Dschara re über einen nicht gar hohen und mäßig steilen Bergpaß, den die Chinesen wegen eines kleinen Paßsees den »Hai tse schan« nennen. Unterhalb dieses Passes haben sie ein Rasthaus gebaut, »neue Herberge« (hsin dien) benannt. Das Haus zeichnet sich dadurch aus, daß man darin immer ein offenes, wärmendes Feuer und warmen Rauch findet. Der Wanderer aber, der nicht für die gedämpften faden Maiskuchen schwärmt, sucht dort vergebens nach einer Stärkung.
Um von hier aus nach Kin tschuan zu kommen, hat man an der »hsin dien« rechts abzubiegen und die östliche Bergkette zu überschreiten. Dieser zweite Paß führt den Namen »Da po schan«, etwa als »Berg mit dem großen Anstieg« zu übersetzen. Er führt auf eine Einsattelung von 4370 m hinauf und ist auf seiner Westseite, die gegen »hsin dien« abfällt, außerordentlich steil. Wir hatten vom Tage vorher 50 cm Neuschnee dazu bekommen – ich war hier baß verwundert über die großen Schneemengen, die in diesen Breiten das Frühjahr bringen konnte. Um die Höhendifferenz von 700 m zu überwinden, brauchten wir fast den ganzen Tag, und Mensch wie Vieh kamen in völlig erschöpftem Zustand oben an.
Am Da po schan erlebte ich zum ersten Male seit vielen Tagen einen strahlend klaren Morgen, und mit jedem Schritt, den wir uns durch den tiefen Schnee aufwärts gepflügt hatten, entrollte sich drüben über der Tai ning-Straße ein schöneres Alpenpanorama. Aus dem breiten, schwarz und schneelos heraufgähnenden Trogtal, das schnurgerade von »hsin dien« nach Ta tsien lu hinabläuft, hoben sich zahllose Schneegipfel, glitzernde Firnfelder und kühne Felsgrate und ragte als höchste alpine Majestät der heilig verehrte Dschara re. Mattes, graues, hartes Gletschereis ließ sich sogar unter dem Schnee in den höchsten Talenden entdecken. Die Gletscher sind freilich auch hier nur mehr Gletscherchen und wie in unseren heimischen Alpentälern bloß die schwächlichen Überreste von kraftstrotzenden Eismassen, die einst die Gebirgsklötze in ihre heutigen großen Umrisse umformten, und die den Tälern die für Herden- und Menschenpfade leichter begehbare U-Gestalt gegeben haben.
Hinter dem Da po schan führt der Weg bald in dichten Rhododendronbusch und zu einer breiten amphitheatralischen Talform. Rasch folgt jedoch dann ein steiler eingeschnittenes Tal mit Hochwaldstämmen. Am ersten trockenen Plätzchen, wo uns etwas Gras für die Tiere einlud, schlugen wir Lager. Kaum war abgeladen, schlief ich vor Müdigkeit ein, denn wir alle hatten mit voller Kraft den Tieren helfen müssen, die Lasten durch den Schnee zu schaffen. Als ich nach nicht gar langer Zeit wieder erwachte, quälte mich ein heilloser Schmerz in beiden Augen, der mir keine Ruhe mehr ließ. Die Diener sagten, es sei noch immer Tag, und die Sonne stehe hoch am Himmel, für mich aber war es Nacht. Ich war so vollkommen schneeblind geworden, daß ich selbst mit der größten Anstrengung die Lider nicht mehr aufbrachte. Ich lag im dunklen Zelte und strampelte wie ein Kind mit den Füßen, wenn die Entzündung der Bindehaut mir allzu heftige Schmerzen bereitete. Ein kleiner schwarzer Bär der Gattung Ursus tibetanus, den ich seit vier Wochen besaß, der im Lager frei umherlief und bei Nacht unter meine Bettdecke zu kriechen suchte, war mein Pfleger und Zeitvertreiber. Er brummte und zankte, wenn ich allzu unruhig auf meinem Schmerzenslager wurde, und kratzte und biß mich in aller Freundschaft in die Knöchel, wenn ich ihn beim Strampeln etwas unsanft und ungnädig berührte. Er biß aber immer rührend vorsichtig und wollte mir nicht weh tun, wie ein Hund, der mit seinem Herrn spielt. Anderthalb Tage lang mußte ich in dem Lager warten. Dann endlich war die Anschwellung soweit gewichen, daß ich mit Zuhilfenahme der Hände die Augenlider etwas auseinanderbrachte und in meiner Apotheke das notwendige Arzneimittel erkennen konnte.
Der Weitermarsch am 10. Juni, immer am gleichen Bache abwärts und durch dichten Wald, brachte uns zu dem Orte Mao niu gu oder tibetisch Brismed (2800 m). Das Dorf ist von Tibetern und Chinesen bewohnt und weist eine ziemliche Anzahl alter Befestigungstürme auf. Von links und rechts mündet hier ein größerer Wildbach in unser Tal ein, und gemeinsam waren nun die Wasser so tief, daß man sie nirgends mehr durchreiten konnte. Der Wald stand schön, hoch und dicht. Nur an einzelnen Stellen, wo winterliche Waldbrände entstanden waren, war er etwas gelichtet. Alte Fichten sind hier selten, Birken, Pappeln, Eichen, Ahorn überwiegen. Syringenbäume standen in voller Blüte. Viele Erdbeeren und Erdbeerblüten riefen mir die deutschen Wälder ins Gedächtnis. Außer Füchsen und dann und wann einer Affenbande, die mit viel Spektakel von Ast zu Ast flüchtete, bekamen wir nichts Jagdbares zu Gesicht.
Die Hsi ning-Pferde, an die schmalen und schlüpfrigen Wege nicht gewöhnt, fielen uns mehrfach über die Böschung hinunter und hielten uns auch an den zahllosen schwankenden Brücken immer lange auf. An jeder Brücke mußten die Lasten abgeladen und von uns Menschen einzeln hinübergetragen werden: die Tiere aber wurden an Kopf und Schwanz gehalten und erreichten halb gehoben, halb geschoben das andere Ufer. Zum Glück fühlte sich kein Pferd so wohl dabei, daß es Lust hatte, übermütige Sprünge zu machen. Einige Brücken mit einer Länge von dreißig Schritt hatten bloß eine einzige Planke, und diese lag nur mit einer Handbreite auf den Auslegern, die sich über das Flußufer hinausstreckten. Die Planken wippten und bogen sich unter jedem Tritt, daß die Pferde sich allein kaum auf den Füßen halten konnten. In 4 m Abstand darunter raste, brauste, schäumte der Kataraktstrom. Meiner alten Hündin Tschimo wurde dabei schwindlig, und immer erst, wenn alle vorbei waren, kroch sie behutsam auf dem Bauche über die Planke hinüber.
Am 12. Juni erreichte ich den Ort Romi (rong mi) Tschanggu, eine Niederlassung von dreihundert Häusern am Ufer des großen Goldflusses, des Da kin tschuan (spr.: tschin tschuan) ho, in der Eingeborenensprache mNiëngun. Ich sah hier viele tibetische Mädchen und Frauen mit reichem Silberschmuck, mit Ringen und Broschen und roten Korallen, die in ihre rund um den Kopf gelegten schwarzen Zöpfe eingeflochten werden. Die Frauen sind stets untersetzte, aber kräftige Gestalten und wesentlich kleiner als die an sich auch nicht großen eingeborenen Männer. Ihre Gesichter sind breit und breitknochig, und doch sind viele der Mädchen recht hübsch zu nennen. In ihrer Kleidung ist vor allem der mit Faltenbesatz versehene, grobe und dunkelbraune Rock auffallend, den sie sich aus der Wolle ihrer schwarzen Schafe anfertigen, und der mit dem Frauenrock der Lolo große Ähnlichkeiten besitzt.
Um die sich dicht zusammenschmiegenden Läden, um die Herbergen und Ya men und die einstöckigen Chinesenbuden erheben sich in Tschanggu als Einzelhöfe rings an den steilen Abhängen der Berge die Turmbauten der Tibeter. Die Eingeborenen sprechen hier noch ein Tibetisch, das dem von Ta tsien lu, bzw. Lhasa gleicht. Der Platz ist sehr warm. Die chinesische wilde Fächerpalme kommt hier bereits vor. Man ist nur noch 1985 m hoch.
Mit gelben Felsabbrüchen, jäh und himmelhoch, türmt sich jenseits des dumpf rauschenden Kin tschuan ho das Gebirge auf. Nirgends um Romi Tschanggu bleibt das Auge an einem ebenen Felde haften. Pferde, Esel, ja Rinder sind selbst in tibetischen Händen recht spärlich geworden, und alle Haustiere sind zwerghaft, am meisten die Pferde; diese letzteren sind auffallend engbrüstig und dünnknochig. Von den Menschen aber tragen erstaunlich viele Kröpfe.
Eine Viertelstunde unterhalb Romi Tschanggu führt eine große Bambushängebrücke über den Goldfluß hinüber. Sie stellt die Verbindung mit dem Tal des kleinen Goldflusses (chin.: hsiao kin tschuan ho) her, dessen Wasser sich nur 2 km weiter im Osten mit dem ohnedies schon mächtigen Strom des Da oder Großen Kin tschuan ho vereinigt. Unterhalb dieser Vereinigungsstelle wird der Strom von den Chinesen Tung ho, auch Yü tung ho – nach dem Stamm Yü tung Dieses Volk wohnt auf beiden Ufern des Goldflusses zwischen meinem Romi Tschanggu und Wa se kou, der Einmündungsstelle des Ta tsien lu-Flusses in den Kin tschuan. – und später auch Da tu ho, d. h. der Große Fährenfluß, genannt.
Ich versuchte am 13. Juni den Großen Goldfluß aufwärts zu verfolgen, schrak aber in Anbetracht meiner ungewandten Steppenpferde vor den allzu abschüssigen Wegen zurück und beschloß, auf dem sogenannten »da lu«, der Haupt- und Heerstraße, die nächste Mandarinenstadt Mu gung ting zu erreichen. Die Reise dorthin sollte nur drei Tage in Anspruch nehmen. Von Mu gung ting sollte ein ungefährlicher Weg über die Berge an den Oberlauf des Großen Goldflusses führen. Allein schon die Überschreitung der Hängebrücke bei Romi Tschanggu, die mir weit und breit als Wunder der Technik gerühmt wurde, machte meiner Maultier- und Pferdekarawane unvorhergesehenen Aufenthalt. Die Chinesen haben diese Brücke erst vor wenigen Jahrzehnten errichtet und haben eine Stelle ausgesucht, wo der Fluß in einem 50 m tiefen Felsgraben dahinschießt (Tafel XXVIII). Die Brücke hängt darum hoch über dem schäumenden Wasser in einer Länge von 122 Schritt (rund 100 m). Kein Stückchen Eisen hat hier Verwendung gefunden. Ein Dutzend dünner, aus Bambus geflochtener Trossen verbindet die beiden Seiten. Sie sind auf beiden Ufern in Häuschen an Pfählen verankert. Jede einzelne ist kurz vor der Verankerung über eine vertikale Walze gespannt und kann mittels dieser Walze je nach Bedürfnis und dem Grade der Feuchtigkeitseinwirkung gespannt oder gelockert werden. Die Gehbreite der Brücke beträgt 1,2 m. Um jedoch die Bambustaue nicht allzusehr zu belasten, bilden nur zwei schmale und dünne Längsbretter den Gehweg und Bodenbelag. Diese sind mit dünnen Häutestreifchen an die Querverbindungen angebunden, die in einem Abstand von nicht ganz 1 m aufeinanderfolgen und die Aufgabe haben, die Belastung auf die Gesamtheit der Taue zu verteilen.
Vor dem Betreten der Brücke müssen alle Pferde und Maulesel abgeladen werden. Ein Brückenwart ließ Tiere und Lasten nur einzeln hinüber. Mehrere meiner Pferde glitten auf den schmalen Planken aus und hingen zappelnd in dem unheimlich schwankenden, luftigen Tauwerk, das jeder Windzug bewegte, und das trotz seiner Walzen und Winden nie ganz gleichmäßig gespannt ist, sondern stets etwas windschief hängt. Der Brückenwart, offenbar an solcherlei Zwischenfälle mit den Pferden gewöhnt, nahm ohne Besinnen an einer anderen Stelle der Brücke einige Laufbretter weg und schob sie dem gestürzten Tier unter den Bauch, so daß es mit Hilfe von zwei Menschen wieder hoch kam. Die seitlichen Schwankungen, in die die Brücke namentlich beim Hinüberführen der Tiere geriet, betrugen mehr als ⅓ m, obwohl wir dabei nur tastend verfuhren und der Brückenwart und sein Gehilfe an zwei Stellen durch kunstvolles Anstemmen mit Händen und Füßen den allzu großen Ausschlägen entgegenzuwirken trachteten. Zur Ermunterung für mein Europäerauge bemerkte ich beim ersten Betreten der Brücke, daß eines der elf Bambustaue verfault war und zerrissen herunterhing. Es waren also genau genommen nur noch zehn Stück, die die Brücke zusammenhielten. Ich benötigte für meine fünfzehn Lasttiere und Lasten genau zweidreiviertel Stunden, um über den Fluß zu gelangen. So lange mußten wir die Brücke vollkommen für uns in Beschlag nehmen, und nur wenige Fußgänger konnten zwischendurchschlüpfen. Der Wärter achtete mit großer Strenge darauf, daß außer ihm nie mehr als vier Personen oder zwei Personen und ein lastfreies Pony gleichzeitig seine Brücke beschwerten. Einen ruhigen Posten hatte der Mann nicht inne. Außerdem, daß er auf die Spannung seiner Taue zu merken hatte, mußte er noch vielen beim Übergang helfen. So kam ein Fünfzigjähriger gerade des Wegs, als wir an der Arbeit waren; ihm wurde schwindlig, als er die weißen Gischtköpfe und die rasenden Wogen durch die Gehbretter hindurch dahinschießen sah. Mit zugekniffenen Augen klammerte er sich an den Wärter und ließ sich von ihm langsam hinüberbringen. Alle zehn Schritt blieben sie lange stehen und ließen die seitlichen und Längs-Schwingungen, die ihre Tritte hervorriefen, sich ausbaumeln.
Die große Straße, die das Kleine-Goldfluß-Tal, das Hsiao kin tschuan, aufwärts zieht, ging – fast möchte ich behaupten – in der Art dieser Hängebrücke weiter. Dabei blieb die Szenerie andauernd großzügig und herrlich (Tafel XXIX unten). Zu beiden Seiten des spitz eingeschnittenen Erosionstales stiegen die Berge, die Felsen und Wälder als gewaltig wuchtige Mauern empor, als wollten sie oben am Himmel über mir zusammenschlagen. Dann und wann brachten kleine Talerweiterungen, eine Siedlung und kleine Ackeranlagen etwas Abwechslung. Einige Dörfer an den steilen Berglehnen zeigten zahlreiche »tiao«, Steintürme, die aus den langen Kriegszeiten der Alteingesessenen mit den Chinesen stammten (Tafel XXX oben). Ungezählte Felstreppen und Brücken, nicht wenige von romantischem Reiz, waren mühevoll zu überschreiten und brachten manche Aufregung (Tafel XXIX unten).
In der Nacht vom 16. auf den 17. zog ein äußerst heftiges Gewitter mit Wolkenbruch durch das Tal, daß das Echo der Donnerschläge zwischen den hohen Felswänden nicht aufhören wollte und von allen Seiten eine Sintflut niederstürzte. Der Fluß schwoll in einer Stunde um 1½ m an. Die Einwohner – ich war bei Chinesen zu Gast, die in kleinen Hütten am Wege wohnten – zündeten ihre Weihrauchkerzchen an und steckten sie an die Türpfosten. In den kurzen Pausen zwischen den Donnerschlägen knatterten ohne Unterlaß ihre »Crackers«, und der Name »Yü hwang ye« wurde tausendfältig zur offenen Tür hinausgerufen.
Am Morgen des 17. waren wir kaum 2 km weiter gekommen, als uns die trüben hochgehenden Wogen des angeschwollenen Hsiao kin tschuan ho unerbittlich den Weg versperrten. 1½ m hoch spülten die Fluten auf der Wegspur, die als schmales Band am Fuß der jähen Talwände sich hinzog. Bei einem Versuch, das Hindernis zu nehmen, wurde unser Führer um Haaresbreite mit einem der Pferde von der Strömung weggespült. Es hieß warten, bis sich das Wasser verlaufen hatte, und da ich meine Pferdefuttervorräte im letzten Quartier nicht hatte erneuern können, so blieb ich mit den Lasten in einem Zelt am Flußufer liegen und sandte Skewliu und Dardyi mit den Tieren leer nach dem Kloster Tschortensa gomba zurück, an dem ich zwei Tage früher vorbeigekommen war. Am 18. Juni stieg das Wasser noch immer weiter, obwohl bei uns mittlerweile schönes Wetter eingesetzt hatte und das Thermometer mittags bis auf +34° gestiegen war. Am Nachmittag, als ich gerade wieder sehnsüchtig an meinem Pegel nach dem Wasserstand gesehen hatte, brachten die Wogen kurz hintereinander zwei Kulileichen. Wie riesige Schweinsblasen tanzten zwei umfangreiche Lasten auf der Oberfläche stromabwärts, und daran hingen die Körper der Unglücklichen, willenlos bald zwischen die treibenden Baumstämme gequetscht, bald gegen Felsklippen gestoßen.
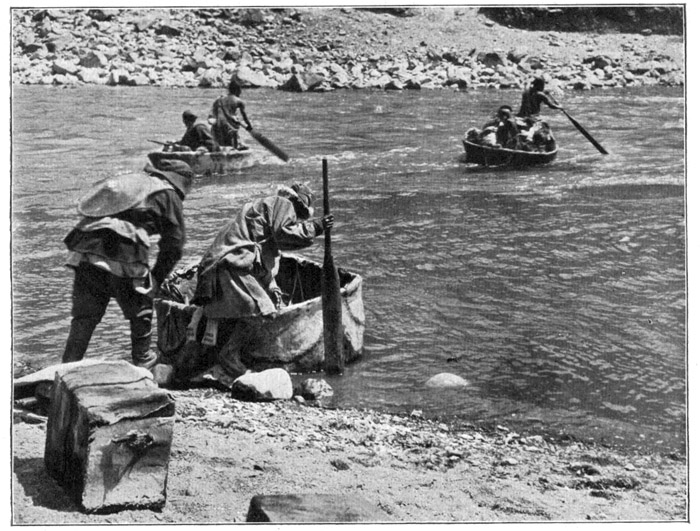
Tafel XXVII
Die Lederboote am Da tschü.

Tafel XXVII
Weihrauchöfchen auf einem tibetischen Hausdache. Links oben Zauberzweigchen als Schutz gegen Wetterschläge.
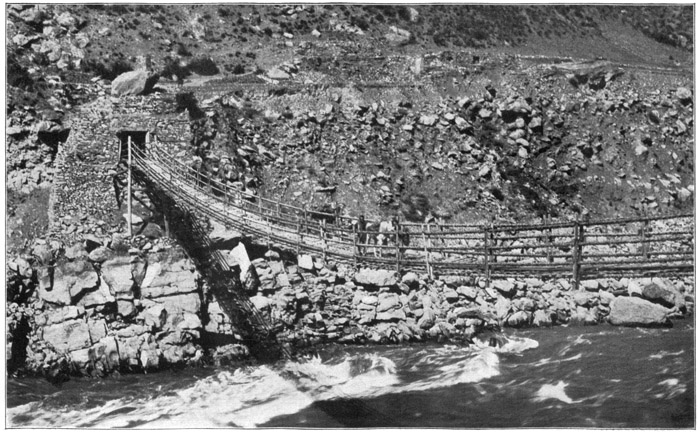
Tafel XXVIII
Bambushängebrücke über den Großen Goldstrom bei Romi Tschanggu.
Endlich am 19. fiel das Wasser um 4 Fuß. Gleichzeitig hatte ich fünfzehn Chinesen zusammengebracht, die meine Lasten weitertrugen. An einigen schwierigen und tiefen Stellen gingen die Kuli angeseilt, so daß keinem ein Unglück zustoßen konnte. Nach 2 km erreichten wir die Brücke Dä hsin kiao, wo der größte Teil der Träger ausgewechselt werden mußte, nachdem auch Skewliu und Dardyi mit den leeren Tieren glücklich durchgekommen waren.
Am 20. Juni war Hsin gai tse, der Marktvorort von Mu gung ting, erreicht. Hsin gai tse mit seinen sechs- bis siebentausend Einwohnern besitzt keine Mauer. Dazu hat es noch nicht gereicht. Die Siedlung ist noch zu neu. Schon der Name Hsin gai tse = neues Marktsträßchen sagt ja, daß die Chinesen sich hier noch nicht sehr lange – wenig über hundert Jahre – festgesetzt haben. Die Eingeborenen nennen den Platz Meino oder Meno, und schon frühe spielte er eine große Rolle. Acht Minuten weiter im Osten, scharf davon getrennt, liegt der Ya men-Platz Mu gung. Der Bezirksbeamte der Täler des Kleinen und Großen Goldflußlandes, der Mu gung ting, hat daselbst seinen Amtssitz. Wenige Häuser nur und ein Hotel für die verschiedenen Schu be und Tsien tsung, d. h. die Bezirkshauptleute, stehen hier auf einem felsigen Rücken hoch über dem Fluß beisammen.
Es hat seine guten Gründe, daß sich gerade in Hsin gai, Mu gung und Ying gai die Chinesen in größerer Zahl ansässig gemacht und hierher das Zentrum der Verwaltung verlegt haben. Nirgends weit und breit ist die gleiche Möglichkeit für eine kopfreiche Siedlung gegeben. Seitdem ich Hor Gantse verlassen, hatte ich nirgends mehr so viele und so dicht beieinanderliegende Äcker angetroffen. 50 und 100 m über dem eng zwischen Felswände eingekeilten Fluß erbreitert sich das Tal zu Terrassen, die ausgiebigen Anbau speziell von Mais und auch von Weizen, Bohnen und Buchweizen gestatten.
Der Mu gung ör fu ting ist der Verwalter und Richter der sogenannten westlichen Miao tse-Länder, die erst nach zwei großen und blutigen Kriegen in den Jahren 1747–1749, vor allem entscheidend und endgültig in den Jahren zwischen 1771 und 1776, von dem Mandschu-Kaiser Kien lung niedergerungen und unterworfen wurden und erst seither in das chinesische Verwaltungssystem eingegliedert und der chinesischen Kolonisation und Volksüberschwemmung geöffnet worden sind. Der Verwaltungsbezirk des Mu gung ting ist sehr ausgedehnt, denn nicht bloß das Tal des Kleinen Goldflusses, das Tsanla der Eingeborenen (chin.: hsiao kin [gespr.: tschin] tschuan), das ich seiner ganzen Länge nach von Romi Tschanggu bis Mu tschʿeng (tib.: Sumdo) auf eine Strecke von 133 km bereiste, sondern auch das Große-Goldfluß-Tal oberhalb Romi Tschanggu, das alte Rardan-Reich (bei den Eingeborenen heute rDyarong [rgyarong == das ausgedehnte oder chinesische Tal], chin.: da Kin tschuan und Hsü tsching benannt), gehört zu seiner Domäne. Gerade am Großen Goldfluß war im 18. Jahrhundert oberhalb der schmälsten Engen des Flusses, einige 50 km über Romi Tschanggu, eine Herrschaft entstanden, die der mächtigste Eingeborenenstaat weit und breit geworden war und erst gefallen ist, als der ehrgeizige Mandschu-Kaiser Kien lung eine gewaltige Militärmacht zu seiner Bezwingung aufgeboten und seine Elitetruppen und Mandschuren aus dem fernsten Nordosten herangezogen hatte.
Das Rardan-Reich am Großen Goldfluß, fernab von den chinesischen Kulturstraßen, hätte sich leicht bis heute erhalten können, wenn nicht die dortigen Machthaber gerade während der letzten Blüte und der größten Kampfeslust der Mandschu-Dynastie besonders unbedacht gehandelt und ihre Nachbarn durch Wegnahme ihrer Länder geplagt hätten, so daß diese immer wieder die Hilfe des Kaisers anriefen und in der Folge auch dem kaiserlichen Heer jeden möglichen Vorschub leisteten.
Aber nur in langwierigen Kämpfen konnte das Land von den Chinesen erobert werden. In allen Schluchten standen aus Steinen und mit Steintürmen geschmückte Burgen (dsong; chin.: kwan tschʿai tse), die auf schwer zugänglichen Bergen und von Bergspornen in die Täler herabdrohten. Alle Engen der großen Talschluchten und alle Grenzstraßen waren mit Gräben und Wällen und zahllosen schlanken Steintürmen, den Tschiao (chin.) oder Tiao gesperrt (Tafel XXX oben). Turm um Turm, Burg um Burg mußte belagert und genommen werden.
Chinesischmandschurische Staatsweisheit, ließ natürlich den Besiegten keine Gnade widerfahren. Die Dynastie in Rardan wurde wie die von Tsanla, ihren Verbündeten, ausgetilgt. In ihren Stammländern aber wurden chinesische Kolonisten angesiedelt. In den Seitentälern hat sich unter etwa einem Dutzend erblichen eingeborenen Beamten, den sogenannten »Darro« und den sogenannten »Tschungro« (erblichen Offizieren) ein Rest des Rardan-Volks erhalten und hält die Erinnerung an den glorreichen Untergang ihrer alten Freiheit aufrecht. Die Darro wohnen teilweise in den alten Burgen. Die meisten Befestigungen sind freilich in Tsanla und in Rardan zur Ruine geworden. Die Darro halten auf ihre Standesehre und heiraten nur unter sich. Die Würde eines Darro ist stets schon seit vielen Jahrhunderten in der Familie. Stirbt eine Darro-Familie aus, so wird der zweite Sohn eines anderen Darro adoptiert. Neben diesem Häuptlingsadel, den Darro, und dem Offiziersadel, den Tschungro-Familien, unterscheidet man freie Krieger-Bauern (Tschralba oder Kralba : Kral, tib. == Dienst) und weiterhin Steuer-Bauern (Tokdamba), endlich Nachkommen von Unfreien, bzw. von Sklaven (Gonag, tib. und kin tschuanesisch, d. h. Schwarzköpfe), sowie noch wirkliche Leibeigene oder Sklaven (Kurme). Daneben gibt es Priester (rgofsches, kin tschuanesisch) und endlich Handwerker, die sich beide aus zweitgeborenen Söhnen von Tschralba- oder Tokdamba-Bauern rekrutieren und auch zum Teil aus Eingewanderten von anderen Stämmen.
Alles Land in Groß- und Klein-Kin tschuan befindet sich seit der Eroberung zur Hälfte in chinesischer, zur Hälfte in tibetischer Verwaltung. Für den chinesischen Teil von Grund und Boden müssen die Eigentümer, einerlei ob sie Chinesen oder Tibeter sind, an die Tai ye, bzw. an den Mu gung ting Grundsteuern bezahlen, ganz wie an irgend einem anderen Orte in China. Sonstige Lasten und Fronen haben die Besitzer nicht. Dieses Verhältnis zwischen Ackerbauern und Staat mutet deshalb schon sehr modern und demokratisch an. Der tibetische Teil von Grund und Boden dagegen wird als Eigentum der verschiedenen Darro angesehen, von denen die Tschralba-Bauernfamilien, die Dienstmannen, einzelne Stücke als erbliche Lehen gegen Gestellung je eines Kriegers erhalten haben. Das Tschralba-Land ist Soldatenland. Es ist unteilbar. Es ist auch unverkäuflich, und nur der Erntebetrag ist verpfändbar. Der Darro kann es einem anderen geben, wenn die Familie sich ein schwereres Vergehen zuschulden kommen läßt. Die Tschralba bezahlen keinerlei Abgaben außer ein paar Scheffeln Getreide als Familiensteuer für den chinesischen Beamten. Sie haben jedoch in Friedenszeiten jährlich zwanzig bis dreißig Tage auf eigene Kosten als Gefolgsmann des Darro tätig zu sein und haben vorkommendenfalls auch Ula (hier Wolag ausgesprochen), d. h. unbezahlte Beförderung von Gepäck bis zum nächsten Ort, zu leisten, in Kriegszeiten aber gleichfalls ohne weitere Entschädigung in den Kampf zu ziehen. Jeder Krieger hat seine Waffen und Pferde selbst anzuschaffen und instand zu halten, wofür der Tschungro, der zugleich Offizier, Gemeindeältester, unterster Richter usw. ist, die Verantwortung trägt. Exerziert wird seit der Besetzung durch die Chinesen nicht mehr, nur im Herbst ist eine zweitägige Parade mit Preisschießen u. dgl. An diesem Tage trägt jeder gemeine Tschralba die alte Rardankopfbedeckung, den Kischtschikgo, ein Pantherfell, das als 30 cm breiter Streifen den Rücken hinabläuft, und dessen Kopf zu einer Mütze umgearbeitet ist. Die Offiziere und Unteroffiziere tragen jetzt chinesische Hüte und teilweise Knöpfe darauf. Bei dieser Herbstkontrollversammlung darf kein Tschralba fehlen. Es werden Belohnungen und Bestrafungen verlesen, und jeder Mann erhält 3 Tael als kaiserliches Entgelt.
Da der Besitz des Tschralba-Gutes mit der Gestellung eines kriegstüchtigen Mannes verknüpft ist, so ist leicht verständlich, daß derjenige, der den Soldatendienst ableistet, auch als der eigentliche Herr des Gutes gilt. Der Vater übergibt seinem Sohne immer sehr früh – kurze Zeit nachdem er ihn verheiratet hat – die Pflichten des Tschralba und nimmt von da ab eine mehr beratende Stellung im Haushalt ein. Wenn der junge Sohn aber seinen Vater schlecht behandelt, so kann der Vater das Haus verlassen und von dem Sohne eine auskömmliche Rente verlangen.
Das tibetische Land ist jedoch nicht ganz unter die Tschralba-Familien verteilt. Weite Waldgebiete sind ungerodet und werden auf Verlangen vom Darro neugegründeten Familien überlassen. Diese haben dafür dem Darro Pacht (tokdam, kin.) zu entrichten, und solche Familien haben daher den Namen Tokdamba. Die Pacht ist ziemlich hoch und richtet sich nach der Menge des notwendigen Saatgutes) sie ist wesentlich höher als die chinesische Grundsteuer.
Sind schon in den Ländern der Reguli des Yü schu, von Dergi u. a. m. die älteren Lamasekten, die Nimaba, Karmaba, Saskyaba noch in großer Blüte – mit Ausnahme der Horba-Staaten, in denen auch durch die Kuku nor-Mongolen des Guschri Khan den Gelugba zur Herrschaft verhelfen wurde –, so ist ein großer Teil der rDyarong-Herrschaften sogar noch konservativer geblieben und hält am alten tibetischen Bönbo-Glauben fest. In Bati, Bawang, in Somo und Tsʿa kou haben sich bis heute Bönbo-Klöster erhalten, und in Tsanla und Rardan leben noch viele Betätiger des alten Bönboismus oder Schamanismus und sind eifrige Regen- und Hagelbeschwörer und Seelenberuhiger und verspritzen noch das Blut der Hähne und Fasanen. Für die Bönbo ist der Berg rDyarongmurdo, ein steiler Felsgipfel östlich von Bali, das Hauptheiligtum der Gegend. Sein Ruf ist weit herum bekannt, und Scharen von Pilgern zieht er jährlich an, die ihn links oder auch rechts herum wie Gelugba umkreisen. Kaiser Kien lung hat in den durch den großen Krieg unterworfenen Gebieten die Bönbo-Klöster, vor allem das Kloster Yung dschung lha sden, in Gelugba-Heiligtümer umgewandelt. Er erst hat dieser Sekte hier Ansehen verschafft. Die Chinesen machten Yung dschung lha sden (chin.: Kwan hoa se) auch zum Sitz eines Kambo-Oberabtes und geistlichen Vorstehers ihres Landes. Auf Befehl der mandschurischen Offiziere wurden damals alle Bönbo-Wandbilder der alten Klöster übertüncht. Die Bönbo-Götter und -Bücher wurden unter den Fundamenten des Du kang vergraben, und nur links drehende Hakenkreuze und andere Symbole im Fußboden erinnern noch an die Zeit vor der zwangsweisen Bekehrung durch die Mandschu. Wer heute in Rardan und Tsanla offen Bönbo-Kult betreibt und heiligzuhaltende Stätten ganz offen linksherum umkreist, dem wird vom Kambo der Prozeß gemacht. Schon mancher Ketzer ist daraufhin vom Tai ye in Tsung hoa wegen Zauberei und Hexerei geköpft worden. Den chinesischen Beamten sind die Bönbo seit dem großen Krieg als arge Hexenmeister verhaßt, sie sollen während des Kriegs Regen und Schnee heraufbeschworen und den Vormarsch des Heeres gehemmt haben.
Die großen Festtage in Kin tschuan sind am 8. des ersten chinesischen Monats, im April, und am 5. des fünften und 12. des elften Monats. Das größte Volksfest heißt »Gala teise«, Hasenfest (gala = gale = Hase, teise = Fest, kin.); es wird um den 12. und 13. des elften chinesischen Monats gefeiert und gilt als altes, einheimisches Neujahrsfest. Der ganze Monat heißt der Hasenmonat
Der Hase spielt auch in allen tibetischen Märchen eine wichtige Rolle wie etwa unser Reineke Fuchs. Hasen sind heilig, sie werden deshalb auch selten gejagt und selten gerne gegessen. Nach der alten taoistischen Volksphilosophie sitzt im Mond ein Hase, und die tibetischen Bönbo erzählen dasselbe.
Für sehr kluge und heilig zu achtende Tiere werden auch die Affen gehalten. Bekannt ist ja, daß die Tibeter von jeher lehrten, daß sie von Affen abstammen, und daß deshalb die wenigsten erlauben, daß man auf Affen Jagd macht.. Das Fest fällt in die Zeit der kürzesten Tage, und Sonne, Mond und Sterne spielen dabei noch heute eine gewisse Rolle. Das chinesische Neujahr, das etwa sechs Wochen später fällt, wird im Gegensatz hierzu das Schlangenneujahrsfest »kawri teise« genannt, da es nach dem Tierzyklus gerechnet im Schlangen- (kawri-) Monat gefeiert wird. Jede Familie bäckt für Gala teise große flache Brote aus Weizenmehl, die die Sonnenscheibe in einem Durchmesser von ½ m,
die Mondsichel, den Vater und die Mutter und alle lebenden Glieder und eine Urmutter (Dianemu) der Familie vorstellen sollen. Diese Brote werden am Neujahrsfest für zwei Tage auf einem Tisch im Wohn- und Küchenraum des Hauses aufgestellt, dazu kommen zwei Figuren, die einem Hahn (begu; kin.) gleichen. In die Mitte aber wird ein »sgoldo« gestellt, eine gebackene Tierfigur (? Vogelfigur), die auf einem senkrechten Stäbchen das Symbol der lamaistischen Köstlichkeiten (norbo; tib. und kin.) trägt. In dem Raum, in dem die Brote aufgestellt sind, werden mit Kreide oder mit Weizenmehl noch Sonne, Mond und Sterne, auch Muscheltrompeten und »bembe« (tib.: bum pa, sanskr.: mangalakalâça), d. h. Weihwassergefäße, an die Wände gemalt, und am Neujahrstage selbst entzündet man Butterlampen (kin.: marme, tib.: dschodmi). Man macht aber keinen Ko tou davor. Kein Hausvater vergißt dagegen an diesem Fest in eine Schüssel mit kaltem Wasser heiße Butter auszugießen, um aus den Formen, die dabei entstehen, die kommende Ernte zu ersehen. Mondsichelförmige Gebilde vor allem sagen ein glückliches Jahr an. Wer aber im vergangenen Jahre einen Trauerfall in der Familie hatte, unterläßt an Gala teise das Brotbacken und malt auch keine Sonnen mit weißem Mehl an die Wunde; er bleibt für ein Jahr »schwarz«. Am Gala teise-Tag ißt jedermann in Kin tschuan Tsamba, was hier sonst
nie gegessen wird; auch bekommt alles Vieh, das die Familie besitzt, an diesem Tage dasselbe Essen wie die Menschen und auch Butter und Honig in seinen Tsamba-Teig.
Am 8. des ersten chinesischen Monats nach chinesisch Neujahr, das mit der zunehmenden Einwanderung mehr und mehr auch von den Eingeborenen gefeiert wird – ein Schwein wird an diesem Tag gesotten und auf das Dach gestellt – ist »tsʿatsʿa bie«. Jede Familie eines Dorfes hat eine bestimmte Anzahl Ton-tsʿatsʿa (hundert bis tausend Stück) mit je drei Gerstenkörnern darin an einen bestimmten Platz zu tragen. Dazu beten die Mönche (meist Gelugba) und weihen sie. Dadurch werden Seuchen verhindert. Abends versammelt man sich ähnlich wie am Schluß des Gala teise-Festes und tanzt, singt und trinkt, und dies wiederholt sich meist am darauffolgenden Tage.
Beim Frühlingsfest, im April, wenn eben die Blätter ausschlagen, zieht man mit den Bönbo-Priestern oder Hagelwächtern (kin.: drmud waya) in die Berge zu einem Lab rtse (kin.: mkarse, s wie franz. z). Die Priester lesen dort Hagelbeschwörungen zum Schutz für die kommende Ernte, und nach der Feier eilt jeder, so schnell ihn seine Beine tragen können, nach seinem Acker und steckt dort die von den Bönbo geweihten Birkenzweige, die mit Hahnenblut und Fasanenfedern beschmiert sind, in den Boden, an die Ecken der Felder und in die Mitte, wo drei weiße Steine das »Herz« des Ackers bezeichnen. Die Zeit zum Säen der verschiedenen Getreidearten bestimmen die Bauern nach der Sonne. Sie haben an ihrem Fenstergesims Marken für den Schatten der aufgehenden Sonne oder wissen, hinter welcher Bergzacke die Sonne verschwinden muß, um die Wintersaat oder dies oder jenes Saatgut dem Boden anzuvertrauen.
Der 5. des fünften Monats ist zugleich ein chinesischer Feiertag. Er fällt in die Zeit des längsten Tages und der Sommersonnenwende. Die Kin tschuan-Leute nennen das Fest Dáwamnio (chin.: wu yüe dang wu). Es dauert zwei Tage wie das alte Neujahrsfest. Am frühen Morgen reiten die Männer auf einen Berg und entzünden dort ein großes wohlriechendes Rauchopfer für die Götter. Nachher zieht alt und jung nach einem Festplatz und unterhält sich mit Preisschießen. Wettlaufen, Hochspringen, Stabspringen u. a. m. Jede Familie des Dorfes bringt Schnaps und Brot mit, und alle singen die alten Lieder, Erinnerungen an die Helden und an die schöne Zeit der Rardan-Könige, als die verhaßten chinesischen Eindringlinge sich noch nicht bei ihnen eingenistet hatten und die Sitten verdarben. In zwei langen Reihen, links die Männlein, rechts die Weiblein, tanzt, man dazu, das ganze Dorf, oft vierzig Männer und vierzig Frauen und Fräulein, tritt man vor- und rückwärts mit gezierten Bein- und Fußdrehungen, stampft man zu den Liedern den Takt mit den Füßen – ein Paar Sohlen muß das Fest jeden jungen Burschen kosten – und umkreist einen riesigen Tonkrug, gefüllt mit ihrem Sorgenvertreiber, dem »arak« (kin.), dem Gerstenschnaps.
»Fest stellt das Schloß zu L(e)u« – lautet eines der Lieder, das schon ein Rardan-König gesungen haben soll – »Tiger aus den finstersten Wäldern liegen als Wachhunde hinter dem großen und hinter dem kleinen Tore, und rings, ringsum schlingen sich die Bergströme. Als Schutzschirm steigen rings die steilsten Klippen auf«
»... rdyalsa (= rgyalsa) powrang Leui re
bdyardyal tschung dyen newsa ba
sgo di sgo tsa ne gui re
naschdien sdang mu nesgo dsche (= kri)
tschü sgor gari tschin tsen re
dschra sgor gari yalwa go.«
Auch am zweiten Tage dauert das Fest oft bis in die Nacht hinein, bis alle Vorräte des Dorfes zu Ende sind.
Im Herbst allein kennt man kein größeres Fest. Alles ist dann vollauf mit der Ernte, mit Dreschen und Pflügen beschäftigt. Es würde ja auch nicht dem ostasiatischen Volksgefühl und Nationalcharakter entsprechen, wenn irgend ein Ernte dankfest gefeiert würde! Später im Jahr, nachdem längst der erste Schnee gefallen ist, versammeln sich die Männer des Dorfes, schlachten gemeinsam ein bis zwei Yakrinder, die sie bei den Zeltbewohnern höher oben gekauft haben, und gehen dann zusammen acht bis zehn Tage lang mit ihren Schadschüchʿ auf die Jagd in die Wälder. Während des ganzen Frühjahrs und Sommers darf nirgends gejagt werden, damit die Wald- und Berggötter nicht verärgert werden und womöglich Hagel schicken und die Ernte vernichten. Alle Tschungro und Dorfvorsteher achten stets darauf sehr genau und bestrafen mit großer Strenge – selbst Chinesen wird das Gewehr weggenommen –, wer immer beim Übertreten dieses Gebots erwischt wird. Das geschätzteste Wild ist auch in Kin tschuan das Moschushirschchen, dann der große ostasiatische Hirsch, die Klippziege, Wildschafe, die in Rudeln zu vierzig und fünfzig Stück vorkommen, und der Budorcas taxicolor und verschiedene Pantherarten wie der Irbis haben hier die Grenze ihres Verbreitungsgebiets. Der Ailuropus melanoleucus Edw., früher Ursus melanoleucus, der weiße osttibetische Katzenbär, der seltsamste der drei sonderbaren Vertreter der nur zwischen östlichem Himalaya und Se tschuan vorkommenden Familie der Ailurinae, der bekanntlich erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde, haust hier neben dem schwarzen Ursus tibetanus.
Die gemeinschaftlichen Feste nur eines Geschlechtes, wie z. B. diese Jagden, werden »tapinghu« (jedenfalls ein ursprünglich chinesisches Wort) genannt. Auch die unverheirateten Frauen und Mädchen feiern im Herbste und Winter oft vier bis fünf Tage währende Tapinghu, während deren sie für sich leben und zusammen wohnen, zusammen nähen und singen.
Soweit Kin tschuan unter dem Einfluß der gelben Gelugba-Sekte steht, werden während der kalten Jahreszeit stets auch einige Mönche in jede Familie gebeten, um ein gTorma zu machen und damit alle Dämonen, die sich im Lauf des Jahres im Hause angesammelt haben, hinauszutreiben. Ist der Hausvater begütert, so werden vier Tage lang Gebete gelesen, und dann macht man auch die Yidam- und Smonlam-Figuren aus Tsamba-Teig; vor der Yidam-Figur wird aber immer auch noch ein kleiner Yakkopf aus Tsamba, ein Überbleibsel des Bönbo-Kultes, aufgestellt. Ist jemand erkrankt, so wird zuerst ein Bönbo gerufen. Oft bringt dieser heraus, daß der Kranke einen b Tsam (Dämon), der in einem Baum oder in einer Quelle wohnt, erzürnt hat. Er verbindet in einem solchen Fall das Haus mit jenem Baum oder jener Quelle durch einen Strick, an dem Tuchstücke mit Beschwörungsformeln flattern, d. h. er macht einen Weg für den Dämon nach Hause. Auch macht er Tierköpfe und Tiere aus Tsamba, wie sie von einem Holzmodel (siehe S. 266, Abb. 8) abgedruckt werden können und läßt sie an Kreuzwegen oder in den Wald legen.
Ich blieb mehrere Tage in und um Hsin gai tse. In der ersten Nacht hatten sich die beiden Dawo-Tibeter »auf französisch« empfohlen; es waren zu wilde Gesellen, als daß ich hierüber hätte betrübt sein können. Ich wäre sogar höchst ungern mit ihnen in einsame Steppen gezogen. Sie hatten etwas Lauerndes in ihren Augen, womit ich mich nicht befreunden konnte. Ich war ihnen aber sicher ebenso unheimlich. Dardyi hatte sich über meine Instrumente und meine Notizen nie beruhigen können. Als Ersatz der Dawo-Leute behielt ich einige Aushilfskuli, die sich mir unterwegs angeschlossen hatten, Klein-Kin tschuan-Leute, mit denen ich mich nur mit Brdyals Hilfe verständigen konnte. Waren aber Dardyi und Skewliu schon wenig gute Pferdepfleger gewesen, so verstanden es die Ersatzleute erst recht schlecht, mit Tieren umzugehen, was sich nur zu bald auf den Rücken der Pferde bemerkbar machte. Dazu waren sie unsäglich feige und legten schon in Hsin gai tse die allergrößte Furcht vor Somo und den anderen Stämmen im Norden Kin tschuans an den Tag. Chinesische Lastkuli boten sich mir in der Stadt in großer Zahl an. Sie besorgen die Transporte nach Kwan hsien, das man bequem in zehn Tagen erreichen kann.
Der weitere Weg flußaufwärts war sehr gut. Anfänglich ging es auf der Mandarinenstraße, die von Mu gung ting nach Kwan hsien und nach der Provinzhauptstadt führt. 6 km östlich von Hsin gai tse gabelt sich das Tal. Ich folgte, um mein nächstes Ziel, die chinesische Grenzstadt Li fan fu, zu erreichen, dem von Norden einmündenden Haupttal, das den Oberlauf des Kleinen Goldflusses bildet, während die Kwan hsien-Straße geradeaus nach Osten zieht. Zwei kleine Auslegerbrücken sind an dieser Stelle zu überschreiten, die aber hier nun so fest fundiert waren, daß die ganze Karawane geschlossen darübergehen konnte. Nachher ging es bald über schmale Felsterrassen, auf Galeriebrücken, auf steilen Steintreppen auf und ab, aber immer auf Wegen, die genügend Raum boten und 1½, ja oft 2 m Breite an den engsten Stellen hatten, so daß kein Tier mehr abstürzen konnte und ich den ganzen Weg im Sattel zurücklegte. Mehrfach hatte die Straße sogar eine Art Geländer bekommen, das freilich weniger zum Sichfesthalten als zum Ansehen da war.
Ich erreichte am zweiten Tage den Chinesenort Fu pien, wo mich ein überaus liebenswürdiger kleiner Zivilmandarin willkommen hieß und lange nicht zulassen wollte, daß ich ein Lager im Freien aufschlage, weil ich mit meinen Pferden in den Herbergen keinen Platz fand. Wir mußten wenigstens in der Examenshalle Einkehr halten. Am anderen Tage gab er mir zwei sehr zuverlässige Leute und seinen eigenen Tung sche mit. Das Tal zeigt schon unterhalb von Fu pien eine breite Felsterrasse aus hier N 40–60° W streichenden Sandsteinplatten, eine Stufe im Tal, auf der Felder und Dörfer liegen, und neben der der Kleine Goldfluß in der neueren Zeit mit großem Getöse eine schmale, oft über 100 m tiefe Klamm eingesägt hat. Bei Fu pien ist die Terrasse und der Berghang von einem dicken Polster geröllvermischten Lößlehms überzogen. Um ebene Felder zu erhalten, gruben die Chinesen aus diesem Löß viele kleine Stufen heraus, so daß sie ähnlich wie in Nord-Schen si und Schan si eine künstliche Treppenlandschaft formten. Die Chinesen nennen sich hier immer »kʿe bien«, Gäste, im Gegensatz zu den »man tse«, wörtlich »den Barbaren«.
Oberhalb Fu pien wird der Weg stündlich breiter und bequemer. Ein neuer Tagesmarsch brachte mich nach Lien ho kou. 2995 m hoch, wo neben einem Kolonisten-gai mit nicht einmal fünfzig einstöckigen Häusern und einem Polizeileutnant mit drei Soldaten ein Darro residiert. Sein Haus diente nach tibetischer Sitte auch als Absteigequartier für Angehörige der höheren Stände. Im Erdgeschoß fand ich Ställe, im ersten Stock lagen die Zimmer und die Küche, und breite Veranden sahen in den Innenhof. Die Man tse nennen den Ort Tschügar. Sie bauen Weizen, Buchweizen, Ackerbohnen, Lein, Hanf und Kartoffeln, aber sehr wenig Gerste. Vor allen Häusern stehen hohe Gerüste, an denen im Herbst die Garben trocknen. Mais soll oberhalb Fu pien nicht mehr reif werden. Die winzigen Schafe, und zwar mit ganz geringen Ausnahmen nur schwarze, Zwergziegen und Rinder der kleinen Kin tschuan-Rasse traf ich hier oben wieder zahlreicher. Die großen Rassen der Nomaden fehlen. Die tiefen Täler sind stets sehr dicht besiedelt, so daß man, wie ich mir von meinen Begleitern erzählen ließ, »gar nicht ganz satt wird« und von anderen Tälern Lebensmittel einführt. Die besiedlungsfähigen Flächen nehmen nur einen verschwindenden Raum des Landes ein. Dies riesige Gebiet der hohen Berge mit den vielen Gipfeln von 5000 m Höhe wird sehr wenig durch Herden ausgenutzt. Zeltbewohnern begegnete ich hier viel weniger in den Bergen als in ähnlichen Gebieten von Kʿam, und wo sie sich finden, gehören sie einem anderen Volke an, sprechen eine andere, eine richtige tibetische Sprache, und sind große Tsambaesser, während die Kin tschuan-Bewohner Tsamba nur an Neujahr und in den Klöstern kosten.
Als ich mich in Lien ho kou eben aufs Pferd setzen wollte, um über den Hung kiao-Paß nach Tsʿakalao und Li fan fu zu reiten, kam ein chinesischer Soldat auf mich zugeeilt und berichtete, daß jenseits des Passes durch die starken Sommerregen alle Brücken weggeschwemmt seien. Es gebe keine Möglichkeit mehr hinüberzukommen. Die Tai tai (die erste Gemahlin des Fu pien-Mandarins) hatte, dicht vor den Brücken angekommen, wieder umkehren müssen. Es blieb für mich nichts übrig, als weiter einwärts und westwärts auszubiegen und über die eingeborenen Fürstentümer Tschoktsi und Somo zu reisen. Ein chinesischer Hauptmann, den ich auf einer Inspektionsreise begriffen fand, riet mir allerdings ganz entschieden davon ab, denn kein chinesischer Soldat könne mich dahin geleiten; Fu pien und Lien ho kou standen zu jener Zeit auf Kriegsfuß mit dem König von Somo. Vor zwei Jahren waren vier Kretschiu-Handelsleute bei Lien ho kou von chinesischen Wurzelgräbern ermordet und beraubt worden, und die Sache war von den chinesischen Beamten, die immer rasch wechselten, nicht geahndet worden. Jetzt verlangte der Somo Tu se 3000 Tael und vier junge Chinesen als Ersatz und hatte ein Ultimatum gestellt und die Drohung ausgesprochen, wenn binnen Monatsfrist der Ersatz nicht geschaffen sei, werde er ihn sich an der Spitze von tausend Mann holen. Es mochte wohl jeder diese Drohung für allzu großmäulig angesehen haben, immerhin fürchteten mein Tung sche und die Soldaten doch, sowie sie Somo-Land betreten würden, als Geiseln zurückgehalten zu werden. Der Somo Tu se selbst war durch die Angelegenheit in gar keine einfache Lage gekommen. Die Kretschiu, ein Stamm im Osten von Somo, stehen in einer Art Lehensverhältnis zu ihm und drängten auf Erledigung; es war für ihn eine Ehrensache als Lehensoberherr geworden, einen Ersatz für die Erschlagenen zu bekommen.
Die guten Fu pien-Soldaten begleiteten mich aber doch bis Tschoktsi, wo ich am 30. Juni eintraf. Vor meiner Zelttür lag verblüffend malerisch das alte Bergnest des Tschoktsi rgyalbo mit vielen Veranden und anderen Ausbauten, die wie Taubenschläge an dem alten morschen Mauerwerk hingen. Sein achteckiger Burgturm neben dem vielstöckigen Schloßgebäude – er soll in einem Erdbeben schief geworden sein – erinnert an die »Tschiao« oder »Deiyo« der Freiheitskämpfer (Tafel XXX unten). Aber nicht bloß die Fürsten haben in Kin tschuan heute noch das Bedürfnis, in die Höhe zu bauen, jeder einzelne Hofbesitzer und Bauer hat ein Turmgebäude. Die gewöhnlichen Bauernhäuser sind viereckig und drei-, vier-, ja manche sogar fünfstöckig, aus Feldsteinen gebaut und verjüngen sich nach oben. Sie stehen immer unregelmäßig in kleinen Gruppen beisammen (Tafel XXIX oben). Der hintere und zugleich meist nördliche Teil des Hauses ist um ein Stockwerk höher als der vordere und wird von einem mit Steinen beschwerten, sattelförmigen Schindeldach überragt, dessen First von vorn nach hinten läuft, und das ihnen das Aussehen alter Schweizerhäuser verleiht. Das Schindeldach ist jedoch immer nur lose mit dem übrigen Haus verbunden, man will es nur für die Friedensjahre und wegen der starken Sommerregen haben. Man kann es, da es nur auf einem leichten Balkengerüst ruht, in ganz kurzer Zeit über Bord werfen, sobald Fehdezustand eintritt. Dann ist der Bauer Besitzer einer kleinen Steinburg geworden. Unter dem Schindeldach befindet sich stets noch ein dickes, flaches, von einer hohen Brüstung umgebenes Lehmdach. Unter diesem ist der Raum, in dem die Götterbilder und heiligen Schriften aufbewahrt werden. Dort lesen die Akka ihre Gebete her, wenn sie zu irgend einer Feier geladen sind. Davor ist eine offene Tenne, das Dach des vorderen Hausteils, mit einem losen Holzgeländer, das abgeschlagen werden kann, wenn man seine Getreidekörner im Winde reinigt. Das zunächst darunter folgende Stockwerk, das nun durchs ganze Haus läuft, enthält den eigentlichen Wohnraum der Familie. Holzveranden umgeben die Front; diese helfen mit ihrer Decke zugleich die Tenne oben erbreitern. Aber auch diese Veranden machen einen recht provisorischen Eindruck; sie können eingezogen und abgeschlagen werden. In den unteren Stockwerken werden meist nur Vorräte aufgestapelt. Zu ebener Erde endlich ist der Stall für das Milchvieh und für die Pferde und die kleinen hellhaarigen Schweine.
Meine chinesischen Begleiter von Fu pien verließen mich hier, weil sie sich nicht weiterwagten. Sie hatten mich aber im Tschoktsi-Schlosse oben aufs beste empfohlen, und kurz nach meiner Ankunft erschienen Mönche und Diener vor meinem Zelt, die Schnaps, Tsamba, Weizenmehl, Teeblätter und Salz vor mir niederstellten, in schön gesetzter Rede sich nach meinem Befinden erkundigten und Entschuldigungsworte stammelten, daß ihr Herr nicht anwesend sei; seit drei Monaten schon halte er sich bei dem Fürsten von Unter-Ngaba auf wegen eines Prozesses, den dieser mit benachbarten Zelttibetern führe. Unter-Ngaba steht in einem Lehensverhältnisse zu Tschoktsi und ist in drei Reittagen von Tschoktsi zu erreichen; es hat nur Nomaden. Die Geschenke wurden nur auf rot- und grünbemalten Holztellern und in schönbauchigen Bronzegefäßen alter Kin tschuan-Arbeit gebracht. Man lud mich auch ein, in dem weitläufigen Schloß Tee zu trinken und dort die Weiterreise mit dem Nirba zu besprechen. Eine endlose Flucht von Zimmern schloß sich an die Veranden an, die auch hier den Innenhof umgaben. Über den Türen der größeren Zimmer hingen mit Stroh ausgestopfte Bälge von Bären, Wildyak und Ebern. Sie sollten zum Schmuck dienen, zugleich aber wohl auch die Lha ndri-Gespenster verscheuchen helfen. Der Tu se hatte keine Familie; ein Bruder, der Lama ist, eine alte Mutter und viele, viele Mönche bevölkerten das Haus. Von diesen hatten die meisten Kröpfe, wie fast alle Bewohner von Tschoktsi. Während ich in Klein-Kin tschuan keine Kröpfe beobachtete und auch das alte Rardan-Land davon frei sein soll, sind Bati, Bawang und Tschoskiab, Sung kang und Tschoktsi dafür berüchtigt, und fast jeder zweite Mensch ist dort mit einem Kropf behaftet.
Zwei Kurme (Sklaven) stellten sich auf Befehl der Tschoktsi-Verwaltung am frühen Morgen als Führer nach Somo bei mir ein. Sie gingen barfuß und besaßen nur ein Hemd und einen zerfetzten schwarzbraunen Schafwollmantel. Als Waffe aber trugen sie in der Hand einen krummen Waldprügel. Der Weg von Tschoktsi nach Somo war anfänglich recht gut. Es ist ein oft begangener Handelsweg zwischen Li fan, Tsʿa kou und den oberen Goldflußgebieten. Er führt erst auf der linken Flußseite, dann über eine schöne Kragbrücke und weiter am rechten Ufer am tosenden, weißschäumenden Kargu-Fluß aufwärts, ständig in Urwald, zwischen dichtstehenden Fichten und Birken, Stechpalmen, Bergbambus und Rhododendren und hundert anderen Holzgewächsen, deren Zweige über den wilden Strom hingen und oben schier zusammenschlugen. An einer Stelle hatte der angeschwollene Kargu-Fluß den immer schrittbreiten Waldpfad weggespült, im glitschrigen Waldboden mußte man einen hohen Felsen umgehen. Die beiden Kurme ergriffen das erste Maultier und zogen und schoben es den gähen Hang hinauf, während wir anderen unten die anderen Tiere hielten. Plötzlich aber gab's statt der Ermunterungsrufe der Kurme ein Knacken im Geäst, und das Maultier brach mitsamt seiner Ladung durch das Blattwerk der Bäume. Nur ein kaum armdickes Stämmchen hielt die Wucht des Sturzes aus; seine Krone hatte sich glücklich im Lederzeug gefangen, mit dem die Kisten am Sattel angebunden waren. Zu dreien sprangen wir rasch zu, packten die Kisten und schnitten sie los. Fast alle Notizbücher und viele Platten waren gerettet, das Maultier aber war nicht zu halten und fiel in den Fluß. Jetzt erst hatten wir auch Zeit, den Kurme zu rufen, sie sollten uns helfen, das Tier herauszuziehen; doch von denen oben kam keine Antwort. Die beiden hatten es wohl für ausgeschlossen gehalten, Last oder Tier zu bergen und waren voll Angst im Busch verschwunden. Wegen dieser schnöden Flucht erreichten wir erst am zweiten Tage die ersten Häuser und den Schloßberg von Somo.
Der Somo Tu se besitzt wie der von Tschoktsi, von Sung kang, von Damba, von Tschoskiab usw. eine große alte Burg aus Stein mit vielen Stockwerken, mit Türmen und festen Toren, die die Tibeter »rgyalsa powrang«, Königsschloß, die Chinesen »kwan tschʿai tse«, d. h. Beamtenburg, nennen, denn der chinesischen Volkssprache ist der Begriff für Feudaladel längst verlorengegangen – sie kennt nur kaiserliche Prinzen; jeder tibetische erbliche Herrscher wird deshalb nur als Beamter aufgefaßt. Die Somo-Burg liegt auf einer kahlgerodeten, schmalen Bergzunge hoch über dem wilden Kargu-Fluß, dessen Tal hierherum etliche kleine Erweiterungen zeigt, auf denen Hausgruppen und Äcker Platz haben. Die Burg ist fünf-, teilweise sogar sechsstöckig, hat drei Flügel, einen großen Innenhof und zwei schlanke Türme, die den plumpen Hausklotz gegen die Bergseite zu verteidigen und flankieren. Das Mauerwerk ist nach außen hin ganz roh belassen. Nach außen zeigen auch nur die zwei höchsten Stockwerke Fensterlöcher, die ohne Papier, geschweige denn ohne Glas, nur mit Holzladen verschließbar sind, um die herum aber mit Kalkmilch eine monumentale Fensterarchitektur gemalt ist. Neben dem Schloß liegen einige wenige kleine. Steinhäuschen, in denen wie in Tschoktsi und um andere Schlösser Dienstleute, Freigelassene und auch einige chinesische Krämer ihr Heim haben. Ich bezog auch hier der Tiere wegen ein Lager auf einer grünen Wiese, und bald waren die besten Beziehungen zum Schloß hergestellt. Am Nachmittage meines Rasttags besuchte mich die junge »Frau Königin«. Wie eine Gestalt aus den alten deutschen Fabeln – wie eine heilige Hedwig – kam sie auf einem weißen Zelter zu mir herausgeritten, mit einer Spindel in der Hand, schwarze Schafwolle spinnend. Ihr stattliches Pferd führte ein Haussklave am Zügel. Hinter ihr drein ritten noch zwei andere Frauen, auch sie in langärmligem, schwarzbraunem Schafwollrock, der bis zur halben Wade hinabreichte, in buntledernen Stulpenstiefeln und das Haar fast so wie die Königin bedeckt von Korallen und Türkisen und silbernen Ringen. Die Königin – es war eine hübsche Frau von etwa vierundzwanzig Jahren – blieb zwei Stunden bei mir im Zelt und freute sich »königlich«, als ich ihr eine Spieldose mit einem Khádar überreichte. Sie hatte eines jener schmalen kleinen Gesichtchen mit schmaler, feiner Nase, die man nur manchmal und zumeist nur in besseren Häusern in Tibet findet Die Kin tschuan-Bewohner sind sonst untersetzte, aber breitschultrige und für Tibeter auffallend rundköpfige Leute. Sie haben zumeist breite und dicke Lippen. Die Nasen sind platt, Adlernasen sind viel seltener als im Innern Tibets und auch im chinesischen Unterland. Die Backenknochen sind kräftig entwickelt, doch lange nicht in dem Maße wie bei Mandschuren und Mongolen.. Auch sie trug ihr schönes, blauschwarzes Haar mit Hilfe von Butter in winzige Zöpfchen gedreht, die mit falschem Haar zusammen – es war dies an seiner verschossenen, braunen Färbung leicht kenntlich – zu vier großen und dicken Zöpfen vereinigt waren, die rund um den Kopf gelegt und so dicht von dunkelroten Korallenketten, von Türkisen und blanken Silberringen bedeckt waren, daß sich dieser Haarschmuck wie eine kostbare mittelalterliche Haube ausnahm. Ein zierliches Filigran-Gawo aus gelbem Gold mit einem himmelblauen Kranz von Türkisen hing ihr wie eine Brosche am Hals und stand zu ihrer knusprig gebräunten Haut und zu dem einfachen dunklen Kleide so gut, sah so wenig barbarisch aus, daß ich auch diesmal wieder die größte Hochachtung vor dem tibetischen Geschmack bekam. Die Dienerschaft der stolzen Herrin sah freilich sehr übel, sah zum Erbarmen aus. Barhäuptig, barfuß und barbeinig stapften die Mägde, die ihre Königin begleiteten, durch den schneeigen Regen. Was sie auf dem Körper trugen, war zerfetzt, und wo ein Wassertropfen aus dem fettigen Haar, das ähnlich wie bei der Königin, nur schmucklos, um den Kopf gelegt war, über das Gesicht und den Hals gelaufen war, konnte man einen hellen Strich sehen, der schwarz gerändert war und fremdartig vom übrigen Gesicht abstach Auch sie waren Kurme (Sklaven). Jeder Darro und Tschungro, ja jeder reiche Gutsbesitzer hat eine Reihe, bis zu zwanzig und dreißig, solcher Leibeigenen. Sie gehen ziemlich dürftig gekleidet und werden immer ganz einfach, mit Maismehl ernährt, doch ist das Verhältnis zwischen Herr und Sklave in den meisten Fällen ein sehr gutes; Revolten sollten nie vorkommen. Es ist in Somo ein ähnlich gutes Verhältnis wie im Lolo-Land, wo bekanntlich die Sklaven oft an den Kämpfen der Herren teilnehmen..
Dem Kargu-Flusse weiter aufwärts folgend, erreichte ich in einem Tagesmarsch den Ort Kargu. Auf dem Wege sah ich noch mehrere Somo-Siedlungen. Turmhäuser, die da und dort, unweit vom Wege und in einigen Seitenschluchten in Gruppen verteilt standen (Tafel XXXI oben).
Auch die Somo hängen noch den alten Sekten an; sie sind Bönbo oder höchstens Nima (rNingmaba). Sie sollen sechs Klöster in ihrem Lande haben, aber keinen Huo fo. Zweistimmig sangen die Männer und Frauen, die sich mir bis Kargu angeschlossen hatten, eine Bönbo-Anrufung herunter, die wie: »o hoō! o hoō! o segwooo ... hoō!« klang, und die sie nur durch die Nima-Anrufung: »Bémna gésar sdung bu-u-la« unterbrachen.
Nachdem wir etwa die Hälfte des Wegs hinter uns hatten, marschierten wir in einer ebenso engen Waldschlucht neben dem tosenden Flusse wie zwischen Tschoktsi und Somo. Der Weg war durch die starken Regengüsse, die täglich niedergingen, vielfach vermurt und abgerutscht, aber ohne einen besonderen Unfall stand ich um sieben Uhr abends vor einer Brücke und gleich darauf jenseits in dem Dorfe Kargu, das wie ein Chinesendorf anmutet und unter seinem chinesischen Namen Ma tang ein landauf, landab bekannter Marktort ist. Unweit von diesem Dorf schlugen wir in der Dämmerung unsere Zelte auf und trieben die Pferde auf die Weide.
Hier an diesem Ort hatte ich die Antwort des Li fan fu-Mandarinen zu erwarten, dem ich von Fu pien und Lien ho kou aus geschrieben, daß ich über Ma tang gehen und von dort den Norden und Nordwesten von Somo besuchen würde.
Ein abgelegener Marktort wie Ma tang ist nirgends in der Welt eine Kulturstätte. In Ma tang geht es immer brutal her. Orgien aller Art, wüste Zechgelage, Verkäufe von gestohlenen Kindern, von Frauen und auch erwachsenen Sklaven werden mit Vorliebe an dem Platze abgemacht, um den sich China noch so gut wie gar nicht, der Tu se von Somo aber nur indirekt kümmert. Der Platz liegt an der Grenze des eigentlichen Somo-Landes und von Kretschiu, eines Lehenstaates unter dem Somo-König, der sich von hier nach Nordosten zu anschließt und namentlich das Becken des Lo hoa-Flusses (chin.: hei schui == Schwarzwasser) begreift. Die Kretschiu haben einen Tschungro, einen Offizier, als Gemeindevorsland in Ma tang wohnen, der aber wenig zu sagen hat. Jeden Tag war in dem Orte etwas los, wurde gestochen und gehauen, und dann versöhnte man sich wieder unter Posaunenklängen und zahlte Sühnegelder für die ausgeteilten Wunden oder versöhnte sich nicht und schlug weiter um sich. Am zweiten Tage nach meiner Ankunft fielen zwei Händler ganz nahe vom Ort unter Räuber. Man hatte sich eben im Dorfe unten bei einem Zechgelage zerkratzt, als die Kunde davon ankam, doch im Handumdrehen ritten alle zusammen zur Verfolgung der – eigenen Stammesangehörigen; niemand zweifelte wenigstens, daß die Räuber Kretschiu wären. Die verwundeten Händler waren schlimm zugerichtet; der eine hatte sechs Schwerthiebe über den Kopf bekommen und lag nach dem Überfall eine ganze Nacht im Walde, bis man ihn auffand; er starb noch während unserer Anwesenheit.
Die größeren Geschäftsleute und Agenten, die sich hier aufhielten, waren auch hier Mohammedaner, die ihre Familien in Tao tschou hatten. Sie fielen nicht bloß durch ihre größere Nüchternheit sofort auf, sondern auch durch ihren helleren und rosigen Teint, ihre grünlichbraunen Augen und den höheren Wuchs. Ein jeder von ihnen war weit in den ngGolokh-Ländern herumgekommen und kannte sich dort wie in seiner Hosentasche aus. Der Wert der Waren, mit denen die Mehrzahl von ihnen in die Steppe zieht, beträgt 500 Tael; wenn sie dann nach Abzug aller Unkosten für die eingetauschte Wolle, den Moschus und die Häute 800 Tael bekommen, sind sie zufrieden. Dafür aber ziehen diese Hui hui zu den Horkurma und zu den Dao Metsang, ja zu den Wanschdächʿe und leben monatelang auf den ungemütlichen Steppenstraßen in Wetter und Schnee. Einige, die größeren von ihnen, sind Drogenhändler, die armen Chinesen und Kretschiu-Leuten ihre Medizinwurzeln abkaufen, die diese während des Sommers und Herbstes in der Umgebung ausgraben. An der Waldgrenze oben wird hier wie in ganz Kin tschuan und bei Ta tsien lu auch viel Rhabarber, das Rhizom vom Rheum officinale, gefunden. Es wird in halboffenen Hütten oben in den Bergen geschält und hierauf über Feuern getrocknet und geräuchert. Wegen der großen Feuchtigkeit ist das Trocknen dieser Knollen hier sehr viel schwieriger als in den Trockengebieten vom Kuku nor.
Während meines Aufenthalts war ein alter chinesischer Arzt in Ma tang, der seit mehr denn einem Menschenalter in jedem Jahr hier durchreiste und bei alt und jung aufs beste eingeführt war. Er war Pockenspezialist, reiste auf die alte chinesische Methode der Variolation; in kleinen Bambusröhrchen hatte er Menschenpockenlymphe, mit der er alle Kinder bis zu zwölf Jahren, die zu ihm gebracht wurden, für 300 Cash »impfte« oder besser gesagt ansteckte. Er goß jedem einige Tropfen seiner Flüssigkeit in die Nase, worauf die Kinder vier oder sechs Tage später an Pocken (Variolois, in der Eingeborenensprache Dabram) erkrankten und bis zu einem oder zwei Dutzend Pockenpusteln im Gesicht und auf der Brust erhielten. Seine Lymphe gewann er immer wieder unterwegs, indem er einzelne Pusteln vor ihrem Eintrocknen aufstach und ihren Inhalt sammelte. Er wählte dazu Kranke, die so wenig wie möglich Pocken hatten, verdünnte aber obendrein die gewonnene Lymphe mit Wasser. Nach seiner Ansicht wollte der Mann in erster Linie durch diese Verdünnung erreicht haben, daß seine Patienten nicht die schweren Pocken bekamen, und daß sie immer nach acht Tagen wieder gesundeten. Ich ließ mir hierzu erzählen, daß in ganz Kin tschuan diese Variolationsmethode in Übung ist, und daß, wenn in einem Dorfe nur ein Teil der Kinder »geimpft« wird, der Rest der Kinder aber ohne Zutun des Variolationsspezialisten angesteckt wird, die nicht geimpften schwere Pocken, eine echte Variola, durchzumachen haben, weiter, daß die Variolation bei Erwachsenen viel schwerere Erscheinungen zeitigt als bei Kindern unter zwölf Jahren.
Das lange Warten auf die Boten des Li fan ya men wurde durch mehrere Ausflüge auf die nächsten Berge unterbrochen, soweit wenigstens das Wetter es erlaubte. In der Regel regnete es jeden Tag viele Stunden, wenn nicht den vollen Tag und die ganze Nacht hindurch. Die Zeit der Sommersonnenwende bedeutet für das ganze östliche Tibet und namentlich für seine südlichen Teile die Regenzeit. Tagelang bleibt der Himmel von Regenwolken bedeckt, und tief in die Täler hinein hängen Nebelfetzen, die größten Feinde der Topographen.
Ich wartete in Ma tang bis zum 15. Juli. So lange reichte meine Geduld. Am Morgen dieses Tages hielt es mich nicht mehr. So frei wie ein Vogel ging es wieder einmal dem »Tsʿao ti« zu. Bald nach meiner Ankunft in Ma tang hörte ich zwar, daß zwei Ya men-Läufer aus Li fan fu durchgekommen und mit einem meine Reise betreffenden Schreiben nach der Somo-Burg weitermarschiert seien. Schon hatte ich große Hoffnungen darauf gesetzt, aber sechs weitere Tage verstrichen, ich sah und hörte nichts mehr von ihnen. Sie hatten sich irgendwo verkrümelt. An einem der letzten Tage hatte ich den Nirba des Somo-Königs im Dorfe angetroffen, und dieser hatte mir verkündet, der König lehne es ab, für mich etwas zu tun. Noch nie habe er Chinesen oder gar Fremden freies Geleite durch Gebiete seiner Lehensmänner zugestanden, ich solle allein reisen, wie es auch alle Tao tschou-Hui hui täten.
Außer meinem Brdyal hatte ich einen Somo-Mann und einen Kretschiu-Burschen aus Ma tang mit auf die neue Reise genommen; der erste hieß Tsʿan Rarschdan, der zweite, ein hübscher und guter Junge, nannte sich Yangsen. Wir verließen um sieben Uhr den Lagerplatz, ritten durch die Häuser von Ma tang, wo sich meinem kleinen Zug von sechs Pferden und fünf Maultieren ein Ho tschou-Mohammedaner, ein Kaufmann namens Ma, auf einem lebhaften, gut gehaltenen Rößlein zugesellte. Zurück über die alte Brücke ging's auf die rechte Talseite des Somo-Flusses hinüber und dann bergauf, den Windungen des lärmenden großen Wildwassers folgend. In der ersten Stunde ist das Tal noch sehr eng, doch dem Wassergraben entlang, den herrlichster Fichtenwald einsäumt, läuft jetzt bereits eine gute und breit ausgetretene Yakstraße, für deren Instandhaltung die Ma tang-Kaufleute im Interesse ihres Handels Sorge tragen. Kurz hintereinander begegneten wir zwei hundertköpfigen Yakkarawanen mit Wolle und Häuten. Halbnackte Steppenleute, wie ich seit dem Verlassen von Dergi keine mehr getroffen, trieben sie rasch an uns vorüber. Die Ware gehörte einem Sung pan-Mohammedaner. Die Treiber waren aus Khorgan. Es waren wieder echte, schlechte ngGolokh.
Drei Wegstunden oberhalb Ma tang verläßt die Yakstraße das rechte Ufer. Über eine Brücke im landesüblichen Stil, die letzte und am höchsten gelegene, geht der Weg hinüber nach der anderen Seite. Den Sommerregen dieses Jahres war aber auch diese erlegen. Das nördliche Widerlager war unterwaschen worden. Sein kunstvoller, aus Steinblöcken und Pfahlrosten gefügter Ausleger hatte sich etwas gesenkt, und die drei Fichtenstämme, die den Fluß überspannten, waren abgerutscht und den Fluß hinabgetrieben. Nach alten Abmachungen haben die Leute von Kretschiu diese Brücke instand zu setzen, wie die Ma tang-Brücke von den Kaufleuten von Ma tang in Ordnung zu halten ist. Zwanzig Kretschiu hausten seit Wochen in Zelten und Rindenhütten unter den Waldbäumen neben der Brücke, und zwischen Jagen und Rakitrinken wurde der Ausleger allmählich ausgebessert, wurden Bäume geschlagen und von Brückenkopf zu Brückenkopf drei neue Balken geschoben. Als ich mich der Brücke näherte, erwarteten mich die Brückenbauer. In aller Eile hatten sie den neuen Bohlenbelag, der bereits gelegt war, wieder abgetragen, und mit Lanzen und Schwertern in der Hand suchten sie 15 Tael Brückenzoll aus mir herauszupressen. Wollte ich nicht in den Geruch ganz unermeßlicher Reichtümer kommen und gewärtig sein, schon am anderen Tage mit einer Räuberbande mich herumzubalgen, so durfte ich jetzt, bei meinem neuen Eintritt ins Tsʿao ti, nicht klein beigeben und den Preis bezahlen. Die Kretschiu ihrerseits aber zeigten sich nicht willfährig, auch nur einen einzigen Tael von ihrem verlangten Brückengeld abzulassen, und so setzte es eine heiße Auseinandersetzung. Selbst die Redekunst meines mohammedanischen Reisegefährten schien nichts zu vermögen. Erst nach Stunden und nachdem auch wir unsere Waffen gelockert hatten, begnügte sich die Bande mit 2 Tael. Als dies bezahlt und ich über der Brücke drüben war, beluden sie noch vor meinen Augen ihre Ponys und marschierten höhnend ab; die Brücke war nun eröffnet und frei für jeden Verkehr. Die Spitzbuben hatten nur noch auf mich gewartet, um mir diesen Streich zu spielen. »Die Kretschiu wollten Zehrgeld für den Heimweg. Dies ist so der Kretschiu Art!« schmunzelte Ma, der mohammedanische Kaufmann.
Ein halbes Stündchen hinter dieser Brücke standen die ersten Zelte. Der Talcharakter war dort bereits breit und muldig geworden, und saftige Weiden bedeckten die rundlichen Hänge, die gar nicht mehr hoch über den Talboden hinaufstiegen. Ich war im Zangskar-Lande bei einem Stamme von hundertvierzig Familien Zeltbewohnern angekommen. Diese teilen sich in Unter-, Mittel- und Ober-Zangskar und bevölkern drei Tagereisen weit die Ufer des oberen Somo-Flusses. Sie sind zwar Nomaden, müssen aber wegen ihrer reichen Weiden nur wenig hin und her ziehen. Sie wechseln zweimal im Sommer den Zeltplatz und wohnen im Winter in niederen Holzhäusern mit flachen Dächern, die 12 km oberhalb der Brücke auf dem rechten Flußufer liegen. In Begleitung von Ma suchte ich am Nachmittage zwei Zelte auf, die schon von weitem durch ihre Größe und schwarze Sauberkeit das Auge auf sich zogen. Es hatte früh am Morgen zu regnen begonnen und goß in Strömen vom Himmel herab, als wir uns dorthin auf den Weg machten. Die Zeltbewohner scherten sich aber den Teufel um die Nässe. An allen Ecken und Enden ihrer Behausung troff das Regenwasser durch die weiten Maschen der Zeltdecke und sammelte sich zu großen Lachen. Gastgeber wie Gäste hatten ja Filzstücke, die sie sich über die Schulter legen konnten. In dieser Wasserdurchlässigkeit wie auch in der sonstigen Einrichtung unterschied sich der Zeltbau der Zangskar-Nomaden kaum von anderen tibetischen Zelten. Nur hörte die Yakhaardecke, die das Zeltdach bildete, schon 70 cm über dem Boden auf, so daß die Luft noch ganz besonders leicht durchstreichen konnte; in dem freien Zwischenraum zwischen Zeltsaum und Boden waren Brennholz- und Reisigbündel aufgeschichtet. Ein senkrecht aufgehängtes Stück Wollstoff mit eingeknüpften Fransen bildete vom Eingang bis in die Mitte des Zeltes eine Scheidewand, von der aus man wie immer links in die Frauenabteilung, rechts in den Männer- und Gästeraum gelangte. Die Mitte des Zelthintergrundes nahmen die üblichen Kisten und Tsambasäcke ein. Im Männerraum lagen auf dem Kultplatz Gebetbücher, davor stand ein niederer, breiter Tisch mit vielen Gerste- und Wasserschalen aus Bronze. Die Feuerstelle war wie immer im Somo-Land eine Bodenmulde, überdacht von einem breit ausladenden, eisengeschmiedeten Dreifuß, der die zwanzig Pfund schweren und wie Waschkessel großen Teebecken trug. Auch sie waren aus Bronze und oben, innen wie außen, mit Hakenkreuzen und anderen Abzeichen hübsch verziert. Farbige, gedrehte Holzgefäße für Butter und Tsamba, mit Steinen besetzte Gabelgewehre und an einem Zeltpfosten rotbraun verschossene, falsche Frauenzöpfe, mit zehn Reihen dunkelroter Korallen gespickt und umwunden mit Silberringen und Bernsteinknollen, bewiesen den Wohlstand der Besitzer.
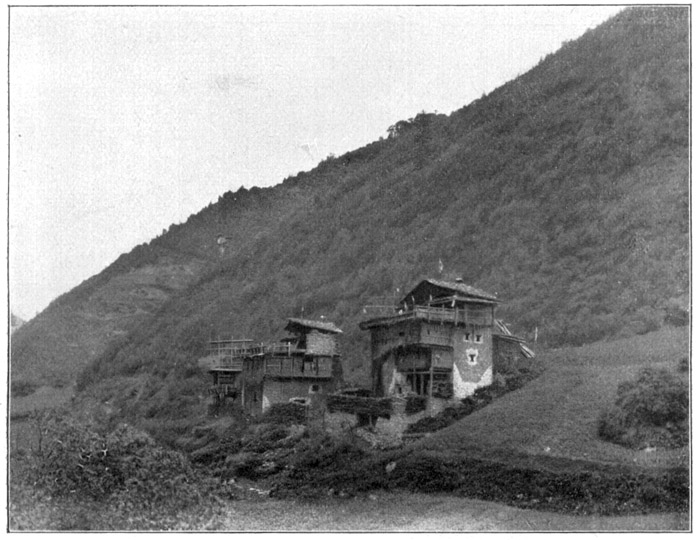
Tafel XXIX
Bauernhäuser in Tschoktsi.

Tafel XXIX
Kragbrücke über den Kleinen Goldfluß.
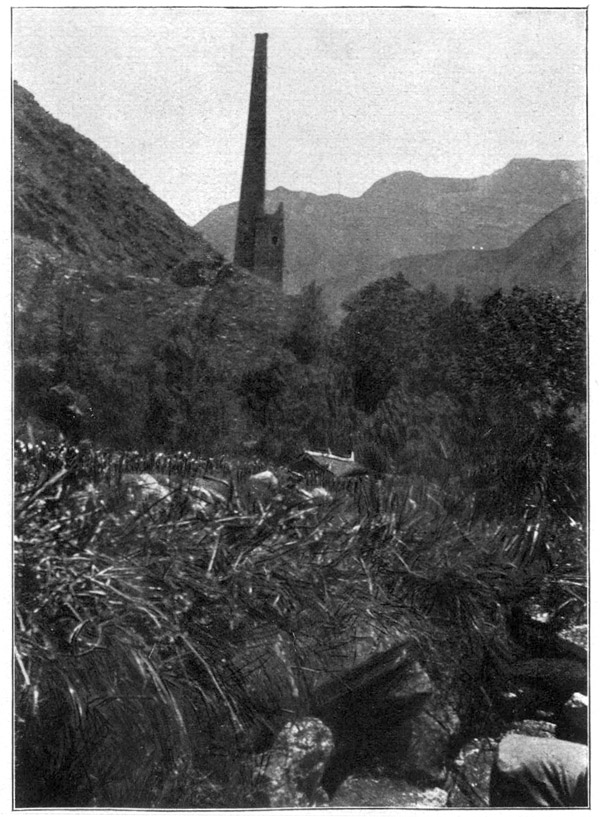
Tafel XXX
Der höchste noch stehende Deio-Turm in Kin tschuan.

Tafel XXX
Pobrang (Schloß) des Königs von Tschoktsi.
Wir waren in ein Haus ohne Männer geraten. Der Hausherr oder wahrscheinlicher die Herren des Hauses waren seit einer Woche auf Mehlkauf in Kretschiu und wurden nicht vor zwei Tagen zurückerwartet. Die Frauen aber erfüllten vielleicht die Pflichten des Gastgebers noch besser. Sie wußten lebhaft zu schwatzen. Im Laufe der Stunden, die wir dort zubrachten, trat noch eine Nonne herein, die von mir verlangte, der jüngsten der drei anwesenden Frauen, einem hübschen Mädchen von achtzehn Jahren, zu weissagen, ob sie Kinder haben werde. Nichts leichter und einfacher als dies! Ich hatte die Kunst, dies auszurechnen, genugsam gesehen. In welchem Jahre des Tierkreises und an welchem Tage und zu welcher Tageszeit sie geboren war, sagte die Kleine mir ohne Besinnen, und dann drehte und schob ich unter den erwartungsvoll aufgerissenen Augen meiner Damen an meinem Rosenkranz, als ob ich ein hochgelahrter Lama der tantrischen Schule wäre. Die Auskunft lautete günstig, wie sie gewünscht worden war, und man wurde dadurch sehr zufrieden mit mir. Schnaps gab es darauf und später Milchtee, dann Tsamba mit Tschürra von nicht über Monatsalter. Zum Schlusse aber kam die immer köstlich mundende saure Yakmilch.
Die Zangskar-Leute sprechen bereits wieder eigentliches Nomadentibetisch, freilich recht verschieden vom Kuku nor-Dialekt. Meine Freundinnen verstanden aber auch den Somo-, bzw. Kin tschuan-Dialekt. Als Sprachgrenze gegenüber dem Nomadentibetisch gilt das kleine Kloster Kang mer, dann Du tang gomba, ein Kloster etwas weiter im Westen, das ebenso an der Grenze des Graslandes gelegen ist, und endlich die Grenze von Tschoskiab. Das Gerdyi gomba, das zwei Tagereisen nördlich von Tschoktsi liegt, ist sprachlich bereits echt tibetisch. Nur das Ackerland in den tiefen Tälern der Goldflüsse erscheint als der eigentliche Boden der Kin tschuan-Sprache.
Die Frauen erzählten umständlich, aber mit offensichtlichem Stolz von ihrer Pilgerfahrt nach Lhasa, von der sie erst kürzlich zurückgekommen waren. Ehe die Familie von ihrer Heimat aufbrach, hatten sie alles verkauft, was sich nicht in einem verborgenen Winkel des Kang mer-Klosters hatte aufstapeln lassen. Zwanzig Familien stark waren sie dann mit Kind und Kegel, mit einigen Yakkühen und Yakochsen losgezogen, und zwei volle Jahre hatte ihre Fahrt gewährt. »Wir hatten großes Glück«, meinte die ältere Hausfrau. »Ein einziges Mal nur wurden wir ernstlich von Räubern angefallen, nur ein Mann wurde erschossen, und wenige Yak wurden uns geraubt.«
16. Juli. Es regnete die ganze Nacht weiter ohne Unterbrechung. Auch mein Zelt ist an vielen Stellen und nicht mehr bloß an den Nähten undicht. Alles wird deshalb durchweicht. Der Bleistift will auf dem Papier nicht zeichnen, und alles und jedes Ding, das zerfließen kann, zerfließt. Die Kleider sind naß, alles Bettzeug ist naß, am ganzen Körper ist kein Faden trocken. Das Brot ist durchweicht. Alles, was ich nicht in meinen zinkgefütterten Kisten verwahre, trieft. Die Morgentemperatur war aber zum Glück +11°. Den ganzen Tag blieb es weiter neblig, und die Regenwolken hingen bis ins Tal herab.
Auf dem neuen Tagesmarsche (von sieben bis halb drei Uhr) blieb die Landschaft weiterhin hügelig mit fußhohen Grasweiden, die voll der schönsten Blumen standen. Die Talsohle war im Mittel 300 m breit, und auf der rechten Seite kamen noch dann und wann geschlossene Hochwaldparzellen vor, die sich meist ganz unvermittelt heraushoben. Die scharfe Abgrenzung dieser Wäldchen forderte immer wieder zum Nachdenken über ihre Entstehungsmöglichkeiten heraus. Der verschiedene Feuchtigkeitsgrad auf den Nord- und Südhängen reicht zur Erklärung nicht aus. Es scheinen mir vielmehr zufällige und auch künstliche Waldbrände die Hauptschuld daran zu haben. Der tibetische Nomade ist, wie ja jeder Hirte, der geschworene Feind allen Waldes. Er will nur Grasflächen sein eigen nennen, auf denen er seine kopfreichen Herden sich tummeln lassen kann. Er brennt rücksichtslos den Wald nieder, wo er ihn trifft, denn den Wald braucht er zu nichts als zu Zeltstangen; zum Brennen ist für ihn der Dung seiner Tiere am bequemsten. Wo aber einmal die alten Hochstämme vernichtet sind, wachsen die jungen Triebe – wie wir es schon in alten türkischen Gebieten sehen – nur ungern noch einmal in größere Höhe. Die Viehherden lassen es vielleicht noch zu einem mäßig hohen und dichten Busch kommen, aber nicht zu Wald. Ehe sich der Mensch in den tibetischen Höhen breitmachte, reichte sicher der zusammenhängende Urwald viel höher hinauf als heute. Das Land wird im Urzustande einen ganz anderen Charakter gezeigt haben und mag allein deswegen schon ein feuchteres Klima gehabt haben. Wer die Hochstämme am Tschürnong tschü betrachtet, wer die einzelnen alten Tannen im Süd-Kuku nor-Gebirge gefunden hat, die sich dort noch in verborgenen Schluchten erhalten haben, wird wohl mit mir übereinstimmen können, daß die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, daß selbst dort in nicht allzu ferner Vergangenheit ausgedehnte Wälder bestanden und die heutigen Prärien bedeckten, und daß es der Mensch sein muß, der sie ausrottete und nur als »Zeugen« einige Überbleibsel duldete.
Auf dem langen Weg bis Mittel-Zangskar, der schnurgerade nach Nordwesten führte, sah ich bloß dreimal drei Zelte beieinanderstehen, und selten begegneten wir Menschen. Die wir aber trafen, ritten Yak und keine Pferde. Eine einzelne Frau, hoch zu Ochs und ohne Sattel, begann, wie es hierzulande unter den Begegnenden Sitte ist, eine lange Zwiesprache mit uns, und durch sie erfuhr ich, warum im Ortsverkehr nur Ochsen verwendet werden. Sie lachte, wie ich so einfältig fragen konnte. »Reitest du ein Pferd, so mußt du gut bewaffnet oder mit mehreren Männern zusammen gehen. Wer ein Pferd stiehlt, ist morgen über Berg und Tal. Einen gestohlenen Ochsen aber treibst du an einem Tage nur so weit, daß ihn die Männer tags darauf wieder haben.« Zurzeit hatten die Leute vor den chinesischen Medizinwurzelgräbern die meiste Angst. Dreihundertachtzig dieser Leute sollten jenes Jahr über Ma tang in das obere Somo-Tal gezogen sein.
In Mittel-Zangskar, einer Siedlung von sechzig Zelten, traf ich einen Kaufmann, auch einen Mohammedaner, der nach ngGolokh-Rentsin hsiang strebte. Wegen der starken Regengüsse kam er mit seinen hundertfünfzig Teelasten, die in großen viereckigen Körben verpackt waren, nicht über den Fluß. Ungeduld zuckte ihm in allen Fingern, und mit nervöser Hast drehte er seine zwei Spielkugeln bald in der Linken, bald in der Rechten. »In Ngaba haben sie nun schon Schafschur gehalten«, jammerte er mir den ganzen Abend vor. »Es ist die höchste Zeit für mich, in ngGolokh-Doba und Rentsin hsiang die Vorschüsse in Tee fürs nächste Jahr zu geben. Meine Konkurrenten von Ardschün werden nun dorthin gehen und die nächstjährige Wolle bekommen, und ich muß den ganzen Winter umsonst im kalten ngGolokh-Lande sitzen.« Auch auf die Empfehlung des hier allbekannten Kaufmanns hin konnte ich hier keine Begleitmannschaft bekommen. Anfänglich wollten zwei Männer bis Merge, vier Tagereisen weit, mitgehen, wenn ich ihnen 100 Tael Führerlohn gebe. Sie bekamen aber keine Erlaubnis dazu, weil hinter mir drein der Somo-Tu se kam, der, wie erzählt wurde, seiner jungen Frau seine Länder zeigen wollte.
Hinter Mittel-Zangskar wird das Tal noch flacher, noch sanfter steigen die Hänge links und rechts aus der breiten Talsohle auf. Die grünen Wiesen und Gebüsche zu beiden Seiten der Mäander des klaren Flüßchens standen entzückend zum Azurblau des Himmels. Es war eine Freude, in die Steppe hineinzuwandern. Die Tiere erholten sich zusehends. Aber unheimlich wurde hier der Weg. Nirgends tauchte mehr ein Zelt auf. Kein Mensch begegnete uns. Nur eine Gazelle sprang einmal vor mir auf. Die Sümpfe des Hochlandes begannen heute, und Stechmückenschwärme summten und surrten um uns. Als wir gegen halb ein Uhr um ein Erlengebüsch bogen, klang uns dumpfer Trommelschlag wie der in der Ferne verhallende Klang eines germanischen Parademarsches ins Ohr, und Ober-Zangskar kam in Sicht. Vierzig schwarze Zelte umstanden als lange Gasse eine hoch herausragende weiße Yurte, neben der sich zwei Gebetsmasten in den Himmel streckten. Verschlafen lag das Zeltdorf in der warmen Mittagssonne. Nichts regte sich, nur aus der weißen Yurte drang immer voller der Ton der Gebetstrommel. In weitem Umkreis hatten die Herden sich zum Wiederkäuen niedergelegt. Da platzten wir wie eine Bombe in das Idyll hinein, und im Handumdrehen stand ein altes ngGolokh-Bild vor mir. Als hätten wir in den Alltag eines kleinen Ameisenstaats gerührt, so lief und krabbelte es wieder aus den niederen schwarzen Zelthäusern, scheuchte die Wiederkäuer auf, trieb die Pferde zusammen, und zwei Reiter sprengten auf uns Ruhestörer zu, um sich über unsere Zahl zu vergewissern und nachzuforschen, was unser Begehr sei.
Auch die Gemeinde Ober-Zangskar untersteht noch dem Somo-König als oberstem Lehensfürsten. In der großen Yurte wohnte als eine Art Be hu der Gechi Rembodyi, ein dicker Kirchenmann, der landab und landauf auch »Pʿan da lama« genannt wurde. Nachdem abgeladen war, brachte ich ihm Geschenke, Stoffe und einige Büchschen echten Schneeberger Schnupftabaks, über die ein Khádar ausgebreitet war. Er empfing mich sitzend und mit einer großen schwarzen Roßhaarbrille vor den Augen und bat mich bald um ein Mittel gegen seine entzündeten Augen. Er schien an Heuschnupfen zu leiden. Wenn man Heufieber hat, muß es freilich wenig Spaß machen, im Grasland Herrscher zu sein. Ich dokterte ihm an den Augen und empfahl eine längere Wallfahrt nach der Insel im Kuku nor. Auf meine Bitte aber, mir Führer und Bewaffnete nach Sung pan ting zu geben, machte auch er Ausflüchte. Auch ihm war die Reise des Somo-Königs angekündigt worden; es sollten Uneinigkeiten zwischen Tschoktsi und Somo und anderseits Ngaba entstanden sein. Er dürfe jetzt keinen Mann weglassen, meinte er. Der König wolle von hier aus Ngaba Metsang, d. h. Mittel-Ngaba, besuchen, das von Ober-Zangskar aus in drei Tagen zu erreichen sei. Dazu müsse er dem König eine große Begleitmannschaft stellen. Wegen der Unsicherheit des Landes dürften die Zelte und Herden nicht ganz von Kriegern entblößt werden.
Mein Lager stand 30 m über dem nun sehr zusammengeschrumpften Somo-Flüßchen und hatte die Höhe von 3720 m ü. d. M. Bei dem herrlichen Sonnenschein gab es um zwei Uhr etwa die Maximaltemperatur mit +15°. Als ich von meinem Besuch zurück war, umschwärmten mich die Untertanen des dicken Großlamas. Nie zuvor hatten die Leute einen Weißen gesehen. Meinen Körper, meine Nase und meine Kniescheibe hätten am liebsten alle der Reihe nach betastet. In ganz Osttibet herrscht die Ansicht, daß letztere bei den Europäern fehlt. Das allermeiste Interesse bot aber wiederum mein Zeißglas. Alle rissen sich darum, und jubelnde Schmeichellaute ertönten, wenn sie damit ganz in der Ferne eine Antilope, ein Wiesel entdeckt hatten. Sie brachten auch Kranke, Lungenleidende und unter anderen einen Mann aus Wuta, dem ein paar Strauchritter in dem Erlenbusch, von wo wir zuerst das Dorf erblickt hatten, seine Habe weggenommen und ihm obendrein die Achillessehne durchschnitten hatten.
Sogar in diesem kleinen Nest traf ich einen mohammedanischen Kaufmann, der gegen Vorschuß Häute und Wolle aufkaufte. Er nahm mich wie ein europäischer Missionar vom hintersten China bei sich auf, froh, wieder einmal einen gebildeten Menschen zu sehen. Er schächtete mir zu Ehren gleich einen Hammel und lud mich auf den Abend in sein Zelt ein, wo ihm eine tibetische Jungfrau wirtschaftete.
Mir fiel auch hier oben in Ober-Zangskar die geringe Zahl Kleinvieh auf, die gehalten wurde. Auch ohne Seuche – sagte mein Gastfreund – haben sie in ganz Zangskar sehr wenig Schafe, und Ziegen fehlen ganz. Der hohe Winter- oder vielmehr Frühjahrsschnee wurde mir als Grund angegeben. Dieser hat zugleich im Gefolge, daß gerade in dieser Gegend, wo der Einfluß des Monsuns die schönsten Weiden zeitigt, die Besiedlung nur sehr gering ist. Die Einwohner träumen immer von den schönen Prärien im Norden und am Kuku nor, weil dort viel weniger Schnee fällt und Kleinvieh besser und müheloser durchkommt. Soweit das Gebiet Ngaba nicht Felder besitzt, gilt auch dieses als überaus arm. Auch dort ist die wahre Ursache, daß die Tibeter keine rationelle Weidenwirtschaft verstehen, daß sie nur für ihre wenigen Lieblingspferde im Spätherbst, wenn das Gras schon dürr ist, mit ihren kurzen Sicheln einige Bund Gras einheimsen und nie in unserem Sinne Heu machen. Tritt im Frühjahr ein stärkerer Schneefall ein, und bleibt der Schnee für vierzehn Tage liegen, so gehen ihre Schafe zuerst zugrunde.
18. Juli. Ein echter Tibetregen fällt mit Graupeln und nassen Schneeflocken, und so bleibe ich gerne noch einen Tag hier liegen. Ich hatte große Lust heute, meinen Reiseplan über Sung pan ting und Tao tschou aufzugeben und dafür bolzengerade nach Norden zu reiten. In östlicher Richtung auf Sung pan zu soll ich nach hiesigen Angaben erst in drei Tagen am ersten Haus eines Dorfes ankommen und von dort an noch weitere zwei Tage bis zur Stadt Sung pan rechnen müssen. Nordwärts dagegen soll ich von Ober-Zangskar aus schon nach fünf Tagen das Kloster von Tangsker und den Hoang ho und von dort in weiteren fünf Märschen die Stadt Tao tschou erreichen. Zwischen Zangskar und Tangsker soll ich nur das Gebiet von Tschirchama zu queren haben, das in der Einflußzone von Sung pan ting liegt und vom rechten Ufer des Hoang ho noch etwas auf das linke übergreift. Betrachte ich meine Karten, so werde ich freilich diesen Berichten gegenüber äußerst skeptisch. Eben erst habe ich Somo verlassen. In fünf kurzen Tagen soll ich genau im Norden den Hoang ho finden, der erst weit, weit im Nordwesten irgendwo eingezeichnet ist? Es zuckt mir in allen Gliedern, diesem Rätsel nachzuspüren. Doch der Teehändler machte meinem Schwanken rasch ein Ende. Unmöglich sei's, mit meinen drei Leuten durch die Räuberbanden im Norden zu kommen. Auch der Weg über Merge nach Sung pan sei voller Tücken, doch könne man hier vielleicht ungesehen und ungeschoren durchschlüpfen. So beschloß ich denn, nach Merge zu ziehen und dort nach Begleitung für den weiteren Weg Umschau zu halten.
Spät am Abend des 19. Juli war Brdyal aus dem Zelt des Pan da lama mit der Kunde zurückgekommen, ich würde bestimmt einen Führer nach Merge erhalten. Vor meinem Aufbruch am Morgen sandte ich ihn noch einmal hinauf, um nach dem Führer fragen zu lassen. Er sei schon unterwegs, erhielt er zur Antwort, und warte hinter dem nächsten Berg, wo er eine Wolfsfalle gestellt habe. Ich wollte natürlich nicht daran glauben. Mein guter Brdyal aber, der sich immer für die Theorie einsetzte, daß Tibeter nicht so viel lügen wie Chinesen, bestimmte mich schließlich, aufzubrechen. Natürlich war hinter dem Berge kein Mensch zu finden, und da wir uns alle schämten, wieder umzukehren, so zogen wir eben allein über die tiefgründigen Talmulden und über Hügel von knapp 100 m relativer Höhe auf einen Bergsattel zu, den man uns als nächstes Ziel bezeichnet hatte.
In einer der Mulden standen wir plötzlich starr vor Schreck an einem großen Lager, in dem an die zweihundert Personen, Männer und Weiber, ihre Morgenkost kochten. Aus allerlei Fetzen und Lumpen hatten sie Schutzdächer errichtet, die kein Meter über den Erdboden reichten. Kein Haustier war zu sehen außer struppigen Hunden, die uns zerreißen wollten. Alles sah lumpig und wüst aus. Ein Zigeunerlager hätte wie eine kaiserliche Hofhaltung davon abgestochen. »Das sind unsere Medizinwurzelsucher aus Kretschiu und Tsʿa ka lao. Wer mit ihnen in die Steppe zieht, nimmt keinen Flicken zu viel mit, denn er hat keinen«, scherzten meine Ma tang-Leute. Nur zwei Flinten, sonst Spieße und Schleudern hatten die Männer zur Verteidigung, und um den Hunger zu bekämpfen, hatten sie ein paar Säcke Mehl, die der chinesische Händler im Tal auf Vorschuß mitgegeben. Zwei Monate waren sie bereits in diesem Lager und suchten die umliegenden Berge nach allerlei Heilpflanzen ab, die sie im Raubbau ausgraben. Der tägliche Verdienst soll 20–30 Taelcent und im besten Fall 70 Taelcent betragen. Das Pfund (600 g) Be mu (tibet.: Gar lo) z. B. besteht aus drei- bis viertausend Knöllchen, weißen Zwiebelchen von Coelogyne Henryi, die einzeln gefunden und ausgegraben werden müssen. Es hat in Ma tang und Li fan einen Preis bis zu 2 Tael. Die Knöllchen bilden einen Leckerbissen der chinesischen Küche.
Von einer Anhöhe am Wege eröffnete sich mir eine prächtige Übersicht. Fern vom Süden und Südwesten grüßten zum Abschied die großen schwarzen Somo-Berge mit ihren zahlreichen Gipfeln, die, aus grünem Tonschiefersandstein bestehend, bis über 5000 m aufsteigen. Von der Ma tanger Gegend zogen sie sich weit in nordwestlicher Richtung hin, bis sie 80–100 km von meinem Standpunkte sich den Anschein gaben, als würden sie weiterhin mit mehr Ostweststreichen nach Tibet hineinführen. Sie sind die östlichsten Enden des Ba yen ka la schan der chinesischen Kartographie Ba yen ka la schan, eine aus dem Mongolischen entlehnte Bezeichnung. Ba yen = bayan (mong.), reich; ka la = khara (mong.), schwarz. In chinesischen Geographiebüchern und sogar Fibeln bezeichnen diese Worte schon lange das wasserscheidende Gebirge zwischen Yang tse kiang und Hoang ho innerhalb von Tibet. Es ist deshalb ein Unfug, dafür einen neuen Namen einführen zu wollen.. Davor und unabsehbar weit nach Norden ausgreifend breitete sich ein grünes Wirrsal von Hügeln und Kuppen, von Talebenen und kleinen Ketten aus. Kein Berg reichte dort, soweit auch an dem regenklaren Tage das Auge sah, über 4400 m hinaus. Dieses grasreiche, zum Hügelland zerschnittene Stück Hochplateau ist heute die Wasserscheide zwischen dem großen Yang tse und dem Hoang ho. Ganz langsam nur nimmt dieses Land – wie ich auf meinen früheren Reisen sah – nach Westen hin an Höhe zu, so daß endlich bei Horkurma die Sohlen der tiefsten Täler bis über 4200 und 4300 m und die Berge bis 4600–4700 m gehen. All dies Land ist die Heimat der freien, frechen ngGolokh und ihrer ungezählten fetten Yakherden.
Erst in meinem Rücken, im Osten, gegen China zu, gab es etwas höhere Berge. Dort stand Granit an und bildete einige Gipfel von nahe an 5000 m. Unverkennbar waren in diesem harten Granit die Gletschermarken noch eingedrückt. Alle Täler hatten dort breite Wannenform, und alle Talanfänge zeigten alte Karböden. Noch auf den Wiesen neben dem Zeltdorf von Ober-Zangskar lagen große Findlinge, die von diesen Höhen im Osten stammten.
Wir hatten auf diesem Reisemarsche wieder mit den schlimmsten Morästen zu kämpfen, und der Weg war schlecht markiert. Weite Strecken war er überhaupt nicht zu erkennen. Zu dem anstrengenden Einbrechen in den zähen Schlamm gesellten sich Blockmeere, die durch zahllose Spalten und tiefe Klüfte für die Beine der Tiere gefährlich wurden. Die Karawane blieb am Nachmittag völlig erschöpft auf einem Naka-Felde an einem Berghange liegen.
20. Juli. In der Nacht schlief ich nicht viel, machte ich mich doch mit Sicherheit auf den Besuch einiger Wurzelgräber gefaßt. Ich erwartete sie nach meiner Erfahrung in zwei Momenten, sofort nach Einbruch der Dunkelheit oder erst um Mitternacht, wenn der Mond hinter die nächsten Granithöhen gesunken war.
Ich saß im Eingang meines Zeltes, hielt mich krampfhaft wach, und die Gedanken flogen dabei weit, weit über ganz Asien hinweg der Heimat zu, von der ich wieder so lange keine Nachricht, keine Zeitung vernommen. Ein föhniger Wind überrieselte mich dann und wann. Die Pferde ratterten mit den Ketten ihrer Beinfesseln, als ob sie Kettensträflinge wären. Ein Nachtvogel schreckte mich aus meinem Brüten in die Einsamkeit zurück. Irgend ein kleines Federzeug wurde rasch aufgeweckt, piepste voll Angst zweimal, dreimal. Dann hörte man eine halbe Stunde lang nur die Sandkörner, die der Windhauch weitertrieb. Ich glaubte so gut wie am hellichten Tage sehen zu können. Wie lauter blanke Taler schimmern in dem kaltstrahlenden Mondlicht die tausend runden Tümpel unter mir. Die glattgeschliffenen losen Granitblöcke wollen bei der fahlen Stille nicht aufhören, meiner Phantasie etwas vorzugaukeln und wieder und wieder lautlos den Berg hinab zu tanzen.
Endlich schickte sich der Mond zum Sinken an. Dichte Nebelfetzen trieben jetzt von Westen her in mein Tal herein. In wenigen Minuten waren wir in schwärzeste Nacht gehüllt. Ich lauerte nun doppelt angespannt.
Wieder und wieder rieb ich mir die Augen aus, als könnte ich danach besser die Finsternis durchdringen. Bald schweiften aber die unruhigen Gedanken wieder ab, der Zukunft, der Vergangenheit zu. Da erhob sich die alte Tschimo, die dicht neben mir zusammengeringelt geschnarcht hatte, lange schnupperte sie das Tal hinab, machte dann gemächlich ein paar Schritte vorwärts, sicherte wieder und war lautlos meinen Blicken in der Finsternis entschwunden. Wenn doch Hunde nur reden könnten! Sie kann ja auch irgend ein Wild in der Nase haben! Ein trollender Wolf mag die Antilopen ins Tal getrieben haben. Jetzt sucht mich Nehʿere auf. Er schmeichelt mir, er will meine Hand lecken, wie er dies in jeder Nacht einigemal für nötig hält. Da ist's, als gab' es ihm einen Stoß, und er jagt mit hellem Anschlag der alten Hündin nach ins Tal hinab. 100 m vor mir liegen zwei größere Tümpel. Von dort hört man einen platschenden Ton, wie wenn ein schwerer Körper ins Wasser rutscht, und in der gleichen Richtung – sehe ich dort nicht ein Glühwürmchen glimmen? – Rasch hintereinander gebe ich drei scharfe Alarmschüsse. Nur »Achtung« sollte dies heißen, nur beizeiten ein: »Hier ist man auf seiner Hut.« An den Tümpeln drunten hört man's hierauf deutlicher patschen, und durch das wüste Hundegeheul dringen ein paar unanständige chinesische Schimpfworte bis an mein Ohr. Bald ist es aufs neue totenstill. Es blieb auch still, bis der Morgen dämmerte, an dem ich mich erst ganz spät erhob und nach meinem Bergsattel zog, der mit seinen 4390 m tief zwischen 400 und 500 m höhere kahle Granitschroffen eingesenkt lag.
Von diesem Sattel aus lief genau nordöstlich ein Riesentrog aus Granit. Er hatte die Länge von 30 km. Alle Seitentäler, die von den umgebenden Granitbergen herabkamen, nahmen 150 m über der Sohle des Haupttals ein plötzliches Ende, und alles Wasser, das sie führten, mußte in flachen schmalen Rinnen an den Wänden des Trogtals hinabfließen.
Am 21. Juli wurde der Wald allmählich dichter. Als wir unter 3700 m gekommen waren, wurde die Talsohle enger, schluchtförmiger und der Fichtenhochwald zum schier undurchdringlichen Urwald. In 3600 m stießen wir auf Weidegründe zwischen den Wäldern und bald auf vier schwarze Zelte. Der Weg wurde nun zum gut ausgetretenen Pfad, er zog sich aber noch lange hin, so daß wir erst um drei Uhr nachmittags an die ersten Häuser von Merge gelangten. Mitten im Tannenwald tauchten Gerste-, Hafer- und Kartoffeläcker auf, und zweistöckige Häuschen, mit Schindeln und moosigen Steinen bedeckt, zauberten eine friedliche Schweizerlandschaft hervor. Über den tosenden Bach, dessen Bett hier noch immer 3450 m Höhe hatte, führten kurz hintereinander zwei breite Holzbrücken. Viehzäune und Schweine vervollständigten den heimatlichen Eindruck. Auf einer Waldwiese auf einer der hohen Talterrassen schlugen wir auch schließlich das Zelt auf.
Bald hatte sich ein Besucher, wie er vorgab, ein Einwohner aus einem der nächsten Häuser, eingefunden, der mit uns Tee trank und uns versicherte, es gebe in ganz Merge weder Räuber noch Diebe, wir könnten die Tiere auch die Nacht über ruhig draußen grasen lassen. Als er gegangen war und wir nach den Pferden sahen, fehlte gerade mein bestes Reitpferd, und die Spuren seines Hufbeschlags entdeckten wir erst nach stundenlangem Suchen genau in der Richtung, in der unser Besuch davongeritten war. Leider mußten wir die Verfolgung bald darauf einstellen, weil die Dunkelheit einbrach und wir erkannten, daß wir einem ganz abgefeimten Roßdieb zum Opfer gefallen waren. Die Spuren liefen kreuz und quer, weiche Stellen im Boden, wo die Hufnägel sich deutlich abdrücken konnten, waren ängstlich vermieden.
Mit den ersten Sonnenstrahlen saßen wir am nächsten Tag wieder am Feuer und beratschlagten, ob es Zweck habe, die Verfolgung noch einmal aufzunehmen, da knackte es in den nächsten Büschen, und unser gestriger Besucher stand wiederum vor uns, band seine Rosinante, eine dürre Stute, neben unserem Waka fest und setzte sich, ohne eine Aufforderung abzuwarten, zum Frühtee nieder. Als wir von unserem Verluste sprachen, erklärte er eifrig, das Pferd habe sich sicher in dem dichten Unterholz unten im Wald verlaufen. Wir sollten noch besser suchen. Ich schickte darum meine drei Gefährten noch einmal auf die Suche, und während der Fan tse sich dann aufs Pferd schwang und wegritt, trat ich in mein Zelt, um Instrumente zu holen. Ich kam aber im nämlichen Augenblick wieder heraus, um den Lagerwächter zu machen, und sah nun unseren biederen Gast gerade noch hinter einem Busch mit einem meiner Maultiere verschwinden. So leicht wie den Abend zuvor sollte es heute doch nicht gelingen. Mit wenigen Sätzen holte ich ihn ein, nahm ihm das Tier wieder ab, riß ihn voll Wut vom Pferd und zwang ihn zum Feuerplatz. Nach einer Stunde im tête à tête mit dem Spitzbuben trafen endlich meine drei Leute ein, natürlich unverrichteter Dinge. Tsʿan Rarschdan, der eine der beiden Somo-Burschen, mußte dem Übeltäter in meinem Namen mitteilen, daß er mit mir ins Merge-Kloster gehen müsse, um sich wegen des heutigen Diebstahls zu verantworten und das Verschwinden meines Reitpferdes aufzuklären. Wir packten sodann zusammen, unser unfreiwilliger Gast half uns diensteifrig beim Aufladen, und weiter ging es nach Nordosten, wo in einer Entfernung von wenigen Li das Kloster liegen sollte.
Der Pfad führte durch dichten grünen Buschwald. Schon 1 km hinter unserem Lagerplatz verließ er die Talschlucht. Der Fluß wand sich in einer scharf eingeschnittenen Klamm zwischen felsigen Hängen nach Osten, und nachdem er in der Ferne aus Nordosten einen Zufluß erhalten hatte, entschwand er in südöstlicher Richtung. Wir aber blieben auf unserem Wege in nordöstlicher Richtung und mußten mitten im Wald einen 3600 m hohen Sattel überschreiten. Mich nahm die Aufnahme des Wegs und der gewundenen Waldschluchten vollkommen in Anspruch. Die Diener hatten mit den Packtieren vollauf zu tun, darum war es für unseren Spitzbuben ein leichtes, von seiner Stute zu gleiten und im Dickicht zu verschwinden. Da die alte Mähre ruhig in der langen Kette meiner Maultiere mittrottete, so glaubten jetzt meine Begleiter, vermittels des Tieres beim ersten besten Merge-Dörfler den Namen des Besitzers erfahren und dem Spitzbuben doch den Prozeß machen zu können. Ich ließ dies geschehen.
Die Wegaufnahme in dem dichten Wald blieb weiterhin schwierig. Immer in der gleichen Richtung weitermarschierend, gelangten wir nun in ein von Nordosten kommendes Flußtal, aus dem links und rechts zahlreiche Berggipfel und kleine Felszacken bis zur alten Höhe von 4000 m emporsteigen. Die Arbeit hielt mich so sehr auf, daß ich eine ziemliche Strecke hinter meiner Karawane zurückblieb. Ins Schreiben vertieft, ritt ich langsam weiter. Da springen plötzlich sechs bis acht Tibeter hinter einem Baum vor und wollen auf mich einhauen. Vom buschbestandenen Rain prasselt zugleich ein Steinhagel auf mich und mein Pferd. An vier Stellen trifft es mich, und Blut rinnt mir von der Stirne und blendet mich. Bis instinktiv das Routenbuch weggesteckt, die Zügel und die Waffe ergriffen sind, ist mein Pferd mit einigen gewaltigen Sätzen der Karawane nachgeeilt, die im dichtesten Busch von einigen Dutzend Mann umzingelt steht. Schwertblätter und Lanzenspitzen funkeln in der Sonne, ein ohrenbetäubendes Geschrei übertönt selbst das Brausen des Wildwassers nebenan. Hunde heulen. Schüsse krachen. Vor und hinter mir sehe ich mit einem Schlage Gabelflinten sich nach mir richten. Alles geht und kommt wie im Kaleidoskop so schnell. Die Maultiere sind schon verloren, sind herumgerissen worden und werden eben über eine Brücke getrieben. Ganz vorne sehe ich noch die beiden Jünglinge aus Somo auf dem Boden knien und kotauen. In einem Augenwinkel glaube ich Brdyal zu erkennen. Er hat sich auf ein Pferd geschwungen, hat ein Gewehr zur Hand und erwidert – wie er nachher berichtete – einige Schüsse. Ich selbst will nicht sogleich schießen und rufe, so gut ich kann, den mir am nächsten Stehenden an: »Ich komme als Freund vom Pan da lama, eurem Herrn. Wer ist der Bon? Was wollt ihr? Was soll dies?« Als Antwort zuckt nur eine Schwertklinge gegen mich, die ich mit der Pistole pariere. Jetzt trifft mich noch ein mächtiger Schlag in den Rücken. Mein Pferd wird von hinten her gestochen. Brdyal reitet los und ruft mir noch ein: »Fort, Herr, ins Kloster, ehe wir einen erschossen haben« zu. Drei Sätze – wir sind beide aus dem Wirbel der Angreifer. Noch 20 m weiter, und wir sind aus dem Gehölz draußen und stehen inmitten einer lieblichen und freundlichen Dorfsiedlung, sehen viele Dutzend Häuser, die zweistöckig und mit Schindeldächern bedeckt wie ein Weiler in unserem Schwarzwald in weiten Abständen voneinanderliegen. Der Ort streckte sich über die ganze Nordseite des Tales hin. Jeder Hof lag auf seinem zu ihm gehörigen Feld.
Einmal außerhalb des Gehölzes, hielten wir sofort die Pferde an. Unsere Angreifer verfolgten uns nicht weit, Sie begnügten sich mit dem Raube. Sie führten die Maultiere in ein Haus auf der anderen Seite des Baches, meine zwei Diener, immer mitten in der Schar, reden eifrigst auf sie ein. Alles spielt sich noch so nahe von mir ab, daß ich leicht jeden einzelnen meiner Angreifer aufs Korn nehmen könnte. Aber warum durch Blutvergießen die Rache und Verfolgung des ganzen Stammes auf mich ziehen? Meine Pistole war überdies durch das Parieren eines Schwerthiebs zerhauen, meine Schwertklinge abgesprungen.
Wir suchten das Kloster von Merge, in dem der Be hu residieren sollte. Aber die Siedlung wollte kein Ende nehmen. Stundenlang zieht sie sich hin. Wir ritten im Schritt. Bald merkten wir, daß nur der unterste Teil des Tales gegen uns alarmiert und aufgeboten war. Höher oben wurden wir gegrüßt. Nachdem wir an gegen dreihundert Höfen vorbeigeritten waren, kam das Kloster in Sicht. Vier Akka hockten träumerisch vor dem Tor und spielten mit ihren Rosenkränzen. Frauen gingen um ein Gebetmühlenhaus und setzten die schmierigen Lederwalzen in Schwung. Es war ein Gelugba-Kloster und machte einen recht ärmlichen Eindruck, der gar nicht zu der Größe und der offensichtlichen Wohlhabenheit des Ortes paßte.
Wir fingen eine harmlose Unterhaltung mit den Mönchen vor dem Tore an und erfuhren schon jetzt, daß der Vorsteher nach Labrang gomba und Gum bum gereist sei und vor einem Monat nicht zurückerwartet werde. Bis Labrang gomba rechneten sie hier fünfzehn bis sechzehn Reittage. Nachdem Brdyal einem der Mönche ein kleines Geschenk gegeben hatte, wurden wir durch das niedere Tor ins Innere gelassen und fanden in dem baufälligen Abtshaus den bTschang dsod, den Verwalter. Wir trugen ihm unsere Lage vor und übergaben ihm den Paß und das Empfehlungsschreiben des Pan da lama, das ich zum Glück bei mir in der Tasche trug und nicht in einem meiner Koffer verpackt hatte. Der bTschang dsod war ein großgewachsener Mann mit einem hübschen, geschwungenen Schnurrbart. Er nahm die Sache sehr leicht und erklärte stolz: »Wir von Merge sind keine Straßenräuber wie die Leute aus Ngaba. Wir sind alle des Sung pan ting gehorsame Kinder.« Wenn die Angreifer Merge-Klosterleute seien, so würde ich noch am Abend mein Hab und Gut wiedersehen. Freilich gebe es auch noch einen Laienvogt im Tale, dessen Leute nicht auf die Befehle des Klosters hörten, sondern zu den Bo lo tse hielten.
Nach kurzem Besinnen gab uns der Verwalter einen Reiter mit, in dessen Begleitung wir wieder die zwei Stunden das Tal hinabritten. Der Mann, der als Abzeichen seines Auftrags einen schäbigen roten Roßhaarbusch in der Hand trug, war guter Dinge auf dem ganzen Weg. Er freute sich schon über das bevorstehende Trinkgeld. Unten im Tale spielen sie gerne Räuber, meinte er. Oben ums Kloster herum säßen dagegen lauter brave und gediegene Hausväter. Ein paar Schritte von dem Gehölz an der Brücke, wo wir überfallen worden waren, steht das Darro-Haus von Unter-Merge. Als wir so weit gekommen waren, machte unser Begleiter schon ein bedenklicheres Gesicht. Er hielt es nun für besser, vorerst allein zu verhandeln, und brachte uns für die Wartezeit in das Darro-Haus, das abgesehen von einem alten Sklaven, dem das halbe Ohr abgeschnitten war, unbewohnt war. Er selbst ging über die Brücke hinüber zu jenem Hof, in dem das Räuberquartier lag.
Bis zur Rückkehr unseres Vermittlers war es längst Nacht geworden, und ich und Brdyal hatten es uns im ersten Stock, in einem großen Saale, in dessen Mitte ein Kupferkessel auf einem schweren schmiedeisernen Dreifuß stand, bequem gemacht. Eine Kurme, eine Haussklavin, verkaufte uns Tee und Tsamba und zündete uns ein Holzfeuer an, das den Raum etwas erleuchtete. Bei Tage war dieser Küchensaal in Halbdunkel gehüllt, da er nur drei Fenster, nicht viel größer als Schießscharten, besaß. Bei Nacht ließen diese Öffnungen nur zögernd den Rauch entweichen, für den es keinen anderen Abzug gab.
Es mochte neun Uhr geworden sein, als unser Vermittler mit dem Sklaven des Darro und mit zwei älteren Männern in unseren Saal trat. Nur wenn man auf dem Boden hockte, konnte man den dicken Qualm durchdringen und die Menschen auf eine gewisse Entfernung erkennen. Die vier Ankömmlinge ließen sich deshalb, kaum daß sie uns kurz begrüßt hatten, rasch am Feuer nieder. Sie zogen das Schwert aus ihrem Gürtel, um bequemer sitzen zu können, und legten es neben sich auf den Boden, suchten behäbig in den Falten ihrer fettigen Röcke nach ihrer Schüssel, ließen sich Zeit, Tee zu schlürfen und Tsamba zu kneten. Dann suchte man umständlich in den Kleiderfalten eine lange eiserne Pfeife, nahm seinen Tabak aus dem gestickten Beutel, griff nach einem Stückchen Dung, um seine winzige Prise zu entzünden, tat ein paar Züge, klopfte die Prise am Stiefel wieder aus, stopfte nochmals und – – endlich kam man aufs Sprechen, und zwar auf Kretschiu-, dann auf Bo lo tse-, endlich auf Kin tschuan-Art. Chinesisch sprach keiner. Hochtibetisch sprach nur der Klostermann, und auch der nur gebrochen. Die Unterhandlung war also sehr erschwert. Brdyal kannte kein Kretschiu, und seine Kin tschuan-Sprache verstand nur der alte Knecht.
Die Alten begannen in ihrem Kretschiu-Dialekt weise und bedächtig und mit vielen Sprichwörtern gewürzt von ihrer Altväter Geschichte und Art zu reden und gaben sodann ohne weiteres zu, daß eine große dumme Sache heute geschehen sei. Ihre Kretschiu-Worte wurden von dem Knecht ins Kin tschuanesische, von da durch Brdyal ins Chinesische übersetzt. Es stellte sich heraus, wie ich vermutet hatte, daß durch unseren Bekannten von Merge Tschumdu die Jugend aufgereizt worden war, und daß mich diese ohne langes Besinnen überrumpelt hatte. »Ehe du dazu kamst, waren deine Sachen in ihrer Hand. Du versuchtest nun, ihnen durch das Kloster den Prozeß zu machen. Es wird aber nicht viel nützen, wenn du nach dem Regen den Schirm kaufst. Was man in Händen hat, besitzt man«, lautete ihr Refrain.
»Unsere jungen Krieger, die deine Sachen in Händen haben, wollen sie nicht mehr zurückgeben. Die Hühner fressen nicht nur Körner, und sie haben die Übermacht. Ihr seid ja nur noch zu zweien.«
»Du hast ein Schreiben vom Pan da lama. Wir kehren uns nicht daran. Hierzulande weiß man, daß die »dia ner« von Sung pan ting vierhundert Fremde und Christengänger vor wenigen Tagen getötet haben. Ihr Fremden dürft also gar nicht hier reisen, und wir brauchen auch nichts zurückzugeben.«
Die Unterredung verlief resultatlos. Sie hatten beschlossen, daß auf jeden Fall nichts geschehen und nichts zurückgegeben werden sollte, bis der Darro wieder komme. Auf meine Frage, wo sich der Darro befinde, erhielt ich keine bestimmte Antwort. Den ganzen nächsten Tag blieb ich im Darro-Haus bei der Kurmi und dem Haussklaven, die beide stupide Menschen waren. Von der Holzveranda des Hauses sah ich auf einen Wiesenplan, auf dem meine Maultiere grasten, wo neben einem Haus ein fortwährendes Kommen und Gehen von Reitern und Fußgängern stattfand. An drei Stellen brodelten Teekessel, Lieder wurden dort gesungen, kurz, eitel Lust und Freude herrschte bei meinen zahlreichen Gegnern, und niemand kümmerte sich mehr um mich. Wenn ich aber Miene machte, über den Bach zu gehen, so nahmen die nächsten ihre Gewehre zur Hand und legten auf mich an.
Am Nachmittag bekam ich zum ersten Male einen meiner Somo-Diener zu Gesicht. Yangsen besuchte mich unaufgefordert und berichtete, daß die Kisten noch nicht erbrochen seien, weil die Tibeter wegen des Inhalts Bedenken hätten, daß sie aber die Lebensmittel verzehrten und im Begriff seien, meine Tiere unter sich zu verteilen. »Wenn du weiterreist,« meinte er treuherzig zum Schluß, »so nimm dich vor dem Sung pan ting in acht. Er hat alle Christen getötet. In China darf kein Christ mehr leben. Die Merge-Fan tse würden auch dir nach dem Leben trachten, wenn wir nicht gesagt hätten, du seist wohl ein Fremder, aber ein Mohammedaner.«
Ich hatte den ganzen Tag Besucher bei mir. Jeder wollte mich in der Nähe besehen. Vom Darro erfuhr ich die widersprechendsten Gerüchte. Der eine sagte, er komme, er sei schon da, der andere behauptete: »Man wird ihn holen lassen«, und der Dritte: »Vielleicht wird man ihn holen lassen«. Die junge Mannschaft fühlte sich als Herr der Lage. Für sie war es nur schade, wenn der Darro bald kam und ihnen die schöne Stimmung raubte. Wie ich sie kannte, war auch noch gar nicht ernstlich daran gedacht worden, einen Boten abzusenden. Sie wollten doch alle nur ein Fest feiern. Der Vermittler vom Kloster hatte sich in aller Stille gedrückt und hatte Brdyal nur noch gesagt, daß keiner unserer Gegner zum Kloster gehöre, es seien Kretschiu Männer, die als schlimme Brüder bekannt seien.
24. Juli. Man steht im Darro-Hause mit der Sonne auf; die Kurme macht Feuer, wenn die Hähne zum zweiten Male krähen. Wenn es hell geworden ist, zieht sie in den nahen Wald, um für den übrigen Tag das Holz zu holen, und in der Zwischenzeit melkt sie rasch die Milchkuh, die bei Nacht im Stalle steht. Von ihrem heutigen Ausgang brachte sie die Nachricht mit, daß noch immer kein Mann zum Darro abgeritten sei. Es war auch nicht möglich, herauszubringen, wo er seine Residenz hatte. Ich erfuhr dagegen, daß er nur ein- oder zweimal zum Steuereinziehen nach Merge komme. Es hatte darum keinen Zweck, länger in diesem Hause zu bleiben. Ohne daß sich jemand darum kehrte, sattelten wir um sechs Uhr früh unsere beiden Reitpferde und ritten nach dem Kloster. Beim Kloster suchten wir einen Chinesen Li ding auf, der bankrott geworden war, weil ihm unweit von Merge Ngaba-Leute sein Letztes abgenommen hatten. Er lebte jetzt in einem schmierigen Häuschen und fristete durch Kleinhandel und Almosen ein kümmerliches Leben. Er wußte mir von den Bewohnern vom unteren Teil des Tals wenig Gutes zu sagen und riet mir dringend, ohne Aufenthalt nach Sung pan ting zu fliehen. Er wollte gehört haben, daß bei dem gestrigen Zechgelage einzelne Schreier ausgemacht hätten, mich totzuschlagen, denn dann erst könne man den Raub verteilen. Wir sagten dem guten Li ding, wir würden heute noch »schang leang« machen und im Kloster bleiben. Als wir uns aber von ihm verabschiedet hatten, legten wir schon hinter der nächsten Waldecke los und trabten immer weiter dem Fluß entlang talaufwärts, bis wir an einige schwarze Zelte kamen, die den zum Kloster gehörigen Zelt-Merge gehörten.
Um Mittag betraten wir eines dieser Zelte und baten um die Erlaubnis, am Herdfeuer Brot backen zu dürfen. Zeltvater und Zeltmutter saßen während einer Stunde neben uns und schauten zu, wie Brdyal mit meiner Hilfe den Teig knetete, Teigringe formte und sie in der Asche buk. Kein Mensch beachtete uns weiter, und niemand schien mich als Fremden zu nehmen. Wir bezahlten die Gastfreundschaft mit einem unserer noch warmen Laibe, durften dafür am Mittagstee teilnehmen und trabten dann weiter.
Wir hatten einer sehr breiten Yakstraße zu folgen, um nach Sung pan ting zu kommen. An der letzten Merge-Zeltgruppe bog sie nach Osten und führte uns durch Hochwald zu einem Lab rtse (Tafel XXII oben) auf 3700 m hinauf, von wo sich ein schöner Rundblick eröffnete. Im Süden wie im Norden erhoben sich die Gipfelreihen bis zu 4100 und 4200 m Höhe, und auch über dem Muldental der Merge-Zelte drüben schob sich ein grüner Rasenrücken hinter den anderen. Nach Südosten aber zog sich von dem Lab rtse ein Tal, das bis zu uns herauf von dichtem, dunklem Tannengrün erfüllt war.
Neben dem Lab rtse stand ein hoher Altar aus Steinen und Rasenstücken, auf dem Thujablätter qualmten, als wir ankamen. Ein Akka war es gewesen, der hier ein Opfer angezündet hatte. Wir sahen ihn noch in der Ferne auf einem ungesattelten Pony davonjagen; zwei einsamen Reitern glaubte er nicht trauen zu können. Brdyal warf sich an seiner Statt vor dem Altar nieder, legte neue Thujazweige dazu und bat durch lautes »i hóloo-o! i hóloo-o!« um die Gunst der Ortsgeister. Ehe wir in das Waldtal hinunterstiegen, ließen wir die Pferde eine Stunde lang unter dem Sattel grasen, hielten aber so lange scharfen Ausguck, ob nicht Verfolger von Merge nachkämen.
Um sieben Uhr abends näherten wir uns einer Rodung in dem großen Wald. Ein fußlanger dreikantiger Zauberdolch (purbu), der in der Mitte des Weges steckte, die Form einiger großen Tsʿatsʿa-Häuser und ein fremdartiger Trommeltakt sagten uns, daß wir in eine Bönbo-Gemeinde geraten waren. Es war Karlong (3150 m). Wenig mehr als hundert Familien stark, hat es nur Bauern, die wenig Vieh besitzen. Wie in anderen Bönbo-Gemeinden sah ich auch hier Fadensterne von 1/2 m Durchmesser an Bäumen und an den Holzspeeren der Lab rtse hängen, die zur Besänftigung der Himmel- und Erdgeister dienen. Über die Enden dünner Holzkreuze waren Garne von grüner, roter, weißer und blauer Farbe gespannt, die in Quadraten, Dreiecken und Sechsecken sich überschnitten, und die ein Bönbo-Priester unter ständigen Anrufungen und Gebeten und unter Anhauchen und Anblasen nach den strengen Vorschriften alter Zauberbücher und in ganz bestimmter Ordnung zusammengeknüpft hatte.
Fußnote aus technischen Gründen im Text wiedergegeben. Re. für Gutenberg.
Waddell, »The Buddhism of Tibet«, London 1899, S. 485, hat ähnliche Fadensternfiguren, wie sie übrigens auch zur Verschließung aller Bönbo-Amulettsprüche angewendet werden, abgebildet. W. beschreibt seine Fadensternfiguren als »emblems to bar the earth- and sky-demons«. Originale davon befinden sich in der ostasiatischen Abteilung des Berliner Völkermuseums. Auch sie gehören zum Bönbo-Kult. Die Verbindung dieser Fadensterne – wie sie Waddell darstellt – mit einem Widderkopf zur Beschwörung der Mutter aller Erdgeister (d. h. zur Beschwörung von allem
![]() »Yin« [chin.]) und die Verbindung mit einem Hundekopf zur Beschwörung des Vaters der Himmelsgeister (d. h. zur Beschwörung von allem
»Yin« [chin.]) und die Verbindung mit einem Hundekopf zur Beschwörung des Vaters der Himmelsgeister (d. h. zur Beschwörung von allem
![]() »Yang« [chin.] s. S. 17, Anm. und das Bild auf dem Einband) ist mir aber in Osttibet nicht begegnet und ist jedenfalls in Kin tschuan unbekannt.
»Yang« [chin.] s. S. 17, Anm. und das Bild auf dem Einband) ist mir aber in Osttibet nicht begegnet und ist jedenfalls in Kin tschuan unbekannt.
Hier dachten wir zu nächtigen, als nach dem fast zwölfstündigen Ritt unsere Pferde ausließen. Allein eine Frau, die uns bei sich aufnahm, erzählte, daß der Weg zwischen Karlong und Sung pan ting nur von großen Karawanen ungefährdet bereist werde, daß es Wahnwitz sei, nur zwei Mann hoch am hellichten Tage diesen Weg zu wagen. Auch Li in Merge hatte uns schon gewarnt, und gerade wegen der Strecke hinter Karlong hatte man in Ma tang so sehr wenig Lust gezeigt, mich zu begleiten. Ich entschloß mich rasch, noch in derselben Nacht weiterzueilen.
Im steilen Zickzack geht es kurz hinter Karlong auf einen Berg hinauf; in der Dunkelheit mußten wir dort aufwärts tappen. Bei 3600 m etwa hatten wir den Wald hinter uns gebracht, und bei 3800 m befanden wir uns auf einer breitgetretenen Straße, die von da an in ungefähr gleicher Höhe am Hang hinführt. Vor Mitternacht schon war die Kraft meines Schimmels zu Ende. Er weigerte sich, noch ein Bein vorzusetzen, und zwang uns, mitten auf der Straße eine Viertelstunde liegen zu bleiben. Von da ab marschierten wir wie die Schneckenpost. Brdyal zog die Tiere am Zügel, und ich trieb von hinten mit der Peitsche. Sie wären sonst alle paar Schritte stehen geblieben. Auch so kamen wir höchstens eine Viertelstunde lang vorwärts, ohne stehen zu bleiben. Nach dieser kurzen Zeitspanne aber fruchtete nichts mehr; die Tiere zogen die Hälse lang, schoben den Schwanz zwischen die Beine, standen starr und angewurzelt und waren so müde, als wollten sie umfallen. Um zwei Uhr war die Willenskraft auch bei meinem Brdyal zu Ende. Er krümelte sich mit einem Male völlig apathisch auf dem Straßenboden zusammen. Mühsam und schluchzend stieß das Häufchen Unglück noch hervor, er könne sich nicht weiterschleppen, er wolle schlafen, nur schlafen. Nur mit unendlicher Mühe und nach einigen kräftigen Püffen gelang es mir, die drei Pfleglinge abermals vorwärts zu bringen; hier stillzuliegen war natürlich ganz unmöglich. Wer bürgte mir denn, daß man uns nicht schlafend fand? An jeder Wegebiegung aber hoffte ich lange vergeblich auf Wald, in dem wir uns verkriechen könnten.
Endlich um vier Uhr in der Frühe senkte sich der Weg etwas, und wir erreichten die Waldzone. Ich ließ nicht locker und brachte die Pferde noch ein paar hundert Schritte in ein Waldstück hinein, legte noch einen Strick um ihre Fesseln, den ich mir um die Füße wickelte – meinem todmüden Brdyal waren längst die Augen zugefallen – und legte mich unter den nächstbesten Rhododendronbusch. Eine halbe Stunde vorher hatte ein kalter Rieselregen eingesetzt, der das Moospolster des Waldes nicht molliger machte, doch wer schert sich in einem ähnlichen Falle um solch eine Kleinigkeit!
Wie ich wieder erwachte, war's heller Tag. Ich hörte Stimmen und Pferdegetrappel, das auf der Straße verklang, konnte jedoch niemand erkennen, da aus allen Tälern dicke Wolkenmassen heraufquollen und auch wir zeitweise in dichtesten Nebel gehüllt waren. Nachdem ich meinen Diener geweckt hatte, zogen wir weiter. In den nächsten Stunden senkte sich der Weg stärker. Ein steinereicher Zickzack nahm uns auf, und unten angekommen, hatten wir nur mehr wenige Kilometer zu tibetischen Bauernhäusern und zu einer Mühle, deren Insassen Chinesisch verstanden, und die mir die freudige Eröffnung machten, daß wir in Mao niu gu angekommen waren, an demselben Platz, an dem ich im Oktober 1904 auf dem Rückzug von Ngaba herausgekommen war. Während wir unser letztes Merge-Brot verspeisten und uns Tee kochten, forschte ich vorsichtig bei einem gesprächigen Alten nach den fremdenfeindlichen Umtrieben von Sung pan ting. Ganz grundlos war das Gerede der Kretschiu doch nicht gewesen. Einen Monat früher vielleicht waren mehrere katholische Chinesen totgeschlagen worden, und der Ör fu von Sung pan hatte eine Bekanntmachung anschlagen lassen, die auch bei meinem jetzigen Gewährsmann die Vorstellung erweckt hatte, als ob alle Fremden außerhalb der Gesetze ständen und kein Recht mehr hätten, in die Stadt zu kommen.
Mao niu gu liegt 3100 m hoch; um nach Sung pan ting zu gelangen, klettert man unmittelbar hinter der Mühle noch einmal auf einen Berg von 3550 m Höhe und hat von dort zum Ufer des Min-Flusses noch einen jähen Abstieg zu überwinden. Ich traf gegen Mittag in der Stadt Sung pan ting ein.
Am nächsten Mittag schon kam ich durch Vermittlung des Polizeihauptmanns der Stadt mit den Sekretären der beiden großen Ya men überein, daß ich ein Mitglied der mohammedanischen Kaufmannschaft, sowie zehn Fußmilizen des Generals unter dem Kommando eines Offizieranwärters, sowie vier Reiter des Ör fu-Ya men gestellt bekomme, um mit ihnen nach Merge zurückzukehren und auf die Herausgabe meiner Sachen zu drängen. Dafür sollte ich nach der Rückkehr in Sung pan ting 100 Tael bezahlen. Leider war es mir unmöglich, schon im voraus durch Geschenke die Willigkeit der Chinesen zu vergrößern. Als ich meine müden Rößlein durch das Stadttor von Sung pan zog, hatte ich nur noch wenige Silberbrocken in der Tasche. Es war schon deshalb die höchste Zeit, daß ich wieder in den Besitz meiner Kisten kam. Wenn sie erbrochen und ihr Inhalt verteilt war, stand es schlimm um mich, denn auf Kredit war hier wenig zu hoffen.
Die Vorbereitungen für den kleinen Kriegszug hatten die Chinesen rasch getroffen. Am Abend des 27. Juli sammelte sich die kleine Schar bereits hinter dem ersten Berg neben der Mühle von Mao niu gu. Dort wurden drei Zelte aufgestellt. Das kleinste, aber beste und schönste bezog Ma san ye, ein siebenundsechzigjähriger mohammedanischer Kaufmann, der in Merge seit Jahrzehnten Handel trieb und landab und -auf bekannt war. Er kam mit einem Neffen und einem jungen Pferdeburschen. Er war als Unterhändler bestellt. Das zweite Zelt beherbergte die vier Ma tui, die Reiter einer mohammedanischen Leibwache des Ting, unter dem Kommando ihres Sche tschang, Korporals oder Anführers von Zehn, eines fünfundvierzigährigen, in Tibet bankrott gewordenen Kaufmanns. Sie trugen scharlachrote Röcke mit breiten Frackschößen an den Seiten, so daß man schon auf weite Entfernungen sehen konnte: holla, hier kommen Reiter des Sung pan ting!
Im größten Zelte schlief der Tsung ye mit seinen zehn Mann. Es waren zwar tatsächlich nur neun Mann. Man sprach aber immer von den »Zehn«. Von diesen waren vier mit alten Hotchkiß-Gewehren bewaffnet, wovon doch immerhin zwei in so gutem Stand waren, daß man damit schießen konnte. Die übrigen Infanteristen trugen in dem blauen Kalikofutteral ihres Parapluies ein kurzes Römerschwert. Die Ma tui hatten drei verrostete Henry-Martini-Gewehre, aus denen man mit Hilfe des Putzstocks nach einer Weile die Patronenhülsen herausbrachte. Da ich selbst kein Zelt hatte, fand ich für Geld und gute Worte ein Unterkommen bei den Ma tui. In der ersten Nacht goß es mit Kübeln vom Himmel, und einmal gab's ein großes Gezeter; der Wind hatte das Zelt der Fußmilizen gepackt und über den Köpfen der Schlafenden in Fetzen zerrissen.
Am 28. Juli erstiegen wir geschlossen den großen Karlong-Berg, auf dem wir auch die Nacht vom 28. auf den 29. verbrachten. Am 29. ging es durch das Dorf Karlong hindurch und noch mehrere Kilometer das Tal hinauf. Meine Soldaten hatten für den Transport ihrer Zelte, Gewehre und Lebensbedürfnisse eine Ula in Gestalt von zwei Yakbastarden, die ihnen die Bewohner von Mao niu gu stellen mußten. In Karlong sollte die Ula wechseln. Aber den Karlong-Tibetern fiel es nicht ein, sofort den Weitertransport des 2 Zentner schweren Soldatengepäcks zu besorgen. Sie führten recht aufsässige Reden und erklärten kühn: »Das Wasser im Fluß dürft ihr nicht trinken, aus unseren Wäldern sollt ihr kein Holz nehmen, unser Gras brauchen eure Tiere nicht zu fressen, und vollends Ula stellen wir schon gar nicht.« Die Soldaten verstanden aber keinen Spaß und verprügelten kurzerhand den Sprecher, der ihnen dies gesagt hatte, woraus sodann eine allgemeine Schlägerei entstand, so daß ich ernstlich für den Ausgang des ganzen Unternehmens bangte. Denn würde sich Karlong mit Merge vereinigen, wie sollten dann meine paar Männeken die geraubten Sachen herausbekommen? Zum Glück gelang es, mit Hilfe des alten Ma san die Mao niu gu-Leute gegen ein geringes Entgelt zu bewegen, unsere Habseligkeiten noch eine Tagereise weiter zu schleppen.
Am 29. Juli wollten wir früh daran sein und bis nach Merge kommen. Kurz nach Sonnenaufgang wurde jedoch das Lager alarmiert. Die Milizen, die die grasenden Pferde hüteten, rannten ängstlich zu mir und riefen schon von weitem: »Ladet die Gewehre! Ganz Karlong ist gekommen.« – – Das Waldtal herauf zog dicht gedrängt eine Schar Bewaffneter zu Fuß und zu Pferd, mit Spieß und mit Schwert und mit Gabelflinte. Was blieb uns übrig, als den Finger am Abzug hinter Büschen und Bäumen zu stehen und auf die Dinge zu warten, die da kommen wollten! 100 m vor uns hielt endlich ein Sprecher mit einer Energie verratenden Bogennase und einem bräunlich schimmernden Backenbart. »Arro! schießt nicht.« rief es uns zu, »wir haben mit euch zu reden. Wir wollen die Sache von gestern besprechen.«
Dieses »Schang leang« wurde auf unserem Lagerplatz, auf der schönen, blumigen Waldwiese abgehalten. Auf der einen Seite hockten die Chinesen, in ihren bunten Soldatenkitteln, und drüben in zwei Gliedern die lange Reihe der vierzig dreckigschwarzen Fan tse. Man redete drei volle Stunden. Die stets langen Sprüche wurden immer mit stoischer Ruhe bis zum Ende angehört. Keiner wurde unterbrochen. Jahrhundertalte Streitigkeiten wegen Ula wurden frisch aufgewärmt, daß ein vergleichender Rechtsgeschichtler seine helle Freude daran gehabt hätte.
Meine Soldaten hatten dadurch einen Vorteil gewinnen wollen, daß sie gleich bei Beginn des »Schang leang« behaupteten, einer von ihnen sei bei der gestrigen Keilerei durch Steinwürfe schwer verletzt worden. Mit dick umwickelter Schulter trugen sie den jüngsten meiner tapferen Schar aus dem Zelt heraus und legten ihn zwischen die Parteien, wo er gar kläglich jammerte und winselte. Wenn er müde vom Stöhnen innehielt, bekam er von seinen Kameraden verstohlen einen Tritt, bis sein Seufzen wieder echt klang. Mit solchen Mätzchen fängt man aber keinen Fan tse. Der Sprecher ließ sich auch nicht eine Sekunde lang bluffen, und ohne Besinnen gab er zur Antwort: »Ich habe einen Mann zu Hause liegen, der ist so zerhauen worden, daß er weder essen noch trinken kann. Gerade deswegen komme ich.« Sicherlich war sein Verwundeter ebenso erdichtet wie der der Soldaten. Aber diese beiden mußten als Grundlage für die Verhandlungen dienen.
Nach der zweiten Stunde sah es aus, als ob der Streit geschlichtet sei, die Parteien hatten sich ausgeredet, und der Karlong-Führer sagte: »Wir wollen Freunde werden«; nach einigen Einwürfen seiner Leute fügte er aber hinzu: »Ula kann ich nicht geben.« »Auf der Stelle kehren wir nach Sung pan zurück und verklagen euch, daß euch der Markt verboten wird«, schrien die gereizten Ma tui zurück. Und alles springt auf. Aus den tibetischen Ärmeln huschen versteckte Steine, und im Handumdrehen brennen drüben die Lunten. Nur der Häuptling bleibt kalt. Er hält seine Leute zurück und hat sie auch vollständig in seiner Gewalt. Auf unserer Seite springen Ma san ye und ich dazwischen. Man setzt sich wieder, und es wird aufs neue verhandelt. Endlich, endlich bequemten sie sich zu der Erklärung: »Wir stellen die Ula, drunten im Wald warten die Tiere auf euch.« Sie wußten, sie mußten Ula leisten; nur willig sollte es eben nicht geschehen.
Und die Ula wartete tatsächlich schon die ganzen Stunden. Mit den frischen Tieren ging's rasch das Karlong-Tal hinauf. Unser viertes Lager stand am Nachmittag bereits halbwegs zwischen dem Paßübergang mit dem schönen großen Lab rtse und dem Merge-Kloster. Wieder fiel am Abend Regenguß über Regenguß, und als wir am 30. Juli weitermarschierten, regnete es Schnürchen. Trotzdem fühlte niemand Lust, im Lager zu bleiben. Die verrotteten Zelte boten zu wenig Schutz. Naß bis auf die Knochen kamen wir um acht Uhr zu den Häusern am Kloster. Ein jeder Mann meiner Truppenmacht trug einen großen Regenschirm. Die Uniformjacken und die Waffen kamen auf der Karlonger Ula hintendrein. Unser Einmarsch glich einem Touristenschwarm, der sich durch Scherzen und Singen den Humor erhält. Aber im Kloster angekommen, sollte die Arbeit einsetzen. Ma san ye besuchte Li ding, besuchte einen reichen Bauern, suchte den Nirba des Abtes zu einer langen Teesitzung auf, bis endlich der Regen aufhörte. Es war zuletzt aber nichts herausgekommen. Niemand wollte zuständig sein, niemand eine Vermittlung übernehmen. Meine Pferde sollten inzwischen unter die Angreifer verteilt sein, die Kisten aber noch dort stehen, wohin sie im ersten Augenblick geschafft worden waren. So halten es die Fan tse stets, wenn der Angegriffene entwischt ist, und wenn Gefahr besteht, daß er noch einen Prozeß führt. Ma san ye und der Tsung ye beschlossen, im Kloster zu bleiben und nicht weiter nach Merge hinein zu gehen. Unter-Merge war mit einem Schlage außerhalb des chinesischen Einflußgebiets oder gar nach Mao tschou zuständig. Die Führer waren ratlos und untätig, und mürrisch saß die ganze Gesellschaft um ein großes Feuer herum. Um fünf Uhr abends war ihnen das Herz bereits so tief in die Hosen gefallen, daß sie davon sprachen, noch mehr Soldaten holen zu wollen und in der Zwischenzeit nach Karlong zurückzukehren. Als ich jedoch aufstand und allein nach Unter-Merge gehen wollte, um nach meinen Sachen zu sehen, wollte keiner zurückbleiben. Es hatte nur an der Führung gefehlt.
Gerade mit Einbruch der Dunkelheit standen wir am Darro-Haus. Über dem Flusse drüben grasten meine Tiere ohne jegliche Wache. Nirgends war ein Mensch zu sehen. Der Schwarm hatte sich verlaufen. Die Feste waren verrauscht. Es hatte jetzt auch wieder zu regnen begonnen. Kein Hund und vollends kein Mensch mochte seinen warmen Ofen verlassen. Nach meiner Auffassung und Kenntnis der Eingeborenen war deshalb die beste Gelegenheit, sich rasch in den Besitz der Sachen zu setzen. Aber ich war eben der einzige Europäer. Wegen des Regens und der einbrechenden Dunkelheit war nichts weiter zu unternehmen. Zum Glück war der Darro-Kurme wieder dumm, ließ sich einschüchtern und gab mir und den Soldaten den Eingang ins feste Darro-Steinhaus frei. Es lag mir viel daran, das schützende Dach dieses Hauses und seine dicken Steinmauern über und um uns alle zu wissen, denn die armen Fußmilizen, die unterwegs zum größten Teil fußkrank geworden waren, machten jetzt einen noch viel elenderen Eindruck als am Versammlungsplatz in Mao niu gu; ich wollte alles aufbieten, sie nicht öffentlich sichtbar zu machen. Im großen Küchenraum kampierten an diesem Abend die Milizen, im Vorraum des großen Saals breiteten sich die Ma tui aus, im dritten Stock fand Ma san ye mit seinem Diener und Neffen in einer Art theologischer Bibliothek des Hausherrn ein Plätzchen. Ich legte mich in die halboffene Holzveranda, wo es zwar kalt war, wo ich aber hoffte, von dem Millionenheer des Darro-Ungeziefers am ehesten verschont zu werden, freilich ein unnützes Unterfangen; auch dort wimmelte es von Läusen und Flöhen und anderem, noch größerem Getier.
Auch diese ganze Nacht regnete es ununterbrochen. Am Morgen wurde gekocht, und dann wurden Lebensmittel eingehandelt. Mittlerweile sah ich von meiner Warte aus die Krieger sich im feindlichen Lager einstellen. Es regnete weiter, und darum schien auch drüben wenig Kriegslust vorhanden zu sein, und die Versammlung des Feindes brauchte recht lange. Bis dahin mußten wir eben geduldig warten! Hätte es nur am 23. Juli ebenso geregnet, es wäre zu gar keinem Überfall gekommen! Ein großer Teil der Fan tse marschierte in Gruppen zu zweien und dreien mit ihren Waffen dicht an unserem Haus vorbei und schimpfte weidlich auf den verrückten Alten, der ihnen diese Suppe eingebrockt habe. Nur wenige machten einen großen Bogen um das Haus und taten feindselig. Um zehn Uhr wurde der Darro-Knecht hinübergeschickt, um die Fäden zu einer Besprechung anzuknüpfen. Es hatte eine kleine Stunde gedauert, bis man sich über den Preis einig war, den der Kurme für seinen Gang bekommen sollte. Von 50 Tael handelte Ma auf ein altes Messer herunter. Auf diese Weise gelang es, daß um zwölf Uhr Ma san ye und der Sche tschang, die allein gut Kretschiu sprachen, in einem Nachbarhaus mit einigen Fan tse zu Präliminarverhandlungen zusammenkamen. Deren Ergebnis war der Beschluß, zwei Mann zu Pferd zum Darro zu schicken, um ihm den Fall vorzutragen. Der Darro sollte sich weiter unten im Lo hoa-Tal in einem anderen festen Haus aufhalten. Ma san ye brachte aber außerdem die Behauptung heim, daß bei dem Überfall einer der Männer durch beide Schultern geschossen worden sei und zur Stunde im Todeskampf liege. Er war der Ansicht, daß man erst den Ausgang dieses Schmerzenslagers abwarten müsse, ehe irgendwelche Schritte Aussicht auf Erfolg hätten. Ma san ye bedauerte, daß ich niemand hätte, den ich als verwundet ausgeben könnte. Gesehen hatte er natürlich den Verwundeten nicht, und er glaubte auch nicht daran. Am Abend kamen meine zwei Somo-Diener und händigten mir meine Wolldecken und meinen Kleidersack aus, den sie drüben gestohlen hatten.
1. August. Wieder regnete es die halbe Nacht, und am Morgen hingen die Regenwolken tief in das schöne Waldtal hinein. Die Tibeter ließen die Nacht über dreißig Bewaffnete in ihrem Hauptquartier, und diese beschlossen, um das chinesische Truppenaufgebot kirre zu machen, sämtliche Krieger des Tales zusammenzurufen. Wer etwa dem Aufgebot nicht gehorchen wollte, sollte der Allgemeinheit ein Rind steuern. Infolge davon strömten im Laufe des Morgens an die fünfhundert Mann drüben zusammen, und Zelt reihte sich an Zelt. 682 Pferde wurden drüben angepflöckt. Meinen Chinesen wurde es bang und bänger zumut, und ihre Gesichter wurden lang und länger, doch schon auf einen kleinen Zuspruch faßten sie sich wieder. Sie schleppten Steine herbei, prüften die Feuerwaffen und trafen Vorbereitungen, das lose Schindeldach, das wie auf allen größeren Häusern in Friedenszeiten zum Schutz gegen die Sommerregen über dem flachen, zinnenbekrönten Lehm- und Steindach aufgestellt war, im Falle des Angriffs rasch abbrechen zu können. Durch den Türspalt einer Kammer entdeckte auch einer ein kleines Arsenal von Gabelflinten, von Pulversäckchen und Bleikugeln. Von meiner Veranda genoß ich ein prächtiges Bild, und ich bedauerte nur, daß auch meine Kamera in Feindeshand gefallen war, und daß es meinen beiden Leuten noch nicht gelungen war diese zurückzustehlen. Der Tsung ye rechtete erregte mit Ma san ye, er habe nur auf seinen Kredit als Handelsmann gesehen, als er mir nicht gefolgt sei und nicht gleich am ersten Abend Hand auf mein Gepäck gelegt habe. Einzelne Schreier drohten uns nun mit Anzünden und Ausräuchern der Darro-Burg während der kommenden Nacht. Das große Machtaufgebot machte alle Fan tse-Bauern trunken.
Am 2. August wurde lange sechs Stunden verhandelt. Jeder, der den Beruf fühlte, zu sprechen, mußte angehört werden. Von tausend Händeln war die Rede. Es hieß heute, dem Verwundeten gehe es viel schlechter, er liege im Delirium darnieder und sei nicht zu sehen. Sonst hatte man immer Kranke und namentlich Verwundete zu mir gebracht, warum zeigte man mir gerade diesen nicht? Immer weniger glaubte ich an die Verwundung. Man wollte heute nur noch unter der Voraussetzung verhandeln, daß der Mann bereits gestorben sei. Ein Toter bringt einem Stamm mehr ein und ist in den Augen der Fan tse ein Mittel, um von dem Raub mehr zu retten. Ma san ye gab nun zu, mit der Annahme rechnen zu wollen, als sei ein Tibeter verwundet worden. Da er die Verhandlungen leitete und nicht ich, so mußte ich mich bequemen, die Verwundung als gegebene Tatsache anzuerkennen.
Am Abend stellten sich ein Lama und ein gut gekleideter Laie, angeblich ein Häuptling aus dem Koser-Tal, vor unserem Tore ein und kündigten die Ankunft des Darro an. Der Darro wagte sein kleines Schloß nicht zu betreten, weil er fürchtete, von den Soldaten als Geisel festgenommen zu werden. Ma san ye wurde zur Vorbesprechung in ein Nachbarhaus eingeladen. Meine Leute duldeten ihrerseits nicht, daß ich selbst mich in das Nachbarhaus begebe, weil sie glaubten, daß es den Tibetern einfallen könnte, mich gefangen zu nehmen, um dadurch noch mehr herauszupressen. Über den Stand der Verhandlungen wurde ich durch den Kurme und durch einen jungen Lama auf dem laufenden gehalten. Zuerst wurde wieder wie zuvor als niederster Preis für die Ablieferung meiner Kisten 1000 Tael verlangt, weil sie Gold und Moschus enthielten. Ganz allmählich wurden die Ansprüche herabgeschraubt. Lange verharrten die Tibeter bei der Forderung von 150 Tael, weil der Verwundete noch sterben werde und das Massenaufgebot, die Boten zum Darro usw. der Gemeinde so viele Unkosten gebracht hätten. Das Massenaufgebot sollte allein 100 Tael kosten. Alle diejenigen, die bei dem Überfall nicht dabeigewesen waren, stellten eine Forderung dafür, daß sie bei Strafe eines Yakrindes erscheinen mußten. Mitternacht war längst vorüber, drüben über dem Bache loderten noch immer die großen Lagerfeuer, als der Darro sich zu 50 Tael herabließ, und zwar wurde folgendermaßen gerechnet: 10 Tael dem Darro für seine Bemühung, seine Reise bei der schlechten Witterung und die Benutzung seines Schlößchens durch die chinesischen Soldaten, 10 Tael »kai kou« (Mundöffnung) für die Vermittler und die Sprecher der beiden Parteien, 20 Tael für Schnaps und für 360 Pfund Tee, der während des Aufgebotfestes von den Tibetern getrunken worden sei, und 2 Tael für den Boten zum Darro. Der Rest als Schmerzensgeld für den Verwundeten.
Da mich allmählich meine verlorene Zeit und noch mehr die Langweile in dem Gefängnis, in der Darro-Behausung, drückte, so erklärte ich mich zum allgemeinen Staunen, sowie ich von dieser Summe erfuhr, sofort bereit, sie zu bezahlen. Die Tibeter aber wollten am nächsten Morgen wieder mehr verlangen, da es ihrem Kranken jetzt wieder ganz schlecht gehe. Wäre der Darro nicht schon ganz früh in sein Haus und zu uns gekommen, so hätte sich die Lage noch einmal zugespitzt. Noch einmal fiel ein Wust von großmäuligen Drohungen auf beiden Seiten.
Erst um drei Uhr nachmittags wurden meine Kisten und die Maultiere vom tibetischen Hauptquartier an den Überfallsplatz an die Brücke gebracht. Die Tibeter versammelten sich dort in dem nämlichen Gehölz zu vielen hundert. Dann wurde ich von dem Darro gebeten, mir die Sachen anzusehen, ob alles da sei. Ich kam mit den 50 Tael, die ich noch vor Aushändigung der Kisten zahlen mußte. Ich halte sie mir von Ma san ye borgen und dabei in Gestalt von meinen zwei Pferden eine Sicherheit stellen müssen; ja selbst einen Damno vergaß der Geschäftsmann nicht. Er wurde mir zu 4 % berechnet.
Die Kisten waren nicht eröffnet worden. Von den kleineren Sachen und vom Lagerzeug fehlte nur Unwesentliches. Für das wenige wurde sogleich Ersatz geschafft. Die Maultiere waren auch alle zur Stelle, dagegen fehlte wieder ein Pferd, und keiner wollte etwas von seinem Verbleib wissen. Ich bedeutete dem Darro, daß ich den Preis des Tieres von den 50 Tael abziehen werde. Ma san ye aber, der allein mit mir gekommen war und den Dolmetscher machte, flüsterte mir zu: »Bestehst du darauf, so wirst du es mit dem Leben bezahlen. Du bist inmitten der tibetischen Scharen, und Hunderte von Gewehrlunten sind entzündet. Es braucht nur einen Wink des Darro, und wir beide sind« – sich unterbrechend fuhr er mit seinem rechten Zeigefinger horizontal an seiner Gurgel vorbei, und stumm deutete er nach der Brücke und in das Wasser des Lo hoa. Während der Worte des Alten schob mir ein Lama ein langes tibetisches Schreiben vor. »Unter dieses mußt du noch dein Siegel drücken.«
»Ich kann nicht Tibetisch lesen«, gab ich zurück und warf gleichzeitig Ma san vor, daß er mir von Derartigem gar nichts gesagt habe. Der schlaue Fuchs aber erwiderte: »Wenn du es nicht unterschreibst, so hast du den Ernährer meiner Familie getötet, denn sie werden mich mit dir zusammen umbringen.« So leicht freilich wollte ich mich nicht einschüchtern lassen. Ich nahm das Schriftstück an mich und bat, es mit meinem Wörterbuch studieren zu dürfen. Aber vergebens! Ma san ye, der Darro und der Lama drängten mich, gleich nachzugeben, das Schreiben enthalte nur die Erklärung, daß ich in Tscheng tu keine Klage einreiche. Schließlich unterschrieb ich den Schriftsatz mit der deutschen Bemerkung: »In der Notlage, umgeben von sechshundert auf mich gerichteten Flintenläufen«. Ich sagte ihnen, so lang sei mein Name. Der Lama, der Darro und Ma san ye drückten einen mit Tusche beschmierten Finger darunter. Die Tibeter kamen jetzt aus dem Gebüsch heraus. Ich war nun selbst erstaunt über ihr martialisches Aussehen und ihre Zahl. Sie banden hilfsbereit die Kisten auf die schon gesattelten Tiere, und fort ging's nach Ober-Merge zu. Die Fußmiliz, die Ma tui, meine Angestellten schlossen sich dem langen Zug hinter dem Darro-Haus an. Die Fan tse juchzten wild, warfen ihre Mützen in die Luft, und talauf und talab schallten ihre Zungentriller. Nur der Alte, der die ganze Suppe angerichtet hatte, lachte nicht. Er wurde vor meinen Augen ganz jämmerlich verprügelt.
Ich selbst war herzlich froh und fand es billig, mit nur 50 Tael alle meine Notizen, Photographien und mehrere tausend Mark Reisesilber zurückgekauft zu haben. Hätte ich nicht so sehr auf rasche Erledigung gedrängt, so hätte ich wohl noch die Tibeter überführen können, daß gar kein Verwundeter vorhanden war, und hätte kein Lösegeld zahlen müssen. Wir hatten aber nur für ganz wenige Tage Lebensmittel bei uns, und meine Chinesen besaßen natürlich ebensowenig Geld wie ich. Es mußte also so rasch wie möglich zu einer Entscheidung kommen.
Wir schlugen an diesem Abend auf einer Waldwiese oberhalb des Klosters Merge das Lager auf. Ich kaufte für die Soldaten eine fette Yakkuh, was sie in die beste Stimmung brachte. Ma san ye war wegen angeblich dringender Angelegenheiten noch im Kloster geblieben und hatte auch seinen Neffen als Geschäftsführer noch dort zurückbehalten. Mit ihm kam anderen Tags noch einmal der Häuptling vom Koser-Tal, der mit der Erledigung der Angelegenheit nicht zufrieden war, weil er selbst dabei leer ausgegangen war. Hatte er zwölf Stunden vorher noch vom Darro als von seinem besten Freunde gesprochen, so warf er diesem jetzt schnödeste Gewinnsucht vor. Anstatt 10 hätte er 20 meiner Tael »gegessen«, und das Schmerzensgeld des Verwundeten sollte er auch noch für sich beansprucht haben. (Weil natürlich gar niemand verwundet war!)
Auf dem weiteren Rückweg gerieten sich die Ma tui, Ma san ye und der Tsung ye noch in die Haare. Die Ma tui hatten einen Anteil an der Summe, die für das »kai kou« bezahlt war, der Tsung ye aber war leer ausgegangen, weil er kein Tibetisch konnte. Ma san ye, der seit einem Menschenalter Geschäfte mit Merge machte und im Kloster eine große Teeniederlage besaß, hatte für die versammelten Heerscharen der Tibeter den Tee und teilweise auch den Schnaps geliefert. An den 30 Tael, die dafür gezahlt wurden, sollte er nach Angabe des Tsung ye die Hälfte Reinverdienst haben. Diese 15 Tael wollten die Ma tui und der Tsung ye unter sich verteilen. Der Streit darüber entbrannte auch noch am nächsten Tage so heftig, daß ich mich höchlichst amüsierte und der ganze lange Rückmarsch vom volkspsychologischen Standpunkte aus sehr lehrreich wurde.
Beim Morgengrauen unseres letzten Tagesmarsches führte meine Mannschaft noch ein unschuldiges Scharmützel auf. Ma san ye saß mit mir vor dem Kochtopf und rauchte sein Pfeifchen. Meine Angestellten beluden die Tiere, als wir unsere vier Ma tui, die vorausgeritten waren, in ihren knallroten Fräcken zurückgaloppieren sahen. Gleichzeitig ertönte ein Schuß. Jetzt rissen auch die Ma tui ihre Gewehre von der Schulter und schossen vom Sattel aus, dann schwenkten sie nach rechts ein und verschwanden hinter dem Kamm. Wir hörten noch einige Schüsse; aber keine Sekunde lang unterbrach mein Begleiter seine Rede, und gemächlich setzte er sich mit mir in Bewegung, als wir aufgepackt hatten. In diesem Augenblick ließ der Tsung ye melden, sie hätten eine zehnköpfige Räuberbande, an ihren spitzen Mützen als Bo lo tse kenntlich, angerufen und, als sie auf den Anruf nicht hielten, angegriffen und in einen Wald gejagt.
Nicht so harmlos verlief ein Abenteuer, das an derselben Stelle Ma san ye's Sohn ein Jahr vor uns mit zwei tibetischen Dienern bestand. Er war auf dem Heimweg nach Sung pan ting und hatte eine Yakkarawane mit sich, die seine im ngGolokh-Lande eingetauschte Wolle, seinen Be mu und Moschus trug. Vier Ngaba-Räuber fielen über sie her. Ein Diener wurde erschossen, der andere konnte entfliehen. Der Sohn wurde total ausgeplündert und ausgezogen mit drei Schuß im Leibe aufgefunden. Waren im Werte von 700 Tael waren geraubt. Der am Leben gebliebene Diener spürte die Räuber aus, und dieses Frühjahr wurden die Waren zurückgegeben. An der Stelle, wo man die Leiche des Dieners gefunden hatte, einige Meter von der Straße, zeigte mir Ma san ye einen kleinen Pfahl, an dem eine weiße Maniflagge im Winde flatterte. Zum Seelenfrieden für den tibetischen Toten war sie aufgestellt. Wenn nur ein leiser Windhauch in den Tuchfetzen greift, flattern die frommen Formeln für den Toten zu den Göttern hin, und die arme Seele kriegt ihre Ruhe und wird von den Schergen des Toten- und Höllengottes weniger gepeinigt.
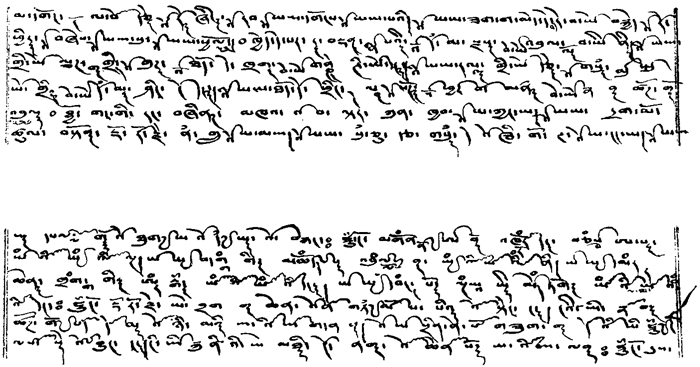
Abb. 13
Zwei Seiten eines Gebetbuches der Saskya-Mönchsekte.
Im Texte Hilfszeichen, Schnörkel und Verbindungsbögen, die beim Gesange den Mönchen das Anschwellen des Tons oder das Tremulieren angeben (⅓ verkleinert).