
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Nirgends in Tibet wurde ich so freundlich empfangen wie in Dscherku ndo. Alle Einwohner des Dorfs, zahllose Weiber, Mädchen und Kinder drängten sich um uns, um den Dolmetscher Tschang und um den großen Tschang, und ein freudiges »Odyi, odyi!« klang von hundert Lippen. Und wer nicht sein Willkommen rief, streckte zwischendurch grienend die Zunge, so lang er konnte, zum Munde heraus. Ein fremder Mann mit freundlichem Gesicht griff nach dem Zügel meines Pferdes und leitete mich bis vor ein Haus, das auf die Kunde von meinem Kommen für uns bereitgestellt war. Alles lachte und grüßte die Hsi ning-Leute. Hundert Hände halfen eifrig die Lasten abbinden und ins Haus tragen, so daß für meine Chinesen gar nichts mehr zu tun übrigblieb. Sie waren hier alle große Herren geworden.
Ein Flügel in einem der weitläufigen Steinhäuser stand uns zur Verfügung. Durch einen gedeckten Torweg mit zwei schweren Flügeln gelangte man in ein Höfchen, das auf allen Seiten von Häusern eingefaßt war. In einem vierstöckigen Turmgebäude in der Nordwestecke wohnte der Besitzer des ganzen Anwesens. Im Nord- und Ostflügel hausten drei größere Parteien neben- und übereinander mit noch einigen Aftermietern. Im Süden war ein einstöckiger Stall, auf dessen flaches Dach vom Hofe aus eine steile Leiter hinaufführte; und von diesem breiten Stalldache aus gelangte ich mit drei Stufen in die Wohnung des Westflügels, den ich für mich und meine Leute mieten konnte. Mein Küchenraum war gleichzeitig Diele und Flur, an den sich vier Zimmerchen anschlossen.
Kaum waren das Gepäck und die Sättel untergestellt, als eine alte Frau mit einem Sack voll Dung und mit zwei Göhren im Arm zu mir heraufkletterte, im Herde Feuer ansteckte und Tee kochte. Sie war vom Be hu gesandt worden und verstand meisterlich, wie alle Kʿamba-Frauen, mit der Diamtung, der Holzröhre von 60 cm Länge und 8 cm Durchmesser, in die der braune heiße Teeabsud mit Milch und Butter und Salz geschüttet wird, umzugehen und durch mehrfaches vorsichtiges Stoßen mit dem Stempel in diesem dem alten Butterfaß ähnlichen Instrument ein wohlschmeckendes und äußerst nahrhaftes Gemisch zu erzielen. Der Alten auf dem Fuße folgend, betraten zwei Männer in reifen Jahren die Wohnung. Den Oberkörper vorbeugend und zum Gruß die Zunge vorgestreckt, kamen sie mit einem kleinen Khádar in den Händen auf mich zu. Sie hatten die in Kʿam üblichen Schuhe mit hohen, weichen, roten Schäften an den Füßen, waren in schmierige, fransige Pelzmäntel gehüllt, und ihr Haar war lang, wirr und wie ihr ganzes Äußere ungepflegt. Ich sah vor mir zwei Vornehme von Dscherku ndo (Tafel XX unten), die sich freundlichst und angelegentlichst nach dem Verlauf meiner Reise erkundigten. Sie versprachen mir für die Dauer meines Aufenthalts Friede und Freundschaft. Kaum daß die beiden sich empfohlen hatten, bewillkommneten mich sechs Schen si-Chinesen, Kaufleute, die der Moschushandel hierher verschlagen hatte. Man begrüßte sich wie Landsleute, wie Europäer, die sich weit im Innern Chinas begegneten. Die Chinesen sprachen mit der höchsten Verachtung von dem wilden dummen Barbarenvolk, in das uns das Schicksal geführt habe, und waren begierig, etwas von der Welt draußen, von China, von Hsi ning bis hinab nach dem Kulturplatz Peking und Schang hai zu hören. Sie blieben etwa zwei Stunden, und man gelobte sich, im Bedarfsfalle einander beizustehen. Alle sechs Chinesen trugen für den Besuch das kleine schwarze Chinesenkäppchen mit dem roten Schnurknopf auf dem Scheitel, auch hatten sie ihre blauen langen Baumwollkleider aus den Kisten geholt. Und nicht mit leeren Händen waren sie gekommen. Ihrem Besuche sandten sie ihre roten Visitenkarten voraus, und jeder händigte mir nach der Begrüßung und Vorstellung ein Päckchen Yün nan-Zucker aus. Es waren zumeist intelligente und nicht engsichtige Leute, die schon vieles durchgemacht hatten. Unsere Unterhaltung war darum recht angeregt, so daß es, bis sie sich auf den Heimweg begaben, dunkel geworden war. Als ich dann auf die Dachterrasse vor meiner Wohnung hinaustrat, stieg da und dort, vom Mondlicht beleuchtet, eine Rauchsäule senkrecht gen Himmel, ein still glimmendes, wohlriechendes Rauchopfer für die Götter schwelte auf den Dachaltären; die wirren Gassen zu meinen Füßen aber, die den Berghang hinabstiegen, waren schon alle leer, und nirgends war mehr ein helles Licht zu sehen. Vom Kloster drüben auf dem Berg schmetterten Hörner schwermütige Töne durchs Tal. Aus den Nachbarhäusern vernahm ich lange die Abendandacht der Bauern, Männerbaß vermischt mit sonoren Frauenstimmen, forte bald, bald piano und leise verklingend. Eine tief religiöse und zugleich melancholische Stimmung wollte sich in jedes Herz schleichen. – Nach der Andacht legen sich Dscherku ndo's Bewohner bald zum Schlafen nieder. Sie erheben sich auch mit der Sonne und beginnen ihren Tag, indem sie harzige Wacholderzweigchen in ihrem Weihrauchöfchen entzünden.
Das Dorf oder die »Stadt« Dscherku ndo (tib. geschrieben: Gye rgu ndo) ist eine Hauptetappe auf der großen Karawanenstraße, die von Ta tsien lu in einem nach Norden ausholenden Bogen westwärts in den tibetischen Kirchenstaat Lhasa führt und bis wenige Tagereisen vor ihrem Ziel durch Gebiete geht, die mit der Lhasa-Regierung nichts zu tun haben wollen. Täglich sah ich auf dieser Straße große Yakhaufen verkehren, die von Osten her chinesischen Tee, Reis, Zucker, Seide, Baumwollstoffe, Anilinfarben und eine Menge kleiner Chinawaren, wie Porzellanschalen, Kochgeschirre u. dgl., herbeischleppten. Vom Westen kamen viele von ihnen leer zurück. Manche führten tibetischen Weihrauch, Heiligenbilder, Bücher, Wollstoffe, Drogen, auch rohe Wolle und Häute (Lammfelle und Pelze von wilden Tieren), auch englische und deutsche Emailwaren. Zweimal traf ich eine dreißigköpfige Herde, die europäische Eisenabfälle in Form von Eisenbändern nach Dergi transportierte. Die Karawanen waren nur von wenigen Mann begleitet, die zu Fuß gingen und oft kaum bewaffnet waren. Die Tiere gehörten den Ortsansässigen, die sie für bestimmte Strecken an die Händler vermieten und auf diese Weise während der trockenen Jahreszeit, besonders im Winter und Herbst, ein gutes Stück Geld verdienen. Zu meiner Zeit hatten die Händler für wenig mehr als 50 km eine Rupie pro Yaklast zu zahlen. Die Händler sind meist Agenten von alt eingeführten Handelshäusern in Ta tsien lu und Hor Gantse oder auch Abgesandte, sogenannte »tsung bon«, großer Klöster aus Dya sde und dBus (Lhasa) und teilweise sogar Regierungsvertreter. Bei der ungeheuren Entfernung, die der Se tschuan-Tee zurücklegen muß, übersteigen die Transportkosten bereits in Dscherku ndo den ursprünglichen Wert des Tees um ein Vielfaches. Zu dem Handel gehören darum ansehnliche Barmittel, und dazu bedarf es noch eines gewissen politischen Rückhalts, um die kostbaren Transporte vor Überfällen durch Banden und Übergriffen einzelner Gemeinden und kleiner Machthaber zu schützen. Darum ist es eine Ausnahme, daß Privatleute oder Nichtadlige in diesem Teil von Tibet Handel treiben.
Dscherku ndo spielt an dieser Straße die Rolle eines Emporiums für das zu Hsi ning gehörige Kʿam und das ganze oberste Yang tse-Tal
Das in Dscherku ndo und in Kʿam im Verkehr befindliche Zahlungsmittel ist die Rupie, »gomo« genannt (siehe Abb. 11).
Wenn nicht diese im Norden, am Kuku nor, ganz unbekannten Rupien gewesen wären – mit dem Norden wird fast nur Tauschhandel getrieben –, hätte ich Dscherku ndo in großem Bogen umgehen können, aber mein Aufenthalt daselbst war zum Geldwechseln sehr notwendig. Nirgends sonst wurde ich mein Silber los. In Hsi ning aber hatte ich nur ganz wenige Rupien, die mit der letzten Steuerkommission dorthin verschlagen worden waren, kaufen können. Auch in Dscherku ndo brauchte ich mehrere Tage, bis ich allmählich 1000 Gomo eingetauscht hatte.. Kauf und Verkauf spielt sich hier aber nicht wie in China in Läden ab, sondern die Kaufleute haben ihre Warenstapel in ihren Wohnräumen liegen, in denen die Kauflustigen sie aufsuchen. Der Ort zählt höchstens 330 Familien, Bauern, Händler und Handwerker und liegt an einem kahlen, warmen, nach Süden gerichteten Berghang, an dessen Fuß einzelne schottervermischte Lößansammlungen sich angehäuft und erhalten haben. Die Häuser stehen unregelmäßig zusammengedrängt zwischen engen, krummen, an Steinen und Schmutz reichen Gassen. Meist sind es mehrstöckige Gebäude aus rohen Steinplatten und Lehm, braungelb wie die winterliche Umgebung, in der ich sie antraf (Tafel XXIV). Mit lustiger, blauer, roter und weißer Bemalung leuchtet dagegen einige hundert Meter ostwärts vom Marktort, über kühne Felsen herab, das Kloster Dscherku, das vierhundert bis fünfhundert Mönche fassen soll. Wie eine deutsche mittelalterliche Burg schauen vom äußersten Felsvorsprung das Abtsgebäude und die Tempel und Heiligtümer ins Land hinein, während die gewöhnlichen Priesterwohnungen an dem Hauptberg dahinter als ein kleines sauberes Städtchen sich ausbreiten. In dem »Dschong« auf der Felsklippe hat der Beherrscher des Dscherku-Stammes (tibet.: sde schok), der Tsawu Be hu, seinen Sitz. Zurzeit ist dies ein inkarnierter Lama der Saskya-Sekte, der aber erst während der Mandschuzeit an die Stelle des einstigen weltlichen und erblichen Fürstenhauses getreten ist. Statt der Erbfolge in der alten Adelsfamilie ist jetzt ein fester Seelenbesitzstand vorhanden. Dieselbe Seele, die von Zeit zu Zeit nur sozusagen aus der alten in eine neue Haut fährt, ist andauernder Herr. Aber sonderbarerweise sucht sich diese Seele immer
wieder adlige Familien aus. Den Chinesen lieferte der Tsawu Be hu noch alle drei Jahre seine Abgaben ab. Im übrigen untersteht er wie seine Nachbarn dem Nan̂ tsien-König als Oberherrn. Außer ihm hat noch ein zweiter lebender Buddha sein Labrang auf dem Berg oben aufgeschlagen.
Als bedeutendster und wichtigster Platz für eine weite Umgebung ist Dscherku ndo zugleich Verwaltungszentrale der chinesischen, d. h. Hsi ninger Regierung im ganzen »Hung mao ör de ti fang« oder »Yü fu« (Peking-Dialekt: Yü schu). Zur Zeit meines Besuchs befand sich freilich nur ein einzelner Mann, obendrein ein Fan tse, aus Dunkur als Vertreter und politischer Agent der Chinesen in diesem Lande. Dieser »Lo tsʿa« wurde auf Kosten der Tibeter ernährt, hatte aber sonst nichts zu beanspruchen und nur die Aufgabe, nötigenfalls über wichtige Vorgänge im Lande Auskunft geben zu können. Nur jedes dritte Jahr traf man hier wirkliche chinesische Beamte, und zwar eine Kommission zur Eintreibung von Steuern, die aus der Mongolenzeit Acht Jahre nach der Erhebung des Enkels Guschri Khans, Lobzang Dandsin (siehe S. 296 , Anm.), erhoben sich drei Banner unweit von Rardscha gomba am Hoang ho. Unter General Ta ai von Hsining fu wurden sie besiegt. Dadurch kam ein größerer Teil von Kʿam unter die Hsi ninger Verwaltung, und von Ta ai wurde das Yü schu eingerichtet. Die tibetischen Steuern, die vordem den Mongolen bezahlt wurden, flossen von nun an in die Hände der Mandschuren. übernommen worden waren, und deren Höhe seit 1732 festgesetzt war. Die Kommission bestand aus einem Zivil- und einem Militärmandarin mit drei Dolmetschern und drei Schreibern, zu deren Schutz an die zwanzig chinesische Soldaten mit vier Flaggen und einige Mongolen aus Tsʿaidam mitgenommen wurden.
Die Chinesen teilen das »Yü schu« offiziell in zwölf Stämme, während die Tibeter bald von 25, bald von 30 und mehr Stämmen sprechen, die sowohl den Nan̂ tsien dyalbo (rgyalbo) als auch den Hsi ning-Amban als Oberherrn anerkannt haben und aus dem letzteren Grunde von ihren Nachbarn vielfach als »Dya de« (rDya de, geschr.: rgya sde), d. h. chinesische Provinz, unterschieden werden.
Die einzelnen Stämme sind heute sehr locker zusammengefügt. Wirklich zu beherrschen vermag der Nan̂ tsien-König nur seinen eigenen Stamm, der freilich mit 9000 Familien der weitaus kopfreichste von allen ist und in den tief eingeschnittenen Tälern des obersten Mekong (Tsa tschü) und seiner südlichen Nebenflüsse, des Ba tschü und Tsche tschü, zwischen herrlichen Wäldern und Alpenweiden auch fruchtbare Äcker innehat. Der Stamm des Königs ist selbst wieder in fünfunddreißig sDe schok (= Unterstämme) eingeteilt. Die königliche Residenz liegt am Ufer des Ba tschü, eines rechten Nebenflusses des Mekong. Das Königtum ist erblich und unterstand nur nominell der Bestätigung in Peking. Die Inhaber der Königswürde hatten sich nie zum Ko tou vor dem Kaiser nach der Reichshauptstadt begeben.
Die vom König abhängigen, wie die beinahe oder ganz unabhängigen Stämme (sde und sde schok) unterstehen entweder einem »Be hu« (= Herrn über Hundert), oder wenigstens einem »Be tschen«. Ihr Amt, soweit sie nicht Lama sind, ist gleichfalls erblich und geht an den ältesten Sohn oder, falls dieser als Inkarnation erkannt ist und als Heiliger in einem Kloster Verwendung findet, an den zweitältesten über.
Wie im sonstigen Tibet unterstehen den Stammesoberhäuptern (Be hu, Be tschen, Hum bo, dBon) die Gemeinde- oder Dorfältesten (tibet.: »rGam bo«). Die Be hu erheben von ihren Untertanen Abgaben in Gestalt von Schafen, Gerste, Tee, Butter und Salz. Dem »rGam bo« aber steht dieses Recht nicht zu. Er ist nur meist abgabefrei. Der weitaus größte Teil der Steuern geht aus den Händen des Be hu sogleich in die Hände der Lama weiter, die der Be hu zum Gebet- und Segenlesen für sich und den Stamm unterhält. Er hat damit die Entscheidung in der Hand, welche Sekte in seinem Gebiet bevorzugt wird. Die Be hu im Yü schu werden auch wie die Nomadenhäuptlinge im Norden als Richter angerufen und können in Zivil- wie in Kriminalprozessen entscheiden.
Ganz wie bei den ngGolokh ahnden die Yü schu-Be hu jeden Diebstahl innerhalb des eigenen Stammes mit drakonischer Strenge. Ein solcher Dieb muß mindestens den neunfachen Betrag des Gestohlenen dem Be hu geben, und sehr oft wird ihm noch auf Befehl seines Häuptlings ein Auge ausgestochen, oder wenigstens die Nase oder ein Ohr abgeschnitten. Im Wiederholungsfalle, oder wenn es sich um einen Raubmord handelt, wird auch das zweite Auge, die Kniescheibe, die Hand oder ein Teil der Hand mit dem Messer entfernt Von einem dieser Krüppel wurde mir erzählt, daß ihn der Verlust erst seiner Nase, dann nach seiner zweiten Festnahme der Verlust der Ohren und eines Auges, später der der beiden Kniescheiben noch immer nicht von seiner Raublust kurierte. Gerade während meines Aufenthaltes hatte er mit einigen Spießgesellen einen neuen Raubanfall auf eine Klosterkarawane unternommen. Er konnte nur noch kriechen und mußte von seinen Freunden mühevoll in den Sattel gehoben werden; aber einmal im Sattel, wußte er so geschickt mit der Lanze unter dem Arm aus dem Hinterhalt hervorzubrechen, daß seiner teuflischen Fratze keiner standhalten mochte.. Auch findet Stockzüchtigung und Einziehung des Vermögens statt. Sogar Enthauptungen werden unter Umständen befohlen, doch zieht der Häuptling aus Rücksicht auf die buddhistischen Lehren meist vor, den Verbrecher samt seiner Familie als Sklaven in einen anderen Stamm zu verkaufen. Während des Aufenthalts der chinesischen Steuerkommission in Dscherku wurden immer auch ein bis zwei Räuber durch die Soldaten geköpft, die die Be hu den Chinesen zur Aburteilung ausliefern mußten. Meist hatten sich diese gegen chinesische Händler vergangen.
Bei Diebereien außerhalb des eigenen Stammes nimmt jeder Be hu auch im Yü schu seine Leute so weit, wie es seine Macht zuläßt, in Schutz. Raub an Fremden und Nachbarn gilt als gerechtfertigte Bereicherung des eigenen Stammes und Geschlechts. Werden fremde Räuber abgefaßt, so werden sie nur bis auf die Haut ausgezogen, aber nicht absichtlich getötet oder verstümmelt. Wird bei einem Raubanfall ein Mann getötet, so zieht in der Regel der ganze Stamm mit dem Be hu an der Spitze ins Feld, um Blutrache zu nehmen oder Blutgeld zu erzwingen. Mancher Be hu in Dya de ist auch selbst ein passionierter Räuberhauptmann, der kein größeres Vergnügen kennt, als fremden Kaufleuten aufzulauern und Streifzüge in die Nachbarländer anzuführen. Wenn immer es bei solchen Überfällen Tote gibt, bedeutet dies einen Rachekrieg, der jahrelang die Stämme in Atem halten kann, bis endlich der eine der beiden am Siege verzweifelt und ein Vermittler Glück hat oder die Verluste auf beiden Seiten zufällig gleich geworden sind.
Zwei Tage nach meiner Ankunft in Dscherku ndo fand ein gutes Stündchen Reitens weiter unten im Tal eine große Messe statt, zu der aus allen Schluchten, von allen Stämmen das Volk zusammenlief. Meine Chinesen nannten den Platz »Mani tsch wan«. Ein kleines Dorf voll armer Teufel hat sich dort neben einem Riesenhaufen Steinplatten angebaut. Wir ritten dorthin in der breiten Talsohle, an der Klosterburg vorüber und an dem klaren gurgelnden Wasser des Dscherku tschü entlang, der in 10 m Breite die baumlose Gegend durchfließt. Von ferne schon sahen wir viele Männer, Frauen und Kinder um eine hellfarbene Steinmauer rennen, als ob sie besessen wären. Immer ging es rechts herum, ohne Aufhören, ohne Ende wie ein Paternosterwerk. Jedes hielt seinen Rosenkranz in den Händen, und jedes betete laut. Die Steinmauer ist 3½ m hoch und oben gekrönt von »zehntausend« Gebetflaggen. Jeder einzelne Stein dieser Mauer trägt mit erhabener Schrift eingemeißelt einen Spruch oder ein Buddhabild, meist natürlich die Worte: »om mani padme hung«, »o a hung« oder »om batschra sa ta hung« (Tafel XXIII unten). Die Mauer zieht sich ganz massiv und in einer Breite von 20 m dem Fluß entlang von Ost nach West, und um sie herum läuft ein breiter Weg für die vielen Betenden. Ich brauchte auf diesem Pilgerweg zehn Minuten, um einmal das Heiligtum zu umkreisen. An einigen Stellen der Mauer sind Nischen, in denen besonders schöne, bunt und sorgsam ausgeführte Heiligenbilder aus Stein zwischen flatternden Lappen aufgestellt worden sind, die Mehrzahl der Steine aber liegt horizontal, so daß man die Schrift nicht mehr lesen kann. Die Heiligkeit und Kraft dieses »Mani« liegt in der gehäuften Masse frommer Sprüche und Bilder. Jeder, der ein Silberstück übrig hat, jeder Kaufmann, jeder Vorüberreisende kauft einige neue Steinplatten von den Dörflern, die sie mit ihren primitiven Meißeln aus dem harten Kalkstein hauen, und fügt sie mit einem Ko tou zu den früheren. Der Platzgeist wird sich ihm sicher dankbar zeigen und ihn vor manchem Schaden bewahren; eine schützende Wirkung, die von diesen Fetischsteinen ausgeht, begleitet auch alle diejenigen, die betend und in der richtigen Richtung die Umkreisung ausgeführt haben.
Zu der Messe hatte sich eine große Zahl Bettler eingefunden. Die einen, die Blinden, machten durch Trompeten, die aus menschlichen Schienbeinen und anderen Röhrenknochen gefertigt waren, und durch Trommeln aus Menschenschädeln auf sich aufmerksam, die anderen saßen, ihren Aussatz oder Lupus, ihre greulichsten Hautdefekte entblößend, am Wege. Vielen fehlte die Nase; gegen Staub und Wind hatten sie sich darum ein Leder vor die Öffnung der Nasengänge gebunden. Dem hatte eine gestrenge Obrigkeit die Finger oder die ganze Hand abgeschnitten, und von dem oder jenem der erbarmungswürdigen Krüppel erfuhr ich, daß seine Heimat im Lhasa-Gebiet und daß er von dort wegen eines Vergehens verbannt sei.
Auf der Messe sah ich die große Tsawu-Inkarnation, die mit einem üppigen Stab von Klosterleuten gekommen war, sich von ihrem Volk anbeten zu lassen. Endlich bekam ich einen Menschen zu Gesicht, der sich doch manchmal wenigstens zu waschen schien; darum kam er mir wohl erstaunlich hellhäutig vor. Im Hauptraum eines der niedrigen Häuser des Dorfes wurde ich mit dem Lo tsʿa zusammen in Audienz empfangen; meine Diener mußten im Hofe eines anderen Hauses warten. Umgeben von seinen Gelong thronte er »unregsam« auf hohen Kissen in malerischer Pracht, beengt von Symbolen, brennendem Weihrauch und gefüllten Opferschalen. Er trug die gewöhnliche dunkelrote Mönchskleidung, nur war seine Kopfbedeckung von roter und nicht von gelber Farbe. Mich persönlich anzureden dünkte ihm wohl zu herablassend. Einer der Mönche mußte alle Worte, die mir zugedacht waren, wiederholen. Durch diesen wurde ich seiner großen Ergebenheit für den Amban und die Befehle von Peking versichert. Bezüglich meiner Weiterreise bekam ich leider nur ausweichende Antworten. Auf meine Bitte um Führer wollte er zuerst den König befragen, der – wie der Mönch sagte – auf das erste Gerücht von meinem Kommen Soldaten aufgeboten hatte, um mich nach Norden zurückzubringen. Mein Geschenk, eine Weckuhr, wurde mit einem halbgetrockneten, im Herbst geschlachteten Schaf und mit einem Beutel voll Tsamba erwidert.
Von diesem Ausflug zurückgekehrt, suchte ich sogleich meine Weiterreise anzutreten. Aber nirgends ließen sich Führer finden. Jeder, der ortskundig schien, erklärte, daß ihm sein Leben und seine Glieder zu lieb seien. Alle behaupteten nacheinander, daß derjenige, der einem Fremden helfe, geblendet würde. Als ich dem Tsawu Be hu in seinem Kloster oben einen Besuch machen wollte, fand ich schon auf dem Wege eine Menge junger Mönche, die mich mit Steinwürfen empfingen und fest entschlossen waren, mich nicht lebend in ihr Kloster zu lassen. Auch Da Tschang und Ma »Sechsunddreißig«, die abgesandt waren, um dem Be hu weitere Geschenke zu überbringen und um einen Führer zu bitten, wurde der Eintritt ins Kloster verwehrt. Die Feindseligkeit im Dorf wurde zwar nicht offenkundig, doch ließ mich vom vierten Tage ab kein Tibeter mehr in seine Wohnung eintreten. Die »Lao Schan« (die sechs Schen si-Leute) ließen mich bitten, sie nicht mehr zu besuchen, da sie sonst »wegen der Dummheit der Fan tse« boykottiert werden würden. Ja, die Schwierigkeiten wurden für mich so groß, daß nur noch Leute von auswärts es wagten, mir Fleisch und Gerste zu verkaufen. Nachts wurden mehrmals Steine nach meinem kleinen Fenster geworfen, und ein Thermometer, das ich dort aufgestellt hatte, wurde heruntergeschossen.
Als ich deshalb so rasch wie möglich – jetzt ohne Führer – weiterreisen wollte, stieß ich unversehens bei meinen eigenen Begleitern auf den entschiedensten Widerstand. Die Zahl der Tibeter in Mani tschwan und die Geschlossenheit des Boykotts hatten sie stutzig gemacht. Sie wollten nur tun, was der junge Tschang Tung sche und der Lo tsʿa für gut fanden. Tschang Tung sche aber wollte zum König vorausreiten und den Durchmarsch durch sein Gebiet erbitten. Diesen Plan, den bereits der Be hu in Tschendu angeregt hatte, hielt ich von Anfang an für schlecht, denn wenn mich auch der König durch sein Land lassen würde, der »Dewa schung« (sde ba gschung) von Lhasa ließe mich sicher nicht anders als verstohlen und auf Schleichwegen zu sich hinein. Ich mußte inkognito reisen und möglichst bald hinter Dscherku verschwinden.
Meine Chinesen aber verlangten nach einer tibetischen Eskorte für die Weiterreise. Sie versagten mir den Gehorsam, und meine Lage war nicht weit von einer Gefangennahme durch meine eigenen Leute. Ich befürchtete sogar eine offene Meuterei. »Wenn die Fan tse weiter so feindlich gesinnt sind, wäre ich dumm, wollte ich bei dir bleiben, und wenn du mir 100 Tael Silber Monatslohn gäbest«, meinte der Mohammedaner So aus Schang wu tschwan. »Mein Leben ist mir lieber als dein Geld«, fügte der Mohammedaner Hʿai hinzu, derselbe, der in Hsi ning fu beim Dingen, als ich ihm die Gefahren schilderte, ausrief: »Wir Leute von der kleinen Gesellschaft trotzen tausend Feinden. Hui hui haben keine Angst!«
Tschang Tung sche erhielt also schließlich seine Geschenke an den König und schlug, begleitet von dem Schara khoto-Mann Yin lu tse und zwei Reitern aus Dscherku, den Weg zum Nan̂ tsien dyalbo ein.
4. März. Heute, zwei Tage nach dem Abreiten des Tung sche, gab ich in noch dunkler Morgenfrühe den Befehl aus, die Tiere zu satteln, um einen Ausflug ins Westtal zu machen. Wir wollen, fügte ich hinzu, einen Grasplatz suchen, wo die Tiere leichter Futter finden können als an dem kahlen Hang um Dscherku. Mit arger List hoffte ich davonzukommen. Kein Grasplatz sollte mir passend erscheinen, immer weiter wollte ich drängen, und so hoffte ich bald in Gebiete zu kommen, wohin noch keine Kunde über mich gedrungen war. Einige Stunden ritten wir das Westtal hinauf, dann südlich einer Wegspur nach zu einem Paß. Auf der Straße trafen wir Reitertrupps, die uns entgegenkamen, oder die uns einholten. Jeder sprach mit uns, fragte freundlich »Wohin?« und »Wozu?«. Unbehelligt ging unser Marsch weiter und weiter. Meine Mannschaft kam rasch in frische gute Stimmung. Es wurde um die Mittagszeit so warm, daß das Reiten Spaß machte, und daß meine Chinesen ihre Lieder voll Lust und Liebe hinausschmetterten, da – da wälzt sich plötzlich ein Reiterschwarm um eine Felsecke, und sechzig Mann – eine volle Schwadron – ergießen sich über mich. Meine Pistole will ich herausreißen, da steht einer vor mir und streckt mir seine Lanze ins Gesicht, als wollte er mir in den Nasenlöchern stochern oder die Zähne putzen, ein barscher Kerl auf breitbrüstigem Schimmel mit großen schwarzen Tupfen, ein langhaariges Leopardenfell um den Hals, das ihn noch tierischer färbte, und grob und rauh brummt er mich an: »Was hast du Russe hier verloren? Diesen Weg bist du vorher nicht gekommen und darfst du nicht begehen. Es ist heiliges ›Bod yül‹ (Tibeterland). Dreh um! Mach', daß du nach Dscherku zurückkommst.«
Der Reiterhaufen drängte mich von den Lasttieren ab. Ich saß allein auf meinem Gaul inmitten der speerstarrenden Horde, die juchzte und brüllte und sich gleich so nahe an mich herandrängte, daß ich links und rechts nicht bloß die warmen Pferdeleiber, sondern die nackten Knie fühlte. Breite gelbe Zahnschaufeln bleckten so höhnisch grinsend in mein Gesicht, daß ich vor Wut am liebsten um mich gehauen und geschossen hätte. Bis ich meine Leute wiedersah, hatten diese längst kehrtgemacht und trieben in der Ferne unserem Ausgangspunkt zu. Bei ihnen waren nur wenige Dutzend Reiter für notwendig gefunden worden, und diese waren schon zu viel. Willig waren ihnen die Chinesen gefolgt.
Es war ein Aufgebot des Tsawu-Stammes, das ein eiliger Bote der Lama zusammengerufen hatte, um mich zu stellen und zurückzubringen. Jedes der zerstreuten Zelte, die in den oberen Teilen der Täler lagen, hatte ein bis zwei Berittene abgesandt. Der Be hu-Lama hatte seine Leute ausgezeichnet in seiner Gewalt.
Schon der Abend sah mich wieder in meinem engen Lehmstübchen, das 2 auf 3 m Bodenfläche hatte, dessen Decke so niedrig war, daß ich darin nicht aufrecht stehen konnte, dessen Boden aus lehmbestrichenem Reisigflechtwerk bei jedem Tritt sich bog und durchzubrechen drohte. Wie ein Gefangener betrachtete ich durch die eine winzige Luke in der dicken Steinmauer meines Hausturms die wirren Gassen von Dscherku ndo unter mir. Ich beneidete die Männer und die Frauen auf den flachen, staubigen Dächern, die da ohne Unterlaß ihre Gebetmühlen in der Hand schwangen, aber frei waren, in Tibet herumzureisen, wo sie nur wollten. Hämische Augenpaare fühlte ich von allen Seiten auf mich und mein kleines, mit dünnen dreckigen Papierfetzen beklebtes Fensterchen gerichtet, wo einer saß, der neue Pläne schmiedete. Mitternacht war längst vorüber, als meine Kerze verlosch.
Nach dem mißglückten Versuch versprach mir der Dorfälteste, mir wieder Lebensmittel zu verkaufen, und langsam gestaltete sich das Verhältnis zu den Einheimischen besser. Der Be hu ließ sagen, ich solle bis zur Rückkehr des Tung sche im Dorf bleiben. Ich hätte doch nun selbst gesehen, wie wild die Zeltbewohner seien.
Täglich kam jetzt Besuch in meine Wohnung. Jeder Tibeter, den sein Weg in den Ort führte, um einige Bedürfnisse, und seien es nur einige Neuigkeiten und Klatschereien zu erhandeln – und gerade Leute der letzteren Art gab es nicht wenige –, mußte mich gesehen und mit mir zusammen Tee getrunken haben. Alte Bekannte suchten, wenn sie ankamen, zum Zeichen der Freundschaft ihre Stirn an der meinigen zu reiben! Meine Gewehre waren ihnen aber noch viel wichtiger als meine Person, und manch einer saß tagelang in der Küche und bat und bat, ich möchte ihm meine Waffen zeigen.
Die Männer luden mich auch oft ein, mit ihnen nach der Scheibe zu schießen. Man wollte wissen, wie ich mich dabei anstelle. Die Tibeter waren immer scharfe Beobachter. Auch kleine Pferderennen wurden veranstaltet, bei denen, wie in ganz Westchina, derjenige Sieger blieb, der das schnellste Paßpferd sein eigen nannte. Da die kleinen eingeborenen Pferde zwar unermüdlich im Bergsteigen sind und prächtige Hufe haben, aber selten einen ruhigen Paß gehen lernen, so reiten die Vornehmen des Landes die weit kostspieligeren Pferde von Hsi ning und Turkistan. Wie die Pferdezucht, steht auch die heimische Maultierzucht nicht auf der Höhe des ortsüblichen Geschmacks. Alle eingeborenen Maultiere sind von kleiner Gestalt und sehen schwächlich aus. Darum werden die guten Maultiere, die einen Huo fo zu tragen für würdig befunden werden, aus Schen si und Hsi ngan fu eingeführt. Yakrinder halten die Bewohner, soweit sie in Zelten wohnen, in ziemlich großer Zahl. Aber auch diese sind klein und schmächtiger als die Yak vom Kuku nor. Man bringt dies damit in Zusammenhang, daß hier nie alte, sondern bloß unausgewachsene Bullen gehalten werden. Die Yak sind so zahlreich und billig, daß sie einen wichtigen Exportartikel nach Dankar bilden. Wie überall in tibetischen Ländern, stehen die Yakbastarde (ntso) auch in Dscherku hoch im Preis und kosten das Zweieinhalb- bis Dreieinhalbfache eines gewöhnlichen Yakrindes. Sie sind ziemlich rar, weil auch nur selten einmal ein farbiges Zuchttier zu sehen ist. Es wurde mir versichert, das farbige Rind könne das harte Klima schlecht ertragen. Schafzucht ist, verglichen mit der der Mongolen und Tibeter vom Kuku nor, um Dscherku ndo gering. Bei der großen Entfernung und der ngGolokh-Gefahr scheint der Wollhandel mit China nicht ergiebig genug zu sein. Auch hier traf ich nie das Fettschwanzschaf, das der Ts'aidam-Mongole züchtet. Ebenso fehlen die mongolischen Ziegen. Von sonstigen Haustieren sieht man noch winzige graue Esel und Hunde. In den Gassen lief eine große Schar herrenloser Köter umher, die für die allgemeine Reinigung sorgten. In den Höfen wurden Kettenhunde gehalten, langhaarige, bis 50 cm hohe, in der Mitte zwischen Collie und deutschem Schäferhund stehende Tiere. Sie nehmen sich in ihrer gelben und schwarzen Zeichnung, mit den breiten Pfoten und kleinen Wolfsohren, mit der schwarzen Schnauze und dem schwarzen Gaumen eigenartig und schön aus. Eine besonders geschätzte Rasse, die ich am Kuku nor nie sah, ist der »Schadschüch'« (scha tschyi), der Jagdhund, ein schlank gebautes, spitzschnauziges, stichelhaariges Tierchen, halb Windhund, halb Vorstehhund, der zur Fuchsjagd gehalten wird und um Dscherku je nach seiner Güte Preise erzielt, wie sie für ein gutes Reitpferd gezahlt werden. In den Händen von älteren Lama sah ich auch die sogenannten chinesischen Ärmelhündchen (sleevedog), Zwergmöpschen kleinster Form, mit denen die Gläubigen ihre Hutukhtu-Lamen beschenken. Die meisten kommen aus China. Einer der tibetischen Kaufleute hatte auf dem ganzen Weg von Dankar bis Dschendu ein solches Hündchen im Ärmel und wärmte sich seine Hände daran. Da meine selbstgemachten Handschuhe nicht viel taugten, hatte auch ich einen Tag lang den Hund zum Handwärmen in meinem Ärmel. Als aber der Tibeter sah, in welche Gefahr sein Hund bei meinen Notizen und Peilungen kam, nahm er ihn mir schnell wieder ab. Der Geschmack ist bei dieser Zwergrasse vor allem darauf gerichtet, besonders kurze Schnauzen und breite Köpfe zu ziehen. Die Lama lehnen sich darin ganz an die Chinesen an und halten mopsähnliche Hunde für die hübschesten. Es ist wohl nicht Zufall, daß die Mongolen mit ihrem breiten Gesicht das breite Mopsantlitz züchten.
Noch ist ein Haustier zu erwähnen, der Hahn. Mein Hausvater in Dscherku hielt sich sechs Hähne, auf die er sorgsam achtete. Für die Hennen aber hatte er nicht das geringste Interesse. Ihre Eier ißt er nicht und wirft er weg, und Hühnerfleisch kommt höchstens in den Mund des Bettlers. Die Hähne werden – wie ich schon in Barun kurä sah – einzig und allein zum Krähen am frühen Morgen gehalten. In Dscherku ndo mußte selbst die eingefleischteste Schlafmütze an dem mörderischen Hahnenschrei der zahllosen Kikeriki erwachen. Der ehrsame tibetische Hausvater spart seine Butter und sein Schmalz, das zur Beleuchtung nötig ist Die Lampen bestehen aus runden irdenen Schälchen von 5–6 cm Durchmesser ohne Henkel und Schmuck, wie ich aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. Hunderte in den Ruinen von Phaistos und Knossos auf Kreta liegen sah. Als Docht dient heute in Tibet meist ein Stück Baumwollzwirn., und geht früh zu Bett; in der langen Nacht ist er darum froh, am ersten und zweiten Hahnenschrei die Nähe des Morgens zu erkennen. Vielleicht aber steckt hinter dieser Liebe und Pflege des Hahns auch noch der uralte Kult, denn die Bönbo-Priester gebrauchen die Hähne noch heute zu Opfern und verspritzen das Blut vor ihren geheimnisvollen Göttern, was all den neuen buddhistischen Sekten ein Greuel ist Die Tibeter erzählen sich, daß die Hähne in der Nacht schreien, weil sie wissen, wann die Sonne auf dem Gipfel des heiligen »Rerab lhunbo« aufleuchtet. Die Hähne spüren die Sonne vom Rerab in ihrem roten Kamm. Der Rerab oder Rerab lhunbo ist der höchste Berg und der Nabel der Welt, um den die Sonne, der Mond und alle Sterne kreisen. Er wird identifiziert mit dem Berg Meru oder Sumeru, dem Göttersitz der indischen Mythologie..
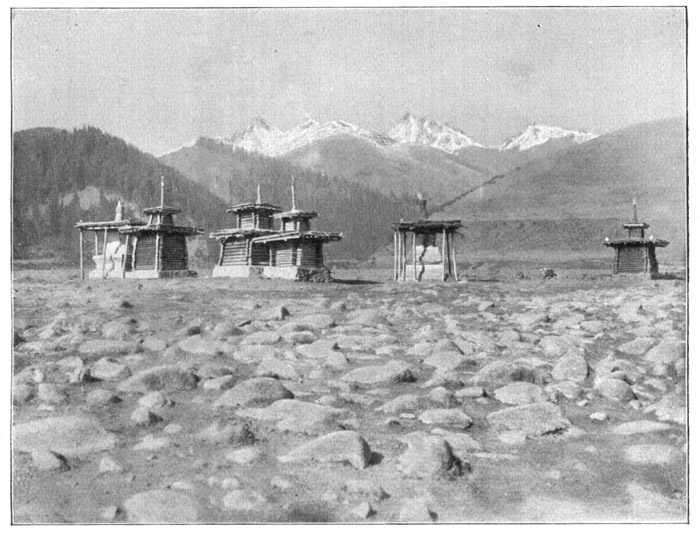
Tafel XXV
Tschorten im Lande Ling gose.

Tafel XXV
Dscherku ndo-er Mädchen vor meiner Behausung.

Tafel XXVI
Tanz der Mädchen in Dscherku ndo.
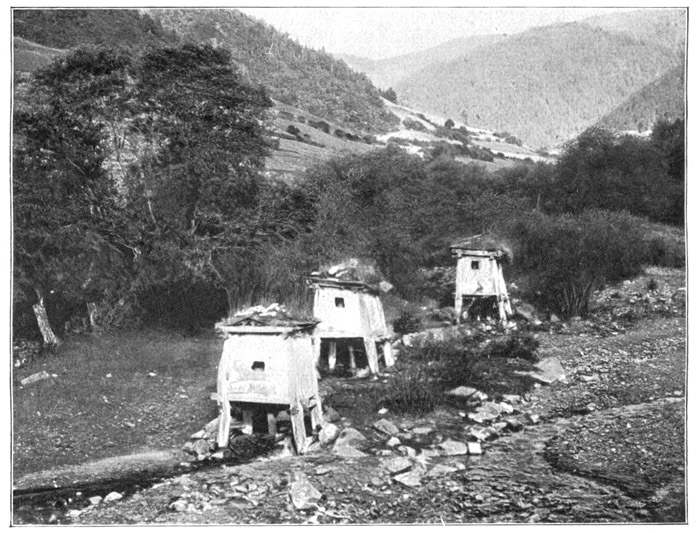
Tafel XXVI
Wassermühlen, die Tag und Nacht Gebetrollen drehen.
Die Verpflegung meiner Karawane blieb in Dscherku sehr teuer und schlecht. Die Tiere hatten es mager, und wir Menschen lebten wie die Einheimischen vornehmlich von animalischer Kost. Für die Mohammedaner erhielt ich von Zeit zu Zeit einen während der Wintermonate abgemagerten, lebenden Hammel, wir anderen aßen das Fleisch von Yak oder Schafen, die die Tibeter im Anfang des Winters – wenn die Tiere fett sind – geschlachtet, bzw. erstickt hatten. Als Brennmaterial kommt wegen der Baumlosigkeit der Umgebung nur Dung in Frage. Alle paar Tage trieben Nomadenweiber einige Dutzend Yak in die Dorfgassen und brachten in großen Säcken getrockneten Yakmist. Etwa 1 Zentner kostete ½ Rupie. Das eigenartige Handelsobjekt stammte von Plätzen, die bis zu 50 km entfernt lagen. Die Zubereitung der Speisen war in Dscherku rasch aus den Händen meines Kochs in zartere, wenn auch nicht sauberere Hände übergegangen (Tafel XXV unten). Schon am ersten Abend, als wir nach Dscherku kamen, drang vom Hofe und von den Räumen, wo meine Diener wohnten, Gekicher bis hinten in meine Klause. Ging ich nach vorn und sah nach, was es denn gebe, so sah ich immer nur einen großen Pelzhaufen auf dem Boden liegen. Am zweiten Abend schlich ich ganz sachte aus meinem Zimmer nach vorn und sah jetzt ein volles Dutzend Dscherku ndoer Schönen bei meinen Dienern am Boden hocken; auf der einen Seite meine Chinesen, zu oberst Tschang Tung sche, Da Tschang und ein paar Tibeter, auf der anderen Seite die Mädels. Es wurden halblaut Lieder gesungen. Einer fing zu trällern an. Eines der Mädchen erwiderte. Man neckte sich mit »Zangskern«, mit Nomadenlyrik:
»Eine Nuß, die ich mit den Zähnen nicht zerbeißen kann,
hat für mich keinen Geschmack.
Eine Liebe, die nur kurz wie ein
Schafböllchen erglühen kann,
hat für mich keinen Geschmack.
Die Feuersglut eines großen trockenen
Büffelfladen
muß die Liebe meines Schätzchens haben.«
Beim Schein eines Butterlämpchens ging es so stundenlang hin und her. Und sowie man einen Laut aus der Richtung meines Zimmers hörte, tauchten die Mädchen mit dem Kopf in den weiten Pelzröcken unter, und einer der eifersüchtigen Tibeter warf noch alte Schaffelle darüber.
Wie Plumpsäcke nahmen sich die Mädchen in den bis an die Waden reichenden Pelzröcken aus, die nach außen ein von Dreck und Fett starrendes Leder zeigten. Die Kopfhaare trugen sie in der Mitte gescheitelt und auf jeder Seite in sechs Zöpfchen gedreht, die hinten mit einem dreizehnten, das vom Scheitel ausging, zusammengebunden waren. Das breite Möpschengesicht paßte mit der Frisur recht gut zusammen, und manches Köpfchen wäre vielleicht gar nicht so übel gewesen, wäre es nur ein bißchen gewaschen worden, und hätten seine Haare nicht allzu viele Bewohner beherbergt; als Parfüm sollte auch nicht bloß ranzige Butter verwendet werden. Aber die Tibeterin soll sich ja nicht waschen; sie wäscht sonst bloß alles Glück herunter.
Die fremden Kaufleute, Klosteragenten wie Chinesen, veranstalten in Dscherku ndo gerne Tanzfeste, wo halbe Nächte lang ein Häufchen junger Mädchen von noch lange nicht zwanzig Jahren sich in zwei Reihen gegenübersteht (Tafel XXVI oben). Während »die Herren« das bierähnliche Gerstengetränk »Tschang« und reichlich Schnaps trinken und auch die Mädchen tüchtig zusprechen lassen, schreiten die jungen Dinger, so leidlich sauber gewaschen und in neue, grüne und rote Kleider gesteckt, bei schrillem Pfeifenton gemessen vor- und rückwärts und singen Stunde um Stunde zweistimmig die alten eigentümlichen Lieder, deren Sinn sie oft selbst nicht mehr richtig verstehen. Zwei oder mehr Sätze dieser Lieder sind immer so vollkommen übereinstimmend gebildet, daß nur die Hauptwörter sich ändern, und daß eine Art »Satzreim« herauskommt. Oft wird auch in mehreren Strophen hintereinander dasselbe Wort angewandt. Beim Tanzen geht es zwei Schritte vor und gleich wieder zurück, ein grünes Tuch wird gereicht und alsbald wieder losgelassen, und selten dreht man sich nach einer Seite, darum ist es im Grunde ein recht einförmiges Treten und Stampfen, um nicht den Rhythmus zu verlieren. Aber keiner kann sich satt sehen, und erst spät in der Nacht nimmt unter dem Einfluß des reichlich genossenen Alkohols die Schnelligkeit etwas zu und jubeln und klatschen alle Zuschauer mit.
Im Dorfe Dscherku leben jedenfalls viel mehr Frauen als Männer. Darum bekommen die Hsi ninger Soldaten leicht ein Mädchen, das sie am Ende ihres Dienstjahres in die Heimat mitnehmen, wie es auch einst mein Da Tschang gehalten hatte. So waren in der Stadt Hsi ning fu vor meinem letzten Aufbruch über zwanzig solcher K'am-Töchter beisammen. Alle aber fühlten sich unglücklich und litten unter Heimweh. Die Lebensweise in der ummauerten Stadt behagt nie den an Freiheit und an ein Leben mit Pferden und Rindern Gewöhnten. Viele von ihnen waren zum Tschendu-Be hu geflüchtet, als er den Amban aufsuchte, und baten unter Tränen, er möchte sie wieder nach Hause mitnehmen. Auch wenn sie den Chinesen einen Sohn gebären, werden sie doch nur ausnahmsweise für voll genommen. Kommt einer ihrer Männer in bessere Verhältnisse, so heiratet er sicherlich sofort eine Chinesin, die dann immer als Hauptfrau angesehen wird und die Fan tse-Frau wie das Aschenbrödel behandelt.
Einer der Vornehmen von Dscherku wußte mir zu erzählen, daß durch die vielen Mädels und die Chinesen heute nur noch acht Familien in Dscherku säßen, in denen nicht nachweislich Chinesenblut fließe. Die Verbindung mit Chinesen scheint nicht weiter übel aufgefaßt zu werden. Die Abkömmlinge solcher Mischehen nennt man »ramaluk« (Ziegenschafe).
In Dscherku sieht man die Frauen und Mädchen immer tätig. Wenn sie nicht im Felde, im Haushalt, bei ihren Kindern und mit Kochen und Wassertragen beschäftigt sind, trifft man sie in der Sonne sitzend und auf ihren kleinen Spindeln Schafwolle spinnend. Das gewonnene Garn wird von ihnen in den offenen Höfen auf riesigen Webstühlen und mit einem Schiffchen von 35 cm Länge in nicht ganz einen Fuß breite Wollstoffe verwoben, die sie später verkaufen, und aus denen die Sommerkleider und Decken genäht werden. Die Frauen rösten auch die Gerste und mahlen die gerösteten Körner auf Handmühlen zu Tsamba. Sie säen und ernten, und höchstens die Führung des schweren klotzigen Pflugs nimmt ihnen der Mann ab. Sie selbst aber müssen dabei die vorgespannten Yak antreiben, wenn es ihnen nicht gar obliegt, den Pflug selber zu ziehen. Auch bei den ansässigen Dscherku's ist es Sache der Frau, das Brennmaterial zu sammeln und den gesammelten Dung in Kuchen zu backen und in der Sonne zu dörren. Und vom Herbst an bis ins Frühjahr hinein steigen sie überdies in Scharen auf die Berge und graben nach den erbsengroßen Knöllchen der Potentilla, die, wie überall in Tibet, so auch in K'am in geröstetem Zustand eine sehr beliebte Zukost bilden.
Auffallenderweise aber können hier die wenigsten Frauen nähen. Alle besseren Kleider, die Stickereien an den Schuhstrümpfen, an den Ärmelaufschlägen und am Kragen stellt immer ein Schneider her. Auch alle Lederarbeiten und die Verzierungen auf Ledergürteln und Ledertaschen macht nicht die Frau, sondern ein Mann. Zu den übrigen Handwerken, die gleichfalls nur von Männern betrieben werden, gehört das Anfertigen von Schuhen, mit der Einschränkung, daß seine Alltagsstiefel jeder selbst macht. Auch Sattler, Schreiner und Zimmerleute konnte ich in Dscherku beobachten. Die letzteren wie die Schmiede waren aber nicht Tibeter, sondern Setschuanesen, die sich nur vorübergehend im Ort aufhielten. Schmiedekunst Ein Schmied in Dscherku konnte Gewehrläufe herstellen. Dieser verstand sich auch auf die Damaszierung von Messer- und Schwertklingen. Er verwendete dazu ein Stück Cantonstahl und Schan si-Eisen, die er tagelang wieder und wieder zusammenhämmerte, und erzielte so eine schöne – freilich echten Damaszenerklingen gegenüber immer noch grobe Damastzeichnung, ehe er an die Herstellung der Klinge ging. In Dankar hatte ich zuvor zwei solche Schmiedekünstler angetroffen; alle waren sie Dunganen. und alle Lederarbeit gilt als schlechtes Gewerbe, als ob – wie beim Barbier in China – ein Fluch darauf läge.
Ein Tagesausflug, von Dscherku das Tal zum Yang tse kiang hinab und einige Stunden in einer linken Seitenschlucht aufwärts, brachte mich zu einem weit bekannten Lama im Deda-Land, der sich von der Welt zurückgezogen und in einer Höhle hatte einmauern lassen. Lange Schnüre mit Wollflöckchen daran, Tausende von bedruckten Wimpeln, im Winde tanzende Schafkiefer, klappernde Pferdekinnbacken, Steine und Felsen, alles über und über mit Sprüchen bedruckt und beschrieben, wiesen uns einen steilen Pfad hinauf zu einer Grotte und zu einer Mauer, hinter der der sonderbare Heilige wohnte. Einige Weiber waren schon vor uns angekommen und belagerten im dunklen Hintergrund der Grotte eine verschlossene Luke. Sie hatten Butter und Tsamba mitgebracht, die sie ihrem Einsiedler zugedacht hatten. Spinnend saßen sie an der Erde und wiederholten ihre Gebetsformel halblaut singend vor sich hin. Eine hatte ihr Ohr an den Laden der Luke gedrückt und horchte mit gottesfürchtigem Blick auf einen hohl und gespenstig tönenden Gesang, der aus dem Innern, von Zeit zu Zeit etwas anschwellend, zu uns herausdrang. »Seit zwei Tagen«, erzählten die Weiber, »hat der Lama den Laden nicht mehr geöffnet. Heute wird er wohl aufmachen.« Klopfen nützte aber auch heute nichts, und wir mußten uns mit den Weibern zusammen lange Stunden gedulden. Schon besprach ich etwas ärgerlich die Umkehr, als doch endlich der Bohlenladen aufklappte und, die ganze winzige Öffnung ausfüllend, ein fahler Kopf erschien. Verfilzte lange, weißliche Haare umrahmten ein verhutzeltes Aszetengesicht, in dem mit schwarzem Schmutz tiefe Rillen und Furchen auf Stirn und Wangen dick verklebt waren. Tiefliegende hohle Augen schienen einen Augenblick gierig nach dem Licht und dem Leben zu lechzen, dann verschwand das grausige Bild des Halbtodes und machte einer noch dürreren Knochenhand Platz, die zitternd nach den dargebrachten Gaben griff. Muffige Kellerluft und schlechte Ausdünstungen drangen aus dem Innern, in dem ein Butterlampendocht schwelte.
Des einen Weibes Kind war erkrankt. »Wird mein Sohn wieder gesund werden?« fragte sie. Langsam brachte der Greis neun grüne Würfel auf den Fenstersims und übergab die Frage dem Schicksal der Würfel.
»Du mußt die Dschoma (sGrolma) im Kloster Tschuschi bitten«, war die Antwort.
»Werde ich mein Pferd gut verkaufen, wenn ich es morgen verkaufe?« fragte die zweite. »Nützt es mir, wenn ich eine Wallfahrt nach Taschi gomba mache?« meinte eine dritte.
Meinen Begleitern, die seinen Segen verlangten, versprach der Einsiedler eine gute Heimkehr und Reichtum, wenn sie sich mit den Göttern gut stellten. Dann klappte der Laden, so plötzlich wie er aufgegangen war, wieder zu, und gleich ging das Rezitieren weiter. In jungen Jahren hatte dieser Scholastiker in Luft und Licht seine theologische Philosophie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Jetzt war er von allem Weltlichen abgeschlossen, jetzt wiederholte er, was er draußen gelernt, und drang bis auf den Grund der Dinge ein, keiner konnte ihn mehr in seiner Betrachtung stören; er mußte bei der nächsten Geburt in einer besseren Welt wiedergeboren werden.
Ein anderer Klausner oder »Tschamba« Lama wohnte im Westen von Dscherku ndo. Der hatte sich nicht vermauern lassen, war aber wegen seines großen Wissens nicht weniger angesehen. Er war »Gechi« Gechi ist einer der höchsten Grade in der buddhistisch-lamaistischen Hierarchie., ja er hatte nach langem Studieren noch andere höhere Doktorgrade der lamaistischen Philosophie und Theologie in den Klöstern von Lhasa erhalten. Er war darum der Stolz der Familie geworden, und seine Verwandten hatten ihm etwas abseits von der Straße ein Häuschen errichtet. Jedermann, der dort vorbeikam, stieg vom Pferd und machte seinen Ko tou davor, und die große Straße machte seinetwegen einen weiten Bogen. Er empfing selten Gäste und nie eine Frau. Nie verließ er sein Heim, und nur mittags trat er vor die Tür. Wenn aber der säuberlich gekleidete, schlanke Mann mit den klugen, mild blickenden Augen in der Tür zu sehen war, flatterten von allen Seiten die Vögel auf ihn zu, setzten sich auf seine Hände und Schultern und pickten die Körner aus seiner Hand. Er war der liebe Freund aller Menschen und Tiere.
In meinem Hause in Dscherku ndo lag auf der anderen Seite meiner Dachterrasse ein Stübchen, das zugleich als Küche diente, und das eine einsame Frau oder ein Fräulein bewohnte. Sie brachte, während ich ihr Wohnnachbar war, ihre Tage mit Spinnen und Weben im Freien zu, saß immer fleißig an einer windgeschützten Mauer in der wärmenden Sonne oder grub auf den Bergen nach Dschuma (Potentilla). Immer war sie geschäftig, und ihr Zimmerchen sah ganz altjüngferlich aus, so aufgeräumt, so sauber und geleckt war es, daß ich mich jedesmal in die Heimat zurückversetzt wähnte, wenn ich einmal hineingucken durfte. Über dem tischförmigen Herde hingen blitzblank funkelnde Messinglöffel, -schapfen und Kasserollen, schön nach der Größe ausgerichtet. Auf einer Truhenkiste an der Rückwand lagen in Seide gewickelte und sichtlich liebevoll gepflegte Gebetblätter. In Nischen der Lehmmauer standen die Holzschalen und die bunt bemalten Holzteller für Ehrengäste. Dort hingen auch getrocknete Hammelskeulen, und dort war ihr Vorrat an Gerste aufbewahrt. Der Bettplatz war ein winziges Fell einer Antilope, neben dem bei Tag einige Pelzmäntel zum Zudecken aufgerollt lagen; Spindeln, Weberschiffchen, Garn, rohe Wolle und schon verarbeiteter Stoff füllten eine ganze Ecke. Das Licht aber fiel durch ein viereckiges Loch in der Decke. An Fenstern gab's nur eine handbreite Schießscharte.
Mein Aufenthalt in Dscherku fiel in die ersten Monate nach dem tibetischen Neujahr, darum sah ich in dieser Wohnung noch die Zeichnungen, die um die tibetische Jahreswende über den Herd an die Wand gemalt werden. Von der geschwärzten Lehmmauer hob sich weiß, mit weißem Weizenmehlkleister aufgetragen, ein Ornament in der Art unseres Mäanders ab, neben dem man aus demselben Material Ringfiguren und eine Zeichnung, den Umrissen einer großen Vase nicht unähnlich, erkennen konnte. In manchen Wohnungen, wie z. B. bei meinem Hauswirt, war außerdem noch das Hakenkreuz mit Weizenmehl auf die Wand gemalt, und die Figur des laufenden Hundes wurde mir erklärt als aus einer Reihe von Hakenkreuzen entstanden. Über die Bedeutung dieser alten Sitte und der Ornamente aber, die noch aus vorbuddhistischer Zeit zu stammen scheinen, auch über die Vorstellungen, die die Tibeter sich dabei machen, konnte ich leider nichts Neues in Erfahrung bringen. So weit drang ich nicht ins Vertrauen der Leute. Die meisten machen wohl auch die Zeichen, ohne viel zu denken, an ihre Hauswände, nur weil »man« sie eben macht.
Die Tage in Dscherku, die ich eng zwischen den eigenartigen Menschen verlebte, verflogen mir rasch. Jeder Besucher und Bettler (Tafel XXI unten), jeglicher kläglich um eine Handvoll Tsamba stammelnde Lamajunge trug mir Interessantes zu (Tafel XXII unten) Hunderte und aber Hunderte junger Pilger und Mönchsnovizen ziehen jährlich zu zweien und dreien von der Mongolei und von Amdo über Labrang gomba und Rardscha gomba und durch das Land der ngGolokhs zu Fuß nach Lhasa. Ein Paar Lederstiefel, die sie unterwegs meist schonen und ausziehen, eine Filzkapotte als alleiniger Schutz gegen Kälte und Schnee über dem dünnen Mönchsgewand, Stahl, Feuerstein, ein irdener Kochtopf und eine hölzerne Eßschale,ein Säckchen für Tsamba sind ihre Begleiter, und so geht es, von Zelt zu Zelt bettelnd, zu den Klöstern von Lhasa, wo sie etwa nach einem halben Jahr nach Verlassen der Grenze von Kan su eintreffen; so lange währt der Kampf mit dem Hunger und dem Frieren, und so ist man schon in den Tagen von Tsong ka ba zu seinen heiligen Schulen nach Zentraltibet gezogen. Wer es wagt, mehr mitzunehmen, erweckt bei den Nomaden am Wege nicht Mitleid, reizt im Gegenteil die Habsucht der Begegnenden und wird ausgeplündert. Nicht bloß einer dieser lernbegierigen Bettelmönche erzählte, daß Räuber seine Kleiderstücke nach eingenähten Rupien durchsucht hätten.. Der fahrende Gaukler, der blind oder knielahm, mit abgeschnittenen Ohren oder durchtrennter Achillessehne bis in mein Wohnloch heraufgekrochen kam, sang mir seine schönsten tibetischen Traumbilder vor. Meist wußten sie mir kürzer oder länger, bald in Reimen, bald nur in Prosa, vom Helden Gesar, ihrem Safrankönig, und vom Lande gLing zu berichten.
Stark gekürzt und vom verwirrendsten Beiwerk entblättert hörte ich hier das Gesarmärchen auf folgende Weise:
Die Gesarsage (Aufzeichnung von Dscherku ndo).
Auf der Erde, im Lande gLing, war man nach vielen glücklichen Jahren, in denen man die Ameisen, die Mäuse, die Lerchen, die Bären und die Mücken zu Steuern herangezogen hatte, sehr unglücklich geworden. Man hatte seinen alten König verloren und mußte selbst Tribut entrichten. Endlich erbarmten sich aber die Himmlischen wieder der Leute von gLing und sandten ihnen »Gesar« dyalbo als König und Erlöser. Gesar lebte zuvor als Göttersohn im Himmel und war der jüngste von drei Brüdern und noch ein Säugling. Die Knöchelwürfel hatten entschieden, wer von den dreien der Gesar werden müsse.
In Gestalt eines schneeweißen Vogels flog der Göttersohn auf die Erde hinab und setzte sich auf das Zelt seiner irdischen Mutter, verwandelte sich dort in eine Mücke, flog ihr in den Mund und kroch ihr in dieser Gestalt bis in den Magen und in die Leber. Als der junge Gesar dann von seiner irdischen Mutter geboren war, konnte er sogleich sprechen und hatte, noch nicht ein Jahr alt, die wildesten Wundertiere und Riesen, die ihm und seinen Untertanen nach dem Leben trachteten, unschädlich gemacht. Seine himmlische Mutter hatte ihm ein schwarzbraunes Wunderpferd zu Hilfe gesandt und Wunderpfeile, einen Bogen und ein Schwert von dreißig Klaftern übergeben, die sich alle beim Nichtgebrauch als kleine Strohhälmchen hinters Ohr stecken ließen.
Bald darauf ging er zum ersten Male auf die Brautschau. Er kam zu einem König, dessen Tochter er zum Weibe begehrte. Der König verlangte aber, daß der Freier zuvor mit einem feindlichen Riesen kämpfe. Gesar warf diesen Gegner nach dem ersten Anprall in den Himmel hinauf, und da er dorthin nicht gehörte, so schleuderten ihn die Himmlischen alsbald wieder auf die Erde zurück. Die Erdgeister aber, nicht mehr willens, ich In gLing aber war seines Bleibens nicht lange; Gesar zog aus, um den schwarzen Dud zu bekämpfen. Der Dud war ein Ungeheuer mit neun Hörnern, neun Augen und neun langen Armen und fraß Menschen. Gesar, der ja selbst ein Mensch war, sollte das Scheusal aus der Welt schaffen. Der Weg zum Dud war jedoch keineswegs einfach zu finden, und Gesar brauchte lange, um zu seinem Ziele zu gelangen. (Der Bericht über diese Irrfahrten wird darum oft tagelang von den Erzählern ausgesponnen.)
Einmal gelangte er auf einen hohen Berg, von dem aus er den Dud zum ersten Male erblickte. Er legte einen Pfeil an die Sehne seines Bogens, aber erst als die Himmlischen das Himmelsgewölbe etwas in die Höhe gezogen und die Erdgötter den Berg etwas hinabgezogen hatten, hatte er genügend Platz zum Abschießen, und dann schoß er dem Dud alle seine neun Hörner ab.
Einmal ritt er durch einen Wald, dessen dicht stehende und dicke Stämme ihn totdrücken wollten. Sein Wunderpferd aber war so rasch, daß die Stämme erst zusammenklappten, als nur noch ein paar Schwanzhaare des Pferdes im Walde waren. Diese allerdings wurden ausgerissen. Endlich kam er ans Zelt des Dud, als dieser eben ausgegangen war. Er traf aber dessen Frau, die Mitleid mit ihm hatte und ihn, nachdem sie ihm Essen gereicht hatte, in ein Aschenloch des Herdes versteckte. Als Dud nach Hause zu seiner Frau zurückkam, roch er gleich das Menschenfleisch und suchte nach Gesar, um ihn zu fressen; aber zum Glück fand er ihn nicht. Schließlich legte sich Dud ermüdet zum Schlafen nieder und schlief ein. Während seines Schlafes kam Gesar aus seinem Versteck, schoß nach Dud und verwundete ihn. Darauf aber rangen sie noch zusammen, und es wäre Gesar noch schlimm ergangen, wenn nicht die Frau ihm geholfen hätte. Sie streute nämlich dem Dud Erbsen unter die Füße, dem Gesar aber Sand. Dadurch stand Gesar fest, während Dud bald zu Boden fiel. Gesar band hierauf seinen Gegner und tötete ihn. Nach dem Tode des Dud kehrte Gesar mit der Frau des Dud nach gLing zurück.
Als er jedoch in die Nähe seiner Heimat kam, erfuhr er, daß drei Könige von Hor das Land gLing inzwischen verwüstet und seine Frau entführt hatten. Deshalb zog er sogleich weiter in den Krieg mit den Hor. Er schlug auch diese, nahm ihnen nicht bloß den Raub wieder ab, sondern auch ihre Frauen und ihre ganze Habe dazu, und »gLing Gesar dyalbo« war nun sehr reich. Er hatte gLing, die Habe des Dud, die Habe von Hor und drei Frauen. Er wurde sehr alt und hatte viele Söhne.
Heute ist Gesar von Ladak bis Ta tsien lu, von Darjeeling bis weit hinter Hsi ning fu hinaus der bekannteste Volksheld. Es wird aber wohl immer eine Streitfrage bleiben, wer Gesar eigentlich war, und welche geschichtlichen Tatsachen der Sage zugrunde liegen oder in ihr zusammengeworfen sind. Wenn man an die Lebendigkeit der Erinnerungen an Gesar denkt, an alle die Gesarsteine, Gesarfurten, -höhlen, -hand- und -fußabdrücke und sonstigen Spuren, von denen die Tibeter sich auf Schritt und Tritt zu erzählen wissen, so ist man zumal als Reisender überzeugt, die Sage sei tibetischen Ursprungs. Bei der ersten Heirat soll es sich um die Werbung um eine chinesische Kaisertochter, beim Kampf gegen Dud um Kriege gegen die Fürsten von Khotan, bei den Hor um Kämpfe mit Mongolen (Hor) oder Tu ku hun handeln. Die K'amba versichern, daß die Hor diejenigen Mongolen gewesen seien, die einst ganz Osttibet erobert hätten, also die Tu ku hun. Im Gesarepos sind vermutlich die Taten des großen Srong btsan sgambo und seiner Vorgänger volkstümlich verarbeitet.
Am 21. März kam Tschang Tung sche aus dem Mekong-Tal zurück. Er hatte sechs Tage zum Schloß des Nah tsien-Königs zu reiten gehabt und brauchte nicht ganz die gleiche Zeit für den Heimweg. Er sah nicht verhungert und angestrengt aus; kaum aber hatte er mein Zimmer betreten, so machte er mit Yin lu tse zusammen einen Ko tou vor mir und begann mit bitteren Klagen über die Behandlung, die ihnen unterwegs widerfahren sei. Überall seien die Tibeter abweisend gewesen, selten einmal hätten sie in einem Zelt geschlafen, und im Schlosse angekommen, habe sie der Ts'ien hu keiner Audienz gewürdigt. Nach tagelangem Warten sei endlich ein Be hu zu ihnen gesandt worden, der durch seinen Nirba mit ihnen sprach. Tschang Tung sche schloß hieran sogleich die Bitte an, ihn aus meinen Diensten zu entlassen. Er könne nicht mehr weiter mit mir gehen, meinte er.
»Ich habe meinen Auftrag erledigt; ich war bei Nan̂ tsien dyalbo.«
»Und was hast du beim König erreicht?«
»Der König und seine Leute haben uns schlecht und erniedrigend behandelt. Sie haben uns verflucht, weil wir dich, einen Fremden, in ihr Land bringen. Sie führten uns in ein großes und leeres Haus. In diesem hätten wir alle mit dir wohnen sollen. Vier Diener waren für dich, Herr, bestimmt, um dir beim Empfang jeden Wunsch an den Augen abzulesen. Man wollte dich köstlich bewirten; Reis, Zucker, Wein und Bier waren bereitgestellt. Nicht fern von den Häusern des Königs aber sah ich in Tuchzelten fünfhundert Soldaten warten. Neben ihnen lagen Berge von Reisig. Wäre ich nicht vorausgeschickt worden, sie hätten uns alle in das leere und abseits stehende Haus eingeladen. Nach einem Gastmahl hätten in der ersten Nacht die fünfhundert Mann die Reisigbündel hoch um das Haus geschichtet, hätten sie dann angezündet, und wer durch einen kühnen Sprung dem Feuertod hätte entrinnen wollen, der wäre von den Kugeln und Lanzen der fünfhundert rings um das Haus aufgestellten Soldaten getötet worden.«
»Du bist wohl ein Weib, daß du durch solche Ammenmärchen dich einschüchtern läßt«, gab ich dem Tung sche zurück. »Du warst vom Schnaps des Königs berauscht und hast diese Geschichten und Drohungen geträumt.«
Doch der Tung sche wich von seiner Erzählung kein Tüpfelchen ab, und ehe er sie noch weiter ausspinnen konnte, ging die Tür auf, und alle anderen Leute drängten in mein Stübchen. Zu sechsen warfen sie sich vor mir auf die Knie, machten Ko tou nach Ko tou und flehten mich an, nach Hsi ning fu umzukehren. »Wir kannten nicht die Schlechtigkeit der Fan tse«, riefen sie einstimmig. »Wir gehen keinen Schritt weiter mit dir; denn weiterzugehen heißt nur ›diu ming‹, das Leben verlieren.« Sie kannten bereits alle Drohungen des Fan tse-Königs und waren vollkommen verzagt. Ich war überzeugt, daß an der Erzählung des Tung sche kein wahres Wort war, und daß er ein abgekartetes Spiel mit mir trieb. Ich überlegte hin und her, wie ich meine Diener für mich gewinnen könnte. Ich überschlug meine Reisekasse. Ohne mich wichtiger Mittel zu entblößen, konnte ich ihnen nicht noch mehr Vorschuß geben, als sie schon hatten. Und eine andere Macht als die des Geldes gab es nicht.
Am anderen Morgen kam in aller Frühe »Sechsunddreißig« zu mir gelaufen und kündigte die Ankunft eines Nan̂ tsien Be hu an. Gefolgt von zwei Bewaffneten, trat ein üppig gekleideter und stolz um sich blickender Fan tse bei mir ein, dessen Züge durch eine auffallend schmale und feine Nase, sowie durch eine ruhige Vornehmheit sehr anziehend wirkten. Er trug sein breites Schwert in einer reich mit Gold und Edelsteinen verzierten Scheide in der Hand, wie es die Etikette gebietet, und hatte auf dem Kopf einen runden, fußhohen Staatshut, der von einem großen Kristallknopf gekrönt war, von dem aus ein Wald von feuerroten Seidenschnüren nach allen Seiten herabflutete, so daß er mich an einen Tambourmajor unserer Garde erinnerte. Die roten Schnüre stießen unten auf eine gelbe Krempe, die in Tellerform vom Kopfe abstand. Der Träger dieser vornehmen Kopfbedeckung wurde mir als einer der vier Adligen vorgestellt, die als nächste Berater oder Pfalzgrafen um die Person des Königs sind. Er war auf Befehl seines Herrn hinter Tschang Tung sche hergeritten, um mich, wie sich bald zeigte, auf dem kürzesten Wege aus dem Land zu jagen.
Als man sich begrüßt und Platz genommen hatte, bot ich ihm in chinesischer Weise Tee an, er aber platzte amtlich und mit fest klingender Stimme heraus: »Wir Tibeter sind dumm wie die Rinder. Wir verstehen nichts, wir können nichts und haben vor allem Fremden Angst. Ihr Fremden seid klug, ihr Fremden seid in allen Handwerken erfahren, ihr Fremden habt großen Mut. Unsere Leute wollen nicht, daß du in unser Land kommst, denn sie sind feig und haben Angst vor allem Fremden, und darum gestattet auch der König nicht, daß du weiter hier herumreist ...« Ohne Unterbrechung plätscherte seine Rede auf solche Art mit Vergleichen und Beispielen gespickt weiter. Tibeter halten ja immer endlose Reden, und in der einfachsten Hütte geht es wie in einem Parlamente zu. Mehrmals wiederholte er zur allgemeinen Erheiterung mit ernstester Miene seine Einleitung: »Wir sind dumm wie die Ochsen und wissen nicht, was wir tun.« – »Gehe zurück,« meinte er hochmütig, »woher du gekommen bist, und wir werden als Freunde scheiden.« Um mir den guten Willen und die Großmut seines Fürsten zu zeigen, legte er zum Schluß seiner Rede einen großen Khádar, ein Panther- und ein Fuchsfell vor meinen Sitz und bat mich, diese anzunehmen. »Es sind nur Felle wilder Tiere. Es ist aber das einzige, was unser Land an Wertvollem besitzt. Für die Augen von euch Fremden ist es freilich ein Nichts.«
»Wie kann ich diese Geschenke annehmen,« erwiderte ich ihm, »wenn ihr mich wie einen Verbrecher des Landes verweist und mir die Weiterreise nach Süden verbietet?«
»Ich verliere meine Stellung und mein Leben, wenn ich dich nicht an die Grenze bringe. Wenn du durchaus nach Süden mußt, so gehe über Ka ts'a. Über Ka ts'a führt die große Straße nach China. Hinter Ka ts'a kannst du nach Süden gehen.«
Ka ts'a liegt bereits jenseits der Grenze des Nan̂ tsien-Reiches und in Dergi. Niemand bürgte mir, daß ich dort nach Süden gelassen würde. Ich ging daher auf diesen Plan nicht ein und schlug vor, im Westen um den Stamm des Nan̂ tsien-Königs herumzureisen. Ich stieß aber auf entschiedensten Widerstand. Bis hinter den Yang tse kiang nach Tschendu sollte ich zurückgehen, wollte ich nach Westen ausbiegen. Wenn mich dort aber auch Guts'a und Nam tso durchlassen würden, die Yüchü würden sicher wieder wie im Jahr vorher über mich herfallen.
Ich kalkulierte im stillen, der Be hu sei doch wohl wegen ganz anderer Geschäfte nach Dscherku ndo gekommen, und dachte bei mir, ruhig abzuwarten, bis dieser Herr wieder abgereist sei. Durch das Fenster auf die Ebene im Süden weisend, zeigte mir der Beamte jedoch ein weißes Zeltlager, das dort eben im Entstehen begriffen war; ich konnte Dutzende von Pferden zählen und sah in der Morgensonne die Lanzenspitzen und Gewehrläufe glitzern. »Dies sind meine Soldaten,« fügte er trocken hinzu, »die mir helfen sollen, dich nach Ka ts'a zu geleiten.«
Höhnisch dankte ich ihm für die große Ehre, die er mir zugedacht, und daß er, um nur mich, einen einzelnen friedlichen Reisenden, abzuschieben, solch einen Haufen Landwehr aufgeboten hatte.
Als der Bon endlich gegangen war, trat mein Hauswirt herein und kündigte die Wohnung mit der Behauptung, er habe sie anderweitig vermietet; er habe nicht gewußt, daß ich so lange bliebe. Zum mindesten war System in der Art, wie der Be hu vorging.
Am Nachmittage wurde angefragt, wann ich abzureisen gedenke. Als ich antworten ließ, meine Pferde seien zu matt, ich könne erst reisen, wenn das Gras gewachsen sei, kamen am Abend Lamas vom Kloster und boten mir schöne Pferde zu mäßigen Preisen an. »Ich habe kein Geld, sie zu kaufen,« sagte ich, »es ist alles so sehr teuer bei euch.« Darauf wurde mir noch in der Nacht vom bTschang dsod des Klosters Ula angeboten, so weit ich sie nur wünsche.
Als ich am folgenden Morgen noch immer keine Anstalten traf, meine Sachen zur Abreise zu richten, versuchte der Tung sche mich einzuschüchtern, indem er behauptete, die Tibeter würden Gewalt anwenden, um mich hinauszuschaffen. Als Antwort gab ich ihm Geld und wies ihn an, sich selbst zu verköstigen. Ich fürchtete selbst, man werde mir wieder den Markt verbieten. Für die Pferde und für mich hoffte ich für einige Wochen noch auszureichen. Ich ließ jetzt den Be hu wissen, ich sei krank und könne augenblicklich nicht abreisen; denn noch immer lebte ich in der Hoffnung, der Be hu würde heimreiten, und ich könne nach Westen ausbrechen. Da trat der Be hu ein zweites Mal bei mir ein und erklärte ärgerlich, nicht länger warten zu wollen. »Wie kannst du als einzelner Peling versuchen, etwas durchzusetzen«, meinte er grob. »Vor einigen Jahren sind zehntausend Peling nach Lhasa gekommen und mußten schließlich auf dem Wege, den sie gekommen waren, auch wieder unverrichteter Dinge zurückkehren. Unsere Götter haben nicht einmal geduldet, daß sie in den Tempeln und Klöstern das Kleinste wegnahmen.«
Als er gegangen war, wurden meine Diener aufs neue rebellisch. Sie verlangten gebieterisch, daß ich abreise, und drohten wieder, mich allein zu lassen, obwohl oder vielleicht gerade weil sie noch mehr als zwei Monate Vorschuß von mir hatten. Es blieb schließlich kein anderer Ausweg für mich, als klein beizugeben. Von dem Augenblicke an, wo ich bestimmt versichert hatte, auf der Straße nach Ka ts'a, wie die Tibeter wollten, weiterzureisen, war wieder alles in Ordnung. Die Hui hui sangen und tanzten. Die chinesischen Kaufleute kamen glückwünschend zu mir, der Tsawu Be hu sandte einen neuen Khádar, und alle Einwohner zeigten freundliche Gesichter und machten allerlei kleine Geschenke. Mein Aufbruch wurde ein kleines Volksfest. Der Hauswirt führte eigenhändig mein Reitpferd am Zügel, und wie am ersten Tage rief es aus hundert Kehlen: »Odyi!« – »Madyi!« – »Odyi!« – »Madyi!« Manchem Mädchen rollte eine Träne über die Wange, ein Beweis, wie festen Fuß meine Begleiter hier gefaßt hatten. Diese hatten kurz vor dem Aufbruch ein großes Wacholderfeuer entzündet und Körper und Gliedmaßen, wie auch die Kleider in den Rauch gesteckt. Sie räucherten sich, weil sie mit tibetischen Frauen in Berührung gekommen waren; jetzt deuchten sie sich wieder fleckenlos und rein.
Mit meinem Da Tschang und mit Ma »Sechsunddreißig« hatte ich bei der Abreise ein ernstes Wort zu reden. Obwohl Da Tschang sich erst kurz vor unserem Aufbruch in Hsi ning mit einer Chinesin verheiratet hatte, wollte er jetzt ein Dscherku ndoer Mädchen mitnehmen, und auch »Sechsunddreißig«, der schon mehrfacher Familienvater war und außer seiner ersten Frau nach dem Tode eines älteren Bruders seine Schwägerin als Frau übernommen hatte, fühlte sich so sehr zu einer Tibeterin hingezogen, daß er glaubte, sie nicht mehr lassen zu können. Dadurch, daß ich beiden rundweg abschlug, ihre Geliebten mitreiten zu lassen, hatte ich leider von nun an in meiner Gesellschaft die zwei aufsässigsten Diener, die es geben kann. Beide waren voll des Lobes der tibetischen Frauen, der Nomaden wie der Bäuerinnen. Sie seien so sehr freundlich und anstellig und hilfsbereit. Um der liebevollen Pflege tibetischer Frauen willen geben nicht wenige Chinesen ihre alte Heimat auf und ziehen in die kalten Steppen und zu den wildesten Stämmen. Bei den Tibetern beobachtete ich oft ein wunderschönes Familienleben, während in China das Zusammenleben häufig zur kalten Konvention herabgesunken ist, in der nur Selbstsucht großgezogen werden kann.
Am ersten Reisetage gingen meine eigenen Tiere vollkommen leer. Ula-Ochsen und Ula-Maultiere schleppten meine Habseligkeiten, und meine Begleiter waren auf Ula-Pferden beritten, die der Nan̂ tsien Be hu beschafft hatte. Wir zogen zunächst nach Süden das Tal hinauf, kamen nach zwei Stunden an dem malerischen Tschanggu gomba vorüber und betraten eine breite Kalksteinzone, die wilde Gipfelformen und zahlreiche ausgewaschene Felsgrotten zeigt, und die der nach Dscherku ndo fließende Bach durchbrochen hat. Die Phantasie der Bewohner hat die absonderlichen Gestaltungen des Kalkes seit Urzeiten mit Göttern und Geistern belebt und darin »Tugendhöhlen« und andere Spielereien guter Geister und Titanen entdeckt. Südlich der Kalke zieht ein mehrere Kilometer breites Hochtal, die Ba tang, mit reichen Viehweiden sacht ansteigend nach Südosten. Dahinter im Süden und als südliche Umrahmung der Ba tang türmt sich aus Schiefer und Granit eine neue und sehr hohe Gipfelkette. Einige Zacken erreichen 6000 m absoluter Höhe. In das breite Längstal schieben sich von diesen Bergen alte dicke Schotter- und Moränenwälle hinein, deren Zungen noch heute von Gletschern reden, während zurzeit aus dieser ganzen Gegend längst die letzten Reste der Eiszeit verschwunden sind. Noch war kein grünes Gräschen zu entdecken, doch auf den zahlreichen Tümpeln glucksten schon die gelben Gänseehepaare.
Die Ba tang ist das Land der zwei Stämme Lada und Puchün. Die Mehrzahl der Bewohner besteht hier in 4000 m Höhe wieder aus Zeltnomaden. Nur ein paar Klöster und die Fürstensitze haben feste Gebäude. Wenige Kilometer südlich Dscherku ndo hatten die Felder aufgehört.
Ich kam am ersten Tage bis zum Kloster Betschin gomba, 25 km von Dscherku ndo. Ein kleines Haus war mir für die Nacht bereitgestellt worden, doch zog ich vor, in meinem Zelt zu schlafen. Ein Reisender, der nicht durch seine Führer auf das Kloster aufmerksam gemacht wird, kann ahnungslos dicht an Betschin gomba vorüberreiten, so versteckt sitzt es zwischen den weißen Kalkfelsen. Es soll dreihundert Mönche und zwei Inkarnationen haben und gehört der Nima-Sekte an. Der Haupttempel hat ein schönes Golddach; in der Umgebung sind mehrere Einsiedeleien.
Am nächsten Tage führte mich die breit ausgetretene Straße an den Häusern des Puchün Be hu vorüber, hierauf über einen Paß von wenig mehr als 4200 m Höhe, dann mäßig steil in ein Waldtal hinab, bis wir in 3700 m auf Felder und auf die Steinhäuser des Dorfes Ka ts'a trafen. Bereits auf diesem Marsche fehlte die Begleitung des Nan̂ tsien Be hu und damit auch die tibetische Ula, die mir einen Monat weit versprochen worden war. Die Häuptlinge von Lada und Puchün sandten nur zwei Khádar und ließen sagen, es sei ihnen nicht bekannt, daß je vorher Fremdlingen Ula gestellt worden sei. Ganz logisch sträubten sie sich gegen die Einführung eines Präzedenzfalles. Sie boten mir aber für je 50 kg ein Tier zur Miete bis Ka ts'a an, wofür sie pro Tier 1 Rupie berechneten.
Meiner Aufnahme im Dorfe Ka ts'a, das bereits im Königreich Dergi liegt, sahen wir alle mit Spannung entgegen. Sie war aber gut, denn sie war höchst gleichgültig von Seiten der Tibeter. Ohne Widerrede ließen sie uns in ein halbzerfallenes einstöckiges Haus einziehen, das, einst ein weitläufiger Ya men, heute als Rasthaus für vornehmere Reisende dient. Eine neue unangenehme Überraschung brachte mir hier dagegen Tschang Tung sche. Kaum daß wir abgeladen hatten, trat er mit einer Abschiedsrede auf mich zu. Er müsse noch einmal zum König reiten, meinte er; denn er habe seine Papiere nicht zurückerhalten. Alle meine Einwürfe, auch daß mir im Ya men in Hsi ning fu versprochen worden war, der Tung sche werde mindestens bis an den ersten chinesischen Militärposten mitgehen, stießen auf taube Ohren. Tschang Tung sche wollte nicht weiter. Er verschanzte sich hinter der Behauptung, er sei mir außerhalb des Nan̂ tsien-Gebiets sicher nichts nütze, er habe anderseits im Interesse seines Ya mens noch einige wichtige Geschäfte beim König zu versehen. Jeder neue Einwurf von meiner Seite erzeugte neue lügenhafte Ausreden. Man hat sich in solchen Fällen mit offenen Augen antölpeln zu lassen und kann nur gute Miene zum bösen Spiel machen. Nachdem ich ihm meine Überzeugung auf den Kopf zugesagt hatte, gab ich ihm sein Gehalt für ein weiteres Vierteljahr, schenkte ihm ein Reitpferd und schrieb in englischer Sprache an seinen Vorgesetzten, daß ich ihm für den Tung sche danke, daß mich dieser aber mitten im Ts'ao ti an einer Stelle verlassen habe, wo ich keinerlei Ersatz finden könne. Als er hierauf rasch eine Tasse Buttertee geschlürft und Lebensmittel für die nächsten Tage zu sich gesteckt hatte, machte er mit dem Lo ts'a zusammen einen Ko tou, dann trabten sie eilig das Waldtal hinauf nach Betschin gomba zurück.
An diesem Abend jagte ich auf weiße Fasanen, die hier zu Hunderten am Waldrand standen. Sie sind kaum kleiner als die europäischen Fasanen, waren sehr scheu und ließen ihren helltönenden Warnungsruf schon aus großer Ferne erklingen. Sie lieferten einen recht guten Braten und kamen bis in die Rhododendronwälder hinauf vor, so daß ich sie noch in 4000 m Höhe antraf. Es gibt in K'am zwei Arten weißer Fasanen, die beide zwischen 3000 und 4000 m verbreitet sind.
In der Nacht setzte ich mich an das Waka der Mannschaft und gab freigebig Schnaps zum besten, um die Stimmung zu heben und Yin lu tse über Tschang Tung sche auszuhorchen. Bald löste sich auch Yin lu tses Zunge. Er erzählte noch einmal von den Drohungen der Nan̂ tsien-Leute; daß der König Tschangs Papiere behalten habe, war natürlich erlogen. Tschang hoffte, der König werde ihm zwölf Ochsen und zwei Pferde geben und andere Wohltaten erweisen. Kurz, ich fand durch Yin lu tse meine Vermutung bestätigt, daß der amtliche Dolmetscher, den ich diesmal bei mir hatte, mich in aller Form verraten und verkauft hatte.
Am 27. März erreichten wir wieder den tief eingeschnittenen Yang tse kiang und am 28. März nach einem scharfen Ritt und ermüdendem Auf und Ab den Fährplatz, der Tschomdo heißen soll, und an dem die große Straße auf das linke Ufer übersetzt. Zwei Lehmhütten stehen dort am Eingang eines großen Seitentals; es sind die Wohnungen der Fährleute. Am Ufer selbst erhoben sich Mauern von anderthalb Manneshöhen und vier und fünf Fuß Dicke. Jeder einzelne Quaderstein dieser Mauern war eine halbe Yaklast chinesischen Tees, der, in rohe schwarze Yakhäute gepreßt und genäht, auf die Weiterreise nach Zentraltibet wartete. Achthundert Ochsen sollten die nächsten Tage kommen und sie auf dem Wege, den ich soeben herabgekommen war, ins Innere schaffen.
Bei den Fährleuten erfuhr ich, daß dem kräftigen, 8 m breiten und 1 m im Durchschnitt tiefen Flüßchen Tscho tschü, das bei Tschomdo mündet, eine Straße nach Tsiamdo folgt, auf der man in acht Tagen durch das freie Fürstentum Lhado den Ort Tsiamdo und die große Straße Batang–Lhari–Lhasa erreichen kann. Leichtsinnigerweise teilte ich meine Absicht, dieser Straße nach Süden zu folgen, noch am gleichen Abend der Mannschaft mit. Am nächsten Morgen waren Yin lu tse und Ma »Sechsunddreißig« auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Yin lu tse hatte sich mit Tschang Tung sche sehr angefreundet, und »Sechsunddreißig« hatte eine ernste Liebschaft in Dscherku ndo zurückgelassen. So war es vielleicht auch nur ein zufälliges Zusammentreffen, daß sie gerade in dieser Nacht ausrückten. Nun fiel mir auf, daß jeden Tag einer von ihnen mit der Bitte um einen größeren Vorschuß bei mir erschienen war. Auch baten beide, ihnen Gewehre für die Nacht zu lassen, weil Räuber in der Nähe seien. Da ich aber die Gewehre im Innern meines Zeltes behielt und die Pferde wie jeden Abend an der Kette angeschlossen und die Schlüssel dazu auch im Schlafe noch in der Tasche getragen hatte, so war mein Schaden nicht allzu groß. Es war nur ein gold- und silbertauschiertes und mit Karneolen geschmücktes Schwert mitgegangen, das ich in Dscherku ndo von einem Häuptling der Gerdschi erstanden hatte. Am lautesten schimpften die beiden zurückgebliebenen Dunganen Hai und So über die Flüchtigen. »Sie haben unseren einzigen koscheren Kochtopf mitlaufen lassen«, jammerten sie voller Verzweiflung, »und obendrein die koschere Wegzehrung für die nächsten vierzehn Tage.« »›Sechsunddreißig‹ hat mich noch gestern um einen ganzen Monatslohn erleichtert, um sich silberne Ohrringe zu kaufen«, klagte Li in seinem Baß dazwischen. Inzwischen kam verstohlen Da Tschang in mein Zelt und setzte mir auseinander: »›Sechsunddreißig‹ hat mich noch gestern um mein einziges Hemd gebeten, bei Gott, es war zwei Tael in Hsi ning wert. Wenn ich mir hier ein neues kaufe, so kostet es zehn Rupien. Willst du, daß ich noch weiter mit dir gehe und nicht nach Dscherku ndo zurückkehre, um mir mein Hemd zu holen, so zahle mir jetzt bitte die zehn Rupien für den Schaden, den deine Diener mir angerichtet haben.« Er fiel nie einen Augenblick aus der Rolle und wußte immer seinen Vorteil zu wahren. Von den übriggebliebenen vier Mann sprach nur er einigermaßen fließend Tibetisch, und nur er verstand die südtibetischen Dialekte.
29. März. Wir begannen um zehn Uhr mit dem Übersetzen über den Dre tschü. Ein halbes Dutzend »go dsche« (geschr.: ko gru), Yaklederboote, standen dazu zur Verfügung. Es war der national-tibetische Schiffstyp, der in ganz Südtibet auf den großen Strömen üblich ist. Die größten »go dsche« hatten hier eine Länge von noch nicht 2,5 m bei einer Breite von 1,2 m und einer Bordhöhe von 0,7 m. Die Außenhaut bestand aus Yakleder, dessen Nähte mit Kohlenteer wasserdicht gemacht waren. Die Spanten – wenn man den Ausdruck dafür gebrauchen darf – waren ungeschälte Fichtenzweige, die das Yakleder überall gespannt zu halten hatten. Einige »go dsche« waren kreisrund und hatten wenig mehr als 1 m Durchmesser. In die größeren packten die Fährleute je zwei Mann und dazu 3 Zentner Lasten. Mit einer solchen Last tauchten diese Boote zur Hälfte ins Wasser ein. In die kleineren ging wenig mehr als der Bootsmann und ein Passagier. Der Bootsmann arbeitete sich mit einem schmalen kurzen Ruderlöffel durch die Wellen. Jedesmal wurden die Boote weit abgetrieben und tanzten wie Seifenblasen, sich drehend und schaukelnd, auf der Oberfläche des Stromes hinab. Drüben angekommen, hob der Fahrer seine Nußschale vorsichtig aus dem Wasser, stülpte sie sich auf den Rücken und spazierte damit das während der Fahrt verlorene Stück am Ufer zurück aufwärts. Wenn die Boote eine Weile im Wasser gelegen haben, werden sie immer wieder vorsichtig an der Luft getrocknet. Nur zwei Männer und eine Frau waren bei dem Fährgeschäft tätig. Die Frau verstand es wie ihre beiden Männer, halb aus der Nußschale herauszuhängen und mit kräftigen Bewegungen des Rührlöffels aus der Gegenströmung des Ufers abzustoßen und den richtigen Stromstrich zu erwischen. Sie war noch jung und hatte hübsche Züge. Da sie ihr Gesicht aber mit der Schmutzschminke, »Deidia« genannt, eingesalbt hatte, sah sie recht abstoßend aus. Sie hatte diese Schminke nicht etwa wegen der Lama gebraucht, um nicht die frommen Hagestolze in Versuchung zu führen, sondern um beim Geschäft ihren Teint zu schonen. So wenigstens behauptete sie selbst, als ich mit hochgezogenen Knien oben auf meinen Lasten in ihrem Boote saß und von ihr über den großen Strom »gezwirbelt« wurde. Drüben verstand sie es ebenso meisterhaft, trotz braunschwarzer Schminke, mit einem Priester, der über den Fluß setzen wollte, am Ufer sitzend, ein Viertelstündchen zu schäkern.
Für das Übersetzen hatte ich den wahrlich anständigen Preis von 12 ½ Rupien zu bezahlen. Dabei mußten die Pferde und Maultiere frei schwimmend das andere Ufer erreichen, und nur zwei Maultiere, die mir zu schwach erschienen, wurden an eines der Coracles angebunden und am Kopfe hinübergezogen. Das eine war trotzdem wegen des eiskalten Wassers ohnmächtig geworden, als es das jenseitige Ufer erreichte.
Die Freischwimmer unter den Tieren wurden zusammen in den Fluß getrieben, aber dreimal wurden sie gerade in der Mitte von Angst gepackt und wollten wieder zurückkehren. Das Übersetzen gestaltete sich dadurch sehr aufregend unter viel Geschrei, Steinwerfen und Schießen. Als wir glücklich drüben waren, fing es zu allem hin noch zu schneien an. Alle Tiere standen völlig abgespannt, triefend, zitternd, mit eingeklemmtem Schwanz und hängendem Kopf im Winde. Das vorgehaltene Futter blieb unberührt; weit und breit war kein schützendes Obdach. Bis die Tiere sich erholt hatten und wir das halbtote Maultier aus dem Wasser gezogen und mit Branntwein ins Leben zurückgerufen hatten, war es so spät geworden, daß es an diesem Tage nur noch bis ins nächste Dorf reichte, wo ich die zwei Maultiere gegen ein Pferd eintauschte.
In dem Dörfchen Sombarwa war ein begüterter Mann, der weit – bis Kalkutta und Peking – gereist war und geschmackvoll und unzerrissen gekleidet ging. Bei dem anhaltenden Schneetreiben waren wir ihm sehr dankbar, daß er uns in seinem warmen Stalle aufnahm. Er fragte nach dem Fremden, den der Nan tsien-König seines Landes verwiesen habe, und wann der komme. »Der ›Bon‹ des Tales«, meinte er, »wolle ihn nicht durchlassen. Die Fährleute dürfen ihn nicht über den Fluß herüberbringen.« Ich war, als ich dies erfuhr, froh, daß ich in Dscherku ndo europäische Kleidung getragen hatte, so daß jetzt meine Perücke, mein dunkler Hautanstrich und der zerrissene und schmierige Pelz, den ich wieder angelegt hatte, in schärfstem Gegensatz dazu standen. Die Kleidung schien für die Leute so anheimelnd zu sein, daß mich keiner genauer betrachtete und als »Peling« erkannte. Zum Dank für die Mitteilung log ich dem Herrn vor, der Fremde wolle erst weiterreisen, wenn das Gras grün geworden sei. Heute verkaufte ich noch meinen schweren Winterpelz und mein halbes Bett, um ja mein Gepäck zu erleichtern.
Von dem Fährplatz nach abwärts ist das Yang tse-Dre tschü-Tal erbreitert. Eine ganze Tagereise weit reiht sich Hausgruppe an Hausgruppe, neben dem breiten Geröllbett des Stroms steht eine niedere und manchmal fast 2 km breite Terrasse mit Berieselungsfeldern, mit gutem Humus und mit Löß, und in der Mitte erhebt sich, wegen seiner Länge und Tiefe schon aus großer Ferne in die Augen springend, der »Pobrang«, der Herrensitz dieser Kulturoase Tschamdo ya tsun. Der Distrikt muß reich sein. Man sieht auch viele, obschon nicht sehr volkreiche Klöster (Sombarwa, Tschede gom, Dschoma lhagan, Tschungkor gom) und trifft auch Einsiedeleien (Retoden) in den einschließenden Bergen im Norden. Alle Laienhäuser sind naturfarben gelassen, während die Mönchswohnungen in bunten Farben oder mindestens blendendweiß aus dem Grün der Felder herausleuchten. Die Mönche überschütten auch hier ihre Hauswände aus Kübeln mit der Farbe und verwenden nie einen Pinsel zum Tünchen.
Die Bauern halten sich gelbe, bzw. farbige kurzhaarige Rinder, die durch ihre Kleinheit in die Augen fallen (0,9 m Widerrist) und mit ihrer schlechten Hörnerbildung verkümmert aussehen. Man sagte mir, daß die Sommerhitze im Tale für die Haltung von Yakrindern zu groß sei. Bei den Eingeborenen kommen gelegentlich Kröpfe vor; doch wie in Dscherku sind sie nicht gerade häufig.
Auf dem nächsten Reisemarsch (1. April) erreichten wir Nan dyi, eine Anzahl Siedlungen von je sieben bis acht Häusern aus Stein. Die Leute waren freundlich, luden uns ein, bei ihnen zu wohnen, und verkauften auch Gerste. Sie fragten, wann der »Pelang« komme. Die Bauern dreschen noch um diese Zeit mit dem Dreschflegel auf ihrer Tenne, die stets auf dem flachen Hausdache liegt. Zum Reinigen des Getreides verwenden sie keine Wurfschaufel, wie etwa die Chinesen, sondern schütten das Korn aus Körben mehrmals auf den Boden der Tenne und lassen den Bergwind die Spreu davontragen.
Am zweiten Tage betraten wir hinter einem Passe das Fürstentum Ling gose, das von König Gesars Ling oder gLing seinen Namen ableiten will (Tafel XXV oben). Es ist sozusagen unabhängig, hat einen eigenen »dyalbo« (rgyalbo). Dieser hat in Gose gomba sein Heim, ein nicht sehr fürstlich aussehendes Steinhaus.
Vom Wege aus sahen wir im Süden und Südwesten noch anderthalb Tagemärsche hinter Dschoma lhagan das Tal des Yang tse kiang, freilich ohne je noch einmal den Fluß zu erblicken, der in der Tiefe eingekeilt bleibt. Jenseits des Tals erheben sich Bergrücken, die bis in 4500 m Höhe hinauf dichte Fichtenwälder tragen, während die Gipfel, von denen viele hoch über 5000 m emporragen, baumlos sind und, solange ich sie sah, in eine lückenlose Schneedecke gehüllt lagen.
Am 4. April ging es über den Paß Chima t'ang, über eine Paßhochebene von 4265 m, zu der man ganz allmählich über naka-bedeckten Moränengrund und zwischen riesigen Granitfindlingen aufsteigt. Rechter Hand (im Süden) hatte ich hinter wirbelnden Schnee- und Hagelwolken einen zackigen Gebirgszug, der immer nur für Augenblicke sich sehen ließ und mit einzelnen Kegeln und Piks noch um 700-800 m den Paß überragte. Linker Hand (im Norden) dehnten sich lange Höhenrücken mit Viehweiden, die mich in ihrem Charakter, mit den monotonen Gipfelreihen und den grüngrauen Sandsteinen und Tonschiefern an die ngGolokh-Länder und die grünen Hügelwirrsale am Ma tschü erinnerten.
Die Chima t'ang gilt für die schlimmste Räubergegend auf dem Wege von Dscherku nach Hor Gantse, denn in ihrer menschenleeren Wildnis lauern mit Vorliebe Ling gose-, Li tang- und ngGolokh-Banditen den Reisenden auf und plündern sie nach Herzenslust bis aufs Hemd aus. Deshalb hatte sich mir bei Dschadschi gomba am 3. April eine kopfreiche Gesellschaft Horba- und Sehen si-Kaufleute angeschlossen, die dort einige Tage auf Verstärkung gewartet hatte. Alle waren bis an die Zähne bewaffnet und sehr gut beritten. Sie zogen zwei Maultiere mit sich, die – wie mir später der chinesische Agent Wang da verriet – allein in zwei Ledersäcken für 14 000 Mark Moschus und Goldstaub trugen.
Auf einem zweiten Paß, der kaum niedriger als der erste war, überraschte mich am späten Nachmittag ein heftiges Schneegewitter, das die Tiere so vollkommen auspumpte, daß ich gezwungen war, mitten im tiefsten Schnee die Lasten abzubinden und zu rasten. Mittags zeigte das Thermometer -2°, nachts -6°. Da ich keinen Wintermantel mehr besaß, war die Nacht wenig angenehm, Mit knapper Not brachten wir am folgenden Morgen die schwachen Skelette der Tiere ins Kloster Tschoktsen. Die tibetischen Handelsleute mit ihren ausgeruhten Pferden hatten dagegen noch in der vorausgegangenen Nacht den schützenden Klosterfrieden erreicht und uns allein gelassen. Sie rasteten noch mit mir zusammen einen ganzen Tag im Kloster, um hierauf einen neuen Gewaltmarsch von weit über 50 km anzuschließen, der über den Muri la (4600 m) führte.
Tschoktsen gomba (3825 m) liegt geborgen vor profanen Blicken in einer überaus malerischen Schlucht. Im Süden erheben sich die Berge zu bizarren Spitzen von überaus großer Höhe. Im Norden schließt sich ein Hochtal mit schönen Viehweiden an, das zum Dsa tschü geht und im Sommer ein beliebter Weideplatz ist. Zur Zeit meines Besuches war das Hochtal unbewohnt. Ich sah viele erratische Granitblöcke darin. Die größten davon hatten die Mönche mit Obos aus weißen Quarzsteinen geschmückt. Das Kloster gehört der weißen Sekte, hat dreihundert Lamen und eine Inkarnation.
Das Haus, das uns zur Verfügung gestellt wurde, war ein großer ummauerter Raum mit vielen Holzstützen, die eine Decke aus lehmbeworfenem Reisiggeflecht trugen. Mit einem Strick teilten wir den Raum für Pferde und für Menschen ab. Drei Steine trugen im Wohnabteil den Kessel, und damit war die Küche fertig. Mit meinen kleinen Kisten und zwei erratischen Blöcken, die tischgroß im Boden steckten, hatte ich mir ein Arbeitszimmer abgetrennt. Es wäre herrlich gewesen, wenn nur bloß die Hälfte des Schnees und Tauwassers durch die Decke hereingedrungen wäre!
Am 5. April schneite es mit kurzen Unterbrechungen weiter, so daß die Tiere nicht auf die Weide hinausgetrieben werden konnten und auf die mageren »Heuzöpfe« angewiesen waren, die die Tibeter im Laufe des Winters in den Bergen gesammelt hatten. Nach langem Bitten und Betteln und mit Hilfe des chinesischen Großkaufmanns Wang da verkaufte mir ein Mönch einen Sack voll getrockneten Quarkkäses als Kraftfutter zum Aufpäppeln der Maultiere; Gerste gab es überhaupt nicht. Beim Aufstieg auf den Muri la verloren wir rasch hintereinander zwei Pferde. Das eine wurde von Da Tschang durch einen Gnadenstoß getötet. Bei unseren Mitreisenden erregte dies aber einen solchen Widerwillen, daß wir das zweite nicht mehr zu töten wagten, sondern im Schnee halbtot stecken lassen mußten und nur hoffen konnten, es würde ihm von den Wölfen rasch der Garaus gemacht werden.
Zum Muri la geht es von Tschoktsen gomba durch ein muldiges Tal, das mit Buschwald von immer noch über 1 m Höhe bestockt ist. Später steigt man über einen kahlen, kilometerbreiten Moränenhang zum Paßobo hinauf. Oben steckt jeder Reisende eine neue Fahne oder einen neuen Holzspeer in das Obo und umkreist mit lauten »o! Lhadialo! o! o! Lhadialo! o! o!« den Paßfetisch. Es hilft dies sicher gegen Bergkrankheiten jeder Art und gegen Räuber. Auf dem Passe lag knietiefer Schnee. Die Berge im Süden überragten uns in Dolomitenformen noch um 600 und teilweise 1000 m. Von Süden scheint auch die große Moränenmasse gekommen zu sein, die die heutige Paßhöhe des Muri la gebildet hat.
Bald hinter dem Paß ließ ich Lager schlagen und die Horba-Händler allein weitereilen. Sie ritten noch 25 km an diesem Tage; denn sie fürchteten auch hier für ihre Habseligkeiten, obwohl sie doch recht gut bewaffnet waren. Jeder Mann hatte eine Gabelflinte auf dem Rücken, an der Seite ein großes, breites und im Gürtel ein kurzes, spitzes Schwert. Die meisten trugen lange Lanzen, deren Vorderteil durch ein spiralig aufgenageltes Eisenband gegen Parierhiebe geschützt war, und last not least pendelte vielen rechts am Sattel noch eine Bogentasche mit einem mandschurischen Bogen und ein mit Pfeilen gespickter Köcher. Weil nämlich die Luntenflinte bei plötzlichen Überfällen in den dichten Wäldern der Täler Osttibets eine sehr zweifelhafte Waffe darstellt, so halten viele K'amba an der uralten Bewaffnung fest. Mit Pfeil und Bogen lassen sich jederzeit rasch hintereinander einige Schüsse gegen den Gegner abgeben. Man braucht dazu nicht erst mit Hilfe von Feuerstein, Zunder und Feuerstahl die Flintenlunte zu entzünden, braucht nicht nach jedem Schuß mit dem langen, ungefügen Ladestock zu stopfen und auch nicht darauf zu achten, daß die Flintenpfanne neues, trockenes Pulver erhalten hat.
Mit der Aufzählung der Waffen ist freilich noch lange nicht alles beschrieben, was an einem tibetischen Geschäftsmann hängt, wenn er eine größere Reise unternimmt. Ist er einigermaßen bei Kasse, so fällt außer einigen kleineren Amuletten, die ja von jedermann stets am Halse getragen werden und in Leder- oder vielleicht auch in Silber- und Goldhüllen verschlossen sind, am meisten ein Metallkästchen von etwa 20 x 15 x 8 cm Größe auf, das an einem silbergebuckelten und quer über die Brust laufenden Wehrgehänge getragen wird (siehe Titelbild). Es enthält außer Beschwörungen und von Heiligen und Inkarnationen angehauchten Seidentüchlein den Leibgott, ein feuervergoldetes Bronzebild des besonderen Schutzheiligen, dem der Besitzer zugetan ist. Ihm wird unterwegs im Quartier oder Zelt jeden Tag Weihrauch geopfert. Außen am Lendengurt aber baumeln dem Reisenden das kräftige Eßmesser, die Feuersteintasche, eine Ledergeldtasche, eine Nadeltasche, ein Beutel für den Eßnapf, die Kugeltasche, die aus Horn gefertigten Pulverbehälter für je einen Schuß und endlich noch ein Hörnchen für das Pfannenpulver der Flinte. Auch das Pferd hat verschiedene Anhängsel. In erster Linie einige kleine Beutel aus Leder und rotem Wollzeug, in die vom Priester geweihte Gerste gewickelt ist. In die Mähne sind rote Bänder geflochten, und am Hals hängt eine rote oder schwarze Quaste und ein silbern klingendes Glöckchen.
Wir begegneten auf den nächsten Märschen täglich vier- bis fünfhundert Yak mit Tee, am 9. April sogar neunhundert Yak. Die Karawanen brechen stets sehr früh am Morgen auf und rasten bereits von zehn Uhr oder gar von neun Uhr morgens. Ein Teeballen braucht auf diese Weise, um von Ta tsien lu nach Lhasa zu gelangen, fünf Monate und passiert Tausende von Furten.
Am 7. April lagerten wir neben Yang tse gomba (Säge gomba), einem kleinen Kloster des Nima-Glaubens mit achtzig Mönchen; ganz in seiner Nähe ist noch ein zweites Kloster dieser Sekte, das abseits zwischen hohe Fichten und Kalkfelsen hineingestellt ist. Einer der Gelong bewirtete mich in seiner Klause mit Buttertee.
Am 8. April lagerten wir neben einer Anhöhe, auf der seit vielen Tagen ein Waldbrand wütete und schon große Verheerungen angerichtet hatte. Es war der größte, den ich in Tibet sah. Mehrere Quadratkilometer des schönsten Urwalds waren dem Element zum Opfer gefallen und völlig vernichtet worden. Spuren von Waldbränden sind eine alltägliche Erscheinung. Niemand achtet auf seine Feuer. Die meisten Waldbrände entstehen in den trockenen Wintern durch die Gleichgültigkeit der Reisenden oder durch die eingeborenen Hirten. Sie werden so gut wie nie bekämpft. Man läßt sie langsam ausbrennen.
Am 10. April überschritten wir bei schönstem Sonnenschein einen neuen 4100 m hohen Paß, von dem aus sich plötzlich und völlig überraschend der wunderbare Blick auf die Berge von Rungwatsun und Amne Rala öffnete. Der Neuschnee war bis hoch hinauf der Sonne der letzten Tage erlegen. Klar und scharf stachen die dunklen Grate aus Urgestein vom schimmernden Blau des Himmels ab. An den steilen Gipfelhalden glänzte Firnschnee, und blaugrüne Eisschründe, Gletscherabbrüche und Seracs, Lawinenrillen und Schneewächten winkten und lockten mein alpines Herz zu sich hinauf. Doch ich mußte unten in der Fastebene der Moräne in 4000 m Höhe bleiben und die Karawane hüten. Wir schlugen Lager zwischen den ungeheuren Moränenmassen, die sich im Norden der hohen Kette viele Kilometer breit ausdehnen, und die die von Norden her an den hohen Urgesteinswall vor Urzeiten herangeschobenen Sandsteine und Kalke mit Granitblöcken überflutet haben. Das Wärmemaximum war an diesem Tage 16,5°; das Minimumthermometer zeigte für die Nacht –4°.
Um Mittag des nächsten Tages ritten wir an einer malerischen Einsiedelei, Tschora yunka, vorüber, die auf einer Kalkklippe liegt und von vierzehn Nonnen, »ani«, bewohnt ist. Ein redseliger Alter berichtete uns kopfschüttelnd von der »Verrücktheit der Weiber«. Seit fünf Jahren wohne auf dem Felsen eine hübsche Jungfrau, die die besten Heiratspartien ausschlage, weil sie ihre Zeit nur mit Beten und Gottdienen zubringen wolle. In ihrem Ehrgeiz, es den Priestern männlichen Geschlechts gleich zu tun, habe sie jedem männlichen Wesen verboten, sich ihrer Zelle zu nähern.
In 3700 m Höhe stellten sich allmählich Felder ein. Das erste Dorf lag 3600 m hoch. Die große Straße führte uns mitten hindurch. Die Häuser, alle zweistöckig und mit flachen Dächern, standen nicht sehr eng zusammengedrängt. Da ich aus der Lektüre von W. W. Rockhills Reise, der 1889 hier durchkam, wußte, daß sich die Einwohner in dieser Gegend besonders fremdenfeindlich gebärden, so ritten wir ziemlich eilig durch die erste Ansiedlung, die fünfundzwanzig Häuser zählte, kaum daß Da Tschang auf die Fragen nach Woher und Wohin eine kurze alltägliche Lüge zur Antwort gab.
Das Dorf liegt am Anfang einer großen und breiten Ebene, die sich von hier weit nach Osten hinzieht, und ist der Sitz eines Gemeindehäuptlings. Es gehört zum Königreich Dergi. Unweit, im Süden, mündet ein großer Bach aus einer stattlichen Schlucht in die Ebene ein. Ein Weg von Dergi gon tschen folgt dem Bache ganz unten im Grunde. Ich überschritt diesen Tso tsa tschü späterhin auf einer Brücke und sah Dutzende von Wassermühlen mit großen Gebetstrommeln von 1–3 m Durchmesser, die so schrill quiekten, daß wir sie noch weithin hörten (Tafel XXVI unten). Die Ebene vor uns war bedeckt von Feldern, und an allen Ecken und Enden tauchten Häusergruppen auf. An den Bergabhängen im Norden bemerkte ich größere Anhäufungen von Löß, aber auch zahllose Felderterrassen, die in den oberen Teilen unbestellt und verlassen waren. In der Ebene ist zweijährige Wirtschaft. Es werden kurzhaarige gelbe Rinder neben Yakbastarden gehalten. Dem, der wie ich aus dem Innern kommt, sind in den Dörfern die vielen braunen und gelblichen, langhaarigen Schweine sehr auffallend.
Auf einer niederen Bodenanschwellung, wohl einer alten Moränenzunge – ringsum sind erratische Blöcke verstreut –, erhebt sich an der Straße mitten in der Ebene das große Datschi gomba. Es hat ein anderes Aussehen als die heiligen Stätten weiter im Westen. Die Wohnhäuser der Mönche, in der Hauptsache aus Holzbalken gezimmert, stehen dicht gedrängt um die Kulthäuser mit den goldschimmernden Abzeichen und den goldgelben Dächern Nur da, wo Götter und Götterbilder dauernd thronen, verlangt der Tibeter ein schräges, ein chinesisches Dach, um schon dadurch zu verhindern, daß ein Mensch und Unheiliger mit seinen Füßen über den Göttern herumtrampelt.. Die Lesehalle und der Golddachtempel waren nach Ostsüdosten orientiert. Ringsum lief eine hohe, weiße Mauer. Im Süden war ein festes Tor, und in der Nordwest- und Südostecke stand je ein schönes Tschorten, am Bachrand daneben aber lag ein kleiner Pappelhain, in dem eine Schar junger Dschraba (noch nicht vollordinierte Mönche) mit einem großen Lederball spielte. Einer warf den Ball hoch in die Luft, und die anderen fingen ihn geschickt mit ihrem Kopfe auf, um ihn so sich gegenseitig zuzustoßen. Zum Kloster Datschi gomba sollten dreitausend Mönche gehören, alle Gelugba, doch schien mir diese Angabe eine große Übertreibung zu sein. Jeden nichteingesessenen Frager und vollends einen Chinesen lügen tibetische Mönche ja grundsätzlich an!
Drei Kilometer nördlich von Datschi gomba und von der Straße, der ich folgte, bricht sich der große Dsa tschü, der chinesische Ya lung kiang, durch die Sandsteinberge im Norden eine schmale Bahn in das Tal. Einige umfangreiche Klöster stehen nicht weit davon. Ein hohes, weißes Haus wurde mir als der »pobrang« des Dengu von Berin bezeichnet; ich war an diesem Abend noch aus Dergi nach Hör ka nga schok, ins Reich der fünf Könige von Hor, gekommen.
Wir stellten unser Zelt in Niara dschomba neben einem Teich auf, an dem So und Tschang sehr gegen meinen Willen Gänse jagten. Ich fürchtete, daß dadurch die Einwohner unnötig auf mich aufmerksam gemacht würden. Seit dem Weggang von »Sechsunddreißig« und von Yin lu tse durfte ich aber nur noch ausnahmsweise hoffen, daß meine Wünsche respektiert würden. Unweit lag eine Gruppe von vier Häusern, die hoch gebaut und weiß getüncht waren und mir mit den ebenen Dächern, mit der hier allerorts üblichen breiten Loggia im zweiten oder dritten Stockwerk und mit ihren luftigen Balkonen süditalienische Bilder vorgaukelten. Alle Höfe machen in diesem Tal einen wohlhabenden Eindruck. Im Innern aber ließ das eine Haus, das ich zum Strohkauf besuchte, nach unserem europäischen Gefühl so ziemlich jegliche Wohnlichkeit vermissen. Die Räume, die sich um die Loggia gruppieren, sind dunkel, kalt und muffig. Der Qualm der offenen Feuer, die in der Mitte der Zimmer gebrannt werden, erfüllt das ganze Haus und zieht nur schlecht durch die Türen ab. Papierfenster – von Glasfenstern ganz zu schweigen – besitzen hier erst die Lamen und die ganz Reichen in ihren Studierzimmern, in denen sie im Winter nur selten ein Kohlenbecken aufstellen.
Die Männer von Hor ka nga schok trugen selten das wirre, wilde, lange Haar wie weiter im Inlande, sie pflegten es, flochten es zu einem großen dicken Zopf, der vom ganzen Haupthaar ausging, und dem manchmal noch mit falschem Haar nachgeholfen wurde. Den dicken Haarwulst legten sie dann wie einen Turban um den Kopf herum. Die Stutzer aber pflegten ihn an der linken Seite durch einen großen Elfenbeinring oder rote Korallen festzuhalten. Man sah hier auch auffallend viele Schnurrbärtchen oder Schnurrbartrestchen in den Mundwinkeln, während das übrige Gesicht durch Ausreißen der Haare mit der Pinzette haarlos gehalten wurde.
12. April. Bald hinter unserem Lagerplatz erreichten wir das Ufer des großen Dsa tschü. Er war schon nicht mehr klar, sondern floß graubraun und in eine Schutterrasse eingegraben. Er sah stattlicher aus als der Yang tse kiang bei Lamda, obwohl auch sein Wasserspiegel noch immer 2½–3 m unter dem Sommerstand lag. Auf der gegenüberliegenden, linken Talseite schloß sich Dörfchen an Dörfchen, immer acht oder zehn, ganz selten einmal fünfundzwanzig aus Steinstücken erbaute Häuser, die wohlhabend dreinsahen. Dazwischen blitzten im Sonnenschein viele goldene Tempeldächer auf. An einer Verengerung des Tales, auf einem wenig hohen Riegel, der von Süden her das Tal einengte, stießen wir auf drei größere Klöster, eines auf dem linken und zwei auf dem rechten Ufer, für die ich die Namen Niara gomba und Doto gomba in Erfahrung brachte. Zu jedem von ihnen gehören mehrere hundert Insassen.
Ehe wir an das erste dieser Klöster kamen, hatten mich vorbeireitende Mönche ausgespürt. Da Tschang verstand noch die Worte: »Es ist der Fremde, von dem die Kaufleute erzählen, daß er aus Dscherku ndo ausgewiesen worden ist.« – Jetzt führte uns der Weg dicht an den Klostermauern hin. Das wurde zum reinsten Spießrutenlaufen. Auf unserer Straße hagelte es Steine. Die Dschraba der Klöster standen oben auf den Mauern und warfen, was sie nur in die Faust bekamen. Die jüngsten Zöglinge hatten sogar ihre langen Schleudern zur Hand. Ein wahres Wunder war's, daß sie nur die Pferde und das Gepäck trafen. Sie trieben uns dadurch die Tiere zur höchsten Eile an. Im Galopp stoben wir an den Klöstern vorbei, um erst anzuhalten und das Gepäck wieder in Ordnung zu bringen, als wir außerhalb des Bereiches der heimtückischen Schleudern gekommen waren.
Einige Schreier und Johler hatten aber damit ihr Mütchen noch nicht gekühlt. Sie mußten uns bis ans Ufer des Flusses folgen. Als wir darum an einer kleinen Siedlung Fährleute und Lederboote trafen und mit deren Hilfe das andere Ufer gewinnen wollten, wagte wegen dieser Gefolgschaft keiner der Bootsinhaber, die am Ufer standen, sein Boot zu verleihen und mir zu helfen. »Wir fürchten die Rache der Mönche.« – »Geht durch die Furt hier!« setzte einer hinzu und wies nach einem alten Mann, der eben auf seinem Pferde durch den Fluß ritt. Kaum einmal wurde sein Sattelkissen vom Wasser bespült. Er hielt sich an eine schräg über den Fluß laufende Kiesbarre, die nicht allzu schwierig zu finden schien.
Inzwischen sammelten sich hinter mir immer mehr Schreier. Schon schlugen wieder Steine nicht weit von uns auf den Boden. Als deshalb zwei neue Reiter des Weges kamen und ohne Umstände die Furt benutzten, schlossen wir uns rasch an sie an und ritten in langer Linie mit den immer noch achtzehn Stück Einhufern in den trüben Strom. Die Dschraba am Ufer halfen mit ihren Steinen und ihren Verwünschungen fleißig, die stutzenden Tiere und die Hunde ins Wasser treiben. Da man aber im spitzen Winkel über den Fluß setzen mußte, so dauerte der Übergang recht lange. Die kräftige Strömung bespülte eine geraume Weile die Sättel, und die kleineren Tiere wurden sogar noch auf dem Rücken naß. Hinter der Mitte war es, als plötzlich der Dankar-Li laut aufheulte, das Maultier, das er führte, losließ, die Augen schloß, weil es ihm schwindlig wurde, und sich krampfhaft am Sattel festhielt. Durch sein Zetergeschrei scheu geworden, stutzte das Maultier hinter ihm, besann sich mit einem Male eines anderen und suchte auf eigene Faust das Ufer zu gewinnen. Es kam dadurch vor meinen Augen von der Barre herunter und in tieferes Wasser hinein. Einen Augenblick, und es bricht mit der Vorderhand ein. Ein Strudel packt es. Noch sehen wir eine Kiste über Wasser, jetzt ein Paar Hufe, dann hatten die gurgelnden grausamen Wogen des Dsa tschü das Tier für immer umklammert und verschlungen. Gleichzeitig war damit ein beträchtlicher Teil meines Reisesilbers untergegangen, Zehrgeld für Monate und viele Pläne waren weggespült samt zweihundertdreißig Vogelbälgen und fünfzig Gesteinsproben und Versteinerungen. Die Lasten zweier anderer Maultiere, die ich noch zurückhalten konnte, die übrigen Vogelbälge, die Bücher und anderes wurden in völlig durchweichtem Zustand aufgefischt.
Wir schlugen nicht fern von der Furt am linken Ufer des Flusses das Lager auf. Da die Dschraba uns nicht gefolgt waren, so fand sich dort leicht ein Bootsmann, der mit seinem Lederboot nach der verlorenen Last fahnden wollte. Als der letzte Dschraba drüben verschwunden war, fürchteten auch die Schiffer dort nichts mehr und suchten mit Stangen und Haken nach den verlorenen Kisten – doch vergebens. Der Strom war zu reißend und das Wasser infolge des Regens der letzten Nacht zu trüb. Der Dsa tschü gab nichts mehr heraus.
Ich blieb bis zum Morgen des 14. April an dem Platz. Wir lagen ganz dicht an der Hauptstraße. Vom frühesten Morgen an zogen die Karawanen an mir vorüber, bald Yaktrupps, die in dicken Klumpen und mit den Hörnern um sich stoßend vorwärtstrampelten, bald endlose Maulesel- und auch Eselzüge, immer einer hinter dem anderen und geordnet dem Leittier nachzackelnd. Alle Einhufer gingen auch hier ohne Eisen und nicht einmal vorne beschlagen.
Erstaunlich viele Lamen kamen vorbei. Die meisten gingen zu Fuß. Nur diejenigen mit dem »scha ser«, dem Goldhut, auf dem Kopf saßen hoch und stolz zu Roß. Eine Gesellschaft von fünfundzwanzig Stück Akka besuchte ein größeres Landhaus, das nicht weit von meinem Zelt stand, und hielt daselbst einen großen Gottesdienst mit Trommeln und Trompeten ab, der erst spät in der Nacht endigte. Nie mehr habe ich so viele Nonnen zu Gesicht bekommen wie an diesem Tage. Sie gingen wie die Mönche in der Regel zu Fuß, denn sie waren wie jene ortsansässig und hatten nur zum Zweck der Seelensorge an Kranken oder Toten und zur Bekämpfung der Gespenster ihre Klosterpforten verlassen. Ihre Kleidung glich so täuschend der der Mönche, daß ich viele Nonnen nur an der Stimme als solche erkannte. Sie trugen auf der Straße den dunkelroten Unterrock (mtang gos), die gleichfalls dunkelrote Wollweste (btschong gag), die lange Priestertoga, san (gzan), sie hatten auch die Haare rasiert und zeichneten sich im übrigen nur durch etwas größere Reinlichkeit vor ihren männlichen Kollegen aus, wie sie auch auffallend viel sauberer und hellhäutiger aussahen als die Laienfrauen.
Während des ganzen Tages wurden wir von Bettlern, Pilgern, Nonnen und Mönchen überlaufen, und da auch respektable Leute unter den Besuchern waren, brodelte unser Teekessel ohne Unterlaß. Durch diese Gäste erfuhren wir, daß wir nur wenige Li vom Hauptort der Horba-Staaten, Hor Gantse, entfernt waren. Die Kunde vom Kommen des »Pelang« war aber mittlerweile auch bis dorthin und in die Klöster gedrungen, und am zweiten Abend kam ein Mann in roter Reitjacke, mit zwei Pistolen im Gürtel, und als Zeichen seiner hohen Würde mit zwei feuerroten Quasten an der Brust des Pferdes, auf mich zugeritten, schickte mir seine rote Visitenkarte ins Zelt und stellte sich mir mit einem »guei«, mit dem mandschurischen Gruße, als Lu ming yang Tsung ye, den chinesischen Platzleutnant von Hor Gantse go vor. Er besuchte mich in Begleitung seines Dolmetschers und zweier berittenen Soldaten von der Se tschuan-er Ebene, um mich bei allen guten Regungen meines Herzens zu beschwören, nicht nach der Stadt Gantse zu gehen. Die Mönche sollten bereits einen Auflauf gemacht und beschlossen haben, mich mit Gewalt zu vertreiben. Lu Tsung ye's Plan war darum, mich bei Nacht und Nebel am Kloster vorbeizuführen. Als ich hierauf nicht sogleich einging, stand er am nächsten Morgen schon vor Sonnenaufgang wieder an meiner Zelttür.
»Geh nicht nach Gantse«, wiederholte er wieder und wieder. »Was sollen wir machen, wenn die Mönche ernstlich angreifen?«
»Sie werden es nicht wagen und werden nur drohen.«
»Sie greifen an. Es sind Horba-Mönche, die bekannt sind für ihre Streitlust. Ihr seid fünf Mann, und wir sind acht (ein Leutnant, ein Tung sche und sechs Soldaten). Wir haben nur Musketen, während die Lama weit über tausend kampffähige Mönche haben und viele moderne Repetiergewehre besitzen. Ja,« fügte er hinzu, »hätte ich zweihundertfünfzig Mann mit modernen Gewehren, dann könnte ich hier kommandieren. Da mir aber von den eigentlich fünfzig Soldaten nur zehn gelassen sind (vier hatte er anscheinend selbst in die Tasche geschoben und ›gegessen‹), so bin ich selbst hier nur geduldet und nicht viel besser daran als du.«
Da ich sowieso wenig Hoffnung hatte, die Klöster in Gantse besichtigen und studieren zu können, so fügte ich mich dem Chinesen und ritt auf der geraden Straße im Süden an Gantse vorbei.
Zuerst kamen wir an einem festen Herrensitz der Familie Mazar Tuse vorüber, dann tauchte bald linker, bald rechter Hand ein größerer Bau nach dem anderen auf. »Hier verbringt die Familie Mazar ihre Sommermonate, dort wohnt ein Vetter von ihr. Drüben wohnt zu gewissen Zeiten der Hutukhtu des großen Klosters Lhaba gomba«, erklärte mir mein Cicerone und Leutnant, der in rührendster Weise den ganzen Tag nicht von meiner Seite wich und fast alle meine Seitensprünge begleitete. Auf einem Bergvorsprung im Osten des Tals zeigte er eine größere Lamaserei der Gelugba-Sekte, die angeblich ein chinesisches Heiligtum der Tang-Zeit gewesen und von einer der chinesischen Prinzessinnen gegründet worden war, die an einen tibetischen König verheiratet wurde. Das Bild der Prinzessin und ihres Ministers werde noch heute gezeigt und hoch verehrt, erzählte mir Lu ming yang. Ob es in Wirklichkeit nicht doch nur ein Tara-Bild und also eine der gewöhnlichen Darstellungen der Wen tscheng, der chinesischen Gemahlin des tibetischen Kaisers Srong bstan sgam bo (chin.: Tschi tsung lung tsan), der Tochter des Kaisers Tai tsung (627–650) aus der Tang-Dynastie war, sowie den Minister Gar gdon btsan darstellte, konnte ich leider nicht herausbringen. Die Heirat der Wen tscheng (Wen tschun) hatte ums Jahr 636 stattgefunden. Die Soldaten nannten sie mir Tschou tschun nian̂g nian̂g und behaupteten, das Bild sei das älteste, das von ihr existiere; es trägt in der Mitte der Stirn, auf den Handflächen und in den Fußsohlen Augen Auf solchen Abbildungen der Tara sehen diese Augen immer schmal und geschlitzt aus, so daß sie Wundmalen der Christusbilder ähneln..
Allmählich wurden die drei großen Gantse-Klöster selbst sichtbar. Sie liegen wenig mehr als 1 km im Norden von der Straße und ziehen sich amphitheatralisch an einer nach Osten und Südosten gerichteten Berglehne hinauf. Ihr Name ist Tsen (?) gom und Lhaba (?) gom. Unten am Berg und dicht außerhalb von den hohen Klostermauern liegt der Marktort Gantse, der höchstens zwei- bis dreihundert Häuser umfassen kann Nach Ansicht der Einheimischen hatte hier König Gesar seine Heimat – freilich, wo in Tibet soll der nicht gewesen sein?. Als ich auf einem Seitensprung bis nahe an den Ort heranritt, fielen mir innerhalb der Klosterumfassung viele Hutukhtu-Häuser auf. Lu ming yang zählte mir sechzehn Inkarnationen her, die alle hier ein Haus besitzen sollen. Unten im Dorfe aber heben sich besonders zwei Gebäudekomplexe durch ihren Umfang und ihre Vielstöckigkeit heraus, der »pobrang« des Kungsar- und der »pobrang« des Mazar-Tu se, die Burgen der beiden Fürstenfamilien, die das Land hier herum beherrschen. Neben den weit und hoch am steilen Berg hinaufgreifenden Lamawohnungen nimmt sich aber alles Profane klein und höchst unwichtig aus. Schon die Bauweise zeigt, daß hier die Mönche die tatsächlichen Herren sind, und zwar ist es hier der Orden der »Tugendsamen«, der Gelugba. Die Gassen scheinen alle eng zu sein, und selbst der Ya men der chinesischen Regierung, sowie das Haus des Gesandten der Lhasa-Regierung sind schlecht zu finden. Außer Tibetern (Kaufleuten und Bauern) wohnen in den Laienhäusern noch über hundert Chinesen, von denen aber die wenigsten begütert sind. Wer von den Chinesen Handel treibt, ist meist nur Agent, und die Mehrzahl gehört dem von den Tibetern für erniedrigend angesehenen Schmiede- oder Tischlergewerbe an, besteht gar aus Lederarbeitern oder betreibt das gänzlich verachtete Handwerk des Metzgers, dessen Kinder wie die des Schmieds in kein Kloster als Novizen aufgenommen werden Da alles Töten und Schlachten als Sünde angesehen wird, so ist unter dem herrschenden buddhistischen Einfluß das Schlachten zu einem wichtigen Gewerbe geworden. Man ladet den Schlächter von Hof zu Hof. Der Schlächter spielt aber in vielen Teilen Tibets die Rolle des Henkers im deutschen Mittelalter. Er ist unrein. Er darf kein Kloster betreten und muß sich vor den Lama und Inkarnationen verstecken, wenn er ihnen auf der Straße begegnet. Die Lama sagen, er könne nicht beten, denn sein Glaube sitze nur oberflächlich, da er so viele große Sünden begehe..
Das Land Hor, einstmals und lange Zeit in einer Hand vereinigt, ist heute von Grafen oder Herzogen – oder wie man sie im Vergleich mit alten deutschen Verhältnissen nennen will – beherrscht. Man spricht von »Hor ka nga schok«, dem Land der fünf Hor-Geschlechter, denn ungefähr fünf Adelsfamilien schalten und walten in dieser Gegend als angestammte und erbliche Herren. Das Oberhaupt jeder Familie führt den tibetischen Titel »Deba« oder »Denggu« (sde hgo?) und wird von den Chinesen Tu se (eingeborener Fürst und Beamter) genannt. Beri (Berin) Tu se, Tsa Tu se, Tunggo Tu se, Kungsar und Mazar Tu se, Tschuwo und Tschanggu Tu se sind ihre Namen. Die Gebiete, die die einzelnen beherrschen, bilden aber meist keinen zusammenhängenden Besitz, sondern diese und jene Gemarkung, dies und jenes Gut, Kloster oder Dorf gehört immer dem einen oder anderen Adelsgeschlecht, hat ihm Kriegsdienste zu leisten und Steuern und namentlich Fronen zu entrichten. Der Beri Tu se hat seinen Sitz zu oberst im Horba-Dsa tschü-Tale. Er ist zurzeit der kleinste und schwächste mit etwa sechshundert und einigen Familien als Volk. Noch nicht tausend Familien besitzt der Tsa Tu se, der nördlich des Beri und nördlich des Dsa tschü sein Volk wohnen hat. Die bedeutendsten Adelsgeschlechter sind die der Kungsar und der Mazar. Ihre Hauptmacht liegt im Hor Gantse-Becken, während Tunggo, Tschuwo und Tschanggu zum überwiegenden Teile im Da tschü-Tale liegen. Die Kungsar und die Mazar sind einmal vereint, sehr oft aber miteinander verfeindet. Als sie 1755 einen großen Streit miteinander angefangen hatten, in den alle Nachbarstaaten wegen ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen hineingezogen worden waren, wurde die chinesische Garnison in Hor Gantse eingerichtet. Die Fürsten von Dergi, von Ober- und Mittel-Tschantui, von rGechitsa und Ming tscheng hatten für Kungsar, die großen Dyalbo von Rardan und Tschoskiab hatten für Mazar Partei ergriffen, ganz Osttibet war dadurch in zwei feindliche Lager gespalten und hatte sich bereits großen Schaden zugefügt, als es einem chinesischen Offizier, gestützt auf ein kleines Truppenaufgebot, gelang, die Parteien in Gantse zu einem Friedensvertrag zu bewegen, der beschworen wurde, in dem die Schwörenden sich Bände des Kandyur auf den Kopf legten. Als Schutzwache des rings von Feinden umgebenen Mazar Tu se setzte sich damals die chinesische Garnison in Gantse fest Das Horba-Land ist 1636 durch die Eroberungszüge des Mongolen Guschri Khan zur Gelugba-Sekte bekehrt worden. Lange Zeit wehrte sich hier der alte Adel gegen die gefährlichen Neuerer mit ihrem strengen und demokratisierenden Kult. Die Kämpfe der Fürstenfamilien Kungsar (oder Kungser) und Mazar gegen die Gelugba-Mönche sind sprichwörtlich geworden; es ist sogar eine Art »Festungsspiel«, das alt und jung in Osttibet kennt, danach »Kungser« betitelt worden. In diesem Kungserspiel – die Firma O. & M. Haußer in Ludwigsburg hat es seither in den Handel gebracht – werden zwei Könige von drei- oder vierundzwanzig Mönchssoldaten in die Enge getrieben. Die beiden Könige wehren sich mit blutiger Hand, während die Mönche als strenge Buddhisten nur durch Winkelzüge die Könige mattzusetzen suchen. Die Tibeter malen sich ihren Spielplan nur in den Sand oder auf einen flachen Stein, sie setzen aber als Gewinn oft erstaunlich hohe Preise aus., Einige Teile des Horba-Distrikts standen zur Zeit meiner Reise mehr unter ihren angestammten Herrschern. Im Jahre 1883 waren die fünf großen Tu se wegen einer Heirat miteinander uneins geworden und hatten den Chinesen Gelegenheit geboten, sich in ihre Streitigkeiten einzumischen und in der Folge bei ihnen einzunisten.
Kurz nach Mittag hatten wir mit dem Leutnant und seinem Gefolge den Ort Puilung erreicht. Ärmliche Steinhäuser, in denen Kätner wohnten, umgaben ein stattliches Herrenhaus. Der Platz war früher im Besitz der Mazar Tu se gewesen, und ein Vogt dieser Familie hatte hier seinen ständigen Sitz gehabt. Im Verlauf der letzten Streitigkeiten wurde die Markung Puilung an die Chinesen abgegeben, und die Bewohner zahlen nun Kopfsteuer und einen Zehnten an den nächsten chinesischen Mandarin. Das Herrenhaus diente nur noch als Unterkunft für vornehme Reisende.
Es ist der Typus eines »pobrang« von Hor. Um das ganze Anwesen läuft eine Mauer mit einem starken Tor. Das Haus selbst ist zweistöckig und hat vier Flügel, die einen Innenhof umschließen, der ein längliches Viereck bildet. Das Erdgeschoß zeigt nach außen eine massive, aus Steinstücken und Löß zusammengekittete Mauer. Der zweite Stock, der allein Wohnräume enthält, ruht nach innen zu auf einem Wald von Holzsäulen und ist selbst aus schweren Fichtenbalken gefügt. Das Dach ist wie bei allen Profanbauten der Gegend horizontal und lehmgedeckt.
Der Raum zu ebener Erde dient als Stall. Von hier führt im Innern eine bequeme Holztreppe auf einen breiten, halb offenen Umgang im zweiten Stock mit dem Blick auf den Innenhof. Von diesem Umgang gelangt man in die zahlreichen Wohngelasse. Schiebetüren aus dunklem Fichtenholz verbinden einzelne Zimmer. Die getäfelten Wände und Decken der Staatszimmer zieren Blumenranken und halbstilisierte Bilder vom Yak, von Fasanen und anderem Jagdwild. In leuchtenden Farben heben sie sich aus dem braunroten Grunde.
Die lange Zimmerflucht steht heute größtenteils leer. Nur einige ganz niedere Holzbänke und ein paar Schreine und bronzene Kohlenbecken bilden den Hausrat. Die großen Fensteröffnungen sind durch Holzladen verschlossen. Nirgends war natürlich eine Glasscheibe zu entdecken, ja, wie weiter oben in den Häusern von Dergi und Dscherku, so fehlte auch hier noch überall das chinesische Papierfenster. Kommt ein Regenschauer, so schließt man die Holzladen und wartet im Halbdunkel dahinter.
Von den Fenstern meines Zimmers bot sich mir eine entzückende Aussicht auf die Zinken und Zackengrate des Ito re und heiligen Kalo re und anderer wildzerzauster Felsgipfel, die mit alpiner Pracht, mit schimmernden Firnfeldern und blauem Gletschereis das Dsa tschü-Tal im Süden einsäumen. In der halben Höhe dieser Berge zeigten sich Waldschluchten, und davor breiteten sich die eben keimenden Felder und die reinlich weißgetünchten Häusergruppen der Bauern aus.
Da ich durch Leutnant Lu in Puilung eingeführt wurde, so waren alle Dörfler äußerst zuvorkommend gegen mich. Jeder meiner Wünsche wurde mit einem demütig klingenden »Lā so! lā so!« entgegengenommen und in kürzester Frist erfüllt. Anders aber dachte mein Da Tschang. Als Lu gegangen war, erklärte er, von jetzt an bei nichts anderem mir helfen zu können als allein beim Einkauf von Stroh und Lebensmitteln. Da ich dies aber selbst und billiger tun konnte und wenig Lust hatte, dafür allein einen Mann beritten zu machen und höher zu bezahlen als andere, so hielt ich es für einen guten Witz, lächelte als Antwort und schrieb an meinem Tagebuch weiter. Er aber wurde grob und, als ich mir seine Worte verbat, sogar angriffslustig. Wütend stampfte er mit seinen dreifach gesohlten Dankar-Stiefeln auf meine Zehen und verlangte umgehend die schriftliche Zusicherung der Erfüllung seines Wunsches, und ehe ich mich von meinem Sitze erheben konnte, packte er mich am Rockkragen und zückte ein Messer. Nur meiner überlegenen Kraft habe ich es zu verdanken, daß ich den großen Mann noch abschütteln konnte, ohne Schaden zu nehmen. Ein Tibeter hörte uns in diesem Augenblick und wand ihm das Messer aus der Faust. Eine Weile darauf kam Li in mein Zimmer und fragte an, ob Da Tschang gehen könne. Ruhig und gelassen sah ich den stattlichen Kerl nach meiner zustimmenden Antwort aus dem Hoftor marschieren. Wenige Minuten später sah ich ihn auf einem fremden Pferde in der Richtung nach Gantse traben. Es war das letzte, was ich von ihm sah. Alles spielte sich so schnell ab, daß ich zuerst glaubte, der Mann sei plötzlich verrückt geworden, und bedauerte, ihn ganz allein in dem wilden Lande ziehen lassen zu müssen.
Am anderen Mittag trafen zwei chinesische Soldaten aus Gantse bei mir in Puilung ein, die der Tsung ye als Eskorte versprochen hatte. Sie erzählten, mein Dolmetscher habe ihnen noch ein »ping ngan«, d. h. seine Wünsche, ich solle in Frieden ziehen, aufgetragen, ehe er sein Ula-Pferd nach Dscherku bestiegen habe. Erst jetzt, wurde mir die Sache etwas verständlich. Da Tschang mußte, koste es, was es wolle, nach Dscherku zurück. Er hatte sich dem Tsung ye insgeheim als der Ya men-Dolmetscher aus Hsi ning fu, der in meinem Paß erwähnt war, vorgestellt und als solcher auch Ula, d. h. ein freies Reitpferd bis Dscherku ndo verlangt und erhalten. Sein Gehalt hatte er ja schon, dazu Vorschuß für anderthalb Monate. Obendrein stellte es sich nach seinem Weggange heraus, daß er eine Reihe kleinerer Gegenstände mitgenommen hatte. Er wollte eben mit dem Dienen Schluß machen und löste seinen schriftlichen Vertrag auf seine Weise. Es ist ein knorriges und wildes Holz, aus dem diese Hsi ning-er und Bayan rung-er Grenzleute geschnitzt sind. Da Tschangs Worte deckten sieh nie mit seinen Gedanken. Oft sagte er zu mir: »Ein kluger Mann spricht nie die Wahrheit!« Zweieinhalb Jahre später erfuhr ich zufällig, daß Da Tschang sich lustig und guter Dinge in seiner Heimat herumtreibe. Er hatte sich eine neue tibetische Squaw aus Dscherku ndo mitgebracht.
Die große Teestraße nach Ta tsien lu verläßt bei Puilung wieder das Dsa tschü-Tal, um das nächste, östlich folgende Parallellängstal aufzusuchen. Ein sanfter Anstieg führt von Puilung (3425 m) zu dem nächsten, nur 4050 m hohen Paß. Nach wenigen Stunden war er überschritten, und wir standen am Da tschü, der, kleiner als der Dsa tschü, etwa unserem schwäbischen unteren Neckar in der Größe vergleichbar, aus dem Nordwesten herkommt und auch seine große Talrinne nirgends ausfüllt. Ehe wir an seinem Ufer waren, sahen wir auf der linken Seite Kloster Dyoro, das, wie die übrigen Klöster der Gegend, von einer festen Mauer umgeben ist und inmitten zahlreicher Priesterhäuser – es sollen vierhundert Mönche zum Kloster gehören – ein kleines hübsches Tempelchen und Bethaus zeigt. Die Klosterfront geht der Regel nach gegen Ost und zeigt auf einen See zu, so dem Spruche genügend: »rgyal re brag dang, mdun re mtsʿo«, gelehnt an die steile Bergwand und einen lieblichen See zu Füßen.
Der See ist 1000 m lang und 400 m breit und fast rechteckig. Die Ufer sind öde. Erst in ziemlicher Entfernung vom Kloster stehen Bauernhöfe. Lamapriester fördern nicht die allgemeine Kultur und den Anbau des Landes, wie die christlichen Mönche im europäischen Mittelalter es taten. Sie ziehen nie als Lehrer und Leiter des Volks in die Wildnis, wie etwa einst die Zisterzienser. Ihre großen Geister und am meisten bewunderten Männer treiben nur die »Unregsamkeit«, das »wu wei«, das schon viele Jahrhunderte vor Beginn unserer Zeitrechnung in den klassischen Büchern der Chinesen gelehrt wird; sie gehen einzig darauf aus, ihre eigenen Leidenschaften zu bekämpfen. Die Klöster aber liegen immer nur da, wo bereits eine Kultur geschaffen ist. In ihrer Umgebung liegen keine Teiche mit fetten Karpfen, keine Gemüsegärten, keine Beete mit feinen Erdbeeren, sogenannten »Pröpstlingen«. Um die Klöster herum ist nur ausnahmsweise angebautes Land. Nie geht ein lamaistischer Mönch mit gutem Beispiel im Bebauen des Landes voran. Die großen Klöster besitzen zwar immer Ländereien und oft ganz enorme Güter, aber diese sind vollständig an Bauern verpachtet, die dem Pater Ökonom des Klosters ihre Abgaben machen müssen. Die Mönche machen im übrigen Geldgeschäfte, indem sie Bargeld gegen 12–20 Prozent Zinsen ausleihen.
Ein Hügelzug trennt Dyoro gomba vom heutigen Da tschü-Lauf, so daß es vor dem Blick auf das strömende Wasser geborgen ist. Dies ist für die gedeihliche Entwicklung der heiligen Stätte dringend vonnöten, denn die reißenden Fluten würden alles Glück, alles Gute und Heilige, das die Mönchsgebete in den tagelangen Andachten schaffen, wieder mit fortschwemmen!
Wir erreichten am gleichen Tage noch Schloß Tschuwo (Tschuobo), das neben einem kleinen Dörfchen und einem kleinen Kloster fünf Stockwerke hoch und dräuend wie ein altdeutsches Raubritternest auf das Tal herniederschaut. Da im Jahr zuvor ein Hochwasser die Brücke fortgespült hatte, die sich dicht dabei, ein Felstor benutzend, über den Fluß spannte, so mußten wir durch den Fluß furten. Das Wasser reichte den Tieren an einer geeigneten Stelle bis an den Bauch, aber ein Tier stolperte in der Mitte des Flusses über unsichtbare Blöcke, und zweihundert exponierte photographische Platten und dreihundert unexponierte verdarben bei diesem Unglücksfall neben einigen hundert Jagdpatronen.
Ohne ein unnützes Wort zu verlieren, quartierten mich meine Soldaten in einem großen Hause dicht unterhalb der Burg ein. Ein Lama brachte ebenso, ohne lange zu fragen, Stroh für die hungrigen Tiere, eine Frau tauchte aus einer schwarzen Ecke auf, steckte eine Specklampe an, machte Feuer und kochte, was wir nur haben wollten. Es waren große dunkle, von Fett und Ruß schwarz glänzende Räume, die ich bezogen hatte. Einem Reisenden, der vom Tiefland herkam – es braucht nicht gleich die Küste und Europa sein – würden sie vielleicht ein gelindes Grausen eingejagt haben, mir, der ich aus dem Innern kam, war darin so wundersam wohlig zumute wie lange nicht mehr. Dazu goß es draußen alle Augenblicke in Strömen vom Himmel; denn die Monsunzeit hatte jetzt eingesetzt.
Im Tschuwo-er Schloß residierten nur zwei Lama. Sie waren äußerst zurückhaltend, aber natürlich nicht mehr feindlich. Wir tauschten Khádar und kleine Gaben aus.
Die Chinesen hatten einen Reiter mit einem Schwert und einer Lanze als Gendarmen und Aufpasser in den Ort gelegt. Seine Schußwaffen bewahrte ihm sein Vorgesetzter, der Oberst in Ta tsien lu, auf. Auch die Schußwaffen der kleinen Garnison Gantse blieben in Ta tsien lu in Verwahrung, da sie dort »sicherer« waren als auf den Außenposten.
Nachdem wir am 16. April eine Wegstunde hinter Tschuwo noch einmal den Fluß in einer Furt durchritten hatten, saß der Sekretär des Lu ho tenn kwan, des Mandarins Wu tschin hsü von Tschanggu, am Wege und wartete auf mich. Er war auf die Meldung des Gantse-Leutnants abgesandt worden. Er kam in Begleitung von vier, mit ausrangierten deutschen Magazingewehren bewaffneten Kavalleristen und einer ganzen Schar tibetischer Reiter und überreichte mir eine überaus höflich abgefaßte Einladung nach dem Ya men in Tschanggu. Mit mir zusammen waren zwei chinesische Soldaten von Gantse und sechs tibetische Reiter gekommen. Durch die neue Verstärkung bekam mein Geleite einen geradezu pompösen Anstrich. Alle Soldaten waren gut beritten. Sie trugen saubere, nirgends zerschlissene Jacken in roter und blauer Farbe. Der Sekretär hatte ganz »à la Tibetan« ein großes silbernes Gehänge wie ein Bandelier um die Schulter geschlungen, an dem er seinen Leibgott und Schutzengel herumtrug. Die eingeborenen Reiter, teils Da tschü-Täler, teils Verbannte aus dem Tschantui-Tale, mit ihren dicken Frisuren, dem wulstigen Vollkopfzopf, der einige Male um den Kopf geschlungen und an der linken Seite durch einen Elfenbeinring festgehalten wurde, mit ihrem überreichen Leopardenbesatz an Sätteln und Röcken boten ein herzerfrischendes Bild. Ich in meinem abgeschabten Pelz mit meiner zusammengeschrumpften Herde von kläglichen Rosinanten kam mir daneben nicht einmal mehr wie ein Strauchritter, sondern nur noch wie ein Vagabund und Bettler vor.
Das Da tschü-Tal – ich hörte auch den Namen Tschuwo tschü – zieht in Südostrichtung und immer kerzengeradeaus, immer dem Streichen der auch hier wiederum steil, ja meist vertikal aneinandergepreßten Sandsteinplatten folgend. Die alte Straße mit ihren vielen, vielen Löchern und Steintrümmern hält sich auch weiterhin auf der rechten Talseite. Schnurgeradeaus wie der Tallauf eilt sie auf ihr Ziel zu. Nur der trübe Fluß windet sich zwischen den um 1000 m über das Tal aufsteigenden Gipfeln hin und her, bald an der linken, bald an der rechten Talseite Anstoß nehmend, bald hier, bald dort ergrimmt aufbrausend; einmal eingeklemmt zwischen Schuttkegeln und Trümmern, die ihm von den Seitenbächen in den Weg geworfen werden, dann verengt durch vorspringende Felsterrassen aus harten Gesteinsplatten, ist er auf ein enges »Tal im Tale« beschränkt. Auf den Talterrassen über ihm machen sich Felder und Höfe breit, und Büsche und Hecken scheiden die einzelnen Äcker. Der Pflanzenwuchs – Mitte April freilich auch hier im Süden (in der Breite von Unterägypten) noch immer im Winterschlaf – war, entsprechend der geringeren Höhenlage von 3500–3300 m, reich, ja üppig, verglichen mit dem, was ich kurz zuvor durchmessen hatte. Die nach Süden abdachenden Talseiten bekleideten dichte Grasweiden bis fast zu den Gipfeln hinauf. Alle nach Norden gerichteten Talwände aber deckten finstere Fichtenhochwälder mit wildem und wirrem Unterholz, herrliche Schlupfwinkel für kleine und große Buschklepper, so daß ich froh war, hier die Chinesen als wirkliche Herren zu wissen. Nach den langen Ritten, die ich mit der gespannten Büchse im Arm gemacht hatte, fühlte ich mich wie in Abrahams Schoß geborgen.
Scharf geschnittene Waldschluchten führen vom Wege aus nach Süden. Durch alle größeren winden sich Pfade ins parallele Dsa tschü-Tal zu den Tschantui. »Vor zwei Jahren noch, ehe unser jetziger ›da jen‹ nach Hor Tschanggu kam, konnte man nicht so ruhig auf dieser Straße reisen«, belehrten mich die Soldaten. »Die Tschantui vom Süden und die Khorgan und Loko vom Norden überfielen jeden Warenzug. Jeden Monat gab es Tote. Aber Wu da jen hat eine eigene Miliz begründet, hat überall Agenten und einheimische Wachen aufgestellt, die jede Annäherung verdächtigen Gesindels durch Feuer- und Rauchzeichen melden. Weder die Tschantui noch die ngGolokh-Khorgan wagen mehr einen Handstreich.« Wie ich freilich ein anderes Mal erfuhr, war seit dem letzten größeren Überfall noch nicht ganz ein Jahr verflossen. Siebenzig Maultiere waren damals samt ihren Lasten ins ngGolokh-Land weggetrieben worden. Nicht bloß die Khorgan, durch deren Land ich 1904 gekommen war, sondern auch die Ngaba-Räuber waren hier wohlbekannt.
Am 16. April kehrte ich in Gendu ein, einem Dörfchen, das – wie in seinem Namen ausgedrückt ist – an der Mündung des Gen tschü liegt. Der Ort liegt 40 m hoch über dem Fluß auf einer Terrasse, die Raum für einige hundert Meter breite Gersten- und Weizenfelder läßt. Die Tibeter pflügten gerade. Sie hatten zwei Yakbastarde vor den Pflug gespannt. Sie gebrauchten dabei aber nicht das chinesische kleine Kummet und den Schulterzug ihrer Tiere, sondern hatten die beiden Tiere gemeinsam in ein hinter den Hörnern durchlaufendes Joch gezwungen, woran das sehr schwere und plumpe Pfluggestell angehängt war. Die Pflugschar allein war aus Eisen. Sie war nach der üblichen nordchinesischen Art klein, lanzettförmig, 12 cm breit und ritzte in horizontaler Lage den Boden. Da diese Pflüge ursprünglich wohl nur für leichte Lößböden berechnet waren, so ist der Vertikalarm, an dessen Spitze die Pflugschar aufgesteckt wird, bei den tibetischen Pflügen für die schwereren Böden unverhältnismäßig schwer und bis 30 cm dick geworden. Aber auch so wird nie tief gepflügt.
Das Erscheinen des Ya men-Sekretärs hatte meine Hsi ning-Leute wie verwandelt. In Gendu angekommen, hoben sie mich wie ein Ei ohne Schale vom Pferde, griffen mir unter die Arme, als könnte ich ungestützt keinen Schritt mehr tun und schleppten mich dienstbeflissen die breite Holztreppe hinauf in den Raum, wo mir der Sekretär Quartier besorgt hatte. In der Erinnerung an das Ungemach der letzten Monate machte es mir ein großes Vergnügen, die Augendiener jetzt wenigstens mein ganzes Körpergewicht fühlen zu lassen. Keiner wagte darüber zu stöhnen.
Auch in Gendu sind die Bauernhöfe mehrstöckig. Zwischen den Holzstützen des Erdgeschosses werden die Tiere festgebunden. Im zweiten Stock liegen die Wohngelasse, im dritten die luftigen Vorratsräume für Stroh und Kuhdung, sowie allerlei heilige Gegenstände für die Gottesverehrung. Auch werden Erbsen und Körnerfrüchte dort oben aufbewahrt. Die lehmgestampften ebenen Dächer dienen als Tennen, auf denen mit Dreschflegeln die Frucht ausgedroschen wird. Seit Ka tsʿa sah ich die Bauern an jedem windigen Tage auf ihren Dächern ihre Körnerfrüchte reinigen. Sie schütteten sie aus Körben auf ihre Dachtenne und überließen es dem Winde, die Spreu fortzuschaffen, eine Arbeit, die nicht anstrengend, sondern für faule Leute geschaffen ist. Daher besorgten sie auch mit Vorliebe die tibetischen Männer.
Das Quartier zu Gendu hatte auch wieder einen viereckigen und offenen Lichthof in der Mitte des Hauses. Nach ihm zu sahen im ersten Stock Veranden aus Holz, von denen man in die Zimmer gelangt. Nach außen hatte man Fensteröffnungen möglichst vermieden, so daß das Haus gleichzeitig eine kleine Festung vorstellte. Die Bauart erinnerte mich lebhaft an meine früheren Erlebnisse und Abenteuer in den albanesischen Hausburgen.
Die Verehrung der Götter und Geister nimmt auch in Gendu einen sehr breiten Raum ein. Neben kleinen Weihrauchöfchen, die sich einzelne Knechte und die Kinder gebaut hatten, stand auf der Veranda vor meinem Zimmer ein großer Lehmofen, in der Form an eine Tope erinnernd, in dem ein alter Hauslama Wacholder brannte. Auf dem Dache flatterten Gebetsfahnen an vielen Masten. Über dem Hauseingang hingen die Symbole und Zeichen der großen lamaistischen Schutzgeister, grinste die Fratze einer scheußlichen Lhamo, pendelten im Winde Lanzenspitzen und Dolche, Bannsprüche, mit Stroh vollgestopfte Bälge von Hasen, Wildschweinen und Wildhühnern. Auf der Treppe wie am Eingang hingen und standen Stein- und Holzplatten mit eingekratzten Gebeten. Gebetmühlen von 1 m Höhe zogen sich am Treppengeländer entlang, die jeder in Schwung brachte, der hier auf- und abstieg. In den spinnweberfüllten Nischen standen da und dort große Lehm-Tsʿatsʿa und in den pechschwarzen Ecken baumelten mit Gebeten beschriebene Kinnbacken und von alten treuen Haustieren ausgeraufte Mähnenhaare.
Die Straße unterhalb Gendu führte an der Mündung noch mancher großen Waldschlucht vorüber, und viele klare Bäche sprudelten über meinen Weg. Die Mühlen im Grunde der Schluchten, die Fichtenhochwälder, die Felsklippen, die Wiesen und Weiden riefen das Bild friedlicher Schweizer Alpenlandschaften hervor.
Am Spätnachmittag des 17. April erreichte meine Karawane Tschanggu; wir kamen zuerst an das Kloster dieses Namens, dann an das Dorf und endlich an die alte Burg. Alle drei liegen auf dem rechten Ufer, auf einer breiten Terrasse 200 m über dem Fluß, der hier zu einem großen Bogen ausholt. Der Aufstieg auf den Tschanggu-er Berg ist steil. Zweien meiner Pferde ging es über die Kraft. Auf halber Höhe der Steige ließ plötzlich mein alter Reitschimmel den Kopf hängen. Er brachte selbst ohne Sattel kein Bein mehr hoch und kam, nachdem wir ihm Branntwein eingegossen, auch nur taumelnd wieder ins Tsa lung tschü-Tal hinab, wo er in einer Mühle endete. Noch ein zweites Pferd, ein junges Füchslein von Lab gomba, hatte einen schlechten Puls bekommen und war außerstande, den Berg zu erklimmen, doch erholte es sich in der folgenden Nacht wenigstens so weit, daß es mir bis Tschanggu nachgebracht werden konnte, wo ich gerade noch 10 Rupien dafür erhielt. Mit den letzten Kräften erreichte ich also den Ort, wo der erste Verwaltungsbeamte Chinas regierte.
Der Tschanggu-Mandarin hatte den offiziellen Titel »Lu ho tenn hsien«, d. h. Kolonistenbezirk des Lu-Flusses. Er war also zugleich Tung ling, d. h. Offizier. Sein Ya men lag in der alten Tu se-Burg. Er bewohnte darin das fünfte Stockwerk. 3 m hohe Käfiggalgen (mo lung) standen als Schildwachen vor seinem Tor. Schwere Kang-Bretter und Kästchen, wie Vogelbauer anzusehen, statt Kanarienvögel aber abgeschlagene Räuberschädel enthaltend, waren sein Aushängeschild und sagten jedem, daß der hiesige Herr nicht mit sich spaßen lasse.
Hinter den Käfiggalgen hervor kamen rasch zwei Diener, in bunten Samt und in Seide gekleidet, und forderten mich auf, sofort ihren »da lao ye« aufzusuchen. Waren es die grinsenden Totenköpfe, die mir Respekt und unbedingte Folgsamkeit einflößten, oder war es reine Neugierde, den zu sehen, der so derb die »Fan tse« anzufassen wagte? Ich sprach kein Wort, stieg rasch vom Pferd und folgte den vorauseilenden Chinesen. Erst hasteten wir um drei bis vier Ecken, dann ging es nicht weniger rasch eine steile Holztreppe hinauf und noch eine und wieder eine, die immer noch höhere Tritte hatte. Die Soldaten zogen und schoben mich dabei hilfsbereit. Wieder bogen wir um ein Dutzend Ecken, durcheilten ein Labyrinth von Räumen, eine Schule, Dienerwohnungen, Küchen und Soldatenräume, endlich die Zimmer des Mandarins, bis ich, völlig außer Atem, in einem hübsch getäfelten Saal landete und mich »Wu da lao ye« gegenüber sah.
Der »große alte Herr« war ein stattlicher schlanker Mann mit energischen und intelligenten Zügen und klugen Äugchen. Seine fahlgelbe Haut stach grell von dem frischen Braun seiner Knechte ab. Er war einer der modernen Beamten Chinas, einer der Neuzeit, die eben dämmerte, aber er hielt sich doch auch an die alte Sitte und ging deshalb ganz selten aus. Meist zog er nur von seiner Burg aus wie eine Spinne an den verschiedenen Fäden seines Regierungssystems. Er war ein Hankow-Mann und erst zwei Jahre hier. In dieser kurzen Spanne Zeit hatte er es verstanden, mit einem Gefolge von nur fünfzehn chinesischen Angestellten in einem Gebiet so groß wie eine preußische Provinz und so unruhig, wie man es sich nur ausdenken kann, Ruhe und Ordnung einkehren zu lassen und es seinen Landsleuten zu ermöglichen, darin der friedlichen Beschäftigung als Ackersleute nachzugehen. Geht er einmal aus, so ducken sich alle Tibeter, steigen von ihren Pferden und nehmen die Mütze ab wie vor einem heiligen Lama. So etwas haben die Hsi ning-Leute, die so sehr stolz auf sich sind und sich für Helden halten, nie erreicht. Bis nach Dergi bringen seine Soldaten die Befehle, ja, er schlichtet Prozesse zwischen Tibetern bis hinauf nach Tschoktsen und bis in die vom Hsi ninger Amban angeblich beherrschten Gebiete.
Ansprechend, in barscher und doch liebenswürdiger Kürze, begrüßte mich der Mandarin. Er schien als Vertreter Chinas aufrichtig froh zu sein, mich mit heilen Knochen diesseits des Tibeterlandes zu wissen, und ließ deutlich durchblicken, daß, soweit er in Frage komme, kein Europäer an ihm vorbei nach Tibet hineingelange.
Wir sprachen noch miteinander, und der aufmerksame Hausherr bot eigenhändig warme und süße Kakes an, als einige Tibeter meine Kisten und Säcke an der Zimmertür abstellten. Ich wollte mich entschuldigen, daß die Leute aus Versehen meine Sachen in sein Haus getragen hätten, er schnitt mir aber kurz das Wort ab und sagte: »Es sind dies meine Knechte, und sie handeln nach meinem Befehl.« Mit einer Kommandostimme, die mir plötzlich den Ru da lao ye von Kue de ting und das Schicksal Kapitän Watts-Jones' ins Gedächtnis rief, donnerte er mich an: »Du bist mein Gast. Es gibt keinen anderen Platz für dich als ein Zimmer in meiner Burg (tschʿai tse).« Ich war so erschrocken, daß ich mich zuerst nur vorsichtig danach zu erkundigen wagte, ob in China Friede sei, und wie es um das Verhältnis zwischen Europäern und Chinesen stünde.
Wu war aber ein vorzüglicher Gastgeber. Solange ich in seinem Hause wohnte, durften meine Diener nicht für mich kochen. Er lud mich persönlich jeden Morgen und Nachmittag zu seinen zwei Mahlzeiten ein, und drei Tage lang ließ er mich nicht weiterreisen. Als er von meinem Pech beim Übergang über den Dsa tschü erfahren hatte, sandte er Eilboten aus, die noch einmal nach meinen Sachen suchen sollten.
Ich hatte ein großes Zimmer erhalten. Kaum saß ich dort an einem nicht sehr wackeligen Tisch und hoffte, in Ruhe und Frieden arbeiten zu können, da huschte der erste Besuch herein. Die zwei frischen Söhnchen des Mandarins, Jungens von sechs und acht Jahren, hatten wie europäische Knaben mich als interessanten Onkel aufs Korn genommen und legten bis zum letzten Augenblick auf mich Beschlag. Der eine brachte schon das zweite Mal sein Lieblingsspielzeug, einen alten knurrigen Affen, mit, der mit seinen losen Streichen meine Stube nicht ruhiger machte. Die Tibeter hatten ihm den Schwanz abgehackt, was ihn klüger machen sollte. Selbst das Kindermädchen kam mit dem jüngsten Sprößling herbeigeeilt, und sehr bald erschienen auch die Mütter der Kleinen, sechs trippelnde und dick weiß bemalte Chinesinnen mit dreizölligen Lilienfüßen, die der Mandarin aus seiner fernen Heimat Hu pe mit hierhergenommen hatte.
Auch nachts war nicht viel Ruhe in der Burg. Durch eine dünne Bretterwand von mir getrennt, saßen in der nächsten Stube die Soldaten auf Wache und rührten von Schlag neun Uhr an die Wachtrommel. Zu meinem Glück hatte diese ein großes Loch und dröhnte nur dumpf. Alle Stunden etwa wurde ein Schuß abgegeben, der mich unerbittlich aufschreckte. Hatte man sich schließlich an diesen Lärm gewöhnt und lag im süßesten Morgenschlummer, dann begann mit Sonnenaufgang die Chinesenschule gerade gegenüber über dem Innenhof. Dreißig Abcschützen, Chinesen- und Tibeterkinder, lernten dort chinesisches Schreiben und Lesen. Hinten an der Wand stand das Pult des Lehrers, und vor ihm, den Rücken ihm zu und das Gesicht gegen die Tür und damit gegen mich gerichtet, saßen auf niederen Bänken seine Zöglinge und brüllten die alten Weisheitssprüche des Confucius und der anderen großen Philosophen des Altertums aus ihren Fibeln in den Hof hinaus. Der Lehrer gab von hinten acht, daß jeder Schüler brüllte. »Brüllt er nicht, so lernt er nicht, sondern schwatzt oder treibt sonstwie Allotria.«
Den Unterhalt dieser Schule bestreitet der Mandarin. Die Kinder wohnen und essen in der Burg und bringen nur ihre Bettdecke und im Winter ein Kohlenbecken von Hause mit. »Der Unterricht geht nach der neuen westländischen Manier«, sagte mir der Lehrer. Alle Stunden wurde er kurz unterbrochen, und täglich gab's Freiübungen. Wenn der Lehrer den Unterricht beginnen oder unterbrechen wollte, so trommelte er auf einem ausgehöhlten Baumstamm, just wie ein Südseeinsulaner.
Der Mandarin mußte auch das Saatkorn an die chinesischen Einwanderer ausgeben; und weil die letzten Jahre schlechte Ernten geliefert hatten, so hatte er aus Dawo und Romi Tschanggu Tsamba, und aus der Stadt Ya tschou Reis kommen lassen müssen. Alle Kolonisten wären sonst längst wieder nach China heimgekehrt.
Der Mandarin erhebt von den tibetischen Familien neben freien Fuhren (Ula) und Heerfolge noch 2,5 Candareen (Taelcents) im Jahr. Seine Einkünfte sind darum gering, und Wu da lao ye klagte während jeder Mahlzeit zum Reiswein und Reis, daß er bei diesem Amt viel zulegen müsse (angeblich 2000 Tael jährlich).
Der Saal, worin der erste Empfang stattgefunden hatte, war auch unser Speisesaal, wo dem Mandarin, seinem ersten Sekretär, dem Herrn Lehrer und mir aufgetragen wurde. Er war wohl schon in der Tibeterzeit ein Festsaal gewesen. Alle Wände und die Decke trugen auf der Holztäfelung in feurigen Farben gemalte Blumenranken und Jagdszenen. Während der Mahlzeiten wurden Tibeter, die irgend ein Anliegen hatten, hereingelassen. Kaum im Zimmer, warfen sie sich auf den Fußboden, und der chinesische Dolmetscher berichtete an ihrer Statt das Anliegen. Selten wagten die Bittsteller einen Einwurf dazu zu machen. Auf den trocken herausgebrachten Bescheid des Mandarins murmelten sie ein erbärmliches »O lāso! lāso!«, neigten den Kopf, schlossen die Augen, erhoben die Hände, die Handflächen zusammengelegt, zur Stirne und warfen den Kopf aufs neue auf den schmutzigen Fußboden. Solcherart verlief auch die Audienz für die ärmeren tibetischen Adligen, was diese Leute sehr erboste.
Das Dorf Tschanggu legt sich am Rande des Abhangs um das Herrenhaus herum. Viele seiner Häuser lagen in Trümmern, der Rest ist von Chinesen bewohnt. Diese, Kolonisten, die die Mandschu-Regierung hierher verpflanzt hat, haben meist tibetische Frauen, und auch der Baustil ist vollkommen tibetisch. Der Ort sah friedlich, aber häßlich aus. Die Kolonisten hatten Gemüsebeete angelegt, aus denen zerfallene Steintürme aufragten, Zeugen von nicht sehr ferner Kriegszeit und böser Kriegsnot.
Das Kloster Tschanggu ist keine Viertelstunde von der Burg entfernt. Die Tempelgebäude und das Obergeschoß der Priesterwohnungen sind – wie vielfach in Südtibet – aus Holzbalken gezimmert, und alles ist hübsch bunt bemalt. Eine niedere Mauer umschließt die ganze Anlage. Sie scheint mehr zum Schutz von Zucht und Sitte der Insassen zu dienen als zur Verteidigung gegen Angriffe von bewaffneten Feinden. Bei einem Jagdausflug lernte ich zufällig auch noch das Nonnenkloster Tschanggu kennen, das nur wenige Kilometer weiter in einer Seitenschlucht liegt. In ärmlichen Hütten beherbergt es über hundert Nonnen. Keine Golddächer verraten diese Stätte von ferne, keine Mauer schützt die Hütten nach außen. Die Nonnen schienen mir weit schlechtere Geschäfte zu machen als ihre männlichen Kollegen, deren Heiligtum mit goldblitzenden Zieraten und Symbolen beladen ist.
Von Tschanggu nach dem nächsten größeren Ort, nach Dawo, rechnet der Tibeter drei bis vier Reisetage. In Tschanggu hatte ich drei Soldaten mitbekommen. Sie mußten Sold und Vorräte aus Ta tsien lu für Wu holen. Ihnen schlossen sich noch zwei tibetische Adlige mit etwas Troß an, die einen Prozeß vor dem Ting in Ta tsien lu anzustrengen dachten. Ich reiste dadurch sehr angenehm. Am 23. April überschritten wir wiederum den Da tschü, der durch seine vielen Seitenbäche so groß geworden war, daß man auch bei winterlichem Niederwasser nur mit den runden Lederbooten darübersetzt (Tafel XXVII oben). Dann ging es nach Dawo und und über den Heka-Paß.
Jenseits dieses Passes war ich aus dem Lande Hor in das des Ming tscheng Tu se oder des Dschagla (lDschagsla) rgyalbo gekommen. Ich war nun in dem großen Königreiche, das sich durch rechtzeitige Unterwerfung und infolge großer Schmiegsamkeit trotz des drückenden chinesisch-mandschurischen Jochs bis heute erhalten hat, obwohl gerade seine Hauptstadt Ta tsien lu ting zugleich der Schlüssel Chinas für das gesamte Mittel- und Westtibet geworden ist.
Noch inmitten des Weidengürtels unterhalb des Heka-Passes hatte der Ming tscheng-König soeben einen Tiao fang (tibet.: dzong), ein mittelalterliches Fort, fertiggestellt, einen viereckigen, lehmbeworfenen Steinbau, vier Stockwerke hoch und nur mit Schießscharten nach außen, in den er einen seiner adligen Vögte gelegt hatte. Die Umwohner und Soldaten sagten mir, das Fort diene zur Verteidigung bei einem neuen Ansturm der gelben Tschantui-Mönchshorden Die Nia rong oder Tschantui-Leute, die von Gantse aus flußab links und rechts des Dsa tschü sitzen, zu Lhasa gehören und das Zentrum der Gelugba-Brüderschaft in ihrer Gegend bilden, sind seit alters eine Geißel für die ganze Umgebung. Streitbare Krieger und nicht weniger kriegstüchtige Mönche haben in den letzten Jahren immer wahre Kreuzzüge in die benachbarten Länder unternommen, um vor allem den alten Bönbo-Glauben auszurotten und ihrer alleinseligmachenden Lehre mehr Geltung zu verschaffen.. Die Missionare von Ta tsien lu nannten es einen Zufluchtsort des Königs vor der immer anmaßender auftretenden Macht der chinesischen Oberherren. Das neue Fort steht mitten in dem breiten Wannentale wie ein Schildwachhaus, ohne viel Vorteil aus der Bodengestaltung zu ziehen, ein sprechendes Zeugnis für die Kriegsanschauungen seiner Erbauer.
Der Dschagla rgyalbo ist, wie viele kleine Könige Osttibets, in religiösen Dingen konservativ gesinnt. Bei ihm gilt am meisten die Nima-Sekte. Wir finden in seinen Tälern aber auch noch mehrfach Reste der alten Bönbo. Gleich in meinem ersten Quartier in Ming tscheng war ich im Hause eines Bönbo-Obermanns, und nicht weit davon waren mehrere Heiligtümer der Bönbo. Allein wiederholte Einfälle der Tschantui hatten den größten Teil von ihnen im Laufe der letzten Jahrzehnte vernichtet, und allenthalben stieß ich auf Trümmerstätten, auf verbrannte Häuser und Tempel. Die Folge war, daß selbst die Söhne des alten Bönbo-Obermanns, bei dem ich eingekehrt war, sich zum Gelugba-Glauben bekehrt hatten, ihre Gebetmühlen nun wie diese im Sinne unseres Uhrzeigers schwangen und die vielen Zauberdolche und Bönbo-Sprüche, die ich in ihrem Hause sah, nicht mehr hochhielten, sie auch nicht mehr, wie sonst Bönbo tun, vor den Blicken ihrer Frauen verbargen. Der Bönbo-Priester ist in diesen Gegenden nur noch der gefürchtete, aber nicht sehr geachtete Wettermacher und Hagelbeschwörer. Meinem Wirte wurde von seiner Gemeinde eine jährliche Abgabe bezahlt, wofür er verpflichtet war, durch seine magischen Künste die Wetterschläge aus dem Tale zu bannen. In der Wohnung waren in Nischen und Spinden viele Tsʿatsʿa von 25 cm Durchmesser aufgestellt. Sie sollten eine große Kraft besitzen und Aschen von heiligen Tieren und Menschen enthalten Als Hagelbeschwörer spielen die Bönbo zwar im ganzen ackerbautreibenden Osttibet noch eine wichtige Rolle. Während aber früher jeder Familienvorstand zugleich Bönbo-Priester war und jedes Frühjahr alle zusammen auf die Hauptberge in der Nähe der Dörfer hinaufstiegen, um den Hagel für die kommende Ernte zu beschwören, hält sich heute jedes Dorf seinen besonderen Hagelbeschwörer, seinen Bönbo. Die Hagelbeschwörer gehen im dritten Monat (Ende April), wenn die Birken und Weiden Blätter bekommen, zu einem Lab rtse auf die Berge, lesen dort Beschwörungen aus einem Buche, stecken darauf in das Lab rtse neue Speere und Pfeile aus Holz (Tafel XXII oben) und kleben auf einen Stein neben dem Pfeilhaufen ein »srogles-wangtang-Lungschda« (Abb. 12, S. 409). Das wichtigste Tier auf diesem Zauberbild ist oben in der Mitte der Garuda (tib.: btschung), der in seinem Schnabel zwei Schlangen hält. Zum Schluß stecken die Hagelbeschwörer auf dem Berge in Birkenäste, die ihnen die Bauern bringen, Federn vom weißen tibetischen Fasanen und färben mit geweihter Tusche den unteren Teil der Zweigchen, der in den Boden kommt, schwarz. Wenn diese Zweigchen mit den Federn fertig sind und noch ein Hahn ausgesetzt oder geopfert worden ist, rennt alt und jung – nur das männliche Geschlecht darf natürlich anwesend sein – ins Tal hinab und steckt die Zweigchen auf seine Äcker, in die Mitte der Äcker neben einen weißen Stein, der das Herz darstellt, je drei und auf die Ecken je eines. Im Sommer, wenn die Frucht reift, wohnen die Hagelbeschwörer wochenlang auf den Bergen und beschwören jede aufsteigende Gewitterwolke. Der Grundgedanke ist der, daß aller Hagel von den Berggeistern der großen Waldberge stammt, die sich mit den Hagelkörnern gegenseitig bekämpfen, die aber durch die Beschwörungen eines tüchtigen Bönbo besänftigt werden können. Wenn im Laufe des Jahres die Ernte kein Hagel trifft, erhält der Hagelbeschwörer von den Bauern bis zu 100 oder 200 Pfund Weizen. Ist Hagel gefallen, so bekommt er nichts oder nur Schelte, weil er nichts versteht, ja in manchen Gegenden muß der Wetterbeschwörer dem Bauern einen Teil seines Schadens ersetzen, und obendrein wird er ausgepeitscht.. Am Abend vor dem Schlafengehen wurde auch in diesem Hause von sämtlichen Insassen eine lange Litanei mit Händeklatschen und Schnalzen hergebetet, die eine halbe Stunde in Anspruch nahm. Wie immer beteiligten sich auch die Gäste daran.
Mein Weg führt jenseits des Heka-Passes über block- und schotterreiche Terrassen, die zwar von Talrissen vielfältig zerteilt sind, aber doch zu einer zusammengehörigen Hochfläche von 4000–4250 m Höhe gehören. Ich hatte schönes Wetter getroffen, und die Gipfel des Dschara re (Zarsun) und des Hai tse schan-Massivs mit ihren heutigen Gletscherrudimenten, die mich zur linken Hand begleiteten, zeigten sich zwei Tage lang in schönster Pracht. Aus weiter, weiter Ferne im Süden winkten dazu heilige Bergriesen des Bogungga herüber, die hoch über 6000 m hinaufragen, während nach Westen gegen das Li tang-Land zu sich eine Steppenhochfläche in 4000 m Höhe bis zu einem unschätzbar fernen Horizonte ausdehnte.
Am 3. Mai stand ich auf dem letzten großen Passe, auf dem eigentlichen Grenzpasse Tibets und Chinas, dem Dschedo la. Eine endlose Kette Maultiere zog dort an mir vorüber. Tier für Tier keuchte unter zwei in Leder genähten Reisballen. Es waren lauter kleine und magere Racker, die aber wie die Katzen klettern konnten. Die Treiber waren Untertanen des Dschagla-Königs und leisteten Ula-Fron mit ihren Tieren. Der Reis war kaiserlich. Es war ein Proviantzug der chinesischen Truppenmacht, die hinter Li tang, um Ba tang und in Siang tscheng im Felde stand. Gerade am Dschedo-Passe war ich auf die große tibetische Heerstraße gestoßen, die von Ta tsien lu über Li tang, Ba tang, Dschraya und Tsiamdo nach Lhasa geht, und der entlang sich seit Jahrhunderten die Eroberungszüge bewegen.
Sogar der kaiserliche Telegraph führte schon über den zugigen Bergsattel des Dschedo la und seine 4390 m. Die Linie war eben bis Ba tang fertiggestellt worden. Meine Hsi ning-Leute, die noch nie eine Telegraphenleitung gesehen hatten, mußten eine eingehende Inspektion vornehmen. Längst hatten sie natürlich gehört, daß man durch den Draht einen ganzen Brief versenden könne, aber wie das vor sich geht, darüber hatten sie die abenteuerlichsten Ansichten. Sie wollten den Draht durchschneiden und sich den Hohlraum ansehen. Kurz nachdem ich sie von dieser wilden Idee abgebracht hatte, begegneten wir einer sechs Mann starken Telegraphenwache, die eine schadhafte Stelle suchte, weil am Tage zuvor die Leitung unterbrochen worden war. Mir war es wunderbar, daß man überhaupt zuzeiten telegraphieren konnte, denn fast keiner der Isolatoren auf den Stangen war intakt. Die Tibeter sahen in ihnen ein ganz besonders passendes Ziel sowohl für ihre Flinten als auch für ihre geliebten Steinschleudern.
Hinter dem Dschedo-Paß stößt das Auge zunächst auf kahle Felsgrate und auf breit ausgehöhlte, trockene Karböden. Die Gipfel in der Umgebung des Passes steigen über 5000 m. Sie befinden sich noch alle unterhalb der Grenze des ewigen Schnees, und nur verzettelte weiße Flecke waren auf ihnen zu entdecken. Wenn man aber die steile und holperige Heerstraße hinabsteigt, die vor vielen Jahren gepflastert worden war, und wenn man um die Ecke gebogen ist und einen verwaschenen Karboden erreicht hat, dann blitzen mit einem Schlage im Süden riesenhafte Firnfelder auf. Vor ihnen in der Tiefe ist das Dschedo-Tal eingebettet mit dem kleinen Ort Dschedo, einer wichtigen Nachtstation für alle diejenigen, die von unten heraufkommen. Bis man zu diesem Ort gelangt, hat man die breite Rhododendronzone zu passieren, die mit ihren großen weißen und rosa Blüten von 4500–3800 m herabreicht. Die großen Blüten waren eben im ersten Aufblühen, und die schroff abfallenden Berghalden bildeten manchmal ein wahres Blütenmeer. Lange bevor Dschedo erreicht wird, ist man innerhalb der Hochwaldgrenze, und die Feuchtigkeitsmengen, die der Monsun in diesen Randgebirgen abladen muß, haben sogar auf beiden Talseiten, sowohl an Nord- als an Südhängen, schier undurchdringliches Dschungel entstehen lassen.
Bei Dschedo biegt die Schlucht, die von der Straße benutzt wird, aus ihrer südöstlichen Richtung ganz nach Osten um, und jetzt stiegen dicht vor mir mit einem Male die Bergmajestäten des heiligen Lhamo rtse auf. Die Wolken der Nacht waren mittlerweile bis auf geringe Reste von der Sonne verzehrt worden. Frech, unverschämt und patzig, wie nur ein Barbar sein kann, reckten sich diese Heiligen zum Himmel empor. Weiß spiegelnder Firnschnee und grünlichgraues zerspaltenes Eis hoben sich drüben zum Greifen nahe von schwarzen Felsschründen ab. Was mir aber bei dieser atemraubenden Überraschung das Herz noch höher schlagen ließ, war all das saftig frische Grün des Laubwerks, was sich da unter den übermächtigen Götterthronen breitmachte. In dem Tal zu Füßen des Lhamo rtse war es schon eine Weile lang Frühling, da zwitscherte eine Unzahl von Vögeln und Vögelchen, die ich nie vorher geschaut hatte, und rings um mich her gaukelten die farbenprächtigsten Schmetterlinge. Mit jedem Schritte abwärts wurde Mutter Natur lebendiger und lebenslustiger, üppiger, artenreicher. Ich hatte im Norden Tibets und während meiner langen Reise im Löß vergessen, wie schön, wie verschwenderisch unsere Erde ausgestattet sein kann. Umso größer war nun mein Genuß geworden.
Man reiste zuletzt in nordöstlicher Richtung; die Straße folgte in der letzten Stunde einem großen Tale, das am Westfuß der Lhamo rtse-Kette entlangläuft. Ein paar Meilen vor Ta tsien lu wird der Wald wieder kümmerlicher. Der Mensch mit seiner Eigensucht hält hier die Üppigkeit der Natur zu seinem eigenen Schaden im Zaum. Die Holzhauer der Stadt lassen nur noch Buschwald aufkommen. Endlich – es war mittlerweile drei Uhr geworden – tauchten im Talgrunde schwarzgraue chinesische Ziegeldächer und Hausgiebel auf, und bald darauf – man mußte nur noch einen Paradeplatz und einen chinesischen Friedhof hinter sich lassen – klapperten die Hufe meiner Pferde in einer engen gepflasterten Gasse und durch das kleinliche Südtor von Ta tsien lu. Ich war wieder in China geborgen.
Die Stadt Ta tsien lu besteht aus zwei schmalen Straßen, die sich zu beiden Seiten des ziemlich wasserreichen Flüßchens hinziehen, das Dar tschü heißen soll (die wenigsten Bewohner wissen natürlich einen Namen für das Wasser anzugeben). Drei Brücken verbinden die beiden Talseiten. Die Beamten, die Offiziere und der König wohnen auf dem linken Ufer in breitspurigen Ya men, die in chinesischer Art gebaut sind. Die Mehrzahl der Kaufbuden und die großen tibetischen Godowns oder »Go tschwan« liegen vornehmlich auf dem rechten Ufer. Ta tsien lu ist heute eine der wenigen Städte im Reich der Mitte, die keine Stadtmauer besitzen. Dazu scheint sie zu spät (1697) ins Reich eingegliedert worden zu sein. Gleich hinter den Häusern steigen die Talwände steil auf, so daß es die Einwohner nur für nötig fanden, an den drei Talausgängen drei Tore zu bauen.
Innerhalb und außerhalb der Stadt zählt man acht Klöster mit zusammen fünfhundert tibetischen Mönchen. Das schönste Kloster ist am chinesischen Paradefeld auf dem linken Flußufer vor dem Südtor gelegen, unter dem Namen »Dordyi dschak« bekannt und hat hundertfünfzig Priester. Es gehört wie die Königsfamilie zur Nima- oder roten Sekte. Neben ihm sind 25-27° heiße Quellen, die schöne Sinterterrassen gebildet haben. Als zweitgrößtes Kloster fand ich eine Gelugba-Lamaserei mit rund hundert Insassen. Sie liegt innerhalb der Stadt und gleichfalls auf dem linken Ufer. Ein Saskya-Kloster mit vierzig bis fünfzig Priestern findet sich im Norden; der Rest sind kleine, meist Gelugba-Priesterhospize. Alle beziehen regelmäßige Einkünfte aus Grundbesitz, wie mir überhaupt in ganz Tibet ohne Grundeigentum kein Kloster bestehen zu können scheint. Vor allem nennt das Nima dordyi dschak-Kloster große königliche Stiftungen und ausgedehnte Besitzungen sein eigen. Diese Klostergüter liegen mit kleinen Ausnahmen im Minyag-Land (chines.: Munia schan), in den achtzehn Vogteien des Dschagla-Königreichs, die vom Dschedo la aus südwestwärts bis an den Nya tschü reichen.
Das tibetische Fürstengeschlecht der Dyala dyalbo oder (geschr.) lDschagsla rgyalbo herrschte bis in die letzten Jahre des 17. Jahrhunderts uneingeschränkt über ihr heute noch ansehnliches Reich, das vom Nya tschü (Ya lung kiang) bis zum großen Goldfluß (Tung ho, Da tu ho) reicht und bei der Brücke Lu ting kiao (erbaut 1701) an den Distrikt von Ya tschou fu und die fast ganz chinesifizierten Reichlein der tibetischen Leng pien und Schen pien Tu se angrenzt. Als kluge Berechner des tatsächlichen Kräfteverhältnisses beugten sie sich vor der Übermacht der Mandschu-Kaiser, als diese Lust zeigten, Tibet zu erobern. Sie gaben immer die Straße frei, verfeindeten sich aber dadurch mit dem Dalai Lama und seinem Dewa schung.
Der König ist heute noch für seine Tibeter absoluter Herrscher, und abseits der großen Heerstraße in den Seitentälern schalten und walten nur er und seine Vögte. In Ta tsien lu selbst sind ihm gewisse Steuerrechte in bezug auf den Teehandel verblieben. Ja, die Bewegungsfreiheit, die ihm von der chinesischen Regierung gelassen wird, geht manchmal ganz erstaunlich weit. Als ums Jahr 1900 der zweite Sohn des früheren Herrschers der von Peking anerkannte König war und sich mit seinem jüngeren Bruder, dem jetzigen König, wegen seines Erbes, des Klosters Dordyi dschak, verzankt hatte, mischten sich die chinesischen Mandarine nicht in diesen Streit und gingen ruhig ihren Geschäften nach, obwohl Nacht um Nacht vor den Toren der Stadt zwischen den Anhängern der beiden feindlichen Brüder Kugeln getauscht wurden und mancher treue Knecht vor den Augen der Chinesen ins Gras beißen mußte. Als der ältere Bruder inmitten dieser Streitigkeiten kinderlos starb – man munkelte allerlei über seinen plötzlichen Tod –, wurde der jüngere Bruder 1901 ohne weiteres als König anerkannt, nachdem er nur die üblichen Ernennungskosten (5000 Tael) in Tscheng tu fu entrichtet hatte.
Der heutige König war bei meinem Besuch ein liebenswürdiger Vierziger von untersetzter kräftiger Gestalt und scharmantem Wesen. Er besitzt eine Hakennase, die seinem blassen Gesicht etwas Forsches verleiht und die ungezähmte Energie des Mannes verrät, der, nachdem ihm seine Freunde im Kampfe erschlagen worden oder winkendem Golde gefolgt waren, den Mut doch nicht sinken ließ und als einsamer Flüchtling durch die Waldberge seiner Heimat irrte, von Fürstenhof zu Fürstenhof eilte und schließlich den Fürsten von rGechitsa überredete, ihm noch einmal ein kleines Reiterhäuflein und eine Ausrüstung zu leihen. Kühn verfocht er seine Rechte. Er wollte ein freier Mann und Zopfträger und kein glattrasierter Klosterknecht sein und verlangte von seinem Bruder die Herausgabe des ihm von seinen Eltern als Erbschaft zugestandenen Klosters Dordyi dschak mit seinen Gütern. Sein königlicher Bruder aber wollte ihm das Kloster nur herausgeben, nachdem er die Gelübde als Mönch abgelegt und versprochen hätte, ehelos zu bleiben. Das Ende wissen wir schon. Der jetzige König ist ein großer Jäger, hält sich weit über hundert »Schadschüch'«, die den Hirsch und den Cerus zu stellen verstehen und alle scheuen Moschushirschchen im dichtesten Urwald aufspüren. Sein Lieblingsjagdschlößchen, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, ist im Yü ling kung, eine Reitstunde im Süden vor der Stadt. Dort hält er sich, wie im Ya men zu Ta tsien lu, zahme Hirsche, Bären, Leoparden, Fasanen und Pfauen. Haben die Untertanen, die der Straße entlang sitzen, die Ula-Fron zu leisten, so haben die Bewohner eines anderen Tales nur die Jäger und Treiber für die königlichen Jagden zu stellen. Die Jäger haben die Moschusbeutel und die Geweihe der Hirsche, die möglichst im Bast gejagt werden, an den König abzuliefern. Sie bilden eine wesentliche Einnahme des königlichen Haushalts. Andere Bezirke haben die Diener und Schreiber und die Mittel zur Hofhaltung, zu der – ich brauche es eigentlich nicht mehr hervorzuheben – eine große Zahl frommer Lama gehört, zu stellen. Das weitere königliche Einkommen setzt sich aus dem Ertrag der ziemlich großen Privatländereien und aus Geschenken der Untertanen, sowie aus Steuern zusammen, die einige Bezirke am unteren Nya tschü zu zahlen haben.
Die gewaltige Bedeutung von Ta tsien lu liegt darin, daß auf 100, ja 1000 km kein anderer Zugang die gleichen günstigen Verhältnisse für die Ersteigung der tibetischen Hochländer aufweist. Gerade an der tibetischen Grenze türmen sich die größten Hindernisse auf. Gerade hier strecken die Berge ihre Häupter noch höher in die Wolken hinein als sonst. Aber man kann bei Ta tsien lu vermöge der passenden Lage einiger tief eingesägter Durchbruchstäler ohne viele Umwege vorwärts kommen und trifft hier immer wieder auf anbaufähiges Land. Von Ya tschou fu in Se tschuan sind über Ta tsien lu seit Jahrhunderten Truppen bis hinter Lhasa gesandt worden, ohne daß diese wirkliches Nomadenland, wie z. B. im Norden, berühren mußten. Die altmodischen chinesischen Heere mit ihrer stets schlecht organisierten Verpflegung konnten hier, gestützt auf die Ansässigen, vorwärts marschieren.
Die ausgezeichnete Lage der Stadt Ta tsien lu hat auch die großen Missionsgesellschaften, die in China tätig sind, angezogen. Ta tsien lu ist seit 1866 der Bischofsitz von Tibet. Die katholische »Mission du Thibet«, ein Zweig der »Missions étrangères«, ist wohl diejenige Mission, die im Verhältnis zu der Zahl ihrer Mitglieder die meisten Märtyrer aufweist. Die Geschichte dieser Mission ist eine fortlaufende Leidensgeschichte. Im Jahre 1846 hat Papst Gregor XVI. das apostolische Vikariat mit dem Sitz Lhasa geschaffen, aber noch nie hat die Mission diese Stadt erreichen können. Ihre Mitglieder sind aus dem Lama-Staat Lhasa seit den 1860er Jahren gänzlich herausgetrieben worden und warten nun ihre Zeit an der chinesisch-tibetischen Grenze ab. Viele, viele aber sind inzwischen von den fanatischen Lamaisten getötet worden.

Abb. 12
Verkleinerung eines »srogles-wangtang- Lungschda« zur Beschwörung des Hagels s. S. 404 (Originalgröße des Druckes 17x26 cm)