
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Welches ist das Meer, aus dem je befreit zu werden, so sehr schwer ist?«
»Der Kreislauf der Wiedergeburt in den drei Welten ist's, in deren großer Leidensflut wir umhergeworfen werden.«
[Ausspruch des bLobzang sKalbzang, des siebten Dalai Lama (1708–1758) bei einer Prüfung.]
Sie wollen in Tibet gewesen sein! Waren Sie denn in Lhasa? Haben Sie dort Sven Hedin getroffen? – oder haben Sie wenigstens den Dalai Lama gesehen?« Diese drei Dinge sind es, die im allgemeinen die Gebildeten in Deutschland von einem, der in Tibet war, wissen wollen. Zu meinem Glück also war ich überfallen und gezwungen worden, wieder nach Hsi ning zurückzukehren. Ich habe dadurch wenigstens eine der drei Hauptsachen Tibets, den Dalai Lama, zu Gesicht bekommen.
Es war Ende November, als ich nach Lan tschou fu hinabritt, um mir von dort Reserveinstrumente und vor allem Silber zu holen.
Sowie meine finanziellen Geschäfte geordnet waren, befand ich mich wieder unterwegs nach Hsi ning fu. Im oberen Teil des Hsi ning ho-Tales war die Straße in einer ganz vorzüglichen Verfassung. Alle Löcher waren ausgefüllt worden, und kein Steinchen lag im Weg. Dies war alles für den Dalai Lama geschehen, als er von Urga kam. Da es seit Monaten nicht mehr einen Tropfen geregnet hatte, war die Straße noch in demselben guten Zustand. Außer den Steinen hatte man noch eine Menge Tempeltore, die Götterbilder, Lokalgötzen und chinesische Heroen enthielten, weggeräumt, ja an der oberen der beiden »Chia« des Hsi ninger Tales, d. h. in der Felsenge 25 Li unterhalb der Stadt, war eine viele Jahrhunderte alte, ungemein starke Befestigungsmauer, die die Straße sperrte, dem hohen Heiligen zuliebe abgerissen worden.
Die Bevölkerung traf ich jedoch auf der ganzen Reise in Wut auf den Dalai Lama. Die Anmaßung seiner tibetischen Reiter hatte keine Grenzen gekannt. Einen chinesischen Tortempel, der nicht rasch genug gefallen war, hatten die Tibeter kurzerhand samt den Göttern angezündet, und den Hsien der Stadt Niembe, der in seiner Amtstracht den Tibetern entgegengekommen war, hatten sie deshalb überritten und mit ihren Reitstöcken verprügelt. Auch in Lan tschou war die Bevölkerung keineswegs entzückt von dem Heiligen. Daß der Fan tse, der Dalai Lama, der immer in einer Reitersänfte reiste – d. h. in einer Sänfte, deren Tragstangen vorn und hinten je vier Reiter trugen –, nicht einmal ausstieg, um den Gruß und Ko tou des Tsung tu, des Generalgouverneurs von Schen si und Kan su, entgegenzunehmen, war für die Chinesen überaus bitter. In Hsi ning fu angekommen, wohnte der Dalai Lama in einem Zeltlager im Osten vor der Vorstadt und antwortete auf die Einladung des Amban, in seinem Ya men zu wohnen, der Amban solle erst die Stadttore niederreißen, er könne sich doch nicht der Demütigung unterwerfen und sich »unten« durchtragen lassen. Für die asiatischen Kaiser und für jeden Sohn des Himmels gibt es nur ein »oben drüber«, nie ein »unten durch«. So hat man, als Kaiser Kuang sü im Jahre 1900 nach seiner Flucht aus Peking in die Stadt Hsi ngan fu einzog, eine kunstvolle Rampe über die gigantische Stadtmauer gebaut und ihn und seine Tante, die empress dowager, in ihren Sänften darüber hinweg in die Stadt getragen. Denn die Tor- und Lokalheroen, die in den Stadttoren ihre Sitze haben, durften keinen Augenblick über Seiner Majestät, dem Sohn des Himmels, thronen. Zwischen den Himmelssohn, den Kaiser, und den Himmel durfte nie jemand treten. Ein Kaiser von China ist selbst ein Gott und der höchste Gott im Lande. Er ist Gott der Götter. Er kann bekanntlich Götter machen, er kann einen Gott genehmigen oder auch absetzen. Er untersteht nur dem Himmel. Der Dalai Lama behauptet etwas ganz Ähnliches von sich und verlangt darum auch für seine Person die gleiche Berücksichtigung.
Nachdem ich von Lan tschou fu nach Hsi ning fu zurückgekehrt war, war ich während mehrerer Wochen damit beschäftigt, meine neue Karawane zusammenzustellen. Nur zwischendurch ritt ich zu dem Kloster Gum bum, um mir eine Audienz beim Großlama zu erwirken.
Über den heiligen Mann schwirrten durch Stadt und Land auch fernerhin schlimme Gerüchte. Die Chinesen blieben gleich den Mongolen Ts'aidams bei der Behauptung, daß sein Lebenswandel in moralischer Beziehung mehrfach zu wünschen übriglasse, und man sagte ihm nicht bloß eine Liebschaft nach. Die Offiziere und der Landrat der Stadt klagten mir bei einem Essen, das ich – nebenbei gesagt – in dem von der Stadt errichteten Ehrentempel Tung fu hsiang's, des Geächteten von Peking, gab, der Dünkel und die Habsucht des Lama seien himmelschreiend, der Unterhalt des Heiligen bringe sie noch an den Bettelstab. Obwohl das Gefolge nur aus hundertfünfzig Tibetern bestand, mußte die Stadt täglich dreihundert Schafe und ganze Wagenzüge voll Mehl, Reis und Nudeln für die Pilger kostenlos stellen. Die Beamten waren gehalten, dem Hohepriester jeden möglichen Wunsch zu gewähren. Die Bevölkerung jammerte, das chinesische Heer sei nach der Niederwerfung der Mohammedanerrebellion leichter zu erhalten gewesen. Viele tausend Kochgeschirre wurden durch den Hsien-Ya men bei den einheimischen Familien entlehnt, damit die müden Reisenden bei ihrer endlichen Ankunft in Hsi ning fu kochen könnten. Natürlich brauchten die Tibeter kein einziges davon. Wer aber seinen Familienkochtopf wiederhaben wollte, mußte dafür mindestens die Hälfte seines Wertes an die Angestellten des Ya mens bezahlen.
Der Dalai Lama war in Begleitung eines Spezialgesandten vom Pekinger Hofe Ende Oktober bis zum Kloster Gum bum gereist. Von dort kehrte dieses besondere Ehrengeleite wieder nach Peking zurück, und der Amban, der Präfekt und der Landrat verlegten ihre Wohnung wochenlang in das Kloster, um dem Dalai Lama zu Diensten zu sein. Der Amban mußte jedoch zehn Tage lang warten, bis er die Heiligkeit zum ersten Male von Angesicht zu Angesicht sah, und zweimal hatte man ihm seine Geschenke mit dem Bemerken zurückgewiesen, sie seien zu unansehnlich. Die Beamten schäumten vor Wut. Der chinesische Stolz wurde aufs härteste getroffen. Dies wagte ein Fan tse, ein »Barbar«, zu bieten!
Auch noch nach vielen Wochen beschränkte sich der Verkehr des Ambans mit dem Dalai Lama auf eine steife Audienz alle zwei Tage, während deren die Heiligkeit auf einem Postament und neun Kissen saß und der zitterige Amban nach einem dreimaligen Ko tou sich nach dem Befinden und den Wünschen seines hohen Schützlings erkundigen durfte. Der Dalai Lama sagte die Antwort seiner Umgebung, die sie ins Chinesische übersetzte. Eines ist sicher, die Hsi ninger Beamten hätten den Dalai Lama am liebsten so rasch wie möglich in die Steppen abgeschoben. Man nannte ihn den »ling gui« und bezeichnete ihn damit als ein kluges, aber böses Irrlicht.
Um mir persönlich den Dalai Lama anzusehen, ritt ich, mit mancherlei Geschenken gewappnet, an einem der vielen sonnigen Winternachmittage von der Stadt Hsi ning nach Lusar, nach dem Chinesen- und Mohammedanerdorf neben dem Kloster Gum bum. Ich hatte niemand meine Absicht wissen lassen, denn wie ich später merkte, nahm ich mit vollem Recht an, daß die chinesischen Mandarinen mir Hindernisse in den Weg legen würden. Um möglichst wenig Aufhebens zu machen, hatte ich sogar nur einen Diener mit mir genommen. Die zurückgebliebenen Ma fu glaubten, ich sei in Dankar. Ich kam in dunkler Nacht am Ziele an und fand Lusar wie Gum bum bis auf das letzte Plätzchen mit Pilgern und Pilgerinnen überfüllt. Es kostete viel Mühe, ein paar Zoll in einem Stall zu bekommen; wie Heringstonnen, nicht wie menschliche Wohnungen, sahen die niederen Räume der Lehmhütten aus.
Am nächsten Morgen machte ich mit Hilfe eines mohammedanischen Händlers die Bekanntschaft eines alten, dicken Mongolenlama. Unweit vom großen Klostertore wohnte der schlau und fettig aussehende Priester in seinen ockergelben bauchigen Kleidern in einem niederen holzgetäfelten Stübchen. Mit buntfarbigen Papierscheibchen waren die Gitterfenster verklebt, die in den kleinen, viereckigen Hof eines der einstöckigen Priesterhäuser sahen. Der Lama war der Dolmetscher und Berater des Großlama im Verkehr mit mongolischen und chinesischen Würdenträgern. Er schien der geeignete Mann, mir Eintritt beim Dalai Lama zu verschaffen, und ich suchte ihn in den nächsten Tagen des öfteren auf, um ihn für meinen Zweck zu bearbeiten. Jedesmal, wenn ich in sein Stübchen trat, hockte er in seiner Fensternische vor einem dicken Bündel Gebete und studierte sie. In die wohltuende Klosterstille und Abgeschiedenheit im Stübchen und im Höfchen davor drangen nur in Zwischenräumen die anschwellenden Töne einer Litanei, die ein benachbarter Priester anstimmte. Dann und wann erschien ein zerlumpter Bettler am Hoftor und rief laut, aber jammervoll: »Herren Lamas, habt Erbarmen! Ich bin auf dem Wege in dies Heiligtum unter die Räuber gefallen. Sie haben mir Zehrung und Zehrgeld genommen.« Einer der Priestereleven nahm dann wortlos ein Brot oder eine Handvoll Tsamba aus der Küche und warf das Almosen dem Bettler in den vorgehaltenen Beutel.
Mein Mongole verstand nicht, daß ich als Fremder und Ungläubiger auf einen Besuch beim Dalai Lama erpicht sein konnte, ohne ein hoher Würdenträger meines Landes zu sein und in einem geheimen Auftrag seinen Herrn aufsuchen zu müssen. Wieder und wieder stellte er an mich die Frage, ob ich nicht ein Schreiben von dem Herrscher meines Landes zu übergeben habe. Indem ich dies verneinte, durfte ich anderseits doch auch nicht verraten, daß einzig und allein Neugier mich hertrieb.
Der Alte erzählte rühmend, daß täglich vier- bis fünfhundert Menschen, Männer, Frauen und Kinder, vor dem Großlama, dem »kleinen Kaiser« – wie er sich ausdrückte – vorbeizögen, die alle von ihm gesegnet, d. h. am Scheitel berührt sein wollten. Alle diese hatten ein Geschenk dafür mitzubringen, auch die zerlumptesten Bäuerinnen und schmutzigsten Nomadenweiber, die von Sung pan- oder vom ngGolokh-Lande zu Fuß herbeigeeilt waren, brachten wenigstens einige Pfund Butter, etwas Silber und ein weißliches, spinnwebähnlich dünnes Fetzchen, den »Khádar«. Jeden Nachmittag sah ich dieses Pilgervolk auf dem Wege hinter dem Hause meines Freundes sich aufstellen. In einer langen Reihe warteten sie kniend und betend. Nach stundenlangem, andächtigem Harren ließ man sie dann mühsam zu zweien und zweien am Tore des Abtshauses vorbeirutschen. Auf der letzten Stufe stand der Dalai Lama in langer Priesterrobe mit seiner gelben, hohen und spitzen Mitra auf dem Kopfe, ein dünnes Stäbchen in der Rechten, an dem eine in Leder genähte Gebetsrolle baumelte. Alle die murmelnden, alle die entblößten und zur Erde gebeugten Pilgerhäupter wurden damit vom Dalai Lama der Reihe nach berührt, während mit langen Lederpeitschen bewaffnete Polizeimönche die Ordnung aufrecht hielten, so daß man als Unbeteiligter die Vorgänge während dieser Zeremonie nur aus hundert Schritt Entfernung betrachten konnte, wollte man sich nicht einen Buckel voll blutiger Striemen holen.
Mit dem Volksglauben, daß die Berührung oder gar der Hauch des heiligen Großlama einem damit Beglückten große Vorteile beim Wiedergeborenwerden, im jetzigen Körper aber bereits Verzeihung der Sünden und wirksamen Schutz vor bösen Einflüssen und Geistern bringe, wurde im Kloster Gum bum wahrhaft Wucher getrieben. Für die niederen Heiligeninkarnationen, sogar für die kleinen Huo fo ye, die dii minores, die in irgend einem Bergkloster zu Hause waren, wurde festgesetzt, daß sie, um zum Dalai Lama zugelassen zu werden, Geschenke im Wert von nicht weniger als 10 Tael abliefern müßten. Stammeshäuptlinge und andere reiche Herren hatten Werte von mindestens 20 Tael abzuliefern. Eine eigene Einschätzungskommission war zu diesem Zweck gebildet worden.
Das Leben des Dalai Lama in Gum bum verlief im übrigen sehr geregelt. Es war ausgefüllt von Kulthandlungen. Gleich anderen gelehrten Lama las er die meiste Zeit in den heiligen Büchern, und zu bestimmten Stunden erschien er in der großen Gebetlesehalle, wohin er von dem Abtspalast auf dem Berge inmitten eines stattlichen Zuges von Richtern und anderen Klosterwürdenträgern und umgeben von Priestern mit brennenden Weihrauchkerzen stolz und würdevoll zu Fuß hinabstieg.
Eines Nachmittags wurde ich in dem großen Tanzhofe Zeuge einer öffentlichen Diskussion und Prüfung. Während Hunderte, ja Tausende von Laien und Mönchen über die Mauer und von den Dächern der nächsten Häuser aus zusahen, hockten in dichten Reihen auf dem Pflaster des Hofes fünfhundert junge Priester, ihren safrangelben Radmantel um die Schultern geworfen und die hohen, safrangelben Raupenhüte auf dem Kopfe. In der gegen den Hof offenen Säulenhalle daneben hockten drei hoffnungsvolle Studenten der buddhistischen Theologie und rings um diese, in steifer, würdiger Haltung, alte Lamas und Inkarnationen. Nur eine dunkelrote, mittelgroße Mönchsgestalt, ein barhäuptiger Priester mit goldgestickter Pulostoffweste, violettroter Toga und gleichfarbigem Faltenrock schritt lebhaft hin und her, sagte mit schallender Stimme Texte und Auslegungen her und stellte Fragen an die scheu dasitzenden Kandidaten. Bei jedem Stichwort schlug er laut klatschend mit der Rechten in seine eigene ausgestreckte Linke, daß es weithin durch die Tempelhallen schallte, und auch mit den Füßen stampfte er, daß es dröhnte; denn es ist alte lamaistische Lehre, daß durch das Händeklatschen die bösen Geister der drei Welten zusammenschrecken müssen, und daß durch das Stampfen der Füße der Diskutierenden die Pforten der Hölle sich öffnen sollen. Gab einer der Kandidaten eine falsche Antwort, so verfiel er sofort in einen ärgerlichen Ton, hielt dem Nichtskönner den Mund zu, verspottete ihn, und einmal schlug er gar zum Hohn mit seinem Bein ein Rad über dem Kopf eines der Unglücklichen, so daß alle Zuschauer den Ernst vergaßen und hellauf hinauslachten. Der lebhafte Examinator mit dem kleinen feingeschwungenen Schnurrbärtchen in der Mitte der hohen Priester war der Dalai Lama in höchsteigener Person.
Wer hätte sich nicht die größte lebende Inkarnation als götzenhafte, steife Pagodenfigur vorgestellt, immer tief sinnend und mit rätselvollem, süßem Lächeln auf den Lippen? Vor meinen Augen aber lehrte mit überraschender Lebendigkeit der Gebärden und mit Kommandostimme ein alltäglich aussehender Lamapriester, der, kurz nachdem ich unter den Zuschauern aufgetaucht war, gleich den übrigen Lamas seine dunkeln Augen auf mich heftete und wie die anderen Hunderte und aber Hunderte neugierig und lebhaft jede meiner Bewegungen verfolgte, sich dadurch immer weiter und weiter von aller Großherrlichkeit entkleidend.
Während der dreistündigen Diskussion waren unter der Menge der Zuschauer immer wieder einige tibetische Hirten zu sehen, die sich zu unzählbaren Ko tou in der Richtung auf den Dalai Lama niederwarfen, so daß ihre Gesichter über und über mit dem Staub und Schmutz des Bodens beschmiert waren. Europäer nennen oft den Dalai Lama den Papst Tibets und Zentralasiens und vergleichen seine Residenz Potala mit dem Vatikan. Für die Lamaisten ist der Dalai Lama aber weit mehr als ein Papst. Er ist nicht nur der oberste Hirte, ihm wird nicht nur Unfehlbarkeit zugesprochen, ja er ist nicht einmal mehr ein bloßer Heiliger, er ist für seine Anhänger bereits einer der höchsten Götter, dem nichts verschlossen bleibt. Er wird für die Fleischwerdung des Bodhisatva Padmapani oder Avalokitesvara gehalten, d. h. er verkörpert eine letzte Vorstufe vor der Buddhaschaft selbst, vor dem höchsten und vollkommensten buddhistischen Wesen überhaupt Der fünfte Dalai Lama insbesondere hat es verstanden, sich als eine ganz besondere Verkörperung hinzustellen. Im Dalai Lama soll jetzt neben dem Bodhisatva Padmapani noch der Gott des Todes und der große tibetische König Srong btsan sgampo, der 629 den Thron bestieg, endlich sogar der sagenhafte König Gesar verkörpert sein.. Und dieser hohe Angebetete weilte damals in Gum bum und war so bequem für die Außenwelt und für mich zu sehen, weil er zuerst jahrelang, aufgereizt durch seinen Verkehr mit russisch-mongolischen Mönchen, seine Nachbarn, die Engländer, herausgefordert hatte, dann, als einige englische Regimenter gegen seine sagenumwobene Hochburg marschierten, die Flinte ins Korn warf und – unter dem Vorwand, er müsse meditieren – aus seinem Lande floh, bis er endlich von den Chinesen recht unfreiwillig in das Grenzkloster Gum bum verpflanzt wurde. Obwohl er dadurch jedermann nur zu deutlich gezeigt hatte, ein wie unvollkommener Mensch auch er war, so war er für die große Masse der Tibeter doch noch immer der Bodhisatva und eine leibhaftige Gottheit geblieben. Nur bei vielen Lamas hatte sein überstürztes Verhalten, seine Flucht in der Richtung auf das ferne Rußland vielfaches Kopfschütteln hervorgerufen. Gerade unter den Höhergestellten und Maßgebenden seines Volkes hatte er an Ansehen eingebüßt. Um daher das alte Prestige wiederzuerlangen – so ließ ich mir erzählen –, soll er sich in Gum bum mit besonderem Eifer aufs Lehren und Diskutieren der buddhistischen Scholastik verlegt haben, und seine Flucht aus Lhasa wurde von ihm gleichzeitig für eine bloße Reise in das westländische Ausland erklärt.
Längst war hinter den Bergen von Gum bum die Dezembersonne mit den letzten wärmenden Strahlen verschwunden, die Dämmerung brach herein, und beißende Eiseskälte verbreitete sich, als der Dalai Lama sein Frage- und Antwortspiel aufgab und in feierlicher Prozession wieder den Berg zum Abtspalast hinaufstieg. Die vielen Priester hatten von der Kälte blaurote Nasen bekommen. Sie schlüpften eilig in ihre Stiefel, zogen ihre Toga über den Kopf und huschten wie Fledermäuse an mir vorüber nach ihren Quartieren. Noch ehe es vollkommen Nacht geworden war, standen die winkligen Gassen der Klosterstadt menschenleer da, und nur die zahllosen herrenlosen Hunde unterbrachen mit ihrem Gekläff die weihevolle Ruhe, die noch auf jeden, der eine größere Lamasiedlung besucht hat, einen tiefen Eindruck gemacht hat.
Ich hatte an diesem Abend in meiner winzigen Gasthofzelle in Lusar, in der einst schon Rockhill gewohnt hatte, einen lustigen Gast zu Tisch. Herr E. Teramoto, ein Japaner, der in der Kleidung eines mongolischen Mönchs im Kloster und in der Nähe des Dalai Lama weilte, hatte mich zu später Stunde noch mit seinem Besuch überrascht, und bis lange nach Mitternacht kauderwelschten wir Chinesisch, Englisch und Französisch zusammen. Kraft seines natürlich echten Aussehens war Teramoto schon in allen großen Klöstern Tibets herumgekommen, hatte Lhasa von Ts'aidam aus ohne besondere Schwierigkeiten erreicht, alle seine Heiligtümer gesehen und unbehelligt monatelang in seinen Klöstern gehaust. Wie gut kann doch die japanische Regierung durch solche opferwillige und tüchtige Forscher über alle Vorgänge im Innern Asiens auf dem laufenden erhalten bleiben!
Während wenige Jahre früher der japanische Mönch Kawagutschi, der erste Japaner, der in Lhasa einige Zeit gelebt hat, vom Dalai Lama noch als Landesverräter behandelt worden war, als sein Inkognito als angeblicher chinesischer Arzt gelüftet ward, wurde jetzt Herr Teramoto vom gleichen Dalai Lama und seinen nächsten Ratgebern als Berater für alle nichtzentralasiatischen Verhältnisse verwendet, auch nachdem seine Nationalität allgemein bekannt geworden war. Da er es gleichzeitig verstand, sich mit den chinesischen Beamten gut zu stellen, indem er sich ganz ihren Sitten unterwarf, auch immer bereitwilligst bei ihren Trinkratespielen mittat, so wurde er sicher einer der besten Kenner dieser ganzen für uns Europäer noch so dunklen zentralasiatischen Welt. Jetzt wohnte er in Gum bum im Ökonomiegebäude Adya fo ye's, den die japanischen Buddhisten zwei Jahre früher zu sich nach Japan eingeladen hatten, und der zurzeit noch in der Ostmongolei als Abt irgend eines Klosters abwesend war.
Als ich am Tage nach der öffentlichen Prüfung den Besuch heimgab und Teramoto in seiner hübschen und gemütlichen Priesterzelle aufsuchte, erfuhr ich, daß der Dalai Lama noch in derselben Nacht nach dem unbekannten Fremden, d. h. nach mir, hatte fragen lassen. Er hoffte, ich sei ein Bote irgend einer fremden Macht und hätte ihm eine Kunde zu überbringen, um Mittag schon erwartete man mich zu einer Audienz.
Ein Mönch aus Lhasa holte mich zur angesagten Zeit in meinem Gasthof ab und brachte mich insgeheim über den Berg und durch eine Seitenpforte in das Abtsgebäude. Vor dem großen, gelben Haupttor lungerten ein paar chinesische Milizsoldaten als Wachen herum. In der Stube des obersten Torhüters, eines Priesters, hatte ich eine kurze Weile zu warten, dann geleitete mich mein Lhasamann in das dahinterliegende Hauptgebäude und eine schmale steile Holzstiege hinauf. Eine kleine Tür wurde aufgerissen, um hinter mir sogleich wieder zugeschlagen zu werden. Mein Diener, der bis dahin mit mir gegangen war, mußte draußen bleiben. Ich befand mich in einem niederen und schmalen Saal, in dem ich zunächst nur viele, in dunkelroten und blauen Pulostoff eingebundene Holzsäulen wahrnahm. Der Raum erhielt sein Licht durch einige Papierfenster und von einem Balkon, der einen weiten Blick über das Klostertal und alle Goldspitzen und Golddächer der Tempel gestattete.
Ein alter Lama tritt jetzt aus dem Säulenwald heraus und auf mich zu und führt mich weiter nach der Mitte des herzbeklemmend engen Raumes, und nun endlich entdecke ich zwischen den Säulen hindurch an der mit Heiligenbildern voll behangenen Rückwand einen lebhaft und interessiert sich vorbeugenden jungen Mann, der auf einem schmalen, meterhohen Podeste nach Buddhaweise hockt – ich stehe dicht vor dem Bodhisat, vor dem Priesterkönig der Tibeter und Mongolen, vor dem höchsten buddhistischen Heros, vor dem Millionen Menschen von den sibirischen Eiswüsten bis hinab in die heißen Ebenen Indiens gläubig ihre Knie beugen! Wie viele Tausende von ihnen mögen mich um diesen Augenblick meines Lebens beneiden!
Ich war einer der ersten Europäer, die den Märchenkönig zu Gesicht bekommen haben, nicht nur für mich, auch für den Dalai Lama bildete darum die Begegnung ein außerordentliches Ereignis. Der Dalai Lama trug das rote, allgemein übliche Priestergewand, nur war es besonders gut ausgeführt und reich mit Gold bestickt. Seine weite, dicke Wollweste täuschte einen breiten Oberkörper vor, doch ist der Dalai Lama nur von mittlerer Körpergröße. Seine Arme waren bis zu den Schultern hinauf bloß, nur um das linke Handgelenk hatte er seinen einfachen Rosenkranz wie ein Armband geschlungen. Er trug natürlich keinerlei Schmuck. Die Haut seiner Arme und seines Gesichts erschien auffallend hellbrünett und blaß; die Sonnenstrahlen treffen sie nur selten. Er trug einen ziemlich dichten und ausgedrehten Schnurrbart, obwohl er doch erst wenig über dreißig Jahre alt war. Seine Kopfhaare waren sicher einen halben Monat nicht mehr rasiert; im Gesicht nahm ich Pockennarben wahr; Tobden Dalai Lama gehört keineswegs zu den nach unserem Geschmack schönen Tibetern. Bei allen seinen Anhängern sind seine schwarzen Augenbrauen berühmt, die groß und schön geschwungen sein sollen, doch sind sie mir nicht als etwas so Besonderes in die Augen gefallen.
Während ich mich mit Verbeugungen näherte, setzte sich der Dalai Lama den gelben, spitzen Priesterhelm auf den Kopf, seine Lippen aber blieben stumm. Er fixierte mich und meinen europäischen schwarzen Rock ungemein scharf. Trotz der großen Neugier, die aus seinen Augen sprach, behielt sein Gesicht zunächst einen mürrischen, abweisend hochmütigen Ausdruck. Als ich den seidenen Khádar überreichte, den mir der Majordomus aus der Hand nahm, wurde ich von ihm nach meinem Befinden und nach meiner Mission und nach einem Schreiben meiner Regierung gefragt. Als ich ihm meine Freude ausgedrückt hatte, daß er mich durch eine Audienz ausgezeichnet habe, mußte ich natürlich auch sagen, daß ich keinerlei Schreiben hätte, ich sei ein Deutscher und nur zufällig des Weges gekommen. Der Dalai Lama fiel mir rasch ins Wort, daß ich ein Deutscher sei, wisse er längst, er kenne Deutschland, es liege dicht hinter dem Lande der Russen und dem der Engländer. Es wurden dann meine Geschenke von dem Mongolenlama herbeigebracht und neben den Sitz des Dalai Lama gestellt, und der Nirba Kampo, der Majordomus, überreichte mir einige Bündel tibetischer Weihrauchkerzen, zwei Stück Pulo (rote Wollstoffe aus Gyang tse, die in den Geschenken des Dalai Lama immer eine Rolle spielen), vor allem aber ein 3¼ m langes und 60 cm breites, weißes Seidenstück, in das tibetische Sprüche gewoben waren, und das angeblich in Lhasa selbst hergestellt worden ist. Es war der Khádar des Dalai Lama; ich habe einen ähnlichen seither nicht mehr zu Gesicht bekommen. Auch wurde mir aufgetragen, wenn ich meinen »Fürsten« sehe, ihm den Gruß des Dalai Lama zu entbieten. Bei diesen Worten machte er einen überaus liebenswürdigen und redegewandten Eindruck. Mein eifriges Bemühen jedoch, im Anschluß an meinen Dank für den großen Khádar und für die Geschenke den Dalai Lama zu einer längeren politischen Unterredung zu bewegen, mißlang leider. Ich hörte nur allgemeine Phrasen, er freue sich, daß überall Frieden sei, und er hoffe, daß ich der Lehre Buddhas auch in den westlichen Ländern Gehör verschaffen werde. Ich konnte mich dabei nicht des Gefühls erwehren, daß er sich vor seiner eigenen Umgebung nicht sicher genug fühlte, um viel mehr zu sagen. Seine Worte, die er nur halblaut aussprach, wurden vom sMamba Kampo wiederholt. Meine chinesischen Worte wurden von einem Mongolen ins Tibetische übersetzt und auch durch den sMamba Kampo wiederholt. Auch meine Bitte, den Dalai Lama photographieren zu dürfen, wurde mir rundweg und mit entsetztem Gesicht abgeschlagen. Die Umgebung des Dalai Lama drängte während der ganzen Unterredung, daß ich so bald wie möglich wieder gehe. Als ich ihm schließlich vor seinem hohen Sitzaltar stehend eine tiefe Abschiedsverbeugung machte, fühlte ich plötzlich seine Fingerspitzen auf meinem Scheitel – der Dalai Lama hatte meinen europäischen Gruß mißverstanden und hatte mir zum Abschied seinen vielbegehrten Segen durch Handberührung mit auf den Weg gegeben. Kaum war dies geschehen, so nahmen mich die vier Priester in ihre Mitte, und fast geschoben ging es zwischen den Säulen hindurch zur Tür, den Dalai Lama aber sah ich noch immer, neugierig sich vorbeugend, mir nachblicken.
Herr Teramoto bemühte sich später noch weiter, daß ich vom Dalai Lama eine Photographie machen dürfe – es war damals noch keine vorhanden. Alle die Lama waren aber in der Vorstellung befangen, daß ihr Großlama verhext werden und sein Leben verlieren könne, wenn ein tüchtiger Zauberer, irgend ein tantrischer Feind, seine Kleider, ja wenn er nur ein Stück seiner Stiefelsohle ohne sein Wissen in die Hände bekomme, und alle waren felsenfest überzeugt, daß diese Beschwörung durch eine photographische Aufnahme erst recht erleichtert werde Mittlerweile sind allerdings in Indien vom Dalai Lama Photographien gemacht worden. Eine ausführliche Schrift über Tobden Dalai Lama ist Rockhill, The Dalai Lamas of Lhasa. T'oung Pao 1910, I, 1–104..
Nach dieser Audienz ritt ich rasch nach Hsi ning fu zurück, und ungesäumt rüstete ich an der neuen Karawane.
Die »Goba«, die »Gentlemen« aus Lhasa, waren in dem Jahre, als Tobden Lama in Gum bum weilte, zahlreicher als je in Hsi ning erschienen. Auf allen Märkten tauchten die malerischen, buntgekleideten und dunkelhäutigen Gestalten der Vertreter des tibetischen Adels auf. Mit den kleinen Schnurrbärtchen und Fliegen an dem Kinn machten sie auf mich einen fast abendländischen Eindruck. Sie handelten mit Hilfe von Dolmetschern um die feilstehenden Maultiere der Amdo-Bauern und um die wenigen anderen Dinge, die wertvoll genug sind, um sie über die öde Tschang tang nach Zentraltibet zu schleppen. Da ich auf der neuen Reise rasch vorwärts kommen wollte, so sammelte auch ich dieses Mal eine Karawane von Maultieren und Pferden und hatte deshalb in den Gobas eine scharfe Konkurrenz. Gute Maultiere, die hier oben aber immer im Verhältnis zu denen, die in Schen si gezogen werden, recht klein sind, stellen sich in gewöhnlichen Zeiten so teuer wie vier Yakrinder. Durch die Anwesenheit so vieler Zentraltibeter schnellten die Preise erstaunlich in die Höhe. Mit großer Mühe brachte ich schließlich achtundzwanzig Tiere, darunter achtzehn Maultiere, zusammen.
Am 14. Januar – ich war mitten in dieser eigenartigen Arbeit und an diesem Tage schon zum vierten Male zum Pferdemustern auf die Straße gerufen worden – wurde es plötzlich auffallend dunkel. Der Himmel war klar und wolkenlos wie an jedem der Wintertage. Kein Lüftchen regte sich. Es schien deutlich dem Abend zuzugehen. Ärgerlich brummte ich meine Diener an, daß sie wieder einmal vergessen hätten, mir ein Mittagessen zu bringen. Als Antwort hörte ich sie noch ausrufen: »Ör tse bu h'au!« (Der Tag ist nicht gut, er ist ein Unglückstag!), dann trabte ich auf dem zum Kauf angebotenen Pferde die Straße hinauf. Mein Weg führte mich durch Zufall an dem Tor des Fu Ya men vorbei. In dem weiten Hofe war eine große Menge Soldaten und Musikanten versammelt, die mit ernsten Mienen auf Trommeln, mit Gong und schrillen Pfeifen, mit Kochkesseln und allem, was nur irgendwie Lärm machen kann, wie die Kinder einen ohrenbetäubenden Spektakel vollführten. In ihrer Mitte stand der Präfekt in voller Amtstracht mit dem blauen Knopf und seinen Federn auf dem Hut und dem gestickten Wappenvogel auf der Brust. Vor ihm war ein Waschbecken aufgestellt, in das er immer wieder mit sorgender Miene hineinblickte, und hinter ihm wurde auf einem Holzrahmen, auf Papier gemalt, das Zeichen »Gefräßigkeit« sichtbar.
Auch aus einem nahen Tempel klangen dumpfe Trommelschläge an mein Ohr, und aus allen größeren Höfen begann eine gleich schauerliche Katzenmusik. Man bekämpfte so – die Sonnenfinsternis dieses Tages. Wer ein offizielles Amt bekleidete – und deren sind in Hsi ning fu wahrlich nicht wenige – sah sich von Amts wegen bemüßigt, mit allen seinen Angestellten Radau zu machen, ihnen schlossen sich aber auch alle Vermögenden der Stadt an, alle Handwerker und Bauern tuteten und klopften, in dem Bestreben, mit ihrem Lärm die Sonne zu retten und das böse und gefräßige Ungeheuer, das sie aufzufressen drohte, zu verscheuchen. Vor Wochen schon war dazu aus Peking aus dem astrologischen Amt ein Befehl eingetroffen. Wie ein großer Stratege verfolgte der Präfekt inmitten seiner Mannschaften den Erfolg seiner Waffen. Und er hatte auch dieses Mal wieder Glück! Das Ungeheuer zog sich fügsam zurück. Die Sonne erstrahlt wieder in der alten Weise. Der Präfekt macht ihr, als die Gefahr vorüber, einen Ko tou mit neunmaligem Nicken des Kopfes und verschwindet, überlegen lächelnd, im Innern seines Ya men. Befriedigt ziehen die Soldaten nach Hause, und alles geht wieder seiner gewohnten Beschäftigung nach.
Die Verdeckung der Sonnenscheibe wurde nicht ganz vollständig. Zur Zeit der größten Verdunklung war noch eine winzige Sichel am unteren Rande sichtbar. Doch war die Verdunklung so weit vorgeschritten, daß sich alle Tiere angeschickt hatten, ihre Ruheplätze aufzusuchen; die Hühner waren wie am Abend in ihren Ställen versammelt, die Sperlinge stritten und putzten sich noch eine kurze Weile, schlüpften aber dann rasch an ihre Nachtplätze unter die Dächer. Völlige Ruhe herrschte in der Tierwelt, nur die Menschen mußten mit ihren kläglichen Musikinstrumenten wüten, bis es wieder hell geworden war und für die Spatzen und die Vierfüßler der neue Tag begann.
Ich warb für die neue Unternehmung sechs Begleiter an. Wiederum war das Angebot riesenhaft. Und mit allerlei Listen und Ränken hatte ich zu kämpfen, um nicht Leute zu bekommen, die überhaupt noch nie in der Steppe und in der Höhe droben gewesen waren. Die schon Angestellten wurden von den Kandidaten bestochen, bei mir für sie gutzusprechen. In aller Eile lernten sie ein paar tibetische Brocken, um sagen zu können, sie verständen Tibetisch. Chinesen aber, die wirklich Tibetisch konnten, fand ich in Hsi ning und Umgebung wieder nur sehr dünn gesät. Anderseits glückte es mir diesmal nicht, auch nur einen einzigen vertrauenswürdigen Tibeter in meine Dienste zu bekommen. Nach dem See Kuku nor hinauf waren sechs Tibeter bereit mich zu begleiten, aber keinen Schritt weiter wollten diese gehen. Sie fürchteten die Gefahren viel mehr als die Chinesen. Von den alten Begleitern trat Da Tschang wieder in meine Dienste, Er hatte mittlerweile wieder Hochzeit gemacht. Es war das vierte Mal, daß der noch nicht Dreißigjährige eine Frau genommen hatte. Stolz erzählte er, daß ihm noch keine Frau verstorben sei und er noch nie die großen Kosten einer Beerdigung habe bezahlen müssen. Er hatte das Glück, seine ersten Frauen stets loszuwerden, wenn er ihrer überdrüssig war. Dagegen jammerte er immer, wie teuer in Hsi ning das Heiraten sei, so viel teurer als drunten im eigentlichen China; für eine halbwegs hübsche Jungfrau müsse man in seiner Heimat schon 100 Tael (300 Mark) dranrücken. Chinesinnen sind in der Tat im Hsi ninger Tal sehr gesucht. Weil der Lebensunterhalt sehr billig ist, so haben alle Vermögenden mehrere Frauen und verringern dadurch noch mehr das Angebot. Von Mädchentötung erfuhr ich hier nie etwas, denn Mädchen aufzuziehen rentiert sich hier. Unverheiratete Mädchen von zwanzig Jahren kommen so gut wie nie vor. Nach einer Verheiratung sinkt jedoch die Frau in den Augen der Männer rasch im Wert.
Unter der Tür meines Gasthauses wurde ich eines Tages Zeuge eines für die niederen Volksklassen typischen Falles. Ein Bauer hatte einem Soldaten 20 Tael gepumpt, und dieser hatte ihm dafür, weil er sonst nichts besaß, seine Frau verpfänden müssen. Jetzt brauchte der Soldat wiederum Geld, und der Bauer gab ihm 20 Tael mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß ihm von nun an die Frau ganz zu eigen gehöre und der Soldat alle Rechte an seine Frau verloren habe. Auch nahm der Bauer noch das Kind an sich, das der Soldat von der Frau hatte, weil er schon viel zu viel Geld gegeben habe. Hsi ning als Garnisonstadt an der Grenze mag vielleicht besonders schlimme Zustände zeigen. So kommt z. B, hier auch Frauenumtausch, kurz alles vor, was man sich an Freiheiten von Seiten des Mannes ausdenken kann. Alles geschieht immer ohne langes Befragen des weiblichen Teils.
Eines Abends brachte mir ein Bauer zwei Maultiere in den Hof, die er rasch verkaufen wollte, und die schließlich recht billig in meinen Besitz übergingen. Die Eile, die der Bauer hatte, fiel auf, denn gerade beim Verkaufen hat man in Hsi ning stets sehr viel Zeit. Ich fragte daher den Roßkamm, der den Kauf vermittelt hatte, warum es der Bauer denn so eilig habe. Mein Mann schmunzelte, und ohne ein Wort weiter zu verlieren, packte er mich am Arm und führte mich hinter dem Bauern drein einige Häuser weiter. Dort warf eben der Bauer das Silber für die Maultiere auf einen Tisch und ergriff mit kräftigem Arm eine mittelaltrige Frau, die sich vergebens zur Wehr setzte und anscheinend ahnungslos vor der Tür gesessen hatte; rasch hob er die Frau auf sein Pferd und eilte mit ihr dem nächsten Stadttor zu. Die Dämmerung hatte sich schon herabgesenkt. Er kam gerade noch vor Torschluß davon. Die Chinesen, die dem Schauspiel zusahen, lachten aus vollem Halse, während die Frau ihr Gesicht in den Händen barg und laut und jammerwürdig schluchzte. Mein Führer erklärte mir unter Lachen: »Der Mann hat sich für deine zwei Maultiere diese abgeblühte Frau, eine Witwe, eingetauscht.« Es ist nicht anständig, Witwen zu ehelichen. Mit Witwen feiert man darum auch keine Hochzeit mehr und ladet keine Gäste ein. Der neue Ehemann zahlt einen gewissen Preis an die Familie des Verstorbenen, oder wem die Frau sonst gehört, und verläßt mit ihr, möglichst bei Dunkelheit und ohne viel Aufsehen zu erregen, ihr altes Heim. Hält die Witwe auf Anstand und gute Erziehung, so verläßt sie das alte Haus unter einem Strom von Tränen, auch wenn sie herzlich froh ist, daraus hinauszukommen.
Ein anderer, für das Rechtsempfinden des Hsi ninger Volkes charakteristischer Vorfall ereignete sich um die gleiche Zeit. Der Sekretär eines Ya men schuldete einer Bank 5 Tael und ließ diese kleine Schuld trotz wiederholter Mahnung stehen. Der Bankinhaber sandte jetzt aufs neue einen seiner Angestellten und drängte auf Bezahlung. Da der Mann aber nicht zahlen konnte oder wollte, gab es eine erregte Szene, und eigenhändig schnitt sich plötzlich der Schuldner mit einem Messer einen Finger seiner linken Hand ab und warf ihn dem jungen Mann mit den Worten vor die Füße: »Hier hast du dein Geld!« Wie ich mir sagen ließ, wäre die Schuld mit dem Blut beglichen gewesen. Die Gemüter der beiden waren aber bereits derartig erregt, daß der Streit weiter ausartete und der Bankangestellte von dem Sekretär und dessen Familienangehörigen tüchtig durchgeprügelt wurde. In seiner Not stieß der Angestellte mit dem Fuß aus und traf den Sekretär so unglücklich, daß dieser ohnmächtig zusammenbrach und zwei Tage darauf tot war. Die Sekretärsfrau lief nun zum Hsien und klagte den Bankangestellten des Mordes an ihrem Manne an. Der Hsien ließ den jungen Mann festnehmen, und er hätte ihn wohl auch enthaupten lassen, wenn nicht seine Familie von der Bank 2000 Tael als Ersatz für den Verlust des Sohnes verlangt hätte. Schließlich entschied der Hsien (der Vater-Mutter-Mandarin), daß die Bank 600 Tael an die Schreiberswitwe zahlen und den jungen Angestellten damit wieder freikaufen solle. Da die »Bank« noch obendrein Gerichtskosten an den Hsien entrichten mußte, so war ihr Inhaber wegen der 5 Tael um Haaresbreite an der Pleite, als ich Hsi ning fu verließ.
Es war mir klar geworden, daß ich bei dem neuen Zug ins Hochland an eine Fortsetzung des alten Wegs nicht denken konnte. Es hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen, an die alte Stelle auf der Tschang tang zu gelangen. Bis ich dorthin gekommen wäre, würden die Tiere so sehr durch die Winterkälte wie auch durch die Länge des Weges gelitten haben, daß ich nur wenig Aussicht gehabt hätte, einen weiteren großen Vorstoß machen zu können. Es fehlten mir aber vor allem auch die Mittel, ein zweites Mal eine gleich große Karawane auszurüsten. Ich hatte mich deswegen für eine Reise in das wenig gekannte K'am entschieden. In K'am, am oberen Yang tse kiang, um die Quellen des Mekong und bis an die Ufer des Salwen, liegt eine tibetische Provinz, die zu Hsi ning, bzw. zum Kuku nor-Gebiet gehört, weil sie in den Eroberungskriegen der Mandschu zu Anfang des 18. Jahrhunderts von Hsi ning-Chinesen besetzt wurde. Die Hsi ning-Leute nennen diese Provinz den Hung mao ör de ti fang, die »Heimat der Rothüte« Alle diejenigen, die nicht zur Gelugba-Sekte gehören, bezeichnen die Hsi ning-Chinesen als »Rothüte«, und zwar einerlei, ob sie nun dem Nima- (rNingma-), Saskya-, Karma-Ritus folgen. Der Unterschied all dieser Sekten besteht für den Laien vor allem in kleinen Äußerlichkeiten des Kultes, in den Anrufungen, in den Handbewegungen, in der Art der Musik, bei der Intonation der Instrumente und beim Pfeifen und Händeklatschen, für die Mönche aber in erster Linie in der Verschiedenheit der Schutzgötter., oder auch das Yü fu (im Pekingdialekt: Yü schu); es ist das Land des Nan̂ tsien (oder Na tschen) dyalbo, eines so gut wie unabhängigen Königs. Das Gebiet ist sehr groß, und wenig davon ist erforscht, weil es äußerst schwer zugänglich ist. Wir kennen deshalb nicht einmal seine genauen Grenzen. Es ist aber heute das wichtigste Zentrum des alten Nima- (rNingma-) Glaubens, eben dieser Sekte der Rothüte.
Um in die Länder des Nan tsien-Königs hineinzugelangen, hielt ich es in erster Linie für durchaus erforderlich, das Einverständnis des Hsi ning-Ambans einzuholen. Wie sollte ich aber an den hochmögenden Herrn gelangen? Es machte gewaltige Mühe. Dieser Ya men hatte erstaunlich viele und allmächtige Torhüter. An zwei Tagen ging ich um zehn Uhr morgens in den Amban-Ya men und verließ ihn am Abend, wenn die Tore geschlossen wurden, ohne daß mich die Torhütergesellschaft durchließ. Fast wäre mir die Geduld ausgegangen. Am dritten Tage aber wurde ich empfangen. Die Unruhe, die ich in den Vorhof brachte, schien allzu groß zu werden. Ich war mit Bettzeug angerückt, um es mir über Nacht bequem zu machen. Auch hatte ich eine Reihe Händler nach dem Ya men-Vorhofe bestellt, um nicht meine Zeit ganz ungenutzt verstreichen zu lassen.
Als ich endlich neben dem Amban saß, hatte ich den lieben alten Herrn nach einer Stunde so weit, daß er mir einen neuen Paß und Geleitbrief ausstellen ließ und mir auch schriftlich einen Dolmetscher für die Reise ins Nan̂ tsien-Land zusicherte. Dafür hatte ich ihm versprochen, künftig vorkommendenfalls auf Schadenersatzansprüche zu verzichten. Der Dolmetscher, Tschang mit Namen, der sich am nächsten Tage schon in meinem Gasthause vorstellte, war freilich viel zu jung. Er zählte erst zwanzig Lenze und sprach nur schlecht Tibetisch. Aber er war schon in K'am gewesen. Als ich ihn wegen seiner schlechten Sprachkenntnisse zurückweisen wollte, stellte man mir einen ganz alten asthmatischen Mann zur Wahl, der vom Opiumrauchen so geschwächt war, daß er kaum zu Pferde sitzen konnte und schwerlich lebend nach K'am gekommen wäre. Da ließ ich es doch lieber beim jungen.
Am 20. Januar war meine neue Karawane fertig geworden, und ich brach unverzüglich auf. Mr. Ridley geleitete mich noch bis vor die Stadt. Wie er mir später gestand, glaubte er damals nicht, mich noch einmal wiedersehen zu können. Die neue Unternehmung schien ihm allzu gewagt. Vor allem meinte er, ich hätte viel zu wenig Leute mitgenommen. Auch ich war überzeugt, daß wir zu schwach seien, daran aber waren nur meine geringen Geldkräfte schuld. Am ersten Abend blieben wir in Tschen hai pu, und am zweiten Reisetage erreichten wir Dankar. Ein weiterer Reisemarsch brachte mich die 70 Li nach Schara khoto hinauf. Ich hatte beschlossen, bis an den Hoang ho und in das ngGolokh-Land die Straße der K'am-Händler einzuschlagen, die ich schon 1904 mit Filchner gereist war, nur daß wir damals nicht wußten, daß dies ein vielbegangener Weg sei. Es ist der leichteste Weg und derjenige, auf dem man am raschesten vorwärts kommt.
Am 23. Januar lagerten wir in der Mitte der Remo yung (mongol.: Ära gol), wenige Kilometer von den Ruinen der Tsaghan tsch'eng, am Tage darauf ritten wir am Bayan nor vorbei und dem Süd-Kuku nor-Gebirge entlang und erreichten mit Dunkelwerden die Bauernkolonie Tschabtscha.
Bis kurz vor meiner Ankunft hatten dreißig Horkurma-ngGolokhs mit mehreren hundert Yak ein Lager neben dem Ort und hatten von hier aus, weil ihnen als »freien Fan tse« der Markt Dankar verschlossen ist, sie keinen Hsië dia dort haben und höchstens verstohlen und in kleinen Trupps die Stadt betreten können, die für den Stamm nötigen Jahresvorräte an Getreide eingetauscht. Diese dreißig sind für uns alte Bekannte. Es waren dieselben, denen im Herbste der Wan̂schdäch' Tschabtsa-Stamm so übel mitgespielt hatte.
Wer das Gruseln lernen will, muß nur in Osttibet mit einer Karawane reisen. Schon auf dem Wege bis Tschabtscha waren die Nächte sehr ungemütlich. Die Hunde wollten sich oft stundenlang nicht beruhigen und rasten immer wieder in die finstere Steppe hinaus. An dem Rasttage in Tschabtscha wurde uns eine Menge neuester Räubergeschichten zugetragen. Als ich den Versuch machte, für die nächsten Tagereisen mein Häuflein zu verstärken, wollten noch nicht einmal fünf bewaffnete Tschabtscha-Reiter mit mir gehen. Sie meinten, sie seien zu fünfen für den Rückweg noch zu wenig und zu schwach. So zog ich denn am 26. Januar allein mit meinem Trüpplein weiter. Zunächst folgten wir der großen Straße, die am Südabhang des Gebirges nach dem Dabassu nor führt. Wir waren etwa vier Stunden geritten, als ich mit dem Glase einen Punkt in der Ferne ins Auge nahm. Eine höchst sonderbare Erscheinung bewegte sich in der Richtung auf uns. In dem tanzenden Flimmerlicht glaubte ich anfänglich an einen Wildesel, dann an einen Bären. Schließlich hatten wir einen splitternackten Menschen vor uns, halbtot vor Kälte und erstarrt von dem eisigen Westwind. Er fror so, daß er lange kein verständiges Wort herausbrachte. Er war jedoch kein Verrückter, wie alle zuerst annahmen. Er stellte sich vielmehr als Lama vor aus einem Kloster bei Kue de, der, mit zwei Dienern von Ts'aidam kommend, nach Hause strebte. Sie waren am Abend zuvor überfallen, die beiden Diener, die sich zur Wehr setzen wollten, totgeschlagen worden, und der Lama hatte nur das nackte Leben retten können. Als wir ihm auf seine Bitten ein Fell und etwas Kleider umgeworfen und am Wegrand etwas Tee gekocht hatten, trabte er weiter auf der Straße nach Tschabtscha. Meine Mannschaft machte faule Witze über die tanzenden Sprünge des Tibeters. Ich aber befahl, eiligst von der gefährlichen Verkehrsader abzubiegen, und suchte näher am Huyu yung-Fluß, wo niedere Hügel und Dünen unsere Karawane vor Späheraugen verbargen, vorwärts zu kommen.
An diesem Abend zeigten alle meine Leute großen Eifer beim Scheibenschießen. Die Resultate waren freilich mehr als kläglich und viel schlechter als das Jahr vorher. Der Chinese »Li yen nien« aus Dankar und der Mohammedaner »Sechsunddreißig Ma« – der Mann hieß mit dem Vornamen Sechsunddreißig, weil er geboren wurde, als sein Vater sechsunddreißig Jahre alt war – waren zum Schießen viel zu zappelig, um je etwas zu versprechen. Unter uns acht Mann waren überhaupt nur drei Schützen, mich selbst dabei mitgerechnet, die zuvor schon mit Gewehren umzugehen verstanden. Herzhafte Jungen waren »So lu ma tse« und »Hai fa tschung«, beide Mohammedaner. So's Gesicht war voll tiefer Pockennarben, weshalb ihm seine liebenswürdige Mitwelt nach chinesischer Sitte den schmückenden Beinamen »ma tse«, der Pockennarbige, gegeben hatte. Er war der einzige, der nicht ein Wort Tibetisch konnte. Ich hatte ihn aber mitgenommen, weil er stämmig war und im Hufeisenaufnageln sich sehr geschickt anstellte. Hai, klein, zierlich und mit einem schönen Zopf begabt, war der arabischen Schrift kundig und der Sohn eines Ah'un Die Muezzin wie die Mollah werden in Kan su stets »ahun« genannt.. Seine Familie war durch die letzte Rebellion ruiniert worden. Als kleiner Junge hatte er den Auszug der Kinder Mohammeds nach Ts'aidam, an den Lob nor und bis Ili mitgemacht, und zuletzt war er auf dieser Irrfahrt Pferdebursche in den Zelten der H'asak gewesen. Tschang yin lu tse, ein Halbbluttibeter aus Schara khoto, wie auch der schon aufgeführte Li und »Sechsunddreißig« machten sehr bald hinter der Grenze kein Hehl daraus, daß sie bodenlose Angst hatten und vor jedem herrisch um sich blickenden Fan tse zitterten. Der Dolmetscher Tschang endlich, faul und dick, rotbackig und dabei auffallend großköpfig, war eine gewöhnliche chinesische Mischung von Geriebenheit und Jungenhaftigkeit. Ich hielt nie viel von ihm, zumal seine Kenntnisse der tibetischen Sprache noch sehr bescheidene waren, aber seine Stellung brachte es mit sich, daß ich auf sein »Gesicht« achten mußte. Er wurde immer mit »Herr« angeredet, auch wurde ihm ein Diener zugeteilt; er ritt meinen besten Ambler und bekam 10 Tael im Monat – so viel, wie er noch nie zuvor verdient hatte – neben seiner freien Kost.
Mit diesen Leuten und meiner kostbaren Karawane war ich nun wieder im Bereich der Tschebts'a fan tse. Wir bekamen von diesen aber nur in weiter Ferne einige schwarze Zelte, schwarze Punkte, zu Gesicht. Die Winterlager dieses Stammes liegen in den Schluchten des Süd-Kuku nor-Gebirges. An dessen Südabhang sind sie und ihre Herden allein vor den Stürmen geschützt. Als wir um halb acht Uhr morgens den Huyu yung tschü verließen, hatte es –22°. Der Fluß war in einer Breite von 20 m spiegelblank. Wir warfen ein paar Schaufeln Sand auf die Fläche und überschritten ihn dicht bei unserem Lagerplatz. Bis wir aber drüben waren, hatte der West nicht mehr viel von unserem Streusand übriggelassen, einige Maultiere stürzten trotz aller Vorsicht, und jetzt verstärkte sich der Wind von Minute zu Minute. Wir hielten auf den Gungga nor zu, der steil zwischen die Sandmassen, ganz wie der Si ni ts'o, eingelassen ist und durch eine breite Niederung mit dem Huyu yung-Tal in Verbindung steht, ohne daß freilich sein Wasser offen nach diesem Fluß abfließt. Ich hielt mich im Osten vom See, wo kein Weg ist, konnte aber dem Uferrand nicht folgen, weil die Schotter- und Sandmassen der Tala oder rDo tang allzu steil in die schlüpfrige Eisfläche abstürzten. Wir mußten bald die Tala-Fläche selbst erklimmen. Und oben empfing uns der zum rasenden Sturm gewordene West mit verstärkter Wucht. Stoß auf Stoß schüttelte und rüttelte an uns armen Reitern, als wollten uns Titanen aus dem Sattel heben. Von zehn Uhr an war die Luft so dicht mit Staub und Sand bepackt, daß wir kaum noch unsere nächste Umgebung erkennen konnten, daß wir uns eng zusammendrängen mußten, um niemand zu verlieren. In der weg- und vegetationslosen Wüste hätten wir die Richtung verloren, wenn ich nicht unausgesetzt den Kompaß in der Hand gehalten hätte. Die Tiere gingen nicht, sie erkämpften sich jeden Schritt vorwärts.
Um drei Uhr endlich fanden wir einen trockenen Erdriß, der uns etwas schützte. Wir kamen nicht länger gegen den Wind auf und bargen uns zwischen den hohen Dünen. Ich maß hier beinahe 33 Sekundenmeter Windgeschwindigkeit.
Als die Tiere abgeladen waren, stellten sie sich eng zusammen. Das Schwanzende gegen den Wind gedreht, ließen sie traurig den Kopf hängen. Abgesattelt wurde der Kälte wegen nicht mehr. Wir folgten darin ganz der Landessitte. Wir Menschen zogen den Pelzmantel über den Kopf, schützten uns dadurch gegen den alles durchdringenden Sand und warteten wie die Tiere. An ein Zeltaufstellen oder Kochen war nicht zu denken. Die erste Bö riß das Zelttuch fort, und das gesammelte Feuerholz wirbelte mit dem Sand davon. Erst als es dämmerte, war der Wind so weit abgeflaut, daß zwei Mann nach dem 1 km entfernten See abreiten konnten, um Eis zum Kochen herbeizuschaffen. Sie brachten die unangenehme Meldung zurück, daß jenseits des Sees Lagerfeuer und Pferde zu sehen seien. Der Gungga nor galt allenthalben als Stelldichein der Straßenräuber, und auch jetzt schien eine solche Schar dort ihr Lager aufgeschlagen zu haben. Meine Späher waren bis in die Nähe der Waka geschlichen und hatten festgestellt, daß sie eine Bande mit mehr als vierzig gesattelten Pferden bildeten. Wir verzichteten deshalb auf etwas Warmes an diesem Tag. Jeder bekam dafür zwei steinhart gefrorene Brote aus Hsi ning fu in die Hand. Atemlos horchten wir Stunden hindurch auf jeden fremden Laut, der das einförmige Zischen des feinen, windgepeitschten Sandes übertönte. Beim leisesten Mucksen eines Hundes erwartet man wieder einmal den Angriff, umklammert die Hand die geladene Waffe, legt den Sicherungshebel am Gewehr frei. Mitternacht ist längst vorüber, ehe der Schlaf eintritt, die Müdigkeit die Nervenspannung überwindet. Ich hatte in der Nacht eine Zehe im Verdacht, nicht mehr mitspielen zu wollen, und zog um Mitternacht meine Strümpfe aus, stopfte dafür etwas Gras in die Stiefel und reiste von nun an barfuß in den großen mongolischen Kanonenstiefeln weiter. Meine ganze Mannschaft steckte barfuß in ihren Stiefeln, und nie klagte einer über eine Erfrierung.
Am nächsten Tage brachte uns ein sechsstündiger Ritt über die Tala hinüber und in die Semenow-Ketten. Ein weiterer Marschtag ließ uns den Oberlauf des Da ho ba-Flusses gewinnen, und zwar da, wo dieses Wildwasser aus den Granitketten heraustritt und sich tief in Geschiebemassen einzuschneiden beginnt. Die Temperatur hielt sich auch am Tage in der Sonne unter – 10°; die Nacht hatte bis – 33°. Selbst die andauernde Nachtkälte hatte es aber nicht vermocht, den Da ho ba-Fluß ganz in Eisfesseln zu schlagen. Die Mitte des Flusses war eisfrei, und der Ritt über das Ufereis, dann durch die Strudel und wieder auf den jenseitigen Uferrand hinauf gestaltete sich sehr unangenehm. Alle Tiere mußten mit einem gewaltigen Sprung den glatten Eisrand erklimmen. Mein Pony glitt hierbei aus, und ich nahm ein Vollbad, konnte aber zum Glück noch Uhren und Aneroide aus dem Wasser heraushalten. Außer mir waren noch zwei Mann naß geworden und drei Lasttiere gestürzt. Kaum eine Minute auf dem Trockenen, hatte sich das Gefühl der Nässe schon verloren, waren die Kleider steif gefroren und klapperten wie Glas um den Körper. Ich ritt ohne Hosen weiter. Das einzige vorhandene Reservepaar, das wir mithatten, hatte ich dem nackten Lama geschenkt. Mein Gepäck war ja auf das Allernotwendigste reduziert.
Höher und höher ging es nun auf dem Weitermarsch. Da wir keinen anderen Weg wußten, hielten wir uns immer an die K'am-Straße. Jetzt legten wir an einem Tage eine Strecke zurück, zu der wir drei Jahre vorher zweieinhalb und drei Reisemärsche benötigt hatten. Meine bedächtige und sorgsame Vorbereitung der Karawane verschaffte mir die Freude, daß ich trotzdem kein einziges Tier einbüßte, und da ich mich mit der Kartenaufnahme nicht aufzuhalten brauchte, so blieb noch Zeit zum Jagen. Freilich war nicht viel zu holen. Dseren-Antilopen, Hasen, Füchse und Hühner waren meine Ausbeute. Auch Kulane (Kyang) waren häufig, aber sehr scheu, so wenig wir daran dachten, ihnen nachzustellen.
Spielend leicht ritten wir am 31. Januar über den Paß Tsassora (4550 m), an dem 1904 unsere Karawane um ein Haar den Untergang gefunden hätte. Am Nachmittage erlebten wir den ersten Schneesturm. Während dessen geriet ein Rudel wilder Yak bis auf wenige Schritte ans Lager. Es waren die ersten, die wir zu Gesicht bekamen, seit ich im Herbste die Tschang tang verlassen hatte. Obwohl wir seit Tschebts'a keine Zelte mehr zu Gesicht bekommen hatten, fanden sich in den tieferen Lagen auch keine Anzeichen für zeitweiliges Vorkommen der Tiere. Der Wildyak scheint mir in Osttibet nie unter 4000 m hinabzusteigen, und wo einmal der Mensch sich zu gewissen Zeiten ansiedelt, ist er nicht mehr zu treffen. Nur dort ist sein Bereich, wo die Menschen selbst wie ein flüchtiges Wild durcheilen.
Wir fanden hinter Tschabtscha täglich die Lagerplätze der Horkurma Tsung wa. Die Spuren wurden jeden Tag frischer. Wir rückten ihnen näher und näher auf. Aber noch eine andere große Karawane war vor uns. Manchmal hatte diese am selben Ort wie die Horkurma abgeladen. Die zweite Karawane war noch stärker und volkreicher. Wir schätzten sie nach der Zahl der Kochstellen auf siebenzig Reiter und weit über ein halbes Tausend Tragochsen. Es war für uns kein Zweifel, diese große Karawane bestand aus heimkehrenden K'am-Leuten, die, wie alle Jahre, im Oktober zuvor aus dem Yang tse-Tal herübergekommen waren und – wie wir gehört hatten – an Weihnachten wieder Dankar verlassen hatten. Am 2. Februar stießen wir auf ein junges Öchslein, das die Karawane verloren hatte, und das einsam am Wege neben einem großen Lagerplatz graste. Es schien wieder ganz erholt zu sein und war sehr munter, trotzdem es deutliche Zeichen eines erbitterten Kampfes mit Wölfen aufwies. Tiefe Bißwunden waren an den Hacken zu sehen, und an dem einen Horn klebte Blut und ein großes Büschel gelblicher Wolfshaare. Ohne ein Wort wurde der Yak gebunden und von den Mohammedanern geschächtet. Alle hatten wilden gleichen, großen Fleischhunger; die paar Hasen und Hühner, die ich zur Strecke brachte, reichten nie aus. Es war aber ein böses Geschick, das uns diesen Ochsen über den Weg schickte. Sah auch das Fleisch nicht krank aus, so wirkte doch sein Genuß verderblich. Drei von uns mußten am nächsten Tage auf die Pferde gehoben und oben festgebunden werden, hatten hohes Fieber und schmerzhafte, drückende Herzbeklemmungen. Wir fühlten uns wie zerschlagen, kurz, wir hatten dieselbe Krankheit, die uns am Tschürnong heimgesucht hatte. Die anderen, die nicht krank geworden waren, hatten das Glück gehabt, daß ihr Magen die Bissen, die ihm zugedacht waren, sofort wieder herausbefördert hatte. Wenn die Tibeter sagen, daß es eine Sünde an den Ortsgeistern sei, die schlappen Karawanentiere zu schlachten und zu essen, und daß die Strafe der Götter dafür nicht ausbleibe, so beruht dieser Glaube auf der Erfahrung, daß der Genuß solchen Fleisches schädlich wirken kann. Es waren die Lager in diesen ersten Tagen des Februar, wo wir in über 4000 m Meereshöhe reisten und Nacht um Nacht das Thermometer bis – 30°, ja – 35° sank, nicht der Ort, genau zu untersuchen, was die Ursache dieser Vergiftungserscheinungen war. Ich habe nur soviel feststellen können, daß alle die Tiere, die in Tibet wegen Erschöpfung nicht mehr mitkamen, und die ich töten ließ, Bauchwassersucht zeigten und eine außerordentliche Ansammlung seröser Flüssigkeit in allen Muskelscheiden aufwiesen, eine bei überanstrengten Tieren ja bekannte Erscheinung. Die große Höhe, die das Wasser schon bei 84° sieden läßt, und das mangelhafte Brennmaterial, das trotz des Blasebalgs dazu beiträgt, daß man alles Siedefleisch mehr roh als gekocht zu essen bekommt, helfen mit, daß schädliche Stoffe und Krankheitserreger nicht abgetötet werden.
Am 3. Februar ritten wir über die Tossun nor-Ebene und am Ostende des Tossu nor vorbei. Über einen flachen und niederen Paß kamen wir am folgenden Tage in die weite rDo tschü-Steppe, in der der Weststurm Staubtrombe hinter Staubtrombe herjagte. Wir waren jetzt in Gegenden gekommen, die unmittelbar in den obersten Hoang ho abwässern. Auch diese Talebene bildet zur Sommerszeit einen unbegehbaren Sumpf, auf den sich höchstens leichtfüßige Antilopenrudel hinauswagen können, jetzt aber war er zur staubigen Wüste, zur Treibsandbüchse umgewandelt. Am ersten Grasfleck, den wir fanden, wurde Lager geschlagen. Bis aber abgeladen war, war der Tag entschwunden. Um ein Haar wäre mir damals mein Dankar-Mann Li erfroren. Sein Gesicht war dick aufgedunsen, kalt, gefühllos und wachsfarben wie das eines Toten. Er konnte nicht mehr gehen und nicht mehr sprechen. Wie einen Mehlsack luden wir ihn mit vereinten Kräften auf ein Pony und schleppten ihn aus der schutzlosen Ebene. Durch Reiben brachten wir ihn im Lager wieder zum Leben, und am Feuer taute er buchstäblich vollends auf, so daß er bald den heißen Tee eigenhändig an seine blauen Lippen führen konnte. Sonderbarerweise hatte er außer seiner Gesichtshaut nichts ernstlich erfroren. Auf seinem Gesicht aber konnte man noch nach Monaten die Spuren dieses Gewaltmarsches lesen.
5. Februar. Wie gewöhnlich waren wir um acht Uhr in der Frühe wieder unterwegs. Wir kamen sehr rasch vorwärts und überschritten am Morgen kurz nacheinander zwei kleine Pässe. Als uns die Pferde keuchend auf den zweiten getragen hatten, drangen plötzlich unsere Blicke nach Süden. Unsere erste Etappe, die rMa yung, die breite Grasebene des oberen Hoang ho, lag vor uns ausgebreitet als ein breiter, ganz flacher Taltrog, der quer über unsere Wegrichtung lief. Niedere Hügel, die man überall von den Talmulden aus zu Pferde erklimmen kann, lagen diesseits und jenseits dieser breiten Ebene, ein wildes Wirrsal bildend. Beim Abstieg von dem kleinen Paß war ich vorausgeritten, um am Hoang ho die beste Übergangsstelle ausfindig zu machen. Da sprengt plötzlich »Sechsunddreißig« auf ausgepumptem Pferd zu mir: »Die Leute mit den Lasttieren haben halt gemacht. Menschen mit brennenden Luntenflinten müssen ganz nahe sein.« Der unverkennbare Geruch von brennenden Lunten war ihnen in die Nase gestiegen. Ein Blick über den nächstgelegenen Hügel belehrte mich, daß wir in der Tat Menschen in allernächster Nähe hatten. Wir waren ganz unversehens mitten in das Winterlager eines volkreichen Nomadenstammes geraten. Nur das Tälchen, dem entlang der Verkehrsweg von Dankar nach Kʿam läuft, war leer und unbesiedelt geblieben, wahrscheinlich um die Herden nicht der Gefahr auszusetzen, mit fremden Tieren und deren Krankheiten zusammenzugeraten.
Rasch zog ich meine Perücke mit dem lang baumelnden Zopf aus der Satteltasche, drückte die Pelzmütze darüber und band mir wie an den kältesten Tagen mein rotes Turbantuch um das Gesicht, um nach Möglichkeit den keimenden blonden Bart zu verdecken. Kaum war dann die Karawane aufgerückt, als schon Späher auf uns zuritten und nach »Woher?« und »Wohin?« fragten. Zu den ersten Reitern, die auf ungesatteltem Pferd und nur mit dem kurzen Schwert im Gürtel herangesprengt kamen, gesellten sich bald weitere mit langen Lanzen und Gabelgewehren in der Hand. Im Handumdrehen war mein Häuflein umringt von wilden braunen Gesellen. Man betrachtete sich gegenseitig von Kopf bis zu Fuß mit den mißtrauischsten Blicken. Dem einen Fan tse saß sein Filzhut, der die Form eines abendländischen Zylinders hatte – nur daß die Röhre bei 25 cm Höhe einen Durchmesser von noch nicht 10 cm besaß – wie das Cereviskäppchen der Korpsstudenten vor dem rechten Ohr; der andere hatte sich ein rotes Fuchsfell aufgesetzt, das er kunstvoll mit seinem Zopf festgebunden. Der hatte trotz der Kälte den ganzen rechten Arm nackt; der trug auf der bloßen Brust eine Kupferbüchse mit einem Bronzebuddha, der hinter einer Glasscherbe vorschaute; sein Heiligtum mußte mehrere Pfund schwer sein.
Jetzt endlich wird das Anstarren durch ein schnarrendes »Arro!« unterbrochen. Es gibt ein strenges Verhör. Tausend Fragen sollen beantwortet werden. Wir erfahren allmählich, daß wir dem großen Stamm ngGolokh-Horkurma in die Arme gelaufen waren, ein Name, der neues Bangen barg. Die Unterredung währte eine halbe Stunde. Selbstredend wurde sie hoch zu Roß geführt. Auf meiner Seite waren die beiden Tschang die Hauptsprecher. Ich hielt mich wohlweislich, soviel ich konnte, im Hintergrund. Trotz aller Verstellungskünste fiel ich aber jedem auf. Ein ngGolokh rief frech, auf mich deutend: »Wessen Frau ist denn diese Chinesin da?« Bei meinem winterlichen Pelzschuhwerk von 35 cm Sohlenlänge und meiner Körpergröße von 1,82 m war es allerdings ein Irrtum, der uns kaum ernst bleiben ließ.
Endlich willigte der Sprecher der Bande ein, daß wir, um einige Hämmel und Pferde zu kaufen, neben seinem Zelte ein Lager errichteten. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es im Verkehr mit Tibetern das wichtigste ist, möglichst rasch auf Kaufgeschäfte überzulenken.
Wir stellten um Mittag unsere zwei kleinen Zeltchen etwa 3 km vom Eisbette des Hoang ho auf. Ganz nahe von uns lief eine große Yakstraße das breite Tal hinauf, genau nach Westen. Sie führte zum Tsʿaring nor und zum Sternenmeer hinauf und ist die uralte Völkerstraße, die das ngGolokh-Land mit Lhasa verbindet. Kein Kilometer von uns waren neben der Straße kleine Mauern aus Leder- und Wollsäcken errichtet, zwischen denen Kochfeuer qualmten. Schon glaubten wir, wir hätten die Tschendu- und Lab gomba-Händler vor uns. Doch erfuhr ich, daß es ngGolokh-Khorgan-Leute waren, die dort lagerten; vierzig Bewaffnete mit dreihundert Yak. Die Khorgan sind einer der mächtigsten und deshalb auch räuberischsten Stämme im ganzen ngGolokh-kaksum und haben ihre Sitze auf der Wasserscheide zwischen Hoang ho und Yang tse kiang, unweit der Grenze von Se tschuan. Die Händler hier hatten weiter im Westen in einer alten Pfanne Kochsalz geholt, das sie fünfzig Reisetage weiter östlich im Königreich Somo gegen Getreide einzutauschen pflegen. Die Leute benahmen sich sehr unfreundlich und abweisend und duldeten nicht, daß auch nur einer von uns ihr Lager betrete. Ich sah einige im Zelte des Sprechers Lobzang, als ich dort, frisch rasiert, frisiert, patiniert und dreckbeschmiert, eine Tasse Tee mit Tsamba zu mir nahm. Sogar gegen den lustigen Lobzang, bei dem den ganzen Tag Gäste aus und ein gingen, benahmen sich die Khorgan sehr hochfahrend.
Horkurma wohnte in diesem Winter auf dem linken Hoang ho-Ufer. Die Siedlungen zogen sich an die 30 km weit das Tal hinab. Alle die vielen kurzen, aber breiten Seitenschluchten und Mulden, die von Norden her in das breite Haupttal münden, waren zurzeit bevölkert. Die Anzahl der Familien oder Zelte wurde mir bald mit fünfhundert, bald mit sechshundert angegeben. Drei, vier, selten bis zu sechs schwarze Zelte lagen beisammen. Meist waren es Gruppen von Verwandten und Verschwägerten oder Vereinigungen, die einstmals von einem anderen Stamme abgefallen und zu den berüchtigten rMa yung-Räubern übergetreten waren. Diese kleinen Gruppen lösten sich im Herdenhüten und in ihren kleinen und großen Haushaltssorgen ab. Man hatte immer sorgsam Stellen ausgesucht, die etwas Schutz gegen den Wintersturm boten, der mit ungeminderter Wucht in dem breiten Hoang ho-Tal sauste und die Eiseskälte, die in den 4100 m Höhe herrschte, durch Kleider und Felle hindurch bis ins Mark hineinpreßte.
Meine erste Sorge nach meiner Ankunft war, mich mit dem Oberhäuptling gut zu stellen. Der Dolmetscher Tschang und der große Tschang mußten so bald wie möglich sein Zelt aufsuchen und ihm einen Khádar und Geschenke überbringen. Die Bitte um sicheres Geleite schlug der Horkurma-Chef aber ab. Diesseits des Hoang ho sei keine Gefahr, gab er zur Antwort, was drüben geschehe, dafür könne er nicht einstehen. War es wahrlich nicht viel, was uns zugesagt wurde, so war es doch schon viel mehr, als wir erwartet hatten. Mein Dolmetscher Tschang hatte mich vorbereitet. Er war vor einigen Monaten als Begleiter des Hsi ninger Bi tieh sche von Kʿam hier durchgekommen. Der Bi tieh sche, ein Mandschure, und der der Tributmission zugeteilte Offizier, ein Chinese, hatten sich in Kʿam entzweit. Der Offizier ließ deshalb dem Beamten vier seiner Soldaten und reiste mit dem Rest seiner Untergebenen und mit ganz wenigen Dscherku ndo-Führern dem Mandschuren voraus. In der Nähe des Hoang ho angekommen, sah er sich plötzlich vierhundert Reitern gegenüber, die ihn anhielten und umstellten. An ernstlichen Widerstand dachte man auf chinesischer Seite keinen Augenblick. Man begann sofort mit Unterhandlungen. Der Offizier und seine kleine Karawane, die nicht einmal den geringen Betrag des Tributerlöses bei sich hatten, durften erst weiterziehen, nachdem man ein gesatteltes Pferd, ein Gewehr mit Munition, eine Lanze, ein Schwert und Tee als Zoll bezahlt hatte. Dem Bi tieh sche aber, als er ahnungslos einige Tage hinterher kam, erging es um Haaresbreite ganz schlimm, weil er noch weniger Gewehre, dagegen eine schwerere Karawane und, wie die Fan tse richtig in Erfahrung gebracht hatten, auch den Tribut mit sich führte. Ihn retteten vor gänzlicher Ausplünderung nur die Tibeter aus Lab gomba, die ihn in größerer Zahl geleiteten, und die für die Chinesen fechten und ihr Leben lassen wollten. Nur weil Lab gomba einen so großen Ruf in der weitesten Umgebung hatte, ließen die Wegelagerer die Gesandtschaft um einiges erleichtert ziehen. Trotz dieser frechen Übergriffe der ngGolokh tat der Amban nichts, um diese wichtige Straße in seinem Gebiet für seine Truppenzüge sicherzustellen. Man beruhigte sich mit den Worten, Horkurma wie alle ngGolokh gehören nicht einmal dem Namen nach zu Kan su, sondern höchstens nach Se tschuan, also in einen anderen Staat. Außerdem hatten – von einigen Kurieren abgesehen – nur alle drei Jahre chinesische Soldaten diesen Weg zu ziehen, und meist sitzt Horkurma etwas weiter flußabwärts und denkt nicht an Belästigungen. Eine Unterwerfung rentierte sich also nicht. Ja, eine ernstliche Unterwerfung dürfte bei der Kriegstüchtigkeit der Eingeborenen und bei der Rauheit der Natur des Landes noch lange eine sehr riskante Sache bleiben, der nicht bloß das ancien régime, sondern auch Jungchina solange wie möglich aus dem Wege gehen wird. Die ngGolokh werden noch lange frei leben und sich um den Willen sowohl der Chinesen wie des Dalai Lama einen Deut kümmern können.
Ich blieb zwei Tage in diesem Lager. Es war die erste Ruhepause seit dem Verlassen von Tschabtscha. Wir waren vollauf beschäftigt mit dem Ausbessern der Sättel und Geschirre. Zehn Tage hatten wir nur bedurft, um mit all den Packtieren von Dankar bis an den Hoang ho zu reiten, und die Tiere waren noch alle munter. Obwohl die Nährkraft des abgestorbenen Wintergrases äußerst gering ist, blieben mir Verluste erspart, weil die Tiere vorher von mir gemästet worden waren und dann ohne übergroße Anstrengungen über die gefrorenen Sumpfebenen hinwegkamen. Wir hatten außerdem bis hierher täglich etwa 2 Pfund geschrotete Erbsen gefüttert. Hier am Hoang ho gelang es, in den Zelten so viel trockenen Quarkkäse zu kaufen, daß ich noch mit über 2½ Zentnern, d. h. zwei ganzen Lasten, weiterreiten konnte. Der Käse wurde mit den Erbsen zu gleichen Teilen gemischt und so von den Pferden und Maultieren fast ohne Ausnahme gerne angenommen.
In der Nacht bekam Frau Lobzang Dandu dschumo einen Sohn. Sie machte es außerhalb des Zeltes, im Zickchenstall, ab, wo zwar kein Dach, aber eine niedere Schutzwand aus Erdschollen und gefrorenen Kuhfladen die allerschlimmsten Windstöße abschwächte. Es wäre im Zelt einige Grade wärmer gewesen, aber aus religiösen Vorurteilen vermeiden es die Nomadenweiber, im Küchenraum ihre schwere Stunde zu verbringen. Die ganze Nacht betete der Ehemann mit einigen Lama im Innern des Zeltes unter Pauken-, Trommel- und Trompetenbegleitung Die Placenta wird abseits von den Zelten und möglichst bei Nacht zu einer von einem Lama berechneten Zeit vergraben.. In dieser Nacht ging die Temperatur im Freien auf – 32° herunter. Am anderen Morgen mieden alle Nachbarn die Stätte, weil sie durch die Geburt unrein geworden sein soll. Der Familienvater kam sofort aus dem Zelt heraus und warnte alle Kommenden vor dem Betreten seines Hauses. Ich durfte mir aber, als ich ein Geschenk brachte, den Sohn im Zickchenstall ansehen. Die Mutter war schon wieder am Zeltherd tätig. Der Neugeborene aber war in der Obhut einer älteren Dame, die ihn unter ihrem Pelzmantel an ihrem Körper warmhielt. Infolgedessen bemerkte ich auf seinem Körper schon einige Läuschen, von denen ich eines sittsam fing und behutsam neben mich auf den Boden setzte, denn auch die ngGolokh sind fromm und wollen, daß keinem Lebewesen ein Leid geschehe. Das Nabelschnurende des Jungen war nur umgekrempelt, nicht abgebunden. Er war über und über mit Butter beschmiert. Gewaschen werden solche Kinder überhaupt nicht, was bei der herrschenden Kälte eigentlich selbstverständlich ist. Es ist eine Hauptsorge der Mütter, daß ihre Babys wie die jungen Hunde nicht naß werden. Bei den nach unseren Begriffen unzureichenden Behausungen haben die Tibeter jedenfalls auch richtig beobachtet, daß das Wasser nur schaden kann. Tücher zum Abtrocknen kennt man ja nicht. Jeder Stoffetzen ist dort oben zu kostbar, um zu solch profanen Zwecken verwendet zu werden. Wasserbecken zum Waschen und gar Schwämme sind nicht einmal dem Namen nach bekannt. Wenn die Säuglinge älter sind, kommen sie in einen Ledersack aus einer Kitzhaut, in dem sich trockener Schafdung befindet, der wie Torfmull wirkt, so daß die kleinen Menschen immer trocken liegen.
Um die luftigen Zelte bauen die tibetischen Frauen im Winter meterhohe Mauern aus Kuhdung, die auf drei Seiten gegen den Wind schützen sollen. Nur der Osten bleibt frei. Diese Wälle und Windschirme sind für uns das einzige, was die Nomadenbehausung einigermaßen erträglich macht. Neben den großen Herdresten bezeichnen sie noch nach Jahren die alten Lagerplätze.
In Horkurma fiel mir die Körpergröße der Männer wie der Frauen auf. 1,7 m, ja 1,75 m war unter den Männern gar nichts so Besonderes. Es waren knochige, kräftige Gestalten, und eine ganze Anzahl hatte mächtige, dicke Adlernasen. Der Kopf wurde rasiert, oder es wurde nur kurzgeschnittenes Haar getragen. Es ist dies die übliche, wenn auch nicht ausschließliche Haartracht der ngGolokh, die dadurch oft andeuten wollen, daß sie freie Männer sind. »Wir sind freie Menschen, und jeder von uns kommt als kluger Mann und mit dem Gewehr in der Hand zur Welt«, ist die ständige Redensart der ngGolokh. Kein anderes Volk in Zentralasien fand ich gleichermaßen stolz und kriegerisch. Fragt man, warum sie so mutig seien, so wird die Sage erzählt, daß im ngGolokh-Lande einst König Gesar sein Wunderschwert verloren habe, das seither noch dort heilig gehalten werde und von seinem Zauber nichts eingebüßt habe, auch daß ihr Ortsheiliger, der Berggott vom Eisgipfel Amne Matschen, sie behüte und zu Taten anfeuere.
Das Lager des Oberhäuptlings war eine gute Reitstunde von dem meinigen entfernt. Es bestand aus einer Gruppe von Zelten riesiger Ausmessung, lauter Yakhaarzelten. Das eine konnte weit über hundert Personen fassen, und das, in dem ich den wegen seiner großen Nase meist unter dem Namen Nawodyi bekannten Herrn selbst fand, war bei 8 m Breite 25 m lang. Der Häuptling war ein Fünfziger mit sehr klugen braunen Augen und einem stolzen, nie zu überwindenden Mundwerk. Seine Familie soll schon seit vielen Generationen die Führung in Händen haben. An Schafen, Yak und Pferden ist Nawodyi bei weitem der reichste Mann seines Volkes. Mit seinem Bruder zusammen führt er ein sehr strenges Regiment über seine schwer zu lenkenden Untertanen. Jeder Diebstahl an den eigenen Stammesgenossen wird von ihm strenge geahndet. Ausstechen eines Auges, Durchschneiden der Knie- oder der Achillessehne, Fingerabhacken sind Strafen, die er über Untertanen verhängen kann, die am eigenen Stamme freveln. Haben seine Leute dagegen Fremde, gar eine Lhasa-Karawane überfallen und geplündert, so erhält er, auch wenn er gar nicht der Führer war und gar nichts von dem Anschlage wußte, einen Teil der Beute ausgehändigt.
Von dem Zelte des Lobzang bis zum Ma tschü-Hoang ho Ma tschü, der tibetische Name des Hoang ho, nach Jäschke und nach Ch. Das, Tibetan-Engl. dict., orthographisch »rma« geschrieben, bedeutet wahrscheinlich »Fluß der guten und glücklichen Weiden«; der Name nimmt hiernach Bezug auf die schönen Weiden, die von Horkurma an sich durch das ganze ngGolokh-Land bis Kue de an seinen Ufern hinziehen. brauchten wir wenig über eine halbe Stunde. So weit mußten aber auch die tibetischen Frauen gehen, um Wasser oder Eis zum Kochen heimzuschleppen. Der Übergang über den Fluß machte keine weiteren Schwierigkeiten. Die Ufer sind überall flach, und der Fluß war in einer Breite von 300 m gefroren. Da keinerlei Schnee auf dem Eise lag, so glitten die Tiere aus, konnten aber, nachdem wir einen Weg mit Sand bestreut hatten, doch mit den Lasten auf dem Rücken ans jenseitige Ufer gelangen. Jenseits ging der Marsch zwischen niederen, grasbedeckten Hügeln hindurch an zwei Seen vorbei, die die Ebenen zwischen den Hügeln ausfüllten. Durch Geröllmassen aufgestaut, standen sie mit dem Hoang ho nur durch ein Überreich in Verbindung. Um Mittag wurde es nebelig, der Wind ließ nach, und bald darauf begann es zu schneien. Mitten in diesem Schneegestöber stießen wir auf eine riesige Yakkarawane. Ein Seitental herab trottete alle paar hundert Meter ein dreißigköpfiger Yakhaufen, den zwei oder drei Bursche antrieben. Es waren die Kʿam-Leute, die aus Hsi ning in ihre Heimat zurückkehrten. Sie hatten zwei Wochen bei den Horkurma gerastet und waren seit heute morgen auf dem Weitermarsch. Einen Teil der Leute hatte ich schon in Dankar und Hsi ning kennengelernt. An einen ihrer Führer, an den Häuptling, den Be hu, von Tschendu, hatte ich mir ein Empfehlungsschreiben aus dem Amban-Ya men mitgeben lassen. Jetzt war dieser Be hu den Yakochsen weit vorausgeritten. Bis wir ihn einholten, hatte er halt gemacht. Zwei Pferdeknechte, die mit ihm geritten waren, hatten bereits die Pferde versorgt, sie gekoppelt und unter dem Sattel an langen Wollstricken grasen lassen. Der Be hu Bon aber war damit beschäftigt, ein Dungfeuer in Gang zu bringen und sich eine Tasse Tee zu kochen. Er war ein breitschultriger, kräftiger Vierziger, 1,65 hoch, der mich mit lächelnder Miene begrüßte und mit vielen Worten zum Sitzen einlud, obwohl er mich ganz bestimmt zu allen Teufeln wünschte. Mein Tschang breitete mir einen Ning hsia-Teppich in dem Schnee aus, und ich hockte mich mit gekreuzten Beinen ans Feuer neben den kleinen Tibeterfürsten, auf dessen nackter Brust fünf tiefe Moxennarben Diese entstehen dadurch, daß die Moxa-Beifußwolle, ein grauer wolliger Stoff, der aus den Blättern und Spitzen des gemeinen Beifußes gewonnen wird, in einen Zoll langen Kegel zusammengerollt, mit Speichel auf der Haut befestigt und angezündet wird. Es bleibt ein Brandmal zurück, das in Eiterung übergeht. Gegen Gicht usw. wird dies Verfahren als Heilmittel gebraucht. von einem unlängst überstandenen Rheumatismus erzählten. Als ich den »Komo«, den Fellsack mit der eisernen Röhre am einen Ende, der als Blasebalg verwendet wird, in die Hand nahm und wie ganz selbstverständlich das Feuer damit in Glut blies, wurde der Be hu sichtlich zutraulicher. Wir unterhielten uns über den bösen Weg, den wir beide machen müßten, über die Gefahren, über die Räuber, die so zahlreich auf jeden Reisenden lauern. Schließlich meinte er, da ich einen Tung sche (Dolmetscher) vom Amban und einen Paß mit dem kaiserlichen Stempel habe, da wir uns beide nun bei den freien ngGolokh getroffen hätten, so wollten wir einander nichts anhaben, sondern Freunde werden, gemeinschaftlich weiterziehen und im Falle der Not einander aushelfen. Vor allem schien ihm das Dutzend Repetiergewehre und Handfeuerwaffen, das ich besaß, eine ganz erwünschte Verstärkung und eine Garantie zu sein, um seine Habe sicher über die Tschang tang zu bringen.
Mittlerweile waren die ersten Trupps Yak eingetroffen. Mit ihren lauten, lustigen Rufen stürzten sich die Treiber an die Arbeit und hoben im Takte eines einfachen Liedes die ½–¾ Zentner schweren Halblasten von den Sätteln. Sie bestanden hauptsächlich aus den trockenen chinesischen Hängenudeln (goa mien), auch aus gelblichem Ning hsia-Reis, aus Stoffen und eisernen Kochkesseln. Tee kommt in das südliche und zentrale Tibet nie über Kan su. Mit den in Lan tschou fu und Hsi ngan fu gepreßten Teeziegeln wird nur der Kuku nor und Turkistan versorgt. Aus den Lasten bauten sie in einem großen Kreis in Abständen von 50–100 m kleine Mauern. Diese standen wie kleine Forts um den weiten Platz in der Mitte, auf dem am Abend an langen Stricken die sechs- bis siebenhundert tintenschwarzen Yak angebunden wurden. Auch mehrere kostbare Maultiere und schwarze Eselhengste hatten die Leute in Kan su gekauft; die letzteren waren sorgsam in dicke Filzmäntel eingenäht, die nur die Beine und die Augen herausschauen ließen. Als meine Lasttiere ankamen, suchte der Be hu selbst einen Platz für uns aus, und seine Knechte halfen scherzend und lachend beim Abladen meiner Kisten und beim Aufrichten meines Zeltes. Dichter Schnee wirbelte noch immer vom bleiernen Himmel. Daß dazu der Westwind durch das breite Tal pfiff, hinderte keinen, den ungefügen Pelzmantel von den Schultern fallen zu lassen und mit nacktem Oberkörper zu hantieren. Es war ein Vergnügen, die kleinen und schmächtigen, aber flinken Bursche bei der Arbeit zu sehen. Freilich, kein Volk auf der Erde kann schmutziger aussehen. In wirren Strähnen fiel ihnen das blauschwarze Haar über Stirn und Nacken. Aus dicken, verfilzten Haarwülsten strebten einzelne der schwarzen Borsten nach allen Richtungen. Nur wenige hatten ein übriges getan und sich vor Antritt der Reise die Haare vorn auf der Stirne als Simpelsfransen zurechtgeschnitten. Bis zum ärmsten Treiber hinab waren dagegen alle schwer bewaffnet, selbst beim Abladen blieb das Schwert vor dem Bauche stecken. Die Waffen, vor allem die Schwertscheiden, zeigten hübsche Eisenarbeiten; viele Scheiden hatten über einem hölzernen oder ledernen Grund Arabesken aus Schmiedeeisen, waren silbertauschiert oder teilweise feuervergoldet, und große Korallen und Bernsteinstücke prangten auf den Arabesken, die an nepalesische Arbeiten erinnerten. In der Kleidung war es am meisten die Beschuhung, die von der der Kuku nor-Tibeter abstach. Der Banag-Tibeter und der Kuku nor-Mongole tragen Schaftstiefel mit schweren, dicken Sohlen, sogenannte Mongolenstiefel. Die Mode von Kʿam schreibt Schäfte aus farbigen, meist roten Wollstoffen vor, die sich wie weite Strümpfe ansehen, an die eine dünne Ledersohle genäht ist (siehe Titelbild). Kurz unterhalb des Knies werden diese weichen Schäfte durch ein Band festgehalten. In diesem Schuhwerk läßt sich vorzüglich marschieren, was in mongolischen Kanonen so gut wie ausgeschlossen ist. In den Schmuckgegenständen, den Ringen im linken Ohr und den Gawos oder Reliquienbüchsen, die die Kʿam-Leute trugen, war nur der Unterschied, daß alles reicher, hübscher und mehr im indischen Geschmack gehalten war, als was weiter im Norden getragen und angefertigt wird. Wenn Banag und ngGolokh schöne Schmuckgegenstände tragen, so sind es stets Arbeiten aus Kʿam, aus Dergi oder Lhasa und Nepal.
Als das Lager in Ordnung und die Tiere auf die Weide getrieben waren, kamen zum Waka des Be hu drei über fünfzig Jahre zählende Männer, von denen mir der eine als der Tsung bon, der Vorsteher der Handelsleute von Lab gomba, und die zwei anderen als Ortsälteste und Adlige von Dörfern südlich des Yang tse kiang vorgestellt wurden. Ihnen gehörte der größte Teil der Karawane. Der Be hu hatte mitsamt dem Eigentum seiner Untertanen noch nicht einmal hundertfünfzig Ochsen. Diese drei »Goba« waren von Anfang an sehr wenig zuvorkommend gegen mich und hatten auch an den folgenden Tagen selten ein freundliches Wort als Erwiderung auf den landesüblichen Gruß, während ich von allen Kleinkaufleuten und Treibern bald mit einem freudigen »Odyi! Odyi!« oder der Frage: »Frierst du nicht?« begrüßt wurde, sowie ich in die Nähe eines Yaktrupps kam.
Unweit von unserem ersten gemeinschaftlichen Lagerplatz standen noch einige spärliche Gruppen von Horkurma-Zelten. Da Tschang erkannte in dem einen der Familienväter im Vorbeireiten einen alten Bekannten aus den Tagen, als er nach seiner Beraubung am Dung re tsʿo dschayu nach Horkurma geirrt war und bettelarm beim Häuptling für die Kost die Schafe hütete. Ich gab ihm den Auftrag, den Alten in seinem Heim aufzusuchen und mir noch einige Schafe zu erstehen. Aber dieses Mal durfte er das Zelt seines Bekannten nicht betreten, da dieser erst ganz kurz vorher, als er auf dem linken Hoang ho-Ufer wohnte, seinen Sohn verloren hatte. Nach der Aussetzung der nackten Leiche war die Familie mit ihren Verwandten rasch mit Herden und Zelten und einigen Lama auf das rechte Hoang ho-Ufer übergesiedelt. Die Lama waren noch damit beschäftigt, Beschwörungsmessen für oder gegen den Geist des Toten zu lesen, und deshalb wollten die geängstigten Leute keinem Chinesen oder Fremden Zutritt gewähren. Wir konnten auch in den Nachbarzelten unseren Fleischvorrat nicht vermehren, weil es Verwandte waren. Solange gebetet wird, wollten alle Angehörigen weder für sich ein Tier schlachten noch etwas verkaufen oder vertauschen.
Wegen der Nähe dieser Zelte fürchteten die Tschendu-Leute noch nichts für die Nacht; sie öffneten Branntweinfäßchen, die sie von Dankar mitgebracht hatten, und feierten ein festliches Gelage. Freilich, vor kleineren Diebereien waren sie auch hier nicht sicher, denn erst die Nacht zuvor, als sie noch neben dem Zelt des Horkurma-Oberhäuptlings lagen, war dem Be hu ein Pferdchen gestohlen worden, das ihm allerdings sein guter Freund, der »Humbo« von Horkurma, sofort wieder ersetzt hatte. Die Macht der Stammeshäupter reicht bei den Nomaden selten so weit, daß sie solche Übergriffe verhindern können. Vor größeren Überfällen aber, versicherte mir der Be hu, seien wir hier ganz sicher.
Bei dem Fest der Tschendu-Mannen saß ich in dem hübschen bunten, blau, weiß und grün gestreiften Zelt des Be hu. Bald nach dem »lha gsol«, der lauten Anrufung und dem Opferguß an die Götter, löste der Branntwein die Zungen, und ein »Zangsker«, ein Liedchen oder Schnaderhüpfel löste das andere ab. Eine Stunde erst mochte ich in der Runde der fünfzehn bis achtzehn Männer gesessen haben, lauter Bronzefiguren, fratzenhaft vom flackernden Feuer beschienen, da stieg das Gehänsel und nahm rasch scharfe Formen an. Mit einem Male springt der Sohn des Be hu, ein bildhübscher Jüngling von knapp achtzehn Jahren, an dem das rauhe Klima seiner Heimat noch nichts verwettert hatte, wie von der Tarantel gestochen vom Boden auf. Mit funkelndem Auge reißt er sein breites Schwert aus der Scheide, und mit einer wilden Verwünschung ist er im Begriff, auf den Sänger, der eben an der Reihe ist und seine Zuhörer lachen macht, loszuhacken. Ganz knapp nur fangen die Dienstleute den wohlgezielten wuchtigen Hieb mit ihren Klingen auf, und der Be hu entwaffnet eigenhändig und mit Mühe seinen toll gewordenen Sohn. Ein alter, wunder Punkt war in dem Liede genannt worden. Der Sänger, der im Dienste des Be hu stand, war ein Dergi-Mann von Geburt. Die Dergi-Leute aber hatten in den letzten Jahrzehnten, ihre Übermacht ausnutzend, die Tschendu durch Übergriffe in deren Land, durch widerrechtliche Wegnahme und Besteuerung ihrer Äcker derartig gedemütigt, daß der Be hu sich schließlich keinen anderen Rat mehr wußte, als den übermütigen Dergi für seine altangestammten und frei ererbten Ländereien eine jährliche Pachtsumme anzubieten. Ja, er war jetzt in erster Linie wegen dieser Händel persönlich nach Hsi ning gereist und hatte vor dem Amban Klage geführt und die chinesische Regierung um Schutz angegangen. Jetzt war hierüber ein unbedachtes Wort gefallen, und jäh war unser Fest abgebrochen worden. Der kleine Prinz wollte sich nicht beruhigen lassen, vielmehr jedem sein Schwert entwinden und damit den Gegner niederschlagen. Kaum weniger hitzig war sein Widerpart. Als noch der Häuptling seinen heißblütigen Sohn festhielt, drückten sich meine Mohammedaner, und auch ich schlüpfte wortlos davon, sowie ich eine Lücke gefunden. Wir kannten alle die Gefährlichkeit der Tibeter, wenn sie durch Alkohol erhitzt sind, und hatten zu fürchten, daß sich plötzlich die ganze Wut gegen uns kehren würde.
In den nächsten Tagen ging unser gemeinsamer Marsch durch ein niederes Hügelland. In der Karawane war wieder völliger Friede. Am zweiten Tage überschritten wir den Tschiang tschü (Kyang tschü), der nur 20 m breit und vollkommen zugefroren war. Er windet sich durch ein breites Tal, das im Sommer von den Nomadenherden besucht wird. Hier verlor die große Karawane zwei Yak, die auf dem glatten Eis ausgerutscht waren und eine Hüftverrenkung davongetragen hatten. Einem großen Teil der Tiere und allen den kostbaren Yakbastarden hatten die Treiber für diesen Übergang die Hinterbeine an den Sprunggelenken mit Stricken zusammengebunden, damit sie sich nicht verspreizen sollten. Die schwer beladenen Tiere mit den kurzen unbeweglichen Füßen nahmen sich wie große Kommoden aus, die einzeln von hinten über das glatte Eis geschoben wurden. Auch auf den folgenden Märschen waren die Verluste an Ochsen recht bedeutend, obwohl die Tibeter allerhöchstens 20 km an einem Tage zurücklegten. Wir hatten aber vielfach über gefrorene Naka-Felder und Hochmoore zu klettern, die die Tiere auspumpten. Man brach immer ungemein früh auf, so früh, wie ich meine Chinesen nie auf die Beine gebracht hatte. Der Tag dämmerte erst unmerklich, als schon die letzten Yaktrupps das alte Lager verließen. Der Be hu und seine Reiter blieben in den ersten Tagen so lange zurück, bis meine Chinesen ihren Tee gekocht und die Lasten aufgebunden hatten. Dann machte er mir mit grinsendem Prahlen vor, wie rasch sie ihr Zelt abschlagen und verpacken, wie gewandt ein Fan tse seine Montur sattelt und mit ein paar Knoten die unbeholfensten Bündel an den primitiven Packsattel festknüpft.
Wir kreuzten die Wa yung, eine West-Ost-Ebene, die ein kleines Flüßchen beherbergt, das später in den Re tschü fließt. Dann ging es genau südwestlich weiter. Die Hügel wurden allmählich höher und gingen in Berge über, und am dritten Tage nach der Wa yung erreichten wir die Wasserscheide zwischen dem Hoang ho und dem ersten großen Flusse, der sich in den Yang tse kiang ergießt, den Paß Rara niembo la. Von ihm ging es rasch bergab, dann bald wieder bergan zur Wasserscheide gegen den Dsa tschü. Ein wildes Gebirge wurde durchritten, bis wir den Dsa tschü selbst erreichten.
Am 12. Februar war bei meinen Chinesen Silvester. Sie hockten den ganzen Nachmittag mit tiefsinnigen Köpfen ums Feuer und unterbrachen nur von Zeit zu Zeit ihr Schweigen, indem sie auf die Kälte und auf den Sturm schimpften, der in die Finger biß, daß die meisten wie Brandblasen anzusehende Anschwellungen und gangränöse Wunden bekommen hatten Handschuhe wurden von meinen Leuten wie von den Tibetern nicht getragen. Dafür trägt man die langen Ärmel, die um Fußlänge (siehe Titelbild) die Arme überragen. Der eine oder andere ließ zwar die Bemerkung fallen, es sei gut, daß er mit mir in die Einöde gezogen, denn hier finde ihn sein Gläubiger nicht und müsse ihm weiter stunden. Gegen Abend wurden die Leute aber mürrisch. Ich mußte der Stimmung aufhelfen und kaufte den Tibetern ein Branntweintönnchen ab, lud auch die Vormänner und den Be hu mit seinem Sohn zu einem allgemeinen Schmause für die Nacht ein. Von den Tibetern berührte jedoch keiner den Schnaps, auch nicht der wilde Prinz. »Es ist ein allzu böser und gefährlicher Ort, an dem wir lagern«, meinten sie. »Wer kann wissen, was die nächsten Stunden bringen, ob wir nicht überfallen und angetrunken eine allzu leichte Beute der Feinde werden.« Sie fürchteten, daß die Sertʿa (Serschtʿa) oder Hantsien Doba-ngGolokh von der Rückkehr ihrer Karawane Wind bekommen hätten und ihnen auflauerten. Dem Reis aber, der zur Feier des Festes ausnahmsweise mit Butter und Zucker geschmälzt war, sprachen sie recht kräftig zu und ließen bei Hammel, Reis und Tsamba-Tee alle Augenblicke einen hellklingenden Zungenschnalzer erschallen als Zeichen, wie herrlich ihnen das Gebotene munde.
Als ich in der Morgendämmerung erwachte und meinen Pelzmantel vom Gesicht schob, gaben sich meine Diener gerade den gegenseitigen Neujahrs-Ko tou und fielen dann auch vor mir nieder, wofür ich jedem ein Geschenk in Silber aushändigte. Unter den Tibetern aber suchte ich vergeblich nach einer sichtbaren Neujahrsgratulation; sie feierten erst einen Monat später das neue Jahr. Am Mittag wurde ein allgemeines Scheibenschießen veranstaltet. Ein wenige Handteller großes Eisstück wurde aufgestellt, und über ein Dutzend Männer hockte in breiter Front auf etwa fünfzig Schritte Abstand davor. Die Tibeter schießen stets, wenn nicht kniend, dann hockend, indem sie sich mit gekreuzten Beinen auf die Erde niederlassen, den Kolben ihrer Luntenflinte in die linke Hand nehmen und den Lauf auf der vorne vor der Mündung im Boden steckenden Gabel balancieren und durch die diopterartige Visiervorrichtung zielen. Natürlich ist das Schießen auf diese Weise sehr schwerfällig. Das Gewehr ist bei ihnen eine Handkanone geblieben. Wegen der im Boden steckenden Gabelstützen ist dabei eine ausgiebige seitliche Bewegung sehr schlecht auszuführen. Deshalb treffen sie auch auf bewegliche Ziele so gut wie nie, aber auf feststehende Ziele habe ich bis 200 m sehr gute Treffer beobachtet. Zagenden Muts, bewußt, was davon abhänge, folgte ich schließlich der dringenden Aufforderung des Be hu und beteiligte mich am Scheibenschießen. Einige hatten Witze über mich gerissen, weil sie mich immer liegend hatten schießen sehen. Sie hatten dies sehr unschön und unzweckmäßig gefunden. Zum Glück hatte ich den »Dusel«, mit einem Hohlspitzgeschoß, stehend und freihändig, mit dem ersten Schuß den kleinen Eisblock zu zertrümmern. Die ganze wilde Schar hob den Daumen hoch und schrie und jauchzte: »Yámo, yamo re! atsatse re!« Der Be hu kam in mein Zelt und überreichte mir einen Schafmagen mit steinhart gefrorener Milch als Inhalt. Und noch einen Monat später wurde ich ob dieses Schusses gelobt. Mittlerweile war er von Mund zu Mund weitererzählt worden; aus den fünfzig Schritt war eine Meile und aus dem Eisstück ein kleiner – Roßapfel geworden.
Noch ein anderes Mal hatte ich auf der Reise mit den Tschendu-Leuten großes Glück im Schießen. Ich hatte dem Be hu versprochen, ihm, wenn er mich gesund nach Lab gomba bringe, ein Gewehr zu schenken. Ich hatte dazu ein altes Henry-Martini-Gewehr bestimmt, das einst in einem englischen Regimente Dienste getan, dann, wie die Stempel weiter zeigten, sich in den Händen des Volunteerkorps in Schanghai befunden hatte. Nachdem die Volunteers moderne Repetiergewehre erhalten hatten, war es ausrangiert worden und schließlich durch Kauf von einem Chinesen in meine Hände übergegangen. Der Tschendu-Be hu kannte den Gewehrtyp bereits ganz genau und sprach sehr verständig über seine Mängel. Deshalb hatte er mich des öfteren gebeten, ihm eine modernere Waffe zu schenken. Es galt darum, den Henry-Martini herauszureißen. Als wir wieder einmal am Waka nebeneinandersaßen, wollte er wissen, ob ein Kyang, das in weit über ½ km Entfernung graste, von meiner Büchse erreicht würde. Es war dies natürlich eine schwere Aufgabe für die ausgeschossene Schießröhre. Ich hielt auch umsonst eine lange Rede über die Windwirkung auf die Kugel, um mich aus der Klemme zu ziehen. Der Be hu ließ nicht locker. Ich mußte vom Lagerfeuer aus zwischen den grasenden Yak hindurch auf den Kyang anlegen. Wohl um 10 m zielte ich weiter rechts in den Wind, und endlich setzte ich meinen Ruf aufs Spiel und drückte los. Ich wagte kaum aufzusehen, rings um mich atemlose Spannung – das Tier aber will sich nicht rühren. Die Sekunde wird mir zur Ewigkeit. Da – das Tier bricht zusammen; es war getroffen. Ich selbst war am meisten erstaunt über den Zufallstreffer. Die Tibeter hielten es für Zauberei. Der Be hu riß mir das Gewehr aus der Hand und hütete es von Stund' an wie einen Schatz. Vom Visierstellen freilich hatte er nach wie vor keine Ahnung, und ich fand es nicht in meinem Interesse, ihn in die Mysterien unserer europäischen Schießkunst einzuweihen. Wer weiß denn, wie er den nächsten europäischen Reisenden empfangen wird!
Am 15. Februar lagerten wir in der Sege tschü yung, einem langen Längstal, das sich parallel mit den anderen großen Flußläufen, dem Ma tschü, Tschiang tschü, Tsage tschü und noch weiter südlich dem Dsa tschü und endlich dem De tschü (Dre tschü) durch das Massengebirge der steilen Schieferplatten durchgefressen hat. Die Kʿam ba ließen auf dem letzten Tagesmarsch vor dem bewohnten Gebiet ein volles Dutzend Ochsen zurück, und unter meinen Maultieren gab es infolge von Stürzen über Felsplatten auch manchen verletzten Gesellen. Die Tibeter hätten wohl noch viel mehr Verluste gehabt, wenn nicht durch vorausgesandte Boten das Nahen der großen Karawane bereits gemeldet gewesen wäre und uns Reiter mit frischen Tieren der Tendu ba (chin.: Tschendu) und Anir ba empfangen hätten.
Wir waren nun in das Land der Dsa tschü ka ba gekommen, eines Nomadenvolks von etwa zwanzigtausend Köpfen, das zur Linken und Rechten des Dsa tschü (chin,: Ya lung kiang) seine Herden weidet, an das Königreich Dergi angegliedert ist und in sechsundzwanzig bis dreißig Unterstämme zerfällt. Einer der am weitesten westlich wohnenden Unterstämme (oder sde schok) ist der der Anir ba (Amir ba), deren Häuptlinge eine besonders angesehene Stellung unter den übrigen Dsa tschü ka (kak) ba einnehmen und mit dem Tschendu Be hu befreundet waren. Als man hinter dem letzten hohen Paß Lager geschlagen hatte, rüstete sich ein jeder zur festlichen Einholung. Gebetwimpel in allen Farben des Regenbogens wurden an den Gabeln der Flinten befestigt. Der Be hu legte seinen Reisepelz ab, der an den Ärmeln und am Kragen als Zeichen seiner Wohlhabenheit und Würde 10 cm breit mit Otterfell verbrämt war, und schlüpfte dafür in einen Pelzrock, der außen mit karmoisinroter Seide bezogen war und an allen Rändern einen 25 cm breiten Besatz von Otterfell zeigte. Zweiundzwanzig Fischottern und sechsundvierzig schneeweiße neugeborene Lämmchen hatten Leben und Haut lassen müssen, um das Einzugsgewand herzustellen. Auf seinen immer noch struppigen, ungekämmten Kopf aber stülpte sich der hohe Herr einen steifen mandschurischen Mandarinenhut mit rotem Knopf und knallroten langen Fransen und mit einer großen blauen Feder Als ich nach seinem Knopf sah, beeilte er sich, mir zu sagen, der Amban habe ihn in Hsi ning mit dem roten Knopf beehrt. Tschang tung sche aber fügte hinzu: »Ein blauer Knopf in Hsi ning färbt sich in der Steppe von selbst rot.«. Das braune ungewaschene Gesicht stach von der üppigen sauberen Kleidung gar seltsam ab. Freilich, große Toilette zu machen, war bei dem unaufhörlichen Westwind und dem Mittagsmaximum von immer noch –8° nicht gerade sehr einladend. Die tibetische Toilette hatte darin bestanden, daß sie sich mit einer Pinzette alle ihre Barthaare ausrissen. Am Nachmittage des 17. Februar und am nächstfolgenden Morgen trafen Hunderte von festlich gekleideten Reitern zur Begrüßung bei uns ein. Wenn sie ihres Be hu ansichtig wurden, sprangen sie behend aus den Sätteln, näherten sich demütig gebückt, ihre Pferde am klafterlangen Anbinderiemen nach sich ziehend, streckten dazu die Daumen in die Höhe und riefen singend: »Ya Be hu rembodyi odyi! odyi!«, und bis ans Kinn hinab glitt schließlich noch zum Gruß die Zunge aus dem Munde. In der blinkenden Schneelandschaft zwischen den hohen Schneegipfeln die struppigen Kerle und struppigen Tiere, die tausend baumhohen Lanzen, die tausend bunten Farben an Stiefeln, an Gürteln, Sätteln und Schwertern gaben mir ein wunderbares Bild mittelalterlichster Wildheit und Farbenliebe. Ich konnte mich nicht satt sehen an diesen Tamerlan- und Hunnengestalten.
Mit den Reitern zusammen ritt ich der langsamen Yakkarawane, die noch einen Tag länger unterwegs blieb, voraus. Inmitten der prächtigsten Kavalkade, unter Hunderten von Lama mit roten Mützen und in der ganzen wehrfähigen Macht von Tschendu ging der Marsch quer über den breiten, gefrorenen Fluß Dsa tschü, dann noch ein breites, früheres Moränenfeld flach ansteigend bergauf zu einer Wasserscheide von 4480 m, um alsbald in eine Seitenschlucht des Dre tschü (des Yang tse kiang) abzusteigen.
Von der Wasserscheide aus traf das Auge weit nach Süd und Südwest nur auf Berge, auf ein Gipfelzackenmeer, auf den wildest erregten Bergozean. Schwarz und trübsinnig waren schneefreie, melancholisch stimmende Täler zwischen den tausend weißen Bergkämmen eingekeilt.
Der erste Blick, den ich in die Kʿam-Provinz tat, war wenig einladend. Und um mir meinen Vorstoß in diese Bergländer noch verwegener erscheinen zu lassen, trafen mich hier tausend schwarze, mißtrauische, giftig stiere Blicke von Lama- und Laienreitern, die auch nicht eine meiner Bewegungen außer acht ließen, die jede Notiz, jede Kompaß- und Aneroidablesung feindlich beurteilten, die in mir nur einen ganz gemeinen Spion sahen, so daß mich meine Begleiter wieder und wieder herzlich baten: »Zeige dein Buch nicht, verstecke dein Instrument, sieh nicht durchs Glas, Herr! Sie murren bereits, weil du ihr Land auskundschaften willst, um ihnen unheimliches Unglück zu bringen.«
Mit dem leichten Reisen und Hin- und Herreiten wie auf der Hochfläche war es mit einem Schlage vorbei. Von Millionen tiefer Rinnen ist hier das tibetische Hochland zerfressen. Wohl reichen die Gipfel weiter noch bis in die Hochregionen, die im Westen die weiten Flächen und Einöden unterbrechen, aber dazwischen hat das rinnende Wasser mit ungestümer Gewalt Schluchten herausgearbeitet, die Wälder und Felder, vielartiges Getier und fleißige, Ackerbau und Gewerben nachgehende Menschen beherbergen. Hier streift der Reisende nicht mehr so leicht und rasch über ungemessene Strecken wie in der Tschang tang. Hier muß man sich mühsam an die Naturpfade halten, die von den Bewohnern gefunden worden sind und ausgenutzt werden.
Im Abstieg ging es erst recht steil eine Geröllhalde hinab, dann folgte der Pfad einem eisgesäumten, schäumenden Bach. Als ich etwa 4000 m Höhe erreicht hatte, schwand der Schnee, und je tiefer wir kamen, desto steiler wurden die Talwände, die uns wie Gefängnismauern einschlossen. In schwarzen Felsabbrüchen stürzten die Berglehnen gegen die schmäler und schmäler werdende Talsohle ab und drückten mehr und mehr auf das beängstigte Gemüt.
Allmählich konnten meine Packtiere mit der leichtfüßigen Kavalkade des Be hu nicht mehr Schritt halten, und wir ritten einsam hinterdrein. Wenig unterhalb 4000 m Höhe trafen wir auf die ersten Häuser, schmutzige, niedrige, ein- und zweistöckige Hütten aus zusammengebackenem Schotter und Lehm, mit flachen Dächern und kleinen Löchern als Türen und Fenster. Haus an Haus standen diese Wohnungen. Ganz dicht waren sie zusammengedrängt und wie Schwalbennester zusammengeklebt. Und alles an ihnen war schmierig und dreckig schwarz. Das erste Kʿam-Dorf sah sehr wenig einladend aus. Vor dem Häuserhaufen hatte sich die Einwohnerschaft zusammengeballt. Untersetzte, breit und plump aussehende Männer mit wirren, struppigen langen Haaren in von Schmutz pechschwarz glänzenden Pelzmänteln, alle ein kurzes Römerschwert im Gürtel und Lanzen und Schleudern in der Hand, maßen mich mit den feindseligsten Blicken, vertraten mir frech den »Tscham lam«, den Hauptweg, der dicht an der Ansiedlung vorbeiführte, zwangen mich, ohne Gruß im Bogen um sie und ihre ängstlich behütete Heimat herumzureiten. Es war ein Dergi-Dorf. Seine Einwohner gehörten zu den Eindringlingen, die in den vorausgehenden Jahrzehnten dem Tschendu-Stamm so sehr zugesetzt hatten. Als zu Dergi zählend, unterstand es nicht der Hsi ninger Gerichtsbarkeit, und ihr Anführer glaubte zuerst gar, mich anhalten zu können und von mir einen Wegzoll in der Höhe von 20 Rupien erpressen zu dürfen. Man ließ mich aber sogleich weiterreiten, als Da Tschang ihm vorlog, unser Gepäck und die Reisekasse sei mit den Be hu zusammen schon voraus, die Lasttiere, die wir mithätten, gehörten nach Dscherku, er könne mir höchstens mein Reitpferd wegnehmen, was ich aber sicher als Raubversuch und argen Schimpf aufnehmen und durch scharfe Schüsse aus meinen Zauberwaffen erwidern würde. Ich bekam den ersten Vorgeschmack von all den Unannehmlichkeiten, die mir die Fremdenfeindlichkeit der Kʿamba bereiten sollte. Der Dolmetscher Tschang war vollkommen unbrauchbar. Hätte ich ihm gefolgt, so hätte ich ein Pferdchen als Zoll entrichtet, um durch diese eine Gemarkung hindurchzukommen, und ich hätte sicher bald kein Geld und kein Tier mehr besessen.
Eine halbe Stunde weiter unten lag das Haus und das erste Dorf des Bon bo oder Be hu von Tschendu (oder tibetisch Tendu), der über vierhundert Familien herrscht. Ein schmaler Pfad zeigte zwischen steinigen Stoppelfeldern dorthin. Bis ich mit meinen Chinesen dort eintraf, hatte der Häuptling bereits seinen Einzug gehalten. Drei Männer aber warteten noch in ihrem Einzugsstaat auf mich, um mir das Quartier zu weisen, das ihr Herr mir versprochen hatte. Es war ihr eigenes Wohnhaus, in dem wir untergebracht wurden. Es lag dicht neben dem des Häuptlings. Es war zweistöckig und bildete mit einem Dutzend ganz ähnlich gebauter und winklig ineinander geschachtelter Behausungen einen kaum entwirrbaren Knäuel, den das Häuptlingshaus durch ein drittes Stockwerk burgartig überragte. In einem hoch ummauerten Hofe daneben war gerade so viel Platz, daß meine achtundzwanzig Einhufer eingestellt werden konnten. Alles war klein und eng. Die Knappheit wirkte auf mich herzbeklemmend; es drückte mich Heimweh nach den weiten und freien Ebenen des Hochlandes.
Im Erdgeschoß des Hauses hatten die Eigentümer zwischen den vertikalen Holzsäulen, die als Stützen für den Oberbau dienten, winzige, graue und unbeschreiblich struppige Eselchen und zwei Bastardkühe stehen. Von da ging es eine wacklige, steile Hühnerstiege hinauf in den ersten Stock. Man betrat einen Dielenraum, der von der Decke her durch die weite Luke erhellt wurde, durch die man mittels einer weiteren Leiter auf das flache Dach gelangen konnte. Die Diele mußte für meine Begleiter als Aufenthaltsraum ausreichen, sofern sie nicht vorzogen, im offenen Hofe bei den Tieren zu nächtigen. Linker Hand von der Diele schloß sich ein schmales, aber langes Gelaß an, das nur durch eine handtellergroße Schießscharte etwas Licht empfing und sonst als Speicher für allerlei Vorräte diente. Es war mein Aufenthalt während der Tage in Tschendu. Von der Treppe her geradeaus ging es in einen etwas größeren Raum, in das eigentliche Wohnzimmer des ganzen Hauses. Wie die Diele und das Erdgeschoß wies es viele vertikale Holzsäulen auf. Es hatte eine kleine Fensteröffnung nach außen, durch die nur wenig Licht hereinfiel. Im Hintergrunde stand ein tischförmiger Kochherd mit vier Kochlöchern. Dort brannte beinahe den ganzen Tag ein Feuer aus Dung und Reisig und füllte das Haus mit erstickendem und beizendem Qualm. Ein paar Kisten standen als Truhen an den Wänden entlang. Einige Felle und Wolldecken waren tagsüber zusammengelegt und bildeten nachts die Betten, ein handhohes Tischchen, einige Schöpfkellen aus Messing, die neben dem Herd hingen, Götterbilder, die, umgeben von vielen wirren Haaren, von schmutzigen, angerußten Tuchlappen und schwarz gewordenen Khádar-Schals, eine Nische ausfüllten, zwei Gabelflinten, Schwerter und Spieße, Pack- und Reitsättel, sowie Säcke voll Gerste vervollständigten den Hausrat. Es hausten hier meine drei Quartierherren, drei Brüder mit ihrer Frau. Die eine Frau hatte den drei Männern Weib zu sein, zu dienen, für sie zu kochen und, wenn es für nötig befunden wurde, zu fegen. Ich war im Lande der Polyandrie angelangt, wo immer der älteste Sohn die eine Haus- und Ehefrau für die ganze Generation auswählen darf. Dicht nebenan mit dem gleichen Hof und Stall schloß sich das Haus an, wo die Söhne meiner vier Eheleute wohnten. Bereits hatte der älteste eine Frau gewählt, und mit ihm zusammen wohnten noch drei Brüder, die teilweise halbwüchsige Bursche waren. Die einzige Tochter meiner Wirte hatte nach auswärts geheiratet.
Vom ersten Stockwerk stieg ich oft auf das ebene Dach, das auf allen Seiten durch eine dicke und hohe Brüstung aus Lehm und Steinen eingefaßt war. Dort oben stand noch der große Hausaltar, ein Bauwerk wie ein kleiner Ofen, in dem täglich den Göttern Wacholder verbrannt wurde (Tafel XXVII unten). An krummen Stecken flatterten fromme Sprüche und Beschwörungen zur Abwehr böser Geister im Wind, und zur Verteidigung gegen menschliche Feinde lagen Haufen von Kieseln bereit, die im Bedarfsfalle teils mit der Hand, teils mit der Schleuder auf den Angreifer geworfen werden. Auch die Nachbarhäuser, die alle eines ans andere gekittet waren – wenn auch jedes eine etwas höhere oder niederere Dachplattform zeigte – bildeten eine solche Trutzburg mit einer Brustwehr, die rund 5–6 m über den Boden ragte. Alle zusammen waren eine geschlossene Festung, innerhalb deren die Bewohner über die Dächer hinweg zueinander gelangen und einander aushelfen konnten.
Von jenen Dächern aus sieht man weit nach Westen und Osten; talab und talauf sieht man noch eine Reihe gleicher, erdfarbener Häusergruppen und Dorfgemeinschaften, alle aus halbmeterdicken Mauern gebaut, aus unbehauenen Steintrümmern unter Verwendung von viel Lehm. Auch mehrere Klöster konnte ich erkennen, den Dörfern ähnlich gebaute Würfel, die aber durch eine lustige, blau, rot und weiße Bemalung das Auge auf sich zogen und von ferne schon auf einen besonderen Zweck hinwiesen, und vollends dadurch, daß die Mönchshäuser frei darum herum standen, sich etwas weniger wie Forts oder Festungen ausnahmen.
Zwischen den verschiedenen Hausgruppen dehnten sich die Felder der Bewohner aus, jetzt im Winter steinige, kahle Stoppelfelder, auf denen da und dort ein paar Pferde unter der Obhut eines Bewaffneten nach etwas Freßbarem herumschnupperten. Im April werden die Felder von den Frauen bebaut. Es wird bis in 3800 m Höhe Gerste, Wildhafer und eine Weizenart angesät.
Aus dem baumlosen Talgrund stiegen jäh die Berglehnen mit steilen Felsabbrüchen empor. Nirgend war ein Stückchen Wald zu finden, kaum dann und wann ein kümmerlicher Busch, vergeblich suchte das Auge die Viehweiden, die sich erst hoch über der Talklamm an den sanfteren Gipfelhalden befinden.
Die Männer und Frauen, die hier in den niederen schmutzigen Hütten wie in Löchern hausen, sind von auffallend kleiner und untersetzter Gestalt und haben ein Aussehen, daß man unwillkürlich Inzucht vermutet. Klein sind auch die wenigen Kühe, die sie in ihren Wohnungen halten, winzig klein die Esel, das hauptsächlichste Lasttier der Bauern (75 cm Widerristhöhe), klein (1,20–1,25 m) die eingeborenen Pferde und die einheimischen Maultiere. Alles ist hier kümmerlich, und ein tiefer Ernst scheint mir auch diese Menschen niederzudrücken. Die Natur hat sich gegen sie verschworen.
Betrachtet man die karge Humusdecke im Verein mit den schlechten klimatischen Bedingungen in 3800 m Meereshöhe, so zählt man staunend die Menge der Siedlungen. Für die unökonomische, rohe Feldbestellung, die auch hier wieder nur kümmerliche Aschendüngung aus verbranntem und verkohltem Wurzelwerk kennt, weil aller Viehdung als Heizmaterial dienen muß, sind es bereits allzu viele hungrige Mäuler geworden. Die weitaus überwiegende Mehrzahl der Bewohner macht einen unterernährten Eindruck. Die Felder sind selten einmal für Wasserberieselung eingerichtet, meist wie die Weiden auf Regenwirtschaft begründet. Selten bleibt einmal ein Feld für ein Jahr brach liegen. Meist wird jahraus, jahrein Gerste angesät. Teuerungen wegen ungenügender oder zu spät einsetzender Sommerregen, sowie wegen zu kurzer und kalter Sommermonate sind nur allzu häufig. Die Nahrungsmittel sind Tsamba (geröstetes Gerstenmehl), Yakmilch, Käsequark, wilde Dschumaknöllchen, Man tsin (eine Rübenart), Hammel- oder Yakfleisch, das in der Regel, zumal im Winter, in ungekochtem Zustand gegessen wird; an Festtagen und bei den Reichen kommen außerdem noch Nudeln aus einheimischem Weizenmehl, Reis und Goa mien aus Kan su in Betracht. Die Genußmittel sind Tee (Abfall aus Se tschuan), Gerstenschnaps, den jede Familie selbst herstellt, Tabak, gleichfalls aus China, der meist geschnupft, selten – von den Mönchen nie – geraucht wird. Salz holen die Bewohner aus nicht allzu großer Ferne im Norden; aller Zucker aber kommt von der chinesischen Grenze und wird entsprechend hochgeschätzt. Brot wird nie gebacken, und Fleisch wird, wie bemerkt, meist roh gegessen, höchstens gesotten, nie gebraten. Fische, Hühner, Eier werden nie berührt, sondern für gleich unrein und schädlich gehalten wie Pferde-, Esel- oder Hundefleisch. Diese Tiere zu töten gilt für frevelhafte Sünde, die die Götter und Geister ahnden.
Jeder Streifen Land, auf dem Getreide reifen kann, ist in festen Händen und durch Gräben oder Hohlwege abgeteilt, gehört dem oder jenem Kloster, dem Adel und den alteingesessenen Familien. Auch die Viehweiden auf den Berghöhen oben sind alle genau verteilt. Auf diesen nomadisieren die Knechte und Mägde mit den Herden der Herren im Tal, doch finden sich hierunter auch Familien, die angeblich aus neuerer Zeit stammen, keinen Feldbesitz im Tale ihr eigen nennen können und für die Weide meist hohen Pacht bezahlen müssen. Diese Hirten wohnen in schwarzen Zelten wie die der Nomadenstämme. Sie leben ganz wie echte Nomaden, doch fühlen sie sich nie so frei wie die ngGolokh oder die Banag-Leute und sind natürlich nie zu größeren Verbänden zusammengeschlossen wie die auf den zusammenhängenden Hochflächen. Die Seßhaften im Tale, die Besitzer der Äcker, die Adligen, bleiben immer die Machthaber, schon weil sie das Hauptnahrungsmittel, den Tsamba, besitzen und verhandeln. Kein Wunder, daß die Bauern um jede Fußbreite des kostbaren Landes immer aufs neue blutige Kämpfe miteinander führen!
Und kein Wunder, daß an diesen Plätzen eine Einrichtung besteht, die die Zerstückelung des Grundbesitzes grundsätzlich verhindert und auch einem allzu raschen Anwachsen der Familien entgegenwirkt. Es ist wohl möglich, daß die Sitte der Polyandrie ihren Ausgang davon nahm, daß die Zahl der Männer die der Frauen übertraf, daß sie also als ein notwendiges Übel begann, oder daß sie eine Spur eines alten, im übrigen heute aber nicht wiederzuerkennenden Mutterrechts darstellt. Heute ist sie jedenfalls in Kʿam von rein besitztechnischer Bedeutung. Es ist bezeichnend, daß die Polyandrie sich immer an einen Besitz knüpft, daß nie Männer zweier verschiedenen Familien eine Frau zum Eheweib küren, daß vielmehr immer die Söhne einer Familie ein Mädchen zur Stammmutter für die nächste Generation wählen.
Nur in den Familien, wo Töchter, jedoch keine Söhne am Leben sind, tritt der Fall ein, daß Männer von verschiedenen Familien die gleiche Frau besitzen, da dann häufig nicht bloß ein, sondern gleich zwei junge Männer adoptiert werden. Diese gelten in diesem Fall, wenn sich die nachgeborenen Töchter nicht nach auswärts verheiratet haben, auch als deren Männer. Sie bilden zusammen eine Familie, d. h. sie haben einen Feuerherd, für den sie sorgen, den sie weitervererben. In der nächsten Generation wird man sicher wieder bloß eine Hausfrau erblicken, und der gesamte Grundbesitz wird schließlich in der Hand von deren ältestem Sohne sein.
Die Polyandrie kommt in Osttibet in erster Linie bei den ackerbautreibenden Stämmen vor, bei den ngGolokh ist sie sehr selten, bei den Banag-Leuten besteht sie so gut wie nie, bei den unter chinesischen Einfluß geratenen Kin tschuan-Tibetern und denen von Ta tsien lu ist sie unbekannt. Dort herrscht Monogamie oder sogar Polygamie vor. Dagegen bildet sie wieder die Regel bei den Scharba-Bauern um Sung pan ting, wie sie auch im ganzen Sangpo-Brahmaputra-Tale und in der Provinz dBus (in Lhasa) und Tsang (Schiga tse) zu finden ist. Als die eigentliche Heimat der Polyandrie gilt immer die große tibetische Provinz Kʿam, wo ja auch die Tibeter am dichtesten sitzen.
Eheliche Treuebegriffe in unserem Sinne werden durch diese sonderbaren Familienverhältnisse selbstredend wenig gefördert, wobei ich jedoch nicht sagen möchte, daß sie gänzlich mangeln. Sehr oft aber haben die Brüder noch Liebschaften für sich allein, die man auch Ehen zur linken Hand nennen könnte. Derartige Frauen haben außerhalb der eigentlichen Familienwohnung, womöglich an einem ganz anderen Orte, ihr Heim, und die Kinder, die aus diesen Nebenehen entspringen, besitzen normalerweise, d. h. wenn Söhne aus der Hauptehe da sind, kein Anrecht auf das Familienerbe. Die polyandrisch verheiratete Ehefrau aber tröstet sich über die Seitensprünge ihrer Ehemänner wie jene Königin von Frankreich, die zu ihrem Gemahl sagte: »Moi je puis faire sans vous un dauphin; vous sans moi vous ne pouvez faire qu'un bâtard.« Das tibetische Familienleben ist auf den Kult des Familienherdfeuers und auf die hierzu notwendige Weiterführung der Familie aufgebaut. Das erste Gesetz ist, daß die Familie nicht ausstirbt, daß das Herdfeuer und sein Gott und alle Manen gepflegt werden. Zu diesem Zwecke ist die Ehefrau auch in tibetischen Augen notwendig und achtenswert.
Die Stellung der polyandrisch verheirateten Frauen ist – vollends in größeren und begüterten Häusern – immer eine sehr respektable. Eine solche Frau vereinigt als Familienmutter in ihrer einen Person mehr Befehlsgewalt als irgend einer ihrer Ehemänner. Stellen doch alle Brüder zusammen, und wenn ihrer noch so viele sind, nur eine Ehehälfte vor und sie allein die andere. Die tibetischen Herrinnen sind darum auch ungemein stolz auf ihre Stellung. Nichts wird ohne ihr Mitwissen und ihre Genehmigung abgegeben und veräußert. Oft fand ich unter diesen Frauen zu meinem Staunen gute Kenntnisse im Lesen und Schreiben, was in dem Lande, das sich sonst noch im grauesten Mittelalter befindet, als ein neuer Beweis der Frauenmacht anzusehen ist.
An unverheirateten Frauen besteht ein Überschuß. Höchstwahrscheinlich ist daneben aber die absolute Zahl der Frauen weit geringer als die der Männer, denn wir zählen zahllose Männerklöster mit Dutzenden, ja oft Hunderten von männlichen Insassen. Wir finden die Vielmännerehe als die Regel bei allen Besitzenden. Die Zahl der unverheirateten Frauen, der ledigen Tanten, müßte doch danach sehr groß sein. Ich sah aber immer nur wenige oder gar keine in den Familien, die ich kennenlernte. Auch Frauenklöster sind recht spärlich vorhanden, so daß nicht eine Nonne auf sechs Mönche kommen wird. Dabei ist Mädchenmord bei den Tibetern selbst da unbekannt, wo, wie im Osten, die chinesische Einwanderung besteht; er widerstrebt allzusehr den buddhistischen Ideen.
In ganz Kʿam und so auch in Tschendu fand ich es sehr schwierig, meine hungrige Karawane satt zu bekommen. Die Familien hatten nur ganz wenig Wildheu gesammelt, das gerade für ihre eigenen Kühe ausreichte. Wo die Kʿamba heuen, tun sie es immer erst im Herbst, wenn das Gras reif und gelb wird. Ich konnte darum in Tschendu nur leeres Gerstenstroh kaufen und auch dies nur in ungenügender Menge. Als Kraftfutter wurde mir endlich am zweiten Tage etwas Gerste abgegeben, aber auch nur in kleinen Mengen. Der Scheffel, den die Leutchen zum Abmessen benutzten, war so groß wie eine Teetasse, und die Verkäufer ließen sich nicht bewegen, zu einem größeren Maß überzugehen. Und wenn man ein Scheffelchen in meinen Sack geschüttet hatte, streute man wieder ein paar Körner in das Scheffelmaß, um es ja nicht leer in den Sack zurückgehen zu lassen. Als der Sack des Verkäufers endlich geleert war, mußte wieder ein Scheffelmaß in ihn zurück. Nichts darf je leer zurückgehen und leer sein; alle Krüge, Kannen und Säcke müssen stets etwas enthalten: aus abergläubischer Furcht, daß ein einmal leeres Gefäß nur ausnahmsweise noch einmal vollzubekommen sei. Zum Schluß aber bekommt der Käufer vom Verkäufer noch einen Segen mit auf den Weg, dessen kurzer Sinn etwa lautet: Möge dir, was du von mir gekauft hast, zum Segen ausschlagen!
Der Be hu fütterte seinen Marstall mit Tschürra und ganz wenig Man tsin-Rüben und gab Fleischbrühe mit etwas Tsamba zum Saufen. Die Abfälle, die in anderen Gegenden den Schweinen vorgeworfen werden, mußten die hungrigen Einhufer in den Winterquartieren fressen.
Trotz der gemeinsamen Reise mit dem Be hu benahmen sich die Tschendu-Leute ungemein zurückhaltend. Die Lama ließen mich in keinen ihrer Tempel hinein, und der Bruder des Be hu, der als Inkarnation eines nahen Klosters lebte, kam mit großem Pomp und vielen roten Lamareitern mit goldstrotzenden Hüten, um dem Bruder sein Mißfallen auszudrücken, daß er einen Fremden in das Land gelassen habe. »Was will der ›Olos‹ (der Russe) hier?« Er unterschied nur zwischen Russen im Norden und Engländern im Süden. »Er wird nur Gold und Silber suchen, Seuchen verursachen und unseren Frieden stören wollen. Wir brauchen die Fremden nicht, und kein Fremder hat das Recht, den Boden von Bod yül (Tibet) zu betreten.« Sie drohten dem Be hu mit der Strafe des Königs Nan̂ tsien, seines Oberherrn, an den sie bereits auf die erste Kunde von meinem Erscheinen Boten gesandt hatten. Da ich als einziger Europäer und nur mit wenigen Chinesen kam, so konnte ich freilich auch nicht allzuviel Respekt einflößen. Niemand scheute sich, mir unzweideutig zu verstehen zu geben, daß ich ein höchst ungebetener Eindringling sei. Die wenigsten ließen mich in den Raum treten, wo das Herdfeuer sich befand. Selbst der Be hu war sichtlich bemüht, mich so wenig wie möglich in das Innere seines Heims blicken zu lassen, als fürchtete er sich plötzlich vor mir.
Das ganze Haus des Be hu hinterließ bei mir einen kriegerischen Eindruck. Die Fenster waren wie Schießscharten so klein, die Wände hingen voll von Gewehren, Beutel mit Kalisalz pendelten von der Decke, ein großer Haufen Schwerter und Bleikugeln lag in einer Ecke. Einige Ledersäcke, mit Rupien gefüllt, nahmen sich wie ein Kriegsschatz aus. Die Stiege vorn vom Erdgeschoß herauf, in dem nur finstere, kotige Ställe lagen, konnte, wie bei meinen Wirtsleuten, für den Fall eines Angriffs hinaufgezogen werden. Das ebene Dach, um das eine Brüstung von beinahe Schulterhöhe lief, gab vollends dem ganzen Gebäude das Aussehen eines Bergfrieds. Auf diesem Dache lagen neben Haufen von Steinen drei eiserne Jingals.
Als ich das Haus zum ersten Male betrat, hörte ich eine helle Knabenstimme das tibetische Alphabet hersagen. Es war der dritte Sohn, ein Junge von noch nicht ganz zehn Jahren, der unter der Aufsicht eines alten Priesters sein ka, kʿa, ga, nga, norro ko, kʿo, go, ngo ... brüllte und in die Mysterien der tibetischen Orthographie einzudringen suchte. Für die Knaben sind die tibetischen Schriftzeichen, die bekanntlich aus den indischen Landscha-Zeichen ums Jahr 632 gebildet wurden, kaum weniger schwer als die chinesische Schrift, denn so viele Worte werden heute ganz anders ausgesprochen als geschrieben, daß selbst die gelehrtesten Lama ihr Leben lang mit der Orthographie auf gespanntem Fuße stehen.
Außer diesem Zehnjährigen hatte der Be hu noch zwei Söhne, den achtzehnjährigen, der die Reise nach Dankar mitgemacht hatte und der künftige Inhaber der Häuptlingswürde war, und einen ein wenig älteren, der als Inkarnation in einem Kloster im Yang tse-Tal saß. Da nach tibetischem Recht der Zweitgeborene jetzt volljährig geworden war, hatte sein Vater ihm bereits eine Frau bestimmt. Die hübsche Tochter des Häuptlings des Anirba-Stammes von oben im Dsa tschü-Tale sollte in wenigen Wochen in die Familie aufgenommen werden. Der Be hu hoffte, durch diese Verbindung ein wertvolles Bündnis zu gewinnen und damit künftig einen Gegendruck auf die andrängende, freche Dergi-Übermacht ausüben zu können.
21. Februar. Im Tale hatte es heute am Morgen – 10° und dazu 10 cm Neuschnee. Wir brachen um zehn Uhr von der Tschendu-Burg auf. Ich wollte jetzt Lab gomba besuchen, dann an Dscherku, dem Hauptort des Gebiets, vorbei immer weiter nach Süden vordringen, bis mir eben irgendwo so energisch halt geboten würde, daß ich nicht weiterkäme. Der Weg zum Kloster Lab, Labe oder Labeg führt über den Berg und Paß Nien ge la. Der Paß ist nicht tief in die Bergkette, die das Tsche(ndu)-Tal vom La(be)-Tal trennt, eingeschnitten und erreicht die Höhe von 4650 m. Wir kamen bei dem Schneewetter unerwartet und deshalb auch unaufgehalten an dem Dergi-Dorf oberhalb Tschendu vorbei, und hinter diesem stieg unser Weg bald steil und immer steiler und geradewegs zum Paß hinauf. Ich hatte zwei Tschendu-Leute als Führer mitbekommen. Diese marschierten in strammem Schritt an der Spitze des Zuges und schienen keine Ermüdung und keinerlei Atembeschwerden zu kennen, während meine Chinesen nicht zu bewegen waren, von den Pferden zu steigen, sich vielmehr zu meinem Ärger wie Mehlsäcke auf die armen keuchenden Tiere klemmten, auch wenn diese am dachjähen Hang ausglitten und auf den Knien abrutschten. Dabei war der Westwind auf der Höhe so heftig, daß ich schon aus Furcht, die Zehen zu erfrieren, nicht reiten mochte. Unweit vom Paß holte uns ein Bote ein, der die frohe Kunde brachte, daß der Tschendu-Häuptling einen vierten Sohn bekommen habe. Ich gab dem Boten auf dem Paß noch einen Khádar und ein Stück Seide als Angebinde, dann eilte er voraus nach Lab gomba, einen Priester zu benachrichtigen und zu holen, der dem Kinde einen glückverheißenden Namen geben sollte.
Aus den Erzählungen der beiden Tschang wußte ich, daß in Kʿam ungezählte, jäh aufsteigende Übergänge auf mich warteten; keiner hatte mir aber gesagt, daß sie als Chinesen über alle diese Pässe reiten wollten. Mir bangte nun doppelt vor diesen Bergen und den Verlusten an Tieren, die sie mir bringen würden. Das Menschenmaterial, das ich diesmal mit mir hatte, war für diese steilen Gebirge ganz ungeeignet. Meine strengen Worte und buddhistisch gedachten Mahnungen riefen an diesem ersten Kʿam-Paß um Haaresbreite eine allgemeine Meuterei hervor.
Auf der Südseite ging es vom Nien ge la steil hinab, bis wir nach 800 m wieder auf Felder trafen und in ein größeres Tal, das mit dem von Tschendu parallel läuft, einbogen. Den Talausgang beherrschte eine alte Turmruine, an die sich Überlieferungen von Grenzstreitigkeiten aus grauester Vorzeit knüpfen. Von ihr ritten wir noch ein halbes Stündchen das La-Tal aufwärts, ohne auch nur einem einzigen Menschen zu begegnen, dann öffnete sich mit einem Male rechter Hand eine wilde Schlucht, und ein eisiger Luftstrom empfing uns. Riesige Tschorten (Tafel XXV oben), mit Tausenden von Tsʿa tsʿa und Gebeten gefüllt Sanskr.: Stupa. Sie sind oft Reliquienschreine, oft aber auch nur zur Erinnerung an irgend einen Heiligen errichtet und dann mit zahllosen von aus Ton gestempelten Buddhabildern oder auch mit »Tsʿa tsʿa« gefüllt, d. h. mit Tonfigürchen, die selber wieder die Form von Stupas zeigen und je ein oder drei Gerstenkörner enthalten. Die Tschorten sind in ganz Tibet und der Mongolei fast gleich, Ein würfelartiger Sockel verjüngt sich nach oben zu in Stufen und wird von einer Kuppel überragt. Aus dieser steigt ein langer Hals mit dreizehn Segmenten empor. Ein manchmal vergoldetes kronenartiges Gebilde gibt den Abschluß. Diese Krönung zeigt noch allerlei Symbole, darunter solche, die an Sonne oder Mond erinnern. Die Tschorten entsprechen auch vielfach den Pagodentürmen der Chinesen in ihrem Zweck, böse Einflüsse und Gespenster von einem Ort fernzuhalten. und Mendong-Mauern faßten unseren Weg ein, die auf jedem ihrer Steine Anrufungen und Bildnisse der Götter eingemeißelt und bunt bemalt trugen. Eine kurze Strecke geht es in diese Schlucht nur hinein, dann stehen wir vor dem düster dreinschauenden Klostertore und vor Steinmauern, die sich schwarz aus dem zusammengewirbelten Schnee herausheben. Wir bitten um Einlaß in Lab gomba.
An eine nach Osten gerichtete Felswand gelehnt, drängt sich eine Häusermasse mit engen und krummen Gassen zusammen. Niedere Wandelgänge umsäumen die Talseite. In ihnen reiht sich Gebetmühle an Gebetmühle, die unter den Händen der Frommen quieken und krächzen. Hoch oben an der senkrechten Felsklippe, die dräuend über die Schlucht hereinhängt, klebt ein farbiges Tempelchen mit einem Erker daran: die Retraite der Klosterheiligen, deren es hier drei geben soll. Ein schwieriger Aufstieg führt dorthin. Dicht am Fuß dieser Felsklippe liegen fünf größere Gebetlesehallen, und an sie schließt sich ein großer Tempel des Schutzgottes der Lehre (Hu hoa dien im Hsi ning-Dialekt, Hu fa schriftchinesisch). Hunderte alter Schwerter und Flinten und Bogen rosten an der Decke dieses Tempels. Daneben ist eine Art Schatzkammer, ein Kuriositätenkabinett, in das sich die sonderbarsten Dinge des Abendlandes verirrt haben. Böhmische Glaswaren, europäische Lampen und Uhren, selbst eine schwere mongolische Karre wurde von frommen Pilgern über alle die Sümpfe und schroffen Gebirge hierher geschleppt.
Das Kloster ist aus Stein und Lehm und in dem schwerfälligen und damit so malerischen tibetischen Tempelstil mit sich nach oben verjüngenden Mauern erbaut und trägt meist flache Lehmdächer. Die Hauptgebäude sind dreistöckig, einzelne sogar vierstöckig und außen rot bemalt. Die obersten Stockwerke zeigen schwarzgefärbte Reisigfüllungen.
An dem grauen Winternachmittag, an dem ich Lab gomba betrat, als Wolkenfetzen um die Felsen trieben und dann und wann harte Schneekörner auf das Kloster niederprasselten, lag eine düstere und kalte, eine verwunschene Stimmung auf dieser Stätte. Alles erschien mir uralt und ehrwürdig und heilig. Die wuchtigen Tempelpforten, deren Schwellen Tausende von Pilgern in den Jahrhunderten ausgetreten hatten, die schweren Bronzeangeln und Türklopfer in ihrer köstlichen grünroten Patina, das weinrot gefärbte ungleichmäßige Gemäuer, die schweren schwarzen Vorhänge, die im ersten Stock eine breite Loggia abschlossen, alle die golden blinkenden Symbole, die goldenen Räder, die Spitzen und Knöpfe auf den Tempeldächern, die unzählbaren »gebi«, die Yakhaarfahnen, mit dem buddhistischen, symbolischen Dreizack an der Spitze, und die vielen, vielen fettigen, schwarzen Gebettrommeln, die in Leder genäht, von schmutzigen, ranzigen Bauern und Bäuerinnen in Bewegung gesetzt wurden, stimmten prächtig zusammen. Wenige Erdenwinkel erschienen mir malerischer als dieses Kloster. Als mein Kommen bekannt wurde, huschten aus tausend Löchern und Winkeln, hinter allen Ecken wie ein Rattenkorps, die Hunderte von jungen Mönchen und Novizen jeglichen Alters hervor. Alle Klosterinsassen mußten den Fremdling und seine Tiere, die mit der letzten Schneewolke in ihr Heiligtum gefallen waren, begaffen, und keiner der Gaffer war je gewaschen worden. Schwarz wie die Mohren stachen sie vom Schnee ab. In ihren zerschlissenen, verschossenen Alltagstogen hatten sie das Aussehen von Vogelscheuchen. Kam ein höherer und wirklicher Lama in die Nähe, so zeigte sich deutlich die harte Klosterzucht. Geräuschlos, wie sie gekommen, zerstoben die Ratten, bis die Luft wieder rein schien; dann kamen sie, vorsichtig um sich schauend, aufs neue aus den Verstecken hervor.
Der Empfang im Kloster, der mir zuteil wurde – ich brauche es kaum noch hervorzuheben –, war so kühl wie der Wintertag, an dem ich ankam. Immerhin wies man mir nicht kurzerhand die Tür, sondern ließ mich meine Tiere in einen Hof treiben und verkaufte mir nach einigem Warten sogar etwas Stroh für sie. Im Erdgeschoß des Pilgerhauses erhielt ich einen niederen, muffigen Raum, in dem außer mir alle meine Lasten und Sättel Platz fanden. Ich packte dort eiligst Geschenke und einige Khádar aus, um damit möglichst rasch dem Klosterabte und den Verwaltern zu danken. Der Ya men-Dolmetscher Tschang sollte herausbringen, wo diese Herren zu sprechen seien. Mein guter Dolmetscher, der sich im Tibetischen noch nicht so zu Hause fühlte, daß er allein gehen konnte, nahm sich Da Tschang mit. Beide ließen mir nach kurzer Zeit sagen, die Klosterältesten seien für mich nicht zu sprechen, im übrigen hätten sie alles geregelt, und ich hätte nichts zu fürchten. Ich sandte nacheinander die übrigen Diener aus, die beiden zurückzurufen, doch auch von diesen ließ sich keiner wieder sehen, und schließlich saß ich ganz allein bei meinem Gepäck in dem unverschließbaren Stallraum. Als es dunkelte, verlief sich der letzte Zuschauer bis auf einen jungen Geslong mit Namen Tseren (der Langlebige), der aus Tschendu stammte. Dieser führte mich auf meine Bitte endlich selber zu den beiden Tschang. In einem hübsch mit Holz getäfelten Zimmer, einen Stock höher, als ich untergebracht war, saßen die beiden Herren und an der Wand entlang meine übrigen Leute mit einigen Mönchen, die sie eifrigst mit Tee bedienten. Mein Eintreten bereitete sichtliches Mißbehagen. Mit sauren Mienen wurde ich an den Ehrenplatz gesetzt. Da Tschang hatte sogar die Frechheit, mir zu sagen, es sei gefährlich für mich, bis hier herauf zu dringen und unten die Kisten ohne Aufsicht zu lassen. Mit einigen kleinen Geschenken hatte ich jedoch die Priester bald freundlich gestimmt, sie boten mir Tsamba an und halfen dann meinen Leuten, mein Gepäck nach oben zu bringen. In dem Zimmer, das sich meine beiden Tschang reserviert hatten, und worin ich auch bereits ihre Sättel und Decken sah, ließ es sich sogar recht gut sitzen, und am anderen Morgen führten mich die Zimmerbesitzer auf meine Bitte im ganzen Kloster herum.
Lab gomba ist ein wichtiges Kloster der Gelug ba-Sekte, die sonst in dieser Gegend nur ganz selten noch ein größeres Heiligtum ihr eigen nennt. Zu dem am Rande der nur von Nomaden besiedelten Hochsteppen gelegenen Kloster pilgern in erster Linie ngGolokh, dann auch Kuku nor-Tibeter und -Mongolen. Es gehören drei Inkarnationen dazu, angeblich drei Brüder. Der eine dieser Huo fo ye, der allein zur Zeit meines Besuches sich im Kloster aufhielt, war noch ein ganz kleines Kind. Der zweite war zu Studienzwecken in Lhasa und sollte damals fünfzehnjährig sein. Der dritte, ein erwachsener Mann, war gerade in »Peking«, was freilich im Munde der Lama auch bedeuten konnte, daß er sich in irgend einem der Klöster der nordöstlichen Mongolei zum Almosensammeln aufhielt. Die drei Huo fo entstammten verschiedenen Häuptlingsfamilien der näheren und weiteren Umgebung, waren also keineswegs dem Blute nach Brüder, sondern nur der in ihnen wohnenden Seele nach.
Zu den Hauptsehenswürdigkeiten des Klosters gehört ein Huo fo ye, der einst fern von seinem Kloster verstorben ist. Sein Leichnam wurde getrocknet und dann vergoldet und sitzt jetzt ganz im Hintergrunde eines dunklen Saales, in seine alten Priestergewänder gehüllt und mit seiner gelben, schmalen und spitzen Abtsmitra auf dem Kopf. Nur in gebückter Haltung nähern sich die Andächtigen dieser Reliquie. Um sie genauer in Augenschein nehmen zu können, kroch ich so nahe an sie heran, als es mir die wachhabenden Mönche gestatteten. Aber weder ich noch meine skeptischen chinesichen Begleiter konnten mit Bestimmtheit sagen, ob die Figur wirklich eine Mumie oder nicht doch aus Bronze oder Ton hergestellt war.
Zur Zeit meines Besuches standen außerhalb der Klosterumfassung nur wenige Laienhütten und Zelte. Wenn aber ein Fest gefeiert wird, wenn die Nomaden zum Ko tou kommen, dann dehnt sich auch hier weit talauf und talab eine riesenhafte Zeltstadt aus. Eines der Hauptfeste wird im Sommer, im siebenten tibetischen Kalendermond gefeiert. An jenem Tage legen die Mönche, wie in allen Gelug ba-Klöstern, ein Riesenbuddhabild, ein Tangga, in die Sonne, das 50 m im Geviert mißt und auf Seide gestickt ist. Man zeigte mir den Platz, wo es ausgelegt wird. Auf der rechten, nach Westen gerichteten Talseite, den Tempeln gegenüber, zog sich, der Größe des Bildes entsprechend, ein Pflaster aus mächtigen Steinplatten den steilen Hang hinauf. Während der Auslegung wird ein Tscham, ein sogenanntes Mysterienspiel getanzt.
Bei starkem Schneetreiben verließ ich das Kloster wieder und folgte abwärts dem Flüßchen La tschü, das an Lab gomba vorüberrauscht. Von der Einmündung des Tschendu-Pfades an ging es immer westlich. Es war ein Längstal im Gebirge, und eng mündeten die Seitenschluchten, die die steil fallenden Sandsteinschichten durchsägen mußten, um sich mit dem La-Tal vereinigen zu können. Drückend wie Gefängnismauern standen links und rechts die schneegekrönten Talwände. Die Besiedlung des La tschü-Tales ist spärlich, höchst selten ist ein Mensch zu sehen. Nie liegt ein Dorf an der Straße, an dem breit ausgetretenen Naturwege, der rücksichtslos auf sein nächstes Ziel lossteuert. Dann und wann nur entdeckte ich eine Ansammlung von einigen dicht zusammengedrängten Lehmhäusern mit flachen Dächern, die oben an der Einmündung einer Schlucht lag. Von schroffen Felsen schauten wie Burgen alte Hausruinen auf uns herab, und Felder voll von Steintrümmern machten den Talboden aus. Was mir am meisten am La tschü-Tal auffiel, war der Löß, den ich hier fand. Freilich sind es keine Massen, wie man sie in China zu sehen gewohnt ist. Nur am Fuße der nach Süden gerichteten Hänge liegt er in größerer Mächtigkeit – bis zu 6 m aufgehäuft. Dort dient er sogleich der Ackerwirtschaft. Auch hier haben die Bauern auf dem Löß ihre besten Felder.
Am Nachmittag traf ich im Ort Lamda (Lambda, Lamdo) ein, wo der La tschü in den großen Dre tschü einmündet, und zum zweiten Male starrte ich auf den tibetischen Yang tse kiang, auf den Tung tien ho der Hsi ning-Leute, den Dre tschü der Tibeter. Smaragdgrüne Fluten und darauf wie Diamanten schimmernde Eisblöcke glitten mild rauschend und gurgelnd an mir vorüber. Wieder hatte mich dieser Strom in seinem Bann, wieder war mir, als zögen und schöben mich diese Wassermassen; ein Sirenenchor sang mir ein »Eile, eile gleich uns! Eile, das Wunderland Tibet zu schauen, in das wir eben erst aus der toten Öde der Tschang tang hereingekommen sind. Hier erst beginnen die Geheimnisse, die zu lösen einen Einsatz wert ist. Auch wir gewaltigen Ströme scheuen keine Mühe, keine Anstrengung, uns durchzuzwängen, uns einzudrängen in das herrliche Land, das so ungezählte Heimlichkeiten birgt.«
In gigantischen Kehren, messerscharf und abgrundtief, ist der Lauf des Stromes in das Gebirge eingelassen, so daß in geringen Abständen schon wieder vorspringende Talecken den Blick nach oben und unten verschließen. Seltsam und märchenhaft durchziehen die asiatischen Riesenströme das tibetische Alpenland! Und immer nur ein winziges Stückchen lassen sie den Eindringling auf einmal entdecken. Gleich schieben sich wieder Bergriegel vor, die sie in nadelöhrenger Klamm durchbrechen, so neidisch den Besucher wieder von sich abstreifend.
Lamda, einige Dutzend zweistöckiger, wiederum nahe zusammengestellter Häuser mit ebenen Dächern, kleinsten Fenstern und Höfen, liegt auf einer Terrassenecke, die der La tschü und der Dre tschü umspülen. Es gelang mir hier, ein ganzes Haus mit anschließendem Hof zu mieten. Es war dies eine Art Hotel oder Rasthaus, das nur von Reisenden benutzt wird, denn Lamda liegt an einem beliebten Fährplatz, an dem Händler, Lama- und Laienreisende über den Yang tse kiang setzen. Dieses tibetische Haus zeigte sich einem gewöhnlichen nordchinesischen Bauernhaus weit überlegen. Es war ganz aus Stein gebaut. Außen, vor allem aber innen, war das Mauerwerk mit Lehm sauber und glatt verstrichen. Mit seinen dicken Wänden, mit der um das Dach führenden Steinbrustwehr, den kleinen, papierlosen Fensterkreuzen, die durch schwere, dicke Holzladen verschlossen werden konnten, und dem sichtlichen Bestreben, die Fenster möglichst nach den Innenhöfen gehen zu lassen, bildete auch dieses Gebäude wieder eine kleine Feste. Die Verteilung der Räume ist in diesen Häusern nie so feststehend wie in einer chinesischen Wohnung. Bloß lagen auch hier im Erdgeschoß nur Ställe. Im ersten Stock, zu dem eine breite, feste Steintreppe hinanführte, gab es einen Küchenraum neben mehreren geräumigen Zimmern, ja sogar – was ein Chinesenhaus so gut wie nie besitzt – einen säuberlichen Abort, der wie in Tirol auf einem Balkon angebaut war. Meine chinesischen Begleiter ließen aber auch an diesem Haus wie an allen Tibeterhäusern kein gutes Haar und erklärten es für eine miserable Barbarenwohnung, weil die Horizontalbalken, die den Boden im ersten Stock und das lehmgestrichene flache Dach trugen, teils auf der Mauer, teils auf einfachen Holzsäulen aufsaßen und nicht, wie es bei den Chinesen der Brauch ist, mittels kunstvoller Verzapfung von den vertikalen Stützen gehalten wurden, so daß das Mauerwerk nur mehr ein Ausfüllsel bildete.
So gut das Hotelgebäude an sich war, so böse war die Aufnahme durch die Dörfler. Die Perücke, die ich in Horkurma angelegt hatte, war seither beibehalten worden, auch die anderen »Schönheitsmittel« hatte ich weiter benutzt, um mich mit den Tschendu-Leuten intimer stellen zu können. So war ich jetzt, ohne besonderes Aufsehen zu erregen, bis in die oberen Gasträume hineingekommen. Eine Weile nachher besuchte mich aber ein Mönch aus dem nahen Kloster, und der warf nur einen einzigen Blick auf mich und meine Nase, um sogleich voll Entsetzen zurückzuprallen und auf und davon zu eilen, und ein über das andere Mal hörte ich ihn zornig herausstoßen: »Das ist ja der Peling (Engländer)! Den Peling habt ihr im Dorf aufgenommen!« Dieser Ruf alarmierte rasch den ganzen Ort. Eine Schar Männer rannte die Treppe zu mir herauf, füllte geräuschvoll den Vorraum und dann das Zimmer, in dem ich ganz hinten an der Wand am Boden saß und eben meinen Tee trank. Mit Verwünschungen und drohenden Mienen und Gebärden wollten sie mich aus dem Hause hinausjagen. Selbst das Stroh für die Tiere, das sie mittlerweile verkauft hatten, wollten sie wiederhaben. Der Be hu von Dscherku ndo – erfuhr ich – hatte bereits durch Eilboten von meinem Kommen Kenntnis erhalten und hatte, da Lamda zu seinem Gebiet gehörte, umgehend den Befehl zurückgeschickt, mich unter gar keinen Umständen in den Ort hineinzulassen. Wenn einer der Fährleute mich über den Yang tse kiang brächte, so würde er an Leib und Gut bestraft. Kein Wunder, fuchtelten darum die Einwohner wutschnaubend mit den Schwertern in der Luft herum und suchten mich auf jede Weise einzuschüchtern. Anzutasten wagte mich aber keiner von der ganzen Bande; vor mir auf meinem nur fußhohen Teetischchen lag mein blankes Schwert und meine Mauserpistole. Bis die beiden Tschang und »Sechsunddreißig« durch die Menge hindurchkamen, war eine gute Weile vergangen, dann erst gelanges, ein »schang leang« Siehe S. 466 zuwege zubringen. Der Mönch, zwei Ortsälteste und wir zu vieren hockten uns in der Zimmerecke auf den Boden, tranken Tee zusammen, und so lange brachten wir es fertig, immer neue Einwürfe zu erfinden und Geschichten zu erzählen, wie es dem und jenem Reisenden in Tibet ergangen sei, bis es ganz dunkel war, so daß die Butterdochtlampen angezündet werden mußten. Dann hatten die Tibeter aber auch durch uns die Überzeugung bekommen, daß ihr Land schon von Tausenden von verhaßten Peling durchreist worden sei, und daß es ganz sinnlos wäre, mich noch in der Nacht hinauszuwerfen. Zum Schlusse versprach ich gerne, wenn ich nach Dscherkundo käme, ihrem Be hu zu melden, daß seine braven Lamda-Leute mich nicht über ihren Fluß gelassen hätten, und wir trennten uns, nachdem die tibetischen Herren noch einen letzten tiefen Zug aus meiner Schnapsflasche getan hatten.

Tafel XXIII
Der Hoschu dsangen Lamadyi (rechts) zu Pferde mit seiner Gabelflinte.

TTafel XXIII
sawu-Tibeter in Mani tschwan / In jeden einzelnen Stein der Mauer im Hintergrunde sind heilige Buchstaben eingemeißelt.
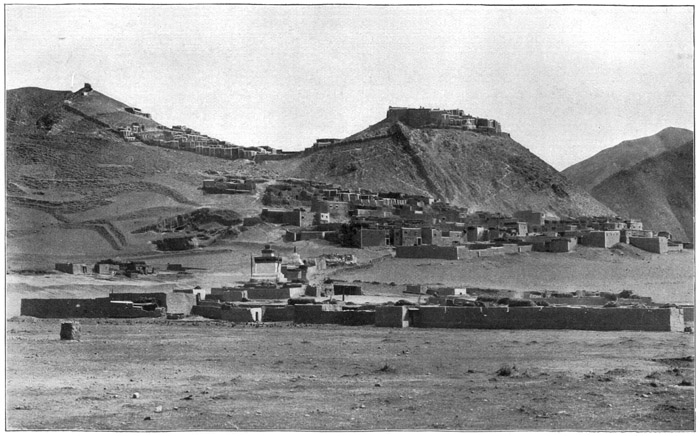
Tafel XXIV
Ort und Kloster Dscherku ndo / Von Westen gesehen.
Zuletzt waren wir noch recht freundschaftlich geworden, und eifrig diskutierte man die Frage, ob blonde Haare und blaue Augen schön sein könnten. Selbst hatte ich ja in diesem Augenblick dicke schwarze Chinesenhaare auf dem Kopf, darum war beileibe nicht von meinem Schopf die Rede. Aus Lamda aber war ein Geschwisterpaar gebürtig, Leute zwischen zwanzig und dreißig Jahren, mit blauen Augen und braunen Haaren, die im übrigen in nichts von den anderen Einwohnern abwichen. Solche Ausnahmen, solche Fälle von unvollständigem Albinismus sind in Tibet selten, immerhin scheinen sie weit zahlreicher zu sein als echter Albinismus, und jedesmal drängte sich mir die Frage auf, ob wir es hier nicht mit Yüe tschi-Überresten, mit indoskythischen Tocharen-Spuren zu tun hätten. Vielleicht sind ja auch die Adlernasen mancher hochgewachsenen ngGolokh und der vereinzelt sehr kräftige und gerne rotbräunliche Bartwuchs mancher Osttibeter darauf zurückzuführen. Für die Leute von Lamda aber hatte unsere Unterhaltung eine viel praktischere Bedeutung. Kein Mann wollte die blonde, blauäugige Maid und kein anständiges Mädel den blauäugigen Mann heiraten, und als das Mädchen eine Pilgerreise nach dem Westen unternommen hatte, war es immer wieder angehalten und für eine Europäerin angesehen worden.
Eine kleine Stunde unterhalb von Lamda bei einem Dörfchen, das wie ein Starenkästchen an steiler Felsrippe hängt, staut sich jeden Winter das Treibeis des Dre tschü und verbindet als Eisbrücke die beiden Ufer. Als ich noch oben im Lab gomba-Gebiet war, hieß es, diese Eisbrücke sei bereits geborsten und abgetrieben. Aber sie hielt felsenfest, als ich am 23. Februar hinüberritt. Die Bewohner des Dorfes gehören einem anderen Hoschunat an als Lamda und machten mir keinerlei Schwierigkeiten. Sie erheben von allen, die ihre Naturbrücke begehen, einen kleinen Wegezoll und zeigen dafür die tragfähigsten Eisblöcke. Auch hatten sie mit großen runden Kieseln, die wie Kettenglieder aneinandergelegt waren, den Übergang gezeichnet. Jeder Kieselstein trug, aus rot bemaltem Grunde herausgekratzt, einen Buchstaben, so daß die Kieselsteine Worte bildeten und sich zu frommen Gebetssprüchen zusammenfügten, die die Ufer verbanden und die Brücke für die gläubigen Bewohner sicherten. Zwei solcher Spruchbänder liefen über den ganzen Fluß. Hügel von Steinplatten, die alle von Gebetreliefs und Buddhareliefs bedeckt waren, Tschorten, Reisigbüsche, an denen Schafwollfetzen flatterten, und andere Symbole mehr säumten das Ufer ein. Es ist in tibetischen Augen ein sehr heiliger Platz, weil die Ortsgeister jedes Jahr hier die Brücke entstehen lassen. Die Führer wie auch wir sangen die Anrufungen der Götter und aller Heiligen herunter, solange wir über das Eis gingen!
Die Übersetzstelle lag 3650 m ü. d. M., und das Eis des Stromes war 150 m breit. Weit hinauf an den steilen Talwänden zogen sich Buschwaldungen. Fichtengruppen und uralte Rhododendren brachten ein fahles Grün zwischen die dunkeln Felsabbrüche. An jeder Talecke entzückte mein Auge ein neues Wunderbild, grüßten neue Schneegipfel zum klaren, grünblauen Yang tse herab. Im Tale unten kann sich der Schnee nur selten halten. Was nicht auf eine ganz besonders geborgene Halde gefallen ist, lecken die Sonnenstrahlen sofort wieder rein.
11 km unterhalb meines Flußüberganges verließen wir wieder das Yang tse-Tal, um in scharfem Winkel nach Südwesten abzubiegen. Mehr und mehr hatte sich zuletzt das Tal wieder verengt, waren die himmelhohen Berge zusammengerückt, und unweit von dem Punkt, wo ich das Tal verließ, schienen die Felsen endgültig über dem Strom zusammenzuschlagen und ihn zu verschlingen. Nur ein ganz schmaler Pfad war, wo wir gingen, der steilen Berglehne abgerungen worden. Nicht 50 m breit floß dicht unter mir so klar, daß ich jeden Stein auf dem Grund erkennen konnte, als herrlichstes Türkisband der Yang tse. Die Tiefe des Wassers wollte ich ungern größer als 3 m schätzen. Der Grund wie der Ufersaum waren felsig. Deutliche Marken zeigten, daß zur warmen Jahreszeit das Wasser einen 4–5 m höheren Stand hat, daß der Strom dann schon hier über doppelt so groß sein muß. Hier in dieser Schlucht war es, wo der berühmte Afrika- und Asienforscher Dutreuil de Rhins sein Leben lassen mußte. Schwer verwundet, angeblich bewußtlos, wurde er von den Bewohnern von Tombu mda in das Wasser geworfen. Aufgerüttelt durch die Kälte, sei er wieder zu sich gekommen – so erzählen sie noch – habe zu schwimmen begonnen und hätte vielleicht das jenseitige Ufer erreicht; aber sie warfen Steine nach ihm und steinigten ihn vollends zu Tode. Eine der schönsten und kühnsten Tibetexpeditionen hatte damit ein vorzeitiges Ende erfahren.
Von diesem traurigen Platz reitet man eine gute Stunde in einem hübschen, lieblich und friedlich anmutenden Seitentale bis zum Dorfe Tombu mda. Mit dichten und hohen Fichtenwäldern sind die Hänge bestockt, Felder machen sich im Talgrunde breit, Gebetmühlen klappern an munteren Wassergräben. Ein Kloster der weißen oder Saskya-Sekte winkt mit weiß getünchten, schimmernden Häusern kurz unterhalb des Dorfes von einem steilen Felsgrat herab. Es gehört, wie der Ort Tombu mda selbst, dem Deda Be hu, einem recht mächtigen Vogt oder Grafen, der weiter unten im Yang tse-Tal seinen Herrensitz hat. Diese Deda Be hu- (oder Detta-) Familie erhielt erst vor siebenzig Jahren von den Chinesen ihren Rang. Der heutige Inhaber der Würde ist aber bereits weit landauf und landab verrufen. Klagen über Klagen kamen jedesmal zum Bi tieh sche, solange er in Dscherku ndo residierte. Was sollte freilich der chinesische Kommissar mit seinen zwanzig Soldaten ausrichten, die womöglich schlechter bewaffnet waren als die Hunderte von Männern, die der Deda ins Feld führen konnte. Jede Karawane, die das Deda-Land passiert, wird schmählich gerupft, und Räubern ist an der Tagesordnung in diesem Gebiet, das zum Wegelagern wie geschaffen ist, in dem mit wenigen Leuten die wichtigsten Straßen zu sperren sind. Deda hört auch nicht mehr auf seinen Oberherrn, den Nan̂ tsien rgyalbo, und steht in Verbindung mit unabhängigen Stämmen von Dergi. Immerhin hat es die letzten Male nach einigem Zureden seine Kopfsteuer noch an die Chinesen abgeliefert.
Von den Tücken des Deda-Herrn war mir auf dem Wege von Hsi ning her durch Tibeter und Chinesen so viel Böses erzählt worden, daß ich mit recht gemischten Gefühlen dem Empfang in Tombu mda entgegensah. Dreizehn Jahre waren vergangen, seitdem die dortigen Einwohner die große französische Regierungsexpedition bestohlen, dann gesprengt und ausgeplündert, endlich den Expeditionsleiter, Dutreuil de Rhins, getötet hatten. Wohl war auf den Druck der französischen Diplomaten in Peking die Ermordung bestraft worden. Ein paar Tombu mda-Leute, die zum Handeltreiben mit denen von Lab gomba nach Dankar gekommen waren, hatte man als Geiseln aufgegriffen und schließlich gegen das geraubte Eigentum der Expedition und gegen den Dorfältesten eingetauscht. Dieser Dorfälteste wurde auf der Richtstätte vor den Toren von Hsi ning fu enthauptet. Wie leicht konnten sie nun an mir dafür Rache nehmen wollen! Der Mord und die blutige Sühne lebten noch in frischester Erinnerung. Meine Aufnahme war deshalb das beste Barometer für das augenblickliche Ansehen der chinesischen Verwaltung.
Als ich an der Spitze meines kleinen Trupps mich langsam Tombu mda näherte, stand ein Dutzend Bewaffneter am Dorfeingang und maß mich von Kopf bis zu Fuß mit grimmig aufgerissenen, stieren Augen, aus deren Weiß wild, braunrot die Blutgefäße hervorstachen, so daß ich froh war, in dem weiten Ärmel meines tibetischen Rockes die Pistole streicheln zu können. Zu meinem Erstaunen ließen uns aber die Bewaffneten völlig unbehelligt; ohne allerdings unseren Gruß zu erwidern, gaben sie den Eingang frei und ließen mich in ihre enge, staubige Dorfgasse hineinreiten, die zwischen hohen Lehmmauern und geschlossenen Toren aufwärts führte. Gerade am obersten Ende von Tombu mda steht ein hervorragendes, festes Haus, das der angesehensten Familie des Platzes gehört, von dem aus seinerzeit die französische Expedition am heftigsten angegriffen worden war, und dessen Besitzer darum in Hsi ning fu den Kopf hatte lassen müssen. Alle die massiven Holzladen dieser Hausburg waren verschlossen und das Tor verrammelt. Wir fragten dort vergeblich nach unserem Tung sche, den ich vorausgesandt hatte, um Quartier zu machen. Obgleich wir Schritte und Flüstern hinter dem Tor hörten, würdigte uns niemand einer Antwort. Als nach einer langen Viertelstunde der Vermißte sich wieder zu uns gefunden hatte, brachte er die Nachricht, der Deda Be hu habe verboten, daß ich in Tombu mda wohne. Noch heute müsse ich bis an die Landesgrenze weiterreisen, widrigenfalls würde ich angegriffen wie die »Peling«. Bei dem Zustand meiner Tiere war dies Verlangen schlechterdings unausführbar. Mehr als die Hälfte der Maultiere hatte sich mittlerweile vor Müdigkeit mit den Lasten auf dem Rücken auf die Straße vor die Hausburg gelegt; der Rest stand teilnahmlos mit gesenkten Köpfen und zum Umfallen ermattet daneben. Ich mußte rasten, wollte ich nicht meine Tiere über ihre Kraft anstrengen und die meisten für immer verderben. In den offiziellen Gasthof, den »dyatschuk kang« hineinzukommen, den es auch in diesem Dorf gab, hatte ich von Anfang an wenig Hoffnung. Nach den üblen Erfahrungen Dutreuils mußte ich aber danach trachten, in den Besitz eines Viehhofs zu kommen, denn wer bürgte dafür, daß die Einwohner nicht auch mir Pferde stehlen und mir, wie den Franzosen, ein Vorspiel zum offenen Kampf liefern wollten? Da sah über eine Mauer ein altes, runzliges Gesicht, das nicht alsbald wieder verschwand. Auf ein lustiges: »Arro, Vater, eine Rupie für den Kuhdung zu einer Tasse Tee!« schob sich der schwarze Kopf sogar noch weiter heraus und ließ sich das Geldstück zeigen, das wir da so freigebig anboten. »Wir wollen rasch Tee trinken, um heute noch weiterzukommen,« sagte ihm der Dolmetscher Tschang beruhigend, »lasse uns doch in deinen Hof hinein. Du sollst dafür noch eine Rupie haben.« Die Worte »dya tung« (Tee trinken) und »tsamba so« (Tsamba essen), dazu das Gesicht und der Rock des chinesischen Lao ye hatten wieder einmal den Bann gebrochen. Der Alte schob nach einigem Zögern den schweren Riegelbalken seines Tores beiseite und ließ uns, dem ausgegebenen Befehl seines Herrn zum Trotz, eintreten. Es war freilich kein allzu guter Platz, wo wir die Tiere abluden. Gegen den Bach zu befand sich nur eine wenig über meterhohe Steinmauer, und auf der einen Seite stand ein Haus, das den Hof bis fast in seine letzte Ecke beherrschte. Aber ich war doch im Ort drinnen und nicht in der offenen Prärie, wo bei Angriffen die Tiere kaum zu halten sind und sich auch nur schwer feststellen läßt, mit wem man es zu tun hat. Nachdem Tombu mda für die Ermordung eines Fremden einmal bestraft war, hielt ich es außerdem nach dem Charakter der Tibeter für völlig ausgeschlossen, daß die Einwohner innerhalb ihrer Mauern einen zweiten Raubanfall versuchen würden.
Nachdem abgeladen war, fehlte zunächst das Stroh für die Tiere. Ein eifersüchtiger Nachbar fand sich aber plötzlich, der das Fehlende verkaufte. Der von schräg vis-à-vis erinnerte sich an eine alte Tante, die arm war; er empfahl sie zum Feueranblasen für ein Dritteil einer Rupie, was wir mit Meißel und Hammer aus einer ganzen herstellten. Ein vierter und fünfter hörte, daß ich ein Maultier zu verkaufen hatte; sie mußten das Tier sehen und darum feilschen. Es kamen aber sonst nur noch wenige Tibeter in unseren Hof, und der Handel wurde von mir kunstvoll so lange hingezogen, bis kurz vor fünf Uhr die Herden der Dorfbewohner von den Bergen herabgetrieben wurden. Dann erst ließ ich die letzte Rupie im Preis nach. Wir sahen uns hierauf umständlich die angebotenen Rupien auf ihre Güte und Prägung an. Als auch dies erledigt war, fing ich zu lamentieren an, daß es nun schon so spät geworden sei, daß die Herden heimgekommen seien und wir ja nun das Maultier nicht mehr hergeben könnten, ohne uns zu versündigen. Notgedrungen war also meine Karawane in Tombu mda festgehalten. Als die Dämmerung hereinbrach, fand nun auch niemand etwas dabei, daß wir die Zelte aufschlugen. Die Nachbarn und der Wirt brachten gerne noch mehr Futterstroh. Ihre Frauen und Töchter halfen beim Kochen und Essen des Abendbrots und blieben noch lange beim flackernden Feuerschein schäkernd und singend bei uns im Freien.
In der Nacht trat starker, nasser Schneefall ein. Deshalb schliefen wir alle im Innern der Zelte und hatten als Wachen nur die Hunde draußen. Wenig nach Mitternacht war es, als diese unmittelbar vor meinem Zelt anschlugen. Auch meine heisere alte »Tschimo« war dabei, die nur mitheulte, wenn etwas wirklich Störendes in der Nähe war. Wir alle rannten darum auf ihre halberstickte Stimme hin mit Gewehren und blanken Klingen in die kalte Nacht hinaus. Zu sehen war niemand. Im Schnee aber fanden sich Fußspuren, die von einer frisch ausgebrochenen Bresche in der Außenmauer der Talseite geradeswegs zu meinen Pferden und wieder zurückliefen. Fleischstücke lagen herum, die den Hunden zugedacht waren, und neben der eingerissenen Mauer hoben wir einen Pelzmantel auf, in den sich mein schwarzer »Néhʿere« verbissen hatte. Vor der Mauer draußen waren noch mehr Fußspuren zu sehen, die weiterhin an der Außenseite des Dorfes entlangführten.
In der Frühe, als wir aufbrachen, deckte Neuschnee alle nächtlichen Tritte, und unsere Wirte waren so willig wie am Tage zuvor. Das Maultier wurde seinem Käufer verabfolgt, nachdem ich mir, der Landessitte folgend, noch ein paar Haare aus seiner Mähne gerauft hatte, dann halfen alle Nachbarn mit ihren Frauen beim Aufbinden der Lasten, und nach herzlichem Abschied, unter den fröhlichsten Abschiedsgrüßen der Frauen und ledigen Mädchen ging es in die Dorfgasse hinaus, an der Hausburg vorbei und die südliche der zwei Schluchten hinauf, über deren Vereinigungsstelle sich das Dorf Tombu mda mit seinen sechzig Familien aufgebaut hat. Eine halbe Stunde waren wir etwa marschiert, als wir im Wald zwei junge Männer trafen, die den Tung sche erwarteten und baten, er möchte uns doch veranlassen, den Pelzmantel zurückzugeben. Sie versprachen ihm dafür eine Vermittlungsrupie; ich erfuhr dadurch zum ersten Male, daß die Trophäe von meinen Dunganen zu ihren Sachen gepackt und mitgenommen worden war. Die beiden Leute machten Augen wie echte Spitzbuben und hatten die Frechheit, mit brennender Lunte zu uns zu kommen. Sie logen uns vor, die Diebe seien junge Männer aus der Nachbarschaft gewesen, die nur Spaß machen und uns erschrecken wollten.
Tombu mda liegt nach meinen Beobachtungen in 3805 m Höhe (Dutreuil de Rhins-Grenard: 3934 m), wenige Kilometer südlich steigt aber der Weg wieder bis auf 4535 m (Dutreuil-Grenard erreichten dort sogar einen Paß von 5000 m). Während unseres Weitermarsches hatte sich der Himmel rasch nach den morgendlichen Sonnenstrahlen wieder überzogen; der herrschende West der großen Höhen konnte die östliche Unterströmung nicht mehr meistern, so daß wir schon vor dem ersten der zwei Pässe, die nach Dscherku ndo hinüberführen, in ein dichtes Nebelmeer gelangten, in dem man sich nur mit Mühe zurechtfinden konnte. Dazu lag beinahe einen Fuß tief Schnee, der alle die Naka- und Nadung-Löcher und -Tümpel des Berges verdeckte und uns aufs äußerste erschöpfte. Unausgesetzt stürzten die Packtiere, mußten hochgezogen und neu beladen werden. Eines der Maultiere bekam eine Herzschwäche, taumelte zuerst wie betrunken und als ob es bergkrank geworden wäre, und fiel wieder und wieder auf die Knie, nachdem ihm längst seine kleine Last abgenommen war. Es wurde das erste Opfer dieser Winterreise. Gerade ehe die erste Etappe von der Karawane erreicht war, schlug ihm seine Schicksalsstunde. Es war früher ein so mutwilliger Scheck, der sich von allen Langohren am besten aufs Hintenauskeilen verstanden hatte. Jetzt mußten wir ihn einsam stehen lassen, um die anderen und uns selbst aus dieser lebensfeindlichen Welt zu retten. Aufrecht, wie angewurzelt und versteinert, blieb das arme Tier am Hange stehen. Eine alte Filzdecke haben wir ihm gelassen – wann mag sie ihm wohl ein vorüberreisender Tibeter abgenommen haben? Mit Mühe drehten wir das steife Tier noch so, daß es der Wind von hinten traf, dann trieben wir herzlosen Menschen die übrigen weiter in den peitschenden Sturm und den Nebel hinein Als ich zwei Tage darauf nach dem Maultier suchen ließ, war die Filzdecke entfernt, das Tier tot. Man legte mir zum Beweis seine langen grauen Ohren vor..
Die breite, sanfte, gerundete Berggestalt, die wir in der Höhe trafen, erschwerte noch mehr die Orientierung inmitten von Wolken und Schneewirbeln. Wäre der tiefe Schnee nicht gewesen, wir hätten glauben können, auf die Tschang tang zurückversetzt zu sein, so sanft waren die Böschungen, so muldig die Talformen, so schwach der Grat durch Pässe eingekerbt, so selten sah der anstehende Fels aus den Massen lockeren Schutts heraus.
Nachdem wir oben ein kleines Längstälchen überschritten hatten, mußte ein zweiter Paß, kaum niederer als der erste, überstiegen werden.
Endlich zerriß der Sturm die Wolkenhülle um uns. Nach Süden und Südwesten dehnte sich weiter und weiter das wirre Felsenchaos, das ich schon nördlich des Yang tse kiang bestaunen und bewundern mußte. Gipfel schloß sich an Gipfel, Kette hinter Kette, aber nirgends wollte sich eine menschliche Behausung zeigen. Zwischen kahlen Geröllhalden, dem Lauf eines Bächleins folgend, ging es von dem Passe hinab nach Süden. Wo das Erdreich durch die Sonne aufgetaut war und der Schnee fehlte, hemmte uns tiefgründiger Morast. Endlich aber trafen wir die dichtstehende Pflanzendecke wieder; wir fanden bald darauf zwei schwarze Zelte und weidende Yak. Vor uns liefen, aus Westen und Süden kommend, zwei große Täler zusammen. Und um eine scharfe Ecke biegend, sind wir plötzlich inmitten der Häuser von Dscherku ndo.

Abb. 11
Für den Handel mit Osttibet geprägte chinesische Silberrupie aus Tscheng tu fu. (Originalgröße)