
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
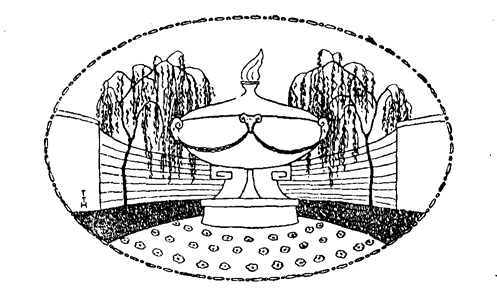
Mit größter Regelmäßigkeit, wie es sich für einen guten Verwaltungsbeamten gehört, pflegte sich Herr Maurice Dautricourt, Gerichtsrat des Euvebezirks, eine kleine Ausschweifung zu erlauben.
Jeden Sonnabend fuhr er mit dem Mittagszug, nur mit leichtem Gepäck ausgerüstet, nach Paris. Die Reisetasche in der Hand ging er die rue d'Amsterdam hinunter, etwa hundert Schritte weit, bis er das Haus Nr. 58 erreicht hatte. Er stieg die Treppe hinauf, die nicht mit Teppichen belegt, aber sauber gehalten war, und schellte an der 2ten Etage an einer Thür, deren Schild die Ankündigung: »Mlle. Grave, Modistin« trug.
Ein kleiner, zerzauster, koketter Fratz von Ladenmädchen öffnete ihm und kehrte, nachdem sie ihn erkannt hatte, in das Atelier zurück um ihn anzumelden »Fräulein, der gnädige Herr ist da«, während er seinen Koffer hinstellte und den Mantel ablegte.
Bei einer zufälligen Begegnung in einem Boulevard-Theater hatten sie sich eines Sonnabend-Abends angefreundet. Martha Grave, die ein etwa fünfzehnjähriges Mädchen bei sich hatte, saß neben Dautricourt. Sie war geschmackvoll gekleidet und in dem Glanze der vielen Lichter schien sie hübsch zu sein mit ihrer elfenbeinbleichen Hautfarbe und dem glänzend schwarzen Haar. Der Gerichtsrat zeigte sich als höflicher Mann, lieh ihr sein Opernglas, wußte die Namen der Schauspielerinnen zu nennen und lud die Damen nach Schluß des Theaters zu einer Tasse Schokolade ein. Und dann, in der Brasserie »Zimmer«, wurde die nähere Bekanntschaft geschlossen. Dautricourt stellte sich vor und erfuhr, wer seine Nachbarin war und daß sie allein in Paris lebte. Ihre Mutter war gestorben, der alte Vater lebte zu Coubert in der Gegend von Brie auf einem Meierhof, einer Art Musterwirtschaft, die von Marthas ältester Schwester geleitet wurde. Die Jüngste war noch im Kloster bei den grauen Schwestern von Brie-Comte-Robert. Sie kam drei- bis viermal im Jahr nach Paris und dann führte Martha sie ins Theater um ihr ein Vergnügen zu machen.
Der Gerichtsrat brachte die beiden Schwestern nach Hause, nach ihrer Wohnung in der Rue d'Amsterdam. Er hatte Martha den Arm gegeben und wagte dann und wann einen vielsagenden Druck. Als sie das Haus erreicht hatten, wurde er dringlicher. Aber Fräulein Grave zeigte auf die kleine Schwester und flüsterte:
»Heute abend geht es nicht. Besuchen Sie mich nächsten Sonnabend.«
Er kam und von da an besuchte er sie jede Woche und blieb vom Sonnabend bis zum Montag morgen, ausgenommen die wenigen Wochen im Jahr, wenn die Kleine zum Besuch bei ihrer Schwester war. Dann blieb Dautricourt den Sonntag in Evreux und langweilte sich so, daß er das nächste Wiedersehen doppelt genoß.
Martha und er waren wie für einander geschaffen, beide waren ordnungsliebend, korrekt in allen Äußerlichkeiten und sparsam. Er pflegte seiner Geliebten Geld zu geben. Es war nicht viel, denn er war nicht reich, aber Geiz lag ihm fern und so gab er, was er eben konnte. Und Martha nahm es an, obgleich ihr Mode-Geschäft einträglicher war als seine Beamtenstellung, denn sie huldigte der in Frankreich herrschenden Anschauung, daß die Gunstbezeugungen einer Frau immer, wenn auch nur um der Form zu genügen, bezahlt werden müssen. Das that jedoch ihren Gefühlen für Dautricourt keinen Eintrag, sie liebte ihn und war ihm treu.
Sie fand ihn distinguiert und gescheidt und bewunderte an ihm die tadellosen Manieren eines wohlkonservierten Mannes von 35 Jahren.
An einem Sonnabend im Juni kehrte der Gerichtsrat gegen elf Uhr vormittags von einer dreitägigen Revisionsreise zurück und fand in seinem Briefkasten ein schwarzgerändertes Couvert mit dem Poststempel von Paris. Er öffnete es und las:
»Monsieur Dautricourt!
Zu meinem Schmerz muß ich Sie benachrichtigen, daß meine Schwester Martha Grave, die Sie zu besuchen pflegten, gestern, am Dienstag, plötzlich am Herzkrampf gestorben ist. Ich bin mit meiner ältesten Schwester in Paris. Man wird die Leiche morgen nach dem Kirchhof überführen, und ich denke, es wird Ihnen angenehm sein, dem beizuwohnen. Meine älteste Schwester wird dann gleich wieder abreisen, da sie auf der Meierei von Coubert unentbehrlich ist.
Ich bleibe noch um die Geschäfte abzuwickeln. – Die Beerdigung wird morgen früh um zehn Uhr stattfinden. –
Ich empfehle mich Ihnen, Herr Dautricourt, als die treue Schwester der Verstorbenen
Marie.
PS. Ich bin diejenige, die damals – das erste mal – mit Martha im Theater war.«
Der Rat war beim Lesen des Briefes bleich geworden. Dem Tode einer Frau, mit der man lange die Freuden der Liebe genossen hat, steht man nie gleichgültig gegenüber.
Dautricourt fühlte ein Prickeln in den Augenlidern, als ob seine längst des Weinens entwöhnten Augen versuchen wollten Thränen zu vergießen.
Er setzte sich nieder und murmelte:
»Das arme Mädchen.« Und in der Erbitterung gegen den Tod, der ein ihm nahestehendes Wesen hingerafft hatte, mischte sich ein selbstsüchtiges Bedauern über die Störung die sein eignes Leben dadurch erlitt. Was sollte nun aus seinen Sonntagen werden? Die arme Martha! Es war alles vorbei, er sollte sie nie wieder sehen. Es fiel ihm ein, daß er sich bei den Leuten des Hauses und den beiden Schwestern durch sein Nichterscheinen zum Leichenbegängnis in ein sonderbares Licht gesetzt habe. Der Gedanke, wie man ihm das möglicherweise auslegen würde, that seinem Herzen weh und verletzte zugleich das korrekte Empfinden, das in seiner Natur lag. Wie schade, daß man ihm den Brief nicht nachgeschickt hatte! Er hätte doch wenigstens noch einmal die Wohnung seiner Geliebten sehen können, ihr Zimmer, das Atelier und den Salon, wo die Damenhüte auf ihren gedrechselten Holzgestellen thronten. Dann dachte er plötzlich daran, daß sich bei Martha noch Nachtzeug von ihm befand, sowie sein Rasiermesser, sein Bild und einige Briefe von ihm. Das brachte ihn zum Entschluß.
»Ich muß hinfahren«, dachte er.
In einer Viertelstunde ging der Zug ab, mit dem er gewöhnlich gefahren war. Rasch traf er seine Vorbereitungen und stürzte zum Bahnhof. Zur gewohnten Stunde schellte er an der Thür seiner Geliebten.
Er erkannte das blonde, frische, junge Mädchen nicht, das ihm die Thür öffnete, dachte sich aber, daß es Marthas jüngste Schwester sein müsse.
»Mr. Dautricourt«, stellte er sich vor. – Sie wurde sehr rot und trat zurück.
»Bitte, kommen Sie in den Salon, mein Herr.«
Sie trat mit ihm ein und setzte sich ihm gegenüber. Er begann zu erklären, warum er nicht zur Beerdigung gekommen war und erzählte ihr die Geschichte von seiner Revisionsreise.
Die Stille, die jetzt in dem sonst durch die Nachbarschaft des Ateliers belebten Raum herrschte, und noch mehr die Gegenwart des jungen Mädchens machte ihn verlegen Und wie es ihm in den Gerichtssälen von Evreux zu gehen pflegte, fing er in seiner Verlegenheit an offizielle Redensarten zu machen.
Marie Grave hatte ihr Taschentuch hervorgezogen und schluchzte leise. Das brachte ihn vollends in Verwirrung. Er schwieg und sah sich um. Die Haubenstöcke mit den verschiedenen Kopfbedeckungen standen an ihren gewohnten Plätzen. Aber auf dem Sofa lag ein großer Todtenkranz, der seine Blicke fesselte, ein Kranz aus schwarzen und weißen Perlen mit einem Mittelstück aus Glas, das wie eine leere Trauer-Bonbonniére aussah. Darauf die Worte: »Ruhe sanft.«
Das junge Mädchen hatte aufgehört zu weinen:
»Sehen Sie den Kranz? Ich habe ihn gestern abend gekauft, ist er nicht schön? – Er hat 22 Francs gekostet.«
Dautricourt stand auf und besah den Kranz mit sachverständiger Miene. Dann setzte er sich wieder und sagte:
»Ja, soviel ist er schon wert. Er ist sehr schön.«
Marie hatte ihre Augen getrocknet und betrachtete ebenfalls mit Bewunderung den Kranz.
Dem jungen Manne kam plötzlich ein Gedanke:
»Wollen Sie mir nicht erlauben, gnädiges Fräulein – diesen Kranz« – er wurde verwirrt – »dem Andenken – kurz, die Kosten desselben zu tragen?«
Marie dachte nach und gab dann zur Antwort:
»Nein, wissen Sie, ich wollte auch gern etwas beitragen – aber wenn Sie wollen, teilen wir uns in die Kosten?«
Damit waren beide zufrieden. Diese Verhandlung hatte sie einander näher gebracht und sie fingen nun an vertraulich zu plaudern. Marie erzählte ihm die Ereignisse der letzten Tage, wie auf dem Meierhof ein Eilbote mit dem Telegramm angekommen sei, das ihnen Marthas Erkrankung meldete und sie bat doch gleich zu kommen, dann die nächtliche Fahrt mit der älteren Schwester und wie sie bei ihrer Ankunft Martha schon tot gefunden hatten, während ein Geistlicher und die Portiersfrau die Leichenwache bei ihr hielten.
»Und dann das Begräbnis und dann alle die Scherereien«, setzte das Mädchen mit dem vielsagenden Ausdruck hinzu, der ihrem eigensinnig geformten Mund so komisch stand. – »Meine große Schwester konnte nicht länger bleiben und nun muß ich wegen der Erbschaft mit dem Notar verhandeln. Wir wissen auch noch nicht, was aus dem Geschäft werden soll. Die Directrice würde es schon übernehmen, aber sie bietet zu wenig dafür. Und ich hätte beinahe Lust, mich selbst daran zu machen. Ich verstehe mich gut aufs Nähen, bei den grauen Schwestern habe ich die Nähabteilung geleitet und ich würde es bald lernen, Hüte zu garnieren. Mir graut nur davor, allein in Paris zu bleiben.«
Dautricourt hörte zu, er fand sie amüsant und anziehend. Als sie von der Erbschaft sprach, dachte er daran, daß sein Geld, das Geld, was er Martha gegeben und das sie immer auf die Sparkasse getragen hatte, nun diesem muntern, tapfern, kleinen Landmädchen zu Gute kommen würde, und das freute ihn.
Er überlegte, wie er die Frage nach seinen Effekten anbringen sollte, nach seinen Nachthemden und Rasiermessern und nach seinem Bild. Aber es kam ihm doch etwas unschicklich vor, diese intime Angelegenheit mit einem jungen Mädchen zu verhandeln, und er beschloß deswegen an die Älteste zu schreiben. Dann stand er auf um Abschied zu nehmen.
Aber Marie schien überrascht.
»Was, Sie wollen schon fort? Wollen Sie nicht mit mir gehen?«
»Mit Ihnen? Wohin denn?«
»Nun, doch zum Kirchhof – den Kranz hinlegen. Es ist nicht weit. Am Ende der rue d'Amsterdam, auf dem Kirchhof Montmartre.«
»Aber natürlich, mein Fräulein«, antwortete der Gerichtsrat. »Ich werde Sie mit dem größten Vergnügen begleiten. Wir wollen einen Wagen nehmen.«
»Das ist ein guter Gedanke«, meinte Marie, »einen Wagen, um den Kranz hinzuschaffen. Den Rückweg können wir dann zu Fuß machen. Ich will mir meinen Hut aufsetzen.«
Sie ließ ihn allein im Salon. Und durch die halbgeöffnete Thür schienen wehmütige Erinnerungen leise hereinzuhuschen, die das leere Zimmer belebten und dem jungen Mann seine Geliebte ins Gedächtnis zurückriefen. Er dachte an alle die Liebkosungen, deren Zeugen diese Möbel hier gewesen waren, und an den furchtbaren Widerspruch zwischen den ewigen Gesetzen der Liebe und denen des Todes.
Eine wahre Erleichterung war es ihm, als Marie wieder eintrat, so hübsch in ihren schwarzen Kleidern, und dem schwarzen mit einem Schleier von englischem Krepp.
Es war gegen drei Uhr, als der Wagen die beiden an dem Eisengitter des Kirchhofs Montmartre absetzte. Dautricourt trug den Kranz am rechten Arm und bot Marie den andern. So betraten sie diesen Garten des Todes. Langsam und schweigend gingen sie über den frisch aufgeschütteten Kies, in der prallen Sonne, unter deren Strahlen die glatten Blätter der Buchsbaumsträucher und die Steine der monotonen Grabtempel erglänzten.
Sie waren beide erhitzt und müde. Nur um irgend etwas zu sagen, fragte der Rat:
»Wissen Sie hier denn genau Bescheid?«
»O ja«, antwortete das junge Mädchen, »ich erinnere mich des Weges sehr wohl.«
Sie verließen die große Allee und bogen in eine kleinere ein, die etwas nach rechts führte. Die Gräber waren hier enger zusammengerückt und sahen einfacher aus. Aber in dieser Ecke des Friedhofes standen auch die Bäume dichter. Man hätte meinen können, daß die armen Leute, die hier begraben lagen, auch jetzt im Tode im Schatten schlafen wollten, nachdem sie ihr Leben in dunkler Verborgenheit zugebracht hatten.
Und oben in den Bäumen zankten sich die Sperlinge.
Vor einer schmucklosen Art Einfriedigung machte Marie Halt
»Hier ist es«, sagte sie und stieg über den hölzernen Zaun.
Dautricourt folgte ihr und sie standen beide vor einem kleinen Kreuz aus schwarzem Holz. Es war ganz neu und glänzte als ob die Farbe noch nicht ganz trocken wäre. Der Gerichtsrat las die Inschrift. Da stand in weißen Buchstaben zwischen zwei senkrecht hingemalten Thränen: »Martha Grave« mit dem Geburts- und Todesdatum.
Nachdem das junge Mädchen das Grab mit dem Blick einer sorgsamen Haushälterin in Augenschein genommen hatte, breitete sie ihr Taschentuch aus und kniete nieder. Dautricourt blieb stehen, zog aber den Hut und nahm eine andächtige Haltung an.
Er dachte an gar nichts. Der Weg, die Hitze und die unvorhergesehenen Ereignisse des Morgens hatten ihn verwirrt. Plötzlich hörte er leises Schluchzen neben sich und bei diesem Schluchzen ging das Herz ihm über, alles, was er seit dem Morgen an Gemütsbewegungen durchgemacht hatte, kam plötzlich wieder über ihn. Die aufgeworfene Erde, die Gräber mit ihrem Schmucke von Buchsbaum und Cypressen, alles das verdunkelte sich mit einem Male vor seinem Blicke, wie wenn die Sonne hinter einer vorüberziehenden Wolke verschwunden wäre.
Der Schmerz machte seine Nerven vibrieren und in diesem Schmerze gingen seine Gefühle für die Lebende und seine Trauer um die Tote unmerklich ineinander über.
Die arme Martha! Er sah sie vor sich, so blaß und müde, wie sie besonders in den letzten Wochen ihres Lebens gewesen war. Sie war doch das einzige Wesen, das ihm in den zehn Jahren, seit er seine Mutter verloren, Liebe entgegengebracht hatte. Ihm schauderte bei dem Gedanken an das Leben, was jetzt vor ihm lag, ein freudloses Berufsleben, nicht ferner mehr erhellt durch die Hoffnung auf die Sonntage, die sie sonst miteinander verbracht, ein Leben, das jetzt nur zwischen öden Geschäften und Zerstreuungen im Café hinfließen würde.
Der Gedanke an sich selbst brachte ihm seinen Kummer mit erneuter Kraft wieder zum Bewußtsein und er zerdrückte eine flüchtige Thräne.
In diesem Augenblick erhob sich Marie. Sie sah, daß er geweint hatte. Ihr beiderseitiger Schmerz, der sich wie ein Bild in zwei gegenüber gestellten Spiegeln durch den Wiederschein verdoppelte, trieb sie dazu, einander in die Arme zu sinken, wie es Verwandte am Sarge eines gemeinsamen Angehörigen thun. Der Gerichtsrat küßte das junge Mädchen auf die thränenfeuchten Wangen. Sie machte sich sanft los und sagte errötend und etwas verlegen: »Wollen wir gehen?«
Dautricourt machte eine zustimmende Bewegung. Beide verließen das Grab und gingen den Weg zurück, den sie gekommen waren. Marie ging voraus, stumm und mit gesenkten Augen. Ihre Brust hob sich unregelmäßig, jedesmal, wenn eine erneute Anwandlung von Traurigkeit sie schluchzen machte. Und wie jeder für Gefühlsregungen empfängliche Mann, der eine hübsche Frau weinen sieht, kam dem Gerichtsrat die Lust, sie in die Arme zu nehmen und mit zärtlichen Worten zu trösten.
Am Kirchhofsgitter angelangt, schien Marie sich wieder zu fassen.
»Ich will Sie jetzt verlassen, mein Herr«, sagte sie, »ich muß zum Notar gehen und Sie haben gewiß auch noch zu thun.«
Dautricourt hatte keine Geschäfte, aber in der That fing die ungewohnte Spannung, die seine Nerven seit dem Morgen auszuhalten gehabt, an ihn zu ermüden, und er sagte zögernd:
»Ja, ich muß auf dem Ministerium vorgehen.«
Dann, wie sie ihm in die Augen blickte, that es ihm leid, sie verlassen zu müssen und regte sich bei ihm der Wunsch, sie wiederzusehen.
So fragte er:
»Würden Sie so liebenswürdig sein, heute abend mit mir zu diniren?«
Sie machte wieder ihr drolliges, nachdenkliches Gesicht.
»Nun ja, ich bin ganz allein. Ich kann mir nichts angenehmeres wünschen. – Wo wollen wir denn essen? In Ihrem Restaurant in der rue Maubenge – ist Ihnen das recht?«
»Sie kennen das Lokal?«
»O ich kenne es recht gut. Ich war immer mit Martha dort, wenn ich nach Paris kam.«
»Nun gut, also abgemacht. Und wann?«
»Um sieben Uhr. Treffen wir uns am Omnibusbureau bei Notre-Dame.«
Sie drückten sich die Hand. Dautricourt blickte ihr nach, wie sich ihre schwarze Gestalt mitten in dem blendenden Sonnenlichte entfernte. An der Straßenecke verschwand sie. Nun machte er sich auch auf den Weg, er ging geradeaus die Boulevards entlang, auf den Arc des Etoiles zu und die Champs Elysees hinunter. Er ging an vielen Frauen vorbei, Damen, denen ihre Wagen im Schritt folgten, Dienstmädchen, Arbeiterinnen und solche, die ihre Liebe feilboten.
Ein Gedanke verfolgte ihn – der Gedanke, dem so viele Liebesverhältnisse ihre lange Dauer verdanken.
»Ich bin jetzt zu alt, um ein neues Verhältnis einzugehen.«
Und jedesmal antwortete etwas in der geheimsten Tiefe seines Herzens:
»Aber durchaus nicht. – Warum nicht mit der Schwester, wenn sie in Paris lebt? Sie sieht nicht aus wie eine heilige Agnes.«
Er wurde so nervös, daß er auf die Vorübergehenden hätte losschlagen mögen, trat schließlich in ein Café und las die Zeitungen, las sie alle durch, von der ersten Seite bis zu den Annoncen, als hätte er eine Aufgabe zu lernen, bis es Zeit war sich zum Rendez-vous bei Notre-Dame de Lorette zu begeben.
Marie war sehr pünktlich. Es schlug gerade sieben Uhr, als sie kam; er hatte schon zwanzig Minuten auf sie gewartet. Sie lächelten sich an und beide freuten sich des Wiedersehens. Sie erreichten das Restaurant in der rue Maubenge und setzten sich an den gewohnten Tisch.
Die Mahlzeit verlief fröhlich. Es kam ganz natürlich so. Wie auf stillschweigendes Übereinkommen hin zwischen Menschen, die von ihrem Kummer genug haben, sprachen sie nicht mehr von Martha. Marie erzählte von ihrer Jugend, von dem Meierhof, vom Kloster und der Nähabteilung.
Sie war animiert und witzig. Die Herren an den benachbarten Tischen warfen Blicke herüber, kurze vielsagende Blicke, die nach Antwort suchten. Und Dautricourt, der das bemerkte, war nicht ungehalten darüber.
Dann sprachen sie über die Zukunft und ob sie in Paris bleiben, oder das Geschäft jemand anderm übergeben sollte.
Dautricourt war dafür, daß sie bliebe. Sie machte Einwände, sprach von ihrer Unerfahrenheit, ihrer Furcht vor dem Alleinsein ...
»Aber ich stehe Ihnen doch immer zur Verfügung«, gab der Gerichtsrat zur Antwort.
Er nahm ihre Hand und drückte sie zärtlich. Und zwischen den Worten, die sie aussprachen, lasen sie beide Gedanken, die sie nicht auszusprechen wagten.
Beim Dessert entschloß sich der junge Mann endlich von seinen Briefen, seinem Bild und den Rasiermessern anzufangen. Marthas Schwester erinnerte sich die Sachen gesehen zu haben, und sie kamen überein, daß er sie am Abend mitnehmen sollte, wenn er Marie nach Hause brachte; und dann wollte er mit dem Zug um zehn Uhr zwanzig nach Evreux zurückkehren.
Sie verließen das Lokal, nachdem sie noch Kaffee und Johannisbeerschnaps getrunken hatten.
Schnell gingen sie die rue d'Amsterdam hinauf bis zu Nr. 58. Marie suchte die Gegenstände zusammen, wickelte sie in eine Zeitung und schnürte das Paket zusammen. Der Gerichtsrat hatte schon den Hut auf und leuchtete ihr. Sie zitterte etwas.
Als sie mit allem fertig waren, sahen sie sich einen Augenblick an, während sie sich gegenüber standen. Dautricourt sagte leise:
»Gut, so wollen wir denn Abschied nehmen.«
Wie vorher auf dem Kirchhofe, so erfaßte ihn jetzt wieder bei dem Gedanken an die nahe Abreise eine tiefe Traurigkeit. Er erhielt keine Antwort. Er dachte: »Es ist doch einfach dumm, so fortzugehen«, und er fand ein Mittel die Trennung noch etwas hinauszuschieben.
»Aber ehe ich fortgehe, möchte ich Marthas Zimmer noch einmal sehen – zum letztenmal.«
Sie sagte etwas beklommen: »Ja« und Dautricourt dachte: »Wenn ich jetzt nicht den Versuch mache, dann ist es zu spät – dann sehe ich sie nicht wieder.«
Sie ging voran. Als sie im Zimmer waren und sie das Licht auf den Nachttisch stellte, nahm er all seinen Mut zusammen, schloß das junge Mädchen fest in die Arme und küßte, wie es eben kam, ihr Gesicht, ihre Brust, ihr Haar. Sie wehrte sich und stammelte:
»Sind Sie toll, was soll das?«
Aber er zog sie zum Bett hin. Und sie blies mit einer geschickten Geberde erheuchelter Unschuld das Licht aus und ließ ihn gewähren. –
Am nächsten Abend begleitete Marie den Gerichtsrat. Im Wartesaal besprachen sie ihre Pläne. Marie hatte sich entschlossen, das Geschäft zu behalten, so konnten sie sich jede Woche sehen.
Es war hohe Zeit zur Abreise. Dautricourt versuchte dem jungen Mädchen einen blauen Schein in die Hand zu drücken. Aber sie wollte ihn nicht nehmen und meinte fest:
»Sie sind mir nur elf Francs schuldig, die Hälfte von dem Geld für den Kranz.«
Er gab sie ihr und während sie das Geld mit ernsthaftem Gesicht in ihr Portemonnaie steckte, murmelte er mit einem Lächeln: »Ja, und die arme Martha – wenn sie uns sähe!«
Und es war Marie völlig ernst, als sie in Gedanken an den Kranz und den Kirchhofsbesuch antwortete:
»Ja, sie würde wenigstens merken, daß wir sie nicht vergessen haben.«
