
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Populäre Vorlesung gehalten i. J. 1864 zu Graz.
Wer das Reisen kennt, der weiß, daß die Wanderlust mit dem Wandern wächst. Wie schön muß sich wohl dies waldige Tal von jenem Hügel ausnehmen! Wo rieselt dieser klare Bach hin, der sich dort in dem Schilf verbirgt. Wenn ich nur wüßte, wie die Landschaft hinter jenem Berge aussieht. So denkt das Kind bei seinen ersten Ausflügen. So ergeht es auch dem Naturforscher.
Die ersten Fragen werden dem Forscher durch praktische Rücksichten aufgedrängt, die späteren nicht mehr. Zu diesen zieht ihn ein unwiderstehlicher Reiz, ein edleres Interesse, das weit über das materielle Bedürfnis hinaus geht. Betrachten wir einen besonderen Fall.
Seit geraumer Zeit fesselt die Einrichtung des Gehörorgans die Aufmerksamkeit der Anatomen. Eine bedeutende Anzahl wichtiger Entdeckungen wurde durch ihre Arbeit zu Tage gefördert, eine schöne Reihe von Tatsachen und Wahrheiten wurde festgestellt. Allein mit diesen Tatsachen erschien eine Reihe von neuen merkwürdigen Rätseln.
Während die Lehre von der Organisation und den Verrichtungen des Auges bereits zu einer verhältnismäßig bedeutenden Klarheit gediehen ist, während gleichzeitig die Augenheilkunde eine Stufe erreicht hat, welche das vorige Jahrhundert kaum ahnen konnte, während der beobachtende Arzt mit Hilfe des Augenspiegels tief ins Innere des Auges eindringt, liegt die Theorie des Ohres zum Teil noch in einem ebenso geheimnisvollen als für den Forscher anziehenden Dunkel.
Nehmen Sie dies Ohrmodell in Augenschein! Schon bei jenem allgemein bekannten populären Teile, nach dessen Erstreckung in den Weltraum hinaus die Menge des Verstandes geschätzt wird, schon bei der Ohrmuschel beginnen die Rätsel. Sie sehen hier eine Reihe zuweilen sehr zierlicher Windungen, deren Bedeutung man nicht genau anzugeben vermag. Und doch sind sie gewiß nicht ohne Grund da.
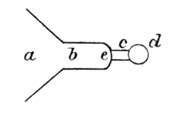
Fig. 6.
Die Ohrmuschel ( a in nebenstehendem Schema) führt den Schall in den mehrfach gekrümmten Gehörgang b, welcher durch eine dünne Haut, das sogenannte Trommelfell e abgeschlossen ist. Dieses wird durch den Schall in Bewegung gesetzt und bewegt wieder eine Reihe kleiner sonderbar geformter Knöchelchen ( c). Den Schluß bildet das Labyrinth ( d). Es besteht aus einer Anzahl mit Flüssigkeit gefüllter Höhlen, in welche die unzähligen Fasern des Gehörnervs eingebettet sind. Durch die Schwingung der Knöchelchen c wird die Labyrinthflüssigkeit erschüttert und der Gehörnerv gereizt. Hier beginnt der Prozeß des Hörens. So viel ist festgestellt. Die Einzelheiten aber sind ebenso viele unerledigte Fragen.
Zu allen diesen Rätseln hat Marchese A. Corti erst im Jahre 1851 ein neues hinzugefügt. Und merkwürdig, gerade dieses Rätsel ist es, welches wahrscheinlich die erste richtige Lösung erfahren hat. Dies wollen wir heute besprechen.
Corti fand nämlich in der Schnecke, einem Teil des Labyrinthes, eine große Anzahl skalenartig geordneter mit fast geometrischer Regelmäßigkeit nebeneinander gelagerter mikroskopischer Fasern. Kölliker zählte derselben an 3000. Max Schultze und Deiters haben sie ebenfalls untersucht.
Die Beschreibung der Einzelheiten könnte Sie nur belästigen, ohne größere Klarheit in die Sache zu bringen. Ich ziehe es deshalb vor, kurz zu sagen, was nach der Ansicht bedeutender Naturforscher wie Helmholtz und Fechner das Wesentliche an diesen Corti'schen Fasern ist. Die Schnecke scheint eine große Anzahl elastischer Fasern von abgestufter Länge (Fig. 7) zu enthalten, an welchen die Zweige des Hörnervs hängen. Diese ungleich langen Corti'schen Fasern müssen offenbar auch von ungleicher Elastizität und demnach auf verschiedene Töne gestimmt sein. Die Schnecke stellt also eine Art Klavier vor.

Fig. 7
Wozu mag nun diese Einrichtung, die sich sonst bei keinem anderen Sinnesorgan wiederfindet, taugen? Hängt sie nicht mit einer ebenso besonderen Eigenschaft des Ohres zusammen? Und in der Tat gibt es eine solche. Sie wissen wohl, daß es möglich ist, in einer Symphonie die einzelnen Stimmen für sich zu verfolgen. Ja sogar in einer Bach'schen Fuge geht dies noch an, und dies ist doch schon ein tüchtiges Stück Arbeit. Aus einer Harmonie sowohl, wie aus dem größten Tongewirre, vermag das Ohr die einzelnen Tonbestandteile herauszuhören. Das musikalische Ohr analysiert jedes Tongemenge. Das Auge hat eine analoge Eigenschaft nicht. Wer vermöchte es z. B. dem Weiß anzusehen, ohne es auf dem Wege des physikalischen Experimentes erfahren zu haben, daß es durch Zusammensetzung aus einer Reihe von Farben entsteht. Sollten nun die beiden Dinge, die genannte Eigenschaft und die von Corti entdeckte Einrichtung des Ohres, wirklich zusammenhängen? Es ist sehr wahrscheinlich. Das Rätsel wird gelöst, wenn wir annehmen, daß jedem Ton von bestimmter Höhe eine besondere Faser des Corti'schen Ohrklaviers und demnach ein besonderer an derselben hängender Nervenzweig entspricht.
Damit ich jedoch in den Stand gesetzt werde, Ihnen dies vollständig klar zu machen, muß ich bitten, mir einige Schritte durch das dürre Gebiet der Physik zu folgen.
Betrachten Sie ein Pendel. Aus der Gleichgewichtslage gebracht, etwa durch einen Stoß, fängt das Pendel an in einem bestimmten Takte zu schwingen, der von seiner Länge abhängt. Längere Pendel schwingen langsamer, kürzere rascher. Unser Pendel soll etwa einen Hin- und Hergang in einer Sekunde ausführen.
Das Pendel kann leicht auf doppelte Art in heftige Schwingungen versetzt werden, entweder durch einen starken plötzlichen Stoß, oder durch eine Anzahl passend angebrachter kleiner Stöße. Wir bringen z. B. dem in der Gleichgewichtslage ruhenden Pendel einen ganz kleinen Stoß bei. Es führt dann eine sehr kleine Schwingung aus. Wenn es nun nach einer Sekunde zum drittenmal die Gleichgewichtslage wieder passiert, geben wir demselben wieder einen ganz kleinen Stoß in der Richtung des ersten. Abermals nach einer Sekunde beim fünften Durchgang durch die Gleichgewichtslage stoßen wir wieder u. s. f. – Sie sehen, bei einer solchen Operation werden unsere Stöße immer die bereits vorhandene Bewegung des Pendels unterstützen. Nach jedem kleinen Stoße wird es in seinen Schwingungen etwas weiter ausholen und endlich eine ganz beträchtliche Bewegung zeigen. Dies Experiment mit den anschließenden Betrachtungen rührt von Galilei her.
Dies wird uns jedoch nicht immer gelingen. Es gelingt nur, wenn wir in demselben Takte stoßen, in welchem das Pendel selbst schwingen will. Würden wir z. B. den zweiten Stoß schon anbringen nach einer halben Sekunde und in gleicher Richtung wie den ersten Stoß, so müßte dieser der Bewegung des Pendels gerade entgegen wirken. Überhaupt ist leicht einzusehen, daß wir die Bewegung des Pendels desto mehr unterstützen, je mehr der Takt unserer kleinen Stöße dem eigenen Takte des Pendels gleichkommt. Stoßen wir in einem anderen Takte, als das Pendel schwingt, so befördern wir zwar auch in einigen Momenten dessen Schwingung, in anderen aber hemmen wir dieselbe wieder. Der Effekt wird im ganzen desto geringer, je mehr unsere Handbewegung von der Bewegung des Pendels verschieden ist. Bei genauer Überlegung stellt sich der Vorgang etwas komplizierter dar. Wenn die schwingende Bewegung gar keinem Widerstand unterliegt und die Erregung genau in dem Takte der Schwingung erfolgt, so kann die Schwingungsweite ins Unbegrenzte wachsen. Weicht der Takt der erregenden Bewegung im geringsten von der Schwingungsdauer ab, so tritt nach einer Periode der Verstärkung, die von desto längerer Dauer ist, je kleiner jene Differenz ist, eine Periode der Abschwächung von gleicher Dauer ein. Dieser Wechsel wiederholt sich fort und fort, wie man am besten beobachtet, wenn man durch eine galvanisch tönende Stimmgabel eine zweite von etwas verschiedener Stimmung erregt. Je geringer der Unterschied der Stimmung, desto länger dauert die Phase der Anschwellung, und eine desto größere Schwingungsweite kann die erregte Gabel erreichen. 1902.
Was vom Pendel gilt, kann man von jedem schwingenden Körper sagen. Eine tönende Stimmgabel schwingt auch, sie schwingt rascher wenn sie höher, langsamer wenn sie tiefer ist. Unserm Stimm-A entsprechen etwa 450 Schwingungen in der Sekunde.
Ich stelle zwei genau gleiche Stimmgabeln mit Resonanzkästchen versehen auf den Tisch nebeneinander. Die eine Gabel schlage ich kräftig an, so daß sie einen starken Ton gibt, und erfasse sie alsbald wieder mit der Hand, um den Ton zu unterdrücken. Nichtsdestoweniger hören Sie den Ton ganz deutlich fortsingen, und durch Betasten können Sie sich überzeugen, daß nun die andere nicht angeschlagene Gabel schwingt.
Ich klebe dann etwas Wachs an die Zinken der einen Gabel. Dadurch wird sie verstimmt, sie wird ein klein wenig tiefer. Wiederhole ich nun dasselbe Experiment mit den zwei ungleich hohen Gabeln, indem ich die eine Gabel anschlage und dieselbe mit der Hand erfasse, so verlischt in demselben Augenblicke der Ton, als ich die Gabel berühre.
Wie geht es nun bei diesen beiden Experimenten zu? – Ganz einfach! – Die schwingende Gabel bringt der Luft 450 Stöße in der Sekunde bei, welche sich bis zur anderen Gabel fortpflanzen. Ist die andere Gabel auf denselben Ton gestimmt, schwingt sie also für sich angeschlagen in demselben Takte, so genügen die ersteren Stöße, so gering sie auch sein mögen, um sie in lebhaftes Mitschwingen zu versetzen. Dies tritt nicht mehr ein, sobald der Schwingungstakt beider Gabeln etwas verschieden ist. Man mag noch so viele Gabeln anschlagen, die auf A gestimmte Gabel verhält sich gegen alle Töne gleichgültig außer gegen ihren Eigenton oder demselben sehr nahe liegende Töne. Und wenn Sie 3, 4, 5 .... Gabeln zugleich anschlagen, so tönt die A-Gabel nur dann mit, wenn sich unter den angeschlagenen auch eine A-Gabel befindet. Sie wählt also unter den angegebenen Tönen denjenigen aus, welcher ihr entspricht.
Man kann dasselbe von allen Körpern behaupten, welche zu tönen vermögen. Trinkgläser klingen beim Klavierspiel auf den Anschlag bestimmter Töne, ebenso die Fensterscheiben. Die Erscheinung ist nicht ohne Analogie in anderen Gebieten. Denken Sie sich einen Hund, der auf den Namen Phylax hört; er liegt unter dem Tische. Sie sprechen von Herkules und Plato, Sie rufen alle Heldennamen, die Ihnen einfallen. Der Hund rührt sich nicht, obgleich Ihnen eine ganz leise Bewegung seines Ohres andeutet das leise Mitschwingen seines Bewußtseins. Sowie Sie aber Phylax rufen, springt er Ihnen freudig entgegen. Die Stimmgabel ist ähnlich dem Hund; sie hört auf den Namen A.
Sie lächeln, meine Damen! – Sie rümpfen die Näschen – das Bild gefällt Ihnen nicht! – Ich kann noch mit einem anderen dienen. Zur Strafe sollen Sie's hören. Es ergeht Ihnen nicht besser als der Stimmgabel. Viele Herzen pochen Ihnen warm entgegen. Sie nehmen keine Notiz davon; Sie bleiben kalt. Das nützt Ihnen aber nichts; das wird sich rächen. Kommt nur einmal ein Herz, das so ganz im rechten Rhythmus schlägt, dann – hat auch Ihr Stündlein geschlagen. Dann schwingt auch Ihr Herz mit, Sie mögen wollen oder nicht. Dies Bild ist wenigstens nicht ganz neu, denn schon die Alten, wie die Philologen versichern, kannten – die Liebe.
Das für tönende Körper aufgestellte Gesetz des Mitschwingens erfährt eine gewisse Änderung für solche Körper, welche nicht selbst zu tönen vermögen. Solche Körper schwingen zwar viel schwächer, aber fast mit jedem Tone mit. Ein Cylinderhut tönt bekanntlich nicht. Wenn Sie aber im Konzert den Hut in der Hand halten, können Sie die ganze Symphonie nicht bloß hören, sondern auch mit den Fingern fühlen. Es ist wie bei den Menschen. Wer selbst den Ton anzugeben vermag, kümmert sich wenig um das Gerede der
anderen. Der Charakterlose geht aber überall mit, der muß überall dabei sein, im Mäßigkeitsverein und beim Trinkgelage – überall, wo es ein Komitee zu bilden giebt. Der Cylinderhut ist unter den Glocken, was der Charakterlose unter den Charakteren.
Finden die Schwingungen unter Widerstand statt, so vernichtet dieser nach einer Zeit, welche desto kürzer ist, je größer der Widerstand, nicht nur die Eigenbewegung der Schwingung, sondern auch die Wirkung der Impulse. Der Einfluß der Vergangenheit verschwindet desto rascher, je größer der Widerstand. Die Steigerung der Wirkung der Impulse ist also überhaupt auf eine kürzere Zeit beschränkt. Aber auch der Einfluß der Stimmungsdifferenz, welcher ebenfalls auf Summation in der Zeit beruht, kann sich nur in geringerem Grade bemerklich machen.
1902.
Ein klangfähiger Körper tönt also jedesmal mit, sobald sein Eigenton entweder allein oder zugleich mit anderen Tönen angegeben wird. Gehen wir nun einen Schritt weiter. Wie wird sich eine Gruppe von klangfähigen Körpern verhalten, welche ihren Tonhöhen nach eine Skale bilden? – Denken wir uns z. B. eine Reihe von Stäben oder Saiten (Fig. 8), welche auf die Töne c d e f g .... gestimmt sind. Es werde auf einem musikalischen Instrument der Akkord c e g angegeben. Jeder der Stäbe (Fig. 8) wird sich umsehen, ob in dem Akkorde sein Eigenton enthalten ist, und wenn er diesen findet, wird er mittönen. Der Stab c gibt also sofort den Ton c, der Stab e den Ton e, der Stab g den Ton g. Alle übrigen Stäbe bleiben in Ruhe, tönen nicht.

Fig. 8.
Wir brauchen nach einem solchen Instrumente, wie das hier erdichtete, nicht lange zu suchen. Jedes Klavier ist ein solcher Apparat, an welchem sich das erwähnte Experiment in ganz auffallender Weise ausführen läßt. Wir stellen zwei gleichgestimmte Klaviere nebeneinander. Das erste verwenden wir zur Tonerregung, das zweite lassen wir mitschwingen, nachdem wir die Dämpfung gehoben, und die Saiten also bewegungsfähig gemacht haben.
Jede Harmonie, die wir auf dem ersten Klavier kurz anschlagen, hören wir auf dem zweiten deutlich wiederklingen. Um nun nachzuweisen, daß es dieselben Saiten sind, die auf dem einen Klavier angeschlagen werden, und auf dem anderen wiederklingen, wiederholen wir das Experiment in etwas veränderter Weise. Wir lassen auch auf dem zweiten Klavier die Dämpfung nieder und halten auf diesem bloß die Tasten c e g, während wir auf dem ersten c e g kurz anschlagen. Die Harmonie c e g tönt auch jetzt in dem zweiten Klavier nach. Halten wir aber auf dem einen Klavier bloß g, indem wir auf dem anderen c e g anschlagen, so klingt bloß g nach. Es sind also die gleichgestimmten Saiten beider Klaviere, welche sich wechselseitig anregen.
Das Klavier vermag jeden Schall wiederzugeben, der sich aus seinen musikalischen Tönen zusammensetzen läßt. Es gibt z. B. einen Vokal, den man hineinsingt, ganz deutlich zurück. Und wirklich hat die Physik nachgewiesen, daß die Vokale sich aus einfachen musikalischen Tönen darstellen lassen.
Sie sehen, daß in einem Klavier durch Erregung bestimmter Töne in der Luft sich mit mechanischer Notwendigkeit ganz bestimmte Bewegungen auslösen. Es ließe sich dies zu manchem netten Kunststückchen verwenden. Denken Sie sich ein Kästchen, in welchem etwa eine Saite von bestimmter Tonhöhe gespannt wäre. Dieselbe gerät jedesmal in Bewegung, so oft ihr Ton gesungen oder gepfiffen wird. Der heutigen Mechanik würde es nun nicht sonderlich schwer fallen, das Kästchen so einzurichten, daß die schwingende Saite etwa eine galvanische Kette schließt und das Schloß aufspringt. Nicht viel mehr Mühe könnte es kosten, ein Kästchen zu verfertigen, welches auf den Pfiff einer bestimmten Melodie sich öffnet. Ein Zauberwort! und die Riegel fallen! Da hätten wir denn ein neues Vexierschloß; wieder ein Stück jener alten Märchenwelt, von welcher die Gegenwart bereits so viel verwirklicht hat, jener Märchenwelt, zu der Casellis Telegraph, durch welchen man mit eigener Handschrift einfach in die Entfernung schreibt, den neuesten Beitrag liefert. Was würde wohl der gute alte Herodot, der schon in Ägypten über manches den Kopf geschüttelt, zu allen diesen Dingen sagen? – »ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά«, »mir kaum glaublich«, so treuherzig wie damals, als er von der Umschiffung Afrikas hörte.
Ein neues Vexierschloß! – Wozu diese Erfindung? Ist doch der Mensch selbst ein solches Vexierschloß. Welche Reihe von Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, werden nicht durch ein Wort angeregt. Hat doch jeder seine Zeit, da man ihm mit einem bloßen Namen das Blut zum Herzen treiben kann. Wer in einer Volkversammlung war, weiß die ungeheure Arbeit und Bewegung zu schätzen, welche ausgelöst wird durch die unschuldigen Worte: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!
Kehren wir nun zu unserem ernsteren Gegenstande zurück. Betrachten wir wieder unser Klavier oder irgend einen anderen klavierartigen Apparat. Was leistet ein solches Instrument? Es zerlegt, es analysiert offenbar jedes in der Luft erregte Tongewirre in seine einzelnen Tonbestandteile, indem jeder Ton von einer anderen Saite aufgenommen wird: es führt eine wahre Spektralanalyse des Schalles aus. Selbst der vollständig Taube könnte mit Hilfe eines Klaviers, indem er die Saiten betastet oder mit dem Mikroskop deren Schwingungen beobachtet, sofort die Schallbewegung in der Luft untersuchen und die einzelnen Töne angeben, welche erregt werden.
Das Ohr hat dieselbe Eigenschaft wie das Klavier. Das Ohr leistet der Seele, was das beobachtete Klavier dem Tauben leistet. Die Seele ohne Ohr ist ja taub. Der Taube mit dem Klavier dagegen hört gewissermaßen, nur freilich viel schlechter und schwerfälliger als mit dem Ohre. Auch das Ohr zerlegt den Schall in seine Tonbestandteile. Ich täusche mich nun auch gewiß nicht, wenn ich annehme, daß Sie bereits ahnen, was es mit den Corti'schen Fasern für ein Bewandtnis hat. Wir können uns die Sache recht einfach vorstellen. Ein Klavier benutzen wir zur Tonerregung, das zweite denken wir uns in das Ohr eines Beobachters, an die Stelle der Corti'schen Fasern, welche ja wahrscheinlich einen ähnlichen Apparat vorstellen. An jeder Saite des Klaviers im Ohr soll eine besondere Faser des Gehörnerven hängen, so zwar, daß nur diese Faser gereizt wird, wenn die Saite in Schwingungen gerät. Schlagen wir nun auf dem äusseren Klavier einen Akkord an, so erklingt für jeden Ton desselben eine bestimmte Saite des inneren Klaviers, es werden so viele verschiedene Nervenfasern gereizt, als der Akkord Töne hat. Die von verschiedenen Tönen herrührenden gleichzeitigen Eindrücke können sich auf diese Weise unvermischt erhalten und durch die Aufmerksamkeit gesondert werden. Es ist wie mit den fünf Fingern der Hand. Mit jedem Finger können Sie etwas anderes tasten. Das Ohr hat nun an 3000 solcher Finger und jeder ist für das Tasten eines anderen Tones bestimmt. Weitere Ausführungen, welche über den hier dargelegten Helmholtb'schen Gedanken hinausgehen, befinden sich in meinen »Beiträgen zur Analyse der Empfindungen«. Jena 1836. 3. Auflage 1902. Unser Ohr ist ein Vexierschloß der erwähnten Art. Durch den Zaubergesang eines Tones springt es auf. Aber es ist ein ungemein sinnreiches Schloß. Nicht bloß ein Ton, jeder Ton bringt es zum Aufspringen, aber jeder anders. Auf jeden Ton antwortet es mit einer anderen Empfindung.
Mehr als einmal ist es in der Geschichte der Wissenschaft vorgekommen, daß eine Erscheinung durch die Theorie vorausgesagt und lange hernach erst der Beobachtung zugänglich wurde. Leverrier hat die Existenz und den Ort des Planeten Neptun vorausbestimmt und erst später hat Gall denselben an dem bestimmten Ort wirklich aufgefunden. Hamilton hat die Erscheinung der sogenannten konischen Lichtbrechung theoretisch erschlossen und Lloyd hat sie erst beobachtet. Ähnlich erging es nun auch der Helmholtz'schen Theorie der Corti'schen Fasern. Auch diese scheint durch die späteren Beobachtungen von V. Hensen im wesentlichen ihre Bestätigung erfahren zu haben. Die Krebse haben an ihrer freien Körperoberfläche Reihen von längeren und kürzeren, dickeren und dünneren, mutmaßlich mit Hörnerven zusammenhängende Härchen, welche gewissermaßen den Corti'schen Fasern entsprechen. Diese Härchen sah Hensen bei Erregung von Tönen schwingen, und zwar gerieten bei verschiedenen Tönen auch verschiedene Haare in Schwingungen.
Ich habe die Tätigkeit des Naturforschers mit einer Wanderung verglichen. Wenn man einen neuen Hügel ersteigt, erhält man von der ganzen Gegend eine andere Ansicht. Wenn der Forscher die Erklärung eines Rätsels gefunden, so hat er damit eine Reihe anderer Rätsel gelöst.
Gewiß hat es Sie schon oft befremdet, daß man, die Skale singend und bei der Oktave anlangend die Empfindung einer Wiederholung, nahezu dieselbe Empfindung hat wie beim Grundtone. Diese Erscheinung findet ihre Aufklärung in der dargelegten Ansicht über das Ohr. Und nicht nur diese Erscheinung, sondern die gesamten Gesetze der Harmonielehre lassen sich von hier aus mit bisher nicht geahnter Klarheit überschauen und begründen. Für heute muß ich mich jedoch mit der Andeutung dieser reizenden Aussichten begnügen. Die Betrachtung selbst würde uns zu weit führen in andere Wissensgebiete.
So muß ja auch der Naturforscher selbst sich Gewalt antun auf seinem Wege. Auch ihn zieht es fort von einem Wunder zum anderen, wie den Wanderer von Tal zu Tal, wie den Menschen überhaupt die Umstände aus einem Verhältnis des Lebens ins andere drängen. Er forscht nicht sowohl selbst, als er vielmehr geforscht wird. Aber er benütze die Zeit! und lasse den Blick nicht planlos schweifen! Denn bald erglänzt die Abendsonne, und ehe er die nächsten Wunder noch recht besehen, faßt ihn eine mächtige Hand und entführt ihn – in ein neues Reich der Rätsel.
Die Wissenschaft stand ehemals in einem anderen Verhältnis zur Poesie als heute. Die alten indischen Mathematiker schrieben ihre Lehrsätze in Versen und in ihren Rechnungsaufgaben blühten Lotosblumen, Rosen und Lilien, reizende Landschaften, Seen und Berge.
»Du schiffst auf einem See im Kahn. Eine Lilie ragt einen Schuh hoch über den Wasserspiegel hervor. Ein Lüftchen neigt sie, und sie verschwindet zwei Schuh von ihrem früheren Orte unter dem Wasser. Schnell Mathematiker, sage mir, wie tief ist der See?«
So spricht ein alter indischer Gelehrter. Diese Poesie ist, und zwar mit Recht, aus der Wissenschaft verschwunden. Aber in ihren dürren Blättern, da weht eine andere Poesie, die sich schlecht genug beschreiben läßt für jenen, der sie nie empfunden. Wer diese Poesie ganz genießen will, der muß selbst Hand ans Werk legen, muß selbst forschen. Deshalb genug davon! Ich schätze mich glücklich, wenn Sie dieser kleine Ausflug in ein blütenreiches Tal der Physiologie nicht gereut, und wenn Sie die Überzeugung mit sich nehmen, daß man auch von der Wissenschaft ähnliches sagen kann, wie von der Poesie:
Wer das Dichten will verstehen,
Muß ins Land der Dichtung gehen;
Wer den Dichter will verstehen,
Muß in Dichters Lande gehen.