
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
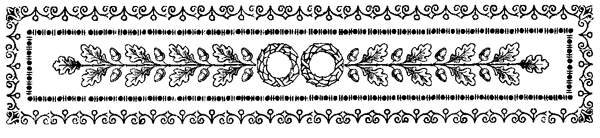
Das tiefste Wesen des menschlichen Geistes ist von dichten Schleiern umhüllt. Man vermag nur darauf hin aus zwei Arten von Aeußerungen zu schließen: aus der Art, wie es Wirkungen von außen aufnimmt und aus dem Widerstande, den es andern leistet. Dem, was wir Eigenart des Einzelnen nennen, liegt nicht die Gesammtheit der verschiedenen Einflüsse zu Grunde, welche er von der Außenwelt empfangen hat, sondern ein Kern, zu welchem die Wissenschaft vom Geiste bis heute noch nicht gelangt ist. Es scheint, als sei derselbe auch der Veränderung oder Entwickelung fähig.
Die Vorstellungen, welche wir mit Hilfe der Sinne in uns aufnehmen, werden nicht unterschiedlos aufgenommen. Von der frühesten Kindheit an findet eine Auswal derselben statt, oder, um es anders auszudrücken, es verhält sich der Wesenskern nicht so wie etwa ein festhängender Spiegel, welcher Alles widerstralt, was ihm gegenüber tritt, sondern wie ein solcher, der von unsichtbarer Kraft bewegt, sich nur nach bestimmten Gegenständen wendet, um deren Abbild in sich aufzunehmen.
Der Säugling schon wird von Farben oder Tönen verschieden beeinflußt, wendet den einen seine Aufmerksamkeit zu, während andere ihm unangenehm sind oder ihn gleichgültig lassen; ebenso verschieden ist das Verhalten gegen gewisse durch die Hautnerven vermittelte Sinnesempfindungen.
Die von außen zugeführten Vorstellungen werden von dem Wesen nicht stets gleich aufgenommen, aber sobald sie in das Gedächtniß eintreten, werden sie der Stoff für den selbstthätigen Geist. Schon sehr frühe beginnt die Einbildungskraft sich bemerkbar zu machen und belebt nicht nur die Dinge der Außenwelt, sondern ist auch innerlich mit den Vorstellungsbildern thätig. Man darf sogar sagen, daß diese Bildungskraft die äußeren Dinge nur als »bedeutende« Zeichen benötige; einige Holzklötzchen können jetzt Bausteine, dann Soldaten, dann Thiere, dann, neben einandergestellt einen Eisenbahnzug »bedeuten«. Das Kind bedarf der »Realität« nicht, denn ihm sind die Vorstellungen wie wirkliche Wesen, die Raumdinge aber oft wie bloßer Schein, welcher jede Gestalt annehmen kann.
Je lebhafter nun die Triebe oder Begehrungen werden, desto mehr beeinflussen sie die Bildungskraft. Sie suchen Nahrung in der Außenwelt und wenden sich immer mehr jenen Dingen zu, welche die Befriedigung eines Begehrens mit sich bringen.
Indem nun die Eltern, Erzieher oder andere Menschen den Begehrungen nachgeben oder dieselben eindämmen, entwickeln sich Vorstellungen vom Erlaubten und Unerlaubten. Aber nicht nur von außen werden diese erzeugt, denn der Mensch ist eben kein »leeres Blatt«, auf welches die Umgebung schreiben kann, was ihr beliebt. Der »Kern« kommt entgegen oder wehrt sich und es ist ebenso gut möglich, das ihm das, was wir »böse« nennen, verwandter ist, als das »Gute«, wie umgekehrt. Bezeichnen wir diese »Anlage« als vererbt, so ist damit zwar für die Erkenntniß nichts gewonnen, aber doch der Zusammenhang mit den Vorfahren angedeutet.
Die Bildung der Vorstellungen von Gut und Böse, von Sittlich und Unsittlich geht also, so zu sagen, dort vor sich, wo sich im Geiste die Einflüsse der Außenwelt und der Gegenstrebungen des »Kerns« begegnen. Immer aber wird, offen oder geheim, das innerste Wesen danach streben, sich mit verwandten Vorstellungen zu nähren.
So entsteht im Innern die erste Weltanschauung mit dem wollenden Ich im Mittelpunkte, aus welchem sich stets neue Begehrungen, Gefühle und Begriffe hervordrängen, während von außen immer neue Vorstellungen herbeifluten, welche das Ich an sich reißt und nach seiner Eigenart ummodelt.
Bei dem Durchschnittsmenschen ist nun die Bildungskraft mehr nach innen hinein tätig, bei dem Künstler dagegen entwickelt sie sich zur Phantasie, welche aus dem Innern hinausstrebt und mit Hilfe des Tons oder der Sprache, der Formen und Farben sich selbst und damit ein Bruchstück des Weltabbildes zu gestalten sucht.
Aber nun entwickelt sich dieser Drang frühzeitig und in Verbindung mit den Begehrungen.
Was das wollende Ich im Leben reizt, das wird auch das gestaltende anziehen; die Phantasie wird im Außenleben jene Nahrung aufsuchen, welche zugleich herrschende Triebe irgendwie befriedigt.
Der Anatom vermag am todten Körper irgend einen Nerv ohne Rücksicht auf die andern zu verfolgen und ihn ganz bloßzulegen und zu »präpariren«. Im lebendigen Geiste ist das unmöglich: nichts wirkt allein für sich, Vorstellungen erzeugen sich auf Antrieb außenliegender oder innerer Reize, von außen oder von innen wird das Wollen erregt; aus der Welt oder aus dem Ich, aus Vorstellungen und Begehrungen nimmt die stets thätige Gestaltungskraft ihren Stoff.
So ergiebt sich denn der Satz: die künstlerisch schaffende Kraft hängt auf das Innigste mit dem ganzen Menschen zusammen. Sie nährt sich nicht nur aus der ästhetischen Eigenart, sondern auch aus der sittlichen.
Die Kunstwerke werden so zu Selbstbekenntnissen des Urhebers; mit und ohne, ja wider Willen enthüllt er in ihnen sein Wesen mit seinen Schwächen und Vorzügen, verrät er das Erhabene oder Gemeine, das Göttliche oder Tierische; die Art des Denkens, Fühlens und Vorstellens offenbart sich; es offenbart sich, was das Ich sein und haben möchte, was es ist und was ihm fehlt. Es ist nur streng folgerichtig, wenn wir sagen; auch die Art, wie ein Künstler die Mittel behandelt, muß bei jedem aus sich schöpfenden Künstler, welcher nicht nur bloßer Nachahmer ist, zum Selbstbekenntniß werden. Je tiefer im scheinbar Unbewußten die ganze Anlage wurzelt, desto mehr muß die Behandlung der Mittel in sich das Wesen des Kernes offenbaren.
Wäre die Menschenkenntniß jemals zur unzweifelhaften Wissenschaft zu entwickeln, – ich leugne diese Möglichkeit – so müßte man etwa an einem Pinselstrich auf dem Bilde eines nackten Weibes genau die Empfindungen nachweisen können, mit welchen der Maler ihn gemacht hat.
Wenn wir aber auch wohl niemals so weit gelangen werden, soviel dürfen wir behaupten: aus den Werken läßt sich mit einer beschränkten Wahrscheinheit auf das Wesen des Urhebers schließen. Die Wal einzelner Worte in einem Gedichte kann dem geübten Beurteiler den ganzen Zusammenhang jener inneren Vorgänge verraten, aus welchen das einzige Wort, wie der Funke aus der elektrischen Spannung, hervorsprang; ebenso ist's mit der Lage des Körpers auf dem Bilde, welches ein entblößtes Weib darstellt, ja selbst mit der Auffassung des Fleischtons, bestimmter Schattenpartien; eine einzige Wendung eines einzigen Körperteils kann so zum Verräter werden und beweisen, daß die Vorstellung aus überwiegend sinnlichen, lüsternen Empfindungen hervorgegangen ist.
In der Kunstwirkung entzündet sich nun Verwandtes an Verwandtem und macht so offenbar, daß dem »Kerne« des Genießenden wie des Schaffenden trotz aller Verschiedenheit zugleich ein Gemeinsames innewohne. Der Ernst der sixtinischen Madonna, aus reiner, gottnaher Anschauung geboren, erzeugt in uns Ernst und Andacht; das nackte Knäblein, welches die Gans würgt, – ein Werk des griechischen Bildhauers Boethos – einer launig gestimmten Schöpfungskraft entsprungen, versetzt auch den Beschauer in leise Heiterkeit; bei Betrachtung der bekannten Aphrodite Kallipygos, welche das Gewand von der Rückseite zieht und mit nach hinten gewendetem Haupt dieselbe lächelnd betrachtet, mischen sich in die ästhetische Vorstellung schon sinnliche Empfindungen, wie das Werk selbst aus einem nicht mehr reinen Vorstellungskreise hervorgegangen ist. Und so giebt es auch Bilder, bei welchen wir genau fühlen, daß der Schaffende, vielleicht absichtlich, Alles betont habe, was die natürliche Erregung im Beschauer hervorzurufen geeignet ist.
Aus diesem Zusammenhange zwischen Geber und Empfänger erklären sich auch die mächtigen Wirkungen der Kunst. Die Schöpfungen, in welchen ein reiner, reicher Geist seinen Inhalt verkörpert hat, wirken befreiend. Sie heben den Geist über das Gebiet trüben Sinnenlebens hinauf zu den Leitbildern seines höheren Daseins, zeigen ihm eine andere Welt, als jene es ist, in welcher die Begehrungen der Sinne wurzeln. Indem sie ihn mit dem Edelmenschlichen und mit dem innerlich Schönen in Verbindung setzen, stärken sie in ihm die verwandten Gefühle und Vorstellungen – ohne deshalb » Moral predigen« zu wollen – und wirken so mittelbar auf das ethische Gefühl ein.
Sobald aber ein Künstler aus dem eigenen sittlich getrübten Vorstellungskreise heraus ein Werk schafft, in welchem das Lüsterne und Schlüpfrige Gestalt gewonnen hat, verbindet sich die im Beschauer erzeugte Vorstellung mit jenen Empfindungen, welche den nur physischen Begehrungen entstammen. Dann aber bildet das Kunstwerk nicht mehr die Jakobsleiter, auf welcher die Nachschaffungskraft des Laien zum Höheren steigen kann, sondern nur die Brücke zum Gemeinen, ästhetisch und sittlich Häßlichen hinüber.
Aus dem Gesagten ergiebt es sich von selbst, daß des Künstlers »privates« Leben durchaus nicht so gleichgültig für sein künstlerisches Schaffen sei, wie man heute anzunehmen pflegt. Was er lebt, das wird fast immer auf seine Bildungskraft zurückwirken und sich dann in seinen Gestalten offenbaren; ohne es zu wissen, wird er allmälig von »dem Gemeinen gebändigt« und während er vielleicht noch glaubt, rein sachlich der bloßen Formenschönheit nachzustreben, liegt er schon im Bann sinnlicher Verdunkelung, welche zuletzt unabwendbar auch das »Ideal« verunreinigen und selbst das sittliche Urteil trüben wird, weil eben, wie ausgeführt worden ist, im Menschen Alles auf das Innigste verbunden ist. Der größte Künstler spielt nicht straflos mit den sittlichen Gesetzen, das Genie hat, wenn es auch nicht mit dem Maßstab der Spießbürgermoral gemessen werden darf, im Allgemeinen nicht größere Freiheit, sondern nur höhere Pflichten. Sinkt der Mann zum Niedrigen und Gemeinen hinunter, so wird allmälig auch der Künstler mit ihm sinken und tiefer noch als der Durchschnittsmensch, weil die trügende Einbildungskraft sich mit dem unreinen Begehren verschwistert und das Gemeine mit schimmernder Hülle umkleidet.
»Der Künstler«, heißt es, »muß sinnlich sein!« Gewiß. Aber was heißt das: künstlerische Sinnlichkeit? Der Klarlegung dieses Begriffs soll der nächste Abschnitt der Untersuchung gewidmet sein.
Fast jedes Wort, welches abgezogene Begriffe bezeichnet, ändert im Laufe der Jahrhunderte seinen Inhalt, so daß wir oft nicht im Stande sind, anzugeben, ob es vordem dasselbe bedeutete, wie heute. Wie »Witz« bei Lessing etwas Anderes sagt, als bei einem neuzeitlichen Schriftsteller, so hat auch das Wort »sinnlich« z. B. bei Kant eine andere Bedeutung, als die heute oft damit verbundene. »Sinn« bezeichnet unter Anderem auch noch »Geistesrichtung« und hat darin die Bedeutung des althochdeutschen sinnan = gehen zum Teil bewahrt. In dem Beiwort »sinnlich« ist diese Vorstellung längst geschwunden und man verbindet nun damit die Begriffe: mit den Sinnen wahrnehmbar, auf die Sinne wirkend, und: den Sinnen schmeichelnd, das geschlechtliche Begehren weckend.
Im gegenwärtigen Sprachgebrauch schiebt sich die letztere Bedeutung immer mehr in den Vordergrund und hat sich allmälig so entwickelt, daß »sinnlich« mit »lüstern«, »geschlechtlich leicht erregbar« fast gleichwertig geworden ist. Aus dieser Wandlung ist auch der Irrtum hervorgegangen, daß dem Künstler eine größere »Sinnlichkeit« nötig sei, und er daher eine Ausnahmsstellung dem Sittengesetz gegenüber einnäme. Diese Ansicht offenbart sich uns somit als Ergebniß der Sinnverschiebung, welcher die meisten Worte, die nicht Raumdinge bezeichnen, mehr oder minder im Laufe der Zeit unterliegen.
Den Rohstoff der Malerei und Bildnerei bieten jene Vorstellungen, welche durch das Thor der Sinne, hier des Auges und des Tastsinns, in den Geist eintreten. In einer früheren Abhandlung (»Randbemerkungen eines Einsiedlers« S. 245-260) habe ich gezeigt, daß eine unmittelbare Nachahmung des Naturvorbildes, weil sie dem Wesen unseres Geistes widerspricht, einfach unmöglich sei. In sich nur sieht der Maler die Farben, in seinem Geiste nur nimmt er die Formen wahr; nicht das Ding selbst, sondern nur dessen Gleichniß besitzt er in der inneren Anschauung. Zwei Lichtbildkammern, welche man auf denselben Gegenstand bei gleicher Beleuchtung richtet, können zwei fast ganz gleiche Bilder geben, weil sie »mechanisch« arbeiten, aber nicht zwei Künstler giebt es, welche denselben Gegenstand vollkommen gleich auffassen. Schon das Wort »auffassen« verrät uns eine Geistesmitthätigkeit. Wol mag sich das Naturding auf der Netzhaut des Auges fast gleichmäßig abzeichnen, in dem Augenblick jedoch, wo es sich als empfunden dem Geiste mitteilt, wird es anders, wird es durch die Eigenart bestimmt.
Aber wir wissen, daß auch zu dem Sehen und Tasten, wie zum Hören gesunde, d. h. regelmäßig gebildete Werkzeuge nötig sind. Krankhafte Mißbildungen oder fehlerhafter Bau der Sinneswerkzeuge können die Vorstellung der darzustellenden Welt so verändern, daß die Menschen mit gesunden Sinnen das Abbild als ganz verfälscht bezeichnen. Sie können, nicht müssen. Denn Jemand kann z. B. für gewisse Farben so wenig Empfindung haben, daß ihm die Welt mehr oder minder farbenärmer als den Andern erscheint, und kann dabei noch immer einen nicht gewöhnlichen Künstlergeist besitzen. Die Sinne sind eben nur Mittel, nicht das Wesenhafte im Künstlerischen.
Andrerseits ist die Uebung derselben erforderlich. Der Durchschnittsmensch sieht z. B. am halbbedeckten Himmel nichts als Grau; das geschärfte Auge des Malers nimmt dagegen bläuliche, rötliche, gelbliche Tönungen wahr. Er überhört falsche Töne, bemerkt kaum, daß irgend ein Spieler einen Takt voraus ist, das geübte Ohr des Tondichters kann einen kaum bemerkbaren schwebenden Ton fast schmerzlich empfinden. Er hält einen Arm für vortrefflich gebildet, wenn er nur den Ansatz an der Achsel, den Ellenbogen und die Hand mit fünf Fingern wahrnimmt, während der künstlerisch fühlende Bildhauer die kleinste Abweichung eines Muskelbandes sieht und als einen Fehler empfindet.
Die Gründe dieser Thatsachen lassen sich auch nur bis zu einer bestimmten Grenze verfolgen. Wir werden dann einen Teil der Wurzeln dieser Erscheinung im Gedächtniß und in der Uebung finden. Der Künstler sieht einen Gegenstand, auch wenn er nicht die Absicht hat, ihn mit seinen Mitteln wiederzugeben, und die »Vorstellung« desselben wird vom »Gedächtniß« festgehalten – sie sinkt in das scheinbar Unbewußte. Wenn er nun denselben Gegenstand wieder erblickt, so taucht zugleich die Gedächtnißvorstellung wieder auf, welche etwas blasser geworden sein kann, und wird durch das wiederholte Vorstellen neu erfrischt, gekräftigt. Indem der Künstler nun den Gegenstand, nehmen wir an den weiblichen Körper, studirt und stets die Gedächtnißvorstellung mit dem neuen Eindruck vergleicht, wird er gewisse Merkmale der Einzelnkörper, z. B. irgend eine häßliche Warze, eine durch Zufälle entstandene Falte u. s. w., ausscheiden, sich dagegen aus den bleibenden Merkmalen allmälig eine Idealvorstellung, ein Leitbild des weiblichen Körpers entwickeln. Stete Uebung und erneutes Vergleichen werden ihn davor bewahren dieses Leitbild so blutlos zu machen, daß es der inneren, künstlerischen Wahrheit entbehre.
Wenn er nun einen weiblichen Körper vor sich hat, um ihn für ein Bild zu benutzen, so wird er nicht mehr nur diesen sehen, sondern wird seine leitbildliche Gedächtnißvorstellung zugleich in denselben hineinsehen, bewußt oder scheinbar unbewußt. Dieser Umarbeitung des Gegenstandes in eigenem Geiste kann auch der sogenannte »Naturalist« nicht entgehen.
Wir sehen, daß bei dem ganzen Vorgang, welchen ich hier zur Erklärung herbeigezogen habe, die Sinne mitthätig sind, aber eben nur mitthätig, denn das Bestimmende vollzieht sich innerhalb des Geistes.
Kein Begehren stört die reine Auffassung des Gegenstandes und die Entwicklung des Leitbildes, welches dann jedes weitere Sehen bestimmt.
Nun aber habe ich im ersten Teile der Untersuchung nachgewiesen, daß die verschiedenen Thätigkeiten des Geistes stets bereit seien sich mit einander zu verschwistern. So kann also auch die ursprünglich reine, von Selbstsucht freie Vorstellung Begehrungen wachrufen und sich mit ihnen verbinden.
Der Künstler sieht dann den Körper nicht mehr mit künstlerischer Sinnlichkeit, sondern mit geschlechtlicher und wir haben nun die Verschiebung des Wortsinnes vor uns.
In überraschender Weise wird sich zeigen, wie dieses unästhetische Begehren sich ebenfalls mit der leitbildlichen Gedächtnißvorstellung verschwistert, so daß der Geist die Gestalt nicht mehr als Form, also keusch, auffaßt, sondern als den Gegenstand des Begehrens. Und ohne es zu wollen, wird er diese grobsinnlichen Regungen in die Gestalt hineinsehen: die reinste jungfräuliche Gestalt wird er zur Dirne umstempeln, wie der reine Künstler in eine Dirne die hoheitsvolle Venus Urania hineinsieht.
Indem die trübe Sinnlichkeit begehrt, formt sie die Flächen, Linien und Farben um und erfüllt Alles mit ihrer Stimmung – sei es noch so leise: aus dem Werk klingt als Widerhall das Begehren des Urhebers zurück. Die Wendung der Hüften, die Haltung des Oberkörpers, der Ausdruck um die Lippen und im Auge werden von der Phantasiestimmung beeinflußt. Wer die Zeichnungen der illustrirten satirischen Wochenschriften von Wien und Paris während der letzten 25-30 Jahre und darin die einzelnen Künstler verfolgt hat, konnte wahrnehmen, wie der Typus des Weibes immer mehr und mehr sich in Richtung des Gemeinsinnlichen entfaltet hat. So wird es auch dem Maler gehen, welcher diesen Weg betritt: das Jungfräuliche, Keusche verschwindet immer mehr und das Dirnenhafte, Sinnlichlockende wird sich stetig entwickeln.
In diesem Sinne wird das Werk, wie ich im ersten Abschnitt betont habe, Selbstbekenntniß wider Willen, dann wirkt es aber auch in gleicher Art auf die meisten Beschauer ein. So beeinflußt das innerlich Unreine des Kunstwerks die Welt und erniedrigt die Menschen der Zeit.
Schließen wir von da zurück, so ergiebt sich der Satz: der Künstler, welcher rein auf seine Mitwelt wirken, welcher wahrhafter Künstler sein will, muß sich selbst als Charakter erziehen und seine Einbildungskraft frei machen von den Begehrungen der Sinnlichkeit.
Die sittliche und die künstlerische Eigenart verknüpfen sich so unlöslich in dem Geiste, daß jeder Mangel des Künstlers nichts Anderes ist, als der sinnlich erkennbar ausgeprägte Mangel des Menschen.
»Das »Temperament« erklärt zwar Vieles, entschuldigt aber Nichts; wo dasselbe die Freiheit des reinen, von Begehrungen freien Kunstschaffens schädigen könnte, dort ist es Aufgabe des Menschen, es zu zügeln, zu erziehen, zu fesseln, damit der Künstler im Menschen sich frei entfalten kann.
Mit diesen Ausführungen ist die Frage beantwortet, ob für den Künstler ein anderes Sittengesetz gelte, als für den schlichten Bürger. Als Glied des Volkskörpers steht er unter denselben ethischen Satzungen, denen Jeder untertan sein soll; seine Sünde ist Sünde wie die jedes Andern. Weil er jedoch Künstler ist, wird sie gedoppelt. Ich weiß, daß diese Ansicht heute von Wenigen innerlich geteilt wird. Aber sie läßt sich streng begründen. Da sich sittliche Schwächen in künstlerische umsetzen, so untersteht auch das Kunstwerk, nicht etwa den Bestimmungen einer schwächlichen Anständigkeit, aber den ethischen Satzungen. Die That eines unbeachteten Menschen kann vielleicht ohne weitere Wirkungen vorübergehen, die Schöpfung des Künstlers aber bleibt und wirkt auf Tausende, oft auch auf die Bürger ferner Tage. Die unsittliche Stimmung, welche sie ausströmt, zittert weiter, wird als Vorstellung von andern Geistern ausgenommen, vereint sich dort mit Begehrungen und entbindet oft unsittliche Thaten oder doch unreine Gedanken.
Darum sündigt der Künstler doppelt und hundertfach und darum fordere ich von ihm, daß er doppelt und hundertfach mehr den Dienst der sittlichen Gedanken pflege, als die anderen.
Eine reine Kunst ist dagegen aus gleichen Gründen ein Segen für Volk und Menschheit. Der Funke edlen Feuers, welcher in einem Werke des schaffenden Geistes glüht, ist für Jahrhunderte, oft für Jahrtausende unverlöschbar. Tausende entzündeten sich an ihm; die Stimmung des Edlen, Reinen, Begeisterten zittert auch weiter und diese Kraft, gebannt in sinnlich wahrnehmbare Formen, setzt sich nun in Vorstellungen um, welche aber reine und schöne Begehrungen wachrufen. So und nur so werden die echten Künstler zu Miterziehern der Völker.
Unsere Tage machen es nötig, daß diese Wahrheiten, entnommen dem Wesen des menschlichen Geistes, mit lauter Stimme gesagt und immer wieder gesagt werden. Auf allen Gebieten der Kunst drängen junge unreife Begabungen sich hervor, fordern für sich die Freiheit vom sittlichen Gesetze, predigen eine Natur, welche Tierheit ist, preisen das nackte Fleisch und spotten der ethischen Empfindung. Gegen diese Schlammflut gilt es einen festen Damm aufzurichten, damit nicht eine Zeit komme, wo in dem Tempel der Kunst statt der himmlischen reinen Göttin eine frechentblößte Venus pandemos trone.
Uralt ist das Wort: der Künstler sei ein Priester, aber es hat nichts verloren von seiner Geltung. Wer aber Unreines gestaltet und auf die gemeinen Triebe der Menschen rechnet, der versündigt sich an dem heiligen Geiste der Kunst. Mag denn auch eine frivole Menge gebildeten Pöbels ihm zujauchzen, von den Besseren wird er gerichtet.
*