
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
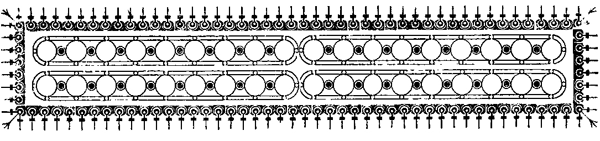
Sobald ein Volk eine bestimmte Höhe der Bildung gewonnen hat, entwickeln sich stets Kreise oder Stände, welche dem Kampfe um das Dasein des Tages mehr oder minder entrückt, die Geistesschätze der Vergangenheit sich leichter aneignen können, als die anderen Stammesgenossen.
Was schaffende Geister aus dem Innern der eigenen Seele hervorgebracht haben, wird bruchstückweise Eigentum dieser »Gebildeten«. Jene haben Welt und Leben in ihrer Art geschaut und empfunden oder die Erscheinungen um den Mittelpunkt eines beherrschenden Gedankens angeordnet; sie haben für Regungen der Seele und des Geistes Worte, Formen und Töne so gebildet, daß die Mehrheit der nicht Schaffenden darin zugleich den Ausdruck für das eigene Wesen findet.
Je reicher der Geistbesitz eines Volkes wird, desto weniger hat der Einzelne nötig selbstschöpferisch zu sein: die meisten wichtigen Dinge sind schon ausgesprochen. Er braucht sich nur der fertigen Begriffe und Anschauungen zu bemächtigen, sie in schon ausgeführtem Zusammenhange zu erfassen und er beherrscht mit einem im Verhältniß nur geringen Aufwande selbstschöpferischer Kraft das Abbild der Welt, wie es sich im Bewußtsein irgend eines Volkes zu irgend einer Zeit spiegelt.
Diese große Arbeit der Selbstdenker und Selbstschauer fördert jedoch noch ein zweites Ergebniß zu Tage: es macht alle jene Mittel geschmeidig, welche zum Ausdruck, zur Gestaltung der inneren Welt dienen. Geschmeidig werden Sprache, Ton, Farbe und Form; die Art ihrer Anwendung, die Geheimnisse ihres Gebrauchs werden allmälig Eigentum einer großen Menge. Was ursprünglich aus der Selbstoffenbarung der findenden Geister hervorgegangen war, läßt sich dann handwerksmäßig, also blos nachahmend aneignen.
In Zeiten, wo in großen Menschen die schöpferische Kraft mit fast leidenschaftlichem Drange waltet, eine neu in ihnen sich bildende Welt, wie geschmolzenes Erz in den Model des Kunstwerkes sich zu ergießen strebt, wird über Kunstmittel und Kunstgriffe wenig geschrieben. Die Schöpferkraft muß erst ermattet sein, ehe nachsinnende, beurteilende Geister den Versuch machen, aus den Werken der Kunst die Gesetze derselben, die Mittel der Darstellung zu entwickeln. Die Wissenschaft ist eben immer nur nachschaffend, niemals selbstschöpferisch; erfindend nie, sondern nur findend. Jahrtausende lang hatten Menschen den Hebel benützt, dessen Erfinder Niemand kennt, ehe Archimedes dessen Gesetze entwickelte: längst vermodert waren die Sänger der »Ilias« und »Odyssee«, war Aeschylus, ehe Aristoteles seine »Poetik« schrieb: kurz, die Uebung der Kunst geht der Wissenschaft immer vor.
Bei allen gebildeten Völkern des Westens und Ostens, bei Griechen, Römern, den neueren Romanen und Germanen ebenso, wie bei Chinesen und Indern entfalteten sich so Kunstsatzungen, deren Aneignung allmälig zum Erforderniß der »Bildung« wurde. Es war selbstverständlich, daß diejenigen Künste bevorzugt wurden, deren Mittel schon im Menschenkörper liegen und früh geübt werden, Sprache, Ton und Bewegung – also Dichtung, Gesang und Tanz, vornehmlich die erste. Man machte sich nicht nur zu Eigen, was schon an Werken vorhanden war, sondern versuchte auch, durch die Kenntniß der Satzungen unterstützt, nachzuahmen.
Es geht daraus zunächst hervor, daß der Dilettantismus als blos nachahmende Kunstübung sich unvermeidlich überall einstellen muß, wo die gewöhnliche Durchschnittsbildung hinreicht, das Mittel, also hier die Sprache, genügend zu beherrschen. Er ist somit eine Begleiterscheinung der höheren Bildung, als solche daher unausrottbar und wird in der Zukunft bei heute noch unfertigen Völkern ebenso sicher eintreten, wie er bei den vergangenen zum Vorschein kam, wie er heute bei allen höherentwickelten herrscht.
Die Wurzel des Dilettantismus Ich möchte für dieses Fremdwort den Ausdruck »Kunstspielerei« vorschlagen. liegt unvertilgbar im Wesen des Menschengeistes, in der Einbildungskraft. Es giebt keinen Menschen, welcher ihrer ganz bar wäre, denn schon der geringsten Willensbethätigung liegt ein Wirken derselben zu Grunde. Bei sehr Vielen tritt sie jedoch nicht so sichtbar zu Tage oder man hat sich gewöhnt, sie nur dort zu bemerken, wo das Ergebniß irgendwie dem Kreise des Künstlerischen angehört.
Jeder Eindruck, den ein Aeußeres auf den menschlichen Geist ausübt, wird mit oder ohne Bewußtsein aufgenommen und sucht dann wieder, oft ebenfalls vom Bewußtsein unabhängig, sich irgendwie zu gestalten.
So wirken auch die dichterischen Werke auf den Geist ein, und führen ihm Gedanken, Bilder und Gefühle in einer bestimmten Form ausgesprochen zu. Durch die Einbildungskraft ist er befähigt, das Empfangene nachzudenken, nachzubilden, nachzufühlen. Zugleich aber speichert er im Gedächtniß absichtslos jene Formen auf. Wird nun in ihm eine verwandte Anschauung oder ein verwandtes Gefühl angeregt, so kann der nicht selbstschöpferische Mensch zu denselben sich eigenartige Formen nicht gestalten und greift zu jenen, welche ihm das Gedächtniß von selbst darbietet.
Ich will den Vorgang durch ein besonderes Beispiel klar machen.
»Frühling« ist ein »abgezogener« Begriff, ein Wort, unter welchem eine Reihe von einzelnen Wahrnehmungen zusammengefaßt werden: Thauen des Eises, linde Luft, Vogelgesang, Knospen der Bäume und Sträucher, grüne Felder, blauer Himmel u. s. w.
Diese Einzelneindrücke, räumlich und zeitlich unter dem Begriff des Lenzes zusammengefaßt, erzeugen nun Gedächtnißvorstellungen, welche sich zu einer Gruppe so vereinen, daß bei Auftauchen einer beliebigen, z. B. Nachtigallgesang, alle mit ihr verbundenen danach streben, die Schwelle des Bewußtseins zu überschreiten.
In jeder Dichtung, welche, wie die deutsche, den Reim kennt, greift in diese Gesellschaftung der Gedächtnißbilder noch der rein äußerliche Beweggrund des Klangs ein: Duft und Luft, blühn und grün, Sonne und Wonne, Thau und Au u. s. w. schließen innerhalb der gesammten Vorstellungsgruppe noch engere Bündnisse mit einander.
Je mehr Frühlingslieder nun Jemand gelesen hat, um so öfter hat er diese und ähnliche Verbindungen von Reimen und gewisse andre fast feststehende Wendungen in sich aufgenommen. Er selbst hatte dabei einen kaum merklichen Aufwand von Geistesthätigkeit nöthig, er nahm einfach das schon Fertige in sich auf, wo dann, vom Bewußtsein unabhängig, sich die Vorstellungen an einander schlossen, bereit jeden Augenblick hervorzutreten.
Nun besitzt aber auch dieser blos aufnehmende Mensch dennoch Einbildungskraft und hat ungefähre Kenntniß von der äußeren Form eines Gedichts. Es ist vielleicht Frühling, alle jene Merkmale, die zu sehen er durch das Lesen fremder Lieder gewöhnt ist, fallen auch ihm in die Sinne: er sieht das Grün, die blühenden Blumen, nimmt die linde Luft u. s w. wahr. Die Gesammtheit der Erscheinungen wirkt nun durch das sinnliche Wohlgefühl auf den Geist ein und bringt diesen in Stimmung, welche die Absicht weckt, ihr Gestalt zu geben.
Die nachempfindende Einbildungskraft weckt jetzt aber – und das ist die Stelle, wo sich Künstler und Kunstspieler unterscheiden – nicht das tiefste, selbstständige Ich, sondern nur die schon in bestimmte Worte und Wendungen gehüllten Gedächtnißvorstellungen, welche ihren Ursprung in einem fremden Geiste haben. Mit wenigen Worten: der Kunstspieler ist nicht ein Selbstrufer sondern ein unbewußter Widerhall.
Das schließt aber nicht aus, daß die Werke des Dilettantismus oft bis zur Täuschung jenen der Kunst ähnlich scheinen. Die erlernbare Kenntniß der Formsatzungen, Geschmack in der Wahl des Stoffes, die Glätte des Ausdrucks: sie können vereint unter Umständen so glänzend wirken, daß sie selbst Schöpfungen echter Künstler für einige Zeit ebenso in den Schatten stellen, wie eine Rakete die Sterne – nur verpuffen die letzteren nicht.
Nachdem festgestellt worden ist, daß die Kunstspielerei unausrottbar sei, worin sie wurzele und sich von Kunst unterscheide, will ich die Verhältnisse zeichnen, welche in neuerer Zeit das unerträgliche Uebergewicht dieses Scheinwesens hervorgerufen haben.
Der Drang, angeeignete Gedanken und Anschauungen in einer erlernbaren Form auszusprechen, hat einen Bundesgenossen im Zeitungswesen gefunden. Von der Zeit an, wo dieses, den bescheidenen Anfängen entwachsen, sich auszubreiten begann, stieg auch die Kunstspielerei. Und zwar sind es vornehmlich die Unterhaltungsblätter, zu denen man auch die »Wochenschriften« des vorigen Jahrhunderts rechnen muß, gewesen, welche diesem Drange entgegenkamen und ihn verstärkten. Wer diese älteren Preßerzeugnisse kennt, wird wissen, daß sie zum allergrößten Teile vom Dilettantismus lebten und daß selbst die vornehmsten unter ihnen – mit wenigen Ausnahmen – die Mitarbeit der Kunstspieler nicht entbehren konnten.
Seitdem ist die Unterhaltungspresse zu riesigem Wachstum gelangt und ein Bedürfniß aller Kreise geworden; jeder Stand und jedes Alter hat heute Blätter dieser Art; es besteht wohl kaum mehr ein mittleres Städtchen, dessen Zeitung nicht wenigstens durch Novellen und Romane diesem Unterhaltungsbedürfniß zu genügen suchte.
Dadurch ist natürlich die Nachfrage nach »Waare« ins Unmeßbare gestiegen.
Ich nehme nun an, daß unter den etwa 10 000 Schriftstellern beider Geschlechter, fünf vom Hundert, also 500 Künstler sind – es ist das eher zu viel als zu wenig gerechnet – und von diesen etwa fünfundzwanzig, deren Werke sich bedeutend über das achtbare Mittelmaß erheben. Darunter sind aber sehr viele, welche einen anderen bürgerlichen Beruf haben und nur hie und da dichterisch thätig sind, oder Gattungen pflegen, welche für die Unterhaltungsblätter und Tageszeitungen nicht passen, wie Romane in Versen, freie Dichtungen, Epen, Bühnenspiele u. s. w. Es blieben etwa 100 gute und beste Schriftsteller übrig, welche nur durch und für die Feder leben, und hauptsächlich die erzählenden Gattungen und das feinere Feuilleton pflegen.
Nun bestehen in Deutschland Hunderte von »belletristischen« Blättern, und darunter etwa 100, welche anständig oder sogar sehr gut bezahlen können, daneben aber noch Tausende von Zeitungen, welche ebenfalls Unterhaltendes, oft in besonderen Beiblättern, bieten.
Rechnet man für die wöchentlichen Unterhaltungsblätter als Bedarf etwa 8-10 Romane und Novellen im Durchschnitt – die »deutsche Roman-Zeitung« hat etwa 16-18 nötig – und außerdem, was sicher zu wenig ist, 104 kleinere Beiträge im Jahre, so ergiebt sich als Bedarf: 800-1000 Erzählungen und 10 100 Aufsätze geringeren Umfangs. Dabei sind die Tagesblätter garnicht mitgerechnet, und die großen von ihnen bringen neben dem Romane noch ein, zuweilen selbst mehrere »Feuilletons« täglich.
Stellt man nun diesem riesigen Verbrauch die geringe Zahl der guten, und die verschwindend kleine der vorzüglichen Schriftsteller entgegen, so kommt man zu folgendem Schlusse: Selbst die reichsten Zeitschriften sind außer Stande ihre Spalten nur mit künstlerisch wertvollen Arbeiten zu füllen und müssen Dilettanten heranziehen; im Durchschnitt aber stellt sich das Verhältniß so dar, daß etwa fünf bis neun Zehntel des Inhalts durch Beiträge der Kunstspieler gedeckt werden. Mag der Herausgeber eines Unterhaltungsblattes noch so gebildeten Geschmack besitzen, die handwerksmäßigen Arbeiten noch so sehr verabscheuen, er ist gezwungen sich mit den Kunstspielern freundlich abzufinden.
Je größer die Anzahl der Blätter wird, desto mehr ist den Kunstspielenden Gelegenheit geboten, ihre Arbeiten anzubringen. Besonders diejenigen Zeitschriften, deren Mittel beschränkt sind, deren Verleger nichts als den gemeinen Erwerb im Auge haben, nehmen selbst das geradezu Schlechte auf, wenn es wenig kostet, und Andre wieder öffnen ihre Spalten jedem, welcher nichts verlangt, sich aber gedruckt sehen möchte.
So wird durch die Verhältnisse, welche sich von außen her garnicht ändern lassen, die Kunstspielerei von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gezüchtet.
Sehr, sehr viele werden auch durch die scheinbare Leichtigkeit des Geldverdienstes gelockt. Ohne jede tiefere Bildung, ohne jeden weitern Weltblick und ohne Menschenkenntniß, oft ohne die Fähigkeit sprachrichtig zu schreiben, wenden sie sich der Schriftstellerei zu. Aber es giebt auch sehr viele Blattleiter, welche ebenso tief in ihrer Bildung stehen und die Fähigkeit zu urteilen garnicht besitzen. Diese sind dann die eifrigsten Mitpfleger dieses kaninchenhaft fruchtbaren Dilettantismus.
Nun aber treten noch vielfach Zufälle auf, welche der Kunstspielerei geradezu glänzenden Erfolg ermöglichen. Irgend jemand hat durch einen Roman, meist ohne es zu wissen, eine Stimmung der großen Mehrheit getroffen und ist mit einem Schlage berühmt geworden. Die Leser verschlingen das Werk und können die Fortsetzungen kaum erwarten. Sofort werden die anderen Blätter aufmerksam und nun beginnt die Jagd nach dem neuen »Genie«. Die Verleger und Leiter der Zeitungen schreiben die schmeichelhaftesten Briefe und überbieten sich in ihren Anerbietungen; die Tagesblätter bringen Berichte über den Stern, andre Zeitschriften das Bild mit einer Lebensbeschreibung. Aber sofort setzen sich auch Dutzende von Kunstspielern hin und gucken sich die Augen aus, um zu finden, worin die »Eigenart« bestehe und beginnen dann nach dem neuesten »Recept« zu arbeiten. Namen will ich keine nennen – der Leser mag sich dieselben ergänzen.
Die sogenannte »Leserwelt« schwelgt in Entzücken (Verleger und Verfasser natürlich auch) und vollkommen urteilslos modelt sie ihren Geschmack nach der neuen Erscheinung, mit welcher nun alles andre verglichen wird. Die Blätter aber, denen es gelungen ist, eine Arbeit des für einige Jahre Unsterblichen zu erwerben, rasseln und trommeln und pauken aus allen Kräften, um der Mitwelt das bevorstehende Ereigniß mitzuteilen.
Fast alle, welche in dieser Art »Mode« werden, sind einfach Kunstspieler. Wohl können sie sich durch Uebung die »Mache« erwerben, und so Täuschungen hervorbringen, im Grunde aber fehlt ihnen immer die echte künstlerische Begabung. Untersucht man unbefangen ihre Schöpfungen, so zeigt sich, daß der Aufbau kunstwidrig, die Kennzeichnung der Menschen oberflächlich ist und dem Ausdruck und der Sprache zielbewußtes Streben gänzlich mangelt; es zeigt sich, daß die Einbildungskraft stets mit schon Vorhandenem, es nur neu knüpfend, arbeitet und gewöhnlich in einem Gedanken, in wenigen Gestalten erschöpft ist, welche dann immer wieder unter neuen Namen und an anderen Orten auftauchen.
Solche Erfolge der Flachheit, welche die deutsche Romanliteratur seit dem 18. Jahrhundert aufweist, wirken nun aber auf Hunderte zurück. Ich erwähne nur ein Beispiel. Irgend Jemand hat einen Roman geschrieben, welcher künstlerisch wertlos, großen Erfolg hatte. In ihm gewinnt eine sehr schöne, sehr kluge, sehr edle Gouvernante einen Grafen oder Baron. Sofort tauchten in allen Ecken und Enden Deutschlands Dutzende von unsagbar schönen, unsagbar klugen und unsagbar edlen Gouvernanten, Lehrerinnen, Gesellschafterinnen u. s. w. auf, welche alle einen sehr vornehmen oder doch sehr reichen Mann bekamen. Alle jungen Mädchen dieser Berufszweige, aber auch alle andern heiratsfähigen Töchter Germaniens sind entzückt – und viele setzen sich hin und schreiben etwas Aehnliches, bis der Geschmack sich einer anderen Schablonengestalt zuwendet, z. B. der unverstandenen Frau, und nun Dutzende unverstandener, sehr hochbegabter Frauen handwerksmäßig erzeugt werden. Für den Sittengeschichtsschreiber sind solche »stehende« Gestalten sehr bemerkenswert – so die Werthers, Renés z. B. – für die Kunst aber sind sie geradezu ein Verderb, denn gerade mit dem Abklatsch derselben arbeitet dann die Kunstspielerei. Man hat nichts anderes nötig, als die groben Umrisse zu zeichnen und die Gestalt zu taufen, das andre ergiebt sich von selbst.
Bezeichnend ist's, daß diese Nachschriftsteller von der Kunstform nicht die geringste Ahnung haben. Sie wissen nichts von einem Unterschied zwischen Roman und Novelle; sie wissen nicht, wie und wann man künstlerisch beschreiben soll, haben keine Ahnung von der Bedeutung des Gesprächs, von der Kunstwidrigkeit der bloß eingeschobenen Betrachtung. Darum wird ihnen auch die Arbeit so leicht, darum gilt ihnen die »Wirkung« die »Spannung« alles, die Vertiefung des Grundgedankens nichts. Und weil sie kein Aederchen echten Künstlertums in sich haben, mißhandeln sie unsre schöne, unendlich bildsame Muttersprache mit ästhetischer Schamlosigkeit; verunstalten sie mit Fremdwörtern, verwässern sie derartig daß von der Kraft nichts, vergröbern sie so, daß nichts übrig bleibt von der Anmut und Feinheit derselben. Wer dazu verdammt ist, viele derartige Arbeiten zu lesen, der ballt oft in ohnmächtiger Wut die Faust über diese unbefangene Frechheit.
Was vom Roman und der Novelle gesagt ist, gilt auch von den übrigen kleineren Gattungen. Eine bestimmte Auffassungsweise, eine gewisse Art des Vortrags hat Beifall gefunden; sofort stürzen sich die Nachahmer auf das Vorbild und beginnen in ähnlicher Art zu arbeiten; sie merken sich gewisse Wendungen des Ausdrucks, gewisse Worte und Gedanken und verwenden dieselben so, daß die Leser oft kaum den Diebstahl bemerken.
Eine große Vermehrung der Kunstspieler geht aus den neuzeitlichen Bildungsbestrebungen hervor. Die Eltern, selbst jene der untersten Stände, streben danach, ihren Kindern den Besuch der höheren Schulen möglich zu machen, oft ohne jede Rücksicht darauf, ob genug Begabung vorhanden sei, statt sie im eigenen Beruf gründlich auszubilden. Sehr viele von diesen jungen Menschen müssen nun oft schon in der Mitte der Bahn den Wettlauf aufgeben, sei es, weil sie geistig zu schwach sind, oder die Eltern die nötigen Geldmittel nicht mehr aufzutreiben vermögen. Nun sind diese Halbmenschen eigentlich zu nichts mehr zu brauchen. Verdorben für das Handwerk oder eine andre schlichtere Thätigkeit und unbrauchbar für jede wissenschaftliche Beschäftigung, wenden sich viele von ihnen der Zeitungsarbeit zu und rücken vielleicht allmälig vom Neuigkeitensammler zum »Schriftsteller« hinauf. Ihre ganze Bildung ist ein Gemenge von Viertel- und Halbwissen und von den alltäglichen Kunstgriffen, deren Anwendung die Mängel für das Auge der meisten Leser unsichtbar macht. Mancher von ihnen kann ja ein Genie sein, denn dasselbe hängt ja vom Wissen nicht ab, aber der Fall ist sehr selten.
Ein andrer Teil der Kunstspieler wirbt sich aus der »Gesellschaft« an. Hie und da ist einer »Dichter von Gottes Gnaden«, die meisten aber sind es nicht und werden Schriftsteller, sei es um Geld zu verdienen, sei es aus Eitelkeit oder aus Langeweile.
Vom rein menschlichen Standpunkte aus wird man sich gewiß freuen können, wenn Frauen und Männer die Feder ergreifen, um sich und den Ihrigen des Lebens Notdurft zu gewinnen. Aber auch dieser vielleicht notwendige Dilettantismus ist schädigend und entadelt die Dichtkunst, wie jeder andre.
Wie wirkt nun die Kunstspielerei auf Charakterbildung, wie auf die Leser ein?
Im Wesen der Kunstspielerei liegt eine Lüge und Lüge jeder Art vergiftet. Die innere Reinheit und Selbstständigkeit des Gefühls wird immer geringer, der halb unbewußte geistige Diebstahl, von welchem der Dilettant lebt, raubt ihm das künstlerische Gewissen, falls er es je besessen hat, ganz und gar. Aber dabei wird dennoch die Einbildung genährt, das Geschaffene sei dem eigenen Ich entnommen. Kein großer Künstler ist je so verletzend selbstbewußt, wie der vom Erfolg gekrönte Kunstspieler. Fehlt ihm dieser jedoch, so wird er neidisch und boshaft oder er fällt der Verbitterung zum Opfer.
Alle diese Folgen sind nun nicht gerade so wichtig, weil sie sich nur auf einzelne Mittelmäßigkeiten erstrecken. Betrübender ist die Wirkung, welche der unverdiente Erfolg der Oberflächlichkeit auf so manchen wahrhaft begabten Dichter ausübt. Ich habe mehr als einen gekannt und kenne jetzt manche, welche trotz aufrichtiger Liebe zu ihrem Volke nur mit Bitterkeit von demselben sprechen. Sie müssen sehen, daß der glückliche Dilettantismus sich volle Garben schneidet und ihnen nichts übrig bleibt als die Nachlese. Es leben in Deutschland sehr viele Dichter von Bedeutung, welche, wenn sie nicht Gnadengehalte von Fürsten oder Unterstützungen von Stiftungen oder Freunden bezögen, thatsächlich nicht im Stande wären die gemeinste Not von ihrer Schwelle zu bannen. Gar oft müssen sie den größten Theil ihrer Kraft der Tagespresse weihen, denn das Volk »der Dichter und Denker« kauft ja keine Bücher. Männer wie Grosse, Greif, Lingg u. s. w., also bedeutende Dichter müssen Unterstützungen aus der Schiller- oder Grillparzer-Stiftung annehmen, Unterstützungen, welche nicht weniger bitter sind, wenn man sie »Ehrengeschenke« nennt. Und diese Männer haben der Kunst, der echten, mit treuer Gesinnung gedient, haben manches Meisterwerk geschaffen, reich an Gedanken, groß an Anschauung, tief in der Empfindung – und der Lohn? Vielleicht einmal irgendwo ein Steinbildniß nach ihrem Tode, während sie im Leben kämpfen mit Sorgen und nicht im Stande sind, für die Zukunft der Ihrigen zu sorgen. Wahrhaftig, unser Volk macht es seinen echten Dichtern oft recht schwer, an den so viel gepriesenen »Idealismus« der Deutschen zu glauben.
Und diese Männer sollen nun nicht bitter werden, wenn sie sehen, daß erfolgreiche Kunstspieler sich, mit einem Moderoman oft mehr verdienen, als sie mit einem halben Dutzend selbstständiger Schöpfungen? Soll und muß sich nicht zu manchen Stunden in ihnen der Gedanke regen, daß es besser sei, nicht als Deutscher zur Welt zu kommen? Ein berühmter Dichter Frankreichs oder Englands kann vom Ertrage seiner Schöpfungen sorgenlos leben, der deutsche aber kann hochgeehrt und vielgepriesen sein – und dennoch von Monat zu Monat sich sorgen und kümmern müssen. Man giebt oft den Verlegern die Schuld. Das ist einfach ungerecht. Wie können sie für eine Dichtung viel bezahlen, wenn sie fast mit unbedingter Gewißheit sagen müssen: »Mehr als 500 höchstens 1000 Abdrücke verkaufe ich nicht?« Von der anderen Seite wird geschrien: »Der Deutsche hat kein Geld!« Auch das ist nicht wahr. Erstens giebt er für ganz überflüssige oft inhaltslose »Prachtwerke« immerhin große Summen aus, andrerseits verbraucht er in der Schenke so viel, daß er oft von einem Drittel seiner Ausgaben für Bier sich im Laufe der Jahre eine schöne ausgewählte Sammlung wertvoller Werke anschaffen könnte.
Die »Dilettanten« beziehen in Deutschland den allergrößten Teil der Summen, welche jährlich für geistige Arbeiten bezahlt werden. Ich könnte eine ganze Reihe von solchen männlichen und weiblichen Kunstspielern nennen, welche für einen Roman mehr erhalten, als Hamerling für alle seine Dichtungen zusammengenommen erhalten hat. Aber der Dilettantismus besitzt eben alle Eigenschaften, welche die große Menge braucht, und der echte Dichter hat sie nicht. Die nachhaltigsten Schäden jedoch fügt die Kunstspielerei dem öffentlichen Geschmack zu. Indem sie es ist, welche der Mehrheit die »geistige« Nahrung bietet, verflacht sie den Geschmack immer mehr und verdirbt die Urteilsfähigkeit, züchtet aber die Sorglosigkeit im Urteile. Die Werke der Dilettanten steigen immer zu dem Leser hinunter, nicht aber um ihn langsam auf einen höheren Standpunkt zu führen, sondern um selbst unten zu bleiben. Sie fügen sich in jeder Art dem Publikum, schmeicheln seinen Schwächen, zuweilen selbst seinen Lastern, bieten Philisterhaftigkeit für Gemüt, Unnatur für Leidenschaft, Geziertheit für Geist und vor Allem viel, viel »Stoff«. An Stelle wirklicher Poesie tritt Wortschwall, aufgeputzt mit poetisch klingenden Worten sog. »schöne« Beschreibungen der Natur drängen sich hervor und die platte Weisheit der Straße wird im Tone des Tiefsinns zum Besten gegeben.
So werden die Leser geist- und gemütfaul einerseits und andrerseits erregungsbedüftig. In sehr weiten Kreisen ist heute jedes wirkliche Kunstverständniß vollkommen geschwunden, und vor Allem ist das Formgefühl fast verloren gegangen. Mit dem Allen aber auch die Achtung vor der wirklichen Kunst. Bietet man den Lesern eine Schöpfung, welche in Form und Inhalt künstlerisch durchgearbeitet ist bis in das Kleinste, so kann man die Erfahrung machen, daß die ungeheure Mehrheit das Gebilde einfach nicht versteht.
Sehr viel hat zu dieser Verrohung des Geschmacks der Zeitungsroman beigetragen. Wollte man etwa von einem Tonwerk täglich zwanzig Takte geben, so würde jeder den Unsinn greifen können. Aber es ist mit einem echten Roman nicht anders: auch dieser muß als Einheit in die Phantasie aufgenommen werden, wenn er ganz wirken soll. Wenn man aber durch ein Vierteljahr täglich etwa vier bis fünf kleine Spalten liest, so ist es ganz selbstverständlich, daß man zuletzt nur mehr das Stoffliche betrachtet. So gewöhnen sich die Romanschreiber, recht viel grobe Wirkungen anzubringen, auf das für mindestens je zwei Fortsetzungen ein » Ereigniß« kommen könne, und die Leiter der Blätter wälen nur mehr derartige Arbeiten, welche spannen. Die Leser aber können dabei auf die Einheit der Ausarbeitung, auf die Uebergänge der Stimmungen nicht achten und der Blick für den Aufbau geht ganz verloren. So entwöhnt er sich allmälig auf die künstlerischen Eigenschaften zu achten: er entbehrt sie nicht, wo sie fehlen, und wo sie da sind, übersieht er sie. Das gilt aber nicht nur von den gewöhnlichen Lesern, sondern auch von Tausenden der Gebildeten. Selbst diese sind durch irgend eine herrschende Geschmacksrichtung geknechtet und lobpreisen einen Zeitdichter auch dann, wenn sie innerlich nichts für ihn fühlen: so groß ist auch ihnen gegenüber die Uebermacht der Mode.
Es hat niemals eine Zeit gegeben, wo ein ganzes Volk die gleiche Bildung besaß – gleich sein kann nur der Mangel derselben bei sog. Naturvölkern. Sonst aber werden sich mit der Arbeitsteilung stets Unterschiede entwickeln; ich glaube sogar, daß, je höher irgend ein Volk steht, diese Unterschiede um so bedeutender sein müssen. Ganz naturgemäß werden in dem geistigen Bildungsbau die Stufen sich nach oben hin verkleinern. Mag immerhin eine gewisse Anzahl von Gedanken und Vorstellungen, von Gefühls- und Empfindungsweisen gemeinsames Eigentum aller Volksglieder sein, so wird doch nach unten hin die Zahl derjenigen, welche umfassendere Bildung besitzen, abnehmen und dieses Mehr an Bildung wird in einem und demselben Volke Unterschiede hervorrufen, oft so groß, als lebten die einzelnen Kreise in einer anderen Welt.
Die verschiedenen Kreise haben auch ein verschiedenes Unterhaltungsbedürfniß und darum verschiedengeartete Schriftsteller. Den Kunstspielern steht die Menge der Lesedilettanten gegenüber, wie den echten Dichtern die Kunstleser, welche mit ganzem Verständniß jeder Absicht des Schriftstellers entgegenkommen, das leise Berührte sofort durch eigene Geistesthätigkeit ergänzen und die Form zu würdigen wissen.
Es ist nun zwar möglich, daß irgend ein großer Selbstschöpfer, indem er an das allen Volksgenossen Gemeinsame anknüpft, unzälige Herzen aller Kreise erschüttern, erfreuen, erhöhen kann, aber solche Geister sind eine Seltenheit. Im Allgemeinen aber gehen selbst hochbegabte Dichter schon aus einem bestimmten Bildungskreise hervor, auf welchen sie zunächst bewirken. Ihre eigenen Anschauungen weisen sie auf ähnlich fühlende und denkende Menschen hin und erst langsam gewinnen sie sich auch Verehrer unter denjenigen, welche sie sich erst erobern müssen.
Es ist somit auch wieder verständlich, daß die großen schnellen Erfolge mit sehr wenigen Ausnahmen nicht den tieferen Geistern zu Teil werden können, weil diese eben über der großen Mehrheit stehen; zumeist krönen sie jene Nachdenker und Nachempfinder, welche an sich eine viel größere Zal von verwandten Seelen besitzen, kurz: meistens die Vertreter der Kunstspielerei.
Der Dilettantismus ist also nicht nur eine unausrottbare Erscheinung im Völkerleben, er ist ebenso der Hauptträger der schnellen und großen Erfolge und nur sehr selten vereinen sich diese mit dem echten und bleibenden Verdienst.
Diesen Thatsachen gegenüber, welche sich nicht abstreiten lassen, ist jeder Versuch, die Kunstspielerei abzuschaffen, ganz und gar aussichtslos. Die einzelnen Dilettanten sind sehr schnell vergessen und mögen sie einige Zeit auch angebetet gewesen sein, der Dilettantismus selbst ist unsterblich, weil, so lange die Erde noch weiter rollen, so hoch die Durchschnittsbildung steigen mag, die Zahl der findenden Geister und der sie zuerst verstehenden Zeitgenossen stets klein sein wird gegenüber jenen, welche nur mit dem schon Gefundenen arbeiten und jenen, die nur dieses verstehen.
Trotz dieser vielleicht niederdrückenden Einsicht bleibt es die Pflicht der echten Kunstrichter, die hohe Kunst ihrer Zeit zu verteidigen und die Kunstspielerei, sobald sie frech und übermütig im Tempel der Dichtung Schacher treibt, zu brandmarken. Liefert sie aber mit gehöriger Bescheidenheit, mit Anstand und einem gewissen Geschmack die Menge der geistigen Alltagswaare für den Markt, so muß man sich mit Humor in das Unabänderliche fügen. Und schlüge man in jugendlicher Entrüstung auch Hunderte von Kunstspielern todt, morgen ständen andere Hundert da, ebenso sorglos gegenüber den großen Aufgaben der Kunst, und auch sie fänden einen Kreis, welcher in ihnen sein Ideal bewunderte.
Jene Geister aber, welche die Aufgabe des Dichters mit ganzem feurigem Herzen erfassen, aus sich selbst heraus schöpfen, sie mögen sich nicht verbittern lassen und mit trotzigem Stolze weiter ringen. Auch der Gedanke ohne Lohn zu arbeiten für die Besten, macht die Muskeln des Geistes zu Stahl, wenn man einmal begriffen hat, daß der Einzelngeist in seiner vorübergehenden Gestalt als Mensch nur flüchtig und nur ein Werkzeug sei für den Ewigen, dem er entstammt. Wer reinen Sinnes und selbstlos auch als Dichter dem Höchsten nachringt, was den Menschen zu bewegen vermag, säet unverwelklichen Samen, der einmal Früchte trägt. Möge er heitern Geistes die Ernte denen überlassen, welche da kommen – »das Echte ist der Nachwelt unverloren« und wirkt lebenweckend weiter; mag auch der Name des Sämanns dann verklungen sein, er selbst bleibt lebendig. Der Kunstspieler jedoch stirbt so gründlich, daß ihn nichts wieder zum Leben zu erwecken vermag. Das ist aber auch ein Trost.
*