
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
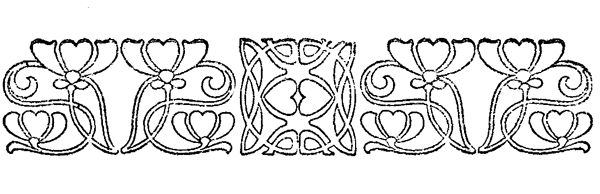
Frau Birkenfeld war am Morgen dieses Tages nicht ganz froh gestimmt. Schon als sie noch im Bette lag, hörte sie den Wind durch die Baumwipfel ihres Gartens rauschen und das war kein trostreiches Zeichen für einen günstigen Tag. Der Wind machte sie engbrüstig und die Engbrüstigkeit machte sie übelgelaunt, – das war eine alte Erfahrung, die jedermann an ihr und sie selbst am häufigsten an sich erprobt hatte. Daher verließ sie auch am Vormittag ihr Zimmer nicht. Gleich nach dem Frühstück setzte sie sich an den Schreibtisch und verfaßte eine lange Epistel an ihren getreuen Sachwalter, den Justizrat Backhaus in B..., dem sie verschiedene Fragen vorzulegen hatte, wie es ihr in Geldangelegenheiten oft begegnete. Als sie damit zustande gekommen – sie war sehr gewandt mit der Feder und außerdem eine geschickte Rechnerin – nahm sie verschiedene Handarbeiten vor, und als sie auch diese beseitigt, berief sie Boas, um mit ihm über die Einsammlung und Verteilung der nächstens zu erwartenden Früchte eine Konferenz zu halten. Nach dieser war die Eßzeit herangekommen und Frau Birkenfeld hatte ohne eigentlichen Appetit ihre Bouillon, ihre grünen Erbsen, etwas gebratenes Fleisch und Obst gespeist und dabei, wie alle Tage, ein Glas guten Rheinweins getrunken, den sie noch von ihrem seligen Mann her in ausgezeichneter Qualität im Keller vorrätig hielt.
Nach der Speisestunde beschäftigte sich die alte Dame eine Weile damit, das Wetter zu beobachten, das Thermometer und Barometer um Rat zu fragen und nach allen vier Weltgegenden Ausschau zu halten, indem sie den Zug der Wolken verfolgte und die Schnelligkeit prüfte, mit der sie über das schöne weite Tal von Berg zu Berg flogen.
Da ihr die Witterung günstiger und der Wind milder geworden zu sein schien, beschloß sie, ein Stündchen im überdies von allen Seiten geschützten Garten zuzubringen, und so sehen wir sie bald in ihrem gewöhnlichen schwarzen Taffetkleide, über welches der unentbehrliche grüne Pelz geworfen war, in der schneeweißen Tüllhaube mit gelben Bändern, um die noch zur Vorsicht, Ohren und Wangen einschließend, ein gelbseidenes Tuch geschlungen, in den Garten treten, sich fest auf einen Regenschirm stützend, den sie stets als Stab gebrauchte, und langsam durch die geschlängelten Wege wandeln, die allmählich nach der baumreichen Höhe führten.
Als die alte Frau sich wieder unter ihren Blumen befand und deren erquickenden Duft einatmete, den sie seit dem verflossenen Abend nicht mehr genossen, wurde ihr wieder wohler ums Herz. Sie beugte sich liebevoll zu einigen Rosen nieder, roch lange und mit sichtbarem Wohlgefallen daran und liebkoste und belächelte sie, als ob es Kinder oder mit Geist und Seele begabte Wesen wären.
Nachdem sie einige Zeit bei den Rosenbeeten verweilt, atmete sie leichter auf, blickte befriedigt um sich her und schritt dann langsam und oft sich ruhend höher empor, um ihren Bienen einen guten Tag zu sagen, die sich gewiß schon gewundert, daß sie die Herrin heute noch nicht gesehen hatten.
Endlich war der freie Platz unter den Linden erreicht, und das Summen und Schwirren der geflügelten Insekten machte sich deutlich vernehmbar. Frau Birkenfeld hob den klugen Kopf in die Höhe, sah nach den Wipfeln der Bäume, und als sie die Schwärme bei voller Arbeit fand, nickte sie zufrieden, indem sie sagte:
»Hm! Sie sind fleißig wie immer. Das ist gut.«
Mit diesen Worten ging sie an das erste Bienenhaus zur rechten Hand, hob den Schieber von der Glasscheibe und blickte lange und aufmerksam in das Innere des künstlichen Baues. Vom ersten schritt sie zum zweiten, dann zum dritten, und erst als sie beim letzten längere Zeit stehen blieb, zahllose Bienen schon ihren Kopf umschwärmten und sich an ihren Pelz hängten, als wollten sie die wohlbekannte Gönnerin begrüßen, sagte sie mit halblauter Stimme:
»So lass' ich mir's gefallen! Hier ist keine Unruhe, kein Streit, kein Neid, keine Eitelkeit, keine Überhebung! Jeder ist mit seinem Lose, seinem Besitz zufrieden, und vor allen Dingen: Jedes tut seine Pflicht, regt seine Glieder, wendet seinen Verstand an und ist fleißig bei der Arbeit. Darum haben sie auch alle Erfolg. Man kann sehen, was jede Biene täglich schafft – und das, ach nein! – das kann man bei den Menschen nicht – wenigstens nicht immer, meine ich. O, die stolzen, begabten und um so viel kräftigeren Menschen könnten ein belehrendes Beispiel daran nehmen! Hier ist Zufriedenheit, Glück, Reichtum und Fülle überall. In der Welt da draußen aber ist Armut und Dünkel, Schlaffheit und Mißvergnügen aller Art, Trägheit und Überdruß überall gepaart. Da gibt es mehr Drohnen als Bienen, mehr Faulheit als Fleiß, mehr Genußsucht als Arbeitstrieb. Jeder will haben, besitzen und so wenig wie möglich tun. Eine schöne Menschenwelt! Sehr zu achten und zu loben und fast zu beneiden, wahrhaftig! – Ach,« seufzte sie nach einer Weile auf und senkte den Kopf auf die Brust, indem sie den Berg wieder langsamer hinunter schritt, »doch was hilft's? Kann man es denn ändern, denn bessern? Hat denn jemand Ohren für gute Lehren? Daß sich Gott erbarme! Gewiß nicht! Ach, wenn mein guter Reinhold auch so gedacht hätte, wie die jetzigen jungen Leute, er wäre wahrhaftig nicht der Mann geworden, als der er gestorben ist. Gestorben! O wie schrecklich – das heißt für mich, denn ihm ist wohl! Ja, er ist tot, und ich sehe ihn nicht wieder – O! – Aber vielleicht doch, gewiß! Da oben! Habe Geduld, es dauert nicht mehr lange, und dann lege ich dir Rechenschaft ab – o! – Still, das war ein trauriger Gedanke – den hätte ich lieber nicht gehabt. Bis dahin gibt es noch harte Arbeit und vielleicht auch einen harten Kampf – aber was will denn die Dina? Sie kommt ja mit einer so frohen Miene?«
Die runde Dina kam trotz ihres schweren Körpers hurtig heran und sagte mit freundlichem Gesicht: »Frau Birkenfeld, es ist zwei Uhr. Soll ich den Kaffee irgendwo in den Garten bringen?«
Die alte Dame besann sich, prüfte den Himmel mit den Augen und bemerkte, daß noch immer flüchtige Wolken rasch vorüberzogen. »Nein, Dina,« erwiderte sie, »bring' ihn in die Stube, es könnte regnen.«
»Ich glaube nicht, Frau Birkenfeld, der Wind hat sich bedeutend gelegt, und es wird gut Wetter werden –«
»Ach, was verstehst du davon! Eben weil er sich gelegt hat, wird es regnen. – Nein, nein, mir ist, als müßte ich heute mehr in der Stube als im Garten sein – ich weiß nicht, mir ist so beklommen –«
»Tut Ihnen etwas weh, Frau Birkenfeld?« fragte Dina in ihrer stets zum Mitleid geneigten Gutmütigkeit.
»Dumme Gans!« brauste die alte Frau heftig auf. »Was für eine alberne Frage! Wann tut mir je etwas weh? Hab' ich dir schon mein Leid geklagt? Frage mich nicht so, ich kann es nicht leiden. Geschwind, tummle dich, du hast nicht viel Zeit. Bringe den Kaffee in meine Stube, fülle mir eine Tasse – ohne Zucker natürlich – und setze sie auf den Nähtisch am Fenster.«
Dina verschwand, noch eiliger als sie gekommen war, und langsam folgte ihr Frau Birkenfeld, trat durch den Gartensaal in das Treibhaus, von da in den Hausgang und erreichte so die freundliche Stube neben der Haustür zur Rechten, in der sie gewöhnlich zu sitzen und zu arbeiten pflegte.
In dieser Stube sah es sehr einfach, aber auch sehr gemütlich aus, wie wir das ganze Haus schon im allgemeinen beschrieben haben. Den Fenstern gegenüber stand ein mit schwarzem Wollstoff überzogenes Sofa. Davor ein runder Tisch, mit einem graugrünen Teppich behangen. Von derselben Farbe und ähnlichem Stoff war der Fußteppich, der den ganzen Boden bedeckte. Rechts vom Sofa an der Flurwand stand ein sehr schöner eiserner und ziemlich großer Geldschrank, an der entgegengesetzten Seite ein viereckiger mit Büchern und Zeitungen belegter Tisch. Das eine Fenster nahm ein fußhoher Tritt ein, einen kleinen Sessel und davor einen Nähtisch tragend. Neben diesem, mehr nach der Stube hinein und fast unter dem klaren Spiegel im Nußholzrahmen stand ein gewöhnlicher Stuhl mit einem großen Korbe von feinem Geflecht, und in diesem lagen eine Menge schon fertiger wollener Shawls von allen möglichen Farben, Socken, Pulswärmer und dergleichen Gegenstände, die Frau Birkenfeld alle selbst gestrickt und schon für den Winter gesammelt hatte, zu welcher Zeit sie die Armen der Umgegend mit irgend etwas davon beschenkte, oder in ihrer Abwesenheit von Boas beschenken ließ.
An den Wänden dieses Zimmers hingen einige alte, sehr schöne Kupferstiche, aber in dem Nebenzimmer, dessen Tür halb offen stand, sah man ein großes Ölbild, einen Mann mittleren Alters in Lebensgröße darstellend – und dies war das einzige Bild im ganzen Hause, welches sich eines kostbaren Goldrahmens erfreute.
Auf dem Nähtisch nun, vor dem sich Frau Birkenfeld alsbald niederließ, um sogleich an einem angefangenen Shawl weiterzustricken, lag eine goldene, sehr schöne, aber alte Taschenuhr an einem schwarzen Moiréebande, – Frau Birkenfeld pflegte nach der Uhr zu arbeiten und sich von Stunde zu Stunde gewisse Aufgaben zu stellen – ferner das Futteral der bekannten blauen Brille und ein Fernglas für zwei Augen, welches sie bisweilen benutzte, um nach irgend einem Gegenstand im Tale oder auf dem Flusse auszuschauen. Den Pelz behielt sie um, nur löste sie seinen Haken unter dem Kinn, und so sah man, daß sie noch eine schwarzseidene wattierte Mantille darunter trug, die die mageren Umrisse ihres kleinen gebrechlichen Körpers schon deutlicher hervortreten ließ.
Dina hatte die Tasse Kaffee bereits auf den Nähtisch gestellt und sich wieder entfernt. Frau Birkenfeld war also jetzt allein.
Von Zeit zu Zeit trank sie einen Schluck aus der Tasse, die mehr Milch als Kaffee enthielt, aber dabei strickte sie immer emsig weiter, als hätte sie noch eine große Aufgabe vor sich oder als müsse sie sich um das tägliche Brot mühen. Bisweilen sah sie scharf nach dem Flusse hinunter, doch stets nur mit raschem Blick, und immer wieder kehrten ihre grauen, lebhaften Augen zu dem wollenen Shawl zurück, der allmählich größer wurde und wahrscheinlich an diesem Tage noch fertig werden sollte.
Allein dies Schicksal war ihm nicht beschieden, es sollte eine unerwartete, auf der Cluus unerhörte Störung, wie ein Blitzstrahl vom hellen Himmel fallend, dazwischentreten.
Frau Birkenfelds Aufmerksamkeit ward nach einiger Zeit von ihrer Arbeit ab und nach außen gelenkt, dadurch, daß die Sonne aus einer großen Wolke hell hervorbrach und den kleinen Vorgarten des Hauses wunderlieblich erleuchtete. Die alte Frau schaute schnell auf und freute sich über diesen heiteren Sonnenblick, der sich nach und nach über das ganze Tal verbreitete, die Schatten desselben vertrieb und alle seine Schönheiten auf ergreifende Weise zum Vorschein kommen ließ. Sie kannte diese Schönheiten und liebte sie, daher sah sie sie jeden Tag gern sich von neuem entschleiern und auch jetzt weilten ihre Augen länger auf den fernen blauen Bergketten, auf dem sanft sich dahin schlängelnden Flusse und auf so manchem andern Punkte in Nähe und Ferne, der bei so plötzlicher Beleuchtung wie ein funkelnder Stern aus einer Nebelwolke hervorzuleuchten schien.
Als sie aber ihr Auge eine Weile an diesem Anblick gelabt, kehrte sie um so eifriger zu ihrer Arbeit zurück, seufzte dann und wann leise vor sich hin und überließ sich geraume Zeit ihrem Nachdenken, das, ihrer Miene nach zu urteilen, keineswegs einen angenehmen Gegenstand betraf.
Plötzlich aber und wie durch eine magnetische Gewalt fortgezogen, fuhr ihr Auge empor und faßte das Fährhaus auf, das, ganz deutlich erkennbar, gerade vor ihrem Fenster am jenseitigen Flußufer lag. Es war ihr, als habe sich irgend etwas Fremdes daselbst bewegt, und als sie nun hastig hinüberschaute, sah sie, daß sie sich nicht geirrt. Allein im Fährhause selbst regte sich noch nichts, nur eine Strecke davon kam auf dem Feldwege von der Chaussee her ein Reiter langsam herangeritten, der dann vor dem Hause hielt, abstieg und, während er sein Pferd der herausgerufenen Frau des Fährmanns gab, selbst in die niedrige Tür eintrat.
Es mußte ein großer Mann sein, denn er bückte sich dabei, das bemerkte Frau Birkenfelds scharfes Auge sehr wohl. Ihr entfielen beide hölzerne Nadeln auf einmal, ihr Herz klopfte fast hörbar und ihre Augen richteten sich mit einer an Starrheit glänzenden Schärfe auf das Haus, an dem doch jetzt nichts mehr zu sehen war.
Als sie aber niemanden und nichts, was ihr auffiel, in den nächsten fünf Minuten wahrnahm, wurde sie wieder ruhiger; ihre noch leise bebende Hand griff nach dem Fernglas, um es sogleich bereit zu haben, wenn es wieder etwas zu sehen gäbe.
Da schrak sie abermals zusammen und vergaß sogar über den ihr zuteil werdenden Anblick, der doch ganz einfach war, das Fernglas zu gebrauchen. Aus dem Hause drüben am Ufer trat nämlich der Fährmann mit dem Fremden heraus und ging dem Ufer zu, wo der fliegende Nachen angekettet lag. Der Fremde hatte, das bemerkte sie sogleich, seinen Regenrock abgelegt und erschien jetzt in einem feinen schwarzen Anzuge. Ja, er war groß, hatte eine männliche feste Haltung und, wie ihr däuchte, ein etwas bleiches, von dunkelem Barte eingefaßtes Gesicht.
Frau Birkenfeld wurde von Minute zu Minute unruhiger, rückte auf ihrem Stuhle hin und her und die bebenden Finger versagten ihr den Dienst, das Fernglas auf den Fremden zu richten, der bereits im Kahne stand und von dem vorwärts drängenden Strom dem diesseitigen Ufer näher getragen ward.
Frau Birkenfelds Gesicht wurde immer fahler und ängstlicher, je näher der Kahn dem Ufer kam. Ihre Brust hob und senkte sich ungestüm und über ihre schmalen Lippen drängten sich jetzt die Worte: »Mein Gott! Sollte es möglich sein – der Mensch dort – ha! Darum meine Beklommenheit heute! Das war die Ahnung eines Unglücks – o! – mußte ich es nicht schon lange befürchten?«
Da war das Boot dem Ufer ganz nahe gekommen. Der Fremde, der noch aufrecht darin stand, richtete sein Auge auf die umliegende Gegend, sein Gesicht hob sich empor – mehr sah die alte Frau nicht. Sie stieß einen unartikulierten Schrei aus, faßte mit der Hand nach dem Herzen und sprang von dem Tritt herunter.
Aber diese Angst, die sie auf so auffallende Weise blicken ließ, sollte nicht lange dauern. Sie ging fast blitzschnell vorüber; ihr Herz schlug, nicht ruhiger, aber weniger furchtsam, und ihr Gesicht nahm plötzlich einen erschreckenden Ausdruck von Groll und Haß an.
Als wäre sie durch zauberische Einwirkung um zwanzig Jahre jünger geworden, erhielten ihre Glieder Beweglichkeit und ihre Hände und Füße Kraft. Mit seltsamer Heftigkeit sprang sie auf die offen stehende Tür des Nebenzimmers zu, schlug sie krachend in das Schloß, drehte den Schlüssel mit fester Hand um und steckte ihn in ihre Rocktasche, noch zweimal fühlend, ob er auch darin sei, als gelte es, ihr kostbares Eigentum vor den Augen und der Faust des hereinbrechenden Diebes zu bewahren.
Nachdem sie dies vollbracht, warf sie rasch einen Blick in den Spiegel, drückte mit beiden Händen die Scheitel der weißen Haare zurück, riß dann das Futteral der Brille auf und befestigte die dunkelblauen Gläser schnell vor ihre Augen, worauf sie, äußerlich ganz ruhig erscheinend und nur noch innerlich bebend, ihren Platz vor dem Nähtisch wieder einnahm, um nach kurzer hastiger Überlegung den forschenden Blick nochmals auf das Ufer zu richten.
Der Fremde war unterdes aus dem Kahne gestiegen, stand aber noch am Landungsplatz und sprach mit dem Fährmann. Dieser nahm nun grüßend seinen Hut ab und der Fremde wandte sich um und schritt langsam und ruhig den Weg nach der Höhe hinan auf die Cluus zu.
Dieser sichtbare Angriff auf ihr stilles Haus aber mußte die alte Dame von neuem aufregen. Sie stand noch einmal hastig vom Stuhle auf, wollte das Fernglas ergreifen, aber die zitternden Hände versagten gänzlich den Dienst. Jetzt setzte sie das Glas unsanft nieder, trat in die Mitte der Stube und trippelte, die Hände ringend, halb bewußtlos hin und her.
In diesem Augenblick hatte der Fremde den Vorgarten erreicht. Er öffnete die Stackettür und gleich darauf hörte man den Granit der äußeren Treppenstufen unter seinen Füßen knirschen. Jetzt stand er eine Minute still, drehte sich gemächlich um, betrachtete die schöne Gegend, das Tal, den Fluß, was jetzt alles im reinsten Sonnenlichte glänzte, und blieb so, wie in Gedanken und Anschauen versunken, eine Weile stehen.
Als ob diese natürliche Zögerung die alte Frau mit neuem Grimme erfüllte, verschwand plötzlich ihre unruhige Beweglichkeit, ihre Gesichtszüge nahmen einen harten, fast beißenden Ausdruck an und ihr graugrünes Auge funkelte, wie ein boshaftes Katzenauge nur funkeln kann.
So stand sie, mit angehaltenem Atem lauschend, was nun geschehen würde. Sie sollte nicht lange warten. Der Fremde griff nach dem Ring des Klingelzuges und gleich darauf schallte der laute Ton der metallenen Glocke durch das ganze stille Haus.
Frau Birkenfeld stand mitten im Zimmer, einer steinernen Bildsäule gleich, mit vorgebeugtem Kopfe, horchendem Ohr und sprühendem Auge. Sie hörte, daß Boas durch den Hausgang kam, die Türe öffnete und daß der Fremde einige Worte an ihn richtete. Gleich darauf entstand ein ihr unerklärlich langes Schweigen – endlich ging Boas nach dem Hinterhause zurück, ohne zu ihr hereinzukommen.
»Was ist das?« schlüpfte es halblaut und mit röchelndem Brustton gesprochen, über die Lippen der alten Frau.
Sie mußte sich noch einige Minuten gedulden, die ihr eine Ewigkeit zu sein schienen. Dann rauschte es an der Tür, sie ging auf und nun trat Dina mit ganz verstörtem Gesicht und leise wie ein Schatten gleitend in die Stube, indem sie ganz leise sagte:
»Ach Gott, Frau Birkenfeld, ich habe eine ordentliche Lähmung in die Beine gekriegt – der Boas hat die Tür aufgemacht, ein fremder hübscher Herr steht da draußen und hat ihn gefragt, ob Sie zu Hause sind. Aber der Boas ist ganz starr vor Schrecken geworden – warum, weiß ich nicht – und ist zu mir hinten in die Kammer gekommen und hat mich gebeten, zu Ihnen zu gehen und –«
»Still!« herrschte Frau Birkenfeld sie an. »Nicht so viele Worte! Was hast du da?«
»Eine Karte, Frau Birkenfeld. So heißt der Herr, der draußen steht und Sie sprechen will.«
Frau Birkenfeld riß ihr mit wütender Geberde die Karte aus der Hand, warf einen funkelnden Blick darauf und starrte dann wie entseelt eine Weile ins Leere. Dann aber riß sie die Karte mit krampfhaft bebender Hand in vier Stücke, zog das Fenster auf und warf die Stücke hinaus.
»Was soll mir der Firlefanz?« sprudelte sie in nur mit Mühe halb unterdrückter Wut hervor. »Bei mir braucht er dergleichen nicht. Mag er seinen Namen sagen, wenn er einen hat, das ist genug. Und mich sprechen will er?«
»Gewiß, Frau Birkenfeld, und er wartet schon lange auf dem Flur.«
»Laß ihn noch länger warten! Ich mag ihn nicht. Warum soll ich den Menschen sehen, noch dazu in meinem friedlichen Hause – wie? Warum? frage ich. Nein, ich finde keinen Grund dazu auf. – Weise ihn ab und sage ihm, ich sei nicht zu Hause!«
»Aber, Frau Birkenfeld, Boas und ich haben ja schon gesagt, daß Sie zu Hause sind!«
»Alberne Gans, du!« rief Frau Birkenfeld mit dem Fuße stampfend, »du wirst alle Tage dümmer und der Boas ist ein – ein Esel! Also so ist es – ich darf nicht mehr empfangen, wen ich will? Nun gut denn, er soll mir nur kommen! Ja, ja, ja – ich bin zu Hause, und recht ordentlich bin ich zu Hause, er soll es gewahr werden! Laß ihn herein!«
Mit einer gebieterischen Handbewegung deutete sie auf die Tür, hinter welcher die erschreckte und überaus verwunderte Dina alsbald verschwand, da dergleichen ja noch fast gar nicht vorgekommen. Die alte Frau aber, sich auf eine unglaubliche Weise zusammennehmend, stieg wieder auf den Tritt am Fenster, rückte die Brille zurecht und nahm ihr zu Boden gefallenes Strickzeug auf, an welchem sie anscheinend mit dem größten Eifer zu stricken begann.
Da ging die Tür leise auf und herein trat die hohe edle Gestalt Bodo von Sellhausens, den Kopf mit stolzer und selbstbewußter Ruhe, aber ohne alle Anmaßung tragend, den tiefen Blick der dunklen Augen fest und doch sanft, gleichsam forschend vor sich her sendend, und in seiner Miene eine so achtungsvolle Ergebenheit zeigend, daß das härteste Herz unter diesem Blick hätte schmelzen können und das erregteste bei dieser Miene sich beruhigt fühlen müssen.
Aber Frau Birkenfeld wurde durch diese Miene und durch diesen Blick nicht beruhigt, im Gegenteil war sie bisher nur aufgeregt gewesen, jetzt, als sie kaum einen hastigen Blick auf die Gestalt und das Gesicht des eingetretenen Mannes geworfen hatte, wurde sie in tiefster Seele erschüttert und schien gar nicht zu bemerken, daß er sich ehrfurchtsvoll vor ihr verneigte und dann mit seiner klangvoll tiefen und doch sanften Stimme sagte:
»Ich danke Ihnen, Frau Birkenfeld. daß Sie mich bei sich eingelassen haben, und bitte um Entschuldigung, daß ich es wage, Ihre Ruhe zu stören, indem ich Sie mit meiner Person bekannt mache und mich Ihnen als Nachbar und Sohn eines alten Freundes Ihres Gatten vorstelle.«
Frau Birkenfeld erhob unwillkürlich die Augen und ließ sie einen Moment auf dem gegen sie gewendeten Gesichte ruhen, denn diese Stimme hatte sie gefesselt und besänftigt, wie das Öl einen brennenden Schmerz stillt und der Orkan sich legt, wenn der Wille eines Höheren ihm Schweigen gebietet.
»Was wünschen Sie von mir, mein Herr?« fragte sie dann hart und fast rauh, denn ihr Herz war noch lange nicht so weit bezwungen, um auch die starrsinnig widerstrebende Zunge zu bemeistern.
Bodo zögerte einen Augenblick mit der Antwort, denn die Art und Weise dieses seltsamen Empfanges gab ihm manches zu denken und er wußte sich nur allmählich in dieselbe zu finden. »Frau Birkenfeld,« sagte er dann, sanft lächelnd und mit seinen großen dunklen Augen sie ruhig betrachtend, »ich glaube es Ihnen schon gesagt zu haben. Vor allen Dingen aber bin ich gekommen, um mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen, da ich von verschiedenen Seiten gehört habe, daß Sie sich in der letzten Zeit nicht ganz wohl befanden.«
Die alte Frau schleuderte einen gehässig flammenden Blick auf den so achtungsvoll und bescheiden Redenden, dann sagte sie kurz und bündig: »Ich liebe es nicht, daß man nach meiner Gesundheit fragt. Ich bin eine alte Frau, die mit einem Fuße im Grabe steht, und da kann man nicht gesund sein oder sich wohl befinden. Darum ist das Fragen danach unnütz und langweilig.«
»Es lag durchaus nicht in meiner Absicht, Frau Birkenfeld,« lautete die noch milder gesprochene Antwort, »Sie an Ihr Alter und die Gebrechlichkeit des menschlichen Geschlechts zu erinnern, die uns allen – ja uns allen – gemeinsam ist und uns früher oder später heimsucht. Wenn ich aber jemanden frage, sei er, wer er sei, wie es mit seiner Gesundheit steht, so sprechen das nicht nur meine Lippen, sondern es spricht es mein Herz, und dies Herz hat von der Natur jenes Gefühl empfangen, welches man Teilnahme für seinen Nächsten nennt.«
»Teilnahme für seinen Nächsten? So! Inwiefern nehmen Sie denn an mir und meinem Wohlbefinden teil?«
»Ich habe keine Nebenabsichten dabei, Frau Birkenfeld, wenn ich hier Teilnahme äußere. Ihnen gegenüber ist dieselbe sehr erklärlich. Sie waren die Frau eines Mannes, den mein Vater liebte und schätzte – bis zu seinem letzten Augenblick.«
Frau Birkenfeld bebte zusammen, so heftig, so von einem inneren Schrecken durchschüttelt, daß ihr der nur halb auf den Schultern liegende Pelzmantel ganz herunter und zum Teil auf den Stuhl hinter ihr, zum Teil auf die Erde fiel.
Bodo trat leise von seinem Platze näher an sie heran und hob den Mantel empor, den er dann sanft über ihre Schulter breitete, worauf er sich sogleich wieder in einige Entfernung zurückzog.
»Bitte, bemühen Sie sich nicht um mich,« fuhr sie schon weniger rauh fort – »und setzen Sie sich.«
Bodo blickte sich bei diesen Worten nach einem Stuhl um, rückte ihn etwas näher an den Tritt und nahm dann Platz darauf. So saß er jetzt still, unbeweglich und erwartungsvoll da, indem er glaubte, die alte Frau werde sich mit einer neuen Frage an ihn wenden, die ihm die Fortsetzung des unerquicklichen Gesprächs erleichtern würde.
Es ist wunderbar, wie oft einzelne Kleinigkeiten uns bestimmen, an einem Menschen, der uns fremd entgegentritt, ein schnelles Wohlgefallen oder auch einen gewissen unerklärlichen Widerwillen zu finden. Eine zufällig gemachte Geberde, ein Blick, ein Wort reicht bisweilen hin, uns zu ihm hinzuziehen oder von ihm abzustoßen. Unbewacht entschlüpft ihm das eine oder andere und uns ergreift es dennoch mächtig, packt und hält uns oder drängt uns auf immer von ihm zurück, wie eine dämonische Faust, trotzdem wir keine Erklärung für das eine oder andere haben und trotzdem gar kein Grund für das eine oder andere vorzuliegen scheint. Sind diese Geberden, Blicke und Worte Eingebungen oder Ausflüsse einer höheren uns dominierenden Natur, oder sind sie nur die Funken oder Zünder eines in uns verborgen ruhenden Zündstoffs, der, in Flammen gesetzt, unsern Willen regiert, unsere Neigung anfacht, unsern Widerwillen stachelt? Wir wissen es nicht, wie wir so vieles nicht wissen, was in der geheimen Werkstatt unseres Innern vorgeht, aber die Wirkung ist gewiß da, wenn wir auch die Ursache vergebens zu ergründen suchen.
Mochte in der entstandenen Pause etwas dem Ähnliches zwischen der alten Frau und Bodo vorgegangen und mochte sich der eine oder die andere desselben mehr oder weniger bewußt geworden sein, wir wollen es nicht zu entziffern suchen – so viel aber ist gewiß, eine Wendung zum Bessern war bei der Besitzerin der Cluus insofern vorhanden, als sie ruhiger wurde und zwar auf einmal so ruhig, daß sie ihr Strickzeug wieder aufnehmen und eine Weile in der Arbeit daran fortfahren konnte. Nur mitunter zuckte es in ihr wieder auf, als ob eine unsichtbare Nadelspitze einen feinen Nerv ihres innersten Wesens berühre, und dann flogen ihre Hände unwillkürlich hin und her und rissen an dem bunten Faden, daß die Knäuel, von denen sie abliefen, dahin und dorthin tanzten. Bei einer dieser unwillkürlichen Bewegungen nun geschah es, daß ein kleines Knäuel Wolle aus dem Korbe sprang und vor Bodos Füße niederfiel, der noch immer schweigend und abwartend seine ruhige Haltung behauptete und in dem Antlitz des seltsamen kleinen Wesens, das er jetzt so nahe vor sich hatte, seine wahre Natur zu lesen suchte. Sobald die Wolle aber am Boden lag, bückte er sich danach, hob sie auf und legte sie still auf ihren alten Platz in den kleinen Korb auf dem Nähtisch zurück.
»Ich danke Ihnen,« sagte die alte Frau mit weniger bissiger Miene, »ich mache Ihnen viel zu schaffen. Aber das kommt davon, wenn man seinen gewohnten Kreis verläßt und die Gesellschaft einer alten Frau aufsucht, die nichts – nichts als ihre Einsamkeit, ihre innere Zufriedenheit und ihren – ihren stillen Kummer hat.«
»Sie nennen da drei Dinge in einem Atem,« erwiderte Bodo mit seinem sanftesten Stimmton, »die auch ich in meinem Besitz habe. Ich liebe auch die Einsamkeit, nach innerer Zufriedenheit trachte ich alle Tage und habe sie mir auch so ziemlich angeeignet, und – und –«
»Nun, warum sprechen Sie nicht weiter? Haben Sie vielleicht auch einen stillen Kummer?« unterbrach ihn Frau Birkenfeld, mit ihren flammenden Augen längere Zeit als vorher auf seinen Zügen weilend.
»Den hat jeder Mensch,« versetzte er, »und ich möchte den Menschen nicht Freund nennen, der nicht durch Kummer geprüft ist und dessen Herz nie die Siegesfreude kennen gelernt hat, ihn bewältigt zu haben.«
»So! Über was könnten Sie denn wohl Kummer empfinden? Doch ja, Sie sind jung, haben vielleicht viel geliebt und können – wenigstens einen Kummer schon kennen gelernt haben.«
»Welchen Kummer meinen Sie?« fragte Bodo ruhig, da er einen beißenden ironischen Zug um ihre Mundwinkel spielen zu sehen glaubte.
»Nun, den so viele Männer erleben, die sich in der großen Welt bewegen – den leidigen Geldkummer, wenn ihre Begierden größer sind, als der Vorrat in ihrem Beutel.«
Bodo lächelte zum ersten Male auf seine feine Weise. Sein blasses Gesicht überflog ein rosiger Strahl, der es noch schöner machte, als es an sich schon war. »Nein,« sagte er dann, »Sie irren darin bei mir. Obgleich ich in der großen Welt gelebt habe und darin leben mußte, so habe ich – den Geldkummer doch nie kennen gelernt, denn das Geld spielte bei mir nie eine so große Rolle, daß sein reicherer oder geringerer Besitz mich in irgend eine Unruhe versetzt hätte, und meine Begierden blieben stets in solchen Grenzen, daß sie mit dem Vorrat meines Beutels nichts zu schaffen hatten.«
Frau Birkenfeld rückte an ihrer Brille und sah den jungen Mann beinahe verwundert an. »Sprechen Sie da die Wahrheit?« fragte sie mit sichtlichem Unglauben in der Miene.
»Ich spreche sie immer, und ich würde mich jetzt einer unverzeihlichen Schuld teilhaftig machen, wenn ich vor einer Frau – Sie entschuldigen, daß ich Ihre Worte wiederhole – die mit einem Fuße im Grabe steht, Lügen vorbringen wollte, die sie nicht berühren, mich aber vor mir selbst erniedrigen müßten.«
Die alte Frau rückte nochmals an ihrer Brille, sann eine Weile nach, als wiederhole sie sich im Geiste die eben gehörten Worte, und nickte dann mit dem Kopfe. Nicht jene Worte des Sprechenden, wohl aber die Art und Weise, wie, und der Ton, mit dem er sie sprach, hatten sie getroffen. Es lag in dem ganzen Wesen ihres Besuchs der Ausdruck der Wahrheit, gemischt mit Achtung und einer wirklichen Teilnahme für sie selber, die sie nicht verkennen konnte, und sie verkannte sie auch wirklich nicht.
Das Gespräch schien jetzt ruhiger fließen zu wollen, als es Bodo wieder, – ob zufällig, ob absichtlich, mag dahingestellt sein, – in stürmischeren Lauf brachte, indem er plötzlich sagte:
»Sie fragten mich vorher, was ich von Ihnen wünschte, Frau Birkenfeld, oder warum ich zu Ihnen gekommen sei. Ich habe Ihnen einen Grund angegeben, und zwar den richtigen, – aber es gibt noch einen andern, den ich Ihnen jedoch nur nennen werde, wenn Sie es erlauben.«
Frau Birkenfeld blickte unangenehm verwundert auf, und ihre Augen nahmen wieder einen stechenden Ausdruck an. »Ich erlaube alles, was ich nicht verhindern kann!« sagte sie spitz.
»Dann werde ich natürlich schweigen!« lautete die mit mildester Gelassenheit gesprochene Antwort.
»Oho, so kommen Sie bei mir nicht durch, mein Herr. Jetzt müssen Sie reden, denn ich will den zweiten Grund Ihres Besuches hören.«
»Gut, so werde ich reden. Dieser zweite Grund liegt uns beiden sehr nahe und doch auch wieder recht fern.«
Frau Birkenfeld horchte hoch auf, und ihre Brust hob und senkte sich mächtig. Mit ihrem scharfen Geiste ahnte sie unzweifelhaft, was sie würde hören müssen, und doch war sie selbst schuld daran, daß sie ihm nun nicht mehr ausweichen konnte.
»Ich habe schon vorher gesagt,« fuhr Bodo fort, »daß mein Vater einst ein guter Freund Ihres verstorbenen Gatten gewesen. Ich wiederhole das jetzt, denn Sie wollen es ja hören. Ob Herr Birkenfeld als der Freund meines Vaters gestorben ist, weiß ich nicht, aber ich glaube es. So viel weiß ich aber bestimmt, daß mein Vater, als er starb, nicht mehr Ihr Freund war, und das – das, Frau Birkenfeld, tut mir leid.«
Die alte Frau fuhr in die Höhe, als habe sie eine Natter gestochen. Ihr runzliches Gesicht überzog plötzlich eine so bleifarbige Blässe, ihr Auge funkelte dabei so unheimlich durch die blaue Brille, und ihre Hände bebten so sichtbar, daß Bodo fast erschrak. »Woher wissen Sie das?« schnaubte sie ihn mit keuchendem Atem an.
»Das hat mir mein Vater in seinem letzten Schreiben mitgeteilt,« sagte er ruhig, »und er hat dabei den lebhaften Wunsch durchblicken lassen, daß es mir gelingen möge, die Schuld, die er vielleicht gegen Sie auf seinem Herzen gefühlt, zu sühnen. Und das, Frau Birkenfeld, ist der zweite Grund, der mich zu Ihnen geführt hat, und ich spreche jetzt – ehrlich und offen – die herzliche Bitte aus – nicht daß Sie meinem Vater verzeihen mögen, denn ich kenne ja sein Vergehen nicht – sondern daß Sie mir gestatten mögen, zu fühlen, in welcher gedrückten Lage ich mich Ihnen gegenüber befinde und Ihnen zu gestehen, daß es mir persönlich unendlich weh tut, nicht als der Sohn eines Mannes vor Ihnen erscheinen zu können, dessen Freund Sie bis an das Ende seiner Tage waren.«
Wenn Frau Birkenfeld bei den ersten Worten heftig auffahren wollte, so schmetterten sie die letzten förmlich nieder. Sie sank in sich zusammen, holte mit zitternden Händen ein Taschentuch hervor und hielt es vor die Augen. Sie weinte wirklich. Aber diese weiche Regung sollte bei der geistesstarken Frau nicht lange dauern. Sie faßte sich schnell wieder, aber nicht schnell genug, daß Bodo nicht während der Zeit hätte aufstehen, zu ihr herantreten und, indem er eine Hand auf ihren Arm legte, sagen können:
»Ich bitte für mich um Verzeihung, Frau Birkenfeld, daß ich Sie mit meinen Worten so peinlich berühre, aber nehmen Sie meine Handlungsweise auf als etwas, was sie wirklich ist: ich kann es nicht leicht verschmerzen, meinem Vater noch im Grabe einen Groll nachtragen zu sehen, den ein guter Wille und ein redliches Herz von seiten seines einzigen Sohnes vielleicht noch zu mildern imstande ist. Ich bitte inständigst, dringend – vergeben Sie mir das. Hätten Sie einen Sohn, der für Sie bei einem Dritten das täte, was ich jetzt bei Ihnen tue, Sie würden meine Handlungsweise verstehen, ja. Sie würden noch mehr tun, – Sie würden sie verzeihen.«
Frau Birkenfeld ermannte sich bei diesen Worten, sie hatten ihr Herz, wenigstens oberflächlich, berührt, und das war schon viel.
»Nein,« sagte sie, indem sie gleichsam mit irrem Blick rückwärts in sich hinein sah, »nein, ich habe keinen Sohn – das ist wahr – ich stehe allein, ganz allein, einsam und verlassen in der Welt. Aber Gott hat es so gewollt, und das ist mein Trost. Aber, daß Sie es verstehen, mich zu bewegen, wenigstens Ihnen zu verzeihen, das will ich Ihnen sagen – und da haben Sie es.«
»Ich danke Ihnen – für mich!« sagte Bodo, noch immer ihren Arm berührend. »Aber glücklich, viel glücklicher würde ich sein, wenn ich Ihnen auch – für meinen Vater danken könnte.«
»Still! Das verstehen Sie nicht. Ihr Vater hat mich nicht gekränkt, nicht beleidigt – nein, er hat mich – mich, das Weib – die Frau – die Gattin – mit Füßen getreten!«
»Wie?« rief Bodo fast erstarrt. »Das hätte mein Vater getan – hätte er tun können?«
»Ja, im Namen Gottes, ja – und nun schweigen wir davon!«
»Nein, Frau Birkenfeld, entschuldigen Sie, davon kann ich jetzt nicht mehr schweigen – die Beschuldigung wuchert zu schwer – auch auf mir! Darf ich denn nicht das Unrecht kennen, welches mein Vater gegen Sie begangen?«
Sie sah ihn mit flammenden Blicken an, als wollte sie durch seine leibliche Hülle hindurch in seine Seele dringen. »Nein,« sagte sie fest, »das dürfen Sie nicht – nie – nie und nimmermehr!«
Bodo senkte ergeben den Kopf. Die Miene, das Auge dieser Frau hatte ihn belehrt, daß er für jetzt nichts zu hoffen habe. »So schweige ich.« sagte er traurig und ernst, »aber ich schweige mit schwerem Herzen.«
»Das ist das Beste, was Sie tun können,« fuhr sie viel freundlicher fort. »O, kennten Sie mein Leben, Sie würden wissen, daß ich auch ein schweres Herz habe und damit in die Grube steigen werde.«
»Wenn es an mir läge, so wollte ich Gott weiß was darum geben, es leichter zu machen.«
»Ich glaube Ihnen, ich glaube Ihnen – doch lassen Sie uns von etwas anderem reden. Also Sie sind Legationsrat geworden?«
Bodo lächelte. Der Sprung war kühn und weit. »Ja, sagte er, »das bin ich geworden.«
»Und sind jetzt nach Sellhausen zurückgekehrt. Warum?«
»Um als stiller Mann mit aller Welt in Ruhe und Frieden zu leben, da Ruhe und Frieden da draußen nicht zu finden sind.«
»Ah!« fuhr sie auf. »Jetzt werden wir uns besser verstehen. Das war ein guter Gedanke. Den habe ich heute auch schon gehabt. Nein, da draußen gibt es keine Ruhe und keinen Frieden. Aber wie sind Sie zu dieser richtigen Einsicht schon in so jungen Jahren gekommen?«
»Durch eine klare Anschauung alles Bestehenden, durch Hang nach Ruhe und Frieden selbst und durch den Wunsch, mein eigenes Leben zeitig vor den Stürmen zu bewahren, die so manches Herz zerfleischen und zerwühlen, ehe sich eine helfende Hand findet, die es rettet.«
»Sie scheinen frühzeitig gute und richtige Erfahrungen gemacht zu haben?«
»Ich bin dazu bestimmt gewesen, frühzeitig auch traurige Erfahrungen zu machen – doch, die werden ja fast keinem Menschen erspart.«
»So. Nun, hören Sie, ich möchte wohl, da wir doch ins Plaudern gekommen sind, von Ihren Erfahrungen – selbst aus frühster Jugend – etwas Näheres hören. – Haben Sie Zeit und Lust, mir zu erzählen, wie Sie – groß geworden sind?«
»Warum nicht? Gern. Aber das ist keine angenehme Geschichte.«
»O, das braucht sie auch nicht zu sein. Wessen Menschen Geschichte ist überhaupt heutzutage angenehm? Selbst Fürsten und Könige wissen davon ein Lied zu singen. Also erzählen Sie. Sie sind auf Sellhausen geboren, nicht wahr?«
Bodo setzte sich wieder ruhig auf seinen Stuhl, tat einen kurzen Blick in sein Inneres und fing dann folgendermaßen zu sprechen an.
![]()