
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
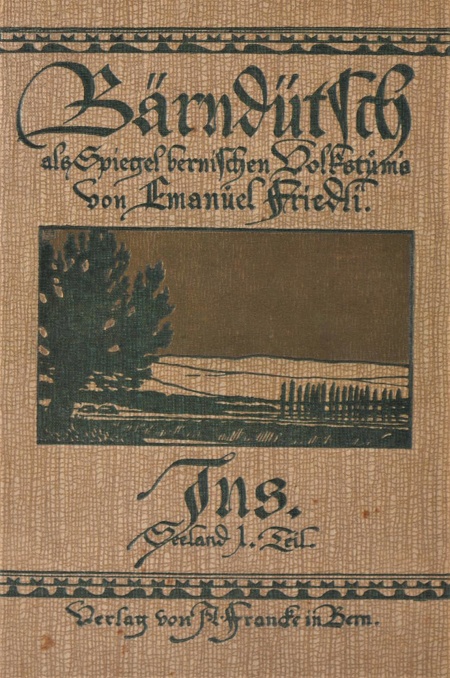
von
Mit 171 Illustrationen im Text und 10 Einschaltbildern nach Originalen von A. Anker, R. Münger, W. Gorgé, F. Brand, sowie nach photographischen Original-Aufnahmen von Dr. E. Hegg, Dr Ed. Blank und anderen, einer Karte und zwei geologischen Profilen.
Herausgegeben mit Unterstützung der Regierung des Kantons Bern
Bern - Verlag von A. Francke (vorm. Schmid & Francke) - 1914
[Die Links innerhalb des Werkes auf Seitenzahlen o.Ä. können in dieser Online-Version nicht genutzt werden. Wir arbeiten an einer Verbesserung. Re. für Gutenberg]
Diesen Band widmen
der hohen philosophischen Fakultät der Hochschule Bern
zum Dank für die verliehene Doktorwürde
Verfasser und Verleger:
Dr. phil. h. c. Emanuel Friedli
Dr. phil. h. c. Alexander Francke
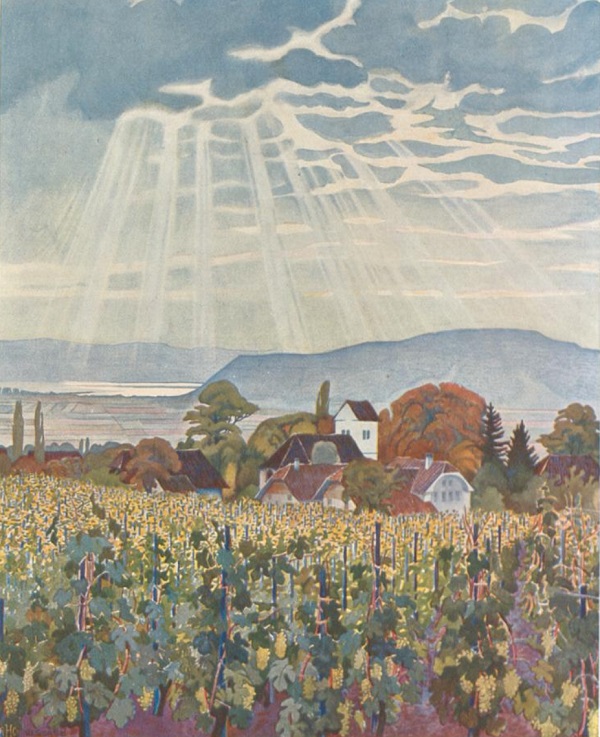
Gemalt von W. Gorgé
Ins, Moos, Wistenlacherberg, Murtensee
Standpunkt unterhalb des Galgenhubels