
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
 hni
Anker e̥s Eiß — das weer wi ohni Wịị
n es Seeland, wi ohni Bụụre
nhoof es Bernerland, wi ohni Beergen e
n Schwịz.
hni
Anker e̥s Eiß — das weer wi ohni Wịị
n es Seeland, wi ohni Bụụre
nhoof es Bernerland, wi ohni Beergen e
n Schwịz.
Aber weel che r n Anker isch g’mäint? Es gi bt män’gen Anker! Scho n z’Eiß gegewertig ihre r 87 i n 19 Hushaltige n. Z’Lü̦sche̥rz sị n ’ren ŏ́ ch n es baar (einige), un d im Wadtland oo ch. Mḁ n 1 säit, das G’schlächt sịg öppḁ vor drụ̈hundert Jahr us Dütschland choo̥ n, un d döörthi n us Schweden u nd Norwege n. Nu n, i n Schwede n läbt ämmel gäng no ch der Radierer Nils Elias Ankers (geb. 1858). 2 I n Norwege n het der Genremaler Peter Bernard Anker (1825-1856) Szenen us dem Volkslebe n g’ma̦a̦le n; der Joh. Casp. Herman Wedel Anker (1845-1895) u nd d’Annete Anker häi n Landschafte n hin͜derla̦a̦ n. 3 Der Hermanus Franciscus van den Anker (1823-1883) isch i n Rotterdam gebore n; 4 der Johann Baptist Anker isch en östri̦i̦chische r Miniaturmaler, 5 und der Mäister vom Anker en alte r dụ̈tsche r Stächer. 6 Nebe n dene n Künstler het en Admiral Anker us Norwege n ’gläbt. A lsó cha nn mạ n begrị̆ffe n, daß das G’schlächt i n Schwede n hoffähig isch.
358 Dḁrneebe n wirt es im Norden ụsse n Schifflụ̈t g’gee n haa n, wi im Dụ̈tsche n u nd wi z’Zürich, wo der Anker, sogar der gu̦ldig, häi n zum Wa̦a̦pe n g’haa n un d im «Anker» z’seeme nchoo̥ n sịị n wi d’Müller im «Mü̦hllirad» u nd d’Pfister im «Wegge n» u nd d’Metzger im «Wi̦d der» u nd d’Fischer im «Salme n». Nid vergeebe ns gi bt es o ch Anker i n däm Schiffer- u nd Fischerdorf Lü̦sche̥rz; u nd täil (einige) wäi n haa n, di erste n Anker z’Eiß häigi d’s schi̦ffle n zum B’rueff ’tri̦ịbe n, we nn albḁ der Mu̦u̦rte nsee̥ bis zu der Eißer Rịịff ( S. 77) g’reckt häig.
Üụ̈se r Ma̦ler Anker het richtig (allerdings) es anders Familie nwa̦a̦pe n; aber der «Hydriot», wi ’nḁ der Wilhelm Müller so begeisteret darstellt, isch ihm doch im Bluet ’bli̦i̦be n. Als Gymnasianer het er daas z’Neue nburg Triftig g’nue g g’haa n z’bewịịse n. Da̦ isch är mit sịne n Kamerate n i n de n zeeche nminütige n Summerp’hạuse n g’schwin͜d, g’schwin͜d ga̦ n baade n u nd öppḁ für Gspaß un͜der e-mene n groo̥ße n Schiff düüra g’schwumme n. De nn häi n si e wi n e n Wink ihrer Hoosen u nd Schueh u nd das länge n Blụụsli mit dem Gurt, wo o ch grad d’s Hemm dli ersetzt het, ummḁ n aa ng’läit u nd sị n wi di fịịnsten Ängländersühnli uf dem Schuelbank g’hocket. Drum het er du̦ o ch «badende Kinder» i n allne n Lagen u nd Stellunge n so lustig chönne n ma̦a̦le n. Aber was het er erst als Gymnasianer u nd Studänt z’Bern fü̦ü̦r g’noo̥ n? Da̦ het äär d’Sịggaare n mit dem brönnigen Oo̥rt i n d’s Mụụl g’noo̥ n u nd isch ḁ lsó i n d’Aar g’sprunge n; de nn isch er g’müetlich uf dem Rügge n g’schwumme n u nd het wịter g’rạukt, 7 ohni (den Atem mühsam) ịị nz’zieh n u nd Wasser us dem Schlu̦ck ụụsḁ z’pumpe n u nd z’schlottere n. E n söttige n häi n si sälbma̦a̦l richtig guet chönne n brụụche n, für am Platz vom chrankne n Schwümmlehrer Stun͜de n z’gee n.
A lsó häi n’s v’li̦cht sịner Vorelteren o ch g’haa n. Göb der Willi Ancker (1656; im gleichen Jahr erscheint ein «Hans Ankherr»), der Hans Immer Anker (1809), der Hufschmied Matthias Anker (1819), der Gabriel Anker (1857), der M éyer Anker zu dene n g’höre n chönne n me̥r richtig nid wüsse n. Verwandt sịn ihm di Schmi̦i̦den Anker, wie z. B. der Mathias (1836). Der erst bekannt Vorfahrer vom Maler het e n chläi n als e n Liechte r g’gulte n; vil licht nụmmḁ n, wil er het Müej g’haa n, sị ns neu g’chạuft Häi m im Dorf z’Eiß i n de n Hän͜d z’bhalte n. Aber sị n Suhn u nd sị n Groo̥ßsuhn häi n sich zu haabliche n Bụụren ụụfg’schwunge n, u nd dür ch guet Hụ̈ra̦a̦te n het d’s Vermöge n vom Familie nkräis g’mee̥hret. Scho n um 1804 g’seh n mer der Rudolf Anker de n Lụ̈t mit ertlee̥hntem Gält ụụshälffe n. 8 Dem Ma̦ler 359 sị n Vater het vill für d’Schuel ta̦a̦ n, u nd dem Ma̦ler sälber isch es, wo n äär sị ns Erb aa n’trätte n het, sị ns Ee̥rste n gsi̦i̦ n, bedrängtne n Bụ̈ụ̈rneli ihrer Schuldschịịne z’verbrönne n.
E n doppleti Schwägerschaft mit de n Probst von Eiß, u nd bsun͜ders du̦ mit dem rịịche n Dokter Gatschet z’Erlḁch, ó ch von Eiß, het dem Familie nkräis vom Anker abaartig wohl ta̦a̦ n. O ch für d’Aa nseeche̥lĭ̦gĭ̦ (Ansehnlichkeit). Dem David Gatschet sị n Frạu isch d’Tochter gsịị n vom Schulthäiß Bönzli un d isch als Mäitli d’s schönste n gsịi̦ n, wo z’Erlḁch zu der Chi̦lchsdüür ịị n un d ụụs isch. 9 (Däm na̦a̦ ch müeße n si e denn doört rächt flị̆ßig z’Bredig ’gange n sịị n. Un͜der Sächsne n d’s Schönste n sịị n isch no ch käi n Chunst.) Es isch d’Elisabeth Salome g’sịị n. Salome het si ihrem Götti z’lieb g’häiße n, dem Schaffner Lentulus; uf ihrem Grab häißt si Elisabeth.
Aber d’Sunnsịte n het richtig o ch da̦ ĭhri Schattsịte n g’haa n. E n Vorfahrer vom Ma̦ler het zur zwäüte n Frạu e n Träitnere n g’haa n, wo ’nen äinisch, wo n er e n chläi n spa̦a̦t isch häi m choo̥ n, het d’Steegen ab g’heit, das s er het d’Achslen ụụsg’macht. Wo n ihm si e der Doktor Gatschet umma het ịị nzooge n g’haa n, het er zue n ihm g’säit: O du arme r n Ankerruedi, du chaa nnsch ó ch rüeffe n:
Ach, lieber Herr, ich klag’ es dir:
Ein böses Weib hast ’geben mir.
Nimm ’s Weib zu dir und ’s Kreuz von mir
Und schenk ein ander Weib du mir.
10
Item, d’Stammlinie n vom Ma̦ler g’seh n mer scho n vor hundertzeeche n Ja̦hr o ch uf der gäistige n Höo̥chi. Sịner Vorfahre n bis u nd mit dem Vatter häi n ’bụụret u nd ’dokteret als g’schickti u nd wịt u nd bbräit b’rüehmti Vehdökter, u nd de̥m Ma̦ler sị n Groo̥svatter no ch dḁrzue als Mönsche ndokter. Wo d’Bla̦a̦tere n g’regiert häi n u nd vill Lụ̈t bla̦a̦tere ndü̦pflet (pockennarbig) ummḁ g’lüffe n (oder g’loffe n) sịị n, het är g’impft; u nd mit Hülf vom Jakob Gatschet, dem Groo̥ßu̦nggle n vom Ma̦ler, het er dür ch de n Chäiserschnitt es arm’s Fraueli vo n Geese̥ rz vor dem Tod errettet. Di e beide n häi n du̦ dem Saniteetsra̦a̦t z’Bern ihri Kunst müeße n vormache n, u nd häi n en iedere n feuf Dublonen überchoo̥ n. 11
Drei abaarti g’schickt Feeger sị n dem Maler sị n Vatter u nd däm sịner zwöo̥ Brüeder gsi̦i̦ n. Der Matthias (1788-1863, s. S. 345) oder guet eißerisch Matthịịs, wi n eer ĭhm (sich) sälber g’säit het, isch 1816 bis 1831 Lehrer, 1831 bis 1862 usserordentliche r u nd bis zu sim Tod 360 orde ntliche r Profässo̥r a n der Tierarzneischuel z’Bern gsi̦i̦ n. 12 Scho n wo n er als Tierarzneischüeler 13 z’eerst z’Leuzige n bi’m Cheiser (Keyser, 1808-1810), u nd du̦ z’Bern g’lee̥hrt het, het er (1811) mit an͜derne n Seeländer: dem Gabriel Simme n von Erlḁch, dem David Stauffer vo n Signau, uf dem alte n Jennerguet z’Gamplen aa ng’sässe n, aber als Vehdokter z’Neue nburg täätig, und dem Bendicht Strauchen (Strụụche n) von Ipsḁ ch, si ch fü̦rḁg’stellt als «ausgezeichnetes Subjekt». 14 Mḁ n het ihm u nd sị m künftige n Kol leeg Schild «lobenswürdige Sitten und Wandel» na̦a̦chḁg’rüehmt; dḁrzue dem Anker «sehr glückliche Geistesanlagen» un d de̥m Schild «unermüdlichen Fleiß». Drum sị n An no̥ Zwölfi di bee̥de n, en iedere r mit 400 altne n Franke n, nach Berlin u nd Wien, u nd dụ noch mit (je) 1200 Franke n durch Böhmen u nd Mähre n g’schickt worte n, für aller Gattig Vịhzuchtanstalte n z’studiere n.
Na̦ ch’m glücklichen Exame n z’Bern isch du̦ der Matthias Anker es Zịte̥lli uf Eiß zu sịm Brueder Samuel ( S. 362), ihm ga̦ n hälffe n doktere n un d öppḁ n äinisch o ch n e n chläi n lustig sịị n. Si e sị n albe n (Tschugg: albe̥z) i’ n Beere n (Gasthof zum Bären). Ihre n Vatter het das ungern g’see̥h n. Är isch versteckter Wịịs dü̦r ch d’s Hụsgang oder dü̦r d’Matte n vo n der Beere nschụ̈ụ̈r u nd het de nn, wenn er öpper aa ntroffe n het, g’fra̦gt: Sị n ü̦ser Hee̥r re n nid da̦a̦? 15
Der Beruefseernst vom Matthịịs isch dụ no ch früej g’nue g aa ngange n! Als Lehrer 16 un d Vorsteher vo n der Veterinärschuel u nd vo n der Hufbeschlagsanstalt hed eer die jungi Anstalt rächt äigetlich uf d’Füeß g’stellt u nd d’Chatz dü̦r de n Bach g’schläikt. Är het g’macht, das s mḁ n zweu Ja̦hr het müeße lee̥hre n, wenn scho n d’Zürcher d’Schüeler darmit häi n zụụcha g’löökt u nd zöökt, daß si̦i̦ n si̦ e na̦ ch äi’m Ja̦hr ’padändiert häi n. Sịner Obere n (die Kuratel) häin ihm dḁrbịị no ch gäng der Schläipfdroo̥g un͜derḁ g’läit, un d är het mit ĭhrer Lamaaschigi (-mắ-) vi̦ll Vertruß g’haa n. Aber är het dü̦ü̦rḁg’hạue n mit sị’m Rueff als «hervorragender Kliniker und Lehrer von großem praktischen 361 Geschick». Är het i n Schrift und Reed mächtig g’chämpft für verbessereti Tierzucht u nd gege n d’Vehsụ̈ụ̈che n. Drum het ’nḁ n o ch di G’sellschaft vo n de n schwịzerische n Tierärzt mit der silberverguldete n Medalje n g’ee̥hrt u nd ’nḁ zu ihrem Presidänt g’macht. 17

|
|
Maler Anker, 50jährig |
U nd was het er für das alles überchoo̥ n? Zwölfhundert (alti) Fränkli im Ja̦hr bi 21 Stun͜d i n der Wuche n. Na̦a̦chḁ ta̦a̦ n häi n si n ĭhm nụ̈ụ̈t. 18 Mit däm Gält het är als Maa n vo n der Elisabeth Leue nberger vo n Dür re nroth (kopuliert 1816, † 1837) u nd du als e n Wi̦ttlig sịner nụ̈ụ̈n Chin͜d dü̦rḁ’brḁḁcht, vo n dene n der jüngst Suhn, Matthias, 1856 26jehrig g’stoorbben isch. U nd dḁrzue het er no ch i’n äigete n Sack g’reckt für überụụs nöo̥tig Bauten am Tierspital, wo gäng niemmer het welle n mache n. A lsó het’s nid chönne n fehlle n, das s nḁn e n längi, schwee̥ri Chrankhäit het ụụfg’ri̦i̦be n, bis das s er an ere n Lungene ntzündung g’stoorbben isch.
Der jünger Brueder vom Profässer Matthias, der Johann Ruedolf (1804-1879), isch bis zum Tod vo n sị’r erste n Frạu Dokter (Arzt) gsi̦i̦ n i n der G’mäin Erlach, wo n ihm us Dankbarkäit d’s Burgerrächt g’schänkt het, u nd du̦ sịt An no̥ 1847 z’Samm Pleesi (Saint Blaise). 19 Aber är isch im ganze n «Kanton» Neue nburg berüehmt g’sịị n, u nd si e häi n ’nḁ zu de n fürnähmste n Familie n g’rüeft. Das het richtig öppis welle n seege n zu dér Zit, wo (bis 1857) Neue nburg no ch isch prụ̈ụ̈ßisch g’si̦i̦ n. Aber ’prụ̈ụ̈ßelet het’s glịịch (gleichwohl) nụ̈ụ̈d bịị n ĭhm. Geege n de n Höo̥chere n het er si ch fürnähm benoo̥ n u nd gege n di e Arme n nobel: är het dene n «käi n Sắntinen» abg’noo̥ n. Är het e n herrlichi zwäüti Frạu us Samm Pleesi g’haa n; die̥ het sich o ch ụ̈serem Ma̦ler müeterlich aag’noo̥ n, b’sun͜ders wo n er z’Halle g’studiert het 362 (s. u.) u nd het di e schönste n Brieffe n, wo n es cha nn gee n, mit ĭhm ụụstụụschet. Uf si’m Grab z’Samm Pleesi het ihm d’G’mäin e̥s Dänkma̦l g’setzt. Ruodolfs äinzige r Suhn, der Adolf, isch e n berüehmte r Chirurg worte n. Är het z’Fleurier ’praktiziert; aber mḁ n het ’nḁ bis uf Lŏ́sane u nd Gämf la̦ n choo̥ n.
Vo n Adolfs schaarffem Blick het mḁn es Bịịspi̦i̦l us Eiß. Alli Wält g’chennt das ergrị̆ffende Bild vo n ụ̈se rm Anker: die todte Freundin. 20 Das drịzeche-jehrig Mäite̥lli (Margarita Stucki, Schwester vom Spitalschaffner z’Eiß), wo wi n es Ängeli i n sị’m schneewị̆ße n Toote nchläid hin͜der dem offenen Umhang lịggt u nd vo n sịne n Frü̦ndinne n u nd chlịịne n Kamerate n betrụụret wirt, het g’hu̦lffe n Grüens z’seeme nsueche n, für am Exame n d’s Schuelhuus z’bekränze n. Uf der Suechi isch es dü̦r ’ne n Haag g’schloffe n un d a’ n Boode n g’falle n. Im umfalle n schla̦a̦t es di linggi Han͜d uf ene n Stumpe n vo n neme n (Schilf-) Röhrli, wo du̦ bi neme n Gläich (Knoten) i n der Hand abbrochchen isch. Der dennzumalig Dokter z’Eiß het nü̦ü̦t chönne n finde n. Du̦ rüeft mḁn i n der grööste Noot — das arm Chin͜d het förchterlich ’glitte n — no ch der Adolf, wo grad bi sị’m Vetter, dem Ma̦ler, isch z’Wisite g’si̦i̦ n. Dee r säit: spräit dị n Han͜d ụụs u nd häb si’ gege n d’s Liecht! En Auge nblick, u nd d’s Röhrli het dür ch n es Hi̦ckli, wo der Dokter am Handrügge n g’macht het, chönne n ụụsazooge n weerte n. Aber z’spa̦a̦t: d’Bluetvergiftig isch scho n im ganze n Lịịb inne n gsi̦ị n.
Der dritt Brueder vom Matthias u nd vom Ruedolf isch der Samuel (1790-1860) gsi̦i̦ n. Deer het dem Eißer Dokte̥r Gatschet sị n Tochter Mariannḁ g’hü̦ra̦a̦tet un d im väterliche n Hụụs ’bụụret u nd g’vehdokteret. Zite nwịịs het er o ch de n chrankne n Lụ̈t g’hulffe n, wi mḁn us Rächnige n für Rüstig (Brech- und Laxiermittel, Ptisanen u. dgl.) g’see̥ht. Aber sị ns rächt Biet isch doch d’Vehdokterei g’si̦i̦ n, u nd da̦a̦ drinn het er si ch sogar berüehmt g’macht. Är het 1824 mit Hülf vo n der akademische n Kuratel es Buech lḁ n drucke n: Praktische Anleitung zur Heilung des Überwurfs oder Bauchfellbruches des Ochsen. Söttig Chnopfoperatione n, wo mḁ n dḁrbịị d’Ii ng’wäid het müeßen in e n Wannen ụụsḁ neh n, hed äär für acht Fränkli es baar g’macht. 21 Dḁrbịị isch är e n Maa n g’si̦i̦ n vo n vill Mueterwitz. Für das s ihm d’Lụ̈t folgi un d nit welli di G’schịịdere n sịị n, het er ’ne n d’Mittel mit aller Gattig g’spässige n Aa nwiisunge n g’gee n. Öppḁ: Soo̥! nehmet iez da̦a̦ di Rüstig, u nd geebet der Chueh exakt z’Mittaag äm zwölfi un d ummḁ n, wenn de̥r Fụ̈ra̦a̦be nd häit; aber den n müeßt er dḁrbii i’ n Stu̦u̦d vo n der Stallsdü̦ü̦r obe n lingger Han͜d es Loch boo̥hre n u nd de nn mit e̥me n Zapfe n 363 vermache n! Häit er’s g’chöört? — Es Fraueli vo n Lüsche̥rz isch cho n chlaage n wege n ’mene n Chalb. Är het es bar Wort g’lost u nd du̦ g’säit: Das Chalbli isch a n der Milch verdeerbt worte n! «Das cha nn nit sịị n!» Jää, mier wäi n luege n! Häit de̥r ihm nid halb Wasser i n d’Milch ta̦a̦ n! «Wohl.» He nu, han i ch n e̥ch’s nid g’säit, das Chalbli sịg a n der Milch verdeerbt? — E n fü̦rnehmmi Damen us Neue nburg het ihm es Hün͜dli ’bra̦a̦cht: das Tierli well nụ̈ụ̈d meh frässe n; es nehm nid e nma̦a̦l mee̥h Brootis. Käi n Dokter i n der ganze n Stadt chönn öppis dḁrggege n mache n. Guet, ụ̈ụ̈se r n Anker nimmt das Hündli, tuet’s un͜der n en umg’chehrti Bụ̈tti u nd het ihm nụ̈ụ̈d ’gee n z’frässe n, bis das s es ihm het roui Rüeben us der Han͜d g’noo̥ n. Du macht er der Frau B’schäid: d’s Hün͜dli sig g’kuriert; si chönn’s ummḁ cho n räiche n. Die chunnt mit der zwäüspännige n Gutsche n u nd het mit groo̥ßer Fräüd dem Dokto̥r, ohni daß dee r’s g’häüsche n het, e n schöo̥ni Summ Gält i n d’Han͜d ’drückt.
Bi all der Witzigi u nd si’m Bitze̥lli Rụ̈ụ̈chi (s. u.) isch er e n Maa n g’si̦i̦ n vo n ’mene n Charakter, das s mḁ n ’nḁ dü̦ü̦re̥wägg g’schetzt het. D’Eißer häi n ’nḁ 1831 i n d’s Amtsg’richt ta̦a̦ n. Vier Ja̦hr drụụf het ’nḁ di prụ̈ụ̈ßischi Regierig zum neue nburgische n Kantonstierarzt g’macht. Das isch er ’bli̦i̦be n bis 1852, wo n er ummḁ sị n Poste n z’Eiß ịị ng’noo̥ n het. Aber g’stoorbben isch er na̦ ch n ere n länge Chrebschrankhäit bi si’m Brueder z’Bern, 22 bi däm o ch sịner zwöo̥ Sühn als Studänten (s. u.) es fründlichs Häi m g’fun͜de n häi n. Der elter vo n dene Sühn, der Ruedolf, wege n sị’r usseroordetliche n Begabung vo n sịne n Lehrer ganz abaartig höo̥ch g’schetzt, het läider a n der galoppierende n Schwindsucht früech müeße steerbbe n.
Dä r jünger isch eben ụ̈ụ̈se r berüehmt Ma̦ler: der Samuel Albrecht Anker (1. April 1831-1910, Juli 16.). 23 Im Verchehr mit de n Wältsche n het er begrị̆fflich Albert (Albert, Albär) g’häiße n.
D’Mueter isch ihm scho n An no̥ 1848 g’stoorbbe n. Aber d’Baase n, d. i. d’s Vaters Schwester, d’s Anna Marei († 31. Mai 1873), isch mit großer Liebi dem Hushalt vorg’stan͜de un d isch ganz b’sun͜ders a n däm jungen Albrächtli g’hanget. U nd dää r het das Beesi, oder wi n er du vom Wältschen ụụs e̥re n g’säit het: «Die Beesi», 24 o ch gar chäibisch 25 geern g’haa n. Es isch o ch n es P’hersööne̥lli dḁrna̦a̦ ch g’si̦i̦ n! Als chlịị ns Chin͜d het mḁ n si wüest la̦ n g’heie n g’haa n u nd niemmerem nụ̈ụ̈d g’säit. Du̦ isch si uf daas chrumm worte n u nd het nid anders chönne n, weder der Chopf uf d’Sịte n helte n. Un d ḁ l’só heltig het ma n si de nn 364 g’see̥h n mit dem Rịdi̦ggụ̈l ( ridicule aus réticule, ursprünglich svw. Netz- Seckli) gḁ n Ku̦missione n mache n gar grụ̈ụ̈slich eer nstig un d exakt, u nd dḁrbịị so frein (friedlich) u nd g’mäin (leutselig). Aber g’see̥h n het niemmer, wi si lang un d ịi̦frig u nd starch bättet het u nd sich uf de n Tod vorberäitet. De nn ummḁ, wenn vom Anker us Paris es Brieffli choo̥ n isch «An Anker Beesi in meinem Haus Ins», de nn het’s us dene n liebe n, g’schịịden Auge n no ch äinisch so fründlig u nd verklärt g’lụ̈ụ̈chtet.
Sị n jungi Schwester Lụ̆ịịs het er o ch früech müeße n verlụ̈ụ̈re n. Dḁrfü̦ü̦r isch du spööter (1864) dere n’s Fründi, Anna Rüefli vo n Längnau, i n Biel, si n Frạu worte n u nd d’Mueter vo n dreine n Töchtere n u nd dreine n Sühn.
* * *
Aber zwöo̥ vo n dene n Sühn häi n als chlịịni, zarti Buebe̥lli dem Vatter ’zäigt, wo n es de nn i n sị’m achtzigste n Ja̦r mit ihm sälber hi n gang, Vo n däm wäi n me̥r iez grad da̦a̦ churz rede n, für der Rahme n linggs u nd rächts vo n däm herrlich ụụsg’chạufte n Leebe n darz’tue n.
Eben e n söttigen Ụụschạuf vo n der chostbare n Zịt isch di e rächti Vorbereitig uf de n Tod g’si̦i̦ n, so das s är het chönne n seege n: Mị n Habersack isch p’hackt, i ch warte n nụmmḁn uf d’s Komando. Das het o ch bi̦ n ihm us zwöo̥ne n Däile n bestan͜de n. Der erst: der Ankündigungsbefehl, isch zeeche n Ja̦hr vorụụs choo̥ n i n Form vo n mene n langsame n Hirnschlag. An no̥ 1901 het er di letschti vo n sine n Töchtere n e̥-mene n Gänfer Dokto̥r u nd dḁrmit us dem Hụụs g’gee n. Un d grad am Taag vor dem Hochzịt verbrönne n du z’mitts im Na̦ chmi tdaag (um halbi drụ̈ụ̈) di drụ̈ụ̈ schöone n Strauhụ̈ụ̈ser gradübere n vo n si’m Hụụs. Da̦ het er ’grännet wi n es Chin͜d u nd g’säit: Jez bru̦u̦cht niemmer meh uf Eiß z’choo̥ n, iez isch nụ̈ụ̈d mĕh schööns! D’s Läid u nd der Chlu̦pf häi n ’nḁ mööge n. Di rächti Sịten isch g’lehmt choo̥ n, u nd der ganz Lịịb wi tood; är het die gar nụ̈ụ̈d meh chönne n verrüehre n. Aber na̦a̦ ch di na̦a̦ ch (na̦a̦ ch t na̦a̦ ch) isch ummḁ Leebe n dri n g’ströömt, un d är het chönne n z’versta̦a̦ n gee n, si söllen ihm vom Beethove n, wo n är so gern g’ha n het, d’Moonschịịnsonate n spịịle n. Das het ihm guet ta̦a̦ n; a lsó guet, das s er blötzlig het chönne n seege n: iez wil l i ch o ch grad e n patience mache n!
So isch er ummḁ e n chläi n z’weeg choo̥ n, das s er ämmel mit der lingge n Han͜d het chönne n schrịịbe n u nd zäichne n u nd ma̦le n. Das het dä r dịfig Maa n so flingg z’weeg bra̦a̦cht, daß die, wo nụ̈ụ̈d vo n der Sach g’wüßt häi n, häi n g’mäint, är schaffi wi gäng i n rächt (mit der rechten Hand).
365 U nd nid gar lang isch es ’gange n, isch alls i der Or dnig gsi̦i̦ n. Är isch umma z’weeg choo̥ n u nd bu̦sper g’si̦i̦ n wi n e n Junge n. Käi n Chrankhäit het an ĭhm ’zehrt. No ch drei Tag vor dem Tod het er g’ma̦a̦le n. Aber das s d’Altersg’nosse n dünne n (seltener werden), daß d’s Alter mit Schwachhäit chunnt, isch er doch inne worte n. U nd das s «chalti» Schleeg de n «warme n» rüeffe n, het er o ch g’wüßt. Wo mḁ n nḁ g’fragt het, wi n es dem Pfar rer Revel z’Neue nstadt gangi, het er g’antwortet: Il attend sa seconde attaque. Er het g’merkt, wi e n es z’Änd rückt, u nd si ch drịị n ergee n. Är het bloß g’wünscht: wen n es nu̦mmḁ n nid so lang mit mer macht!
U nd d’s g’läitig Änd isch choo̥ n. Nḁ ch n e̥re n Nacht, wo n er o ch weeni g g’schla̦a̦ffe n u nd mit sịne n gäng no ch gueten Auge n vill g’leese n het — in e̥ren abaartige n Stu̦u̦be n, für niemmere n z’stööre n — chunnt er nid zum z’Morge n, wi süst. D’Frạu gäit ga̦ n luege n: da̦ li̦ggt er leblos vor der Tü̦ü̦r, Är isch grad drann gsi̦i̦ n, sich aa nz’legge n.
Was das a n däm 19. Häümonḁt 1910 für ’ne n Lịịch g’gee n het mit Trụụrmarsch u nd G’säng u nd Rede n, chönnen o ch die dänke n, wo nụ̈ụ̈d drüber g’leese n häi n.
Uf dem Grab im Chloos ( S. 296) het ihm sị n Familien es fürnehms Dänkma̦l us g’schliffnem Granit la̦ n setze n. Un͜der däm guete n Chopfbild us Brongße n (der Frey z’Basel het ’s g’macht) stäit de r Spruch (Hiob 5, 26): Du wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Garben eingeführt werden zu seiner Zeit.
1
Wir bringen in diesem Abschnitt «mḁ
n» (alt-erlachisch: mḁ-r) als proklitisch und enklitisch gleichlautende Partikel. Sonst heißt «man» proklitisch auch hier mĭ̦.
2
Thième und Becker.
3
Ebd. 529.
4
Ebd.
5
Ebd.
6
Nagler (München 1835) 1, 132.
7
Rytz 7.
8
Kal. Ank.
9
Kal. Ank.
10
Ebd.
11
Ebd
12
Als 1805 die Akademie Bern reorganisiert wurde, erhielt sie auch einen Lehrstuhl der «Vieharzneywissenschaft», und zwar innerhalb des Verbandes der medizinischen Fakultät. 1868 wurde die Veterinärwissenschaft von dieser abgetrennt und eine unter eigenem Gesetz stehende Tierarzneischule errichtet. An ihren Platz trat 1900 die eigene veterinär-medizinische Fakultät der Berner Hochschule, die erste ihrer Art. Vgl. Theodor Oskar
Rubeli (von Tschugg:
S. 344): Die tierärztliche Lehranstalt Bern (Bern, Haller, 1906) mit Matthias Ankers Bild (von Maler Anker) auf S. 49, auf unserer
S. 345 wiedergegeben). Ferner:
BB. 2, 317-320;
Taschb. 1867, 423.
13
Studienkosten: Rubeli 40.
14
Rubeli 44. 46. 47.
15
Kal. Ank.
16
Für spezielle Pathologie (besonders Seuchenlehre) und Therapie, Chirurgie, Tierarznei, Diätetik und Arzneimittellehre.
17
Als solcher hielt er die großen Reden zu Luzern 1829 und zu Solothurn 1831: Rubeli 265-271 und 271-274.
18
Rubeli 156.
19
Quart. 3, 103.
20
MB.
21
LBI. 138.
22
Taschb. 1865, 217.
23
Vgl. die Biographie von Rytz (Bern, 1911), 5 ff.
24
la chère petite tante.
25
Beides klingt nicht etwa roh.
Täil vo n sine n Familie ngli̦i̦der häi n ị̆hri Summerwohnig im Ankerhụụs un d im Stock dḁrneebe n. Döört isch es de nn richtig, we nn d’Bahn vo n Biel uf Eiß vorbịị fahrt, ni̦mme̥h r so rüeijig. Aber ländlich häimelig g’seht’s i n der Umgeebung vo n däm mächtige n Bụụre nhuus am Aa nfang vo n der Möntschemiergasse n notti ụụs, wen n scho n nid uf di glịịchligi Wịịs wie früecher. (S. Bild S. 5.) Wo dem Ma̦ler sị n Vatter döört het Hụụs-g’haa n, sị n alben e n ganzi Zịlete n Lạube nneege̥lli (Hängenelken) über d’Schaueli (Scheieli) vom Garte nzụụ n ụụs g’hanget; u nd wenn di e Reisende n uf der Post vo n Bern uf Neue nburg (s. «Twann») im «Beere n» uf d’s wächsle n vo n de n Roß g’wartet häi n, sị n si e de nn di berüehmte n Bernerblueme n ga̦ n aa nluege n. Der Dokto̥r (hier also der Vieharzt) het ’ne n de nn mit sị’r ganze n Liebe nswürdigkäit dere n duftige n G’schänkli g’offeriert. Anno̥ 1815 o ch de n Hofdame n vom Prụ̈ụ̈ße nchü̦nig, wo dää r i n sị ns Neue nburg g’räiset isch. 1 Hü̦t stan͜den iez dḁrfü̦r 366 großi Chü̦belpflanze n i n Räih u nd Gli̦i̦d uf der B’schụ̈̆si, un d e n sụụfere r Zuegaug vo n Trŏdwargrien (Trottoirkies) füehrt am Garte n vorbịị, wo Passionsblueme n über de n Haag ụụs recke n.
Jez, wer albe n zum Anker het welle n, oder mier wäi n lieber seege n: wer zum Ma̦ler het döörffe n, isch z’erst dü̦r ch ’ne n Steege n vo n g’wöhnlicher Bräiti zu n ere n Spịịcherdü̦ü̦r choo̥ n. Dḁrna̦ ch isch es dü̦r n es schmals, stu̦tzigs Steegli, wo si̦t Ankers Schlagaa nfall het es grobs Säili als Lehnen überchoo̥ n, i n d’s Atelie r ụụcha ’gange n. Da̦ drinn, da̦ het’s de nn grad uf äi nsma̦l g’wịtet! U nd häiter isch es g’si̦i̦ n fast wi e voru̦ssen a n der Sunne n! Wa̦rum? Wi̦l halt iez der Ma̦ler nü̦mmḁ n ’bụụret het, het ihm du̦ di alti Straubühni d’s Atelie r g’gee n; un d i n d’s Ziegeldach (d’s Ankerhụụs vo n 1803 isch d’rum [eben, nämlich] d’s ee̥rst Hụụs mit Ziegeldach im Dorf Eiß) het er la̦ n Pfäister ịị nsetze n, das s e̥r d’s schönst Oberliecht het überchoo̥ n. Das isch e n wahri Herrlichkäit g’si̦i̦ n gege n das früecher «Atelier», wo n ihm der Vatter — als Bụụr — für sịner Pariserserie n (s. u.) i n der Neebe ntstụụbe n gege n Berg (also nordwärts) ịị ng’richtet het. Für daß’s e n chläi n meh Häiteri geeb, het er e n Bitz Dach la̦ n dänne n neh n. U nd der Suhn, nid fụụl, het vo n den a bg’sŏgte n (abgesägten) Treem u nd Raafen es G’stelaasch g’macht un d en ung’hoblete n Lade n drüber g’läit. Da drüber si n zwöo̥ Hördöpfelseck voll Strau choo̥ n, u nd das het gar mil lionisch es toll 2 Rueijibett g’gee n für de n Maler u nd sịner Wịsịte n. Un d e n Staffelei het er o ch ganz e n scharmanti g’haa n: zwöo̥ Eerbsstickel, wo un͜der na̦a̦hḁ no ch der Heert un d obe n na̦a̦hḁ no ch n es bar dü̦ü̦r r Stängel dra n g’hanget sịị n. 3 Und das isch no ch äinisch e n Herrlichkäit g’si̦i̦ n geege n wi ’s der Anker als Ma̦lerlehrbueb i n Paris (s. u.) g’haa n het: das chalte n Mansardestübli, wo dä r erfinderisch Maa n het d’s Ri̦ịßbrätt über d’Füeß g’noo̥ n, für nit z’verfrụ̈ụ̈re n, Nu̦mmḁ der Böcklin het’s bitterer g’spü̦ü̦rt, wo n er z’Zürich het d’Atelie rtü̦ü̦r ụụsg’hänkt, für z’Nacht dru̦ffe n z’lịgge n.
I n däm Mansarde̥lli het der Anker chụụm ’dänkt, daß Paris de nn äinist der Platz sịịg, wo n är siner beste n Sache n machi, am ee̥rste n zu Gält un d z’Ee̥hre n chööm u nd sịner liebste n Fründe n fin͜di. Aber ḁ lso isch es choo̥ n, un d är het als Maler en iedere n Winter i n Paris zue’bra̦a̦cht bis im Ja̦hr 1890. Bloß der dütsch-französisch Chrieg het ’nḁ n e n Zit lang ganz z’Eiß b’halte n. Wi wohl es ihm als Ma̦ler z’Paris isch gsi̦i̦ n, zäigen e n Bodo̥grafịị von ihm 4 u nd sị ns Wort vom Ja̦hr 1855: I ch risgiere n, ganz e n Pariser z’weerte n. 5 Aber är het Frankrịịch nid nu̦mmḁn i n sị’r Hauptstadt g’chennt. Im Herbst 1856 het er sich mit 367 de n Fischer i n der Bretanie n ụmmḁ ’trịịbe n. D’s Französisch het er de nn hinggeege n (in Wahrheit) los g’haa n wi sị ns Eißerdütsch. Wa̦rum o ch ni̦i̦d? Är het ja ( S. 368) vom vierte n Ja̦hr aa n, bis das s er z’Bern i n di drittobersti Klaß vom Gymnasium het chönnen ịị nrücke n, mit sịnen Eltere n z’Neue nburg g’wohnt u nd dört d’s Collège classique b’suecht.
Italie n het er ó ch g’chennt (oder b’chönnt: Vi.) u nd wie! An no 1862 isch er d’s erst Ma̦l dört gsi̦i̦ n. Aber z’Florenz het er d’s Närve nfieber (Typhus) überchoo̥ n. Er isch toodchrank da̦ g’leege n, u nd daas drei Wuche n lang in äi’m ịịchḁ (ohne Unterbruch), ohni zue n ĭhm sälber z’choo̥ n. Sị n Frü̦nd Ehrmann het zue n ĭhm g’luegt so guet das s er het chönne n un d ihm Dökter la̦ n choo̥ n. Aber sị n Unggle n, der Rudolf ( S. 361), isch ’nḁ ga̦ n räiche n und z’Samm Pleesi isch er du̦ ummḁ ganz z’weeg choo̥ n. Glịịch isch er du̦ no ch zweu Ma̦l: 1887 u nd 1891, i n das gelobte Land vo n de n Künstler ’pilgeret.
A n der Kunstrichtung vo n däm beräits rịffe n Maa n het das frịịli ch nụ̈ụ̈d g’änderet; aber es het sị n wältmännische n Blick u nd sị n gäistige n G’sichtskräis erwịteret.
U nd het ihm du erst rächt sị ns Häi m lieb g’macht! Sị ns Eiß u nd siner Eißer het er erst us der Fröndi vo n Grund ụụf verstan͜de n u nd g’würdiget. Es het si ch bịị n ĭhm erwahret, was der Gottfried Keller e n chläi n rụụch säit: Wer unter Heimatliebe nur Zuhausehockerei versteht, wird der Heimat nie froh werden, und sie wird ihm leicht nur zu einem Sauerkrautfaß. De̥m Anker isch Eiß du grad rächt der Platz vo n sị’m höchste n künstlerische n Schaffe n worte n; u nd z’Eiß z’wohne n het ihm u nd sịne n Chin͜d für d’s Höchsten i n der Wält ’gulte n. Es isch, wi wenn der Dokto̥r Schnịịder ihn g’mäint hätt, wo n er 1817 bi’m ụụftauche n vom Seeland us dem Nebel en Anker uf der Gästlere n la̦a̦t hööch ụụfgu̦mpe n. 6 E n Eißer het der Anker bigährt z’sịị n mit Lịịb u nd Seel, währe nt män’ge r «G’wäste r» si ch de nn sị’r Häimḁt schämt.
1
Kal. Ank.
2
Unflektiert; vgl.
S. 132.
3
Rytz 34. 36.
4
Ebd. 32.
5
Ebd. 29.
6
Schn. 3.
Häi m het also der Anker äigetlich drụ̈ụ̈ g’haa n: z’Eiß, z’Neue nburg u nd z’Paris.
Z’Eiß het er als Chin͜d di drụ̈ụ̈ erste n Lebe nsja̦hr un d als Ma̦ler ungfähr di zwenz’g letz̆te n, u nd dḁrzwüsche n di mäiste n Summere n zue’bra̦a̦cht. U nd d’Eißer un d überhaupt d’Seeländer häi n bewi̦i̦se n, daß si ’nḁ schetzi. 1871 isch er Groo̥ßra̦a̦t worte n; das isch er zwar (allerdings, ze wâre) nu̦mmḁ zwäü Ja̦hr blịịbe n. D’Politik het ihm’s 368 nụ̈ụ̈d chönne n, wenn’s scho n sịner Fründe n lieber g’see̥h n hätti. Äinisch het der Anker ḁ lsó us lụter Jux es brönnigs Sunnerad zu ’mene n Fasnḁchtfụ̈ụ̈r (s. u.) ’zäichnet, un d es Bụ̈ụ̈rli dḁrbịị, wo sị n Gäiß am Glöggliban͜d het dḁrzue hee̥rḁg’risse n, daß si fast erwoorgget isch, u nd g’rüeft: Jä wohl, Gịbe n, muest du d’s Fụ̈ụ̈rweerch g’see̥h n! Sịner Frü̦nde n hain ihm du das ḁ lsó ụụsdütet, wi wen n eer der Zwang u nd der Gwalt vo n de n politische n Parteifüehrer we lltt verspotte n. — Dḁrggeege n het er sich als langjehrigs Mitgli̦i̦d u nd als Sekretär vo n der Eißer Schuelkumission a n sị’m Platz g’see̥h n. Im Männerchor z’Eis; het er g’hulffe n singe n u nd hie, wi e z’dü̦re̥wägg bi de n Lụ̈̆t, öppḁ der rụụch, robust Eißer fü̦rḁg’chehrt. Är het’s g’haa n wi d’Seeländer all un d in ihrer Art o ch d’Ämme ntaaler: är het nid welle n dee r sịị n, däm öppis Rüehrends z’Heerze n gang. Wi äine r, wo sịner häiligste n u nd zartiste n Gfüehl mit rụụche n Worte n glịịchsam i’ n Heert ịịlochet, si zuelochet, für si nid müeße n z’zäige n, het eer über ’ne n Charfrịtḁ gsbredig na ch’m Lied «O Haupt voll Blut und Wunden» nachhee̥r i n vertrautistem Kräis erzehlt: Da̦ han i ch grännet (geweint) wi n en Esel. Das ist dä r glịịch Maa n, wo na̦ ch n e̥ren an͜dere n Bredig dem Pfar rer si ns Bedụụren über die fast gar leeri Chilche n ụụsgsproche n het, aber ihm o ch het z’versta̦a̦ n gee n, es sịg an an͜deren Ort nid besser, u nd mi chönn dört im Winter o ch das Veersli seege n:
O, wi isch es chalt u chüehl!
O, wi leer si d’Bänk u d’Stüehl!
O, du liebe Herr Jesus Christ,
Chumm de umma, wenn’s weermer ist!
Na̦ ch n eren an͜dere n Bredig, ó ch im Ämme ntaal, het er dem Pfar rer voru̦sse n g’wartet, für i n warmer Härzlichkäit u nd zuglịịch mit der fịịnste n Pariser Höflichkäit (s. u.) ihm z’danke n.
Wi vertraut är mit den Eißer het chönne n verchehre n, ohni ĭhm (sich) öppis z’vergee n, dḁrvo n chönnti me̥r us dem Mụụl vo n de n Lụ̈̆t es ganzes Buech schrịịbe n; aber mier müeße n’s la̦ n sịị n (unterlassen), so lustig das s es wee r, Ankerwitze n z’erzelle n.
Z’Neue nburg, wo no ch Täil vo n sịne n Familie ngli̦i̦der der Winter verlebe n, het der Anker sị n Schuelzịt dü̦rḁg’macht. U nd wenn mḁn ieze n dänkt, was Neue nburg für ’ne Kunststadt isch, so begrịịft ma n völlig, wi n eer da̦ vo n Chin͜d ụụf het chönne n zum Künstler ụụfwachse n. Sit An no̥ 1842 gi bt’s i n Neue nburg e n G’sellschaft vo n Kunstfründe n; u nd die het im Ja̦hr 1885 das Kunstmuseum ( Musée des Beaux Arts) z’Stand ’bra̦a̦cht, wo äi ns vo n de n schönste n, wenn nit d’s besten isch. Da̦ häi n du i n der Stadt, wo als di besti Bilderchäüffere n gilt, Männer wi 369 Edmond de Pury, de Meuron, Calame, Girardet, Leopold u nd Paul Robert us dem Ried bi Biel, vo n denen es bar Bilder sich ụụfgläcket häi n wi Zucker, es Häi m überchoo̥ n, u nd der Ma̦ler Anker oo ch. Der Paul Robert isch sị n Buese nfründ gsi̦i̦ n. In Ankers Atelie r isch das groß, prächtig Landschaftsbild g’hanget, wo n er de̥m junge n Künstler für drụ̈tụụsig Franken abg’chauft häig, für ihm Gụraasch z’mache n.

|
|
Maler Anker |
Was Neue nburg i n d’Seel vom Chin͜d g’sääjt het, das het du Paris im Maa n vo n Wält u nd Wältrueff zur Rị̆ffi ’bra̦a̦cht. Scho n 1866 het der Anker für sịner «chlịịne n Blaaustrümpf» di guldigi Médalje n vom Pariser Salon ụụsag’lü̦pft. Anno̥ 1878 isch ihm der Orde n der Ehre nlegion i n d’s Hụụs g’floge n, u nd spööter vo n Berlin der Sankt Georgs-Orde n. Är het drum a n der Kunstụụsstellig z’Berlin 1896 als Prịịsrichter g’funktioniert, wi d’s Ja̦hr drụụf o ch z’Münche n. Aber scho n lang vorheer het ’nḁ der Bundesra̦a̦t z’Bern i n d’s Auge n g’fasset. 1878 isch der Anker i n di äidgenössischi Kunstkommission choo̥ n u nd du̦ spööter i’ n Verwaltungsra̦a̦t vo n der Gottfried Keller-Stiftung. Zu sị’m sịbe nz’giste n Geburtstag het ihm der Bundesra̦a̦t Glück g’wünscht. D’Kunstkomission u nd d’G’sellschaft vo n de n schwizerische n Ma̦ler u nd Bildhauer häi n d’s glịịche n g’macht, u nd Künstler wi der Architekt Auer häin ihm ebe nfalls i n schöne n Brieffe n ’grate̥liert. 1 D’Berner Hochschuel 370 het ihm der Dokto̥r g’gee n (ihn zum Dr. phil. honoris causa ernannt). Na̦ ch si’m Schlagfluß het ihm di ganzi Berner Regierig e n Wịsite n g’macht; u nd wo im Summer 1909 der historisch Veräin vo n Bern z’Eiß z’seeme nchoo̥ n isch, het er natürlich o ch nid versụụmt, däm verehrte n Maler u nd große n, täüffgründige n G’schichtskenner ( S. 376) es B’süechli z’widme n.
1
Rytz 65 -70.
Daß das alles ụ̈se rn Anker vo n Heerze n g’fräüt het, verstäit si ch von ihm sälber (von selbst, ung’säit); aber öppḁ zu Stu̦lz (Selbstüberhebung) oder e̥-mene n Hochmüeteli hätt das ihn nie verläitet. E n Ma̦ler Anker häiße n u nd stu̦lz sịị n? Das hätt zu n enan͜dere n ’paßt, wi öppḁ n uf sị ns Eißer Bụụre nhụụs e n Windmühlli. Im Geege ndäil: är isch män’gisch nu̦mmḁ n fast z’beschäide n g’si̦i̦ n. Wo ’nḁ der früsch Pfar rer Schnịịder z’Eiß bi der erste n Wịsịte gebührender Wịịs het mit «Herr Dokto̥r» aa ng’redt, hed err mit si’m herzlichste n lächle n g’säit: O, löö ßt daas nummḁn uf der Sịte n! Wenn de̥r chrank sịt, chönnet Er ämmel ja doch nid zu mier choo̥ n! Är het natürlich dḁrmit welle n seege n, mi häig’s mit dem Dokto̥rhuet, wi öppḁ mit dem Zilinder(huet) u nd mit de n Glasseehändsche ch, mi zäig si ch nụmmḁ n bi ganz abaartige n Gleege nhäite n dḁrmit. Vo n der sịbe nz’giste n Geburtstagsfịịr ( S. 369) het er z’vollem nụ̈ụ̈d welle n wüsse n. Är isch mit e̥-mene n Generalabonnement furt g’räiset u nd het no ch sịner äigete n Lụ̈t nu̦mmḁ n bloßdings la̦ n wüsse n, wo si n ĭhm pressierigi Brieffe n sölli hi n schicke n.
A n der Berliner Ụụsstellig isch üserem Eißer das märten um d’Prịịse n u nd das chöstlig Lebe n vo n gwüßne n Ma̦ler en überụụs z’wĭ̦deri Sach g’si̦i̦ n. Är het überhaupt uf üsserem Schịịn nụ̈ụ̈t g’haa n, u nd uf Presentazion am gehörigen Ort mängisch e n chläi n z’weni g. Das het zu lustige n Szene n chönne n füehre n wi äinist i n Zürich. Da̦ isch Kunstkumissionssitzig aa ng’stellt g’si̦i̦ n i n ’mene n Hŏ́tell erster Klaß. Der Anker het sich am Aa̦be nd vorhee̥r dört aa ng’mäldet für z’übernachte n. A lsó n e n g’schnịglete r Portie r, vo n dene n, wo dem Anker am mäiste n wider de n Strich ’gange n sịị n, het dä n Maa n mit der Täsche n, wo n ihm a n mene n Rieme n zur Sịten aachḁ g’hanget isch, vo n Chopf bis z’Fueß i n d’s Auge n g’fasset. Mit e n chläi n spöttisch verzogene n Mụlegge n säit er du: «Hm, Manoo, sind Si e ächt nü̦d an es lätzes Ort hi n g’wi̦se n worde n? Händ Si e vilicht i n d’s ‹Schwärt› welle n, oder öppḁ n i n d’s ‹Chrụ̈ụ̈z›? Wüsse nd Si e, Lụ̈ụ̈t von Ihrer Klaß gönd aamị̆gs dörthi̦i̦ n.» Guet, der Anker het nụ̈ụ̈d g’antwortet un d isch furt. Am an͜dere n Morgen äm zeechni het er si ch vor der Kumission ịị ng’stellt. Der Wi̦i̦rt, wo vo n der Abwịịsig vernoo̥ n g’ha n het, g’seht, 371 wi di e Her ren ụ̈se rn Anker mit allne n Zäiche n der Hochachtung epfange n u nd ị̆hm der Ee̥hre nplatz oben am Tisch aa nwịịse n. Chrebsroo̥t vor Verlege nhäit, nimmt er, soball d er Triftig het, der Anker neben ụụs u nd veräxgụ̈siert si ch mit aller Kunst vo n ’mene n Wältmaa n. Aber ụ̈se rn Eißer antwortet ĭhm: O, Herr Wirt, Dịr häit E uch gar nid im G’ringste n z’entschuldige n! I ch bi n im Chrụ̈tz rächt wohl g’si̦i̦ n, u nd de nn no ch gar billig!
Mit de n Chläider z’hụụse n isch richtig e n G’wahnhäit g’si̦i̦ n vo n Paris na̦a̦chḁ, wo ’nḁ sị n Vatter us erzieherische n Gründe n ( S. 382) knapp g’ha n het. Da̦ het er ämmel o ch ne n halblịnigi B’chläidig schwarz la̦ n feerbbe n u nd schrịbt du häi m: Mit de n Chläider han i ch’s schier, wi Jaggi Hụsamma ns Schwester mit ĭhrem Gloschli. B’sun͜ders d’Hoose n lịịde n «an der allgemein menschlichen Hinfälligkeit». Zum Glück han i ch e n längen Aṇg’lees. 1 Wo n er du̦ elter g’si̦i̦ n isch, het er alti Chläider gern so lang a ls mügli ch träit, wil mḁ n so ung’schiniert drinn cha nn schaffe n. Mi het ’nḁ gäng u nd ggäng i n der glịịche n graue n Chụtte n un d im glịịche n graaue n Tschäppel im Atelie r chönne n g’see̥h n. Wa̦rum? Wenn er es neus Chläid het la̦ n mache n, so het’s exakt umma vom glịịche n Stoff u nd vo n der glịịche n Faarbb müeße n sịị n. U nd de nn isch es ihm de nn vorchoo̥ n, wie wenn i n däm neue n Chläid e n neue Möntsch weer. Är het de nn chönne n dä n Witz mache n, är heig iez umma neu dinget; är müeß iez no ch länger leebe n. So weeni g het dä r Künstler, wo alles um ĭhn ummḁ het welle n voll Faarbb g’see̥h n, a n sị’m äigete n Lịịb vo n Faarbb öppis welle n wüsse n. D’s Chläid isch ja̦ eben am Änd so z’seegen nu̦mmḁn e n zwäüti Hut, wo mit der erste n zu äi’m Stücki verwachset un d äinist mit ihm z’Stạub un d Äsche n wirt. 2 Aber so lang es da̦ isch, soll es äim nid vo n der eernsten Arbäit abzieh n. Der Wälti u nd der Stäbli un d an͜der Künstler sị n ja̦ ó ch so ’dänkt g’si̦i̦ n.
Was Or dnig isch o ch im Üssere n, für das het der Anker deßwege n grad no ch n es scheerffers Urtäil g’haa n; u nd name ntlich an sịne n Döchtere n het er nụ̈ụ̈t U nwa̦ttligs welle n g’see̥h n. Daas prächtig Wort bedütet z’nööchst «unkleidsam»; aber es gäit glịịcherwịịs uf d’Maniere n u nd bidütet o ch dört alles, was äi’m nid guet aa nstäit 3 ( ce gui ne «sied» pas). D’s Innere n u nd d’s Üssere n het si ch dem Anker zum z’seemethafte n Bild vo n Anmuet müeße n veräinige n; ohni das het ihm alles, was d’Lụ̈t «schön» fin͜de n, chönne n g’stohle n weerte n. Äinist sịn es Trü̦ppeli Frạue n bi ’nan͜dere n gstan͜de n u nd häi n mit ere n Neue nburgere n, wo i n Samet u nd Sịịde n vorbịịg’rụụschet isch, grụ̈ụ̈slich es 372 Weese n g’haa n, was ieze n das für ’ne n Schönhäit sịịg. « Qu’en dites-vous, Monsieur Anker?» «‹ Hm, elle est bien mise›» ( si het schön’s Zụ̈ụ̈g aa n), het der Künstler mụtz g’antwortet.
Äine r, wo mit Schịịn sị ns Schwịzerdụ̈tsch ni̦mme̥ hr chönne n het oder si ch desse n g’schemmt, het mit dem Anker ämmel o ch uber ’s zäichne n g’redt u nd rächt «vollmundig» dä n Satz fü̦rḁbbra̦cht: Wenn ị̆sch äinen Pfĕrdeghopf zäischnen wịl l, so zäischne isch zuerßt... Druf macht ü nse r n Eißer: Un d i̦i̦ ch, wen n i̦i̦ch wott e n Roßgrin͜d zäichne n, so machen i ch’s ḁ lsó:...
Är het überhaupt alli Arte n, si ch wichtig z’mache n, uf der Latte n g’haa n, u nd het si mit fi̦i̦ne n Worte n chönne n häi m schicke n. Äinisch het ihm d’Frau Pfar rer Liebi es Scheeme̥lli ’zäigt u nd g’rüehmt: Lueget, Her r Anker, das han i ch alles us altem Zụ̈ụ̈g dee nweeg z’wägg’schuesteret. «Mḁ n g’see̥ht’s, Frau Pfar rer!» het der Anker zur Antwort ’gee n. E n junge r Ma̦ler het ihm e n Landschaft ’zäigt, wo e n chläi n z’fast isch Grüen i n Grüen g’ma̦a̦le n gsi̦i̦ n u nd het welle n wüsse n, wi si n ihm g’falli. «Hm», macht der Anker, «dä r Maa n, wo di grüeni Farbb macht, verchạuft si ó ch geern!»
De r glịịch Künstler het o ch i n der Behandlig vo n sịne n B’steller zwüsche n Fü̦rnehm u nd Min͜der an͜deri Un͜derschäide n g’macht weder di großi Wält. Wenn öppḁ so n e n groo̥ßartige r (großtuender) Sü̦chchel, Hắnaagger (Kerl) oder Flangg ( gamin) als Kunstverständige r bịị n ihm het welle n ga̦ laafere n u nd plafóute n u nd pralaaxe n u nd pắrlischanggere n, so het er bịị n ihm chönne n aa npụtsche n schier wi bi’m Gottfried Keller. Abg’sụ̈ụ̈feret zwar, wi dee r, het er nid liecht äine n. Un d es wird vo n Kenner in Abreed g’stellt, was An͜deri behaupte n, är häig äinisch e n B’steller vo n ’mene n Porteree aa ng’ränzt: Looset, daas chosteti meh, weder daß Dier weert sịt! Aber mi het chönne n g’seh n, wi de r nervöös u nd chlü̦pfig u nd liecht erregbar Maa n wehre nt allem zäichne n oder ma̦le n sị n Ungidult oder gar sị n Täübi verweerchet, bis de r B’suech si ch pfätzt het u nd u̦mmḁ n isch d’Steegen ab g’si̦i̦ n. De nn het si ch de nn d’Ụụfregung öppḁ n i dem philosophische n Satz Luft g’macht: Nu n, es mueß ó ch Söttig gee n! Aber nid gäng! Äinist isch e n fürnehme r Heer r ga̦n es Bild b’stelle n u nd het dḁrbịị e n chläi n groo̥ß ta̦a̦: «I ch bi n käi n Gịtgnapper! I ch bi n käi n U nnäätige r! 4 I ch zahlen E uch’s! I ch giben E uch, was de̥r heuschet! Säget nu̦mḁ n, was es chostet! Es chunnt me̥r uf hundert Franke n nid drụ̆f aa n! I ch gị̆be n tụụsig!» Der Anker het a n sị’m Bild 373 zueg’schaffet, wi wenn niemmer da̦ wee r u nd nụmmḁ n alben äinisch g’macht: mhm! — mhm! — mhm! Dä r Heer r isch unverrichteter Sach 5 furt, u nd der Anker macht du̦ sị’r Täubi Luft: Dee r Ttonner! Mäint dee r Naar r de nn ächt, i ch sịg u̦f sị ns Gält aa ng’wi̦i̦se n u nd vo n sị’r Gnad abhängig? — Wi lieb het er darggeegen e̥-mene n braven äi nfache n Mannli vo n Eiß, wo abso̥lut es g’stoorbbnigs Chin͜d nach ere n Bodograffịị het welle n groß ’zäichnet haa n für i n d’s Toote nbụggee a n der Wan͜d: Loos, Hansli, i ch schänke n de̥r das Bild! Was es weert isch, wäist du ni̦i̦d, u nd zahle n chönntisch es ni̦i̦d. Für käi n Rappe n Gält het är o ch sị’r Na̦chbụụrs-Frạu der g’stoorbbnig Maa n un d alli acht Chin͜d u nd d’s Hụụs abzäichnet. An͜deri B’steller, bi denen är g’merkt het, daß d’Hụshaltig drun͜der chönnt lịịde n, oder das s ’ne n sụ̈̆st’s zahle n Müej miech, het er uf ene n zarti Wịịs wü̦sse n ụụfz’daagen un d ụụsaz’stụ̈ụ̈de̥lle n: si sölli öppḁ n en an͜dere Chehr äi ntweedere n Daag ummḁ choo̥ n; är well de nn luege n. So het er si mache n z’waarte n, bis daß si di B’stellig ni̦mme̥ hr dü̦r ch de n Chopf ’drääijt häi n u nd si u̦s dem Chopf ta̦a̦ n.
So het är o ch im Atelier di sịịni, vol ländet wältmännischi Umgangsart a’ n Daag g’läit, wi si n ihm z’Neue nburg u nd z’Paris zur an͜dere n Natur woorten isch. Är het o ch süst scho n z’Eiß G’lege nhäit g’haa n, da̦s z’erzäige n. So bi Bụ̈ụ̈ri’s (in der Familie de Pury) öppḁ n an ere n soirée. Käi n Maa n vo n Wält am Chäiserhof hätt mit sịịnere n Maniere n d’Frạu am Arm zum Tisch g’füehrt. U nd käine r hätt mit dem Heer r, wo sị n Fründ g’si̦i̦ n isch, gäistrịịcher g’wüßt z’b’richten u nd z’plạudere n. Käi n Schriftsteller hätt ihm, wo n er chrank g’si̦i̦ n isch, schöneri Brieffe n g’schri̦i̦be n. Es isch de r glịịch Anker, wo scho n als Zofinger Studänt e̥n-ere n Balldochter b’sun͜derbar zierlichi, duftigi u nd doch g’haltvolli Brieffeli 6 het la̦ n zuechoo̥ n.
1
Rytz 43; vgl.
Lf. 400.
2
Vgl. die Gleichbenennung von Leibesteil und Leibeshülle
Gb. 429;
Gw. 492.
3
Vgl.
Gw. 492.
4
Intraitable, der wie steifes Tuch nicht «nähbar» ist. Vgl. «u
nspunnig» («unspinnbar»).
u
nsööd («unsiedbar»: vgl.
schwz. Id. 7, 320).
5
Bemerke die Analogie zum lat.
Ablativus absolutus.
6
Nachlaß.
Wettigi Geege nsätz: der rụụch dütsch Eißer u nd der fịịn wältsch Pariser in äi’r P’hersoon! «Geege nsätz»? Nääi n! Zwöo̥ verschi̦i̦deni Stämme n us äi’r Wü̦ü̦rze n. U nd die Wü̦ü̦rze n, wo täuff, täüff i’ n Boden aachḁ reckt, isch d’Heerze nsgüeti. Die het d’Seeländer Rụ̈ụ̈chi ( S. 368) nu̦mmḁ n zu der schützende n Rin͜de n g’haa n, wi öppḁ die am Rebstock isch; u nd si het d’Fịịni i n de n Maniere n dḁrvor bewahrt, zum bloße n raffinierte n Schliff z’werte n, un͜der däm sich e n brütaali, zynischi Rohhäit cha nn verstecke n.
374 Sị n Güeti het aber o ch der fröndisch (fremdeste) Mönsch scho n i n den erste n Minute n chönne n merke n. Da̦ isch i n G’sellschaft v’li̦cht öppis Chrumms passiert, wo «Gebildeti» dḁrbịị ohni wịters lụtụụf lache n u nd greedi ụụfḁ platzge n. Wi fịịnfüehlig het si ch der Anker z’erst verg’wüsseret, göb’s niemmerem nụ̈ụ̈d g’schadt häig! Wo «Schreiber dies» z’Eiß «umgschauet» het ( S. VII): wi merkig het der Anker sịner zweu Modäll vo n interessanten Eißersache n g’macht z’b’richte n!
Är het überhạupt d’Lụ̈t g’wüßt mache n z’reede n. Oder besser g’säit: är het nu̦mmḁ n ’brụụcht zue nne n z’hocke n i n der Ịịse nbahn oder i n der Stube n oder sü̦st, so het d’s Reedweerch aa ng’fange n lạuffe n wi n en ụụfzognige r Wecker. Si häin ihm ganzi G’schichten erzellt; am liebsten us ihrem Lee̥be n. Är het nummḁ n di (richtig groo̥ßi) Kunst brụụcht z’üebe n: z’loose n u nd gäng ummḁ n z’loose n, u nd är het für der churzwịligist Mönsch ’gulte n, wo n e̥s uf Gottes Eerdboode n chönn gee n.
So het er vor allem di alte n Lụ̈t gwunne n, wo der Wịịl häi n. Jüngeri Lụ̈t her er o ch vill ’zäichnet (s. u.), nummḁn erwachseni Mäitli sälte n. Die löö n sich überhaupt nid alli gern vom Ma̦ler neh n. U nd b’sun͜ders Täil hü̦bschi Ti̦te̥lli tüe n bịị n ihm hin͜derhäägg (hinterhältig); si gangen um so lieber zum Photograph. Wa̦rum? Häi si di kuriosi Mäinig, wo nu̦mmḁn us uralte 1 Vorstellige n z’erklären isch: si verlu̦u̦ri ( perdraient) von ihrer Schönhäit, wenn si da̦a̦ so n e n Stun͜d lang vor dem Ma̦ler stien͜di? Aa nfa n förchte n si, si schu̦ni 2 ( paraîteraient) uf dem Pŏ́rteree zeeche n Ja̦hr elter, weder daß si sịị n. U nd dem seege n si de nn richtig: I ch ha n der Lụụn nid, mi ch (beim Maler) la̦ n z’neh n. Si häi n di Ụụffassig (Vorstellung) vo n der Ụụffassig (malerischen Fixierung) vo n ihrne n G’sichtszü̦ü̦ge n, wi wenn die en Ụụffassig (ein förmliches Aufsaugen) vom Tuech oder Papịịr weer.
Um so lieber sị n dem Anker d’Chin͜d ga̦ n hocke n (sitzen; hocken oder kauern wird dagegen als grụụpe n b’namset). Dene n het er de nn G’schichtli erzellt, daß si äi ntweeders ’grännet (’plääret) häi n, oder daß si sị n lachig worte n u nd lụt ụụsa häi n müeße n geuße n. Si si n ganz z’gäggels choo̥ n u nd b’richtig, daß si mit lächerige n G’sichtli pläüderlet häi n, was zum Mụ̈ụ̈li ụụs möge n het. De nn häi n si n ihm de nn müeße n oder döörffe n Reetsel ụụfgee n. U nd wenn dä r guet Maa n, wi für öppis scheerffer z’g’see̥h n, da̦ so über si n Hornbrüllen überḁ g’luegt het u nd darbịị grụ̈ụ̈slich g’stụụnet u nd na̦a̦chḁg’sinnet, was daas ächt iez o ch möögi bedüte n, oder wenn er am Änd de nn no ch bekennt het, 375 da̦ chönni äär ämmel ieze n nid drü̦ber choo̥ n: da̦ cha nn mḁ n dänke n, was das für ’ne n Si̦i̦gesjubel u nd für n es Halloh het g’gee n!
Äinisch het er würklich äi ns nid chönne n löo̥se n; u nd das het ihm es sächsjehrigs Mäite̥lli ụụfg’gee n: d’s Maarteli Stucki. Das Reetsel het g’häiße n:
Vier Rundummeli,
Zweu Tschumtschumeli
Un
d e
n leederige
r Säustaal
l.
Di vier Wa̦a̦ge nreeder u nd di zwöo̥ Schü̦mmle n weeri ja̦ ball d erra̦a̦te n gsi̦i̦ n, wa̦rum ni̦i̦d? Aber daß der leederig Säüstaal l di Postgu̦tsche n sị n söll, wo früecher all Daag zwüsche n Bern u nd Neue nburg g’fahren isch (s. «Twann»), het ihm d’s Maarteli lang chönne n seege n. Der Anker het’s «nid begri̦ffe n». Är het ja̦ frịịli ch chönne n wüsse, daß z’erst der Schaare̥bank ( char à banc, Seitenwagen), wo der Vater Anker ( S. 362) als Vehdokter drinn g’fahren isch, dä r Spottnamen überchoo̥ n het (so wi si dem höo̥che n, groo̥ße n Roß der Gịraff g’säit häi n); u nd zwar deßtweege n, wil der Anker es baar Gasse nschlingle n het uf der Mu̦gge n g’haa n u nd ’ne n für ihrer Boshäite n öppḁ n äinisch het d’Gäisle n g’gee n. Dü̦r ch’s «na̦a̦chḁfra̦a̦ge n» isch er du̦ drụfchoo̥ n; u nd wi het er’s dem Chin͜d zahlt? Är het ihm erklärt, er häig’s nid chönne n löo̥se n u nd mües iez halt es Pfand gee n. U nd was isch du̦ das für n e̥s Pfan͜d g’si̦ị? Das lieblich Pastell vo n däm Mäite̥lli mit dem Chachche̥lli, wo n es drụs trinkt. (Eebe n d’s Maarteli sälber.)
Aber es het dem Anker o ch nụ̈ụ̈d g’macht, mitts am helle n Daag uf offener Stra̦a̦ß mit de n Chin͜d z’g’vätterle n. So het er’s äinisch g’macht vor dene n drei unglückliche n Strauhụ̈ụ̈ser ( S. 364). Da̦ häi n Chin͜d ’ dräcke̥llet (im nassen sandigen Ton gespielt). Der Anker het’nen es Chehrli zueg’luegt. Du̦ gäit er zụụchḁ n u nd säit: So, iez wäi n me̥r äi ns von äüne n Hụ̈ụ̈ser fertig mache n! Da̦ chunnt d’s Cheemi. Soo̥. U nd da̦ hin͜der dem Hụụs mache n mer der Misthụffe n, und so wịter.
Sogar wildfrönde n Schwachsinnige r het er sich aag’noo̥ n. So e̥-mene n Taubstummen im Schwarzwald, 3 wo no ch iez vo n Ankers Familie n Guets u nd Liebs erfahrt, wo n er si ch sälber cha nn dü̦rḁbringe n. Mit wettigem Glück het dä r Erasmus das Brieffe̥lli g’schri̦i̦be n: Rasi kann jetzt lesen und schreiben; er dankt dem Maler.
Di ịịndringendi Seele nkund, wo der Anker hie bewi̦i̦se n het, het er natürlich erst rächt a n sịne n Chin͜d ’zäigt. Ihn E ntwicklig vom Ii ntritt 376 i n d’s Leben aa n het ’nḁ so g’waltig interässiert, das s er die i n ’menen äigeten Ụụfsatz 4 bis i n di chlịịnste n Dingelli ịịchḁ sorgsam het darg’stellt. I n däm Maß, wi si sị n schuelfeehig worte n, het eer si zwüsche n d’Schuel ịịchḁ o ch sälber i n d’Heere n gnoo̥ n. Vor allem het er si scharff u nd richtig g’lehrt d’Natur aa nluege n u nd zäichne n mit enan͜dere n. Un d ihres Gedächtniß het er o ch dee n-weeg g’scheerfft mit Hülf vo n der G’schicht, wo n eer, der no ch schier all Tag Griechisch u nd Latịịn g’leese n het, si ch bịspi̦i̦llos gründlich drụf b’chönnt het u nd wo n er sich alls 5 het b’sinnt, was er äinisch het g’lee̥hrt g’haa n. Da̦ isch de nn o ch alles aa nschạulich u nd handgrị̆fflich u nd luter gege nwertigs Lebe n worte n, wenn der Vatter am Aa̦be nd zu de n Chin͜d a n d’s Bett isch u nd g’fra̦gt het: wo si n mer ’bli̦i̦be n? u nd de nn furtgfahre n het. Zum Bịịspi̦i̦l öppḁ n us dem Homer het er erzellt vo n der Penelope, daß d’Chin͜d dere n’s ganzi Angst an ’ne n sälber dürḁg’macht häi n; u nd ’grännet häi n si vor Rüehrung, wenn er ’ne n b’richtet het vom Hun͜d, dem alte n, treue n, wo na̦ ch villne n Ja̦hr sị n Heer r dem ganz an͜deren ụụsg’see̥h n z’Trutz ummḁ g’chennt het. 6
Aber u̦ssḁ g’lee̥hrt het de nn ó ch müeße n sịị n! Der Anker het übersichtlichi 7 G’schichtstabälle n g’macht, u nd die het eer mit de n Chin͜d uf de n Spaziergäng (wi öppa zum U̦ngglen uf Samm Pleesi) dü̦rag’noo̥n n.
De nn zwüschen ịịchḁ, wenn er d’Chin͜d alläini (al lenzig) ’gaumet het un d es chlịị ns Übermüeteli über si choo̥ n isch, isch är im Stand g’sịị n, blötzlich z’seege n: Soo̥! iez wär am schönste n cha nn wüest tue n, überchunnt es Feufi! Aber nie häi n si dörffen an͜der Lụ̈t ụụsmache n (ausspotten). Da̦ het frịịli ch en äinzige n Blick g’nüegt, wi gegen an͜deri Unarten oo ch. Scharffi oder gar no ch bösi Wort het es chụụm g’gee n. Der Vatter isch mit de n Chin͜d umgange n wi mit Kameraten u nd Fründe n. So häi n si ’nḁ lieb g’haa n u nd doch g’respäktiert (g’schụ̈ụ̈cht). Mit Liebi het er si mache n z’folge n.
Sị n Hạuptteetigkeit isch richtig d’Arbäit im Atelie r gsịị n, us Fräüd a n der Kunst un d us Sorg für d’Familie n. U nd si het si ch g’lohnt, wenn eer scho vo n sịne n Hạuptbesteller in Amerika u nd Paris, wo dü̦r ch ihn sị n rịịch worte n, si ch grundsätzlich un͜derschäi̦de n het: Si n sị e Händler un d i ch bi n Künstler; si fra̦a̦ge n: was räntiert sich? un d i ch: was isch schön? Si chlömme n d’Lụ̈t un d i ch borge n ’ne n. U nd wenn scho n 377 Ankerbilder wi «d’Wäise nchin͜d i n Stanz» hüt uf dem Handelsweg der Brịịs verzeeche nfachet häi n. Neebe n Gält het doch der Anker sịne n Lụ̈t o ch no ch an͜ders welle n hin͜derla̦a̦ n. Bsun͜ders sị ns letzt Ölbild: d’Un͜derwịịsig, wo n er nümme̥ hr het, chönne n fertig mache n, u nd wo glịịch en U nsumm ’gulte n hätt. Vo n däm het eer g’säit: das blịịbt iez mịne n Lụ̈t! Si häi n sü̦st a nfḁ weni g g’nue g vo n mịne n Mache ntschafte n. 8
1
Animistischen.
2
Umsprung von Typus «reiten» in den von «finden». Vgl. «weben» u. a.
3
Rytz 44.
4
In der leider längst vergriffenen Nummer 102 der Neuenburger
Suisse Libérale vom 5. Mai 1898. Wir konnten ihn glücklicherweise einer Sammlung der Frau Quinche entheben und deutsch im «Berner Schulblatt» 1912 nachbilden.
5
Genitiv.
6
Ritz 57.
7
Synchronistische.
8
Ritz 74.

Maler Anker, der Kinderfreund
Söttig «Machetschafte n» sị n richtig bi der Art, wi der Anker g’schaffet het ( S. 383), nid vo n sälber choo̥ n. Als Muster vo n ’mene n schaffige n Maa n isch är ụụchḁ (hinauf ins Atelier) vor der erste n Taghäiteri, scho n göb’s ’daaget het. Es sịgi es pár Ma̦l z’Paris ụ nd z’Eiß Wettine n g’macht u nd verlore n worte n vo n Fründe n, wo der Anker häi n wellen im Bett aa nträffe n. Da̦ het er e uch chönne n ma̦le bis z’Nacht äm sächsi oder no ch länger: bis vierzeeche n Stun͜d im Taag. Aber o ch, wenn eer sị’s chrụ̈tzerig Pfị̆ffli het i n d’s Mụụl g’noo̥ n un d äxbräß (absichtlich) schier wi n e n Nụ̈ụ̈dnutz dür ch d’Gasse n g’jogglet isch. U nd wenn er sogar im erste n beste n Wịịrtshụụs mit 378 e̥n-e̥me n Vagant het es Gụ̈ụ̈x uf de n hohle n Zan͜d g’noo̥ n (es Gleesli, es Roggịịnli, es Brönnts, öppḁ Hördöpfler, wo no ch d’s realsten isch): so isch das bị̆ n ihm erst rächt g’schaffet g’si̦i̦ n. Wi weer är süsch zu dem berüehmte n Brueder Liederlich choo̥ n? Wo hätt eer das ganze n trunknen Eländ vo n Gotthelfs «Branntweinmädchen» welle n studiere n? Wo di Säüäügli von äi’m, wo n es rị̆ff isch mit ihm für häi m? Wo aber o ch di fịịne n Wịị nproobe n in ụ̈ụ̈se rm Wịị nkapitel («Twann»)? Wo hätt är chönne n g’see̥h n, wi n e n Wirtshụụsbrediger öppḁ n i n Gotthelfs Chĕserei en ịị nzoogne n Näcke n (oder Äcke n) un d e n Bu̦ggelirü̦gge n macht, oder im Versteckte n na̦a̦chḁzäichne n, was e n Dorfpolitikus mit dem rächten Arm für Scheßte n oder Fịgeesen ụụsüebt? U nd wenn er nid schịịnbar fụụl so hin͜der e̥-mene n Trapp i n d’s Loch (Chummen i ch nid hü̦t, so chummen i ch moo̥rn!) hee̥r ’gange n wee r: wi hätt er chönne n beobachte n, was de n Lụ̈t ĭhrer Hose n bi’m lạuffe n (gehen) für Rümpf mache n?
So het der Künstler abwächsligswịịs du̦sse n u nt dịnne n g’schaffet; das isch sị n Ụụsspannig gsi̦i̦ n. Das het sịne n Nerve n glịịch guet ta̦a̦ n wi d’s schön Wätter, wo n är gar überụụs gern g’ha n hett, wi alli, dene n d’s Reegewätter u nd di trüebi Luft sich uf d’s G’müet schlöö n. Uf d’s schöo̥n Wätter het er si ch g’freut wi n es Chin͜d; u nd wenn öpper di Forcht g’ü̦sseret het, mi müeßi ’s de nn u̦mma mit schlächtem zahle n, het är g’säit: Mier wäin i ns fräüe n, wịl’s (währendes) da̦a̦ isch, mier häi n’s ämmel de nn ghaa n.
E n söttigi Fräüd a n der glückliche n Gege nwart mahnt äim a n dä n Spruch vo n der Zuekunft mit ihrer Ung’wüßhäid: Mier wäi n d’s Bessere hoffe n; d’s Böo̥sere n chunnt sụ̈́st.
Wär dänkt da̦ nid a n di Bibelstell vom «nid sorge n für z’mornderist» ( pour le lendemain)? 1 E n söttigi am rächten Ort aa n’bra̦a̦chti Unbesorgthäit vom wahre n Künstler, wo si ch vo n der Sorglosigkeit vom «Auch Künstler» un͜derschäidet wi Guld vom Gu̦ldschụụm, g’hört zum guldlụụtere n Charakter vom Anker. Das spieglet si ch so rächt in ụ̈se rm Ankerbild vom Dokto̥r Blank z’Erlach ( S. 369). Un͜der däm schịịnbar böo̥se, sụụre n Blick, wo doch nụ̈ụ̈d an͜ders isch weder dä scharff Blick vom rächte Ma̦ler, li̦s’t mḁn e n merkwürdigi Veräinigung ụụsḁ vo n starcher Männlichkäit u nd e̥n-eren Art Chindlichkäit, wo sälbstverständlich 379 mit öppis «Chindischem» bị wịt u nd fern nụ̈ụ̈t z’tüe n het. Us ere n söttigen Art ụụsa het der Anker vom Himmel g’redt. Zwar, wenn er äinisch e̥-mene n fürnehme n Heer r en unglücklichi Familie n e mpfohle n het mit dem Verspräche n, er wärd de nn äinisch e n Sperrsitz im Himmel ịị nneh n, so glạubt mḁ n bi der bekannte n spöttische Bedütig vo n däm Bild z’g’seh n, wi dem witzige Maa n «der Schelm im Nacken sitze». Aber de r Heer r het’s rächt versta͜nde n, wi̦ll er gar wohl g’wüßt het, wi na̦a̦ch bi sị’m Frü̦nd G’spaß un d Eer nst bi ’nan͜dere n sịị n. 2 Un d e n halb wehmüetige’n Eerst isch es g’si̦i̦ n, wenn er es bár Ma̦l g’säit het: I ch glạube n, si̦ e bruuchi öppḁ glịị ch e n Ma̦ler im Himmel. Aber d’Fräüd a n däm het voorzooge n. Äini vo n sịne n Döchtere n het ĭhm für di chalte n Daagen es warm’s Schịlee (Weste) g’höögglet, wo n er über d’s Chrụ̈tz het chönnen ịị ndue n. Mit däm g’fräüte n Chläid, het er erklärt, well äär dee nn vor dem Vater Abraham sta̦a̦ n. A n süeßne n Frücht us dem Garte n het er abaartig wohl g’läbt; aber no ch besseri geeb es de nn im Paradịịs. Es G’schichtsweerk vo n mehrere n Bän͜d het er nịmme̥ hr Zịt g’fun͜de n z’leese n; aber im Paradịịs, da̦ häig er de nn Zịt g’nue g.
So het richtig dä r Maa n g’redt, wo n er «alt und lebenssatt» g’si̦i̦ n isch. Aber di Üsserunge n sị n e n seelische r Niderschlag vo n ’mene n höchst bedütsame n Zug i n sị’r Gäistesart: e̥-mene n wahre n Hunger u nt Durst na̦ ch G’stalt, na̦ ch grị̆ffbarer, sinne nfälliger G’stalt. So wi dem Böcklin siner Auge n na̦ ch Faarbb g’schraue n häi n, das s er anstatt Broo̥t Roo̥t g’chạuft het, für si ns Ma̦lerhụ̈ụ̈si z’Zürich über un d über aa nzfeerbbe n. Der Anker isch äini vo n dene n plastische n Nature n, wo müeße n g’see̥h n, was si e dänke n, u nd zäichne n, was si n g’see̥h n.
So erkläre n si ch di Müsterli vo n sịnen erste n Zäichnigskünste n. Als Terzianer z’Bern het er im Versteckte n d’Bilder vo n sịne n Lehrer uf d’Pfäisterschịịben ịị ng’chri̦tzt, u nd das ḁ lsó g’chenntlig (chennbḁr), das s mḁ n si het ụụsḁg’noo̥ n un d i n Blịị g’fasset. 3 Z’Halle het er uf den Umschleeg vo n de n Heft, wo n er d’ri̦n het d’Vortreeg vo n de n Theologie-Profässer nạạhḁ g’schri̦i̦be n, deene n’s Chöpf ’zäichnet, wịl das ihm min͜der het z’tüe n g’gee n, weder öppḁ z’schrịịbe n: Einleitung ins Neue Testament, oder dgl. ( dérigs Züüg, dér Gattig). Anstatt i n ’mene n Brieff z’längem u nd z’bräitem ụụsz’legge n, wi sị n P’hensionsmueter äini sịịg, het er si äi nfach hurti g ’zäichnet: «So sieht sie aus.» Als junge r Maa n het er das o ch öppḁ n äinisch im Unmuet oder im Übermuet g’macht. So äinisch a n’mene n G’sangfest z’Mu̦u̦rte n mit de n Kampfrichter, mit dene n sịner Männerchöörler nid häi n chönne n z’frịịde n sịị n. D’s Protokoll soll no ch iez dḁrvo n reede n.
380 Aber o ch i n Gedanke n het er si ch di Lụ̈t, wo n er von’ne n g’leese n oder wo n er g’studiert het, i n Lịịb u nd Seel u nd Gäist buechstäblich vor Auge g’ma̦lt. Sịịg’s, das s er mit wahrer Verehrung zue nnen ụụchḁ g’luegt häig, wi zum Chäiser Julian «dem Abtrünnigen» ( Apóstata); oder das s er mit wahrem Haß von’ne n g’redt häig, wie vom Ludwig XIV. — wo si ch doch am Hof vom «Sonnenkönig» hunderti vo n «Künstler» g’weermt häi n, ja̦ richtig als Schmarotzer uf Chöste n vom ụụsg’hungerete n Volk. Der Anker isch im Stand gsịị n, mitts i n’mene n ganz an͜dere n G’spreech blötzlich z’schwịịge n u nd na̦a̦chḁz’stụụne, u nd de nn uf äi ns-ma̦ls ganz vertraulich z’seege n: Ja̦ gääl let, oder: Seeget dier, der Ludwig isch doch e n schlächte n Kerli g’si̦i̦ n!
Dem lịịblichen Auge n u nd dem Gäistesạuge n het d’ Han͜d wunderbar g’folget u nd na̦a̦chḁg’hu̦lffe n, ụ nd das i n allne n Däile n. Der Anker het nid bloß ’zäichnet u nd g’ma̦lt, was er du zwa̦r (allerdings) zu sị’m Lebe nsberueff g’macht het. Är het o ch chönne n model liere n. E n großi Aa nregung dḁrzue het er bi sị’m Vetter z’Bern überchoo̥ n: dem Profässo̥r ( S. 359 ff.). Dem sị n Chnächt: der Wüeterich (Wüthrich), het ḁ lsó g’schickt Beere n (Bären) g’modelliert, wi nụmmḁ n no ch dä r gäiste nsschwach Gottfried Mind (1768-1814), der «Katzen-Raphael», si nebe n de n Chatze n het chönne n ma̦le n. De r Wüetrich het si ch dụ z’Bern als Beere nweerter g’mäldet un d isch nid aa ngnoo̥ n worte n; us Gram dḁd’rüber isch de r arm brav Mönsch i n d’Aar g’sprunge n. Der Maler Anker het si’r Lebe n lang mit Liebi von ĭhm g’redt.
Er het sü̦sch no ch mängs chönne n, der Mäister Anker. Tĭ̦fig u nd gläitig, wi n er isch g’si̦i̦ n, het er im Wink us dem erste n beste n Chneebeli e n Binsel g’schnätzet g’haa n. Er het ’buechbin͜deret. Er het sịner Mäidschi g’lee̥hrt brodiere n u nd ’ne n Muster dḁrfü̦r ’zäichnet. Är het am Rad vo n si’r Mueter g’spunne n; u nd sịner Töchtere n häi n ḁ lsó n e n Fräüd dḁdraa n überchoo̥ n, daß si o ch, wi n eer, ganz e n schöne n glịịchlige n, guet ’drääijte n Fade n häi n z’weegbra̦a̦cht. Er isch zu ’mene n früsch ịị nzogne n Wagner ga̦ n wagnere n u nd zu ’mene n Zimmermaa n ga̦ n zimmere n u nd het das ḁ lsó tĭ̦fig fü̦ü̦rgnoo̥ n ( il s’y est si habilement pris), daß si g’mäint häi n, er sịịg, was si̦i̦ e. U nd wettigi Fräüd het är g’haa n, sịne n Seeländer zuez’luege n bi’m määije n ( S. 316) u nd bi allnen an͜deren Arbäiten uf dem Fäll d! Und handchehrum het er e̥mene n Notar e n faltschi Un͜derschrift na̦a̦chḁg’wi̦i̦se n.
1
Matth. 6. 25 ff.
2
Man denke an religiöse Genies wie Luther, Franke, Spurgeon.
3
Rytz 3.
Settige Berueff u nd Rueff zu ’mene n Künstler! U nd doch isch er erst i n de n spöötere n Jünglingsja̦hr dḁrzue choo̥ n, ’s z’werte n. Groo̥ßi üsseri Hinderniß sịn ihm im Weeg g’stan͜de n.
381 Der Albrächt het solle n Pfar rer werte n am Platz vo n sịm eltere n Brueder Ruodolf, wo läider 1848 als nụ̈ụ̈nzeechejehrige r Theologie-Studänt het müesse n steerbbe n. Der Albrächt het nḁ höo̥ch in Ee̥hre n ghaa n. Dee r isch meh g’sịị n weder mier alli! het er a̦lbe n g’säit. Nu̦mmḁ n scho n us der Verehrung, u nd de nn für zum Gfalle n u nd dem häilige Wunsch vom Vater z’lieb, het er z’Halle u nd z’Bern flị̆ßig Pfar rer g’studiert bis na̦a̦ch a n d’s Staatsexame n zụụchḁ.
Du̦ zäigt sich du̦, was e n gschịịde n Profässer isch u nd chaa nn, wo sịner Studänte n g’chennt u nd schetzt. Der Karl Wyß z’Bern.
Vor däm het der Anker solle n über ’ne n Seligprịịsung 1 bredige n. Guet, er isch grad mit der ganze n Bergbredig i n’s Zụ̈ụ̈g u nd het, für mit der ganze n Macht loosz’gee n, sich in ĭhre n Schauplatz ịịchḁ ’dänkt. Das het e n Schilderung g’gee n ḁ lsó anschaulich un d ḁ lsó faarbbe nrịịch, das s ma n Jesus i n sị’r ganze n traditionelle n G’stalt uf dem Berg u nd di tụụsigchöpfigi Schaar d’run͜der zụụchḁ mit ihrne verschidenen Arte n z’loose n oder nid z’loose n förmlich u nd lịịbhaftig het vor sine n Auge n g’seh n sta̦a̦ n. Dḁrmit isch richtig d’Halbstun͜d ummḁ ’gange n wi ne n Minute n, u nd von ’ere n Bredig isch käi n Reed meh g’si̦i̦ n.
Der Anker überchunnt d’s nööchst Ma̦l en an͜deri Seligprịịsung zum T’hägst. Ummḁ d’s glịịche n: der Schauplatz wo mügli ch no ch anschaulicher, no ch faarbbiger, no ch g’stalte nrịịcher; aber von e̥re n Bredig chụụm es Stü̦mpeli.
Jez wäiß der Profässer z’vollem, was Gattigs. «Ja, mein lieber Herr Anker, das war auch heute keine Predigt, das ist ja wieder lauter Malerei! Mir ist, Sie würden, statt Pfarrer, besser Maler.» «‹Das we lltt i ch öppḁ geern, Herr Profässer! aber›» ...
U nd das «Aber» isch zur Erlụ̈terig choo̥ n i n der Studierstube n vom Profässer, U nd dee r la̦a̦t aa nspanne n u nd fahrt u̦f dem Wöögeli stracks uf Eiß zue zum Pfar rer Lụ̈thard. Dört hin͜der dem Pfar rhụụs uf dem Bänkli un͜der däm Chestele nbạum, wo nach Ankers dankbarem Bild de r würdig alt Heer r ( S. 171) über dem zauberhaften Ụụsschnitt vom Moos u nd Neue nburgersee dem «Sunnenun͜dergang» zueluegt: dört isch der Plan g’schmi̦i̦det worte n, wi di Festi vom väterliche n Zuekunftsideal chönn belageret werte n.
Si häi n wohl gwüßt, das s ’nen e n schwee̥ri Arbält voorständs isch (daß si e n schweeri Arbäit vorständs häi n). Es wird no Mụ̈ụ̈s haa n! Allweeg wohl; du mịni Güeti (du mịn Ggott)! Es aläinzigs lätzes Wort, u nd di ganzi Mụsig gäit z’nụ̈ụ̈te n.
382 Nu n, si gangen ämmel zum Vatter Anker u nd probiere n’s. G’haarzet hét das richtig! Der Vatter het z’erst käi n Wank welle n tue n (nụ̈ụ̈d drum tue n). Aber di Manne n häi n nid lu̦gg g’la̦a̦ n, bis si na̦ chtina̦a̦ ch ’nḁ häi n vorummḁ ’brạạcht u nd bis alls stịịff fü̦ü̦rg’gangen isch, u nd bis si e häi n chönne n seege n: Jez het’s i ns f rei e n chläi n g’wohlet!
Jää, dänk mḁ n! Zwoo̥ fi̦ndlich Mächt, weel chi gröo̥ßer, weel chi erhabener, weel chi edler! si n i n hertem Aa npụtsch uf enan͜dere n gstooße n: Vernunft u nd Liebi. D’Vernunft, wo das häilig Rächt vom frei g’wehlte n Lebe nsberueff uf de n Lụ̈ụ̈chter stellt, u nd d’Liebi, wo d’s unerfahren Chin͜d vor Mißgriff un d Entgleisung will bewahre n. Uf dä n Lieblingswunsch, daß der äinzig über’bli̦i̦ben Suhn am Platz vom g’storbbne n Pfar rer werti, hätt der Vatter öppḁ no ch grád äinisch mit großer Seel verzichtet. Aber daß der Suhn, der äinzig, un͜der das «liechtleebig», wenn nid «liederlig» Chünstlervölkli müeß, das het dem Vatterheerz nid ịịchḁ welle n! Nehm mḁn aa n: in ere n Zịt, wo o ch ganz gschịịdi Manne n d’Ma̦ler u nd d’Schauspi̦i̦ler in äi ns Ban͜d gnoo̥ n häi n, u nd wo vo n denen ohni Staatshülf ganz uf si e sälber gstellte n Kunstjünger chụụm äine r vo n hundert uf ene n grüene n Zwäig choo̥ n isch: da̦ hätt iez das müejsam furtg’eerbte n un d uf d’Hööhi ’bra̦a̦chten Ankerhäi m ummḁ sollen in alli Lüft verflaadere n! U nd der guet Anker-Name n dḁrmit!
Mier verstan͜de n der Vatter Anker. Un d um so höo̥her schetze n me̥r’s an ĭhm, daß i n däm gewaltige n Kampf zwüsche n Liebi u nd Vernunft der Glạube n u nd d’s Vertraue n i’ n Genius vo n sị’m Suhn het oberi Han͜d g’wunne n. Dee nweeg het är der Wält äine n vo n de n bode nständigste n, volkstümlichste n, solịdiste n, charakterfestiste n u nd charaktervollste n Künstler g’schänkt.
Das s er ’nḁ du̦ z’Paris als Maler-Lehrbueb knapp bi Mittle n g’haa n het, für das s er im «Seine-Babel» nid über d’Stange n schlööij, das s er nid d’s Gält verlaborier u nd vergänggeli u nd d’Zịt verplämpeli: das het der Albrächt als Geege nrächt u nd zuglịịch als stränge n Liebesbewịịs vom Vatter si ch gern u nd mit frohem Muet la̦ n gfalle n. Er het das o ch um so mee̥h chönne n, wi̦l sị n herzgueti Tante n, di zwäüti Frau vom Unggle n Rudolf, di geborni Dardel, ihm e n müeterlichi Frü̦ndi isch g’si̦i̦ n.
1
Matth. 5, 3 ff.
Bi’m Wa adtländer Charles Gleyre z’Paris (1806-1874) 1 u nd i n der dörtigen École des Beaux-Arts het der Anker g’lehrt zäichne n u nd 383 komponiere n (zwüsche’m Grundgedanke n vom Bild u nd den äinzelne n Figuren e n strängi Äinhäit hee̥rstelle n). Mit bee̥dne n Sache n het’s der Jünger wi der Mäister sträng g’noo̥ n. Das wird allgemäin anerchennt, un d Äinzelhäite n wi di Handstudie n i n Ankers groo̥ße Schgịzze nbüecher bewịịse ns no ch äxtra. Daß der Anker aber o ch im feerbbe n zur Mäisterschaft g’langet isch, zäigt b’sun͜ders di wundervolli Belüchtung i n der «Bụụre nstube n».
Nu n, an͜deri chönne n das v’li̦cht no ch besser. Aber im Gäist vo n der Malerei, du̦nkt ’s äim, chööm nid hurti g äine r dem Anker na̦a̦ ch. Mḁ n möcht seege n, är zäichni nid Modäll, är zäichni Möntsche n. Bi de n Pŏ́rteree 2 vo n an͜dere n Künstler g’seht mḁ n, das s iez da̦ ’zäichnet u nd g’ma̦a̦le n worten isch; bim Anker isch es äim schier, si̦ n sịgi ohni di schwerfälligi Vermittlung vom Rịịßblịị u nd vom Bänsel u nd vo n de n g’machte n Farbbe n (wo doch äigentlich im Verglịịch mit de n natürliche n nu̦mmḁ n Dräck sịị n) grad ḁ lsó us dem Gäist vom Ma̦ler uf d’Lịịnwand ü̦berḁ ’zauberet worte n, der Ma̦ler wüß sälber nid wie. Öppis vo n söttiger Genialiteet isch o ch us dem Anker ụụsḁ g’sprudlet, wo n er uf die Fra̦a̦g, wi n er’s doch o ch fü̦ü̦rnehm, so schöni Bilder z’mache n, g’antwortet het: He, mḁ n luegt d’Sach afḁ rächt guet aa n; u nd darna̦a̦che̥rt (abgekürzt: darnótt), so wi si isch, so zäichnet mḁ n si dee nn. 3
Nu, söttigi Unmittelbarkäit erzi̦i̦lt zwa̦r d’Fortograffịị so vo n ’mene n rächte n Glụ̈ụ̈ßi oo ch; u nd b’sun͜ders iez no ch die faarbbigi, wi si̦ e der Franz Rohr cha nn. Aber der Anker het eebe n just nid welle n photographiere n. So piinlich g’naau das s er ’zäichnet het un d a n ’mene n Chrụụsel käi ns Hööreli (Häärchen) vergässe n: er het doch d’Zü̦ü̦g vo n sịne n Modäll ụụsḁg’leese n u nd zu däm Charakterbild z’seeme ng’stellt, wo n eer si ch het voorg’noo̥ n g’haa n. Der Anker isch Charakterma̦ler.
Drum isch da̦ u nd dört öpper, wo si ch bi däm berüehmte n Maa n abso̥lut o ch het welle n la̦ n mache n, mit dem Bild nid rächt z’fri̦i̦de n g’si̦i̦ n. Soll das mi̦i̦ ch sịị n? Das isch doch nid mi̦i̦ ch! D’s Bild glịịchlet me̥r ja̦ schoo̥ n; d’s G’sụ̈ụ̈n weer es no ch; aber ich bi n doch nid so alt! So un d an͜ders het’s de nn öppḁ g’häiße n, wenn d’s Ankerbild u nd d’s Spiegelbild e n chläi überéggs choo̥ n sịị n. Uf söttigi Porteree im g’wöhnliche n Sinn het er si ch o ch gäng weniger ịị ngla̦a̦ n. Dḁrfü̦r het er Lụ̈t, wo n ĭhm interessant vorchoo̥ n sịị n, gäng u nd ggäng ummḁ n ĭhm mache n z’hocke n. Wer i n däm hundertfränkigen Ankeralbum 4 384 äi n Heliogravüren um die an͜deri aa nluegt, oder nu̦mma n scho n i n der illustrierte n Gotthelf-Ụụsga̦a̦b, oder i n der Schwịzerg’schicht vom Sutz 5 bletteret, rüeft uf den erste n Blick: eh, das isch ja̦ dee r u nt dee r! Da̦ der «Zinsheer r» isch der Notar Sigri, u nd der Mälcher Peter im Beere n isch der Schuldner, wo zahlt. D’Frau Heß täilt «d’Arme nsuppen» ụụs, u nd d’s Ni̦ggi Elịịs isch als di lieplichi «Schwester» i n der «Krippe» ụụf- (oder aab-) g’figụ̈ụ̈rt. Der Leue nberger isch Pfahlbauer un d isch Zụ̈ụ̈ge n im «Ehekontrakt»; un d es Mäitschi von ĭhm wirt im schrịịbe n vom jüngere n Schwesterli «g’stöört» usw.
E n wahre r Verwandlungskünstler isch der Luftschlosser g’si̦i̦’ n: der Vatter vom früech g’storbbne n Luftschuester oder Lufter, wo wi der Luftsattler gäng i n der Luft g’si̦i̦ n isch; das wott seege n, si häigi’s im tue n u nd reede n gäng i n der Ịịl gnoo̥ n, das s weni g guets dḁrbịị sịg ụụsa choo̥ n. Dä r guet alt «Luftschlosser» het dä n Naame n nid verdienet. Är isch e n flị̆ßige r un d e n g’schickte r Maa n g’si̦i̦ n, wo in Amerika z’erst als Uhrimacher u nd dụ als Schlossermekaniker sị ns Broo̥t verdienet u nd z’lĕtzt da̦häim als Fịsịggeler de n Lụ̈t g’fịsịggelet 6 het; är het ’nen alli mügliche n Sache n z’weeg- oder ummḁ g’macht. Nu n, de r Maa n mit sịm wunderfịịne n G’sicht u nd dene n elastische n Zü̦ü̦g het der Anker abaarti guet chönne n brụụche n. Er het ’nḁ für de n «Lavater» gnoo̥ n. Er het ’nḁ la̦ n «Großvaters Andacht» fịịre n. Er het ’nḁ n als «vereinsamte n» Greis g’macht d’Gaffẹmühlli z’drääije n. Er het in ihm d’s rächt Modäll erli̦ckt für de n Fallstaff. Er het ’nḁ n o ch als Zụ̈ụ̈gen aa ngrüeft im «Ehekontrakt».
De r Bueb, wo dem andächtige n «Großvater» vorli̦st, isch der Gasche n Xanderli: «ụ̈se Her r Verwalter» ( S. 341), wo der Familien Anker i n Hụụs u nd Garten u nd Dorf aller Gattig Dienste n het g’läistet. Der Inschi̦nöör Widmer het o ch so n e n dienstbare n Gäist g’haa: der Fäldmässer z’Si̦i̦sele n. — An͜deri Neeme n tööne n hingege n öppḁ wi Băbi Rüedels Lịịsi, wi dee r u nd tee r Jaako̥b oder Mäxel, wi der Lụggi (Ludwig) oder d’s Lụggi (Luise, d’s Lịịsli), der Mịggi (Emil) oder d’s Mịggi (Maria); oder us der Zit, wo alls zwöo̥ Neeme n g’ha n het: d’s Ammarei (Anna Maria). I n der Täubi säit mḁ n däm de nn richtig d’Amarolle n; u nd das mahnet scho n chläi n a’ n Ri̦ggi Pu̦mmer, oder de nn a n d’s Breemen-Elsi, wo bi allem reede n gäng ḁ lsó g’schnu̦u̦r ret oder b’brummlet het, oder a n Sprịng-Sammi, wo gäng i n de n Sätz g’si̦i̦ n isch. Die schi̦i̦nen umma der «Luftschuester» z’eefere n (zu wiederholen).
1
Bruns Künstlerlexikon I, 593-5. Vgl. «Ein Äffchen als Lebensretter» im «Berner Heim» 1910, Nr. 29.
2
Im weitesten Sinn: Gemälde. Im Ursinn: das herausstudierte, «hervorgezogene» (
pro-tactum, por-traict, por-trait) Gesamtbild der Gesichtszüge eines Menschen.
3
Vgl. den Bergführer als genialen Pfadfinder:
Gw. 26.
4
Verlag Zahn.
5
Ebd.
6
Erinnert an die Ausdrücke im
schwz. Id. 1, 1078 f.

Gemalt von R. Münger.
Lina Blank
17 jährig
Nu n, di ganzi Art, wi der Anker g’schaffet het, u nd dä r erstụụnlich Rịịchtum, wo n er g’schaffe n het (siehe die folgenden Abschnitte), häin ihm e n Volkstümlichkäit ịị nträit, wo n eer gar nid erwartet u nd nid g’suecht het. Bi an͜dere n Bilder vo n unzwịịfelhaft große n Mäister, a n die der redlich un d ụụfg’weckt Maa n wegen ĭhrem sichtbare n Flị̆ß mit Respäkt ụụchḁ luegt, het’s scho n öppḁ g’häiße n: Es isch mị n Seel schöo̥n, aber i ch cha nn’s nid verpu̦tze n! Oder mḁ n het’s, wi äiner Töchterli, dere n’s Mueter als e n gueti Chöchi äinisch öppis ganz abaartigs het uf de n Tisch g’stellt. Da̦ häi n si g’chü̦stet un d e n chläi n d’s Mụ̈ụ̈li verzooge n u nd dḁrzue heerzliebi, süeßi Äügli g’macht u nd g’säit: O Mueti, es isch rächt, rächt guet g’si̦i̦ n, aber mach ämmel ni̦mme̥ hr mee̥h dḁrvoo̥ n!
Was der Anker nid us pụụrer sụụrer Verpflichtung ungern g’schaffet het, das ma g ma n gäng luege n; u nd mi luegt’s lang u nd cha nn chụụm dḁrvoo n, wi̦l mḁ n so uf der Stell verstäit, was es isch, u nd wi̦l es äi’m so vi̦ll, vi̦ll säit.
Das het grad der erst Verleger vo n sịne n Werk: der Goupil z’Paris, a n de n «Blaaustrümpf» un d a n de n «Bụrbaki» (von 1871) un d a n der «Pfahlbauere n» zu sị’m u nd zu Ankers Glück zur Gältung ’bra̦a̦cht. Und glịị ch na̦ ch’m Tod vom Mäister häi n di Ụụsstellige n z’Neue nburg (1.-30. November 1910) u nd z’Bern (15. Januar bis 15. Februar 1911) u nd z’Zürich (7. Mai bis 5. Juni 1911) 1 bewi̦i̦se n, wie «Kunst Gunst bringt» und «das Volk seine Idealisten liebt.» 2
Nachhaltiger häi n zwa̦r Zịtige n u nd b’sun͜ders Zịtschrifte n g’würkt. 3 Aber nụ̈ụ̈d gäit über di Art, wi mit Hülf vom «Säemann» u nd vo n der Wanderụụsstellig vo n 260 religiöse n Bilder iezen n o ch vier prächtigi Ankerbilder di schụụrig schöne n Mämmi a n der Wan͜d u nd di Album-Mämmi (Helge n, Buechzäiche n) uf dem Tisch 4 mit dem Kunstwert vo n de n Bilder uf dem Mämmi-Schịggeree aa nfange n verdränge n.
U nd das s i n de n Zälle n vo n de n Stra̦a̦ffanstalte n das eernste n schwịịgen am Sunndḁ g dür ch das stille n reede n vom Mensche nfründ Anker verkleert wird, fräüt äin’ oo ch.
Mḁ n verlangt ja̦ doch vom Künstler, «daß uns seine Werke freudiger, größer und besser machen», 5 u nd vo n der Kunst, daß si ụ̈ụ̈s daas bring, 386 was i ns d’s Leebe n versäit: Harmonii zwüsche n de n Seele nchreft, wo im Kampf für Broo̥t u nd Ee̥hr ḁ lsó us enan͜dere n ’zerrt u nd g’risse n werte n.
Wer ụ̈ụ̈s, we nn mier’s nöötig häi n u nd mögen u nd müeße n loose n, am mäisten u nd d’s beste n säit: dee r isch ụ̈ụ̈s di wahri Autorität, u nd wen n er’s e̥käim an͜dere n Möntsch weer.
1
Diese besonders reichhaltig und erschöpfend.
2
Wahlspruch des jüngern Bitzius.
3
So die Anker-Nummer der «Schweiz» mit dem schönen Aufsatz von Albert Geßler in Basel; die Schweizer Familie; das «Sonnt.-Bl.d. Schweizerbauer».
4
Vgl. Schweizerdorf 1911, 285 ff.
5
Weltchronik 1912, 21.
Innerhalb seines weise umgrenzten Arbeitsfeldes entfaltet Anker eine so erstaunliche Mannigfaltigkeit persönlicher Charakterbilder, daß wir bloß eine kleine Auswahl solcher in das folgende Thema einordnen können.
Achten mir zunächst auf Einzelheiten des Leibesäußern. Da fällt uns vor allem die ansehnliche Leibesgröße und die Wohlgestalt recht vieler halbwüchsiger Bueben u nd Mäitli ins Auge. Sie liefern einen großen Beitrag zum Nachweise, daß dank der vielfach verbesserten Lebenshaltung d’Schwịzer groo̥ße n. (Im letzten Jahrzehnt durchschnittlich um 2 cm.) Gewiß fehlt auch heute weder der kleine, dicke Chnü̦ü̦rbs, der Drụ̈ụ̈ Määs Chrü̦ü̦sch höo̥ch, der Rụ̆́mpị̆ser, noch die «Knirpsin»: der Pfu̦mpf und der Fu̦nggel, das Pfu̦mpfli und das Fu̦nggeli. Noch leben das häßlich magere, alte Schi̦i̦rbbi, das Brächche nschịtt, die Schịntelle n (Kartoffelschale), wie ungekehrt die Bieße n oder die Bü̦tti als unförmlich dickes Weibsbild fort. Allein, sie finden ihr Gegenbild im Länge n und in der Länge n ( S. 323), im Ggaali und Gaabli. Eine unebenmäßig Gewachsene ist e n Ha̦a̦gge n, es Hu̦u̦schi, e n Chrü̦mchel, e n Gnauggel, e n Chru̦tze n. Ein allzu höo̥ch G’schoßne r, ungeschlacht Langer heißt der Gịịbi, eine Überschlanke der Schwane nhals. Von einem verstorbenen Durni sagt man: Mi hätt’nḁ chönne n chnü̦pfe n (durch Abschnürung zwöo̥ us ihm mache n). Auch an Männern mit kräftigem Mu̦ggel (Wulst) am Oberarm, der von g’eederiger (sehniger) Konstitution zeugt, fehlt es nicht.
Die Größe der Gestalt hängt, wie der Maler weiß, an der Lengi oder Chü̦ü̦rzi der Bäi n oder altseeländisch: Schäiche n, Scheiche n. Sie kommt in Betracht bei der Ausgiebigkeit des gaa n oder lạuffe n; des laufen oder springe n; des springen oder gu̦mpe n, satze n; des kindlichen pföösele n, na̦a̦chḁhümpele n, des gra̦a̦gge n und schna̦a̦gge n uf allne n Viere n; des täppisch und läppisch uf öppis 387 ummḁ tschalpe n und des schwerfällig den Fuß aufsetzenden trappe n oder chniepe n, sowie des gegenteilig behenden chleebere n (klettern).
Wie das stü̦pfe n mit dem Fueß und das mü̦pfe n (e n Mụpf oder es Mü̦pfli gee n) mit den Ellboge n («boxe n») der Brutalität dient, wie bänggle n oder schieße n dem kunstgerecht geworfenen Fußball oder dem vo n Han͜d geschleuderten Stein gilt, so ist der unverkümmerte Zeefe n (die Zehe, der Zeeije n) des barfuß Gehenden immer noch der Prototyp der zu wunderbarer Kunstfertigkeit und Ausdauer berufenen Fingere n.
Das konstantiert stärkere Wachstum des lingge n Bäi n und des rächten Arms beruht (wie dasjenige des dem Sprachzentrum benachbarten linggen Ohre n) auf dem vermehrten Gebrauch der also bevorzugten Glieder. Charakteristische Ausnahmen zeigt die Linkshändigkeit nicht weniger Seeländer, die bi’r lingge n Han͜d sịị n oder i n lingg sịị n, Linggi sịị n, i n lingg ässe n usw. statt bi’r rächte n Han͜d oder i n rächt, i n rächts. So ißt in der « Krippe» eine Kleine sehr geschickt i n lingg, ohne wie ein anderes, rechtshändiges, uf d’s Mänte̥lli z’leere n. Gleichwohl findet sie ihre Kleinmeisterin, welche sie zu veranlassen sucht, d’s schöo̥ne Hän͜dli z’brụụche n. Aus den Jahren 1655, 1667, 1736 begegnen uns Hans Weber und Hans Baudritsch der Lingg, 1671 aber einfach: der Lingg, 1811: «lings Rüdey» ( Lingg’s Rüedi). Also ein guter Beitrag an die 2% linkshändiger Europäer; zugleich eine Mahnung, nach dem Beispiel intelligenter Naturvölker beide Hände zu gleicher Gwaanig zu erziehen. Auch bei zweihändiger Arbeit sind viele Seeländer lingg, d. h. die als Führerin des Werkholzes vorn an demselben angreifende Hand ist die linke. Und da wird mit Stolz behauptet:
Di Lingge
n sị
n die Flingge
n;
Di Rächte
n sị
n di Schlächte
n.
Dem Anker het’s nụ̈ụ̈d so guet chönne n wi «Haarstudien». Zu solchen leitete er gewissermaßen auch seine Kinder an, wenn er im Spiel mit ihnen sị ns Ha̦a̦r rächt wüest verchụtzet het, es g’hụụrsch, «hursch» 1 (zerzaust) oder zu einem G’hu̦u̦rsch g’macht, es verhu̦u̦rschet oder verhü̦ü̦rschet (s̆s̆) het, es zu einem Tschụppi oder Tschụ̈ppli («Hu̦ppi») ụụfg’strụ̈ụ̈ßt het, damit sie es zuerst mit dem Strehl, d. h. der weitzahnigen Seite des Doppelkamms, und alsdann mit dem Räine n (der engzahnigen Seite) desselben, auch der Kläiber 2 oder der Lụụser geheißen, wieder in Ordnung bringen. Solches strehle n mit dem Strehl (jetzt svw. Kamm), gefolgt von 388 schließlichem, bü̦ü̦rste n, vollzogen die Kleinen denn auch so gründlich, daß er sie bitten mußte, si söllen ihm nid Löcher i’ n Chopf mache n.
Für die Malerei aber bevorzugte Anker sichtlich die blu̦nde n Ha̦a̦r der Mehlschägge n u nd zwar ganz besonders an wị̆ßha̦arige n Chin͜d, doch auch an rötlich-blonden. Daß er nicht nach landläufigem Urteil die Roo̥tha̦a̦rige n oder Rottannige n für böo̥s (zornmütig) 3 gehalten, beweist er durch die Aufnahme ( Ụụffassig) eines solchen in die «Krippe». Ebenso wenig stimmte er in die Verurteilung der sommersprossigen Buntschägge n ein. Wie sehr aber mußte der Reiz der fliegenden Haare und der hängenden Trü̦tsche n (Zöpfe) unerwachsener Mädchen ihn anspornen ( aa nheerig mache n)! Nid ụụfbun͜de n trägt die Zöpfe denn auch eine Eignerin prächtiger Chrụụsle n, Chrụ̈ụ̈seli, Chrụụselha̦a̦r, der « Krauskopf», Chrụụselchopf, das Chrụụselgrin͜dli. In diesem will ein Andenken an den alte n Chrụụsi oder den Grụụsi Schnü̦pf als einstiges Verwandtenkind gesucht werden. Verwandt war unserm Anker insbesondere der Schmi̦i̦d Chrụụsi mit dem in seiner Familie fortgeerbten ganz g’ringlete n Ha̦a̦r: den überhaupt bei alten Seeländern beliebten Hắrlocke n.
Aus Ankers Bildern ersieht man dagegen nicht, wie der «Spịịrifäcke nschnauz», 4 «wi zweu Ratte nschwänzli wit uber d’Backen u̦ụsa z’säme ng’wichset», 5 dem dritte n Napolion na̦a̦chḁg’gịịget worten isch. Solche Na̦a̦chḁgịịgete n trug sich nachmals auf den « Bolzgradụụf vom dụ̈ụ̈tsche n Chäiser» 6 über. Wer als junger Fant in solcher Erobererrüstung ein Bild von Anker gefordert hätte, wäre einer empfindlichen Abweisung, vielleicht unter barschem aa nschnauze n, sicher gewesen. Überhaupt weiß man ja, wie der isolierte Schnurrbart und vollends der obsig drääijt Schnauz, sowie das aus ersten Flaumhaaren z’weeg’bra̦a̦cht Schnäüzli (Niklaus Manuels «Knebelbart») noch vor einem Menschenalter als widerwärtig angesehen wurde. Als ältern Mann aber ließ Anker sich doch von Paul Robert nach einer Photographie mit Schnauz- und Kinnbart zeichnen; und unleugbar erhält der in « Andacht» versunkene Kapuziner erst recht durch das «Patriarchengewächs» seine volle Würde. Seine Bauern dagegen fahren in hergebrachter Weise fort, si ch sälber z’rassiere n. 7 So bringen sie unbewußt, wie der «Luftschlosser» ( S. 384) unfreiwillig, alle die seinen Abschattungen der Gesichtszüge und des Mienenspiels zur Darstellung, 390 welche der Männerbart und der Frauenhut verhüllen. Der heutige freie Bauernstand übt mit dieser Blutlosigkeit auch ein unbewußtes stolzes ụụfleese n des Sklavenzeichens ihrer unfreien Vorfahren.

Studie von Anker
Zu den Kriegsmitteln der ersten Alemannenzüge hatte nämlich auch dieses gehört, durch wild’s drị ng’seh n den Feinden Furcht einzuflößen. Zu diesem Zwecke banden sie ihre Haare zu einem Chnopf uf der rächte n Sịte n. 8 Diese zur Tracht erwachsende Manie und Manier setzte sich nachmals fort in den langha̦a̦rige n Adelige n, in der «Bartfreundlichkeit» der katholischen Kirche, insbesondere der Klostergeistlichkeit, und im Schnauz der Franken. 9 Der Unfreie aber mußte zur äußern Unterscheidung kurzhaarig und bartlos daharchoo̥ n. 10
Wie d’s Ohre n, sagt man im ganzen Erlacheramt (außer in Tr., Fh., Si., Tsch.), sowie in und um Twann d’s Auge n (ạ-). Dieses Organ, das bei allen im Freien sich tummelnden Landleuten ohne das Übel der chu̦u̦rze n G’sicht trefflich wị̆tems (in die Ferne) und n̦a̦ach g’seht, erwahrt und bewährt sich nirgends wie bei Ankers Kindergesichtern als der «Spiegel der Seele». Welch herzerfreuender Gegensatz zu der G’sicht des Greisen, der vor Elti (1691: Älte) käi ns Äügli voll cha nn schla̦a̦ffe n, die häiteri Luegi dieser Kleinen, die bei tausendfältiger Art ihrer Seelenstimmung so fröhlich offen i n d’Wält ụụsḁ luege n. 11 Als feiner Beobachter zeichnete Anker unter den um die « tote Freundin» ( S. 362) Trauernden einen Kleinen, der noch mit de n Fingere n luegt oder g’schạuet. Wie offen dieser Blick spanịịflet (aus- und umschaut) im Gegensatze zum versteckten glụ̈ụ̈ßle n, fü̦ü̦ra glụ̈ụ̈ßle n und dem Aug und Ohr gleicherweise betätigenden lụụße n, dem vom offenen Mund begleiteten gäüe n oder güije n!
Ohne die Seitenblicke, mit welchen Schielende oder aber Neidische jemand oder etwas nach Basler Sprache «aa nschääre n», g’see̥h n (1587, gesechen) 12 Ankers Kinder klar und scharf. Welch ein Gegensatz zu den halb erloschenen Augen der ihr «hohes Alter» schmerzlich empfindenden Frau am Kohlenbecken! Aber auch zu den bebrillten Kleinen und Großen, deren «Spiegel der Seele» durch den Spiegel, Augspiegel oder nun häufiger, die Brü̦lle n Umhänge vorgesteckt erhält, wie die Fenster als die Augen des Hauses!
391 Welche seelischen Eigenschaften dieser Spiegel verhüllen kann, zeigen die schmalen Lippen ( Läspi) des « Herrn Gemeindschreibers» mit der zwischen sie gekniffenen Gense nfeedere n. Seine gesamte Geistesverfassung zeigt auch, daß der Mann keinen Grund hat, etwa aus finanziellen Sorgen d’s Läspi la̦ n z’hange n. 13 Eher mag das Studium eines schwierigen und wichtigen Briefs ihn veranlassen, selbstvergessen e n Bampel z’mache n oder nach der Art eines leidenschaftlichen Pfeifenrauchers der Lätsch la̦ n z’hange n wi n es alts Roß — wenn nicht gar wie der Sụrnĭ̦bel, der Choldermaa n oder wie das schmollende Kind d’Mạuggere n z’mache n, oder e n Schaare nbank ( char à banc) oder e n Plämpel.
Kehren wir aber zurück zu den heerzige n Chrottli der Ankerschen Kinderwelt mit ihren durch kein Aa nmaal (Narbe) verunzierten, anmutigen Göscheli (s̆s̆) oder G’freesli (Gesichtchen), deren kein einziges das bloße Zịịf ferblatt einer nichtssagenden Dutzendschönheit ist. Wie kann so n es Mụ̈ụ̈li, nu̦mmḁ n so n es He rtppeeri, anreizen, ein Mụ̈ụ̈li, 14 der ältern Sprache: ein Mü̦ntschi ( os-culum) aufzudrücken: das Kind herzhaft z’mụ̈ntschle n! Wir vermeiden es auch dem Original gegenüber mit der nämlichen Zurückhaltung, welche Anker und Gotthelf, die Maler mit Pinsel und Feder, so streng und darum im einmal gegebenen Fall so wirksam beobachtet haben. Wir können ohnedies unser Wohlgefallen bezeugen an den, über der blutroten Bi̦llere n lächelnd gezeigten ersten Mụ̈ụ̈se nzän͜dli ( la ratta) oder am Lachen eines Vierjährigen, der Zän͜d het wi n e n junge r Hun͜d. Dieses Bild wendete einst Anker selbst in einer Schulkommissionssitzung überraschend an. Es war eine Lehrerin zu wählen, und man war lange unschlüssig, welcher von den vielen vortrefflich empfohlenen Bewerberinnen der Vorzug zu geben sei. Endlich entschied unser Maler: Eh, mier nehmen ieze n d’Jumpfer Tröösch; die het es Bi̦i̦s wi n e n junge r Hun͜d! So der Mann, dem Eifer u nd Verständnis für die Schule in gleich hohem Maße eignete, und der lange an sich zu halten pflegte, bevor er seine Meinung oder seinen Gemütsausdruck het vor d’Zän͜d ụụsa g’la̦a̦ n. Die Gelegenheit, sich an schönem Gebiß zu erfreuen, ist freilich nicht immer da. Taub (zornig) oder ertaubet (erzürnt) kann schon der Kleine ganz schreckhaft äim’ aa nzänne n. Zän͜dliweh kann als der erste trübe Gast einkehren. Oder aber der Nụ̈ggel, Lu̦lli, Lu̦llizapfe n, 392 Lü̦ller ( lolet, paton) legt sich als Hängeschloß vor den Mund, wie später die Läbchüechli oder Schoggelḁdeefeli, besonders freilich der Schogge̥laagaffee, welche Kostbarkeiten Anker seinen kleinen Modellen als Zugabe zum Sitzungsgeld spendete. Kinder dagegen, welche gähnen, gi̦i̦ne n, 15 die miechi de nn en an͜deri Fratze n, welche keinen Anker anzog. Si miechi e n lätzi Gattig.
Um so charakteristischer erschienen unserm Maler d’s Chi̦nni, zumal das mit dem Dü̦mpfi zu zweu Chinni geteilte, und ganz besonders d’Naase n. Allerdings gefielen ihm gleich wenig das zum ernääsle n kleiner Geheimnisse vorgestreckte Naase nbeeri, das «schnüpfisch» 16 wie zum schnüpfe n, zum vollatmigen schnụppe n oder zum erschnụppere n eines Wohlgeruchs g’rümpfet Neesli und die bei Großen an ihm sichtbare Verschmitztheit, welche den Vertrauensseligen «an der Nasen vmbher zieht» (1670). Was sagt überhaupt nicht alles die Nase! Sie verrät scho n vo n wịtem sowohl den hochnäsigen Menschen, den Naasụụf und die dummstolze Gäxnaase n oder das Dü̦pfi, wie auch den Auf- und Zudringlichen, wo mueß sị n Schmecki oder Schmeckḁ bi allem haa n. Die Nase charakterisiert ferner, im Verein der Lippen, den schwerfällig vierschrötige n Träll, den G’hei-um, den Trápp-i n-d’s-Loch, den Houdappe n, der einherhumpelt, als sammelte er, an der Chrü̦cke n gehend, Chru̦cke nmünz. Aber sie kennzeichnet auch, im Gegensatze zum affektiert zarten und feinen Zịperịịneli, das gutmütig flegelhafte Mädchen als den Houderidou, den Ruedi (zürcherisch, den Herr Gottlieb), das Roß, das Bohne nroß, den Holzbööde n. Den Burschen zeigt sie an, aus dem e n rächte r Knụ̈̆sser (Kerl, «Fink») werden kann, wenn er nicht unerchannt, schü̦tzig, als Schu̦tz überall unbesonnen dreinfährt, oder als Hóllḁhoh sich mit großem Kraftaufwand an jede Kleinigkeit heranmacht und damit dem Clown si ch verglịịchlet, der mit einem ungeheuren Anlauf und Gu̦mp über den hingelegten Hut setzt. Das ist freilich immer noch heimelig im Vergleich zu der von ihrer Nase gekennzeichneten Gu̦u̦re n, Saugu̦u̦re n, dem Reef, Saureef, der alte n Bịßzange n, dem Rịịbịịse n, dem (sauertöpfischen) Sụ̆́rụx, der Schweefelhäx, der Wätterhäx, der Giftguege n, dem Giftschi̦i̦rbbi und dem Biánx oder Biángß, welcher sich durch jede Kleinigkeit zum biánxe n (keifen), zum piórne n oder sonst zu bösartigem, d. h. unfreundlichem Wesen reizen läßt und u nsööd ( intraitable), ja gewalttätig, brụ̈̆taal werden kann. Immerhin ist auch das 393 bis zu einem gewissen Grade wäärklig (komisch) und ist Chuchchibulver in die fade Suppe. Belladonna dagegen, vor welcher erst der Stern des kranken Auges sich öffnet, ist die am unheimlichsten von der Nase verratene, raffinierte Mischung von kindlicher Naivetät, Hingebung, Verdorbenheit, Sinnlichkeit und Kälte, «eine Spottgeburt von Dreck und Feuer».

|
|
Aus Treiten. («Im Bären») |
Der noch nicht so kompliziert bösartige Kleine, der selbst mit Chü̦ü̦rbsbletter (emmentalisch: Chăbisbletter) als Ohren «nicht hören will», wird in rasch angewandter Erziehungsmaßregel an solchen Handheebe n gezaust, damit er «fühlen müsse».
Dann, sagt man sich, wird dä r Totze n, das Dü̦tschi, dä r Du̦tsch (vergröbernde Rückbildung) 17 dä r chöpfig Möntsch, dä r Teetụ̈ụ̈ (Lg. für têtu) die Auseinandersetzungen kapiere n ( capire, capĕre) oder chopfe n, wird wohl auch behufs tieferen Verständnisses druber na̦a̦chḁchöpfle n.
Wenn es ihm nu̦mmḁ n nid lätz i n Chopf chu̦nnt! Das täuscht aber der Läcker vielleicht nur vor: er trịịbt Fandást. Beim Durchschauten heißt es dann: das isch nu̦mmḁ n Fandást! Wer mit mehr Glück der glịịche n tuet, erlangt, daß man ihn mit Dịịri daäri mache n, mit chụ̈ụ̈derle n, mit flattiere n oder flattöörle n kirre zu machen sucht. Er isch gäärn flattiert (Ga.).
394 Schulinspektoren wie Egger pflegten Kinder unversehens uf de n Scheitel z’dü̦pfe n (Lg.), uf de n Scheidle n z’dü̦mpfe n (Tsch.) oder uf d’Schäidle n z’dü̦pfe n (Ins), um sie zu einer Antwort aufzufordern. Diese kam dabei allerdings selten ung’stagglet (ungestottert) heraus. Mehr als ein Kind wurde übrigens durch solche und andere Einschüchterungen zum Staggelibänz. Wie erst, wenn der erschrockene Kleine um alle Besinnung kommt und ihm nur dann und wann e n schwarze r Zwi̦tschger 18 am Auge vorüberhuscht!
1
Nikl. Manuel.
2
Vgl. dazu
Gb. 140.
3
Wer dächte hier nicht an Simon Gfellers herrliches «Rötelein» (in Bopps Heim-Kalender 1912)!
4
Gfellers Heimisbach 40.
5
Lg. 169.
6
Ebd.
7
Raser, afz.
raire, radere (schaben).
8
Bdbg. 423 nach
Tac. Germ. 38 f.
Amm. Marc. 16, 12.
9
Hottenroth 3, 9.
10
Ebd. 12.
11
Dieses
luegen als ursprüngliches Gucken aus einem Versteck ist erhalten in der Patois-Entlehnung
luga: durch ein Schlüsselloch u. dgl. beobachten (
Brid. 229), wie
le lugare oder
lougare tut.
12
Mit diesem g’- vgl.
g’hööre
n = g’chööre
n, g’spü̦ü̦re
n, und emmentalisches «es g’schmöckt mer» = schmeckt mir; mit -ch-: got.
sächwan = lat.
sequi (mit den Augen) folgen.
13
Emmentalisch, der Labi la
n hange
n. «Labi» liegt zunächst dem lat.
labium, germ.
lëb, woraus niederdeutsch und entlehnt hochdeutsch Lippe (
Kluge. 292). Aus «
lesf» wurde ebenfalls niederdeutsch
lëfs = Lefze, Läfzge
n; erhalten ist
lesf in
Läspi, (
Schwz. Id. 3, 1462.)
14
Z. B. bei Niklaus Manuel (Elsli Tragdenknaben 994) und im Chorg. vom 17. Juli 1586.
15
Welches «ginen» z. B. bei Nikl. Manuel mit offenem Munde horchen bedeutete; vgl.
Kluge 156;
schwz. Id. 2, 328 f.
16
Lb. Heir. 36.
17
Lg. 165.
18
Ebd. 116.
Welche Fülle urchiger Volkstypen! Um diese ganzi Räiete n als solche erst recht wirksam abzuheben, schuf Anker auch Bilder, welche die Hinfälligkeit und Schwechi des Menschenlebens vor Augen führen. « Hohes Alter» predigen die über dem Kohlenbecken Wärme suchenden Hände und die erlöschenden Augen 1 dieser Frau, aus denen ein hartes und schweres, aber mit Ergebung getragenes Schicksal zu lesen ist. G’altet het auch, oder wenigstens elterlich (ältlich), ni̦mme̥ hr ganz im Sänkel, nï̦mme̥ hr n im Vormittag, und damit im Räst ’bli̦i̦be n isch dieser etwas g’stăbe̥le̥tig (in Twann für «ungelenk») am Stäck einhergehende Mann. Bei diesem Mu̦u̦rbe n (Lebensschwachen) und jenem G’stru̦ppierte n hopperet’s u nd chachchelet’s. Chrankhält bis zum toote n-chránk sịị n zehrt am Lebensmark von Greisen und Kindern: des von französischer Kugel getroffenen « Lavater»; des alten « Hugenotten»; des « Andacht» Feiernden; des « im Bett» spielenden Mäiteli. Doch zeigen zwei Bilder die « Genesung», in der man si ch b’chịịmt und ụmmḁn á̆wärt (alert, vgl. «Krieg») chunnt. Hoffnungslos steht es einzig mit « deux natures mortes».
Denn selbst den Verlust zweier eigener Söhnchen: des jehrigen Emil († 1871) und zuvor des zweijährigen Ruedi († 1869) überwand der Mann mit dem hohen Christusgedanken, daß der Tod nur ein Schlaf sei. Das zeigt das weihevolle Bild « Der liebe, liebe Ruedi», welches mit Recht nur zu sehen bekommt, wer mittelst eigener Erfahrung die hier angeschlagenen Töne in sich nachklingen fühlt. Eher durfte sich in Kunstsalon und Ausstellung die fremdem Leid nachempfundene « tote Freundin» ( S. 362) von 1863 2 wagen, so nahe auch hier das zugrunde liegende Ereignis dem Maler ging.
395 Auch sonst vergegenwärtigt uns Anker Kindertrauer und Kinderleid. Dieses löst am leisesten und gerade damit am sprechendsten sich aus, wenn der oder die Kleine d’s Dụụreli macht. Wer empfindet da nicht, wie ’s äin’ dụụret! 3 Solches dụụre n herausfordernd, grännet oder pleeret ein anderes Kind gar wehlig; es briegget (Lü.) aanhaltig (in einem fort). Äußerst verdrießlich und langweilig ist das verhaltene sü̦ü̦rme n (Br., Tr.) des Kindes, das auch sü̦ü̦rmig oder zährig (Mü., d. i. weinerlich) ụụfbigehrt oder resiniert (räsoniert). Bis zum mordismordbrüele n steigt dagegen das Gebrüel des Erregten an; dieses brüele n (e n Brüel ụụsla̦a̦ n) heißt bloß schriftdeutsch «schreien», während man auch mundartlich g’schrạue n (geschrien) sagt. Zum Wịịberzụ̈ụ̈g gehört das laut quietschende göüße n: der Göüß, ob dessen ụụsla̦a̦ n es auch dem Nervenstarken über de̦ n Rü̦ggen ụụf tschụụderet, tschụ̈ụ̈derlet oder gramslet, wenn nicht gar ĭhm d’s Bluet g’stäit.
1
Schweiz 1900, 172.
2
Kunstmuseum Bern = MB.
3
Das genitivische «es» nun als akkusativisches empfunden, wie sonst häufig. (Drehscheibe des Kasus.)
Hie und da wird eins der von Anker gemalten Kinder benannt ( g’namset oder b’namset): Rööse̥lli, Lịịse̥lli. 1
Und zwar bewegen sich bereits diese Kinder in einer reichen Welt. Jener Kleine het sich ergelsteret 2 (überanstrengt) und ist nun aus unruhigem Schlafe jäh aufgewacht. Nach einer Weile jedoch bị̆ße n ’nḁ d’Schla̦a̦fmụ̈ụ̈sli (im Emmental: d’Schlaaflụ̈ụ̈sli) von neuem, und ein beschwichtigendes «Schlaf, Kindlein, schlaf» ( fais dodo! fa néné!) bringt es dazu, daß er nun ruhig schla̦a̦ft, nachdem er eingenickt ist ( g’noutet oder emmentalisch «Chụder g’wooge n» het). Um jener wichtigen Tätigkeit erfolgreicher obzuliegen, hat ein lustiger Knirps einen Holzbööde n und einen Strümpf abg’spoor ret. Eines strampelt: es stampfet, dröschet (s̆s̆), schla̦a̦t drịị n mit de n Schäichli. Ein anderes Kind ist « im Wald eingeschlafen». 3 Eins zaablet i n der Wa̦a̦gle n oder im Chindsstüehli nach Befreiung. Ein wenige Wochen altes schickt, uf der Schoos einer Schwester sitzend, der es lockenden andern das überglückliche « erste Lächeln» 4 zu. Ebenfalls bụspe̥rig (munter) bla̦a̦st Ankers kleines Mädchen i n d’s Pfị̆ffli, 5 das am Ende eines Klingelgeräts (« le hochet») sitzt. In allen möglichen Situationen hocke n (sitzen), stan͜de n 396 (stehen), li̦gge n kleine Mädchen auf dem Ofen, auf dem Sopha oder im Freien und spielen ( gäggele n, g’vätterle n). Nicht zufrieden mit bloß einem Bäabi (Br., Tr.) oder Tanti (Ins), hält eins e n ganzi Aarvlete n (Lg.) 6 oder en Aarve̥le n voll (Ins), nicht etwa bloß e̥s Eerve̥lli solcher Tante n (Puppen) triumphierend empor: « Alle mein!» Es gibt gelegentlich auch einen Tanteler, der mädchenhaft mit Puppen spielt. Ein anderes Mädchen hat zum lebenden « kleinen Freund» es Bụ̈̆ssi (Chatzli), das, wie ein Bär aufrechtstehend, mit der Bạu mwo̥l le n naar rlet, welche strickend verarbeitet werden sollte. « Chu̦mm, chu̦mm!» ruft ein ferneres, welches nicht lieber singt oder sinnet, und ladet zum « Stäbchenspiel», zum Ergötzen mit dem Bäiaß 7 (Hampelmann), zum blampen oder gị̆gampfe n auf dem Gị̆gampfiroß oder dem einfachen Brett, welches d’s Gị̆gampfi heißt. Indes üben Knaben sich im Bockspringe n, oder sie tummeln sich « im Schnee», ohne daß einem G’frü̦ü̦rlig dessen Kälte unbelieplịch wird. Im Gegenteil! Was geht Inser Kindern, denen so selten ein liegenbleibender Schnee ( S. 70) sich zum chu̦u̦rzi Zịti mache n bietet, über die an einem Schneemaa n geübte Skulptur und Modellierkunst! Nur dem « kleinen Architekt» steht zum Hụ̈ụ̈seli bạue n immer Stoff zur Verfügung. Wie hier, kann im Durchblättern des «Bilderbuchs» (Mämmibuech) der Vers sich bewahrheiten: Ein tiefer Sinn liegt oft im kind’schen Spiel.
Weiß man doch längst, welche Vorbereitung aus den Mutterberuf im tantele n mit dem Tanti (s. o.) des ein- bis zwölfjährigen Mädchens liegt! Die Beobachtung erwahrt sich aufs anmutigste an der « kleinen Mama», welche ihr Ehrenamt de̥m Brüederli gee n z’trinke n, so außerordentlich wichtig nimmt und es ausführt mit den gespanntesten Zügen des gescheidten Gesichtchens, auf welchem die ganze Größe des Verantwortlichkeitsbewußtseins zu lesen steht. Wie leicht könnte ja der kleine Trinker, der so heißdurstig i n d’s Glas bĭßt, si ch überschlǘcke n! Etwas zu vorg’rückt erscheint der « die ersten Schritte» versuchende Kleine, wo lee̥hrt lạuffe n. Ebenfalls « in treuer Hut» geborgen ist das so außerordentlich malerisch zum Schlafen hingestreckte Buebli, das auf zwei Bildern von der « ältern Schwester» 8 bewacht wird. Ersten Schreibunterricht aber erteilen « die kleinen Blaustrümpfe»: ein Mädchen lee̥hrt de̥m Schwesterli schrịịbe n. 9
397 Wie glücklich Bauernkinder sich spielend in die Arbeiten der Eltern hineinleben, zeigen « die kleinen Botenmädchen» und « die kleinen Wasserträger in Ins».

|
|
Ernst Probst, Hanslis,
|
Zwischen ernster Arbeit an Schulaufgaben, die manch einem mit schrịịbe n und leese n beschäftigten Kind das Zeugnis « fleißig» eintragen könnte, und lockenden Allotria wird die heranreifende Jugend hin- und hergezogen. Bei all dem ihm abgezwungenen Lachen ( es ma g si ch nid überhaa n z’lache n) rührend brav kämpft gegen solche Ablenkung das auf seiner Taafele n schreibende blonde Mädchen, dem ein zweites Blondköpfchen belustigend knapp über den Tischrand weg zueluegt, wenn nicht sein Blick eher dem lockenden Öpfel gilt. In der Schule wird gewiß jene «Fleißige» richtig betöönt leese n und nicht wi n e n Rönnle n, nicht drääiöörgele n. Bedenklicher aber als sie « gẹstört» wird eine angehende Schöne in ihrer Strickarbeit durch so n es Briefli, in welchem ein Schuelschatz seinen erwachenden « Gefuehlen» Ausdruck verleiht. Nehmen wir an, auch der habe am Schluß die Bertha gebeten, im Fall des «Nicht drauf eintreten Könnens» das Sendschreiben an die Emma weiterzugeben — auch ein Kind, das nicht mehr so harmlos wie das Ankersche mit Tafel, Schrịịbheft und Chöörbbli zugleich für d’Arbäitsschuel und di rächti Schuel den Weg der Pflicht beschreitet. 11 398 Ungeteilte Arbeit aber lernt das Mädchen beim Stricken und Nähen — li̦i̦sme n u nd nääije n — unter der strengen Lehrgotte n, wie der Knabe zumal in der militärischen Vorschule der « Turnstunde».
Die Schule als solche erhält ihre Darstellung sowohl im «Spaziergang der Kleinkinderschule» (Gäggelischuel) auf der Kirchenfeldbrücke und in Ins, wie an dem berühmten Schul- Exaame n. 12 Weniger bekannt ist ( S. 377) die kirchliche Schule oder Un͜derwịịsig, von welcher die Müntschemierer « Konfirmandinnen» heimkehren. Mit Ernst zeigen mehrere einander im Fra̦a̦ge nbuech, was sie für das nächste Mal häi n z’lehre n, während einige singen, und noch andere die schịịnt’s nicht ganz zustimmende Beurteilung des Mannes mit der Seege̥ßen uf der Achsle n herausfordern, der auf seinem Weg zur Wiese ämmel no ch mues z’ru̦ggg’luegt haa n. 13
In den Lebensernst der weiblichen Haushaltungsarbeiten führt die bereits angezogene Mädchenarbeitsschule über. Eine solche aus alten Tagen, wo Freiwilligkeit das heutige Obligatorium ersetzte, leitet in einem Bauernhaus eine alte Frau. Das hier zum nääije n u nd li̦i̦sme n erlaubte schwätze n findet ein rührendes Gegenstück in der Anstrengung eines Kindes, «eine verlorne Masche» (e n Lätsch, wo ’s het la̦ n g’heie n) wieder ụụchaz’neh n. Noch rührender lernt die sechsjährige « kleine Strickerin» ihre Kunst ḁ lsó schröckeli ch eer nst, daß sie mit dem Mụ̈ụ̈li na̦a̦chḁ n macht. Das an sie gelehnte Schwesterchen aber schaut ihr mit gespanntem Interesse zu. Auf eine ganze Anzahl strickender Mädchen kommt eins, welches häkelt ( höögglet, in Gals: hö̆gglet, vgl. das Hö̆ggli, der Hŏgge n = Haken). Neben dieser Luxusarbeit in der Stube führen uns Ankers zahlreiche Vorstudien ( S. 253) zu seinen drei « Erdbeeri-Mareili» 14 auf die schon in das Kindesalter hinausreichenden, aber von ihm ihre Verklärung empfangenden Nahrungssorgen.
1
Sonnt.-Bl. d. Schwz. Bauer 1910, S. 92; vgl. unsere
S. 389.
2
Vgl.
schwz. Id. 2, 234 (Galster).
3
Museum Lille.
4
MN.
5
Verlag Varin.
6
«Der Arm voll» oder wie hier: «Die Arme voll»: der Aarvel; mit Auffrischung von voll. Vgl. Hampfele
n und «Mumpf».
7
Paijaß:
Gb. 490.
8
Eins vom «Säemann» verbreitet.
9
Apprendre qq’ch à qq’un.
10
Bruder des Lehrers (s. «Schule» im Band «Twann»).
11
MN.
12
MN.; ebenfalls vom «Säemann» verbreitet.
13
Eine sinnvolle Verwertung der künstlerisch geforderten Gegenbewegung, wie sie z. B. auch im Ligerzer Pilgerzug zu bewundern ist.
14
Eins in der «Schweiz» 1900, 176; ein anderes im Ankeralbum.
Wie mit solchen Erwachsene kämpfen, zeigt vorab die « alte Strickerin», welche doch wenigstens warm’s Wasser suecht z’verdiene n. Etwas mehr gewinnt die «Flickerin», wo verheit’s Zụ̈ụ̈g umma macht, und bedeutend mehr die von der « Wasserträgerin» zur «Wäscherin» (Weschere n) aufgerückte Taglöhnerin. 399 Im chlịịne n Taglohn (für zwänz’g Rappe n) verarbeiteten vormals 1 auch in seeländischen Bauernhäusern je drei bis vier Spinnere n oder Spinnerwịịber sowohl Rịịste n als Chnöpf. (Der seeländische Chụụder ist bloß Seilerware.) Anker jedoch malte « Spinnerinnen» aus dem Familienkreise, welche ihre im Chunkelstüehli steckende Chuunkle n, 2 sowie Haspel und «Garnwin͜de» z’Zịte nwịịs für andere Geschäfte bei Seite stellen durften, zum Schnurren des Rades aber das spuele n der Katze und die Gesellschaft des an Schulaufgaben arbeitenden Jungen, sowie dessen Schulsack am Boden behaglich duldeten. Sie blieben dabei gleicherweise « Arbeitsame» wie die bäuerlichen Spinnerinnen für den Hausgebrauch, welche wie die nunmehr 85jährige Frau Schumacher in Ins häi n alti ụụfg’schrịịbni Lieder a n d’Chunkle n g’hänkt, um in angeregter Abendgesellschaft, während das Rad seinen Baß zu schnurren nicht aufhörte, si z’lehre n u nd z’üebe n. 3
Wenn solche Greisinnen noch immer enem-e n Junge n z’Trutz schaffe n, für nid vor Längizịti umz’choo̥ n, so macht auch ein altersschwacher Greis sich noch damit nützlich, daß er Sa̦a̦m-«Bohnen» ụụschi̦flet (enthülst). 4
In Ergiebigkeit steigern sich die Arbeit des « Regenschirm-flicker», wo Parisööl oder Baariblụ̈ụ̈ umma macht, so daß si no ch öppḁ guet sịị n für ḁ lsó im Hụụs ummḁ; die des « Reisigsucher», welcher im Walde dürres Holz ụụfli̦st; der «Holzschlag» (Tannen ummache n); der «Torfstich» (Tu̦u̦rbe n graabe n, S. 167 ff.); der «Erdarbeiter» Mühsale; die «Kartoffelernte» (Hördöpfel graabe n), «im Heu» (der Heuet), «Ernte» (Summer), «im Obstgarten» und selbstverständlich nicht weniger «Rebgelände in Ins» unter der Hut des Reebbannḁcht (siehe «Twann»), des «Rebhüter» und mit der Hauptarbeit des Leeset («Weinernte»), gefeiert im «Winzerfest». Auch in verschiedene «Werkstätten», Bụụtịgge n (Lg.) oder Bụ̆́dịgge n blicken wir: die des «Dorfschneiders» und «Dorfschusters von Ins», des «Schreiners» und des «Küfers». Auch ein «Kramladen» (Laade n) weist uns die Geheimnisse, wie man es nach und nach zum 400 Vermögen des «reichen Müllers» bringt. Mit mehr Mühsal wandelt man seine Wege zum Emporkommen in der «Käserei» (Chĕserei, S. 351 ff.). Der frühere «Schäfer» (Schööffer) war an den Handel auf dem Meerid (s. «Twann»), z. B. den «Markt in Murten» angewiesen. Den Verkehr mit Neuenburg und Bern aber erleichterte « La Directe» (s. «Twann»), deren Ausstecken durch den Ingenieur nach dem zuerst gewählten tracé (1885) die jenem zuschauenden Kinder mit dem Jubel begrüßten: «Die Eisenbahn kommt!»
Der mit Theodolit und ähnlichen Instrumänter Arbeitende vertritt die G’studierte n. In der militärischen Laufbahn schließt sich an ihn der Ofizier («Offizier») als Aufseher über das «Kantonnement» und die Soldaten, unter welchen Anker auch einem «Todten» Ee̥hr aa nduet. Gesetz und Verwaltung kennen der «Notar», der die «Gemeindratssitzung» leitende «Gemeindsamman» (Ammḁ n) vor 1830 und «der Herr Gemeindschreiber» ( S. 391), dessen Kollege in der «Gemeindschreiberei (G’mäinschrịịberei) Ins» seines Amtes waltet. Der Schuelmäister oder sonst bernische Schu̦ lmäister, «Schu̦meister» ehrsamen alten Schlags ist im Exame n («Schulexamen») dargestellt: er könnte gemäß vormaliger Übung «Organist» und ehrsamer Küster (Sigrist, Si̦i̦gerist) zugleich sein. «Die neue Lehrerin» (Lehrere n) aber (1906) 5 und das Bild «Bei der Schullehrerin» (1905) halten sich an die Gegenwart. Wie weit stand glücklicherweise von vornherein der Bildungsgang der Lehrerin oder Lehrgotte n (im Amt, doch nicht im Städtchen Erlach) ab vom Konviktleben der «Nonne»! So nun auch der des Lehrers vom «römischen Seminarist». Den diesem eingepflanzten Fanatismus konnte nur die in «Alt und Jung» dargestellte Lebenserfahrung mildern und zur Frömmigkeit des «Andacht» feiernden Kapuziners verklären. Als welch anderer «Student», froh und fleißig in einem, steht Ankers Studiengenosse (und Biograph) Rytz da! Pfăr rer stellt Anker keinen für sich dar außer Bähler; 6 auch keinen Dokter. Den letztern muß gemäß dem Sinn eines Annebäbi Jowäger der Oltige nmätteler (Johner) als «Wunderdoktor» ( medicus, «meige») 7 vertreten, natürlich mit der Magie eines «Kartenschlägers».

|
|
Friedrich Feissli,
|
Die Verschiedenheit des Arbeitserfolgs, sowie die in Brauchen und Sparen zutage tretenden verschiedenen Bedürfnisse verschärfen fortwährend die sozialen Unterschiede, nach deren Ausgleichung hinwieder das Schicksal und die Politik streben. So zeigen die Bilanzen von «Soll und 401 Haben» immer wieder die Kluft zwischen einem dem «Sparkassen-Verwaltungsrat» anvertrauten Vermögen und der «Geltstagssteigerung» zu Äschi. Welche Gegensätze hier zwischen dem alt und arm uf d’Gasse n g’stellte n Großmütterchen, das, im Dunkel der offenen Türe zusammengekauert, sein weinendes Gesicht in der Schürze versteckt, und dem Sohn als Bụụr, der, mit gesenktem Kopf, anscheinend interesselos, dem Beschauer der Rü̦gge n chee̥hrt! Und abermals zwischen beiden und dem Pöbel: den gedankenlosen Gaffern und den scheebig Pfiffige n, wo o ch no ch hie n e n Schick luege n z’mache n! Gegensätze, wie der im «Zinstag» ( S. 384) zwischen dem vornehm strengen Kapitalist und dem seine Jahresschuld abtragenden Schulde nbụ̈ụ̈rli führten erstmals in den Dreißigerjahren zu Szenen wie dem «Sozialist auf dem Lande», welchem während seiner Rede vor Aufregung d’Ha̦a̦r z’Beerg stan͜de n. Diesem gegenüber dü̦schet (s̆s̆) si ch der Eingeschüchterte und meint allenfalls mit jenem Ankerschen Modell: Mit dem leere n Hoose nsack ga n laafere n isch ó ch nụ̈ụ̈t.
Wie vieles allerdings geschieht zur Überbrückung der sozialen Klüfte! Wenig allerdings bis zur jüngsten Zeit für den urteilslos auch von der Gesellschaft verfehmten «Gefangenen», so eifrig namentlich Gotthelfs Kinder für ihn einstunden. Mehr tat man seit Gotthelfs «Armennot» in Wohltätigkeitswerken wie der «Armensuppe von Ins» und der «Krippe».
1
Nach
Lg. 117 spannen Schwarzenburgerinnen sogar
für ’ne Batze von 6 bis 10 Uhr, also mit Anrechnung der knappen Mahlzeiten 16 Stunden.
2
Übrik. Pfalz 35.
3
Diese bis vor kurzem noch erstaunlich jugendliche Greisin verfügt über einen von uns sonst nirgends gehörten Volksliederschatz, welchen nun Herr Oberlehrer
Probst in Ins sich in die Feder singen läßt, um ihn der schweizerischen Volksliederkommission zuzustellen. Vgl. auch die
Spinnstubeten
Lg. 117.
4
Eine von Anker beglaubigte Kopie hängt in der «Erle» zu Erlach.
5
Sonnt.-Blatt des Schwz.-Bauer 1910, S. 87.
6
Der Kanzelredner in «Änneli. gi
b mmer es Müntschi» (zu Gotthelfs «Käserei»), ist natürlich Nebenfigur.
7
Mus. Basel.
Mit den zwei letzten ideenverwandten Bilder: das so überwältigend groß angelegte von «Pestalozzi und die Waisen von Stans» 1 und die gewissermaßen wiederholten «Kinder von Stans in Murten von ihren Pflegeeltern in Empfang genommen», 2 gehören der Geschichte an. Nicht minder die «Königin Berta, 3 welche die Kinder aus dem Volke spinnen lehrt» 4 und «Karl der Große, die Schule besuchend». Welche fürstliche Charaktere gegenüber dem von Ehrgeiz fast g’fräßne n «Karl dem Kühnen», diesem abso̥lute n Grin͜d (Zwänggrin͜d) einerseits und seinem geschwornen Feind «Ludwig XI.» anderseits, der die von ihm un͜derholzeten Eidgenossen so erfolgreich gegen jenen g’hịtzget het! Gerade diese so meisterhaft psychologisierte Figur mit dem spitzbübischen Greisengesicht und dem so vielsagenden Griff ans Kinn scheint es unserm Künstler angetan zu haben ( S. 380). Zum glịị chhste n (Si.: am ersten) als Fayencemalerei (s. u.), dann als Zeichnung häufig wiederholt, hielt er sie stets im Atelier vor Augen. Wohl diesem mit wahrer Leidenschaft gehaßten Ludwig hätte er am ersten den Dolch einer «Charlotte Corday» aa ng’wünscht. Als Heldenjungfrau aber verehrte auch er die «Johanna von Orleans»; und an sie erinnernde Heerführer wie «Hans von Hallwyl» und «General Weber» hielt er seines Stifts gleich würdig wie die Schultheiße «von Steiger» und «von Mülinen», den «Bürgermeister Wettstein», den «Bundesrat Schenk» und den «Regierungsrat Fetscherin». Als historische Dökter verewigte er den «Hippokrates» und den Hugenotten « Ambroise Paré» (1510 bis 1590). Seine berühmte «Milchsuppe zu Kappel» eröffnete eine Reihe Kriegsbilder wie «Neuenegg 1798», die «Polen im Exil», die «Internierten» von 1871. Der Kirchengeschichte gehört vor allem das überwältigend großzügige Bild an: «Der Pilgerweg nach Ligerz vor der Reformation», 5 sowie das von Karl Girardet in ebenfalls ergreifender Weise gemalte Bild «die flüchtigen Hugenotten». 6 Einzeln sind dargestellt: «Luther im Kloster», «Calvin», «Lavater», sowie «Kardinal Schinner» und «Karl Borromeo». Auf Fayence malte Anker eine «Ägypterin» und einen «Ägypter», einen «Assyrer», einen «Perser». In die Vorgeschichte griffen der «Pfahlbauer» und die «Pfahlbauerin» zurück. 7
403 Wie manches «Lied aus der Heimat» gab ihm also die Geschichte ein, und wie wußte er sich in fremde Gestalten hineinzudenken! Auch in biblische: den «Hiob unter seinen Freunden», die «Deborah», die «Grabesengel». Aus Sophokles vergegenwärtigte er sich die herrliche «Antigone», aus Shakespeare die «Ophelia» und daneben den «Fallstaff», aus Molière den «Bürger Edelmann», aus Schiller den «Franz Moor». Als Gotthelf-Illustrator aber ließ er sich zuteilen: den Schulmeister, Dursli, Besenbinder, die Branntweinmädchen, Joggeli, Käserei ( S. 400), Erdbeerimareili ( S. 253), Michel, Erbvetter; aber auch Uli und Barthli blieben ihm nicht fremd. 8 Viele der historischen und poetischen Bilder malte er während etwa zwanzig Jahren für den Elsäßer Fayence-Fabrikanten Theodor Deck (1823 bis 1891). — Herren, Damen und Mädchen von «südlichem Blut» seien nur i n’s Gene̥ree erwähnt.
1
MN.
2
Ebd.
3
Mus. Lausanne.
4
Vgl.
Anz. 7, 18 ff.
5
MN.
6
Ebd.
7
Verlag Goutil.
8
Kurztitel erklärt in
Lf. IX ff.
Welch feine und reiche Abstufung von Seelenstimmungen läßt sich schon aus den genannten Bildern herauslesen, und wie viele bleiben noch äxtra als Stimmungsbilder zu erwähnen! Billig beginnen wir hier mit all den «Andacht» Feiernden, welche am «Sonntag Morgen» oder durch das «Nachmittagsgebet», welches später in der «Andacht des Großvaters» noch einfacher, größer, eindringlicher gestaltet wurde, sich den Kirchenbesuch ersetzen. «Ins Buch vertieft» sind sowohl der «Bibelleser» wie der das «Gebetbuch» (Bättbuech) aufschlagende «Betende Bauer». Den «in Trauer» Geratenen und «in Tränen» Erleichterung Suchenden ist die G’schrift die erste «Trösterin»; stille Lebensklugheit und «Seelenruhe» (Ruej) bringt sie dem gereiften Mann. Daneben bietet das «Sonntagsblatt» des «Seeland» (mit dem Ankerschen Titelkopf), das des «Schweizerbauer», des «Bund» usw. der «lesenden Frau», den «Zeitung (Zịtung) lesenden Bauern» «am Ofen» oder sonstwo eine «interessante Lektüre». Aber auch «Der neue Kalender» hilft dem «sinnenden Bauer», der über einer «ernsten Geschichte» in «Träumerei» versunken war oder «in Gedanken» die Umwelt vergessen hatte, wieder zurecht. So z. B. dem «rechnenden Weinbauer», dem in einem Mißjahr manch «ein trüber Gedanke» gekommen war. Doch, eifriges Lesen und namentlich Verständnis suchendes Buchstabieren dunkler Stellen: wi macht’s da̦? kann auch in große Erregung stürzen. Eine das Wohl und Weh des Lesers nah berührende 404 «schlimme Neuigkeit» kann diesen bearbeiten, daß es ihm i n de n Mụụlegge n zu̦cket oder zocket. Dann heißt es: «Mu̦ni böo̥s!» Und beherrscht der Mann sich nicht, dann darf man rufen: Dää r macht e n strụụben Esterich! Immerhin ist der für das Auge noch erträglicher, als das verblüemt, will sagen: unverblümt sị n Mäinig kundgebende taub Weibsbild, von welchem man sagen muß: Das isch, b’hüet is Gott, es Register! 1 So verstund sich Anker gleichsam auf alle Orgelregister von der lieblichsten Vox humana bis zur schrillsten zweifüßigen Quint und bis zum Margg u nd Bbäi n durchdringenden Schnarrwerk. Und das zwar schon als Student in Halle. Da saß er einmal, während Tholuck die «vier Temperamente» behandelte, anscheinend teilnahmslos, jegliches notiere n unterlassend. Daheim aber illustrierte er diese durch «Geblütsmischung» bestimmten Arten des «Naturhangs» an vier Personen so überraschend geschickt, daß auch der Profässo̥r sie sehen wollte und dem Zeichner das Kumplimänt machte: Mein lieber junger Freund. Sie haben mich am besten verstanden. 2
1
Aus einem Ankerschen Skizzenbuch.
2
Rytz 15.
So streng wir laienhaften Künstlervergleichungen aus dem Wege gehen: eine Parallele zwischen Vautier’s «Auf dem Standesamt» und Ankers ungefähr gleichzeitigem, nicht weniger geschicktem « Contrat de mariage» drängt sich gebieterisch auf. I ch ha n si mit List überchoo̥ n, es het si sü̦st nie̥mmer welle n: das Oxymoron stellt sich unweigerlich im Gedächtnis ein, wenn wir des erstern dralle, fast blu̦derigi Braut ( si isch e n Bla̦a̦ste n) ins Auge lassen, welcher der Standesbeamte mit dem Zeigefinger wie mit dem Holzschleegel die Stelle anweisen muß, wo sie ihren Namen hinzusetzen habe. Die zwei als Zeuginnen geladenen Mädchen sehen wir denn auch demgemäß ihre n Sämf dḁrzuegee n. Was tuscheln ( chüüschele n) sie kichernd einander zu? Vielleicht, daß, wenn auch sie einst mit dem Schatz verzwangsringlet sein werden, sie zum Bitzeli Chü̦mi im Sack ihm auch etwelches Grütz im Chopf zu bieten haben. Ja, selbst für den Fall — meinen sie —, daß sie z’seeme n nu̦mmḁn äi n Strạusack in die Ehe brächten, würde das, was sie können und sind, das Schiff über Wasser halten. Da müßte freilich hinter der Heiterkeit ein großer 405 Lebensernst sich bergen. Es gäbe kein flatteriges amisiere n mit dem Bewerber, der ihrḁ hööflet und den sie a n der Hand het; kein «grausames Spiel», ihn e n chläi n la̦ n z’löölle n (la̦ n der Lööl z’sịị n) unter der Rechtfertigung: wen n äär so dumm isch u nd daas nid schmeckt... (so kann ich dem Tropf nicht helfen); wäis er de nn ni̦i̦d, wi n e n Läide r ( laid, Häßlicher) das s er isch?

|
|
Frau Füri-Probst von Ins |
Eine gleich ansehnliche: guet g’stellti, aber charakterfeste Person, welcher a n ’neme n Finger ihre r zwöo̥ wu̦u̦rdi hange n, we nn si drum teet u nd ’s e̥re drumm weer (dra n g’leege n weer), die denkt freilich nobler. Sie antwortet auf die Frage, wi mäṇge n Choorb si scho n ụụstäilt häig: No ch käine n! I ch la̦a̦ ße es nid so wit cho̥o n. Das geeb Chịịb im Dorf; und ich müßte die, wo n i ch abg’schụ̈̆ffelet hätt, bedauern: es duureti mi ch um si.
In Ankers durch nicht wenige Studien vorbereiteten «Ziviltrauung» weiß die geistig und leiblich feine junge Blondine mit dem züchtige n G’sichtli, dem gediegen einfachen Hochzeitgewand und dem anmutig glatt g’strehlte n Ha̦a̦r ohne Weisung sehr wohl, woo un͜derschrịịbe n. Man gewahrt auch, wie reif sie den folgenschweren Schritt sich überlegt hat. An ein treuloses ihn la̦ n fahre n und si ch hin͜dertsi ch drụs mache n ist nicht zu denken. Gleichwohl überwacht der sympathisch 406 schöne junge Mann (es ist der Sụụri Hämmi) ihre Schriftzüge mit äußerst gespannten Blicken und will überzeugt sein, daß ’s es ämmel jó de nn häig. Man sieht ihm an, von welcher Bedeutung es zu allen Zeiten in erster Linie für den Bauersmann ist, die sorgfältig Erkorne als ebenbürtige Partnerin in das Königreich seines Hofes einzuführen und in diesem Sinne si̦i̦ als Mịni zu erklären, ihn (sich) sälber von ihr als Mịne n beanspruchen zu lassen (vgl. ụ̈ụ̈ser: unsere Angehörigen; äär: mein Mann oder mein Sohn; ääs oder ẹs: meine Frau oder auch: meine Tochter).
Wenn ’s da̦a̦ nid guet gäit, woo dee nn? Es gibt allerdings verschiedene Methoden, Rost und Gift chronischen Streites aus den zwei wichtigsten Dritteln menschlicher Lebenslänge fern zu halten und keinen «sich freuenden Dritten» als hausfreundlichen Spaltkeil la̦ n zwüschen ịịchḁ z’choo̥ n.
Die hiezu strikt erforderliche Einheit der Willensrichtung kann nach der Wegweisung des Volkswitzes auf mehrere Arten gesichert werden.
Einmal, indem gleich am Hochzeitsmorgen ausgemacht wird, wer von beiden d’Hosen und wer d’s Gloschli aa nleggi, und wer demgemäß bifähl oder aber gu̦nterbier.
Sodann nach dem Vorschlag jenes Standesbeamten. Ihm wollte eine angehende Frau den Ehevertrag gäng nid un͜derschrịịbe n. Sie hatte etwas von Frauenemanzipation g’hööre n lụ̈te n und bestand heftig darauf, daß auch sie ämmel de nn well Rächt haa n. Der durch die Stube voll anderer Klienten zur Förderlichkeit gedrängte Beamte schlug ihr endlich vor: Loos, Fraueli, machit ier das z’seemen ḁ lsó: Wenn dier bäidi über öppis unglịịcher Mäinig sị̆t, so het der Maa n Rächt. Aber wenn der bäidi d’s glịịche n weit, de nn hest de nn dụ́ Rächt. Wosch ḁ lso? Eh, nu̦ n jja̦a̦! wenns dee nweeg isch! rief die angehende bessere Hälfte aus. Soo̥ miech’s e n Gattig; soo̥ g’su̦chi’s (sähe es) iez dḁrggeege n! Und freudig setzte sie ihren Namen her.
Ein sehr energischer Bauer pflegte an Regentagen mit wenig oder schier gar keiner Feld- und Scheunenarbeit zu rufen: Soo̥, Frau, hü̦̆t bifi̦hlst dŭ̦́ ieze n!
Ein rabiates Weib schmiß den lieben Herrn und Ehewirt un͜der d’s Bett. Der Pfarrer kam dazu, redete zum Frieden und ermahnte den Mann, är söll iez der G’schịịder sịị n u nd fü̦ra choo̥ n. Der aber raffte seine ganze Mannheit zusammen und würgte hervor; Nääi! Niema̦a̦l chu̦mmen i ch fü̦rḁ! Die mueß iez äinist wüsse n, daß si e n Mmäister het!
407 Mit den «Tröstungen der Philosophie» dagegen ertrug jener Inser das Regiment eines körperlich winzigen, giftig energischen Ri̦i̦feli und Rịịbịịse n. Ihre stundenlangen Keifereien und Gardinenpredigten hörte er schließlich so wenig mehr, wie der Müller das Klappern seiner Mühle. Das derartig angewöhnte Schweigen forderte er einst auch von einem Freund, der ihn über die Verkettung mit solcher besserer Hälfte trösten wollte: Schwịg, schwịg, i ch ha n vo n allnen Üble n d’s chlịịnste n g’noo̥ n!
Eine nicht üble Auskunft in solchen Sachlagen ist das unerbittlich grundsätzliche «Schiedlich friedlich», wie ein von Anker trefflich gezeichneter Namensvetter es mit seiner in bestandenem Alter angeheirateten Magd durchgeführt hat. (Man merke die nun verwischte Unterscheidung: i ch ha n g’hụ̈ra̦a̦tet, i ch bi n g’hụ̈ra̦a̦te n.) 1 Äär het sịị ns Reebli g’schaffet u nd si ihrers. Das war doch eine Arbeitsteilung, die eine wirkliche Arbeitsbesorgung gewährleistete. Wenn si̦ e̥s Säüli g’metzget häi n, het äär sị n Däil g’räükt u nd g’gässe n, u nd sị ihre n. Das war lautere Folgerichtigkeit. Äär het nid i’ n glịịche n Spiegel g’luegt, wo si̦ị n. Das war Furcht vor Vermischung beider Seelen, welche ja nach uraltem Glauben der Spiegel, vor den der Beschauer sich hinstellt, einfängt. Das schmunzelnd zustimmende probatum est verstummt jedoch bei der Kunde, daß unser in Gesellschaft sehr gemütliche Mann es guets Bitzli wohl ihm sälber, nicht aber ihrḁ gönnte. Nach einer gemeinsamen «Chalatzete n» von Brot und Wein für insgesamt zwanzig Rappen schickte er sie heim, um sich noch allein gütlich zu tun. Auch der schöo̥ner Bettlade n des Ehebettes sollte nicht für si̦i̦ (Lg.: für seie n), die voorna̦a̦hḁ g’leegen isch, bestimmt sein. Är het d’s Bett verchehrt g’stellt, für daß der schöo̥n Lade n uf sị n Sịte n a n d’Wan͜d chöo̥m. Das zeugte doch von latenter ästhetischer Veranlagung.

|
|
Fräulein Ida Schneider |
Wie mannigfaltig also Sinn und Gesinnung, womit bisher Li̦i̦digi Chnaabe n (1799: ledige Knaben) und Mädchen den G’spaane n suchen, womit sie z’seeme n chnü̦pfe n oder der Chnopf mache n, dem Gịrịzimoos und dem Affe nwald ( S. 260) e n längi Nase n mache n 2 und die im erstern zum bleibenden Sitz ausgewählten Moosbösche n ( S. 112) verlassen! Der unter Zweien herrschende Geist wird auch in der gesamten Aa nhänki des neuen Verwandtenkreises zutage treten. Daß unter den Gliedern desselben e̥s mit enan͜dere n hottet oder hu̦u̦rstet, daß der Kampf ums Dasein in Eintracht 408 verläuft, ist nicht immer guet z’mache n (leicht zu ermöglichen). Wie in aller Welt, mußte auch hier das Chorgericht Klagen anhören, Schweher (1668) oder Schwächer (Schweeher) und Dochtermann (1661) oder schweer und schwiger (1576) leben nit wol mit einanderen; die NN. sey von ihrem schweer gelüffen (1576), und der NN. wolle sich nicht Schwägerlich verhalten und tragen (1668). Ein Dritter klagt von wegen sines sünis Frouw (1587); eine Vierte beschwert sich, ir sünißwib welle iren nit folgen (1590), während eine um zehn Schilling Gebüßte ir süniswyb by geschloßner thür geschlagen hat (1576). Auch die stifschwiger (1670) machte von sich reden. Ein bekanntes Verhältnis taucht aus alter Zeit neu empor, wo einer (1591) verklagt wurde, er habe si’r Frouwen stieffmuter gseyt ( g’säit) und hinwieder einer (1590) sine stiefkindt geschlagen hat, als si ir er großmutter die Hand gereckt ( g’reckt) und sie geheißen wil komen sin. 1652 mußte einer gefragt werden, wo syn gschwyen ( G’schweie n) syn. 3
Auch zwischen Eltern und Kindern können Mißhelligkeiten oder Unstimmigkeiten zu öffentlichem Austrag kommen, wo etwa, wie 1670, ein Sohn erklärt, Er seye nit mehr vnder synes Vatters muß vnd brot. Welchen Gegensatz bietet hierzu eine Szene wie Eduard Girardet’s « Bénédiction paternelle», oder auch dessen « Amour maternel»! Anker setzt die letztere Motivreihe fort in « Mutterglück» und in 409 «Mutter und Kind», wo schon das dü̦pfliglịịch sịị n in Gesichtszügen und Haltung, das enan͜dere n glịịchle n wi n e n Tropf Wasser (dem andern), an die uralte Vorstellung erinnert, daß im Kind der Ahne wiedergeboren sei. 4 Wenn dabei die elterliche Liebe, ohne eigentlich parteiisch zu sein, sich instinktiv mehr dem einen oder andern zuwendet, so gilt diese Bevorzugung oft in rührender Weise dem geistig oder körperlich Zurückgesetzten. Nur wo ein, oder sogar der Bueb der Bụụre nhoof zu erben hat, kommt jenem gleich dem waadtländischen bob, boubo, bouébo 5 die Rolle des enfant, einfant eifet 6 eben als Bueb 7 zu, wenn auch lange nicht mit so intensivem Wertgefühl wie in Gegenden des Hofsystems. Dagegen muß das Mäitli (in Erlach: Meidschi), « qui n’est qu’une fille», sich als bouba, bouéba, boubetta 8 betiteln lassen. Da kann einem wohl sogar die der Hirtensprache entnommene Bezeichnung als Gu̦ste̥lli 9 angenehmer klingen.
Irgend eine Gruppe lebender Wesen ist eine Bu̦u̦rß. E n Bu̦u̦rß Mäitli spaziert miteinander, e n Bu̦u̦rß Chin͜d spielt zusammen. Auf der Weide treibt sich e n Bu̦u̦rß Säüli, e n Bu̦u̦rß Hüener herum.
Innig vertiefte sich Anker auch in das Verhältnis von Großeltern und Enkeln. Als zärtlich sorgsame Kinderwärterin tritt im Volksmund die Großmutter, die mère-grant oder grand’ mère in den Vordergrund. Wo isch ụ̈si Grắmeere n? konnte man der Grameere n-Fritz und den Grameere n-Metzger, die von Großmüttern an Kindesstatt auf- und angenommen worden, als Buebe n jeden Augenblick fragen hören. Die beiden so Geheißenen machten obendrein von sich reden als Besitzer einer aus dem Welschen mitgebrachten grammaire.
In überraschender Lichtführung ( S. 383) öffnet Anker uns eine Stube, wo d’Groo̥smueter am Fenster sitzt und das Kind im Vordergrund das Kätzchen lockt. Wie lacht hinwieder dem Grŏßvatter und dem Buebeli mit der Gäisle n 10 das Glück aus den Augen, da jener ( der alt Tri̦i̦be̥let Zimmermaa n), behaglich auf dem Ofentritt die Beine ausstreckend, diesen rịti rịti Rößli uf d’s Chnäü nimmt! Auch die Großmutter ( di alti Tandere oder d’Tanderi-Vreenḁ) macht sich dazu ihren Vers. Wie gespannt hinwieder horcht die kleine Korona, wie «Groo̥ßvatter e n G’schicht erzellt!» Eine Reihe Studien reden von der Vorbereitung dieses berühmten Bildes. Dann wieder sitzt der Großvater uf dem oberen Ofe n. Ein Kleiner hat sich eben dahin begeben und ist eingeschlafen. 410 Er lehnt dabei an den Leib des Alten; und der hütet sich nun mit peinlicher Strenge, e̥s Mụ̈xli z’mache n, um den Schläfer nicht zu wecken. 11
Auch bei ihrem Ruhebedürfnis zeigen diese Greise eine Lebenszähigkeit ( Zääiji), dank welcher sie es, wenn nicht auf das bisher bekannte höchste Alter von 130 Jahren, 12 doch auf das unserer seeländischen Nụ̈ụ̈nz’ger bringen. Daß aber aus neunzig hunderte werden können, beweist die 1861 zu Peseux 101jährig gestorbene Susanna Elisabeth Schreyer von Gals, Tochter eines Brütteler Badwirts, 13 eine Namensgenossin der Hungervirtuosin (s. «Twann»). Es fehlt bloß noch, daß sie, wie jüngst jener 84jährige Florentiner, 14 no ch neu Zän͜d überchööme n und es bei den Ha̦a̦r a n de n Zän͜d sein Bewenden haben muß.
Bei solch hohem Alter erleben nicht ganz seltene Seeländer die Würde eines Ähni (Ga.) oder Urgroßvater, «Ähnigrosatt» und eines «Urmüeti» (Lg.). Im Erlachischen sind die letztern ebenso ungeläufig wie alle Ersätze des einfachen Vatter und Mueter. Die vor längerer Zeit im Bauerndorf Treiten durch eine kleine Kinderpension importierte Benennung Papa und Mamma reizte die Spottsucht der benachbarten Brütteler in dem Maße, daß sie die Treitener di Wältsche n hießen und die Redensart aufbrachten: Wenns im Wältsche n brönnt, so lụ̈tets (Sturm) im Dụ̈tsche n. Aufgebauscht lautete der Spott: Wenn’s i n Frankrịịch brönnt, so lụ̈̆tet’s i n Dụ̈̆tschland. Zum Ersatze des so gründlich abgeführten Papa kam dann der Elter auf.
Sind Kosenamen für Eltern ungebräuchlich, so hört man dagegen den «Neugebornen» eine Zeitlang das Mụ̈ụ̈sli oder das Chröttli nennen; und als letztes Kind ist er der Rästbụtz, Nästlibụụz. Diesen hat natürlich erst recht in der Moosgegend der Storch ( S. 261), der Chlapperstorch den ältern Geschwistern gebracht, falls nicht die Knaben un͜der der Chrü̦pfe n fü̦ü̦rḁ und die Mädchen un͜der e̥-mene n Roose nstock fü̦ü̦rḁ choo̥ n sịị n, oder un͜der enem-e n (Findlings-) Stäi n ( S. 51) fü̦ü̦rḁ.
Ein allerliebstes Ankerbild 15 zeigt «die ältere Schwester» sitzend und strickend neben dem auf der Ofenbank eingeschlafenen Brüederli. Auf gewissen (vielleicht na̦a̦ cheltere n) Gruppenbildern sind wohl auch g’schwisterti Chin͜d (in Twann: G’schwisterchin͜d) herauszuerkennen. Gleicherweise der so gern als «Götti» angerufene Vétter Sammi, das ebenso oft als Tánte n-Gotte n 16 ausersehene 411 Tánte n-Lịịsi oder Baase n, und sogar die Groo̥ßtante n. Die ist allerdings bloß noch wịt u̦sse n verwandt: vo n si̦i̦be n Jụụcherten e n Fuhre n, oder vo n mene n groo̥ße n Bitz es Chlettli, oder vo n si̦i̦be n Suppen e n Löffel voll oder e̥s Bröchli. Sie leitet über zu den «natürlichen blutsfründen» (1584, 1667) oder einfach «nachen fründen» (1587) im weitesten Sinn, wo’s nụ̈ụ̈t meh vetteret.

|
|
Die 84jährige
|
In verschiedenem Maß und Grad empfundene Lücken des Familienkreises, in deren schmerzlichste das «Lebewohl» auf dem neuen Inser Friedhof blicken läßt, stellen zumal das Waisenkind (1589: dz arm weiß) und die Wi̦ttfrạu als des NN. «Verlaßne» (1647, vgl. die altwaadtländische relicta) hin. Wie viel weniger e n Maa n ihm sälber cha nn hälffe n, wenn er «sich Sälber spisen» soll (1574), wieviel leichter er es aber auch hat, sich für eine neue «Hälfte» umzutun, zeigen die 49 Witwen und 13 Wittlig des Jahres 1912 im Dorf Ins. «Arm und alt und kalt» verweisen allerdings auch die letztern auf die klaglose Traurigkeit des «Einsamen», welcher, wie der Ankersche, in Sinnen versunken beim Kaffeemahlen plötzlich inne hält.
Wie glücklich in solchem Falle, wem dank sorgfältiger Abmachete n oder sogar einem Vermächtnis (bei Niklaus Manuel: gmecht) doch ein 412 gleichsam abgeschliffener Teil eines bisher genossenen Vermögens: der Schlịịs darüber weghilft, daß d’s Alter mit Schwachhäit chunnt! Dieser «Schleiß» wurde früher sehr häufig gegen die Abtretung von Haus und Hof an einen Sohn oder Tochtermann einbedungen. 1668 klagte einer vor Chorgericht, der Sohn wolle ihm syn geordneter Schlyß nit mit suberem Korn vsrichten. In Twann hat am 1. April 1791 Mutter Irlet sich vier Züber Most und acht Kübli Trauben als Schlịịß gesichert. Aber auch ein «wegen seines einsamen wittib-standts» ein «Teillybell» veranstaltender Twanner behält als ein Schlịịser sich 1678 vor: die Stuben und kuchi, sowie angenehme Hausgenossen als Mietsleute seines Sohnes. Alles andere Gut wird «vnder und zwüschen den Erben» geteilt, und diese werden als Abgeteilte abg’fergget. Ein Schleisbrief aus Lüscherz vom Jahr 1805 sichert der Mutter ( Schlịịsmueter, Schlịịsere n) als Schlịịswohnig, also schlịịswịịs die hin͜deri Stube n nebst Anteil Küche und Keller, Bühne und Garten, Platz für äi n Chueh und e n Säüstall; ferner den Dritteil des Obstes vo n der Hụsmatte n, des Getreides und Weines, sowie zehn Garben «Rüschstrau» ( Rụụchstrou? S. 312).
Auch diese Frau hat also si ch d’s Rächte n la̦ n voorschrịịbe n (verschreiben), gemäß dem Satze: Mi mues für äin’ sälber luege n. Denn es sị n Lụ̈̆t, wo mäine n, die, wo guet dänkend sigi, sigi Lööle n. ( S. 121. Wer das Beste will, wird zum Besten gehalten.) Und gerade den Angehörigen wie dem Freunde gegenüber darf das «gute Herz» nicht das erste Wort haben, wo es gilt, nid der Löffel us der Hand z’verlụ̈ụ̈re n. Drum sagt der Volksspruch: We nn ma n mit Fründe n akko̥rtiert, soll ma n mache n, wi wenn e̥s die grösste n Fịnde n weeri.
Durch den Schleißbrief sichert sich also der oder die von einer Gutsverwaltung Zurückgetretene e̥s G’nammts. So auch jener Vinelzer, der sich bei einer Verwandtenfamilie verdingt hatte. Er erklärte: I ch ha n mi ch bịị ’nne n übergee n; si müeße n mi ch fuetere n, bis das s i ch fụ̆́tụ̈ụ̈ 17 bi̦i̦ n. (Merkwürdigerweise bedeutet aber — etwa über einen Mittelbegriff wie «vollendet» hinüber — dieses fụ̆́tụ̈ụ̈ sehr häufig svw. geschickt, fähig, geeignet. I ch bi n nid fụ̆́tụ̈ụ̈ g’si̦i̦ n, das z’mache n; in allerdings bloß niedrigstem Französisch: je n’étais pas foutu de faire cela.)
Die Sicherung der Altersrente schließt selbstverständlich nicht aus, sondern erst recht ein, daß zuvor für das Emporkommen der Kinder «bedencliche vorsorg gethan» (1678) worden sei. Dankbar mögen dann 413 diese erklären: Der Vatter het ụ̈ụ̈s der Choorbb g’macht, mier chönnen ieze n drị n sitze n; un d är het ụ̈ụ̈s der Ofe n g’häizt, mier chönnen ieze n d’Füeß drann weerme n. I ch vergässe n mị’r Leebstag nie, was i ch n ihm schull dig bi̦i̦ n. Zum Familienkreis gehören schließlich die Verdingchin͜d, deren Loos unter dem alten Regiment der Min͜derstäigerige n das bekannte traurige sein konnte, wenn nicht ein Kinderfreund und Greisenvater wie der sehr gescheite und bei seiner Invalidität glücklich optimistische alt Posthalter Gugger sich ihrer annahm, sowie die Dienstboten: Chnächten u nd Jumpfraue n (Emmental), Jumpfere n (Aarberg, Büren), Mägd (Ins).
Am 12. Februar 1814 hat Maler Ankers Großvater ( S. 359) «den Bändich Warmbrot von Siselen gedinget für ein Knächt». Er gab ihm 25 Kronen und ein Paar Schuhe Jahrlohn. Allein am 23. November 1814 stellte er den Abraham Graser für 1815 ein und versprach ihm: 2 Par Schuh, 1 Par Solen, 2 Par Strümpf, linig und wullig, 1 Par Zwilchhosen, 1 libley und Westen in Halblein, zweü Hemter, 30 Batzen für den Hut, 2 Dublonen in Geld. 18
Unterm 2. Jenner 1806 hat er den Peter Amseiler für ein Knächt gedinget bis den 2. Jenner 1807. Er fügte bei: Ich versprich Imme vier Dublonen und drey Neue Taler in gält, ein Hemt, ein Par Schuw und ein Par Solen und 20 Batzen Haftpenig (Haftgält), welchen er Empfangen. 19 Der urchige Inser bestätigte damit, daß er Knechte aus Berns Umgebung vorzog «wegen dem Füttern, dem Frühaufstehen und dem Laufen». Ein zweitmals gedingter seeländischer Knecht, der wegen Spätaufstehens gegen Winter getadelt und aufgefordert wurde, künftig bei Licht zu füttern, antwortete: dini Chäibli frässe n dị ns Häü sạuft («sanft» = sehr leicht) am Tag. Dabei ist zu bemerken, daß Ankers Stallvieh zum schönsten im Dorf gehörte. 20 Solche Art, dem Mäister d’s böo̥s Mụụl aa nz’hänke n, vereinbart sich mit der alten und neuen Manier, mit dem Geld z’gänggele n und die Zeit zu verplaudern: si ch z’verbb’richte n (schwatzend sich zu versäumen) und kostbare Augenblicke für ein unaufschiebbares Werk z’verchlappere n, 21 oder als der Dampi und die Dampe n sie z’verdampe n.
1
Die «starke» verbale, und die «schwache» nominale n-Form mit adjektivischer Geltung.
2
Lg. 122.
3
Über diese und die folgenden Verwandtschaften vgl.
Gb. 467.
4
Samter 144.
5
Brid. 50.
6
Ebd. 132.
7
Vgl. das gegenteilige zürch. «Chind» als Mädchen.
8
Brid. 132; vgl. Luchsinger 1910, 284.
9
Vgl. das Kalb als Bu̦schi (s̆s̆, Wickelkind) im Zürcher Oberland.
10
Vom «Säemann» verbreitet.
11
MN.
12
Bei Sofia.
13
Taschb. 1866, 463.
14
Domenico Creppi zu
San Colombano.
15
Ebenfalls vom «Säemann» verbreitet.
16
Als Gegenstück zum «Vetter Gö́tti».
17
Schwz. Id. l, 1136.
18
Kal. Ank.
19
Ebd.
20
Ebd.
21
Den Hasen «verklappert» hat ein Jäger in
Lg. 175.
Sind die Familienglieder in rascher Überschau an uns vorübergegangen, so denken wir sie noch einen Augenblick in angeregter Geselligkeit beieinander. 1
414 Es sei nach einem winterlichen Nachtessen. Die Kleinen, welche bereits schlööfflige n g’gässe n und, den Löffel schlaff haltend, höcklige n oder sitzlige n (vgl. ständlige n) e̥s Nü̦ckli g’noo n häi n, müssen a n d’Rueij, z’grächtem ga̦ rueije n. Kein Wunder: sie waren am Morgen gar früech erwache n und waren wi n e n Wink («Wi̦ck», im Schwick) in den Kleidern, um als bereits schaffigi Lụ̈t sofort eine Arbeit an die Hand zu nehmen und sich tüchtig z’rüehre n. Denn lắmaaschig oder schlắmaaschig und lääü (phlegmatisch, pflegmatisch) dürfen schon junge Seeländer nicht sein. Nie auch darf es heißen: das isch me̥r e n z’wĭ̦deri Arbäit. 2 Das steht in Verbindung mit dem Vermeiden alles Hätschelns. Da gibt’s kein «d’s Mịịne̥lli da̦a̦ u nd d’s Mịịne̥lli dört.» Ein Kind, das von der zum Ausgang gerüsteten Mutter ein «Mitbringsel» 3 verlangte, würde etwa mit der Vertröstung abgefertigt, es bekomme es guldigs Nụ̈ụ̈te̥lli un d e n länge n Waart drụụf (es Waarte̥lli, «es längs Waarteli»).
In solchen Familienkreis mischen sich nun, nehmen wir an, einige Na̦a̦chbḁrslụ̈t. Es komme zu einem Aa̦be ndsitz, etwa nach Art des alten Nußchnụ̈tschet (s. «Twann»), der all Aa̦be nd oder doch all Üü̦bera̦a̦be nd abwechselnd jetzt in diesem, jetzt in jenem Hause stattfand.
Der Fall sei ausgeschlossen, daß es zugehe wie nach der Schilderung des Twanners Irlet vom 28. Juni 1778: Meine Frau und meine Töchteren waren samt der ganzen suitte fort, und nun ging es gemäß dem Spruch: wenn die kaz auß dem Hauße ist, so machen sich die Mäüße lustig. (Isch d’ Chatz u̦s dem Hụụs, so tanzet d’Mụụs.)
Die obligate Art zu grüßen (1586: grützen, «grüeze n») und speziell «ein gutten abent zu wünschen» (1652), wurde auch altinserisch mit Go tt dánk e uch! erwidert: So pflegte man einen zu «heißen willkommen sin» (1590). 4 Das Anerbieten einer Erfrischung aber wird abgelehnt: I ch wo lltt e uch nit z’Schade n choo̥ n! I ch bi n nid weege n däm choo̥ n! Erwiderung: Eh, machet e uch nid äigelig! D’Aigeligi oder d’Äigeligkäit löö n mer hi̦nḁcht uf der Sịte n!
Der im Seeland selbstverständlich immer verfügbare Hauswein regt nach einigem Gespräch (s. u.) zum Singen an. Die ee̥rsti u nd zwäüti Stimm (Höo̥ch u nd Ni̦i̦der), sowie der allfällige Paß (auch von Schulmädchen mit niedriger Stimmlage) finden sich unschwer zusammen. 415 Unter den zahlreich erhaltenen Volksliedern ( S. 399) befindet sich auch d’s chu̦u̦rzöötige, das wegen seiner hohen Töne ein sehr häufiges Atemholen erfordert. D’Mụụl- oder d’Handhaarffe n (burschikos d’Ru̦nzele ngịịge n oder d’s Mắnsaarde nklavvier geheißen) stellt sich rasch ( blötzlig) zur Begleitung ein. Es gibt Mụ̆sig, in Gals: Mụ̈̆ssig.

|
|
Frau Neukomm in Erlach, 80jährig
|
Nun gab es aber, bevor das (unter «Volksbildung» im Band «Twann» zur Darstellung kommende) veredelte Vereinsleben seine Segnungen brachte, neben den schönen Liedern ohne Worte ( jụ chze n) auch sehr unschöne Worte ohne Melodien. Ihr Ursprung war ein lebhaftes dischbidiere n, wobei lang nid darvoo n ab’g’stan͜de n woorten isch, daß die eigene Meinung die richtige sei. Plötzlich nun fühlt sich ein Empfindlicher i n d’Naase n g’chutzlet. Ein Wort kam geflogen, das er als eine Fleere oder einen Fleederlig (eine beißende Bemerkung) ụụfhe bt: auf sich bezieht. Er amertiert (Ga.), d. h. er «reklamiert» und p’hochet drụụf, er habe recht verstanden. Er fordert aber unverblümte Aussprache: Seeg’s rächt, du bist vịll wöhler! Oder hest öppḁ so vi̦ll Schenịị? Schịnierst di ch, wi n e n Feuflịịbersänger?
Nun wird der Angeredete auch chụtzig und pru̦nt (zum aufbrausenden Herausgeben rasch bereit: pronto, prompt). Er ri̦i̦felet in langen, hastigen Sätzen und erwirbt sich damit das Ku̦mplimänt: Du redsch, wi n es Buech; aber wi äi ns, wo i n Chalbfäll ii nbbun͜den isch! Antwort: O, wenn du a n der ee̥rste n Lu̦u̦gi erstickt weerisch, du lebtist langisch ni̦mme̥ hr. So ging es einst an ein helke n, föpple n, fötzle n, in dessen Feuer der dumm schwatzende Challi, wo so drị nplatschet, der sauertöpfische Mụggi und andere Kụndine n 416 (verschieden von den Kunde n des Gewerbsmannes) Öl gossen. Die kamen dem Aufgebrachten grad so schön baarisaard (« par hazard» iSv. grad eebe nrecht) i n d’Heere n. Ein böswilliger Sü̦chchel hetzte, und es kam zur Gu̦nxe n oder Gu̦nxete n. Wer nicht in blitzschnellem si ch böögge n auskneifen konnte, erhielt Schläge, welche hier einen Schnäppe n (eine Schnatte n, Striemen) und dort eine Beule hinterließen. Das gab eine Ordnung! Die häi n e n Zueversicht g’macht! Alls d’s un͜derobsig, alls d’s hin͜derfür d’s voordder! — Es isch also handlig ’gange n. Aus dem Geb’richt und G’jaust (Lg.), dem G’lärmidier, dem haleie n (holeie n) und halláudere n (Lg.) konnte der Skandal, der Grampool und Spịtákel erwachsen, der einen würbelsinnig machte und us dem Hụ̈ụ̈sli brachte. Das Schlußwort sprachen dann Chorgericht und Landvogt.
So besonders nach den alten Troßlete n, wobei durch troßle n der seine Hochzịtletzi oder sein Trosselgält verweigernde Bräutigam bestraft wurde. 5 So auch bei der Tanne nfuehr am Hirsmäändḁ g. 6 Ordentlicher geht es bei dem noch üblichen Äierụụfleeset zu. Daß dies erst recht vom österlichen Eier dü̦pfe n oder dü̦pse n (Tsch.), depse n (Lü.) zu erwarten ist, ergibt sich schon aus seinem Zusammenhang mit der hohen Festzeit. Besonders das vergeebe n oder für G’spaß, für ’ne n Gspaß (ohne Verlust des eingeschlagenen Eies) vorgenommene n dü̦pfe n ist das friedlichste aller Glücksspiele. Aber selbst das dü̦pfe n für Äärst oder Äärnst (Tsch.) oder z’Äärstem (Ga.), z’grächtem (Erl.) oder z’rächtem (Mü.), uf g’wunnen oder verloore n (Vi.) braucht bloß eine friedliche Fortsetzung des Eier feerbbe n in der Küche und im Chlammere nhụffe n des Waldes zu sein, wo die «Waldhängste n» die vom Osterhaas (Ins), Oostere nhaas (Lü.), Oo̥stere nhaas (Ins), Oostrehaas (Tsch.) gespendeten Eier so schön ’tü̦pflet oder g’spreeglet machen. Das nämliche «für ’ne n G’spaß oder für Eerst» (vergääbe n oder gi̦lt) gilt ja auch für das Kinderspiel des spicke n, meermele n, maarmele n, chlu̦ckerle n, chlu̦ggerle n mit dem weltbekannten Tonkügelchen, welches der Spi̦cker (Erl.), der Meermel (Ins) oder Määrmel (Lü.), das Maarmeli (Lg.), der Chlu̦cker und das Chlu̦ckerli (um Nidau), der Chlü̦gger und d’s Chlü̦ggerli (Biel) genannt wird.
In Vinelz diente dieses Spiel den Konfirmandinnen als Ersatz für das weihnächtliche Singen im Dorf herum, das trotz der Auswahl 417 schöner Lieder zur Bettelei ausartete und abgestellt wurde. In Ins übte man solches Singen am Silvesterabend.
Verschwunden ist an beiden Orten auch die kindliche Feier des Sankt Niklaus: des Sắmichlạus mit all seinen weitläufigen Stämpereie n. 7 In Bern ist er als Konkurrent des Wienḁchtchindli auf den 24. Dezember verschoben. Bloß das Nidaueramt hat noch seinen Chlạusermäärit und läßt allenfalls am 6. Dezember seine Schüler chlạusere n. Im Erlacheramt ist selbst die Verquickung mit dem Weihnacht-Vorabend so gut wie erloschen, und kein Kind mehr sahnet oder b’langet nach dem Chlạuseresel mit belastetem Zwäärchsack (Lg.) und obligater Begleitung durch Tschäädere n usw.
Auch der Mäie ntoggel 8 des Mäisúnda g (Mü.) spielt keine grosse Rolle mehr. Um so anmutiger können sich auch im Seeland Bräuche gestalten, wie der allerwärts übliche Mäie nbạum und der zum (Bauern-) Faasnḁchtfụ̈ụ̈r entzündete Faasnḁchthụ̆ffe n. Wie aber jener als das bunt bebänderte und mit Blumen übersäete Tanntschụpli (Tanntschụ̈pfi) auf dem Dach der Verehrten durch den Strautoggel oder den Fụụlbạum-Zweig höhnisch ersetzt werden kann, so bot auch der Fastnachthaufen mit seinem Gefolge von Haarzbenggle n u. dgl. vormals Gelegenheit zu allerlei Schabernack. «Wi an e̥re n Făsnḁcht» ging es nach bewußtem Bilde zu statt nach früherem Vergleich wi an e̥re n Chĭ̦lbĭ̦ («Kirchweih»). Vormals war das eine recht schöne Fastnachtfeier, wenn die gesamte Schülerschar der Kirchgemeinde Ins in abendlichem Fackelzug, voran e n Bueb mit der Tru̦mme l, vom Feuer weg nach dem Pfruendhụụs (Pfarrhaus) hin sich bewegte, um hier eine patriotische Ansprache anzuhören.
Das Würde- und Weihevolle dieser Feier vererbte sich auf die des ersten Augste n.
Diese ersetzte aus guten Gründen das vormalige Jakobsfụ̈ụ̈r des 25. Juli und das noch frühere Sonnenwendefest, welch letzteres auch auf dem Twannbärg gefeiert wurde. Es blizte und krachte unaufhörlich (schreibt der Twanner Schaffner Irlet am 28. Juni 1778), so daß es allhier am Berg ein Echo machte. Auf dem Berg wird es Sauber zugangen seyn mit dennen Frauen bey so vielen HH. biß gegen 1. uhr in der nacht, wann nur nicht etwann ein ander Feürwerk hinderlaßen oder ausgerichtet worden ist.
1
Vgl.
Gb. 480 ff.
2
Vgl. die Entwicklung von «zufrieden».
3
Frauenheim 1910, 593. Vgl. Max Müllers «Überlebsel» (
survival).
4
Vgl.
Les salutations dans les pays romands im
Bull. 2, 41-48.
5
Lg. 149;
Gb. 476.
6
Lg. 150.
7
Eingehend und ergötzlich geschildert durch Abrecht in
Lg. 130-9.
BW. 1913, S. 159.
8
Vgl. «Kleine Blätter» zum Berner Intelligenzblatt 1912, S. 142;
schwz. Id. 4, 1241 f.
Je bitterer wir die persönliche Führerschaft Ankers in der Haus- und Ortskunde von Eiß entbehren müssen, desto mehr erfreuen uns die farbigen Lichter, mit denen er auch i n d’s Hụụsweesen ị̆ nhḁ r (ịịchḁ) ’züntet het. Er malte den «Bauer am Tisch», das Kind «Bei’r Suppe», die Frau vor ihrem Gaffee. An ihrer Hand sei die folgende kleine Hauskunde aufgerollt:
Bei dringenden und hausfernen Arbeiten läßt auch der Seeländer e̥s hurti g păraad g’macht’s Möhli (entlehnt: einen Kụ̆mis oder Mi̦nggi̦s) zu sich ụsḁ schläike n. Sonst aber hocket allerwenigstens d’s Wịịbervolch im Winter vier-, im Sommer fünfmal zu Tisch. Er äßt (oder ịßt natürlich nun auch) z’Moorge n oder er di̦schiniert (s̆), sobald er g’chöo̥llet het (das Eingrasen besorgt hat), der Staall g’macht isch (die Stallgeschäfte erledigt sind), und die Milch i n d’Chĕserei gewandert ist. Um so besser schmecken dann der (Milch-) Gaffee, das Bụụre nbroo̥t und die (Hördöpfel-) Röösti. Fehlen die Kartoffeln, oder gelten sie hohe Preise, so werden sie nicht wie anderwärts (zumal im Oberland) durch Mäiß ersetzt; eher kommt selbstbereitete Gụ̆́mfịdụ̈ụ̈re n aus unverkäuflichem Obst auf den Morgentisch. (Sehr wohl kennt man die delikate Gelée aus der Öpfelrinde n.) Dann geht’s auch düechtig hin͜der d’s Broo̥t! Es wird nicht bloß e̥s Schneefe̥lli oder e n Schneefel so dünn wi Fli̦i̦ßbapịịr heruntergeschnitten. Das abg’hạune n oder abg’häüne n (Br.) Stück stellt vielmehr einen ansehnlichen Mocke n, eine Mu̦u̦re n, eine Schmu̦u̦re n eine Jante n dar. Dabei soll jedoch der Laibrest e n Gattig mache n und nicht Ausrufe des Unwillens erwecken: wi isch iez aber o ch das Broo̥t hin͜der a bha r (oder aachḁ) g’jantet! wär het’s ḁ lsó verjantet! verschneeflet! verschnöözt! (Br., Tr.) Hieran ist allenfalls das u nhạuig Mässer schuld, wenn es hạut, wi n e n toote r Hun͜d bị̆ßt.
Auch der Geschmack des Brotes findet seine erfahrenen Kritiker. Wie aber erst der des Kaffees! Erweist sich der als G’schlü̦ü̦der, als Abwäschwasser, als Lụ̈ụ̈rliwasser ohni Du̦u̦ge nt und ohni Faarbb (welche ihm allerdings durch Schịggo̥ree leicht beizubringen ist): dann begnügt sich auch der Durstige mit einem Sprụtz oder gar mit einem Drööne̥lli, einem Dra̦a̦n oder (die Singularisierung von «Träne» mitmachend) einer Drööne n. (Wer keine Trauer erzeigt hat, hed nid e n Dra̦a̦n gla̦a̦ ßen.)
419 Z’Mi̦ tdaag äßt mḁ n z’Mittaag geege n de n z’wölfe n, aß man aber früecher (früehner, z’früehnerige n Zị̆te n) äm elfi (äm ängle̥fi, in Si.: engle̥fi). Das war zur Zeit, da man zum Flegeldrusch in der Tenne ( S. 318) sich um zwei oder drei Uhr erhob. Aber auch heute noch stellt sich das Mittagsmahl dem Morgenimbiß als z’Aa̦be nd gegenüber. 1 Wer das Mittagessen auf einen Arbeitsplatz trägt, geht noch heute ga̦ n z’Aa̦be nd tra̦a̦ge n, wenn er nicht in moderner Redeweise z’Mi tdaag träit.
Man saß eben vormals auch hier bloß beim vruo- und beim âbent-imbiß: man genoß das «Abendbrot» und man hat «z’morgen gegessen» (1591), beide Mal aber «mit Wein» (1610). Ohne solchen war am wenigsten das «Morgenbrot» denkbar, «um» welches (z. B. 1595, 1596, 1668) das Chorgericht Fehlbare zu «strafen» pflegte, wenn diese sich nicht mit Geld (z. B. 1668 mit zehn Pfund) loskauften. Am 7. November 1652 aber mußte ein Inser Auskunft geben, ob er das Chorgericht gemeint habe, als er sich äußerte, «er müsse für die Zoben-eßren tröschen».
Aus Twann erzählt der Schaffner Irlet am 30. Juli 1774: Wir haben nach der Predigt in Täuffelen die Pfarrfamilie besucht, alda z’aben geßen, und um 3. uhr sint wir verreißet. Zum Morgen Eßen (heißt es am nämlichen Tag) haben wir ein Spanferkel ( Spanfärli) gehabt.
Die intensivere Hand- und Landarbeit und die dadurch erforderte bessere Lebenshaltung heischen nun, wie ein kräftigeres drị n bị̆ße n zu anstrengungsreichen oder entsagungsvollen Aufgaben, so auch ein häufigeres en-bîssen 2 in neuerm Sinn. Der Imbiß oder «das» Imbis (=Essen): d’s I̦mmi̦s oder das d’s Immis, das z’Immiß, das Zi̦mmis wurde im Seeland 3 zum Zwischenmahl. Mị nimmt (in Treiten und Erlach: mḁ n nimmt) z’Immis ăm nụ̈ụ̈ni (oder ăm zeechni) und äm vieri, also das sommerliche z’Nụ̈ụ̈ni und das ganzjährliche z’Vieri. Und zwar ist es, der Gewohnheit des Weinbauers gemäß und der häuslichen Zeitersparnis zulieb, beide Male es chalts z’Immis. Immerhin räumt der mehr und mehr fehlende Wein allgemach vor Kaffee oder Tee das Feld; so z. B. wenn mḁ n Wesch (Wösch, Wäsche) het.
Die Hauptmahlzeit hieß früher auch hier «Suppe». Man unterschied vom kalten Mahl «ein g’sottne suppen». 4 Zur Suppe n als zum Mittagsmahl laden wir noch heute ein. Und welcher Wert auf ihre kunstgerechte 420 Bereitung als Mahlzeiteröffnerin gelegt werden kann, zeigt das Kụmplimänt jenes wegen Trunksucht magenschwachen Dachdeckers an eine Bäuerin: O, i ch häuschen e uch (als Taglohn) e̥s Zeechni min͜der weder an͜dere n Lụ̈t; wa̦rum, dier häit gäng gar gueti Suppe n!
Mit dem Sprichwort Mues gäit ǘber Suppe n deutet man auf eine Nötigung oder einen Zwang. Es mischt sich nämlich in diesem «Mues» das zum Dingwort erhobene Mueß = «Muß» der Biegungsgruppe i ch mueß, är mueß mit «Mues» als Speise. Anlaß zu dieser Mischung konnte neben dem Wortklang auch die von alter Herleitung behauptete Gemeinsamkeit des Bedeutungsursprungs geben. Danach wäre nicht bloß «das Mues» svw. zugeteilte Speise, sondern auch «das Mueß» das einem Zugemessene, Eingeräumte, Zukommende und schließlich ihm Aufgenötigte. Dem «du̦ muesch haa n» ( tu en auras)! 5 zu einem bittenden Kinde stellt sich der eindeutig vieldeutige Sarkasmus gegenüber: Es isch Mues dḁrhin͜der! Är oder si e het müese n oder müeße n. Är oder si e mueß.
Aber auch das Mues 6 als Speise ist noch vieldeutig. Das isch es Chrausimues! ruft man angesichts eines wirren Durcheinander. Im engern Sinn ist dieses «rächt Mues» ein unappetitliches G’schlapp, G’chaarst, G’schlaargg, G’schli̦i̦rgg, das eine unberufene Hand z’seeme n g’schlaargget oder -g’schli̦i̦rgget het. In gutem Sinn aber verstund man sonst auch im Seeland unter Mues 7 ein Gemüse oder Obst, welches, durch Zusatz von Gewürz und Wein oder Essig e n chläi n reez u nd sụụr g’macht, zu einer konsistenten Suppe gestaltet wurde.
So tischte die Hausfrau auf: sụụrs Hördöpfelmues; e̥s Trụ̈ụ̈belmüesli; es Öpfelmüesli oder es Öpfeltschụ; es Lạuchmüesli mit wị̆ßer Sooße n; ein ebensolches Eerbsmüesli oder Eerbsmues, nun auch Eerbssuppe n geheißen; es Boo̥hne nmues (e n Boo̥hne nsuppe n), wozu man auf dem Feld in dicht geschlossenen Reihen die niedrig bleibenden Mues- (oder Suppe n-) böhnli ( S. 208) ebenfalls selber pflanzt. Wenigstens das letztere hat sich als sụ̆ụri Böo̥hnli auf den heutigen Tisch herübergerettet. Als das rechte sụ̆ụre n Mues aber zog der Pfarrer-Dichter Molz in Biel den dortigen Wein dem Lắgoote n des Waadtlandes vor. (S. «Twann».) An dies «saure Mues» erinnert im Wort das Sụụrimụụs (um Nidau: das Sụụrimụụri), d. i. der junge, saftige Sauerampfer als 421 Kinderschmaus. (Es ist das emmentalische Gu̦ggersụụr.) Den süßen Schläck dazu bietet der Wiesenbockbart: das Haabermaarch.
Beliebte Gerichte sind auch Hördöpfel und besonders Sa̦la̦a̦t an ere n Schwäizi, wenn nicht mit Öl und Essig chalt aa ng’macht. Der heiße, fettig dünne Überguß wird übergetragen auf das ermüdend Umständliche (das Längfeedige n) einer Erörterung. Daas isch e n Schwäizi! Däa r macht iez e n längi Schwäizi draa n!

|
|
Studie von Anker |
Fernere geschätzte Gerichte sind oder waren noch unlängst: Öpfel u nd Hördöpfel in enan͜dere n (Mü.; das emmentalische Stu̦nggis); 8 Brịị (oder nun Brei; vgl. dagegen Brịịpappe n als Morast, Lg.) aus Gries, Hördöpfel, Öpfel, Frụụme n; Öpfelfu̦nggis und Frụ̈ụ̈mlibrụụsel, Quätschgerchueche n ( S. 327) und Öpfelchüechli; früher: Äiersuppe n z’Mit tdaag, am Samstag dafür e n dolli Mehlsuppe n und warme d Soloot, mit Schwäizi (s. o.). In Begleit von g’schwellte n Hördöpfel ist Mehlsuppe, wenn nicht Bohnen- oder Äärbsmues mit Chees, als Leeset- oder Leesersuppe n das unerläßliche Mittagsmahl der Weinlesezeit. Sonst gilt von den Kartoffeln: z’Mi tdaag g’gschwellt (gesotten), zum z’Nacht g’schellt ([der Rest] geschält) und z’Morge n g’rööstet (als Röösti). Grüens Fläisch aus dem Wistenlach (Sugy; doch vgl. S. 350) ersetzte bloß an Festtagen die Hụsmetzg ( S. 350). Rindsschenkelstücke als Doobe n ( la daube, Sauerbraten): als sụụre r Mocke n darf nunmehr die Hausfrau öfters herzhaft mit der Herausforderung auftischen:
Do isch Mocke
n!
Wär nid will, cha ’na lo hocke
n!
422 Wer ließe sie freilich «sitzen», wenn daneben die appetitlich hingelegten Kartoffelstücke: Bịtze n oder Bi̦tzli einladend winken!
Auch die eingepökelten (ịị ng’machte n) sụụre n Boo̥hne n, Sụ̆r-rüebe n und das ebensolche Sụ̆rchrụt ( la choucroûte) waren und sind eine geschätzte Äß- und G’chöo̥chrüstig. Allein diese darf zumal im Weinland der Säure und Würze nicht entbehren. Als daher zugleich mit den Mähdern auch die Weiber aufstanden, um für das Morgenmahl Gemüse zu kochen, 9 mußte, wenn das Sụ̆rzụ̈ụ̈g wieder an die Reihe gekommen war, gäng öpper uf dem Weeg sịị n, um den Hausgenossen auf dem Felde Wasser zuzutragen. Wie schmeckte dann erst die zum Mittag blu̦tt u nd bbloß (ohne irgend welche Zugabe) aufgetischte chalti Milch! Aus deren Überfluß het’s de nn am Aa̦be n’ Brịị g’gee n. Wenig Umstände machte man auch mit den Bụtze nrüebe n (klein gebliebenen Herbstrüben). Sie kamen gesotten i n e̥s Feßli. Demselben enthob man Partie um Partie, stellte sie auf den warmen Ofen und aß sie ohne weiteres lääü (lau). 10
Wer begriffe nach der Einsicht solcher Küchenzettel nicht, wie ein biederer Altinser, der einige Tage in der Stadt gearbeitet hatte, rühmte: die häi n e n gueti Chost g’haa n! Alli Daag e n Chueche n oder öppis mü̦ü̦rbs! 11 Solche Leckerei, vielleicht auch solche, die ihm das Heerzglu̦xi (den Schlucker) eintrug, sah er wohl auf dem eigenen Tische höchstens zweimal im Jahre. Nämlich nach den strengen Erntearbeiten an einer etwas opulentern «Nachtmahlzeit» (1746), welche mit ihren Sichlete nwegge n oder -zü̦pfe n (Lg.), ihren ung’habne n oder g’habne n Chüechli (Chneublätze n), ihren Schnittli 12 und dergleichen an eine welsche ressa t 13 erinnern konnte. Im übrigen war er froh, wenn d’Frạu gäng hurti g öppis het chönne n z’wegschla̦a̦ n und er sich sättigte, daß e̥r’s het chönne n mache n oder daß e̥r’s het mögen erlịịde n von äi’m Ma̦hl zum an͜dere n. Dann konnte er doch auf die übliche Grußfrage: Häit e̥r’s g’haa n? mit zufriedenem Ja̦a̦ antworten.
Die Art zu essen entfernt sich insofern von der im alten Seeland und Emmental 14 gebräuchlichen, als man die dortige Schüsselgemeinschaft sehr unäigelig und unappeditlich finden würde. Jedes Familienglied äßt 15 und trinkt abaarti aus eigenem G’schi̦r rn. Höchstens d’Röösti äßt mḁn us der glịịche n Blatte n. Das Tischgeschirr muß daher, bis auf das Blättli (die Untertasse), beim daartue n (den Tisch decken, «mettre» la table) vollständiger vertreten sein. Auch die 423 dem Serwisse nchöörbbli («löffelkratten») 16 enthobene Sérwisse n muß z. B. das Dischmässer mit umfassen, da kein «us der Scheiden gezogenes» dolchartiges Messer (1589) es mehr ersetzt. 17 Auch die (überhaupt erst neuere) Gable n und der längst nicht mehr rund Löffel weichen in nichts vom städtischen Besteck ab. Eine Erinnerung an den alten Eisenlöffel würde mit dem Kindervers abgetan:
Liirum laarum Löffelstiil;
Wer das chaa, dee
r cha nid viil.
Verpönt ist natürlich, wie überall, alles u nwa̦a̦dlig ( S. 371) ässe n. So das unverschämte ị nha r- oder ịịchḁli̦gge n über den Tisch; das drị nhạue n und d’s Zü̦ü̦g z’seeme nschla̦a̦ n, als wollte man nach dem berühmten Rezept «e n Schluck un d e n Druck» den Hausherrn vo n Hụụs u nd Häi m frässe n. Der Wạusti wạustet, indem er mit Hast und Gier ịha- oder ịịchḁstooßt, ịịchḁschoppet oder -stoppet: und er verwạustet alles, was er spricht; mi verstäit ’nḁ nụ̈ụ̈t. Dafür straft ihn das Glụxi, wenn nicht sogar d’s Blatt: ein bis zu Erstickungsanfällen gesteigerter Zwerchfellkrampf nach hastigem Genuß halbgebackener, heißer Teigwaren. Gern sieht man dagegen den gezügelten Appetit: den G’lust (1667: lust), der ohne auffälliges g’luste n, aber auch ohne sich zu zieren, nid u nverschant, aber ung’schi̦niert d’rị n längt. Altmodisch aufdringliche Nötigungen zum Zulangen wehrt ein solcher ab: i ch bi n ŭ́ber si̦bni (älter als siebenjährig). Widerwärtig ist, wie das verspätete Erscheinen («är het es Sụụmhölzli g’haa n»), das schnĕderfreesig (wählerisch) tue n, sowie das draa n ummamü̦mpfele n, mü̦mmele n, grü̦mmele n, mü̦ffele n, möüsele n, määüle n des Määüli, des Mu̦ffel oder Mu̦ffli, der die Speisen appetitlos im Mund herumwälzt. Solchen Vorwurf ziehen sich namentlich Kinder zu, welche genascht: g’schnạuset häi n.
Zum manierlig ässe n gehört bei Bauernkindern das schwịịge n. Die Kinder werden so gründlich daran gewöhnt, daß schon ein flüchtiger Blick auf die Ruete n hin͜der dem Spiegel, und als allfällig zweites Warnsignal ein kurzes schaar re n mit dem Fueß jedes Mụ̈xli unterdrückt.
Zum Anstand rechnet man natürlich im fernern das Danken für jede Darreichung, die etwa mit sä̆ oder sää! (in der Mehrzahl: sä̆t!) begleitet wird. 18 Der kindliche Dank lautet 19 dắdaa! Größere seegen iez Merßi. Früher hieß es: Go tt dank der! Oder: Dank häigisch ämmel dee nn!
1
Wie
Gb. 386, und im Gegensatze zum
z’Morgen:
Gw. 498.
2
Mhd. WB. 1, 194 f.
3
Vgl.
le goûter als waadtländisches
petit goûtâ (Vieruhrbrot) und
goûtâ (Mittagessen), letzteres gleich dem noch emmentalischen z’Imis:
Lf. 505.
4
H. R. Manuel. «Suppe» ist eben ursprünglich alles, was sich
supfen (schlürfen, sü̦ü̦rfle
n) läßt.
Kluge 452.
5
Anders
Kluge 323; vgl.
schwz. Id. 4, 499 f.
6
Wozu
Gmües = Gemüse:
schwz. Id. 4, 488 ff.
7
Welches anderwärts auch Brei bedeutet.
8
Lf. 506.
9
Ebd. 508.
10
Kal. Ank.
11
Ebd.
12
Lg. 119.
13
Favre 625;
Brid. 328.
14
Lf. 513 ff.
15
Zu
schwz. Id. 1, 522.
16
H. R. Manuel.
17
Chorg. Vgl.
Gb. 380.
18
Sänd hin den gulden! (
NMan.) Vgl.
schwz. Id. 7, 1-12.
19
Wie auch z. B. waadtländisch (
Brid. 95).
Wie Wein und Brot im z’Immis, gehören Schmauchen und Schmausen, Wein und Tabak zusammen in gemütlicher Geselligkeit, Zeitung und Tabak in müßigem Alleinsein. Letzteres zeigt der voll behaglicher «Seelenruhe» im Bett schmauchende und lesende Greis. Selbstverständlich zog kein Schi̦ggi, der seinen Schịgg schịgget, unsern Anker an. Auch die Schnu̦pfnase n übte auf ihn keinen Reiz. Ebensowenig aber der Rạuker oder Räüker von Stinkneegel, die als Gaagel vom Mund des nonchalant sich Gebenden herunterhängen, oder von etwas vornehmern Stumpe n ( bouts). Nur das Pfị̆ffli findet der Maler abbildungswürdig, schon um seines respektablen Alters willen. Das Letztere wird u. a. bezeugt durch drei dem 17. Jahrhundert zuzusprechende Funde aus dem Bielersee bei Twann. Eine Tabakspfeife mit Klappdeckel bestand aus Eisen; zwei andere, mit Lilie und Kopf in Relief, aus Ton. 1
Bei Anker freuen sich des Pfịffli Bauersleute in allen Graden der Behäbigkeit; von dem Verlegenen an, der we lltt rạuke n, aber nụ̈ụ̈d bịị n ĭhm het, weder d’s Mụụl, oder vom Spaßvogel, welcher meint: Wen n i ch e n Pfịffe n hätt, so we lltt i ch rạuke n, aber i ch ha n käi n Tuback; hesch du me̥r Füür? bis zum Herrn Gemeindschreiber, bei welchem für den Augenblick der Gänsekiel das Pfeifchen auf den Aktenbündel verwiesen hat. Der Letztere gehört also nicht zu den Insern, von denen es heißt: Am Morge n, wenn si e über d’s Bett aha sịị n, göb si e d’Hosen aa n häi n, fülle n si e ịị n. Das g’chöört zum guete n Too̥n. Und es verdeckt die seelenleichte Rechtfertigung: d’s rauken isch d’s äinzig Laster, wo n i ch haa n. Wo aber selbst der wohlfeilste Stöörzler oder Aatụback — von den bessern und besten Sorten des Murte nchabis nicht zu reden — dee nweeg i n d’s Gält gäit, darf die Pfeife nicht zu teuer bezahlt werden. Da tuet’s d’s heertig Pfị̆ffli. Das chost et allerdings e̥s Feufi. Wer diese fünf Rappen zu erschwingen vermag, also wär Gält het, chan n e̥s heertigs Pfị̆ffli chạuffe n. Dann empfiehlt es sich freilich, zu dem teuer erworbenen Gut Soorg z’neh men. Soll man doch gerade zu dem, was am min͜dste n chost et, am söörgste n haa n: söörger, weder zu Sache n, wo äi’m tụ̈ụ̈r chööme n. Drum hụụset der Inser redlich mit dem Chrụ̈tzerpfị̆ffli, indem er, wenn dessen Röhrchenende zu Schaden gekommen ist, immer wieder mit dem Stummel vorlieb nimmt, bis e̥s ’nḁ a n d’s Mụụl brönnt. Haben dagegen Chopf 425 und Röhrli Scheidung eingeleitet, so hält ein Faden die Abtrünnigen immer noch zur Not beisammen.
Weit teurer noch kommt eine andere «Pfeife» zu stehen; wie erst deren zwei und drei! Drum erzählt man: Wenn äine r nid e n silberb’schlagni Pfị̆ffe n un d e̥s Sa̦a̦ge nmässer het g’haa n, so het er nit töörffe n hụ̈̆ra̦a̦te n. Der versilberten aber kommt die pu̦u̦rße̥leenigi Pfịffe n 2 an Chöstligi gleich. Das rief zu seiner Zeit einem andern Inser Witz. Eine kleine Gesellschaft guet g’stellter, d. h. in Herkunft, Wohlhabenheit, Wohlgestalt und Anzug flotter Mädchen, die als Ha̦a̦rna̦a̦dle nveräin im Sonntagsstaat zusammen spazierten, hieß auch der pu̦u̦rßeleenig G’staat.
1
MZ.; Anz. N. 7, 52.
2
Vgl.
Les pipes du 17/18
me siècle:
Anz. 8, III. 129-137.
Ankers Badende einerseits, seine Kostümbilder und -studien anderseits leiten über zum Gewand.
Die vom Chnäu aufwärtsreichenden, ganz a n d’s Bäi n aa ng’sperrte n, einknöpfbaren Chnöpflihose n der bekannten ältern Männertracht (wie um 1678 Niclaus Hubler der Hosenstricker 1 in Twann sie gefertigt haben kann) hatten zum gleichaltrigen Gegensatze die weiten Hụ̆perhoose n. «Es ist interessant, wieweit herum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die pludrigen Fältlihosen als Bernertracht gäng und gäbe waren.» 2 In Cheerze̥z, dem Hauptort des Hụperland, 3 des Hụpergau oder Hụperamt, zu welchem auch Orte wie Fräschelz, Agriswil, Oberried gehörten, 4 zeigte man 5 uns das letzte Hụperchleid. Zu den Hụperhose n gehört die Hụperchu̦tte n und der (doch wohl neuere) Hụperhuet. Die aus weißlichgrauer Rịịste nzwi̦lche n bestehende Hose, welche mit den Strümpf éin Stück ausmacht, 6 ist einknüpfbar (mi cha nn si e ịị n-due n) mittelst messingener (möschiger) Häftli. Diesen entsprechen Ri̦ckli (aus Faden, während die Ringli metallen sind). Die Hose zeigt zwöo̥ Sị̆te nseck und einen Gältsack, welcher, verschnürbar, mit bauschigen Falten ( plu̦derig oder plunderig) hervorsteht. Dazu stimmt äußerst malerisch der Rock von ganz schwarzer, einheimischer Schafwolle. Die Nähte sind rot garniert. 426 Zwei große Brusthaften mit Ringen schließen den Rock bis an den schmalen Halsbän͜del. Als Röhrlig ganz belassene Roggenstrohhalme geben zur Ergänzung des Gewandes den Hut ab, welcher vom Röhrlihuet unserer Knaben, der aus ganze n Hälmli besteht, sich wenig unterscheidet. Er ist eben nur ein Surrogat des wirkliche n Hụperhuet, welcher gleich dem Hụperhemm dli in einer Brunst (s. u.) zugrunde gegangen ist.
Es lebten zu Kerzers um 1845 noch drei Hụper: der alt Talmḁ, der alt Bula und der alt Tschachtli oder der alt Hupertschachtli. Sie setzten als Träger des Huperkleides sich unverdrossen dem Spott ihrer jüngern Zeitgenossen aus.
Zwei zeitgenössische Maler haben die Hupertracht in lebensvollen Bildern verewigt: Reinhardt in den «fünf Sinnen» mit dem dicken Müller als Zecher im Vordergrund ( S. 429), und Locher (1774) im Laitier Bernois, sowie in den Paysans Suisses du Bailliage de Morat. 7
Die weibliche Seeländertracht, aus welcher die Bernertracht hervorgegangen ist, wirkte durch die Verbindlichkeit, sie aa nz’legge n, 8 in gewissem Sinn der Hoffḁrt entgegen. Wer hoffeertig, als Hoffḁrtsgaagel sich z’bu̦tze n, ụụfz’bu̦tze n begehrte, mußte gleich sehnlich — nun wirklich vollständigen — dem erga̦a̦ n der Tracht entgegenharren, wie die Freiheitsdurstigen, deren e̥s n ieders het bigehrt z’tra̦a̦ge n, was e̥s g’ha n het, ohni si ch la̦ n z’kumidiere n.
Zur — festlichen und feiertäglichen — Tracht stund das Haus- und Feldgewand in augenfälligstem Gegensatz, hervorgerufen durch das Bedürfnis, sich ung’schiniert chönne n z’verrüehre n und z’vertue n. Gemein aber hatten Fest- und Alltagsgewand, sowie alle Längsche n die Dụụrhaftigi ihrer selbstgewonnenen Wollstoffe und Gespinnste: die sị n dụụrhaftig g’si̦i̦ n! die häi n ’s möge n haa n! anders als der Hu̦delrupf (welcher Name überhaupt min͜deri Waar bezeichnet). Flächsig Hömm dliseermel und -brust. Mänte̥lli oder Voorschü̦ü̦be̥lli (Vorhemdchen), Zweechele n und Tischlache n waren auch im Seeland der Stolz der Bäuerinnen. Hamf oder Weerch aber gab die Chläider für z’pantsche n. Hemden aus dem Jahr 1830 sind trotz regelmäßigem Gebrauche noch jetzt in gutem Stand: der Faden isch no ch ganz starch. Ganz chnöpfigi wị̆ßi Zwilche n, deren Zettel oder Zetti besonders sorgfältig gesponnen war, gab 427 Männerkleider. Sehr schöne Frauenröcke fertigte man aus Strichlizụ̈ụ̈g, dessen Ịị ntrag aus je zwei Fäden Naturwulle n und zwee̥ne n aus blau gefärbter Bạu mwol le n bestand. Nie aus Gaarn, d. i. leinenem Garn. Denn d’Wu̦llen und d’s Garn frässen (oder bị̆ßen) enan͜dere n: die straffen Fasern des Gespinnstes knicken die weichen der Wolle. Gefälligen Schangschang ( changeant) als zwei- bis dreifarbiges Schillern erzielte man durch Einschlag, dessen Farben man dem Gespinnst in der Faarbb z’A arbeerg erteilen ließ. Früher, noch 1751, gab es eine Färberei auch in Ins. Bis zur Stunde heißt eine Familie Blank Feerbbers; zu ihr gehören der Feerbber Hänsel und d’s Feerbber Röo̥si. Walkine n gab es 1825 zu Ins aus der Allmend beim Klingelsbrunnen, 1828 zu Webers Mühle in Brüttelen und 1832 auf der Brüttelen-Badbesitzung des Regierungsstatthalters Müller.
Das hier behandelte Haustuch ward aber von der Gespinnst- und Wolleerzeugung an auch selbsteigen hergestellt. Man spann also auch hier und verteilte das Webgarn auf Spulen, wobei es manch ein G’hu̦u̦rsch verwirrter Strangenfaden auf der Garnwinde in Ordnung zu bringen gab. Dás isch e n Chlü̦tterete n (es G’chlütter)! rief man etwa bei einer allzustrengen Geduldprobe aus, entzog sich dieser aber nicht. Im Gegenteil galt der goldene Spruch: Mi soll nid hụ̈ra̦a̦te n, geb ma n chan n e n verchlü̦ttereti Strangen ụụflöose n!
Einfach Glatt n und das landläufige Góttonige n mit blaaue n Hụ̈ụ̈sli ward im Bauernhause g’woobe n. 1582 war der Bescheidene Baltthyssar Knub (Knupp), ein Wäber, Säßhafft zu Galz. Zu Ins lebte 1811 Jakob Blank der Weber und 1825 zu Gampelen der Leineweber Antoni Schwab. In Twann arbeitete 1744 der Strumpfweber Hans Jakob Lehnen.
Für Gewänder, die z’verschnu̦u̦rpfe n man nicht riskieren mochte, kam der Schnịịder uf d’Stöör. Er fertigte auch die schwierigsten Frauentrachtstücke, wie Brüstli und Tschööpli ( S. 428). Seiner Wichtigkeit bewußt, ließ er sich aber auch nicht foppen. Eine besonders geistreiche Frau, wo äi’m der Faaden ịị nb’schlossen het u nd nḁ nu̦mmḁ n zum Schlüsselloch ụụs het la̦ n zieh n, für das s er min͜der brụụch, strafte der Schneider lachend durch zehnfachen Verbrauch. Ein anderer Störschneider bestrafte den Argwohn eines Bäuerleins, indem er vor dessen ihm scharf auf die Finger schauenden Argusaugen von der vorgelegten Halbleinwelle gleich zwei Hosen statt der einen herunterschnitt und in der für ihn selbst gefertigten zum sonntäglichen Mittagstisch sich präsentierte. Das Bäuerlein betrachtete den 428 gemächlich zur Tür Hereinschreitenden von Kopf zu Fuß und rief dann: Luos, Schnịịder, wen n i̦i̦ ch der nid zueg’luegt hätt, i ch glạubti mi n Seel, du hättist Hosen aa n vo n mi’m Tuech!
Solchem Fachmann wurde besonders das oberländ’sch Tuech (aus Frutigen), auch Chitteltuech genannt, anvertraut, welches g’stan͜den isch, mi het’s chönne n z’seeme nrumpfe n. Ebenso das aus der Spinnerei z’Samm Pleesi bezogene Guettuech, welches durch dekardieren ( deggartiere n) seinen schönen Strich erhalten hatte. Hóchzịtchịttel aus solchem Stoff vererbten sich als lebenslängliches Alltagsgewand auf Töchter; eigene gaben den Sunndḁ gschị̆ttel ab.
Bis fast zur Gegenwart trugen am Weerchti̦g die Männer glatts (zweischäf tiges) Gri̦ßtuech aus blaauer Bạum m’wo̥l le n als Einschlag und ’brüejtem leinenem (später auch baumwollenem) Zettel. Solches Tuch tragen noch Waadtländer und Wistenlacher. Daneben gab es (dreischäftige) Gri̦ßzwilche n. Gri̦ßröck, welche seinerzeit die Unterschenkel nur halb bedeckten, trugen am Werktag die Frauen. Sie ersetzten die noch frühern Kittel aus schwarzgefärbter Schafwolle, an deren unterm Saum ein ordentlich ( stịịff) breiter, roter Innenbesatz als schmales Böörtli (Li̦se̥ree) gnapp hervorguckte. Vor der Reformation war Roo̥t die Farbe des ganzen Kittels.
Dieser über dem Gloschli getragene Chi̦ttel der bụ̈ụ̈r’sche n Tracht, entsprechend dem stedtlige n oder stedtliche n Rock, welcher auch das Schụ̈pp ( jupe) oder das Schụ̈ppung ( jupon) heißt, forderte zur Ergänzung das (ärmellose) Brüstli. Im Sommer offen getragen, war es mit Broderịịen von geel be n Chräälli (pullverkorngroßen Glaskorallen), wohl auch mit silberige n Hafte n geziert. Zum Sommer-Brüstli gehörte das Gorßee mit Sam metlatz. Im Winter wurde dies ersetzt durch das Tschööpli oder Schắgẹttli, welches, mit Fischbäi n g’staabelig g’macht, sich knapp und eng über das schmucklos gelassene Brüstli, sowie über die Arme legte. Nach unten in einen Schnabel oder Spitz auslaufend, ließ es über dem obern Rand das durch gu̦feriere n oder durch maṇ’ge n in zierliche Fäldli (Fältchen) gelegte Vorhemdchen ( S. 426) heraustreten. Wie frei atmet heute die Brust ohne diese Zwangsjacke, welche glücklich durch die leichtanliegende Blụụse n ersetzt ist! — Den Hals bekleidete das mit blüemlete n Blätzli gezierte Göller oder Geller, von welchem mehrfache silberigi Chötte̥lli (Plampichötteli) 9 un͜der den Armen dü̦ü̦r ch herunter hingen. Den Anzug vollendete das bräit, wịt Fü̦ü̦rte ch ( S. 431) mit länge n Bän͜del. — Die Ärmel erschienen 429 in zwei Hauptgestalten. Als Ellbogeneermel stumpfwinklig geschnitten und an der Achsel ịị ng’fältlet, wurden sie hinter der Hand durch das Mịtli vervollständigt. Ein Brasseli ( bracelet) dagegen legte sich vor den Plụnderhändsche̥ n, welcher den glockenartig nach vorn sich ausweitenden Hammeneermel 10 abschloß.

«Die fünf Sinne», von Reinhardt
Der dicke Müller im Vordergrund wird als spezifischer Träger des Huperkleides ( S. 425 f.) angesehen.
Un͜der dem Chu̦ttli trugen die Bụ̈ụ̈r’sche n das spitz Hemm dli, während im Sommer das Fäcke nhemm dli seine g’steerkte n und ’gletteten Ärmelbauschen wie ausgespannte Flügel ( Fäcke n) frei zur Schau trug. 11
Des Bügelns durften aber auch die Männer- Hemm dliseermel nicht entraten, wenn sie zum Schị̆lee (vollends zum «schönen brodierten Chilet» [Twann 1796]) ohni Chu̦tte n getragen werden sollten. Eher liehen sich die gestärkten Stellchrääge n, Ụụfstellchrääge n, die als Vattermöörter des Trägers Ohren blutig ritzten, durch bloßes fiegge n an der Stuhllehne oder an der Bettstattwalze zur Not steifen. Un͜derweege n blịịbe n konnte auch diese Kunst an 430 der Hemm dlibrust, wenn der Mu̦tz oder der Brustfläck (Spänz) sie deckte. Der Ausschnitt der als Jaquet oder Veston gearbeiteten Chu̦tte n, des alten Aṇ’glees aber wollte und will auch beim einfachen «kleinen» Mann es schöns Hemm dli zum Vorschein bringen.
Um so weniger kam es begreiflich auf die Beschaffenheit des Hemm dlistocks an. Das soll einen Vinelzer Pfarrer zur Satire auf der Kanzel veranlaßt haben: da chöome n si n mit ihrne n rịịstige n Hemm dliseermle n; aber Gott wäiß, wi der Stock isch!
Als das Bargunderhemm dli, der Bargunder oder Burgunder legt sich die Blụụse n oder der Blu̦ß (Ins), der Blụụs (Mü.) über das auf Markt und Straße zu schützende Männergewand. Wer nicht mit ihm will Hoffḁrt trịịbe n, ersetzt es an halbsonntäglichem Sommertag durch das Ermelschịlee. Der ältere Inser liebt überhaupt die Weste mit Recht als gar g’sun͜d, wenn sie statt des modischen Glanzrü̦gge n immer noch den Halblịịnrü̦gge n ịị ng’setzt trägt.
Die Modezeit desselben ist allerdings vorfü̦ü̦r (vorüber); wie erst recht die der lang herunterhängenden Späcksịte nchu̦tte n und der als Bleechscheeri verspotteten Fäcke nchu̦tte n (des Schwalbenschwanzfracks)! Denn auch hier het’s g’änderet (in Tr.: het’s veränderet); es het (fü̦̆r u̦s der Wältschi ụsḁ z’rede n) g’schangschiert — wie ein sich Umkleidender si ch gäit ga̦ n schangschiere n.
Den Wandel der Sache macht hier langsam auch die Sprache mit. In allerdings ferner Zeit wird selbst der bäuerliche (Männer-) Rock die auf dem Mönchsleben stammende Chu̦tte n 12 verdrängen und deren Namen seltsam fremdartig nachklingen lassen, wie etwa heute noch das Wamms in der alten Mundart. Geläufig war es dieser noch 1770, als «ein fleüter Wamiß» 13 im Brandsteuerrodel (s. u.) von Brüttelen erschien. 14 Auch eine «bruni ga sagen» 15 ward damals von einem Inser geschenkt, und ein Galser trug 1706 eine Cassaque. 16 Diese mantelartig geschnittene, meist braunrote Gắsagge n, wie der «Bauernkönig» Klaus Leuenberger sie trug, scheint nachzuklingen in dem Ruhm eines kleinen Inser Mädchens: Mị ns Tanteli (Puppe, S. 396) het es Ggasse̥wéigge n aa n (trägt eine Art verkehrt — d’s hin͜der fü̦ü̦r — angezogenen Ärmelschurzes, eines Eermelfü̦ü̦rte̥ ch). Länger als die Kasake hielt sich der der Pelerine ähnlich geschnittene, 431 aber schwarzwollene Mantel für feierliche Anlässe. Namentlich für z’Lịịcht war er noch um 1860 dermaßen de rigueur, daß man im Bedarfsfall sich ihn gegenseitig auslieh ( e ntlehnt het) und auch dann noch mit ihm paradierte, wenn ’nḁ d’Schabe n (Motten) verfrässe n g’ha n häi n. Ebenso unentbehrlich war er noch im 17. Jahrhundert für z’Bredig, und auch da sah er nicht immer wie neu aus. Am 21. August 1671 mußte der Chorgerichtsweibel einem Inser z’wüsse n due n: Er solle in das Könfftige syn zerrisnen mantel, an welchem ein Fetzen hier, der ander dort hangen thut, nit mehr in die Kirchen bringen, sondern daheimen laßen, damit es nit ein gelächtert gebe, wie geschehen. (Der schier hundert Jahre alte Mantel war, wie man drollig von einem alten Regenschirm sagt, öppḁ no ch guet für im Hụụs umma.)
Noch lauterere Heiterkeit erregte 1774 jener um ein Pfund Gebüßte, der im «Capotrock» die Kinderlehre besuchte. 17 Dieser Kăbŭ́t mit Kragen und Schnalle mochte allzusehr an einen Chapizịịner erinnern, oder an sonst einen Mönch, wie etwa den Ablaßkrämer, zu dem es hieß: 18 Wir wend dich wol eins lochs näher gürten (als es in Rom geschieht: dir der Ringge n ängger ịị ndue n). Gürtel ( Gü̦ü̦rt, Sängtụ̈ụ̈re n) trugen um 1580 auch die Inserinnen; ein Bewerber um eine solche wollte ihr «ein schwarzen sammatigen Gürtel vf die Ee geben». Derselbe konnte zwar trotz beträchtlicher Breite nicht etwa das heutige Korsett 19 ersetzen, wohl aber mit seinem Schmuck den ’blüemlete n oder gestickten Schurz: das baslerische Fï̦ï̦rtuech, das «Fürtuech» von 1586, das Fü̦̆rte̥ ch ( S. 428). 20
Dieses bot von jeher die Gelegenheit, den bis 1913 von der Städterinnenmode verpönten Bieter 21 oder wenigstens ein Bieterli (einen Sack, sa c, cha c, «Wätschger», Karnier, eine fatta, catzetta) im Gewand anzubringen. Sind doch solche Kleidertaschen der Hausfrau gleich unentbehrlich wie dem Mann d’Hose nseck, d’Schileetäschli und d’Chu̦tte nbuese n! Sie waren es selbst in alter Zeit, da man «zu sinem gelt kein seckel» nötig fand (1581), sondern einfach d’s Gält i’ n Sack g’stoo̥ße n (1751) oder i’ n Sack g’chalte n het oder in den Zipfel des Nase nlumpe n ii n’bun͜de n, wie heute Kinder tun. Der Händler aber protzte mit dem versteckten Geldgurt und der offenen 432 Säübla̦a̦tere n. Die elegante Welt ihrerseits ersetzte sich mit dem g’fịloschierte n, g’höögglete n oder g’li̦smete n, mit Chrälli durchwirkten Gältseckeli, dessen beide Öffnungen ein Ringli verschloß, das heutige Boortmo̥nee.
Sonstige Häkelarbeit ( Höögglete n, in Gals: Hö̆gglete n), mit welcher heute so zierliche Möbelüberzüge und Gewandstücke aller Art geschaffen werden, hielt man sich vormals mit dem Spotte fern: das gi bt e n Weermi für n e̥s Roß! Hinter solcher Rede steckte nicht sowohl öppis Grădglịịchligs (eine Gleichgültigkeit, der alles grắd glịịch ist), als vielmehr eine gewisse Eintönigkeit ( Äi ntönigi) in aller Lebenshaltung. Die hatte freilich zum Gegenstück den Sinn für Solidität, besonders auch im Anzug.
So im Schuhwerk. Für dieses sorgten einheimische Gerber. Eine Geerbbi besaß 1795 Peter Probst in Ins und 1807 bis 1821 der zugleich ein Schmiedenrecht ausübende Johann Ulrich Gfeller, als einer der vier damaligen Gerbermeister des Amtes Erlach. Eine solche Lederfabrik alten Stils stand zu Ins an der Brüttelengasse. Um 1889 mit einem gewaltigen Krach z’seeme ng’heit, ist sie durch Räubi-Gfellers Haus ersetzt worden; nur die Geerbbimatte n spricht noch von ihr.
Vom Gerber Bertram in Erlach aber kaufte 1769 ein Galser für 1 Krone und 5 Batzen e n Hụ̆t Überg’schüehleeder. Das Sohlleder ersetzte man sich von jeher für den Werktag durch die Holzsohle. Nach dieser benennt man den mit Oberleder versehenen und meist mit Filz gefütterten Tschogge n, Holztschogge n zumeist als den Holzböode n. Diese wegen des steten Anblicks der Paarigkeit in die Einzahl vorgedrungene Mehrzahlform herrscht im ganzen Erlacheramt. Eben hier, außer im Städtchen, ist auch der Strumpf zum Strümpf geworden, wie der Socken zum Sti̦i̦felstrümpf. 22
Zum weitausgreifenden und raschen tschuehne n, wie dann erst zum eiligen Bäch gee n, bächiere n, dechle n ist ein so schwerfälliges Gehgerät sicherlich wenig geeignet. Dafür macht seine stete Trockenheit und behagliche Wärme, sowie die Ermöglichung eines behenden drụụs u nd drịị n schlụ̈̆ffe n oder schlị̆ffe n — wie bald isch mḁ n drị̣n g’schlü̦ffe n! — den «Gloppäng gloppäng n» 23 zum Günstling selbst der beweglichen Seeländer und Seeländerinnen. Dabei ist freilich das schlappig schlürfende tschi̦i̦rgge n mit in Kauf zu nehmen.
433 Blu̦ttfueß, wie auch ein des Hufbeschlags bedürftiges Zugtier lạuft, gehen mit Vergnügen Kinder im Sommer. «Mit baren Füssen» 24 (1560) vertieft sich Ankers «Gotthelfleserin» noch vor Bettgang in ein fesselndes Kapitel, von diesem ganz angezogen, halb ab’zoge n. (Bemerke auch die Kreuzung: ein Kleid ablegen = e̥s Chläid und damit sich selber abzieh n, ein Kleid und sich selber anziehen = e̥s Chläid und sich selber aa nlegge n.)

|
|
Studie von Anker |
Wie barfuß oder blu̦ttfueß, gehen zur Sommerszeit Seeländer Kinder auch barhaupt oder mit blu̦ttem Chopf. Letzteres tun nicht weniger die Erwachsenen. An kältern Arbeitstagen aber tragen namentlich Müntschemiererinnen das Chopftuech, als dessen zierlicher Ersatz das aus Seide geklöppelte Chopflümpli gelten kann. Die Austeilerin der Inser «Armensuppe» trägt ihr Ohre ntüechli.
Unter dem «Kopflumpen» läßt Anker gelegentlich d’s Fịlee fü̦ragu̦gge n. Das als Strahle nchäppli gehäkelte feedig Chindschäppli (aus weißer Baumwolle) ist gewissermaßen eine Vorbereitung sowohl hierauf, wie früher andrerseits auf die festliche Frauenkappe. Eine besonders am Morgen getragene wißi Spitze nchappe n aus geklöppelter Seide ist im «Hohen Alter» vorgeführt. Selten war im Seeland eine solche mit Roßhaarspitzli, wie die Wirtin «Frau Moser» sie trägt. Die Stündelichappe n mit kurzen Roßhaarspitzen war auch hier bekannt.
Vor das Inser Chorgericht kam 1671 folgender Disput. Löffels Frauen wyße Kappen sye wohl so schön als deß Kuhns Frauen Hut. Antwort: Gang, du wüste Kappen!
434 Von dem als altmodisch erwähnten charité- Hüetli will keine Gewährsmännin wissen, wie hinwieder die Notiz vom vffbrochnen Pareth Futher (1587) einer alten Frau 25 seltsam klingt. Um so lebhafter erinnert man sich des alten schwarzen Frauenhuts mit ni̦derem Gu̦pf oder Gü̦pfli (Huetguggụụs, Lg.) und breitem Schi̦i̦rm (Schopf). Der letztere konnte mit Fleederbän͜dle n nebenaha’zoge n werte n.
Vornehmer nahm sich die Sam methụụbe n mit zudienendem Lätsch aus, zumal wenn blonde Haare häi n drun͜der fü̦ü̦rḁ ’gugget und die darüber gelegten Trü̦tsche n (Zöpfe) mit dem meerblauen Wasserban͜d als Ende der Ha̦a̦rschnuer sogar beim Tanz frei herunterhingen. Daas het g’fleederet albḁ! So eine Haarschnur ward denn auch (z. B. 1667) gelegentlich als Ehepfand geschenkt. Ebenso das zierlich um den Hals geschlungene Chnü̦pferli mit Fränseli, wie solche auch aus den Handblätzli hervorguckten — diesen Gegenstücken der immer modischer um sich greifenden Gamaschen der Männerwelt.
Komisch feierlich erscheint uns heute der männliche Dreiröhre nhuet sowohl wie der einst sogar von Knaben getragene Zilinderhuet, der für Leichengeleite mit handbreiter Greppe n ( crêpe) oder mit Floor besetzt war. Öppis Rụụschigs (s̆s̆) dieser Art war auch das Läidban͜d mit Lätsch am Arm. Um so werktäglicher, so daß sie in drolliger Zusammenstellung mit dem gleich unerläßlichen heertige n Pfị̆ffli ( S. 424, vgl. den «porzellanenen Staat», S. 425) di heertigi Chappe n genannt wurde, nahm sich die Zipfelmütze aus. «Tschöttelichappe n» heißt sie im Emmenthal, Zöttelchappe n in Lengnau, Zöttelichappe n in Br. und Tr., Bụ̈̆sselchappe n in Ins. (Ihre Quaste erinnert an den flaumigen Pelz des «Kätzchens».) Schwarz ward sie früher von Jüngern 26 Sunndḁ g u nd Weerchtḁ g, von Ältern am Alltag getragen; wị̆ß war dagegen die festliche und ins Grab mitgegebene Mütze dieser Art. Im Winter wird sie etwa ersetzt durch die Belzchappe n am Platz des ehemaligen Plụ̈ssertschäppi (aus peluche, «Blụ̈ụ̈sch»). Doch trägt die Männerwelt heute jahraus jahrein mit Vorliebe das leichte Tuechchäppi, kurzweg das Chäppi oder Tschäppi oder der Tschäppel geheißen.
Zum überberühmten Schwööbel- oder Schwööfelhüeti alter Zeiten, welches so viel länger in den Köpfen seiner Verherrlicher als über den Köpfen seiner Trägerinnen haftete, hier kein Wort. Dagegen 435 ergänzen wir unsere Gewandkunde mit den folgenden zwei Inventarauszügen aus Gampelen.

|
|
Studie von Anker |
Danach erbte 1748 Samuel Milliet vom Statthalter: 1 alten schwarzen Rock sammt Camisol und Hosen; 7 Hembder; 2 Mußelinige und 2 Indiennige Halsthücher; 2 Nachtkappen und 1 paar weiße Leinene Strümpf. Von seinem Bruder Benjamin: 1 Bildet Tischlachen und 1 Ehrenen Hafen.
Eine Frau erbte 1759: 1 altes schwarzes Kleid, geschätzt auf 1 Krone 7 Batzen; 1 strichli Fürthuch für 8 Batzen und 3 alte Hauben für 5 Batzen.
Wenigstens andeutend erwähnen müssen wir Zierstücke wie die Brosche n — vielleicht eine der besten Freundin abg’läßleti («abg’lä̆scheleti», abgeschwatzte), bei deren daartue n das Weib und Mädchen als geborne Meisterin sich ausweist, wenn die Frage statt hat: Wo wótsch? Wo gäisch? Wo ụụs?
1
Irlet.
2
So schrieb Frau Dr. Julie Heierli, die Verfasserin der prächtigen neuen Arbeit: «Die Wehntalertracht» im Anz. 1912, Nr. 2, zum Manuskript dieses Abschnitts. Höchst schätzenswerte Hilfe zu dessen Ausarbeitung leisteten uns die Inserinnen Frau
Feißli-Tribolet (Fäislis Mueter), Maria Elisabeth
Anker-Probst (Kurisammis
Mueter), Frau
Weber-Züttel und Fräulein
Rosa Geißler, Schneiderin (
S. 273).
3
Mül. 300.
4
Pfarrer Wüthrich in Kerzers.
5
Nämlich die Familie
Johann Tschachtli in der Moosgasse.
6
Vgl. Frau Dr. Heierli. Wehntalertracht (= Wehnt.) 157.
7
Beide reproduziert von Dr. Zesiger im
Taschb. 1911 und danach im Jahresber. d. hist. Mus. Bern für 1910. Einen Originalabdruck des «Berner Küher» besitzt Frau Irlet-Feitknecht in Twann.
8
Vgl. Wehnt. 178.
9
Lg. 110; vgl. Wehnt. 170.
10
Vgl. Wehnt. 171. 177.
11
Vgl. «hitzig gaa
n» in Wehnt. 177.
12
Kluge 273.
13
Vgl. die Flotterhosen im Wehnt. 163 und den emmentalischen Flouti (
Lf. 401).
14
Vgl. Wams, Wammis, Wambist (1639), mhd.
wambeis, afz.
wambais, mit.
wambasium als Kleid der
wamba, Wamme (als des Mittelleibs):
Kluge 482.
15
Kasake,
casaque, zakka als «Haus» (
casa des Leibes):
Brid. 68. 416;
schwz. Id. 3, 499 f.
16
SJB. A 641.
17
Im Namen erinnert dieser an den «schapper» (
NMan. Papst 595) als den kurzen Beghinenmantel.
18
NMan. (S. 120).
19
Anna, kannst du mir sagen, was uns im Leben aufrecht hält und uns besser macht, als wir von Natur sind? «Das Korsett!»
20
N. Manuels «Fürfell» oder H. R. Manuels «schube» (die emmentalische «Scheube
n». Der Schurz erscheint wieder als waadtländischer
surtzo oder (burlesk):
tschoueirzo.
Brid. 360.
21
Erinnert an «Beutel». (
Schwz. Id. 4, 1882.)
22
Den Socken trägt man im Sommer, wie auch das
aestivale, lo stivale, den Stiefel im Ursinn dieses Wortes.
23
Nach Dürrenmatts lustigem «Holzbodengesang».
24
Vgl. «baareermlig» im Wehnt. 177.
25
Chorg. Das Barett als weibliche Kopfbedeckung:
schwz. Id. 4, 1443.
26
Vgl.
Lg. 172.
Zum Glück für ihre gesellschaftliche Geltung wissen die durch das neuenburgische Welschland im Schach gehaltenen Seeländerinnen trefflich mit zwei Schutz- und Trutzwaffen umzugehen. Die erste derselben ist die Säüffe n, welche nicht bloß während der großen Halbjahrs- Wesch (oder nun - Wösch) das Linnen, sondern zwischen hinein das Gewand in Behandlung nimmt und jeden Schlaargg und en iederi Mooße n unbarmherzig entfernt.
Von der Wäsche und der sie abschließenden Weschglettete n ist hier 1 nicht weiter zu sprechen. Erwähnt sei bloß die «Wöschglätteten», welche 1778 sogar einen Landvogt Gatschet ungeachtet eines nötigen 436 Ausgangs ans Haus fesselte. 2 Die zweite der genannten Waffen erteilt mit Hilfe der (Näh-) Na̦a̦dle n und der Stecknadel ( Gŭ̦fe n) 3 selbst dem Stallgewand zum «Rein» das «Ganz». Es ist die Scheeri, bei den alten Galsern, welche noch nicht wie die heutigen in den Spaß mit der Galserschẹẹri oder richtiger mit den Galserschẹẹrine n ( «les» ciseaux) selber lachend einstimmten, etwa das Abhauerli geheißen.
Allzu hoffnungslos ausschende Gewänder, welche höchstens noch den Fötzel, Hu̦del, G’hü̦ü̦del als Gegenbild des Paraade̥gaagel (Hoffahrtsnärrchen) zieren, sind doch noch zum hu̦u̦dilumpere n gut. Dieses Gewerbe betreiben der Hu̦dilŭ́mper und die Hu̦u̦delfrau oder d’Hu̦u̦dlere n, welche als der Chachler und d’Chachlere n 4 lieber mit Kachelgeschirr als mit Baargeld bezahlen. So der Chachelihạns und d’s Chachelimeiji: ein außerordentlich schaffigs Ehepaar Gugger, das sich bald zum Besitzer des jetzigen Krämerhauses Weber-Züttel in Ins emporschwang.
1
Vgl.
Lf. 436,
Gw. 486.
2
Irlet.
3
Früher mit als Bild für Wertlosigkeit gebraucht: «Ich geb dir nit ein böse krumme gufen» um deinen Ablaß.
NMan.
4
Vgl. die «Hudelchacheli»
Gb. 422.
Der vorhin erwähnte Reinlichkeitsdienst vollzieht sich bei den heutigen Einrichtungen i n der Chuchchi, wie früher im Oofe nhụụs ( S. 331 ff.). Da finden sich die Bụụchbü̦tti, das Chessi oder der Ggụ̆́löös ( la couleuse), der Bụụchzụ̈ụ̈ber (Mü., zum weniger scharfen und langen Bäuchen der Zieche n, damit diese di an͜deri Wesch nid verfeerbbi), eine Reihe anderer Zü̦ü̦ber (z. B. 1791 in Twann ein Chupferzüber), ein Chü̦ü̦bel, welchen äi’m umg’heie n so viel bedeutet wie: ihm d’s Glück verdeerbbe n. Nur flüchtig seien erwähnt: D’Chelle n, d’s Gätzi, der Handlumpe n, d’Wäschchachchle n, der Bassänghaafe n.
Ebenso Haafe n (z. B. 1791 in Twann ein ehrige r [eherner] Brathafe n), und Pfanne n (ebenda ein Chupferpfänni und eisige, [ ịịsigi] Pfannen) zum Kochen, sowie irdene Geschirre mit der unentbehrlichen Glasur, Glesụụr. Eine häßlich gewordene Weibsperson (welche g’wüestet het), hat ebenfalls die Glasur verloren; si mangleti an͜ders z’glesụ̈ụ̈re n.
In solchen Fall kommen unbildlich all die Heefe n als Milchbehälter mit Zuegge n (Schnabel) und Handheebe n, die Chupferschüßle n (1791 in Twann), die Térrine n als Suppe nschüßle n, 437 das Solootschüsseli oder das Săle̥die̥ ( saladier), Săle̥dieli, Salle̥dierli. Gleichsam als Großmueter der hee̥rtige n (irdenen) Tăßli mit Gaffeeblättli (Untertasse) paradierte sonst auf dem Tisch die bleechigi Gaffẹchanne n mit dene n drụ̈ụ̈ne n Bäi n, d’s Drụ̈ụ̈bäi n. Die Channe n überhaupt hieß einst auch in Twann die Kandten (1569), wie d’s Chännli: das Käntly (1674). An sie erinnert die Gaffẹmühlli, deren Drehkurbel jetzt Handheebe n heißt, sonst aber der Lịịr-um genannt wurde. Das Tụ̆́long und die Näpf von Bleech oder Holz, der Zimmischratte n und ein Dutzend Chöörb sind weitere Einzelheiten des gesamten Chụchchig’schir rn, welches wir in frühern Bände n erschöpfend aufgeführt haben. Ein Brunnchessi und ein Schaalchessi aus Twann von 1791 mögen das Register vervollständigen.

Der alt Gilium (Guillaume Dietrich), Gampelen
Schaufel und Besen in einer Ecke (auch der mụtz Beese n oder Stumpbeese n, Stumpe nbeese n, Stoupbääse n fehlt nicht) deuten auf die Reinhaltung des Hauses, welche einst zugleich ein Fernhalten böser Geister bedeutete. 1 Ohne Rücksicht auf das Kunstwerk der 438 Spinne wird dabei jeder Spinnhoppele n (so heißt sowohl das Gewebe wie das Tier) der Krieg erklärt.

|
|
D’Gampele Grosmueter |
Ein sonst zum Zü̦ü̦gstuehl oder Zü̦ü̦gbock gehöriges Zü̦ü̦gmässer ruht zum Spĕrn mache n (der Span heißt das Spĕrn) in einer Ecke des Feuerherdes, wo auch die Oofe nziehe n oder der Oofe nchratzer, das Oofe nchratzerli stehen. Die nun fast überall durch das potager ersetzte Fụ̈ụ̈rplatte n erwärmt im Privathaus ohne besondere Nachhilfe den Zimmerofen. Sie macht besonders d’s Oofe ngu̦ggeli oder d’s Oofe nloch, d’s Oofe nhu̦u̦li, d’Oofe nhü̦ü̦li zum « cachet» für warm zu stellende Sachen, das Oofe ngu̦nggeli oder Oofenegge̥lli aber zu dem von Anker so unermüdlich gefeierten «gemütlichen Winkel». Die Gemütlichkeit wird erhöht durch das Scheeme̥lli: die umlaufende Bank zum Aufstemmen der Füße, sowie in nun verschwundenen Häusern durch das mittelst Dechchel (Klappe, trapon) 2 verschließbare Oofe nloch ( trac), welches behagliche Wärme ins Obergemach entläßt. So ist es noch zu sehen im Wirtschaftsgebäude der Bielerinsel. Es bot dem Flüchtling Rousseau den bekannten Schutz vor Verfolgern. Ein längst abgebrochenes Häuschen am Ende der Müntschemierstraße zu Ins gewährte den Aufstieg ins Obergemach sowohl vom Tenn, wie vom Stubenofen aus.

|
|
Aus Gampelen |
439 Von den allerwärts üblichen graaue n San͜dööfe n (Sandsteinöfen) bietet einer im Inserdorf mit seinen Oofe ntritte n und der hübschen Bezeichnung «1768 AG.» (Abraham Gatschet) einen sehenswerten Anblick. Viel verliert an Aussehen der mit Kalk verstrichen und daher graulich wị̆ß Oofe n. Um so vornehmer präsentierten sich selbst und gerade in den Strohhäusern des alten Ins bis zu dessen Bränden von 1798 und 1848 (s. u.) die grüenen Oöfe n: Chachchelööfe n, deren Anker es ganzes Album voll abgma̦a̦le n het. Ein solcher vom Jahr 1619 steht noch im Haus Louis zu Ligerz. Allein die Westschweiz zeigte noch ältere und zudem kunstreichere aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts. So vier grünglasierte Kacheln mit Fabeltieren. 3 Aus dem 16. Jahrhundert lieferte besonders Twann 4 und speziell die Chroos ( S. 21) museumswürdige Stücke. So drei grün glasierte Reliefkacheln, welche Simson mit dem Löwen, 5 einen römischen Imperatorenkopf und den Apostel Matthäus darstellen; drei grün glasierte Gesimskacheln mit Reliefs eines Löwen, von Putten und Grotesken; eine grün glasierte Kranzkachel mit Reliefs von Delphinen und Ornamenten; eine farbige Reliefkachel, die einen Engel als Schildhalter und die Bezeichnung 440 H S 1598 trägt. Aus dem 17. Jahrhundert: eine blaue Ofenkranzkachel. 6 Schön wị̆ß u nd blaaui zeigt das Widmerhaus in Ins. Aus dem Jahr 1810 werden Ofenblatten aus Gri̦ssḁch erwähnt. 7
Öfen, deren Kacheln ebenfalls selbständige Malereien darstellen und sich von der Monotonie heutiger Fabrikate weit entfernten, baute in den Jahren 1750-1780 auch Landolt in Neue ntstaad, 8 gleichzeitig also mit dem Ofenbauer Michael Leontius Küchler in Muri und Luzern. 9 Ofenkacheln im Neuenstadter Rathaus stiftete Landolt zum Dank für seine Aufnahme ins Bürgerrecht. Neben ihnen machten sich die Hafner 10 ( S. 39) Abraham Künzi zu Erlach (1697) und Bitto in Biel (1732) 11 einen Namen. Künzis Nachfolger waren die Scheurer in mehreren Generationen. 1760 durfte der Haffner Johann Heinrich Beertram von Erlach einen Brönn-Offen auffrichten. 12 Öfen, wie der eben so riesige wie heimelige im Löwen zu Kerzerz, zwei außerordentlich sehenswerte im jetzigen Stuckihụụs zu Ins, einer in der Wohnung der Emma Müller († 1913) zu Erlach, der 1912 nun gänzlich abgetragene im ehemaligen Dokterhụụs Müller zu Ins u. a. m. reden von ihrer Kunstfertigkeit. Ebenso Reliefkacheln im Hause Probst und gelbbraune Kacheln im Haus Pauli. Die Hafnerei Erlach bestand bis 1850.
Ihre Kunst brauchte dagegen nicht am Begriff des Ofner zu haften. Das Wort bedeutete vielmehr ein Handwerk und war bereits 1585 (wie bei Ludi Offner), ja im Guggisbergischen schon 1533 (z. B. bei Symon Offner) ein Geschlechtsname. Die «Öffner» erscheinen 1645 zugleich mit den Dorfmeistern als Fụ̈ụ̈rg’schạuer, welche «die Feuer-Stett zu besichtigen» (1799 Ga.) und das jährlich zweimalige rueße n (1800 Ga.) zu überwachen hatten. Das Chorgericht überwachte seinerseits auch ihre Tätigkeit. So sehen wir 1657 die «Offner» zu Ins vor Chorg’richt b’schickt, weil sie gestatten, dz etliche Lüht an den Sontagen bachen vnd dz offenhauß nit byzythen beschließen ( b’schließe n, vermache n). Es wurde Erkennt: dz bachhauß ist am Sambstag by Sonnenschyn zu bschließen vnd niemand auff thun. Wenn solches wyters zur Klag käme, würde man sy darumb hertiglich Straaffen. Dennoch ließen die Offner immer wieder backen bis zur sonntäglichen Predigtzeit. Da beschloß 1659 das Chorgericht: Sie sollen künftig an Sambstagen im Sommer um 4 und im Winter um 3 Uhr schließen und den Schlüssel dem Statthalter übergeben. Selbst das scheint nicht lange gefruchtet zu haben. Drum ließ das Chorgericht am 24. November 1661 durch den Schulmeisteren eine schärfere 441 Ordnung in der Kirche by Offentlicher Versammblung verläsen. Die sollte sich auff alle Dörfer in diserem Kilchgespält 13 erstrecken, damit Feüwrsgefahr vnd anders vermittet werde.
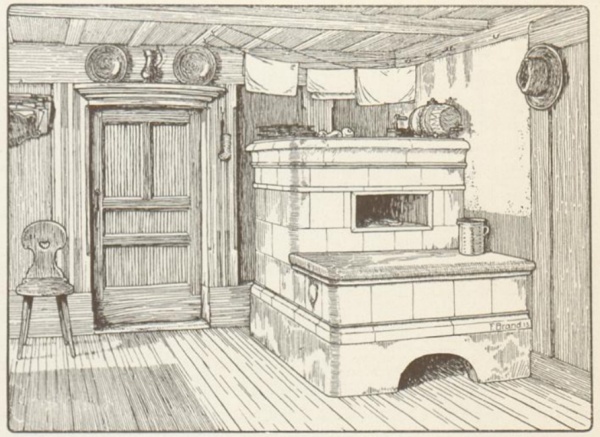
Ofenecke aus Notar Scheurers Schreibstube, Gampelen
Das Chorgericht wachte also doch auch über Fụ̈ụ̈r u nd Liecht, bi welchem als dem Synonym von Haus und Heim eine Familie «sitzt». 14 Feuer und Licht gingen vor der Gasbeleuchtung (in Biel seit 18. und in Bern seit 31. Dezember 1862) und besonders vor dem elektrischen Licht ( S. 232) oft auf sehr gefährliche Weise ineinander über. So 1589, wo Feuertransport in einer Lanteerne n (vgl. dazu die Hälj Laternen in Twann 1679) als etwas Gewöhnliches gegolten haben muß. Da wurde (am 1. Juni) eine Weibsperson vom Chorgericht gefragt, ob sie wirklich in einer bosen ( böo̥se n, schadhaften) glöchereten pfannen für gereicht ( Fụ̈ụ̈r g’räicht) habe. Sie sei doch von NN. beschulten (scheltend gemahnt) worden, sy söle ein Lateernen nemen oder doch ein gut geschirr, das ( daß, damit) si das für 442 ( Fụ̈ụ̈r) gewarsamen muge. Do habe si im (dem Mahner) bösen bescheid geben, im gefluchet und geschulten: Krott menli! herd menli! 15 er solle iren fünff pfund kuder in arß blasen (mit züchten zu reden), sie wolle noch ein bösere (Pfanne) nemen. Ist reuig. Strafe: Herdkuß (s. « Chorgericht»), 1 Tag und 5 Nacht 16 kefi ( Cheefi), und 5 Batzen Buße. 1663 wurde mit einer Liederligi, ob der bald ein Haus verbrannt wäre, Ein kachlen ( Chachle n) mit feüwriger glut, Spän und strouw herumgetragen. Da war (1657) Ein liecht, in einen vßgeholten ( uusg’hü̦ü̦lete n) vnd gelöcherten kürbs ( Chü̦ü̦rbs) gesetzt, harmloser. Es war ja so leicht ausgelöscht (1839: gelöschen, glösche n), wi das alte Gänggi und das Ampeli (Lämpchen und Lampe jeder Art).
«Bei der Lampe n» oder «um die Lampe»: auch das war ein Lieblingsmotiv Ankers. Im Bilde «bei der Nachtkerze» hinwieder zeigte er die Kunst seines Lichtauftrages. Das Licht der Cheerze n kann ebenso feierliche Stimmungen erzeugen, wie profaner Stimmungen Zeuge sein. Jenes z. B. bei der Wandelkerze als Windlicht zu Prozessionen, 17 dieses ob nächtlicher Zecherei bei der «Viererwärtigen Kerzen» (1668), die einen Vierer wert war.
In alter Zeit gehörte schönes Lichtgerät für äi’m z’zünte n zum Trossel ( trousseau, trossé) oder zum Mö̆beliaar wie das B̦uffe̥rt oder Bụ̈ffee (Glasschränkchen) über dem breiten, niedrigen Schaft (Schrank) oder dem Schụ̆́plaade nstock mit f rei e n chläi n mäṇ’gem Schu̦plaade n. Zwischen die beiden Hauptteile schiebt sich öfters der Bụ̈roostock ein. Ferner seien erwähnt: die geebig (bequem) fächerreiche Gụ̆́moode n; der altväterische Tisch, Disch mit den Gri̦ttifüeß (geschnitzten Kreuzbeinen); der Bank und das Tắbe̥ree 18 usw.
Für sich aufgeführt seien die Better oder Betti. Das Bett wird spassig als das Hu̦u̦li, auch etwa als der Wäbstuehl bezeichnet. Das Bettzụ̈ụ̈g ruht noch heute gern auf dem Strohsack als dem Stiere nfeederenun͜derbett. 19 Wir wollen schlafen gehen: mier wäi n i n d’s Strou oder: uf d’Stiere nfeedere n. Die wirklichen Flaumfedern füllen ebenso das unzweckmäßige, weil Rheumatismen erzeugende Un͜derbett, wie die im Winter willkommene Deechi, das Dachbett (1752: dackbeth) mit der Zieche n, Aa nzieche n, dem Aa nzu̦u̦g (1639). Die Decke, sowie das Hạu ptchü̦ssi (1770: «zwo haupt küsi federiten» als Brandsteuer) oder Hạub tchüssi, Hougchüssi (Lg.) nebst Lịịnduech 443 bedürfen zweckmäßiger Besonnung: mi soll si sunne n i n dene n Monḁte n, wo käi n r häi n. 20 Früher, z. B. 1751, übte man auch das b’strịịche n. Obschon nämlich sonst auch in erlachischen Bauernhäusern g’woobe n worten isch und in Vinelz noch heute ein Weber wäbt, waren gute Federsäcke zu allen Zeiten schwierige und seltene Gewebe. Dies namentlich, wo es sich um zweu- bis drụ̈ụ̈schlöoffigi, nicht bloß äi n- oder an͜derhalbschlööffigi Better oder Betti handelt, die sich früher auch hier in einen Chaste n (1778) 21 fügten. In diesem fühlte sich zudem, hinter dem wịß- oder blaugstrichlete n Bettumhang geborgen, der Schläfer bald erwarmet, ohne einer Bassine zu bedürfen, oder die Füße vorerst über einem Gluetchessel, Gluethaafe n, Gluetheefeli, einem Schŏ́fe̥bie̥ ( chauffe-pied) bähen zu müssen. Warm gi bt wegen seiner Schmalheit auch das Rueijibett (1654: Ruhwbettli), das « Rollbeth» (1662), das Gu̦tschli (kleines Stehbett), das frühere Un͜derstoosgụtschi, die Wa̦a̦gle n (in Erlach: d’s Wiegeli), 22 sofern die Kindswärterin mit dem Wa̦a̦gelban͜d das Dachbettli aa nbin͜dt. Dagegen gehört das wa̦a̦gle n, wiegle n, Bụtteli mache n, bụttele zu den mehr und mehr verpönten Mitteln, das Kind mache n z’schwịịge n u nd z’schla̦a̦ffe n.

Aus Ins
444 Nichts Besonderes ist hier über «die Uhr, das Herz der Zeit» 23 (z. B. die stähelne [ steechligi] Wanduhr von 1791 in Twann) und über das «spiegelglas» 24 (den Spiegel) an der Wand anzufügen, so sehr der Gleichklang der Mehrzahlen Betti und Zịti dazu einzuladen scheint. Gern lassen wir uns dagegen durch Ankers «Kammer mit Blumenstrauß» an die Mäie nheefe̥lli vor den Fenstern voll Granium, Schlü̦sseli (Hyazinthen) und dgl. erinnern. Ein Klima, das in Ins und Vinelz zimmerhohen Kaktus gedeihen läßt, könnte es allerdings in solchem Hausschmuck dem so blumenfreundlichen Emmental noch weit zuvortun. — Neben die Krone der Pflanzenwelt sei die Zierde der Tierwelt gestellt in dem gefangenen Sänger: dem Chreeze nvööge̥lli, sonst Karnaari geheißen.
1
Samter 32 f.
2
Brid. 378.
3
Im Landesmuseum Zürich (MZ.); vgl.
Anz. N. 2, 15 ff.; 5, 79; 7, 278-280.
4
Zum großen Teil von Kurt Irlet (in reichem Maß und fachkundig) aufbewahrt.
5
Richt. 14, 5 f.
6
MZ.;
Anz. N. 7, 51 f.
7
LBI. 99.
8
Laut Biographie von Dr. Schwab in St. Immer.
9
Anz. N. 3, 72-79.
10
Stauff. 35.
11
Anz. N. 1, 46.
12
Schlaffb. 1, 267.
13
Stimmt am besten zu agf.
spélian (schützen, hegen), womit «Kirchspiel» als umgrenzter Bezirk erklärt würde.
Kluge 243. Vgl. übrigens das Kirchenkapitel in «Twann».
14
Urb. Mü. 12.
15
«Erdmännchen» (Zwerg) also als Schimpf; vgl. das «Chrotte
nmodel»
Gb. 278.
16
Alter Plural (wie «Tag»).
17
NMan. Test. d. Messe 15.
18
Schöne geschnitzte Stuhllehnen zeigt
Bdbg. 66.
19
Ochsefäderenun͜derbett: Gfeller, Heimisbach 44.
20
Gb. 394. Gemeint ist: im lateinischen Namen. Hübsch sagt Abrecht in
Lg. 111: Das Dorf Längnau liggt darg’spreitet wi n e
n
Bettsunnete
n unger am Jurahang.
21
Vgl.
Gb. 395.
22
Gb. 393.
23
Rosegger.
24
HRMan.
Die Bauernstuben des von seinen kleinstädtischen Bezirkshauptorten und von dem nahen Neuenburg so sichtbar beeinflußten Seelandes zeigen das überall beobachtete Durchsickern herrschaftlicher Gewohnheiten und Einrichtungen in besonders starkem Maße. Wie nahe berührt sich eine heutige Inser Dorfstube mit den Zimmern des alt Landvogts von Graffenried im de Pury-Sommersitze zu Ins von 1801! 1 Da barg auch das Bett «In deß Herren Stuben» ein Un͜derbett auf der Madratze n und unter dieser den Strausack. Besondere Bequemlichkeit bot dem alten Herrn bloß die von der Decke herunterhängende Bettstrange n. Als Träger des Betthimmels ist das soupassement des Inventars zu deuten. So schreibt 1776 Schaffner Irlet, der dem Hauptmann Fischer in Bern die Herbstwohnung auf Engelberg zu Twann rüsten soll: Das Rothe Bett habe ich aufgemacht. Aber die Umhäng sind viel zu lang, es sind auch keine suppassement Stängli. Soll ich Stängli machen lassen, oder werden sie mitgebracht? Und soll ich die Umhäng aufschlagen? Das Wịsịte nbett in der grünen Stube war ungefähr gleich beschaffen. Als halbe Grümpelchammere n dienten die Dienste nstube n; als völlige solche enthielt das «Rubelj Stüblin»: 1 Mehlkasten, 7 Wöschseil und 1 Seiffenseil, 16 gläserne Glocken, 1 kupfernen Betttägel, 1 Bolzwa̦a̦g usw. Zwei Brennhäfen u. dgl. fanden sich «Auf dem Estrich annoch» (also auf dem Dachraum, während das der Estrich ụụf führende Estrichweegli zu Ins auf die Grundbedeutung hinweist: ebenes Bodenstück zum Sonnen von 445 Gegenständen). 2 Das «Grümpelgemach» des Estrichs barg 1 Ankentrüllen, 3 Bräzelenịịse n, 1 Glettöfeli (noch heute wird im Hause de Pury mit dem alten Glettịịse n und gußeisernem Stäi n, Fụ̈ụ̈rstäi n, geplättet), 1 Calandre (zum glanderiere n) samt allem Zubehör, 1 Vogelchreezen und 1 alte Papageikräzen usw.

|
|
Studie von Anker |
Schreiten wir wieder hausabwärts an der Mägdestube und dem Steege nstü̦ü̦bli vorbei, so heimelt uns die «Eßstube» wieder wohnlicher an. Frauen begleiten uns indes wohl lieber nach der hundertjährigen Heer re nchuchchi, und dann nach dem Wäscheschrank. Die erstere birgt u. a. 1 kupfernen Schaalkessel, 3 eherne (eerigi) Dü̦pfi, 5 Tourtières, 1 kupfernen Kuchenschüssel (vgl. der Schüssel, S. 331), 2 Tourtières mit Handheb, 1 « Chocolade Tierre», 1 Mu̦lte nschaaber, 1 Dreifuß, 1 Feurhund, 1 Dröölnaagel (Wallholz, «Chueche ntrööli»), 1 Roseneisen (für «Rose nchüechli»), 1 Hählj ( Heeli), 3 1 Bratspieß, 7 messingene ( möschig, aus Mösch, s̆s̆, gefertigte) Kerzenstöcke, 1 Frisiereisen ( Brönnscheeri, Glögglischeeri), 2 Pfäfferbecki («Vertropfbecki», «Löcherbecki», Löchlibecki), Löffelchessi, 2 Ryber ( Rịịberli) und 1 «Riedhächlen» (Hörfehler für Rüebhächle n?), vgl. der Schị̆bler und der Drücker (für Hördöpfelröösti); 1 sturzener ( bleechige r) Deckel, 1 Gnyper (das Gnịppli, Fläischgnịppli, Fleischwiegemesser), 1 Krautbrett (Brättli, Hackmaschineli, 446 Mắschine̥lli), 1 Wurster, 1 Nydelkübel ( Nịịdle nchü̦ü̦bel) usw.

|
|
Frau Stauffer, Gampelen |
Ein g’wun͜derige r Blick in den Längsche nschaft endlich zeigt uns gemäß alter Bauernart räini (feine) und grobi Linges: 367 Zweecheli, 13 reine und 16 grobe Handzweecheli, 19 grobe und 8 reine Handzwechele n usw.; 27 Tassenzwecheli ( Abtröchnitüechli), 121 Chuchilümpe n, 34 reine und 32 grobe Tischtüecher, 48 Zieche n (Bettanzüge) usw. Vergleichen wir damit das «Fädergwant» von Twanner Inventaren: 1 grüner Umhang samt Bettstadt und Himmel (1795; 1776: Himlezen); 1 Unterbett von weißem Trilch (und 1 von Trilch mit blauen Strichen); 1 bestreich Unterbett; 1 Schürletz Deckbett; 1 Hauptküssi von Trilch mit blauen Strichen; 1 bestreich Hauptküße (alles 1791); 2 Tachbettzieche n (1678), 2 kölschene ( chöltschigi) und 2 weiße Unterbettziechen, 2 kölschene Deckbettziechen (1791), ein Tabis ( Tắpị̆, 1776). An Tischzeug: bildete (’bildeti) Tischlachen (mit eingewobenen Zeichnungen), strichen Tischlachen (g’strichleti), gestrichelte Handzwehelen usw.
1
Vgl. «Hausrath eines geistlichen Herrn von Bern im 14. Jhd.» (Dr. G. Studer im
AhV. 7, 415 ff.), sowie «schiff, gschir und hußratt» 1540 zu St. Johannsen. (
SJB. A 161).
2
Vgl.
Gb. 333.
3
Lf. 224;
Gw. 417 f.;
schwz. Id. 2, 1133 ff.
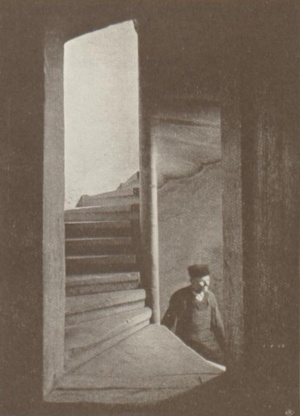
|
|
Rundstäge, Stauffers,
|
Von dieser mundartkundlich getroffenen Auslese blieb das Möbeliaar, welches vor hundert Jahren die guten Stuben des alten ländlich-sommerlichen 447 Heerehụụs zu besetzen pflegte, fast unberührt. 1 Die nämliche Bezeichnung «Herrenhaus» kommt einer Reihe anderer Gebäude zu, welche sich äußerst augenfällig von den Bauern- und Geschäftshäusern des Dorfes Ins abheben und als Sommersitze städtischer Herrschaften aus Bern und Neuenburg (s. «Twann») gebaut worden sind. Nur so erklärt sich ihre teilweise riesenhafte Ausdehnung, sowie die Größe und Höhe ihrer Gehälter, welchen nur durch kostspielige Umbauten die winterliche Unwohnlichkeit benommen werden konnte oder kann. Vielfach ohne Kenntnis und Berücksichtigung der Launen des seeländischen Klimas bauten städtische Werkmeister, deren einem auch die Erstellung des stilvollen, aber leider gründlich durchfeuchteten Pfar rhụụs oder Pfruendhụụs auf dem herrlich sonnigen und aussichtsreichen Platze anvertraut war, nach städtischer Schablone drauflos. Für die Zweckmäßigkeit entschädigten da und dort, z. B. im Tschaggeneihụụs Kramänzel 2 teils bŏßliger, teils aar tiger, g’lungener (d. h. seltsamer), teils gefälliger Art. Zu letztem gehören Blumenmalereien auf Wänden und Balken im stäinige n Saal des Estrichs im erwähnten Tschaggeneihaus ( S. 449).
448 Saal und Seeli, die als ursprünglich herrschaftliche Einzelwohnung des Grundbesitzers verschiedentlich zu Ortsnamen geworden sind, erinnern an verwandte solche, die aus dem Romanischen gekommen sind. So an casa (Haus), dessen präpositionale Zuspitzung « chez» der deutsche Freiburger und der in seinem Gebiet sich heimisch machende Guggisberger in Wendungen wie: «bii n ĭ̦s anhi n» ( chez nous), «bis bịị mme̥r», «va n ụ̈ụ̈s e nwägg» u. dgl. nachahmen. Die Erweiterung casaria, versus casarias, vers les cheseyres 3 spiegelt sich u. a. in Gääserz, Gääse̥z, das wir auch als «Kehrsatz», 1478 als Gärserts, 1479 als Gersatz 4 geschrieben finden. Dagegen hört man um Bern für das benachbarte Kehrsatz: Chä̆se rz und früher Chäärschĭ̦ts. Auch die keltische «Hütte»: cab, caban 5 ist verewigt in der Mehrzahl cabanes, latinisiert capannae, Chavannes (um 1262), 1499 à la Chavannaz (vgl. die Rue des Chavannes in Neuenburg und Zavannes im Wallis), 1315 Otto von Tschaffans, 1386 Tschafans, 1338 Zschauans, 1393 Zschafans, 1534 Tschaffys, 1593 und 1801 Tschafis, in Twann 1678 Tschaffĭ̦s, Tschaafis, Tschaafiz, Schaafis, Schaaffis, Schaffis. 6
|
Haus des Salzgutverwalters Jenner in Bern, jetzt Rebleutenwohnungen und Kellereien des Spital Pourtalès |
Tschaggeney-Haus; dann Schmiede, nachher Käserei, später Post, jetzt Eisenladen |
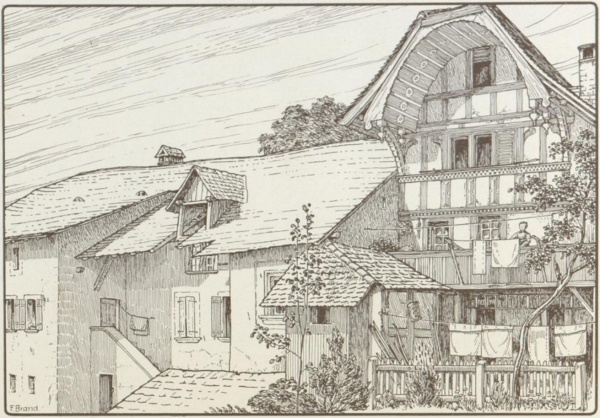
Aus Ins
Noch gibt es unter der Twanner Hütte nflueh die Hütte nreebe n, und als unterstes Gebäude des Dorfes Ins stand 1798 vereinzelt das Mụụserhüttli. 7 Sonst bezeichnen wir nun mit Hü̦tte n ein bloß gewerblichen Zwecken dienendes, altes, kleines Gebäude nach Art der Tu̦u̦rbe nhütte n ( S. 168) im Moos. Wer heute eine solche bewohnen wollte, würde an die Lobsiger Familie in den dortigen Sandsteinhöhlen erinnern. 8 Oder auch an das ehemalige Chu̦chcheli ( S. 49) unter dem prächtigen Nußbaum westlich der Strafanstalt Ins, bewohnt von dem Einsiedler Stäubi-Sämmel oder -Sammi (Samuel Küffer, † um 1899), der mit dem Esel als Grämpler das Seeland absuchte, als Neuja̦hrsinger, vom Hund begleitet, ist chnäulige n (auf den Knien, vgl. är ist g’chnäulet) ga̦ n singe n und als Lohn ganzi Hu̦tte n voll Broo̥t heimtrug, auch mit Hilfe seines zăhme n Säüli Trüffeln suchte. Er erfreute sich überhaupt seitens seiner Haustiere größerer Anhänglichkeit als seitens der si̦i̦be n Wịịber, deren eine nach der andern ĭhm fu̦rtg’lü̦ffen isch — nicht ohne daß eine einen sehr intelligenten Großsohn hinterlassen hätte. Die Anlage der Wohnung: e̥s păr Stü̦ü̦d i’ n Booden ịịchḁ g’schlaage n, rächts u nd linggs Strau dḁrvor un d z’mitts es Tü̦ü̦rg’räis, setzte allerdings weibliches Asketenheldentum auf eine etwas kitzliche Probe. Dazu kam der Schabernack von Bengeln, der oft genug in verächtlich dumme oder schlechte 450 Streiche (Einbruch u. dgl.) ausartete. Mit Erfolg erwehrte sich dieser letztern das Eselhụ̈ụ̈slimannli. Das hatte in einer Art Balm über Twann, welche in der alten Heimatlosenzeit auch sonst als Unterschlupf diente, sich mit Esel, Gäis, Hün͜d und Hüener nicht ganz unwohnlich eingerichtet. Der Einsiedler brauchte den Jungen, die mit ihrem Zuruf: Eselhụ̈ụ̈slimannli, nimm mi ch! ihn herauszufordern kamen, nur mit der Kanu̦nne n vor der Tü̦ü̦r, d. h. mit dem tüchtig ausschlagenden Esel vor der Wohnung zu drohen, und die Bande stob für ein Weilchen auseinander. Vor größerer Unbill schützte ihn der Verstand der Erwachsenen, die vor seiner vielseitigen Kunst als Vehdokter, als Hächler und als Sänger selbstgedichteter schöner Lieder Achtung empfanden. Das Seeland bietet eine Fülle von Übergängen zwischen solch primitiver Wohnung und dem Dḁrhäim (Mü.) herrschaftlicher Häuser. Der Umschwung der letztern heißt Hof. (S. «Twann».) Man spricht in diesem Sinne von Bụ̈ụ̈ris Hof als Teil des Gutes de Pury, sowie vom Rennishof als Umgebung des ehemaligen Hauses Reynier, das nun Herrn Dr. Hagen gehört. Dagegen nennt sich «Hof» ( S. 6, 298) heute kein seeländisches bäuerliches Privatgut mehr, wie sonst die beträchtlichen bernischen. Ein noch so ansehnlicher Besitz an Land, Obst- oder Bạumgarte n und Gemüse- Garte n heißt Guet. Ein noch so stattlicher Hofraum hinwieder nennt sich, soweit er mit Sandstein belegt oder nun zementiert ist, Tắresse n (Terrasse), soweit er mit Pflastersteinen b’setzt oder b’schossen ist, die B’setzi (Br., Tr.) oder die B’schü̦ü̦si. ( B’schieße n ließ Aarberg 1563 die Stadt um 125 Gulden, 6 Määs Roggen und 1 Mütt Dinkel.) 9 In Kerzers gilt dafür d’s Tä̆fel ( tabulatum).
Vom sonstigen unterbernischen Hof unterscheidet sich das heutige seeländische Gut auch darin, daß es wo möglich alle notwendigen Räume unter das eine Dach des Bụụre nhụụs zieht. Zu jedem solchen gehörte vormals auch hier ein freistehender Spịịcher. (In Brüttelen und Müntschemier steht noch einer, in Ins keiner mehr.) Ein Spịịcherli steht oben im Dorf Kerzers. Das oft sehr stattliche kleine Gebäude war im Erdgeschoß g’stü̦ü̦det, d. h. in Ständern gebaut, in dem um die Breite des Tragbalkens vorragenden Oberstock « g’chlaffet» oder vielmehr g’chlappet, d. h. mit Flecklig g’wättet. 10 Dagegen fügte sich von jeher das Schụ̈ụ̈rweerch mittelst des Tenn (1657: das thän) 11 451 an den Wohnteil, indes die primitiven Oofe nhụ̈ụ̈sli als Korporativbesitz ( S. 331 ff.) ihre Vereinsamung fortführen. Nur ausnahmsweise erinnert ein Stock oder Stöckli in seiner Bestimmung an das Emmental, in seiner Bauart aber an die turmartige Wohnung der Burgundionen (s. «Twann»). Die drei ersten Häuser von Treiten (dessen Name dort aus diesem Zahlwort abgeleitet wird) waren Stöck. Zwei derselben stehen noch. Der dritte dagegen, durch ein Bauernhaus ersetzt, trägt bloß noch den Namen bi’m Stock. Gleich verhält es sich bei dem 1846 neu gebauten Stock zu Finsterhennen.
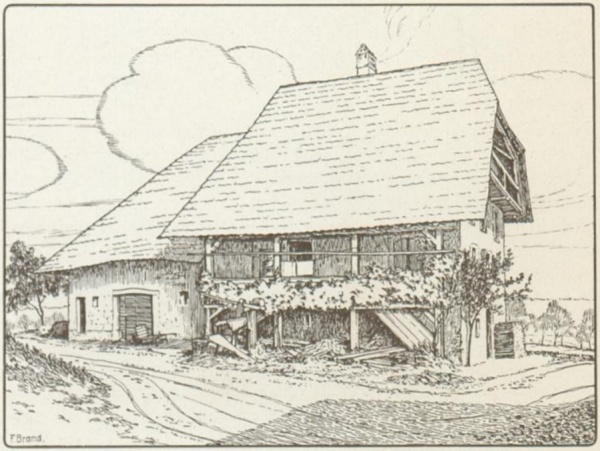
Der «Stock» in Finsterhennen
Die Zentralität auch des seeländischen Bauernhauses nötigt in Verbindung mit den durch die Mooserträge so stark vermehrten Ernten von selber zum stelle n immer stattlicherer Gebäude. Es gibt nun solche sogar mit Mansardendächern. Zimmermeister wie Jakob Hämmerli von Vinelz in Ins errichten ebenso gefällige wie solide Bauernhäuser, während die nach dem Brand von 1848 ( S. 462) rasch aus grünem Holz ụụfg’stellte n doch als e n chläi n lützel (lotterig) sich erweisen. Nur die genügende Beschaffung von Schatte n u nd Scheerme n (1678 in Twann: Herberg, Schatten und Schermen) vereinbart sich allezeit 452 schwer mit den Ansprüchen auf stattliches Aussehen. An Straßenzügen wie zwischen Dorf und Bahnhof Ins wächst Gebäude um Gebäude wie von selbst aus dem Boden hervor, und immer neue Profile erinnern mit ihren vier langen, dünnen Stangen an den Witz eines Bauern. Dem begegnete ein befreundeter Stadtherr in Begleit eines großen, aber vor Magerkeit bäi ndüür re n Hundes. Der Mann beschaut sich das Tier wie nachdenklich eine Weile und frägt dann wie aus einer plötzlichen Eingebung heraus: Aha, dier wäit schịịnt’s e n Hun͜d haa n. «Was, haben wollen. Habe ich da nicht wirklich einen?» Jää sooo̥! I ch ha n g’mäint, er sig bloo̥ß aafḁ n prŏfịịlet!
Bei solchem Planieren und Profilieren, mit Spanndienst und Handreichung während der ganzen Bauzeit vom Graben des Fundaments 12 bis zur Ụụfrichti mit dem Segen bringenden Tannli, bis zum ịị nzü̦ü̦gle n und zu der Hụ̆sräüki arbeitet der kleinere und größere Bauherr meist selber mit. «Der Schlüssel i n d’Han͜d» bu̦wt (bemerke: i ch bu̦wwe n, du bu̦wwist usw.) also der Baumeister oder der Zimmermeister nicht häufig. Doch liefert dieser, da privater Waldbesitz selten ist ( S. 238), in der Regel das Bauholz und überläßt dem Bauherrn eher die Beschaffung der Bausteine aus dem Juragehäng ( S. 37) oder vo n der Flue ( S. 43), ergänzt durch die Waren der Baumaterial-Handlungen von Ins, Müntschemier, Erlach. Denn reiner Holz- und reiner Steinbau treten heute gleicherweise zurück vor dem Rigelwärck (1574), Rigelwärk (1594): dem g’ri̦i̦gete n (1641: ingerigeten) Fachwerk. Gerne wird noch heute mit Haberstrou, welches in den Mörtel «gewickelt» worden, g’wi̦gglet. Solcher Wi̦ggel ist warm und troche n und dabei so dauerhaft wie Sandstein.
Die baukundlichen Fortschritte der Neuzeit unterliegen allerdings in der Bauernschaft immer in gewissem Maße dem Dämpfer des zu starker Kritik geneigten Herkommens. Mit diesem muß namentlich rechnen, wer sich an die — für sich so schöne — gegenseitige Aushilfe mit Material und Arbeit gewiesen sieht, 13 weil für ihn Geld und Zeit kostbar sind. Ein Finsterhenner Haus kostete denn auch im Jahr 1776 bloß 400 Kronen: 100 das tannig und 100 das äichig Holz, 100 die Lade n und 100 die Taglöhn. 14 Wie rasch auch ist mit nachbarlicher Hilfe so ein nach allgemein gültigen Regeln geplantes Gebäude erstellt bis zum letzten Strụụbe n-, Niet- und Li̦i̦ste nnaagel oder -zwäck, zu den Zu̦u̦g- und Winkelbän͜der und Winkelchlammere n usw.! Wer sich ferner in 453 Geheimnissen wie den der hölzige n Zapfe n im Äiche ng’schwell alter Häuser auskannte, half zu den Zeiten der Zwangsenteignung für die Juragewässerkorrektion, sowie in der Wohnungsnot von 1848 ( S. 462), mit Stolz von eenet dem Moos Hụ̈ụ̈ser transportiere n. 15 Die Kunst erstreckte sich sogar auf Häuser mit Wi̦derchehrig (Kreuzfirst), und zwar ohne jegliche Schädigung alles dessen, «was Nagel und Nuth fassen und begreifen thut» (Twann 1678).

Gampele-Mäitli singet äis!
Weit weniger als im Alpen- und Voralpengelände gab man von jeher im Seeland auf den Schmuck der Hausfront. 16 Gleich selten wie Fassadenmalereien 17 in Erlach und in Gampelen sind Hausinschriften. 18 Von den uns aufgefallenen seien hier zunächst zwei aus Treiten, welche 1912 der Hauserneuerung weichen mußten, wiedergegeben:
Min aus und ingang, Her, bewahr,
Das ich gerat in kein gefahr,
Ich sei zu Wasser oder Land,
Leit mich, Her, mit diner Hand. 1728.
454 Disem hvs volch leist, das sei wandlen auf deinem wäg
Vnd alzeit dräfen den Rächten stäg.
Aus Gampelen sei notiert:
Wän nid vnd has brun
n wie ein führ,
Also wär das holtz nit halb so tür.
Aber förcht du Gott vnd halt dich fromm
Bis dein Läben zum end kommt.
1
Interessenten finden das ausführliche Inventar von 1801 im Besitz der Frau
de Pury in Ins.
2
Bei
NMan. 454; T. d. M. S. 228 sind «Kramanzen» (aus
grand merci abgeleitet) Komplimente. Vgl. dazu
Gw. 440 f.;
schwz. Id. 3, 817. Es gibt auch
g’kremänzleti Buechstabe
n, g’kremänzlet’s G’schirn usw.
3
Jacc. 504.
4
Schlaffb. l, 20.
5
Jacc. 82.
6
Mül. 475-7.
7
Kal. Ank.
8
Mül. 337; vgl. die Fluehüsli
Lf. 173. 175.
9
Forer.
10
Hunziker (vgl. Note 16). mit der Photographie des ehemaligen Speichers der Handlung Schwab im Unterdorf Ins.
S. 129. Der Speicher als Schlafort für Mädchen:
Lg. 149.
11
Vgl. die «Tenne» als Ableitung von «Tanne». Der Tennboden besteht aus starkem Weichholz oder aber aus Lehm, mit Ochsenblut durchknetet, damit er beim Flegeldrusch elastisch
noogeeb und so die Körner vor Zerquetschen bewahrt bleiben.
12
Pfulmend (1574); Pfulment:
NMan. So heißt aber 1680 die First.
13
Lf. 181 f.;
Lign. 98;
Ndsächs. 7; Sohnrey (Kunst auf dem Lande) 8 f.
14
Mitgeteilt des frühern dortigen Lehrers Mäder, jetzt in Bern.
15
Z. B. das der
Tante Mathilde in Ins.
16
Vgl. dagegen Giebelzeichen wie
Bdbg. 73.
17
Anz. 7, 256.
18
Vgl.
Bdbg. 76-83; sodann
Lf. 128-133;
Gw. 448-451;
Gb. 338-343.
Wie Bauern ihren Gemeindegenossen Bauholz schenkten, wenn nicht sogar gelegentlich ganze Türen und Fenster, die allerdings vielleicht ungenau schlossen (« g’lodelet» oder g’schli̦tzt häi n): so «verehrten» Rät und Burger von Städten ihren Angehörigen ganze Bauteile. Namentlich Pfäister (in Erlach: Fänster) aus hellem Glas. Das war eine noch schwer erschwingbare Kostbarkeit, bei deren Ermangelung manche Arbeit halb oder ganz feisterlige n abgetan werden mußte. So erhielt 1585 Niclaus Pinschi zu Erlach aus Aarberg ein Fänster in sin nüw Huß geschänkt. Mehrfach lesen wir von solchen Gaben der Gnädigen Herren von Bern. Ein 1581 dem Statthalter Hans Chellent zuor Nüwenstatt vereretes venster kostete ein Pfund. 1 14 Pfund dagegen mit aller zugehört ein fenster, welches 1578 der würt Christian Murer zu walperswyl erhielt, 2 und 15 H 5 ß ein 1563 Herrn Hans Wyßen zu Gals geschenktes. 3 Daß die Geberin das Fenster mit Irem Eren wapen schmückte, ist aus sehr viel andern Fensterschenkungen zu ersehen. 4 Aber auch die Namen von Glaaser wie Meyster Peter Tillier in Bern (1578), wie Hans Rudolff Tüscher in Ins (1677) 5 schienen verewigenswert. Sie machten sich wohl auch rar, wenn wieder einmal, wie 1593, der Lufft die Fenster im obern Saal des Schlosses Erlach gschän͜dt hatte. Mit welcher Lust dagegen schaute man, auf den Pfeisterbank an der Innenwand oder auf die Pfeistersịnse n an der Außenwand gestützt, zum vänster vßhin (1585) oder vsen (1580)! So läßt Anker die «Strickerin» und den «Zeitungsleser am Fenster» ụụsḁ luege n. Einen vollen «Blick ins Freie» genießt allerdings erst, wer das Läüfterli oder gar das ganze Fenster und natürlich vorab den allenfalls vorhandenen Schalụsịị 6 oder die Fellläde n (Tw.), Felääde n (Erl.) ụụfta̦a̦ n het. 455 Ụụfta̦a̦ n oder dụụft, tụụft, 7 wie man in Lengnau und Umgegend, toffe n, wie man im ganzen übrigen Gebiet der Tụụfner sich ausdrückt. Mit diesem Übernamen belegt der unbeteiligte Inser die Bevölkerung von Guggisberg, 8 dann wieder die um Schüpfen, Aarberg und Siselen, sowie die am rechten Bielerseeufer, an Zihl und Aare von Hagneck an bis nach dem Bucheggberg hinunter, welche «öffnen» durch dụụffe n, tụụffe n ersetzt. 9 Auch Treiten sagt tụ̆ffe n, aber ụụfta̦a̦ n.

|
|
Bauernhauslaube, Gampelen |
Diese «Tụụfner» könnten dem Inser mit einem spitzen Vermerk heimzahlen, daß ihm jedes mögliche Verschließen, Zuschließen, Schließen einer Lücke ein vermachen ist. Vermacht ist also auch die in den Scharnierspange n oder Chlööbe n (Angeln) fest ịị ng’hänkti und vom Stü̦ü̦rzel überragte Chäller- oder Spịịcherdü̦ü̦r, sowie die Stu̦u̦be ndü̦ü̦r mit der altväterischen Falle n, Chlapperfalle n usw. Vermacht ist ferner in der Regel das Tenndoor, sowie an der Hüsdü̦ü̦r der ganz alten Häuser der mannshohe Unterteil, indes der obere, kleinere Teil sozusagen wie ein Schalter zum 456 ụụsḁluege n und zum kurzen B’schäid gee n offen bleiben kann. In Zeiten strenger Feldarbeit aber werden wir allerdings die ganze Haustüre verschlossen und Invalide für ganze Halbtage ịị nb’schlosse n (1666: in die stuben bschlossen) finden. Dann hilft auch kein aa nhosche n (s̆s̆) und holla! holla hoh! (hoba!) rüeffe n. Es ist unmöglich, zụchḁ (1580: zuchen) und ịchḁ (1567 auch «inher») z’ga̦a̦ n.
Dieses «hinaus», «hinein», «hinzu» usw. veranlaßt uns hier zum folgenden etymologischen Exkurs. Das im Bernischen 10 noch immer vorherrschende har (wo chunnsch du haar? wi chunnsch du dḁhaar! die chunnt g’strackti dḁrhaar!) überstimmt her (altinserisch hee̥r und hee̥rḁ = «herhar») und unterdrückt als nebentoniges Grundwort das bloß noch in Gebirgsmundarten 11 lebendige «hin». Die Zusammensetzungen hinab und herab, hinauf und heraus, hinein und herein, hinaus und heraus, hinzu und herzu verfließen zu umgestelltem «ab-, ụf-, ịn-, ụs-, zụ-hḁr» und lauten links des Bielersees, sowie modern erlachisch und tschuggerisch (mit intakt erhaltenem Bestimmungswort auf Kosten des Grundworts): aabḁ, ụụfa, ịịnḁ, ụụsḁ, zụụhḁ, oder verkürzt: ăbḁ usw.; bei ältern Insern: aahḁ, ụụhḁ, ịịhḁ, ụụsḁ, zụụhḁ oder etwa verkürzt ăhḁ usw.; modern inserisch: aacha, ụụchḁ, ịịchḁ, ụụsḁ, zụụchḁ, allenfalls verkürzt: ăchḁ usw. Das hier (aus Kosten des Bestimmungswortes) erhaltene h des Grundwortes verstärkt sich also sogar zum Reibelaut, ähnlich wie etwa in modern durchkonjugiertem g’chööre n am Platz des älter inserischen g’hööre n (hören). Den strikten Gegensatz zu dieser Strömung zeigen Lützelflüh und Guggisberg.

Chilmeiers Johannes, Brüttelen
Wollen wir den Hausgang: in Kerzers die Hụ̆sga ng und in Ins das Hụsgang, falls es dü̦ü̦r chgänd oder dü̦ü̦rchgängig ist, in der ganzen Länge durchschreiten, um die Hausteile kennen zu lernen, so müssen wir einen wüeste n Daag abwarten. Dann führt man uns, sofern wir Vertrauen genug erwecken, zunächst in den Chäller, auf dessen Boden das Un͜derg’schlacht die «Chrümme n» für die nicht im Freien (im Loch, S. 221) überwinterten Feld- und Moosprodukte abgibt. 12 Früher (z. B. 1669) konnte unter «Keller» das Erdgeschoß eines primitiven Wohnstockes, worin gelegentlich Dienstboten schliefen, verstanden werden; 1755 diente ein solcher als «Mägdenstübli». Die (voordderi) Stu̦u̦be n unterscheidet sich als Wohnstube der Familie von der Neebe ntstu̦u̦be n und allenfalls (wie 1778) von der hin͜dere n Stu̦u̦be n, welche, wie in d’s G’richtseese n zu Ins, hübsch vertääfelet sein kann. Über den Stuben breitet sich das meist unbewohnte Obergemach: d’Chammere n. 458 Ihr alter Name Fälbe nchämmerli (für Aufbewahrung von Haferkornhülsen und andern Druschabfällen) kann nun meist durch G’rümpelchämmerli ersetzt werden. (Das Gaden als ursprünglich alpwirtschaftliches Gehalt kennt das heutige Seeland nicht mehr.) — Am «sprachhus» (1586) 13 oder an der «Heimlichkeit» (Twann 1777) und am Bịßwaar vorbei schreiten wir nach der Chu̦chchi, um uns den Fụ̈ụ̈rsoller seitlich unter dem Tennsoller oder Hohsoller (der «Reiti») den Cheemischoos mit seinen Schätzen, und das Cheemi der neuern Bauart zeigen zu lassen. In alten Gebäuden tuet’s d’Rueßdị̆li.
Nicht diese ist’s, welche die großen Bedenken wegen Feuersgefahr weckt und die Alten veranlaßte, gäng es g’sun͜dnigs Rŏsịịse n gegen Blitz und Brand auf der Schwelle liegen zu haben. 14 Etwas anderes weckt, im Wettstreit mit poetischer Stimmung, die Furcht vor motten u nd bbrönnen oder brünne n. (Letzteres gilt auch transitiv: d’Oome̥ße n (Ameisen) brünnen äin en gar wüetig.)
Ein Bild nur taucht empor aus alten Träumen!
Ein Strohdach dort in einem kühlen Grund,
Umzäumt ringsum von blütentragenden Bäumen.
15
Sei’s die Strohhütte in Dr. Schneiders Geburtsort, 16 seien es die 15 Strauhụ̈ụ̈ser, welche noch 1895 in Müntschemier standen oder die, 17 welche damals in Treite n noch die Hälfte der Gebäude ausmachten, seien es die vielen großen Doppelhäuser, welche vor 1880 in der Marxmatte n standen, seien es die in unsern Bildern verewigten, welche noch stehen oder mittlerweile verschwunden sind: alle machen sie das Interesse begreiflich, welches unser Anker ihnen entgegenbrachte ( S. 364). Schon die Birchen und Hịmpeeri uf Anker-Tschäppels Hụụs im Egge n zu Ins erregen das Wohlgefallen selbst des wenig Kunstsinnigen. Dieser Meinung war auch der Besitzer eines recht heimeligen Gampeler Strohhauses, der auf Beteiligung an der hübschen Dekoration des Dorfes für das Schützenfest von 1912 mit dem Hinweis verzichtete:
Mein altes Dach, oft repariert,
Hat die Natur selbst dekoriert.
Allerdings ist das Anschauen solcher Strohhäuser bisweilen anmutiger als das Wohnen darin; zumal wenn, wie im alten Tschugg, äi ns Strauhụ̈sli d’s an͜der aa ng’rüehrt het. Wie unheimlich sah hinter dieser Poesie die Wirklichkeit aus, wenn das Strautach wi n 459 en schwarzi Nachtchappe n sich Licht und Luft absperrend über die niedrigen Fenster hinuntersenkte! Kommt sodann zum böo̥se Na̦a̦chbuur und zum böo̥se n Wịịb d’s böo̥s Dach, fehlt es an Binsen, Schilf und Stroh ( S. 110), um an schadhaften Stellen neue «Schauben zu verdecken» (1832, Lüscherz), und ist vollends Mu̦tti in Finsterhennen als der einzig Strauteck im Amt Erlach nicht zur Stelle: dann müssen Schin͜dle n, müssen sogar Laade n (Bretter) her, wenn nicht nagelneue Ziegel, warum nicht auch Blech oder wie in Kerzers Eternit; und es gibt eine Blätzerei, daß’s Gott erbarm.
Schade dann um die Vorteile, die solches Haus noch immer bieten konnte: es gi bt im Winter warm un d im Summer chüehl ( S. 6). Schade auch um die Zierden des richtigen alten Strohdaches, welche durch die eben erwähnten Flickereien zu gräßlichen Zerrbildern umgestaltet werden. Wie zierlich wird aus unverpfuschten alten Dächern das abwärtsgerundete Dachdauli oder die Firstchappe n (der waagrechte Abschluß) durch den Eggschoub, auch der Jaggeli oder Joggeli genannt, nach rechts und links abgeschlossen! Die Rạuchlöcher helfen den altertümlichen Eindruck erhöhen. Für jedes solche Rạuchloch habe der Dachdeck ein Broo̥t bekommen, erzählt man. Die Schmalseite des Daches hieß der Walbe n, die Traufseite das Eebi. 18
Das Dachtrauf galt, wie überall, als Lieblingsaufenthalt böser Geister, das daher von Brautleuten und von Wöchnerinnen zu meiden war. 19 Die Ziegeldächer fangen nun das Traufwasser ab mittelst des Dachcheenel. Da ihre Anbringung mit der beträchtlichern (zweistöckigen) Höhe der neuern Gebäude in Beziehung steht, konnte das Witzwort über einen anmaßenden und zugleich beschränkten Menschen in Umlauf kommen: Wenn dee r so groo̥ß weer wi dumm, so chönnt er us dem Dachcheenel sụ̆ffe n.
Glücklicherweise bieten sich der Zukunft in Stoffen wie Lätt, Je̥ps und Salzwasser die Mittel, Stroh, Schilf und Schindeln feuerfest zu imprägnieren und im Verein mit neuen Präparaten (Durotekt u. dgl.) ein heimeliges Aussehen des Dorfbildes mit höchster Wohnlichkeit der Häuser zu verbinden. Denn daß die roo̥t verblätzete n Schin͜deldecher und die eintönigen Kunstgebilde des modernen Ziegeldeck (so seit 1721) das Ideal landschaftlicher Schönheit seien, isch de nn no ch niene n g’schri̦i̦be n.
1
Anz. N. 5, 199.
2
Ebd. 198.
3
Ebd. 192.
4
So aus dem ins
Musée Clugny zu Paris verschleppten. Vgl. auch
Sartori 9.
5
Räbg. 197.
6
Geschlechtsanlehnung an «den» Fensterladen
7
Lg. 160: Längnau het der Hosechnopf toll tuuft.
8
Gb. 652.
9
Lexikalische «Fenster», wie z. B. auch «die Huen» (
S. 339 f.) solche zeigt. Unser
duuffe
n oder
tuuffe
n kann (vgl.
Vetter 266) als eine durchkonjugierte Zusammenziehung von tue uuf! tu’ uuf! t’uuf! betrachtet werden, oder allenfalls als eine mit
häi-t(t)ier (habt ihr) u. dgl. analoge, ebenfalls durchkonjugierte falsche Worttrennung aus «d’Tüür is-t (t)offe
n.» Dieses vorn angewachsene t- oder d- erinnert in gewisser Beziehung an das mit
«dans» (boire dans la tasse) aus
d’en zu vergleichende
d’ouvrir (aus «
de-ouvrir», wie
d’ôter = dôter) usw. Vgl.
Carte N° B 165, 1, fasc. 33 des Atlas linguistique de la France.
10
Vgl.
schwz. Id. 2, 1159 ff.
11
Gb. 958 f.;
Gw.
12
Urb. Mü. 52.
13
Schwz. Id. 2, 1730 f.
14
Sartori 12; Weltchronik.
15
Dranmor.
16
Bähl. 7.
17
Zimm. 2, 10.
18
Diese in Hunzikers «Schweizerhaus» V (ed. Jecklin; Aarau, Sauerländer, 1908), S. 125 ff. angeführten Namen sind derart vergessen, daß nur ganz alte Fachmänner sie uns bestätigen, bezw. ergänzen oder präzisieren konnten. Bmk. Hunzikers Abb. S. 124 ff.
19
Samter 23. 56 f.
Die alten Holzhäuser mit ihren Strohdächern unterlagen allerdings gerade im Seeland (und Oberaargau) mit den dicht geschlossenen Straßen und Haufendörfern zu allen Zeiten besonders furchtbaren Bränden. Wasser ( S. 88 ff.) und Feuer und Stuurmluft ( S. 61 ff.) wetteiferten im Zerstören der Werke menschlichen Fleißes. Fast in jeder Ortschaft ist zu verschiedenen Malen «das Füwr angangen» und ist damit eine ganze Anzahl Häuser «mit Füwr angangen» (1589), also verbrönnt (in Erlach: verbrü̦nnt). Bald hier bald dort het’s ’brönt (1601: hat es gebrunnen; 1780 in Twann: sind Häuser abgebrannt worden). Sei es, daß ein unbewachter «Glumm» (Luther 1537), ein «gneist» (Niklaus Manuel) oder gneistli (1610 für Fünklein) dem Herd entflog; sei es, daß, wie z. B. früher nicht selten in Lattrigen, 1 Verbrecherhand ein Gebäude ansteckte oder «anzunt» (H. R. Manuel für: aa nzüntet het). Am 10. März 1588 heige der Hans graser grett, es sigin drei schauben vff meyer füriß Hus (des) sigerist, da wollen sy drei Karten 2 yfflegen, das die schouben nit lang daruff bliben werden. 3 Bedenken wir dazu die noch mangelhafte Fụ̈ụ̈rwehr (die wir allerdings z. B. 1845 in Lüscherz neu geordnet sehen) und die ebensolche Fụ̈ụ̈rg’schau (in Aarberg freilich 1586 an zwei Füwrgschauer übertragen), die bloß für «die gemeinen Kamine» bestellten Chemifeeger. Es fehlten auch die erst in neuerer Zeit erstellten und im Fụ̈ụ̈rspri̦tze nchämmerli (Ins) oder -hụ̈ụ̈sli (Br. Tr. Fh. Sis.) oder -spịịcher (Mü.) verwahrten Löschgeräte und die noch lang nicht überall vorhandenen Hydranten (zu schweigen von den Schutzpräparaten eines Josef Köhler in Biel). So begreifen wir die Häufigkeit der Brände alter Zeit.
Auch Städte und Städtchen blieben von solchen nicht verschont. An das Schicksal von Worms, das im 13. Jahrhundert sieben Mal fast ganz abbrannte, erinnert das des alten Bern. Im Streite zwischen letzterem und dem Bischof von Basel verbrannte 1367 Biel. 1520 wurden 18 Häuser in Nidau eingeäschert; 1752 13 Firsten in Büren; 1419, 1477, 1645, 1656 brannte es in Aarberg; 1760 in Landeron; eine zwanzigjährige Tochter verbrannte hier samt 15 Häusern. 4 In Erlach zerstörte die Brunst von 1660 unter 15 Gebäuden die Stadtschreiberei samt dem Archiv. Wie oft auch sonst ist solch ein Verwahrnis alter Schätze, von deren Wert das denkwürdig erhaltene Geeserz zeugen kann, zugrunde gegangen!

D’s Stöckli zu Müntschemier
So in Eiß. Schon 1502 den 28 tag Julii gienge bei Nächtlicher weil das gantze Dorf Ins durch ein (verbrecherisch) angezündetes Fewr sehr klaglich zu grund. 5 Im Mai 1655 verbrannten 24 Häuser an der Gampele ngasse n. 1677 legte ein Dragụụner dadurch, daß er aus seiner Pistole auf Pulver schoß, welches er auf seiner Fenstersimse trocknete, 70 Häuser in Asche. 1730 steckte eine brodiziersüchtigi Inserin ihr Haus an, wobei noch drei andere mitverbrannten. Sie erhängte sich darauf an einem langen Seil, das sie an einem Pfeiler der Zihlbrücke befestigt hatte; nicht, ohne auf einem Zettel, den sie in ein Fläschchen steckte, ihre Reue kundzugeben. 6 Nach einem Brand von 1747 folgten zwei in dem Schicksalsjahr 1798. Der eine entstand im Oberdorf, ein Jahr nachdem der Besitzer eines Bocks denselben het welle n b’räüke n und damit ein Haus in Flammen setzte. Den Brand vom 7. Mai verursachte der Küfer Sigmund Jenni, der bsoffe n z’Nacht äm zeechni mit einen Ampeli i n Stall isch. Mit ihm erlitten drei Kinder den gräßlichen Flammentod, welchem auch 97 Stück Vieh zum Opfer fielen. Der Brand von 26 Häusern machte 53 Familien 462 mit 247 Personen obdachlos und verursachte einen Schaden von 51,519 Kronen. Das Unglück erweckte aber auch viel tatkräftige Teilnahme aus nah und fern, besonders aus Neuenburg. Das Direktorium ordnete eine Landessteuer an. Ein Engländer zeichnete sich durch Edelmut aus. 7 Durch bụụbele n von Kindern gingen am Meentig na ch ’m Bättag (am 18. September) 1848 in Ins 71 Firsten im Feuer auf. Es wütete besonders in der Gampele ngasse n, die von daher so neu aussieht. Ein alter Mann und zwei Kinder, deren Mutter vor Schreck und Jammer d’s hin͜der fü̦ü̦r choo̥ n isch, kamen in den Flammen um. Das Feuer ergriff selbst die ausgegrabenen Kartoffeln auf dem Feld und schwärzte alle drei Seen mit fliegenden Strohhalmen. So gräßlich aber das Unglück, so groß war hier wieder die Hilfe. Wie abermals Neue nburg, dessen Mitbürger de Pury sich in Hilfeleistung hervortat, zeichnete sich auch Neue ntstaad durch tagelanges tätiges Ausharren auf dem Platze aus. — Das Jahr 1880 brachte neues Unheil über die Marxmatte n. Dem Feuer erlagen zwölf Personen. Die noch lebende Frau Jenni wurde und blieb vor Schreck lahm. Die Regierung verkaufte die Marxmatte zu billigem Preise, damit die neu auf ihr zu erstellenden Häuser witer u̦senan͜dere n chöömi. In dieser Weise wurde sie 1898 überbaut.
Vor zwanzig Jahren brannten zwei Häuser in der Moosgasse ab. Der Zöllner-Sammi rettete zwei fast verbrönnti Chin͜d, welche Tat der Inser Arzt Dr. Bruhin in einem Gedichte feierte. Vom letzten Inserbrand — des Jahres 1901 —, der drei Strohhäuser verzehrte und den Schlaganfall von Maler Anker herbeiführte, ist S. 364 erzählt.
Auch Brüttele n erlebte fürchterliche Heimsuchungen. Am 13. April 1610 verbrannten neun Bauernhäuser und sechs Spicher. Ein Kind von sieben Wochen erlitt den Flammentod. 8 Das 1710 angelegte «Brandsteur Buch» erzählt von einer Katastrophe des 27. März 1770, und — mit dem nämlichen Eingang, Gott der all Mächtege habe durch seine gerächte Straff das dorff Brüttelen Mitt Einer Er bärmlichen fürs Brunst heim gesucht — vom Einzelhausbrand des 24. November 1811, dem Brand von fünf Häusern am 7. Mai 1813, dem Brand der Fegge n ( S. 16) um die Mitternacht des 9./10. März 1832, dem eines Dreifamilienhauses am 3. April 1844. Schon am 11. September 1854 brannten acht Häuser 9 in der nämlichen Hünige ngaß, welche dann im September 1856 durch die Bịse n während des bräche n von Gespinnst gänzlich eingeäschert 463 wurde. Leider ist allemal auch von Haustieren die Rede, welche mit zugrunde gingen.
Die Katastrophe von Müntschemier am 2. Oktober 1827 (als Nachfolgerin derjenigen von 1738) ward in sehr schön ausgefertigter Inschrift am Haus des Gemeindspräsidenten Niklaus durch den Lehrer Berger dargestellt:
Als man den zweiten Weinmonat acht hundert und Sieben und zwanzig that sprechen,
That morgens um vier Uhr in diesem Dorfe Feuer ausbrechen,
Durch welches innert einer Stund
Neun und zwanzig Häuser sind gegangen zu Grund,
In welchem, wie man hat erfahren,
Drey und vierzig Haushaltungen mit zweihundert und sechs und zwanzig Seelen waren.
Darum Jakob Niclaus auch mußte schauen
Sich eine andere Wohnung zu bauen.
Durch Zimmermeister Niclaus Stauffer zu Bühl.
Aufgerichtet den 1. Merzen 1828.
Für glückliche Bewältigung des Brandes empfing Statthalter Probst ein eigenes Dankschreiben. 10 Ein solches sandte man doch wohl auch an den König von Frankreich, von welchem eine Gabe von tausend Franken ergattert wurde. 11 In den Kirchen der Stadt Bern, welche damals bei 18,000 Einwohner zählte, wurden an der Weihnacht dieses Unglücksjahres für den heimgesuchten Ort 6421 Franken, 6 Batzen und 2 Kreuzer (in heutigem Geldwert über 20,000 Franken) gesteuert, nachdem bereits an der Weihnacht zuvor 7216 Franken nach Frutigen geflossen waren. — Ein weiterer Brand fiel in das Jahr 1846.
Treite n ward 1759 (14 Häuser) und 1852 heimgesucht, Feisterhenne n 1731, Si̦i̦sele n 1731, 1746, 1834, 1908. Die Brunst vom 14. April 1908 verzehrte fünf Häuser. Die Katastrophe von Vinelz, welche im Frühling 1825 15 Häuser forderte, vernichtete auch zehn Menschenleben. 12 Lüscherz ward am 29./30. Oktober 1873 der Stra̦a̦ß naa n ganz in Asche gelegt. Gampele n verlor 1737 16 Häuser, Gals 1852 15 und 1869 ebenfalls mehrere. Bereits durch die Brände von 1852/53 aus einem Straudorf in ein Ziegeldorf umgewandelt, verlor Tschugg 1862 abermals sechs Häuser. In Walpertswil wurden 1824 durch den traurig berühmten Wälti Bänz (Bendicht Maurer) 37 Firsten in Brand gesetzt; 13 1843 wurden abermals mehrere Häuser zerstört. Dem Brand zu Büel vom 9. Juni 1779 folgte, durch die Chäiserlige n verursacht, der vom 14. April 1814. Bözinge n verbrannte 1874, Maaderịtsch 1854, Orpund fast 464 gänzlich 1778 und durch Verbrecherinnenhand 1868; 14 in Safnere n vernichtete der Blitz am 27. Juni 1829 20 Häuser, 15 1866 ein Brandfall deren 15. Pieterle n büßte 1726 26 Firsten ein, Rütti bei Büren 1868 deren 54, und eine Anzahl 1876. In Nods 16 wurden 1798 25, 1851 32 Häuser eingeäschert, an Ostern 1817 in Lamlinge n 64. 17 Die Katastrophen von Gụrbrụ̈ 1779, von Fräschelz 1798 und von Cherze rz (1339, 1476, 1558, 1764, 1881) mögen diese Unheilschronik beschließen. Besonders fürchterlich war der durch einen zweijährigen Knaben verursachte Brand von Kerzers im Jahr 1764. Ihm fielen 64 Häuser zum Opfer. Die Hitze war so gewaltig, daß selbst die Jauche in ihren Behältern wie Steinkohlengas hell brannte. Um so verwunderter gewahrte man, wie der ein Rootbrüstelinäst herbergende Ast eines Pflaumenbaums unversehrt blieb.
1
Kal. Ank.
2
Vgl.
charta, ahd.
karz, als Docht, wie ahd.
kerza als Kerze bei
Kluge 239.
3
Chorg.
4
Quart. 3, 342.
5
Michel Stettlers Chronik II, 209.
6
Kal. Ank.
7
Vgl. Sterchi im Berner Tagblatt 1898, 197 ff.
8
Taschb. 1900, 276.
9
Taschb. 1857, 291.
10
Probst III (19. Okt.).
11
Stauff. 52.
12
Mül. 535.
13
Man lese Appz. 74.
14
Taschenb. 1870, 355.
15
Chronik der Pfarrei Guggisberg.
16
Lign. 5.
17
Schwzrfrd. 1817, 129 ff.
Aus vorstehender Chronik geht hervor, wie stark zumal die dicht geschlossenen Dörfer des Unterlandes der Feuersgefahr ansgesetzt waren. So auch das ausgesprochene Straßendorf Eiß mit seinem nun zur zukunftsreichen Bahnhofstra̦a̦ß umgewandelten Gäßli, seiner Moos- oder Murte n- oder Wịstelḁ chgasse, seiner Müntschemier-, Brüttele n-, Erlḁch-, Gample n-, Lüsche̥rzgasse n, zu unterscheiden von der aus dem Dorfbereich hinausweisenden Brüttele n-, Müntschemier- usw. Stra̦a̦ß. Eine Moosgasse n hat auch Treiten, eine Träite ngasse n hat Müntschemier. Ebenda gibt’s eine Cheßler-gasse n.
Die modernen Löscheinrichtungen ( S. 55) und der Nachtwächter-Dienst (s. «Twann») lassen allerdings nun den Gedanken der Gefährlichkeit ganz zurücktreten hinter dem der Geselligkeit, welche im Straßen- wie im Haufendorf (z. B. Vine̥lz) so ganz andere Formen annimmt als in den Gebieten des Hofsystems. Das Leben uf der Gasse n ist d’Urhaab zahlloser Abschattungen von Zuneigung, die bis zum dingen i n d’s läng Ja̦hr führt, und von Abneigung, die sich in den Zuruf kleiden kann:
Rätschi, Rätschi uf der Gasse,
Wenn
ich di
ch g’seh, so mues
ich di
ch hasse!
Beide Pole der Lebensachse lagen vor dem scharfen Auge Ankers offen; aber nur der erstere ward seines Pinsels würdig erfunden. Er 465 verließ einmal sehr unzufrieden die Kirche, in welcher gepredigt worden war, Christus sei das Schwert zu bringen gekommen. 1 Die Seeländer, meinte er, haben nötiger, daß man ihnen zum Frieden rede.

Das Rathaus von Ins vor 1848
Zu friedlicher Gesinnung, deren Hort das Ackerfeld und die häusliche Arbeitsstätte, die Gemeindestube und die Kirche sind. Da wie dort erblickte er, der nicht umsonst als vorgesehener «Diener am Wort» das paulinische «Alles ist euer» sich zu eigen gemacht hatte, Stätten der Volkserziehung zu einem Frieden, der seiner Wortgeschichte gemäß mit Freiheit, 2 zuvörderst der moralischen und dann der politischen, eines Ursprungs ist. Wir vergegenwärtigen uns dies, indem wir den bisherigen noch zwei Bilder ergänzend beifügen. Im Rathaus Ins (gemalt von Frau King) tagten bis zum Brand des Jahres 1848 das Chorgericht von Ins und die dortige Schulbehörde, deren eifriges Mitglied Anker gewesen ( S. 368), sowie vormals die gesamte Landschaft Ins (s. «Twann»). In der Kirche zu Vinelz aber, wie der von Ins, war Anker ein hörbegieriger Sonntagsgast.
In jeglicher Lebens- und Seelenlage kannte der Altmeister von Ins seine Pappenheimer. Das beweisen seine Bilder, deren wir eine Auswahl an uns vorübergehen ließen. Sie beweisen uns, wie tief er, der Prediger mit dem Pinsel, «kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürfnis». Er kannte dieses, weil er seine Seeländer liebte, und jenes, 466 weil er in vollen Zügen aus seinen Bornen getrunken. Gleich heimisch fühlte er sich auf dem gebohnten Parkett der Weltstadt und auf dem bäurischen Stube nbode, «dem man wohl trauen darf»; 3 er, der im Wältsche n wie der feinste Weltmann sich umtat, und er, der im Bärndütsch sich auswies als der inserischeste aller Eißer.
1
Matth. 10, 31.
2
S. «Twann».
3
Gotthelf.

Studie von Anker (Kirche von Vinelz)