
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
 n
das Grŏß Moos, welches rund 13,200 Jucharten umfaßt,
1
teilen sich die Kantone Bern, Freiburg, Waadt und Neuenburg. An (
u̦f) das Moos stoßende Gemeinden zählte Bern vor der Entsumpfung 24: 14 aus dem Amt
Erlach, 4 aus dem Amt
Nidau, je 3 aus den Ämtern
Lạupen und
A
arberg. Von den andern 24 Gemeinden waren 13 freiburgisch, 10 neuenburgisch und 1 waadtländisch.
2
Über seine 6500 Jucharten erklärte Bern von vornherein sein Obereigentumsrecht. Übrigens durften, wie Dr. Schneider als bernischer Direktor des Innern durch sein Fragenschema vom 12. Februar 1849 feststellte, alle diese Gemeinden das Moos in gleicher Weise
nutze
n oder
nutzge
n (Si., Tsch.), wenn nicht
ụụsnutzge
n bis zum
ụụshu̦ngge
n («aushonigen»). Die Nutzung bestand in der Regel im «Weiden, Mäyen und Häüwen» (1549); ein G’stäüd (
G’stụ̈ụ̈d) aber schenkte lang vor 1650 Bern den Insern und Müntschemierern, daß sie es gemeinsam
äferen, nutzen, mit gehörntem gut darein fahren, weiden, darin
holtzen und ihren Frommen darin schaffen. Über den nachmals geteilten Besitz mußte jede der beiden Gemeinden einen Bannwart (
Bannḁcht) setzen.
3
n
das Grŏß Moos, welches rund 13,200 Jucharten umfaßt,
1
teilen sich die Kantone Bern, Freiburg, Waadt und Neuenburg. An (
u̦f) das Moos stoßende Gemeinden zählte Bern vor der Entsumpfung 24: 14 aus dem Amt
Erlach, 4 aus dem Amt
Nidau, je 3 aus den Ämtern
Lạupen und
A
arberg. Von den andern 24 Gemeinden waren 13 freiburgisch, 10 neuenburgisch und 1 waadtländisch.
2
Über seine 6500 Jucharten erklärte Bern von vornherein sein Obereigentumsrecht. Übrigens durften, wie Dr. Schneider als bernischer Direktor des Innern durch sein Fragenschema vom 12. Februar 1849 feststellte, alle diese Gemeinden das Moos in gleicher Weise
nutze
n oder
nutzge
n (Si., Tsch.), wenn nicht
ụụsnutzge
n bis zum
ụụshu̦ngge
n («aushonigen»). Die Nutzung bestand in der Regel im «Weiden, Mäyen und Häüwen» (1549); ein G’stäüd (
G’stụ̈ụ̈d) aber schenkte lang vor 1650 Bern den Insern und Müntschemierern, daß sie es gemeinsam
äferen, nutzen, mit gehörntem gut darein fahren, weiden, darin
holtzen und ihren Frommen darin schaffen. Über den nachmals geteilten Besitz mußte jede der beiden Gemeinden einen Bannwart (
Bannḁcht) setzen.
3

|
|
Studie von Anker |
Sehr häufig waren aber solche Gemeindsnachbarschaften Gegenstand langwieriger Prozesse. So mußten 1547 die von Erlach denen von 148 Finells helffen, das moos zweg zu bringen. 4 Hinwieder sollte Ins, das von seinem überflüssigen Streuiland jeweils viele Jucharten verbrönnt het, auch die Erlacher lassen strauwen und häüwen 5 (1520). Ins hatte aber 1520 dessitweege n auch Streit mit Sougye ( Sugy, Sụ̈schi), Chaumont, 6 Zur Matt ( Praz) und Mi̦ste̥lach ( Môtier). 7 Bereits 1510 zankte Ins deß Moos halb auch mit Lugnoroz ( Lugnorre) und mit Murte n, 8 sowie wegen Vmbgelt und Feldfahrt mit Sougie, Nan t und Lupra ( Praz). 9 Auch Möntschemier ward 1549 von den Wistenlachern 10 und 1556 von Murten verchlagt. Sei jenes Futhers und streüwe oder Lischen mangelbar, so möge es bei Murten darum bittlich ankehren, soll aber nicht sogar Raub ab fremdem Gut verkaufen. 11 1575 wurde zwischen beiden Anstößern g’maarchet. Die Land-March ging von der March Funderlin aller grede ( Greedi) nach an ein Eichene Suhl 12 ( Sụ̈ụ̈le n, Pfoste n), dann gegen dem Fählbäum an das ort, da die Bruch ( Broye, S. 27) ihren außgang hatt. 13 1617 aber war diese eichine seule nieder gesunken und verursachte neben dem Pintschgrabe n neuen Streit. 14 Kurz, wie alle diese Händel, besprechen wir hier auch die mit Neuenburgern ausgefochtenen aus der Zeit, da das Bernische über d’Zihl übera g’reckt het. Durch die Festsetzung des Zihlkanals als Kantonsgrenze und Vergreederig vom Gri̦ssḁchchrumm (vgl. den A arbärgerchrump in «Twann») fielen etwa 90 ha Grissḁchmoos von Gals an Grissach. Dagegen wurden das Roothụụs und das Zihlschloß ( La Thielle) bernisch. Früher mußten die beiderseitigen Regierungen wegen Veltfahrt, Wunn und Weidgängen anderswie der Chueche n däile n. So 1491 zwischen Neuenburg einerseits, Erlach, Ins, Gampelen und Gals anderseits. Da wurden die Weidrechte durch zween ( zwöo̥) Marchsteine geschieden: einen am See und einen gegen demselben an der Bruch (Broye, s. o.). Wegen Schädigung gepfändetes Überlaufsvieh mußte von den Neuenburgischen mit 300 Pfund ụụsḁglööst werden. Dagegen durften letztere auch auf Berner Gebiet «gantz unersucht und unbekümberet Mayen und Häüwen». 15 In solche Vergünstigungen wollten, gestützt auf angeblich im Jahr 1336 erworbene Rechte, auch die zur Landeren sich einflicken ( sich ịịchḁschlịịche n), wurden aber 1549 darauß gewiesen. 16 Den andern Neuenburgern aber wurde 1550 das Recht verweigert, aus dem moos Chablaix ( S. 74) Banwarten 149 ( Brenars) zu setzen. «Damit jedoch dester baß ( baas) gehüetet würde, ließen wir zu Bern uns erbitten, daß wir mit ihnen nach Imbiß 17 (am 18. April 1550) nidersitzen (Sitzung halten) und darob underredens hallten und Inarticulieren 18 und lugen ( luege n; mier wäi n luege n, mier wäi n öppḁ luege n), wie der sach zethund» ( wi das öppḁ z’mache n sịịg, wi n es sich öppḁ lööi a ngattige n, 19 das s es dḁrggege n g’seei). 20 Man kam überein: Neuenburg darf dem Vogt von Erlach zwei Banwarten ( Bannḁchte n, speziell: Fäll dbannḁchte n oder Fäll dhirte n) in das Schloß presentieren, der ihnen auch den eyd geben (diktierend eingeben und damit abnehmen) solle, falls er sie als tüchtig erfindet. Gepfändetes Vieh aber sollen sie nach Erlach bringen. Von jedem Haupt oder Stuck erhalten sie, wie von allter har, 4 Pfenning, und dazu von den dem Vogt verfallenen Bußen unter 3 Pfund je 10 Schilling. 21 Die Bannwarte übten jedoch ihr Amt derart aus, daß die Herren von Bern nit zufrieden gsin. «Dan unß dardurch unsere Herlichkeit (Herrschaft) geschwecht und merklicher im bruch (Einbruch) begägnet, daß wir nun nit dulden noch gestatten wellend, das s die Bannwarten auf unßerem Ertrich in unßeren hochen und nideren gerichten und Herlichkeiten gewallt und grichtszwang brauchen 150 und üben.» Gleichwohl durften laut Beschluß vom 8. Juni 1552 22 auch noch die Nachbarn von Sant Bläsy und ander in der Vogtei Zihl ( Thielle) auff dem großen Erlach Mooß Chablaix weiden und mäyen. Und das zwar In ansechen ihrer diensten, so sie unß mit Reisen (Mannschaftszuzug im Krieg) von ihr Herschaft wegen bewiesen haben und für der zethünd gutwillig zesein erpotten. Sie sind daher gleicher gestalt wie unßer Undertanen und die von Neuenburg berechtigt, aus dem Moos zu weiden und mäyen. Jedoch dürfen diejenigen Herschafftleüth der Vogty Zihl, so nicht burger seind der Statt Neuenburg, mit ihrem Vech allein zu Zeiten der Nodt und wan sie nit fürkommen (auskommen; heute ist fü̦ü̦rchoo̥ n: genesen und am Leben bleiben), auff das Groß Moos fahren, und sonst in kein Wäg ( i n käine n Weege n, keineswegs). Auch dürfen sie erst zehn Tag nach St. Johanns des täüffers tag (also am 4. Juli; s. u.) Lischen mäyen, und zwar bloß für eigenen Gebrauch, so daß sie die nicht verkauffind. Und das alles auß sondern gnaden und unter der Bedingung fernerer guter Dienste, mit uns zureisen, und auß craft deß ewigen Burgrächten, so zwischen den Herren graffen von Neuenburg und unß auffgericht ist.
1
Schn. 94.
2
Stauff.
3
Urb. Mü. 49-52.
4
Schlaffb. 1, 101.
5
Ebd. 73-75.
6
Es ist der
Chaumont am Nordabhang des Wistenlacherberges gemeint.
7
Ebd.
8
Ebd. 62-66.
9
Ebd.
10
Urb. Mü. 18.
11
Ebd. 21.
12
Ursprüngliche Einzahlform zur ursprünglichen Mehrzahl «Säule».
13
Urb. Mü. 24-27.
14
Schlaffb. 1, 173-5.
15
Urb. Mü. 3;
Schlaffb. 1, 43-47.
16
Schlaffb. 1, 107-116.
17
Vgl. zürcherisch «na
ch’m Imbig» = nachmittags, der Imbiß =
das z’Imis also (wie z. B. emmentalerisch) als Mittagsmahl verstanden. Vgl. unser
Nahrungskapitel.
18
Vgl. «Kapitulieren» im Ursinn.
19
Vgl. «Gattung» im Ursinn des Angepaßten (
Kluge 161), wozu
gattlig und
ungattlig: der Kon-venienz zuwider.
20
Wie
Nuet und
Feedere
n (vgl.
Lf. 186) einer Fuge.
21
Schlaffb. 1, 117-124.
22
Ebd. 128-131.
Vom Grŏßmoos het mḁ n d’s Häümoos un͜derschäide n. Dieses erstreckte sich bis zur Mu̦u̦nie n 1 (« la Monnaie», der Münze ngrabe n S. 144) d. i. zum Hauptkanal. Vo n dört isch mḁ n de nn i n d’s Wältsch Moos choo̥ n: i n d’s Miste̥lachermoos. Das Heumoos unterstand der Mooskumission (1787) und wurde nach der im Seeland auch bei Privatgütern üblichen Formel drụ̈ụ̈ sächs nụ̈ụ̈n i n Leeche n g’gee n. Das heißt: wenn nicht nach drei oder nach sechs Jahren aufgekündet wird, so gilt die Pacht für neun Jahre. An den Platz der Verpachtung trat mit der Zeit die alljährliche Versteigerung des Heumooses nach Parzellen. In solche teilte z. B. Eiß seine dreitausend Jucharten. Sie wurden zusammengefaßt in Komplexe, welche man als so und so beschaffene oder gelegene «Teile» benannte. Von der Ins-Murtenstraße und -bahn durchschnitten, grenzen sie nordwärts an die Inser Mŏsgeerte n (Moosgärten). Diesen Moosgärten entsprechen teilweise die Reie nmatte n (Mü.): heute svw. Pflanzbụ̈ụ̈n de n. Bis 1871 bekam jeder Müntschemierer Burger eine Reie nmatte n, einen Riedacher, 151 ein Stück Pfaffe nmatte n, eine Moosallme ndmatte n und eine Spitzallme ndmatte n.
Für weitere Kreise sind bloß die folgenden Namen von Interesse. Wie im Großmoos die Allme̥n de n und die (dem Wucherstier der Gemeinde vorbehaltenen) Stiere ndäile n lagen, so im Heumoos die Arme ndäile n, di chu̦u̦rze n, länge n, groo̥ße n und die zur Ausgleichung bestimmten volle n Däile n und alle die folgenden. Nach der Lage sind benannt: die (Haupt-) Karnaaldäile n und die Grĕblidäile n, die I̦i̦slere n- und die Neumoosdäile n; auch Gampelen hat I̦i̦slere n-, sowie Moos- und Bösche ndäile n. Nach charakteristischer Bewachsung: die R äckeldoorne n- (Wachholder-) däile n, als die hin͜dere n und die vorddere n unterschieden (vgl. die Hin͜dernịderteile n zu Finsterhennen); die Wịịde ndäile n, die Pösche ndäile n ( S. 112). — Wịịde nteile n hat auch Gals, Allmeliteile n (nebst Halbbrünne n-, Baach-, Neumoos-, Hụụs-, Eerliteile n) auch Siselen. Auf altes Eigentum Eingewanderter deuten die (schon 1800 erwähnten) Jerne̥ttäile n zu Gampelen, aus welcher Gemeinde noch folgende der Verwaltungsart angepaßte Ausdrücke geholt seien. Jeder Burger, der jeweils auf 1. März als Inhaber von äige ntem Fụ̈ụ̈r u nd Liecht ausgewiesen ist und zwänz’g Fränkli für Moosnutzung erlegt, hat das Recht, alljährlich auf alle die verschiedenen Moosteile z’stäigere n und als Inhaber eines schlechtern Stücks Besserig z’stäigere n oder uf Besserig z’stäigere n. Das aufgegebene Stück ist dann der G’mäin g’falle n (verfallen, auf sie zurückgefallen). Etwa 50 Jucharten Burgergut sind zu diesem Zweck als Wächseldäile n eigens vorbehalten, und die überwäärffe nte n Däile n im Neumoos dienen, ähnlich der Ụụsbesserig zu Siselen, zur Ausgleichung stattgefundener Inhaberwechsel. In Treiten und Lüscherz gibt es Schuelteile n, in Erlach und Gampelen d’s Rundi, in Gampelen noch speziell d’s Gampele nrundi, sowie d’s hin͜der und d’s vorder Schuelrundi, erinnernd an die Inser Rundidäile n, in Finsterhenne n (1701) das Runti als Waldstück. Das vorder Schuelrundi stößt an das Rundi oder le Rondet, wie weit herum i n der Ründi auch die Krümmung des Broyekanals ( S. 86) heißt. Sonst aber bedeutet das Rundi gleich dem Rondet oder Rondez (auch bei Delsberg) lediglich den («abgerundeten», arrondierten) enclos: Ịị nschlaag im Moos, der mittelst Graben und Zaun der gemeinen Nutzung entzogen wurde. So das Neue nburger Rundi am untern Ende der Broye. Bis zur Parzellierung im Jahr 1880 gab es in Mü. auch den Schuelblätz.
1
Volksmäßig daher gedeutet, daß die 1476 aus Murten fliehenden Burgunder gerufen hätten:
Mon Dieu, mon Dieu!
Wie der Staat unabgetretene Moosreviere, z. B. das Schwarzgrabe n- und das voraussichtlich mit neuem Zuchthaus überbaute Islere ngebiet sich als Eigentum vorbehält, sind umgekehrt grosse Moosteile längst in Privateigentum übergegangen. Anstößerische Eigentümer taten sich je und je zu Korporationen zusammen, um ihr Gebiet durch Drainage ( treniere n, S. 144) und Weganlagen ( weege n) zu verbessern. So erst kam es zu den prächtigen Mooserträgen, von denen später die Rede sein wird. Aber auf welch mühsamen Umwegen! Diese bestanden zunächst in Einschlagsbewilligungen an Gemeinden: an Erlach für den Brüel (1549) 1 bei der Foffneren ( Fa̦a̦fere n, 1639) 2 und für 100 Jucharten im Moos (1771); 3 an Gals für 14 Jucharten (1762); an Finsterhennen für 30 Mannsmeder (1526) 4 und für das Bundimöösli (1761). 5 Die eigenmächtigen Einschläge aus den Jahren 1521 bis 1526 aber mußte Finsterhennen wieder außwärffe n. Die Matten sollten (dem Weidgang frei) außliggen, 6 weil die Einfristung nicht in aller gepühr und bescheidenheit 7 (wie 1639 in Erlach) geschehen war. Vereinzelte Einschlagsbewilligungen galten Privaten: eine von 1774 an Pfarrer Gerwer zu Vinelz für eine Matte im Glausit, und eine von 1776 an Sattler Bloch für 3 Mäß (ein mit drụ̈ụ̈ Mees Getreide zu besäendes Ackerstück) im Blochsgäü. Eine ganze Reihe Flurstücke tragen von daher die Namen Ịị nschlaag, Moosịị nschlag, Lüscherzerịịnschlaag (zu Treiten), sowie die Neumoosbụ̈ụ̈n de n (Beunde, s.u.) und die Erlacher Brädele n-, Vinelz-, Weier-Bụ̈ụ̈nde n,
1
Schlaffb. 1, 105.
2
Ebd. 139.
3
Ebd. 314 ff.
4
Ebd. 92 ff.
5
Ebd. 266.
6
Ebd. 90 f.
7
Ebd. 139.
Wie noch heute stellenweise im Jura 1 herrschte bis 1798 auf den altbernischen Feldern und bis zur Entsumpfung im Moos die Gemeinweide. Auf solche, an denen auch Städter teil hatten, deuten Namen wie Galmiz ( Charmey) unweit Murten. Denn Charme (1285) und Chalmeis (1228), Chalmitis (1242) gehen zurück auf calamus (Rohr, Röhricht). 2 Um fremdes Eigentum zu schonen, mußte der Auftrieb zur 153 Weide laut Geboten von 1549 und 1584 3 mit Tribner ruten (mit der Treibrute) 4 geschehen. Auch war über sehr weichen Boden eine gute Hurt ( Hu̦u̦rd) 5 zu machen: ein Geflecht von Stangen und Ruten. So befahl eine Verordnung von 1552. 6 Danach sind die Hurdtmatten (1710) und ist eine Matte bei der Hurd im Inß Brühl (1735) zu deuten.

|
|
Studie von Anker |
Besonders lässige Hut der Schafe konnte zu Verdrießlichkeiten führen, die (z. B. 1657) vor das Chorgericht gezogen wurden.
Solche Verdrießlichkeiten pflegten daher zu rühren, daß da und dort eine Haushaltung ihre Tiere selber hüten wollte, statt sie von den Gemeindehirten (s. u.) schlecht besorgen zu lassen und obendrein empfindlich hohe Weidegebühren zu zahlen. Die lasteten besonders schwer auf den Hin͜derseeße n. Darum zogen die letzteren vor, ihre Tiere daheim im Stalle zu füttern 7 und damit — wohl am Lịịb z’bhalte n.
Das wurde freilich manchenorts als Auskneifen gedeutet und zu verhüten gesucht. So 1816 in Tschugg. Da mußte auch, wer dem Hirten ein Tier oder mehrere nid un͜der d’Ruete n g’gee n het, seinen Anteil am Hirtenlohn entrichten.
Das zog gleichwohl mancher der Gemeinweide vor. Warum? Die Kühlein der Burger sị n am Aa̦be nd hungeriger un d eländer häi n choo̥ n, weder daß si am Morge n z’Wäid g’gange sịị n. 8 D’Mooschüehli, milcharm, strụụb u nd schlächt, sị n z’ringset um d’s Gspött 9 vo n de n Meeridlüt gsi̦i̦ n, Für z’zieh het’s 154 drụ̈ụ̈ Roß brụụcht, wo iezen äi ns, und auch so konnte manch eine Moorstrecke sich ähnlich benennen wie der Roßschinteracher zu Tschugg.
Die zuträglichen Gräser und Kräuter waren bald einmal bis uf d’Wü̦ü̦rzen abg’nagt. Dann ging es an ein schaale n, 10 und zwar derart erbärmlich, daß «der Schäli» i. S. v. Hungerleider als Schimpfwort diente, welches 1669 vor Chorgericht eingeklagt wurde. (Auch die ältesten Inser kennen «Schäli» und «schale n» nicht mehr.) Die ausgehungerten Tiere verloren ihren gesunden Instinkt und vergriffen sich an ausgemachten Giften. Sie soffen, da nicht einmal das doch gesunde Tu̦u̦rbe nwasser ( S. 104) zu finden war, an heißen Tagen aus Pfützen. Sie fraßen Wolfsmilch, welche die Milch rot färbte, und wovon diese gleich der Butter und dem Fleisch im bekannten Doppelsinn des Wortes schlächt g’schmeckt het. Sumpf- und Schlamm-Schachtelhalm häi n no ch im Häü gstunke n. Sie brachten die tra̦a̦gene n (tragenden) Tiere zum ergee ben (verwerfen). In andern Fällen riefen sie gleich dem Hahnenfuß, dem Läusekraut, der Wolfsmilch und andern Kräutern Entzündungen, Blutharnen, Koliken, Dü̦ü̦r chlauf 11 hervor. Der Sonnentau und der gleißende Hahnenfuß ( Ranunculus Flammula) brachten tödlichen Scha̦a̦fhueste n und Eegle n; 12 die letztere Pflanze het d’Leebere e ntzüntet, und der giftige Hahnenfuß ( R. sceleratus) brachte d’s chalt Fụ̈ụ̈r: ein Zittern und Schaudern auch ( S. 101 f.) der Tiere, wobei die größeren Adern am Bauche stark anschwollen. Auch der Seidelbast (das bois gentil des Wistenlacher Berges), der Nụ̈ụ̈ntööter und der Wasserschierling ( Cicuta virosa) verursachten große Viehsterben. 13 Zu solchen führten aber nicht bloß an sich giftige Pflanzen, sondern schon die sehr kleinen rostähnlichen Schwämmchen (Rostpilze), welche in regnerischen Jahren sich auf Gräsern und Kräutern ablagerten und langsame Blutzersetzung herbeiführten. 14
Das Schrecklichste aber kam von der gierigen Atzung saftiger Stellen des Schindangers ( S. 155): die brachten den Milzibran͜d. Um das Unheil voll zu machen, wurde das Fleisch der daran gestorbenen Tiere wohl gar ausgeschlachtet und gegessen, was z. B. 1827 die tödliche Krankheit auch auf Menschen übertrug. Ja der gesamte Viehstand der damals heimgesuchten Familie stand an Milzbrand um. 15
Aber auch das nicht direkt schädliche Futter war doch arm an Nahrungsstoffen. Insbesondere war es kalk- und kieselarm. So wurden die Weidetiere knochenbrüchig. Es kam vor, daß Stiere n (Zugochsen) mitts uf der Stra̦a̦ß ịị ng’heit sịị n. Auch die Winterfütterung 155 besserte an der Sache nichts, da es an eingeführten Futtermitteln noch fehlte, und das für Brot erforderliche helig Chorn Tieren zu verabreichen für Sün͜d gegolten hätte.
Die schlechte Weide brachte allerdings den indirekten Vorteil, daß jung verkaufte Tiere, an besseres Futter gestellt, zusehends ’trüejt häi n, guet ta̦a̦ n häi n. Allerdings nur, wenn ihre Entwicklung nicht von vorn herein i’ n Grund-Bóden ạchḁ vertụ̈ụ̈flet worden ist. Und wie oft war das der Fall!
So gingen im Moos Pferde, Kühe und Schafe zu Hunderten: hụ̈̆ffeswịịs, zu Grunde. 16 Einzig im Jahr 1758, nach einer fürchterlichen Überschwemmung, fielen im Amt Erlach über 200 Rindviehstücke, und nur 16 Kälber blieben am Leben. 17 Entsetzliche Seuchen, die aber auch dem Gedanken an Selbsthülfe endlich Durchbruch verschafften, kamen 1831 über Siselen, Müntschemier u. a. Orte.
Daß unter solchen Umständen der Hexenglaube immer neue Nahrung fand, und daß der und der aufs Korn genommene Mensch die verunglückten Tiere verhäxet haben sollte, ist begreiflich. Scheu ging man insbesondere an den Schindallmen de n und am Schinter-Ịị nschlaag vorüber. Der bis um 1890 zugleich als Schaarpfrichter amtierende Schinter uf der Flue über Brüttelen (welches «Wasenhaus» (1806) 18 nun von der daherigen Servitut befreit werden soll) galt wie überall als verfehmt, als «der Verschmechte» (1659). In der Kirche mußte er, scharf kontrolliert, z’hin͜derist hocke n. Auch seine Frau, die «Wasenmeisterin» (1661), und seine ganze Familie waren von dieser «Schmach» mit betroffen. Man begreift daher, daß immer nur Auswärtige, wie z. B. 1753 Niclaus Hotz, der Roth Schinter genannt, 19 sich als « rev. ( reverenter, salvo honore, nit z’seeme nzellt) den Wasenmeister» betiteln lassen mochten. So 1663 in den langen Verhören vor Chorgericht wegen Eheversprechens mit des Wasenmeisters Tochter. So unterm 7. März 1658 in der Abmahnung, den Abdecker zum Götti zu gewinnen, weil ein expresses Mandat der Obrigkeit solches verbiete. So in den Verhören vom 23. Dezember 1649, warum der Weibel und ein Gefährte so vngschücht ( ung’schoche n) mit dem Schindter trinkend. Für solche Vertraulichkeit wurden beide um 10 Schilling gebüßt; selbst die Trinkgemeinschaft an einer Holzfuhr kostete am 6. März 1653 fünf Pfund. Auch der Nachweis, es habe der Schinter sin besundern ort, wie auch besunders glas vnd spys ( sị ns b’sun͜derig oder abaartig Glas usw.) gehabt, schützte nicht vor weitläufigen Verhandlungen (19. Mai 156 1650). Und einer, dem am 6. April 1501 neuerdings syn häßliche g’selschaft vnd gmeinschaft ( reverenter) mit dem Wasen Mr: fürghalten worden, ward wegen trotzigen Verhaltens bis auf sein Geständnis im Schloß eingekerkert.

|
|
Studie von Anker |
Daß solcher Waase nmäister alle Tage in seinem Revier het z’tüe n g’haa n, het äin gar nụ̈ụ̈d abaartigs dunkt. Und wie man das heute so schwer empfundene Fallen eines Haustieres aufnahm, zeigt die folgende Äußerung des Besitzers einer im Moos versunkenen und erstickten Kuh: Die het’s g’suecht! Si ist scho n meṇ’ge n Tag mit ere n schwarze n Schnu̦u̦re n häi’ m choo̥ n!
Auch solches Versinken eines armen Stucks in de n unputzte n Greebe n war eben etwas Gewöhnliches. Es mußte noch viel heißen, wenn der Hirte einen Unfall rechtzeitig gewahrte und um Hülf ’brüelet het. Dann nahte mäṇgisch es Dotze nd Mannschaft mit Schụụfle n u nd Säili. Mit jenen wurde g’lochet, damit es gelinge, die Seile um den Leib des Tieres zu schlingen und es unter boorze n u nd bäärze n ụụsḁz’zieh n. Es fragt sich bloß, ob diese Mühe sich nicht auf Tiere beschränkte, wo n es «si ch der weert» isch gsi̦i̦ n, zue nne n Soorg z’gee ben’ (oder z’haa n).
So die Weide. Daß als Weidetiere hauptsächlich solche des Rindviehgeschlechts auf sie angewiesen waren, geht schon aus dem Bisherigen hervor. Wir fügen bei, daß im Moos aufgefundene Büffelzähne von 3-4 cm Länge und 2 cm Breite, sowie im Untergrund von Iferten entdeckte Knochen von Elchen 20 unter den Beweisen für einstigen Tiefstand der Juragewässer ( S. 82 f.) mitzählen.
Nach solchen Wildtieren sah sich natürlich bloß der Jeeger um. Erst zur Haustier-Herde gehört der Hirte n. 21 Der tritt uns freilich von der 157 alten Moosweide her ganz nid in dem poetischen Gewand entgegen, ohne welches wir uns den Hirten nicht denken zu können meinen. Da ist nichts von Jauchzen und Sennengruß zu vernehmen, nichts vom Zusammenleben von Tier und Mensch, wenig nur von Glocke und Halsband 22 u. dgl. Wenn es tringelet, so geschieht es bloß am Glockenzug des Krämers und im Herrenhaus, sowie an der Hand des in der Dorfgasse ausrufenden Weibels. Besser stimmte zur alten Moosweide das spelke n und verspelke n (scheuchen und wegscheuchen), das versenke n schüchterner Tiere, und das jeuke n als jagen im transitiven, wie freilich auch neutralen Sinn. Aus das jeuke n als wildes umenan͜dere n fahre n des Jeuki verstunden sich die Herde und der Hirte gleich gut. Als Hirten nahm man Rangen, deren Betragen oft schlingelhaft genug war, oder auch Ältere, mit denen gelegentlich das Chorgericht sich zu befassen hatte. So 1590. Da hieß es: Die Hütter sind gewarnt, das si nit vßfarind mit dem gutt zwischen den beiden zeichen des lütteß (Läutens zum Gottesdienst), vnd mit iren Kinden redind, das si nit über das gutt und lütt schwerind und böß redind.
Von der Art der Jungen, Dummhäite n z’spi̦i̦le n, erzählt man noch jetzt Müsterli wie diese. Wi si Gott erschaffe n het, rannten sie bei sommerlicher Mooshitze den von oder nach Sugiez fahrenden Fuhrwerken nach, um mit un͜derlegge n, spanne n oder unverblümtem bättle n Geld zu ergattern. Erhielten sie nichts, so erhoben sie das G’mụụl:
Der Herr ohne Geld
Gehl dreimal um die Welt,
Geht dreimal ums Haus
Und fallt
eenen aacha i d’s Sch—.
Und der Heer, der Beer het e
Chuuppen (Eiterbeule) am — usw.
23
Die Burschen bildeten unter sich eine Art Genossenschaft mit Statuten, welche sie als ungeschriebene gerade um so strenger einhielten. Insbesondere galt dies vom Paragraphen über die Erlangung der Mitgliedschaft. Moospöschliwaase n ( S. 112) wurde an Ort in kleine Stücke zerschnitten. Wer im stande war, es Dotze nd von solchen mit dem Mụụl Stück um Stück vom Boden herauszuheben und auf ein Häufchen zu legen, gehörte fortan zur Gilde. Die Aufnahmsurkunde war schwarz auf braun in dem über und über mit Torferde beschmierten Antlitz zu lesen.
Nach der guten Seite hin schlimm und du̦r chtri̦i̦ben (beides also im Sinn von «gescheidt») mußte aber doch wenigstens der Stiere nhirte n 158 sein, der jeweils am Morgen äm vieri g’hoornet het. De nn häi n de nn d’Lüt d’Waar alli ụụsḁgla̦a̦ n, na̦ chdäm si d’Chüeh häi n g’mulche n g’haa n. Das grŏß Moos bis zur Brue̥ije n war ein Weidegebiet, das der Verantwortung namentlich für die wertvollern Stuck doch schụụderlich vill brachte. Sie mit gutem Gewissen übernehmen hätt der Hundertist nit chönne n.
Wie Büffel-, fanden sich auch Pferdezähne im Moos. Weit jüngern Datums sind die um Port und Brügg dem Torfmoor enthobenen Roßịịse n. (Die Römer kannten unsern Hufbeschlag nicht.) Auf Pferdeweide deuten auch Namen wie Marais aux chevaux bei Cornaux. Weidende Pferde und namentlich Füllen gehörten bis zur durchgreifenden Moorkultur durchaus zur Charakteristik des Mooses. Man zählte im Jahre 1816 neben 842 Hornviehstücken 250 Pferde. 24
Eine Anzahl der letztern, mit bräite n Ịịse n b’schlaage n, kam allmorgendlich aus dem Waadtländischen über die Broye geschwommen, um uf dem See, d. h. aus dem (bernischen) Seestrand inne nfü̦ü̦r dem Gatter die zuckersüßen Röhrli, Seeröhrli (Schilf, S. 110) abzuweiden. Zu ihnen gesellten sich, uf d’Wäid g’spelkt, die einheimischen Rosse, auf welchen ihre jugendlichen Hirten nach Art der Gauchos ohne Sattel und Zaum, sogar stän͜dlige n, herangesaust kamen. Übrigens ritten auch Mäitli, bloß der Halftere n als Zügel sich bedienend, im Galopp. Um auf solchem nicht vom hohen Schilf abg’sträipft z’weerte n, mußten sie sich am Chammha̦a̦r haa n.
Als sommerliches Nachtlager diente gelegentlich für Mensch und Vieh der Feerig (Pferch) auf offenem Feld. Schon das Dröölnagelbett, wie humoristisch die Viehstreu über der aus schmalen Rundhölzern gefertigten Pritsche heißt (vgl. die Stierefeedere n), wäre für den Hirten ein unstatthafter Luxus gewesen. Unter einer mit Tuch bedeckten Bänne n nächtigte der Scha̦a̦fhirte n oder Schööffer, an welchen die Schööfferachere n erinnern,
Waren seine Tiere auf diesem oder jenem guten Scha̦a̦fblatz etwa schneederfreesig geworden, so verging ihnen solch wählerisches Gehaben im Moos gründlich. Und wie manches Tier ging hier sogar in seuchenfreien Jahren zu Grunde, wenn e̥s G’chü̦ppeli, Tschöppeli etwa über eine rutschende Kanalböschung hinjagte und rettungslos versank! — Im Jahr 1871 wurde die ganze vierhunderthäuptige Herde englischer Schafe des vormaligen Witzwilergutes (s. u.) zweimal rü̦ü̦dig. Dreißig Stück mußten wegen Erbrụụde n (1670) zur Unzeit geschoren werden und gingen im Winter ein.
159 Alle Morgen ferner mußte der Säühirte n die schwyn außtryben (1668) und den schwynen hüten (1646), 25 was natürlich der alte Kanzleistil mit « rev.» zu vermerken nicht unterläßt. Da bekanntlich d’Säüe n chläi n wi d’Möntsche n, wenn nicht sogar besser behandelt sein wollen (was keine noch so entrüstete Ablehnung: ja̦, Tü̦ü̦felsdräck u nd Lewatööl! wirksam bestreitet), bedürfen sie auch eines bessern Obdachs. Als solches diente, nahe dem Dorf Ins, der Säüegge n. Schon der gleichbedeutende Name im Sank deutet auf die hi̦lbi Lage der Örtlichkeit, welche heute mit etwa vierzig Mannwerk Reben und den für ihre Bearbeiter bewohnbar gemachten Spitalscheuern bestanden ist. An die bessere Haltung der weidenden Borsteriche erinnern auch die Schwịịnbaadi und die einstige Siseler Säumatte n.
Es gab also im Großen Moos Stiere n- u nd Scha̦a̦f- und Säühirte n. Zu ihnen aber gesellte sich, als der geprüsteste, der Genshirte n. Im Lengnauermoos hütete dieser Änten u nd Gens 26 zusammen. Im Erlachischen dagegen macht die zahme Ente ihren zoologischen Namen «Hausente» zur vollen Wahrheit, indeß die Wildänte n ebenfalls ungehütet das Moos mit seinen Greebe n zum Nachtlager wählt. Aber so ball d es aa nfa̦a̦t taage n, flụ̈ụ̈ge n si ụụf u nd rode n si ch hụ̈̆ffe nswịịs z’seeme n uf dem See̥. Gräben und Bäche suchen ja im Winter auch Gänse auf; und die Feststellung, daß einer an einer Angelegenheit mitbeteiligt sei, kleidet sich in die Redensart: er het ó ch Gens im Bach. Allbekannt ist das Genslichrụt ( Potentilla anserina). Schlechter Wein heißt spöttisch Gense nwasser. Auf die G’freesigi der Gans gründet sich das Kinderspiel «Gens fuetere n». Dem zwischen die Knie Geklemmten wird ein kleiner Leckerbissen nach dem andern in den Mund gesteckt, bis er plötzlich durch etwas Widerwärtiges enttäuscht wird. Eben auf die Gefräßigkeit aber rechnete der alte Gänsezüchter. Am wenigsten wegen des Gansenäi; mehr schon wegen der Gense nfeedere n, besonders aber um des Gänsebratens willen. Daher alle die sommerlichen Weideplätze für die allzeit schwịtigi Grasfresserin: das Gensenallme ndli zu Gampele n; das Gense ng’leeger und der bis 1870 beweidete Gense nblätz in Finsterhennen; die Pré de l’Ouye, d’Oyau, Louye, Louyes, Louyaz. 27 Auch auf den Gensenachchere n von Ins und in dessen Moosanteil schnatterten einst meh weder tụụsig Gens in den Freßpausen ihr vielsagendes Gágagaag und Gigagaag der Unterhaltung, ihr Gang! als Schreck- und Warnruf, 160 ihr leises Gangangang als Marschlied, oder den einsilbigen Jammerton der abgekommenen Jungen.
Schon um 1852 war freilich ihre Zahl auf den Zehntel gesunken, und noch später war etwa ein sommerlicher Bestand vo n neme n Dotze nd die Regel. Da für die Betti (Betten) die Daunen noch nicht so leicht käuflich waren, mußte man doch Gens ru̦pfe n (altinserisch: rạupfe n, wie man noch strạupfe n, Chi̦i̦rße n strạupfe n, abstrạupfe n sagt), in halbjährlichen Ru̦pfe n ihnen d’Feedere n neh n. Etwa zwei Tiere behielt man über Winter zum Züchten.
Die Jungen, welche zum Fressen noch äußerst unbeholfen sich anließen, aber bereits zwäüdeegig ’badet häi n und mit ihrem muntern Wesen viel Vergnügen bereiteten, konnten aber selbst in de n deckte n Hüennerferige n nicht sorglich genug vor de n Chrääije n geschützt werden. Es mußte also ein sehr wachsames kleines Mädchen sein, das, mit eme n Bitz Broo̥t im Sack ausgestattet, in der fast bloß mit Gänsekraut bewachsenen Flur bim Bandbrünne n die Bruetgans und die ihr anvertrauten eigenen und fremden Gensli überwachte.
Trotz den Kulturschädigungen, um deren willen die Gänse ungern gesehen wurden, 28 hat ihren Besitzern jeweils uf’s d’s Neuja̦hr e n schöne r Profit ụụsḁg’luegt. Galt doch in Neuenburg und etwa auch in Biel jedes der Tiere, die als groo̥ßi Dotsche n im Moos zu rascher Mast gelangt waren, g’chöpft und g’ru̦pft ( g’rạupft) fünf bis acht Franken.
War das aber auch ein Zug ins Moos am Morgen und vom Moos am Abend! Das ging im richtigen Gänsemarsch, die Läitgans als die vu̦u̦rteristi an der Spitze, die andern etwa von der jeweiligen Nachfolgerin mit dem Schnabel am Schwanze gepackt. Das geschah bisweilen so derb, daß die Gebissene mit lautem Quack! uufgumpet isch.
Am Morgen rief der Hirte durch die Dorfgassen: Géns ụụs! Géns ụụs! Die Eigner brauchten nur mit einem Riegelruck die Ställe zu öffnen, und ohne Verzug watschelte das vom Haus zur Gasse, Trüpplein um Trüpplein zur Herde sich sammelnd, wie hundert Bächlein zum Fluß und Strome. Am Abend löste die Schar auf umgekehrtem Wege sich wieder auf, nachdem die ung’hụ̈ụ̈rig g’freesige n Dierer etwa mittelst vorgetäuschten Hetzens durch einen der außerordentlich gefürchteten Hunde: Deei, dee, dĕ dĕ, Beeri! zu schleunigem Verlassen der Weide bewogen waren. Ung’häiße n begab jede Gans, die nicht eine Gans 161 war, sich nach dem heimischen Stall. Die Eigner kennzeichneten allenfalls ihre Tiere mittelst eines um ein Bein geschlungenes Bändli oder eines in eine Schwimmhaut gestanzten Löchli. Im liebe n Fri̦i̦de n gingen übrigens diese Märsche nicht etwa ab. Die Gense nmännli, Ganser, Geeber hatten auf jedem Hin- und Herweg mit enan͜deren es Hüenli z’rupfe n u nd häi n enan͜deren erbissen öppis grụ̈ụ̈seligs. Einmal in Wut geraten, zischten sie, die Federn sträubend, so daß diese si n fü̦ü̦re̥rtsi ch ’gange n, mit vorgestrecktem Hals heftig an, was ’nen nu̦mmḁn i’ n Weeg choo̥ n isch, Menschen und namentlich Katzen. Wagten sie gegen erstere keine Schnabelhiebe in die Waden, so häi n si mit de n Fäcke n dri n g’schlaage n, das s es fast g’chlöpft u nd g’chnatteret het wi n es Rotte nfụ̈ụ̈r, und daß auch der Nervenstarke verchlü̦pft isch. U̦f Chin͜d, wo si ch g’förchtet häi n vor ’ne n, sị di donnstigs Tierer gsịị wi Tụ̈ụ̈fle. Si häi si bim Zụ̈ụ̈g (Gewand) p’hackt u nd ne n mit de n Fäcke n d’Chnäü blaau g’schlaage n. U̦ber (über) Fuehrweerch u̦u̦berḁ (ü̦ü̦berḁ), erzählt eine greise Inserin, sị si̦ g’flooge n u nd häi n d’Roß erschụ̈ụ̈cht.

|
|
Studie von Anker |
Weniger Verdruß erlebte der Hirt auf der Gänseweide, falls er nicht einem vom tödliche n Gense npfi̦ffi (Pips) ergriffenen, also verhäxete n 29 Tier behufs rascher Rettung die aus dem Stielknorpel entstehende Verhöo̥hig abzuschneiden oder auszurupfen hatte,
Ụụstrags Handels (schließlich) het er den n es chlịị ns Löhnli uberchoo̥ n. Darzue het er en iedere n Morge n, un d am Sunntig no ch äxtra, döörffen in eren iedere n Hushaltig ga̦n e n Bitz Broo̥t ịị nzieh n. 30
Über anderweitige Hirtenlöhnung belehrt uns die Gampeler Gemeindsrechnung von 1800. Danach gebührte beyden Hirten jedem ein mas Wein und für 1 batzen Brot. Dazu hat man ihnen der Hụszins zalt mit 2 Kronen 12 Batzen 2 Kreuzer.
162 Das war die alte Mooswäid. Welchen Gegensatz bildet zu ihr z. B. die Weidepraxis der Strafanstalt Witzwil auf ihrem entsumpften Weidegebiet! Hier tummelt sich während der ganzen Vegetationszeit das gesamte Rindvieh, das innert der Jahre 1898 und 1910 von zirka 100 aus 742 Stück angewachsen ist, während die Zahl der Schafe in derselben Zeit von 400 aus 30 zurückgegangen ist, ja eine Zeitlang auf Null reduziert war. In einem so ausgedehnten Betrieb lohnt sich eine mäßige Schafhaltung eben doch insofern, als die von keinem andern Weidetier und von keiner Sense erreichten Gräser und Kräuter in Fleisch und Wolle umgesetzt werden können. Von Weideplätzen aber wie dem Groo̥ßhubelmoos wurden die Schafe durch die Gu̦sti (Jungrinder) verdrängt. So wird der Rasen verbessert, der Boden gefestigt und vereebnet, und die immerhin zur Genügsamkeit erzogenen Tiere geben die für bessere Weide doppelt dankbaren Milchkühe und Zugochsen. Rationell abgegliederte Weidebezirke, den Alplägern analog, sorgen aber dafür, daß geng gnue g z’frässe n da̦ isch. 31 Zudem bessern Chrü̦üsch (Kleie) und Salz, bei naßkaltem Wetter auch Heu, die Nahrung zweckmäßig auf.
Aber mehr: Witzwil 32 besitzt seit 1900 nun auch eine Alp im geläufig gewordenen Sinn der Höhenweide. Es ist die Simmentaler Alp Kilei, von welcher wir später Näheres berichten.
1
In den Freibergen, in den Münsterschen Gemeinden
Les Bois, Geneveyes, La Joux
2
Verschieden von keltischem
calmis, was eine wegen Steilheit meist unbeweidete, dafür gemähte Berghöhe bedeutet. Vgl.
Gauchat im
Bull. 1905, 1-15;
Thomas in
Romania 21, 9, 1. Verwandte Namen:
Jacc. 74 f. 81.
3
Urb. Mü. 19. 32.
4
Vgl.
Gw. 329.
5
Schwz. Id, 2, 1604.
6
Urb. Mü. 10.
7
Schn. G. 21.
8
Ebd. 22.
9
Ebd.
10
Vgl.
Gb. 165.
11
Kocher 15.
12
Gb. 280. Vgl. die Katastrophe in Frankreich im Regensommer 1910.
13
Schn. G. 26.
14
Ebd. 27.
15
Stauff. 58.
16
Ebd. 21.
17
Ebd. 27;
Schwell. 36.
18
Es gehörte der Landschaft Ins:
LBI. 71.
19
Chorg.
20
Sowie das im Herbst 1913 zu Gampelen gefundene Hirschskelett.
21
Also schwach gebogen (wie «der Hase» u. dgl. in
Gb.), wie mhd.
hirte = Hirte, ahd.
hirti, als -ja-Stamm aus
hërdô = Herde abgeleitet: der zur Herde Gehörige. (
Kluge 209.)
22
Gb. 196 ff.
23
Kal. Ank.
24
Schwzfrd. 1816, 225.
25
Der Wemfall erklärt sich aus der Grundbedeutung (
Kluge 217) «schützend zur Seite stehen». Dem
Dativus commodi gesellt sich der ältere (z. B. Luthersche)
Genitivus causae bei.
26
Lg. 115.
27
Jacc. 241. 315 (zu
auca, oie).
28
In Fleurier mußten sie 1675 innert acht Tagen abgeschafft werden. (
Jacc. 315.)
29
Stauff. 57.
30
Mündliche Schilderungen von Reubi-Ruedi und Frau Schumacher.
31
Schwz. Alpstatistik 14, 158 f.;
Stat. 02, 2, 226 f. 278 f.
32
Kell. W. 18.
Der heutige Milchlieferant manglet brav Sträüi. Solche gewähren ihm vorab die Binsen und die (Schilf-) Röhrli, welche am Bodensee und an der Nordsee sorgfältig kultiviert werden 1 und im Seeland wenigstens einen wertvollen jährlichen Raub liefern. Der sarkastisch so geheißene Woorbe nweize n 2 könnte aber nach gelungenen Versuchen auch als Nahrung für Schweine, Schafe und Rinder dienen, wenn er nach Art der Heufeimen eingesäuert würde.
Mit großem Erfolg hält denn auch jeweils im Juni die bernische Staatsforstverwaltung am Strandboden z. B. des Faane̥l eine Schilfstäigerig ab. Die ebensolche am Häide nweeg aber verzinst jeweilen den Preis, welchen Erlach 1893 für das «Sumpfstück» bezahlte, um den vollen Viertel. Sehr abträglich fällt auch die Lische aus, wenn sie in günstigen Sommern meeterig (meterhoch) wird. Im Winter werden 163 Binsen und Schilf als g’froorni Sträüi über d’s Ịịsch g’määit, 3 damit sie nicht mit ihrer Steifheit (Gstaabeligi) de n Chüeh d’Ụtter verstächi.
Ebenfalls in den Juni fällt die Moosgraas- oder Mooshäüstäigerig der Gemeinde Ins über sieben Parzellen vor Bruedersgrabe n, sowie sieben in den Grĕbli- und den groo̥ße n Däile n. Auch hier handelt es sich also um ein neh n, was’s gi bt. Immerhin macht sich der Übergang vom Sumft zur Dauerwiese bemerkbar durch das Auftreten mittelguter Futterpflanzen wie des wolligen Honiggrases, des Besenriedes 4 ( Molinia, S. 116) und des Sauerampfers ( das Sụụrimụụs geheißen).
Verschieden von diesem Häümoos ( S. 150), in welchem natürlich die Ersteigerer chönne n ga̦ n häüe n, wenn (wann) si wäi n, ist das Grŏß Moos als der Schauplatz des einstigen Mooshäüet. Mit diesem und der vorbeschriebenen alten Mooswäid ist seit der Entsumpfung und Moorkultur ein charakteristisches, wiewohl wirtschaftlich keineswegs zu vermissendes Stück seeländischen Lebens verschwunden.
Im grŏße n Moos het chönne n ga̦ n määije n, was het welle n. Nur nicht vor dem zeeche nte n Häümoonḁt. 5 Vormals galt als zeitliche Grenze der erst Augste n, noch früher der zeeche nt Augste n (Lorä́nze n), und um 1575 die Zeit nach dem 24. Juni ( «St. Johanns des Täufers Tag»). 6 Zuletzt waren der frühste und der späteste dieser Termine eingeräumt. Der Mooshi̦i̦rte n, Moosbannḁcht (Moosbannwart) oder Moostụ̈ụ̈fel, wie er im Gepolder der über seine Strenge Erzürnten geheißen wurde, wachte darüber, daß das Määijrächte n nicht zur Unzeit ausgeübt wurde, und das s alls i n der Oor dnnig zuegang. Drei Daag u nd drei Nächt durfte man dem Moosheuet obliegen. Doch war es den aus weiter Ferne Hergekommenen lieb, d’s Häü grad am glịịche n Daag chönne n z’neh n. Das war bei schönem Wetter auch möglich, we nn mḁ n d’s Häü rächt ’gḁumet u nd gäng dra n g’fochte n het.
Das het albe n zaablet! U nd Fräüd het mḁ n ghaa n i n däm Moos! Denn da̦ het mḁ n mäṇgisch no ch rächt brav chönne n häüe n, we nn mḁ n si ch darzue g’ha n het. Das geschah denn auch. Man durfte erst um die Mitternacht des ersten eingeräumten Tages beginnen. Allein, mi isch scho n am Aa̦be nd ga̦ ịịchḁ- oder ịị nschla̦a̦ n, d. h. zur unbestreitbaren Abgrenzung des in Beschlag genommenen Stücks mit einem hin u nd wider geführten Sensenstreich ga, n zäichne n, wo mḁ n dü̦ü̦rḁ 164 well. Drụụf isch mḁ n de nn aafḁ ga̦ n ringsed um määije n. Mit Wịịderüete̥lli als Zi̦i̦l wurden wo möglich zuvor die Strecken, die man mit ’dingete n Häüer zu bewältigen hoffte, abg’steckt. Andere hatten vielleicht die nämliche Strecke sich ausersehen und bekriegten nun den, wo isch der ehnder oder eeijer gsi̦i̦ n. Mit het enan͜dere n g’sablet mit de n Seege̥ze n. — Die gleich im Moos übernachtenden Mäder hatten ihre Hausgenossen längst verständigt, wo’s öppḁ dü̦ü̦rḁ gang, damit diese ihnen ohne langes Suchen das Frühstück zutragen können. Obendrein het mḁ n als Erkennungszeichen de nn öppḁ n e n Rächen ụụfg’steckt un d e n roo̥ten oder e n wị̆ße n Naase nlumpe n dra n g’hänkt, oder e n Schmaale nschü̦ü̦bel (Schmielenbusch). De nn het mḁ n dee nn, für zum ässe n doch o ch chläi n Schatte n z’haa n, zwo Gaablen ụụfg’steckt u nd g’schläsmets (welkes) Gras drüber ghänkt.
Nächtlicherweile, oder wie im Wịtiheuet auf der Grenchener Weite wenigstens rächt früech drị n z’haue n empfahl sich auch sonst. Die magere n Greesli («die Sụụreloudiohee und wị̆ße n Lische nzötteli drüber wi Watte n») 7 mußten vom Tau g’hörig ii ng’säüffet werte n. Süst isch d’s Gras ummḁ n ụụfgstan͜de n, und kam höchstens den kleinen Na̦a̦chḁstumper zu gut für d’Chü̦ü̦neli. Im Moos bekam es wenigstens e n g’schleeberigen Überzug, der es auf die Seite legte. Da hieß es also: ferm fü̦ü̦rahạue n i n groo̥ße n Halbmöön d. 8 Aber bis am Aa̦ben d äm sächsi het ebe n doch müeße n g’määijt sịị n.

|
|
Studie von Anker |
Di Lüt häi n das aber o ch los g’haa n! Scho n ihri Seege̥ze n sị n dḁrna̦a̦ ch gsi̦i̦ n. Mi het ’ne n na̦a̦ chg’redt, si siigi verhäxet. Ämmel lang het mḁ n mit ne n chönne n määijen ohni z’wetze n. Un d o ch d’s Mụụl het mḁ n nid lang u nd nid mäṇgist g’wetzt: we nn z’ringsed um isch g’määijt g’si̦i̦ n, het mḁ n hurti g es Mụụl voll ịịcha g’stoppet un d umma drị n g’schlaage n, wi wenn nụ̈ụ̈d meh guet weer. Äm zeechni het’s Broo̥t u nd Wịị n ’gee n, u nd gege’n Aa̦be nd isch der Häüermäister ga̦n e n Suppe n choche n.
165 Aber wo het mḁ n de n g’schla̦a̦ffe n, we nn mḁ n män’gi Stun͜d vo n häime n dännen isch gsi̦i̦ n? He, da̦ het ma n scho n wehre nd dem z’Imm bis hurti g e n Hụ̆ffe n vo n däm g’määite n Gras, wenn mügli ch d’s chü̦ü̦rziste n ’zettet, für das s mḁn äm Aa̦be nd chönn dru̦ff li̦gge n. Si häi n wohl g’wüßt, das s es e n Chalberei weer, uf dem bloße n Boode n z’ubernachte n u nd de nn Sumpffieber ( S. 101) oder G’süchti oder süsch öppis Tụ̈ụ̈fels Tumm’s ụụfz’leese n. Drum häi n si e n Mooshütte n z’weg g’macht: 9 si häi n us dem Häü ḁ lsó z’seege n drei Mụụren ụụf’bịịget u nd di mittlisti ḁ lso gmacht, daß das Ganze n ung’fehr wi n es Roßịịse n ụụsg’seh n het. Uf der vierte n Sịịte n het mḁ n chönne n d’s Segel vo n däm Wäidlig, wo mḁ n drinn isch ü̦berḁ g’fahre n, drü̦ber hänke n, un͜derḁ schlụ̈̆ffe n un d schla̦a̦ffe n — we nn’s de nn notti 10 us dem Schla̦a̦f öppis g’gee n het.
Mi mues eebe n wüsse n, daß vo n Ruej nid vill het chönne n d’Reed sii n. Ämmel äine r het geng müeße n wache n un d d’s Fụ̈ụ̈r schalte n, wo mḁ n vor dem Lager aa n’züntet het, für gäng z’wüsse, was öppḁ gang. Da̦ isch gäng öpper parat gsi̦i̦ n, für andere n ga̦ n Häü z’stehle n. 11 Das het chönne n bluetigi 12 Händel absetze n; un d äinisch isch äine r vo n Wileroltige n dḁrbii ’töödet worte n.
Am zwäüte n u nd am dritte n Mittag het mḁ n de nn i n der Mooshütten 13 o ch g’suecht z’schla̦a̦ffe n — we nn’s ämmel öppis d’rụụs ggee n het weege’m G’schmäüs vo n dene n Müggen u nd Flöo̥h, wo äin verbisse n häi n öppis grụ̈ụ̈sligs, u nd weege n der förchterlige n Hitz. Öppḁ die häi n vilicht e n chläi n chönnen es Nü̦ckli neh n, 14 wo z’mäṇgisch dä zin nig Wịị nbächer, wo na̦’m z’Mi tdaag 15 umg’gangen isch, häi n a n d’s Mụụl g’hänkt. Das ist drum gar e̥s tu̦u̦rstigs z’Mi tdaag g’sii n: di gröösti hin͜deri Hammen us dem Cheemi achḁ, u nd dü̦ü̦r ri Boo̥hne n dḁrzue, wo mḁ n dahäime n ganz langsam g’chochet g’ha n het. Da̦ het de nn der Vater sị ns schweer Sackmässer fü̦rḁ g’noo̥ n, het’s a n mene n groo̥ße n Stäi n g’wetzt u nd de nn Bitzen abg’hạue n so groo̥ß wi n e n chlịịnni Han͜d. Dḁrna̦a̦ch het er d’s Mässer umma g’macht zuez’chlöpfe n u nd dänne n ta̦a̦ n u nd g’rüeft: So, nehmet iez, langet zue!
Z’Mittág z’schla̦a̦ffe n häi n e n Däil so wi so nụ̈ụ̈d bigährt. Denen isch es um’s jaage n z’tüe n gsi̦i̦ n. Si häi n gwüßt, das s es i n de n Sü̦mft Luivögel (in der Bedeutung Kronschnepfe) gi bt u nd Strandläüffer, i n de n Röhrli Rallen u nd Wildänten u nd Kriechänte n. U nd da̦ häi n si scho n wehre nd dem häüe n dḁrfür g’sorget, daß d’Büchse n nid 166 z’wit dänne n sịịg, wenn’s zum z’Mi tdaag hoorni. Di g’schoßne n Dier het mḁ n de nn grad am Mittag drụụf im Moos ’kalatzet. Di ụụsg’noo̥nen u nd g’rupften Änte n het mḁ n an ere Schnuer vor dem Fụ̈ụ̈r ’bbra̦a̦tet (oder ’bbra̦a̦te n). Dee r, wo der Choch g’macht het, isch öppḁ n uf ere n g’höögerige n Tanne nwü̦ü̦rze n g’hocket u nd het si ch mit dem Rügge n a’ n Stamm aa n’drückt. Mäṇgisch het e̥s de nn öppḁ no ch n e n fäiße n Hecht g’gee n. Dää n het mḁ n dee nn i n der Äsche n b’breeglet u nd Hördöpfel dḁrzue! Das s e̥s bi all däm kalatze n nid an ung’wäsch’ne n G’spässe n g’fehlt het, brụụche n me̥r nụ̈ụ̈t z’seege n.
Aber we nn’s de nn mit de n Häüfueder gege n häi m zue g’gangen isch, de nn isch es de nn mit der Fräüd am Mooshäüet ụụs g’si̦i̦ n! Schiffle n wi d’Seebụtze n (s. im Band «Twann») het mḁ n nit dḁrmit chönne n, u nd Weege n si nd längs Stück käiner gsi̦i̦ n. Mi het müeßen über Sumft u nd Moos fahre n, wi mḁ n het chönnen u nd möge n. Da̦ het es ’s en iederen Auge nblick chönne n gee, das s der Wa̦a̦ge n bis zu der Achs ịị ngheit isch u nd d’Stiere n (Zugochsen) bis a n d’Chnäü. Ja̦, mängisch het’s d’Wööge n (Wagen) ̣ụụsg’leert, u nd de nn het mḁ n müeßen äi n Büntel um der an͜der tra̦a̦ge n, gäb mḁ n ummḁ n es Fueder het chönnen e n Bitz wịters fergge n.
Aber erst rächt e n trụụrige n Mooshäüet isch de nn das g’si̦i̦ n, wenn’s gä ng g’reegnet u nd gä ng g’reegnet het, bis der Karnaal über isch. De nn het mḁ n de nn mit de n Häübeere n (Heubahren) das nasse n Gras müeße n bis zum Bandbrunne n fergge n, für’s dört luege n z’deer re n. Über de n Karnaal isch e n Steeg g’gange n, daß d’Lụ̈t häi n drüber chönne n. Aber wär de nn vill het z’häüe n g’haa n, het’s de nn uf ene n Wa̦a̦ge n g’laade n u nd Stieren oder Roß aa ngspannet; die häi n de nn dur ch d’s Wasser müeße n. Di g’waanete n Roß, die sị n albḁ no ch g’läitig g’gange n, u nd mi isch äi nfach uf si ụụfg’hocket. Aber di ung’waanete n! Wenn’s i n däm lin͜de n Bode n un͜der ’ne n g’la̦a̦ n het, de nn häi n si si ch grụụsam g’förchtet u nd häi n zaablet u nd sị dḁrmit gäng täuffer drị n choo̥ n. Mi isch mit de n Stiere n besser g’fahre n. Aber bis mḁ n die het dü̦r ch d’s Wasser g’jagt g’haa n, das het g’spu̦ckt! Da̦ het mḁ n de nn richtig ó ch mit ’ne n dü̦r ch d’s Wasser müeße n watte n. U nd we nn d’s Wịịbervolch scho n het der Chittel ụụfg’steckt, so het’s doch der ganz Daag vo n z’oberist bis z’un͜derist ab ĭhm ’tropfet, un d d’s Hemm dli het e n Schleegel g’haa n vo n Dräck. Aber ämmel de n Mäitli het das nụ̈ụ̈d g’macht! Die häi n noch di blụtte n Füeß dü̦r ch de n Läiterwa̦a̦ge n dü̦ü̦rḁ g’steckt, für si chönne n dü̦r ch d’s Wasser z’schläike n. Es nimmt äi’n nu̦mmḁ n Wun͜der, das s mḁ n nie nụ̈ụ̈t (keine Krankheit) ụụfg’leese n het.
167 Äntlich isch de nn äi n Wa̦a̦gen um der an͜der i n d’s Dorf ịịchḁ g’fahre n. Da̦ häi n d’Lụ̈t zu allne n Pfäister ụụsḁ g’luegt. U nd d’Manne n sị n mit der Pfị̆ffen im Mụụl chŏ n dḁrhee̥r z’trappen u nd häi n es Hämpfe̥lli Häü ergriffe n u nd g’lost, gob es chrụ̈ụ̈spe̥lli (leise rausche) u nd ’s a n d’Nase n g’haa n un d öppḁ g’säit: He wohl, es isch no ch rächt es stịffs Häüli! oder de nn: O wetsch! das isch wüest b’reegnet! es g’seht ụụs, wi we nn’s si̦i̦be n Mal hätt g’chöört (an Samstag Abenden) Fụ̈̆ra̦a̦be nd lụ̈te n! Nu̦mmḁ n d’Buebe n häi n nụ̈ụ̈t dḁrzue g’säit. Die häi n g’hu̦lffen ablade n wi d’s Bịịse nwätter, u nd geb (bevor) der Häüstock a n d’First ụchạ g’gangen isch, sị n si bi’m daarlegge n («fu̦ḷḷe n») 16 drü̦ber überḁ g’gumpet wi d’Fü̦lli (Fohlen) uf der Wäid.
Ganz andere Bilder bietet nun die Heuernte auf dem entsumpften, mit bessern Gräsern bestandenen und ordentlich fahrbar gemachten Moos. Da kann man in guten Juni- und Julitagen Hunderte schwerer Fuder sich langsam heimwärts bewegen sehen.
1
Fr. Schr. 331.
2
Vgl. die Wachholderbeeren als «Schwantebuechchriesi»:
Gb. 234.
3
F. im Berner Intelligenzblatt.
4
Besonders bemerkbar auf dem Gut von Notar Wyß in Lyß (s. u.).
5
Frau Schumacher.
6
Urb. Mü. 75.
7
Lg. 177.
8
Ebd.
9
Favre. 545.
10
Ungefähr svw. «wirklich».
11
Favre. 157.
12
Ebd. 143. 175.
13
«
Aux grand Hôtel du Chablais»:
Favre. 132.
14
Ebd. 127.
15
Bemerke:
das z’ Midaag als Mahlzeit,
der Mittág als Tageszeit.
16
Vgl.
Lf. 81.
Es brönnt im Moos! Diese Schreckenskunde ließ sich zwischen Kerzers und Ins schon mehreremal vernehmen. So seit dem 24. April 1893, wo 200 Jucharten Tu̦u̦rbe n mit Vernichtung bedroht waren, 1 und ihr etwa 50 Jucharten bei Cheerze̥ rz binnen vierzehn Tagen wirklich verfielen. Es ging allerdings bloß minderwertiges Material zugrunde. Am 9. Juli 1902 zerstörte ein neuer Brand 3-4 ha zwischen Witzwil und Sugy; ein größerer Schaden konnte durch Aufwerfen von Greebe n verhütet werden. Kleinere Brände entstehen etwa in heißen Sommern wie 1911 durch das ụụsleere n von Breeme ncheßle n (an die Wagendeichsel gehängte Kessel voll rauchender Stoffe zur Vertreibung der die Pferde quälenden Bremsen).

Turbenhütten im Insmoos
Unwillkommene Zeugnisse der Brennbarkeit des Torfs! Die Tu̦u̦rbe n, dies verzwoorgget Gewirr halbverwester Pflanzenreste ( S. 103 ff.), ersetzt denn auch im Seeland das immer teurer werdende Brennholz zu sehr großem Teil. Und wäre nicht der durch tü̦ü̦rbele n 2 ausgebeutete 168 Boden nachher ein trefflicher Ackergrund, so läge die Frage nah, göb es si ch nid wurd räntiere n, den Torfboden als solchen sich erneuern zu lassen, wie den Waldboden. Zumeist müßte allerdings der zwischen Praktikern und Theoretikern waltende Streit, göb’s z’mache n sịịg, erledigt werden. Jene behaupten: Ja̦, diese: Nääi n! Die letztern weisen auf das 7 km lange und 1,4 km breite Brüttele n-Hagni-Epsḁ ch-Walpertswil-Moos hin und sagen: solche si̦i̦be nmeetrigi Tuurbe nblätze n, die beim Vorüberfahren selbst unschwerer Wagen wie eine federnde Matratze auf und abwiegen ( waggele n), konnten erst im Verlauf von anderthalb Jahrtausenden entstehen, und das erst noch bloß unter günstigsten Umständen. 3 Und da der Stoff wi täüffer wi besser isch, während Schichten von bloß öppḁ n e n Schueh Täüffi höchstens guten Gemüsedünger und brauchbare Turbe nsträüi liefern, ist für lohnende Torfausbeute eine gewisse Mächtigkeit erforderlich. Dagegen behaupten Praktiker: Jä wohl! Us Sumpf gi bt’s gäng u̦mmḁ Tu̦u̦rbe n! Und zwar so rasch, das s es sich in acht Ja̦hr guet um ene n Schueh lü̦pft, b’sun͜ders wenn der Wase n blịịbt. So erneuert sich in 50-70 Jahren ein Torflager in alter ansehnlicher Dicki. Unser Gewährsmann 4 wies zum Exempel auf die Hofmatt hin, wo Belassung des Abraums und einer untersten Torfschicht sozusagen als Tu̦u̦rbe nsa̦a̦mme n das «Wunder» bewirkten. Als Fluren so benannte Tu̦u̦rbe nsti̦i̦che n zu Siselen und (einst dem Faane̥l zugehörige) auf dem Witzwiler Gebiet können den 169 Beweis nicht mehr erbringen. Auch nicht die von Witzwil und Tannenhof (auf welch letzterm im Sommer 1912 444 m³ Torf si n ụụsa ’ta̦a̦ n woorte n).
Vor der Urbarmachung bieten die ausgebeuteten Stiche noch den Nebengewinn von Ịịsch (Eis als gefrornes Tu̦u̦rbe nwasser), sowie die Gelegenheit zum schlịffschuehne n und zịịbe n, zịịsle n (glitschen), wohl auch zu weihnächtlicher Illumination ( S. 111).
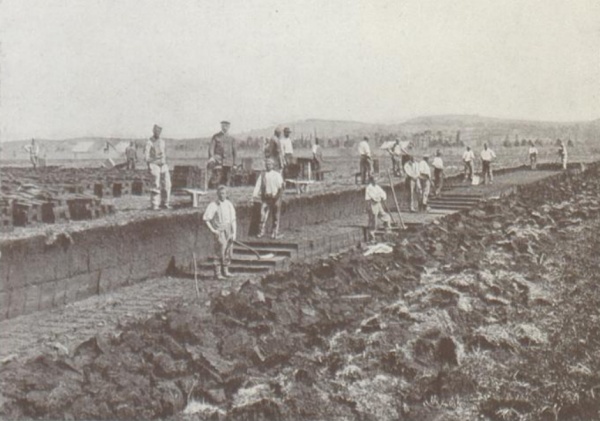
Im Turbenstich Witzwil
Die Urproduktionsart des Tu̦u̦rbe n stäche n aber vergegenwärtigen wir uns nun auf einem Torfstich in der Nähe der Tuurbe nhütte n, welche auf dem Gampele nmoos sich zu einem kleinen Hüttendörfchen vereinigen.
Die Arbeit vollzieht sich von aa nfangs Mäie n bis z’letst im Augste n. Vorher ausgehobener Torf würde den Spätfrösten des Mooses erliegen und als erfroornig sich durch rote Farbe verraten. Zu spät ausgehobener Torf la̦a̦t si ch nimme hr deer en. Die vier Monate müssen also in strammer Arbeit ausgekauft werden; sei’s bei der schwülen Mooshitze, wo der Schwäiß z’Bächli-wịịs vo n der Stirne n u nd vom ganze n G’sicht aachḁ rü̦nelet u nd d’Fläügen u nd d’Mugge n äim fast frässe n; seis unterm tollen Dahinfegen der Winde oder unter 170 anhaltendem Sprühregen. Nu̦mmḁ n wenn’s grandig chunnt, gäit mḁ n z’Scheerme n.
Der Tüürbeler oder Tuurbe nstächer beginnt mit dem Abmessen einer Aushubbreite von acht Fuß; das ist der Karnaal. Seine Länge ist die Breite des für den Sommer in Arbeit genommenen Stücks. Rasch wird der Wasen abg’hacket und der schlecht vertorfte Tuurbe n heert abg’schụụflet, bis ’s aa nfa̦a̦t glänze n. So wird eine etwa fußtiefe Abrụụmete n zu beseitigen sein. Das heißt abdecke n. Nun kommt das voorstäche n. Der Voorstächer: eine fußhohe und sechs Zoll breite spatenartige Schụụfle n mit bequemer Handheebi am Sti̦i̦l mit starker Dülle, dient mit Hülfe des Mees zum Bestimmen des Gängli. Das ist die Länge eines frischen Torfstückes, eines Tu̦u̦rbe nbitz oder kurzweg: einer Tu̦u̦rbe n (vgl. «das Brot» und «der Käse» als Laib). Sie beträgt zwölf Zoll (36 cm) bei drei Zoll Breite und drei Zoll Höhe, welche Maße beim Eintrocknen auf zwei Drittel oder gar die Hälfte zurückgehen werden. Das Gewicht aber schwindet, wenn es sich um gute, schwarze Ịịse ntu̦u̦rbe n handelt, von etwa sechs Pfund auf ein halbes Pfund.
Neben Wasser, das beim Trocknen des Torfs von 90 auf 15% zurückgehen kann, zeigt der letztere 8-10% mineralische Beimengungen, die beim verbrönne n als Tu̦u̦rbenäsche n zurückbleiben. Sie veranlassen mit ihrer Färbung die volksmäßige Unterscheidung von schwarzer und roo̥ter Tu̦u̦rbe. Jene gilt als älter und fester; diese wird zugleich als schwu̦mmelig («schwammicht») bezeichnet und von der wu̦llige n unterschieden ( S. 111 ff.).
Nun wird das Tu̦u̦rbe nschụ̈ụ̈feli zur Hand genommen: eine an geebigem Stiel befestigte Schnịịdi von Torfstücklänge mit rechtsseitig senkrecht aufgesetztem Öhri von Torfstückhöhe. Beide sind scharff wi Rassiermässer, ohne jemals der Schärfung zu bedürfen; solche erteilt ihnen während der Arbeit die Humussäure des Torfs.
Das Stäche n vollzieht sich stötzlige n: senkrecht von oben hinunter mit dem etwas abweichend eingerichteten Stötzligịịsen, oder li̦gglige n: waagrecht mit dem Li̦ggligịịse n. Die erstere Grabart empfiehlt sich für zeeije n (zähen), die letztere für brü̦ü̦chige n Torfstoff. Jene bedingt einen Stächerlohn von Fr. 1.40, diese einen solchen von Fr. 1.60 für hundert Höck zu je acht Torfstücken.
Man möchte stundenlang zusehen, wie dĭ̦fig das Werkzeug durch den speckig glänzenden dicke n Brịị fährt, und wie es Stück um Stück in elegantem Schwung dem jungen, wohl noch schulgenössigen Abnehmer zuwirft. Dieser faßt sie mit erstaunlicher Sicherheit auf, so daß kaum 171 eines verheit, und schichtet ( bịịget) sie im Stooßbeerli, um sie auf den nahen Tröchniplatz zu verbringen. Je zwäü Gängli gee n e n Beerete n.
Zum Trocknen werden die Stücke um einen kurzen Pfahl als Stütze recht dü̦ü̦r chzü̦ü̦gig ụụfg’höcklet, falls nicht ein ganz trockener Sommer das deer re n in Monatsfrist ohnedies ermöglicht, und wo nicht eigener Verbrauch das derart erleichterte Einzählen unnötig macht. Denn hundert Höck zu acht Bitze n machen einen Meter (m³) aus, der ab Ort etwa fünf Franken zu gelten pflegt. Danach bemessene Ladungen, von 2 m³, auf rasselndem Gefährt nach Neuenburg gefahren, werden dort unter dem Namen bauche, umgedeutscht als Tu̦u̦rbe nbu̦sch, entgegengenommen.
So ein Tröchniplatz mit dicht nebeneinander aufgeschichteten Höck kann an stark bewölkten Spätsommertagen sehr wohl aus einiger Ferne wie eine kleine Kumpanei Soldaten mit Kapút und p’hacktem Sack anzusehen sein. Das machten in den westschweizerischen Truppenübungen des Septembers 1911 Soldaten der «blauen» Armee sich zunutze. Sie hingen solchen Höck weiße Bänder um, wie die Truppen der feindlichen Armee sie markierend um den Helm trugen. Richtig erschöpfte eine regelrecht ausschwärmende Waadtländer Kompagnie erst ihre Munition mit Salven auf die mit stoischer Ruhe jede Annäherung Erwartenden, und dann die letzte Kraft mit wütendem Bajonettangriff. Nun erst sị n si e drüber ịị ntroolet, wie mḁ n si g’fụxt häig.
Torfstücke, die in nassen Sommern trotz fleißigem chehre n nie z’grächtem trochne n wäi n, zerkrümeln leicht zu Tu̦u̦rbe ng’rü̦ll. Solches wird hin͜der dem Horn bei Kerzers zu Tuurbe ncheesli oder Modeltu̦u̦rbe n geformt: eine Prozedur, die sich besser lohnt, als die 1857 zu St. Johannsen begonnene Kondensation und das zu Hagneck versuchte künstliche tröchne n. Auch die zu Brügg in Betrieb gesetzte Stächmaschine n verdrängte nicht die Handarbeit, deren Geduld und Intelligenz in manch einem Gewerbe doch immer noch oben ụụs schwingt.
1
Taschb. 1896, 261.
2
Diese Verbalbildung festigt die Dialektform
Tu̦u̦rbe
n, welche gleich it.
torba, frz.
tourbe usw. sich an die im niederdeutschen «Torf» erhaltene Lautstufe t- lehnt. Vor derselben sind die altalemannischen Verschiebungsformen (
Graff 5, 706) mit z-:
zurba, zurft, zurf, zturf, zcruf, zuruft, surfo, curffo, curffodi wieder verschwunden. Die Grundbedeutung war: (verworrner, verfilzter) Rasen.
Kluge 461. Vgl. noch das
Zu̦u̦rpfiwääse
n unter «
Rüstig».
3
Schn. 75.
4
Wie Reinhard in Ins, dem wir die meiste technische Belehrung während seiner ungestört fleißigen Arbeit verdanken. Vgl. auch
Le Foyer domestique 1899, 126 f.
Der Maler Anker stellt im «Sonnenuntergang» einen würdigen Greis 2 dar, welcher, unter dem mächtigen Chestene nbạum der 172 Pfruendhụụs-Terrasse zu Ins sitzend, mit stillem Sinnen ausschaut über die vor ihm ausgebreitete Mooslandschaft. Gedachte wohl der einsame Beschauer von seiner luftigen Höhe aus der Wandlungen, durch welche die stundenweite Ebene gegangen ist?
Wenn man von Einst und Jetzt im Großen Moose redet, so mäint mḁ n mit dem «Äinst» in der Regel die Jahre vor der Juragewässerkorrektion ( S. 81 ff.),
Zeugen der Urgeschichte gibt es eben im Moos z’seege n weeni g. Doch reden dört um enan͜dere n, wo d’Brue̥ijen i’ n Neue nburgersee̥ lạuft, noch vorhandene Pfööl von einer Pfahlbausiedelung (siehe «Twann»). Nicht weit davon finden sich so viele Bruchstücke römischer Ziegle n, daß man wohl auf eine dortige Milidärstazion schließen darf. An ihrem täüffe n Stäi nbett ferner erkennt man die Römerstra̦a̦ß von Aventicum nach dem Jura, welche als der Mạuriweeg, das Mạuri, das Mạur den oberiste n Däil des Großen Mooses durchquert. In der Nähe des Gütchens Tonkin 3 stößt sie an die Broye. Hier zeugten noch vor wenigen Jahren starke Pfähle von einer römischen Brügg. Ob die Burgunder, welche 1476 sich von Murten flüchteten, diesen Übergang ebenfalls benutzten, cha nn mḁ n richtig nịmme hr seege n. Beim acheriere n aufgefundene Münzen aus jener Zeit beweisen jedenfalls, daß die einsame Gegend von den damaligen kriegerischen Ereignissen am Fuß des Jura ebenfalls berührt wurde. Die bei der Urbarisierung des Mooses in großer Zahl zutage geförderten Eichenstämme ( S. 103 f.) lassen vermuten, daß in weit zurückliegenden Zeiten das Moosrevier mit Wald bedeckt gewesen sei. Es bildete damals vielleicht ( v’lịcht) das Jagdrevier der am Neuenburgersee angesiedelten Pfahlbauer. Ein Dorado der Jäger (s. u.) blieb es jedenfalls bis in die Zeit, wo es entsumpft wurde. Es war wohl in der Hitze der Geflügeljagd, als einem Jäger das gläserne ( gleesig) Pulverhorn mit der Jahreszahl 1794 verloren ging, welches der Pflug hundert Jahre später wieder zutage gebracht hat. Die Geflügeljagd besonders war dankbar in der oftmals überschwemmten Niederung. Und wenn auch heute die Änten und Schnepfen (Einzahl: der Schnäpf) auf dem bebauten Land ihr Heimatrecht verloren oder aufgegeben haben, so bildet doch der einsame Seestrand dem Broye-Damm ( Walm) entlang eine so günstige Wohn- und Nistgelegenheit der Wasservögel, daß sie sonst 173 nirgends ( niene n) in der Schweiz in so vielen Arten sich ansiedeln. Ihnen ist daher ein bedeutender Landstreifen als ungestörte Heimstätte gesichert worden.
1
Den (zumeist wörtlich wiedergegebenen) Grundstock dieses Abschnittes bildet der autoritative Aufsatz «Die Kultivierung des Großen Mooses mit besonderer Berücksichtigung der Domäne Witzwil», von Herrn Direktor Kellerhals. Eingeflochten sind als sachlicher Beitrag: Erinnerungen an den Hauptbegründer und Namengeber Witzwils; als sprachliche: Mundartformen aus
Gampelen und (die Lebensskizze von Notar Witz) aus
Erlach. Vgl. auch
Le Foyer domestique 1899, 155 ff.
2
Pfarrer Haas in Gampelen († 1896).
3
Launenhafte oder launige Erinnerung an den deutsch-chinesischen Feldzug von 1901; vgl. «Tripolis» am Münster-Grenchen-Tunnel, «Krim», «Yalta», den «Suezkanal» zu Tschugg (
S. 143), die Pension
Montmirail (
Mụmmeral) bei
Epagnier (
S. 19), und die verschiedenen
Ló̆reene
n (Lorraine) zu Tschugg, die Coopersche zu Bern usw.
Im Herbst und Frühjahr war das Moos meist Sumpf und See. Wenn aber das Wasser endlich sich verlaufen hatte ( si ch verlü̦ffe n g’ha n het), so lag wochenlang eine graue, trostlose Einöde da, bis dann unter dem Einflusse sommerlicher Hitz die Streuegräser ( Scha̦a̦fgaarbe n, Gäisläitere n, Röhrli d. i. Schilf, die schlechte, scharf schneidende Saarete n, S. 109) sich schnell und üppig entwickelten. Innert kurzer Zeit bildete sich eine grüne, wogende, zum Schnitt reife Wiese. Dann entfaltete sich für einige Zeit ein reges Leben auf der sonst so stillen Weite ( S. 163 f.). Lange vor Sonnenaufgang rauschte die Sense. Ein Mäder suchte den andern an Fli̦nggi (Schnelligkeit) zu überbieten. Die Ernte war jedoch im Verhältnis zur Wịti oft gering. Ja, i n trochene n Ja̦hr het’s gar nụ̈ụ̈d gee n. I n nasse n Summere n de nn hingege n so vill, das s mḁ ns nid alls het möge n g’määije n. De nn sị n de nn im Früehlig Buebe n g’gangen u nd häi n’s aa nzüntet. Hunderti vo n Jụụcherte n häi n da̦ ’brönnt.
War aber auch die Ernte klein: sie erforderte mindestens keine Opfer. Es ist daher begreiflich, daß in den umliegenden Ortschaften die Juragewässerkorrektion anfangs durchaus nicht als Wohltat begrüßt wurde ( S. 138), da einerseits der Heu- und Streueertrag stark zurückging, und anderseits die interessierten Ortschaften hohe Beiträge an das Kulturwerk leisten mußten ( S. 140 f.). Mit der Regelung der Wasserverhältnisse blieben eben die periodischen Überflutungen aus, und den Gräsern und Streuepflanzen wurden die wichtigsten Wachstumsbedingungen entzogen. In dem trocken gelegten Boden gelangten sie nicht zur Entwicklung, und das kümmerlich sprießende Gras lohnte kaum mehr die Mühe des Mähens.
Heute erscheint es uns nun als selbstverständlich, daß die Jahr für Jahr unabträglicher werdenden Moosflächen mit ihrem schwarze n Heert zum Tragen reicher Ernten wie geschaffen schienen, und daß die Idee aufkam, sie in fruchtbare Äcker und Wiesen umzuwandeln. Immerhin war solches Unternehmen ein gewagtes. Die Bevölkerung der Moosdörfer gewöhnte sich doch lange nicht an den Gedanken, daß dort nun gepflügt ( z’Acher g’fahre n), g’sääit und g’summeret werden sollte, wo während Jahrhunderten die Natur allein Meister gewesen war.
174 Einige tatkräftige und weitschauende Männer verwirklichten aber doch den Gedanken, und zwar sogleich in kühner Ausdehnung.
An der Spitze der Vereinigung standen Gutsverwalter von Fellenberg-Ziegler, Gerichtsschreiber Rösch, Sachwalter Wildbolz, Bankpräsident und gewesener Bundesrat Stämpfli, sowie der Notar und Rechtsagent Friedrich Emanuel Witz (14. September 1819 -1887, Februar 14) von und in Erlach. Dieser war die Seele der Unternehmens.
Sị n Vatter, der Húetmacher-Witz, isch en ei nfache r Maa nn gsi̦i̦ n und het us dem Suhn o ch n en ei nfache n Schrịịber welle n mache n. Dḁrfür het er ’nḁ, wo n er z’Erlḁch isch us der Schuel choo n gsi̦i̦ n, zu ’mene n Notar z’Nidau i n d’Lehr ’gää ben. Der Jakob Stämpfli vo n Wengi, der spääter Bundesrat, het ó ch grad mit ihm g’lehrt; und vo n dắ här isch är mit ihm äng befründet bli̦i̦be n sịr Läbtig. Schrịịber hei n richtig scho n denn die beide n nid gäng ’dänkt z’sịị n. Si hei n nääbe n zuechḁ d’s Rächt g’studiert us Lịịb und Lääbe n; der Bụụre nsuhn Stämpfli für Fü̦ü̦rspräch und der vermöge nslos Witz für Rächtsagänt und Notar.
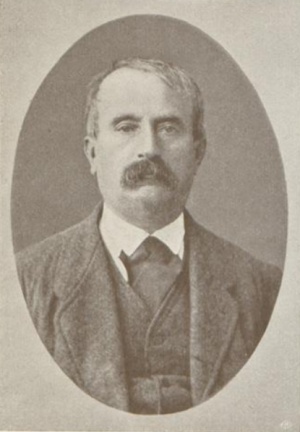
|
|
alt Bundesrat Stämpfli |
Notare n het’s denn im Erlach Amt nid so mäṇge n ’gää n wi iez. Drum het der Witz dra n dänkt, i n si’m Vatterstedtli es Bụ̈roo ụụfztue n. Aber a n der Sprachgränze n het er richtig o ch müeße n französisch chönne n. Wi het er das fü̦ü̦rg’noo n ohni Gält? Är isch uf guet Glück uf Lŏ́sane und het sich dört bi̦ si’m Brueder Sammeel es ganzes Jahr lang als Chällner verdinget. Dḁrmit het er richtig d’Sprach guet und gründlich g’lehrt, besser wi mängs P’hänsionsdöchterli, wo vil Gält fü̦ü̦r i̦ ns ’zahlt wirt. Är het i n Verhandlunge n, wo Dụ̈tsch und Wältsch wi Chrụt und Rüebe n dü̦r ch enandere n ’gangen isch, gäng an ei’m müeße n der Dollmätsch mache n. Dä n glịịch Flịịß und Ịịfer het er du o ch g’haa n für sị ns Bụ̈̆roo. Är het di G’schäft, wo mḁn ĭhm het übergää n, prompt und g’wüsse nhaft erlediget; und ball d het’s fast e̥kei n Brozäß im 175 Amt und drum ụmmḁ g’gää n, wo nid ei n Partei ihn g’noo n het, und sälten e n Verschriibung, wo n är nid ’berchoo n het.
Aber sị’r ganz apartige n Taatchraft u nd sị’m g’meinnützige n Sinn, wo nid hurti g sị̆nes glịịche n g’funde n het, isch di Bürotäätigkeit z’weeni g g’si̦i̦ n. Es het no ch öppis anders müeße dḁrnääbe n gaa n, wen n e̥s ihm scho n kei n Profit ịị ntreit het.
Är het zur Wasserversorgung der Aa nstoos s ’gää n und bi der Erstellung mitg’hu̦lffe n.

|
|
Friedrich Samuel Witz 1819-1887 |
Für Verdienst i n d’s Stedtli z’bringe n, het er d’Uhrimacherei ịị ng’füehrt. Da̦ het mḁ n no ch di ganzi Uhr g’macht vo n der Schalen aa n bis zum na̦chḁtraagen im Schịleedäschli. Der Herr Brennịịse n (Brenneisen) und sị n Dochtermaa n Hochuli hei n du̦ di schöni Industrịị wịter g’füehrt und dem Stedtli erhalte n, wenn o ch in andere n Bransche n (Pierristerie, s. im Band «Twann»).
Darna̦a̦ ch het er alls aa ng’setzt, für dem Stedtli us sị’r Wältabg’schi̦de nheit und us sị’r abg’fahrne n Laag ụsḁz’hälffe n. D’s «Dornröschen» het ụs sị’m länge n, länge n Schlaf sollen erwache n und sị n früecheri Bidụ̈tung ụmmḁ ’berchoo n. Drum, wi der Witz isch i’ n Burgerraat und i’ n G’meinraat choo, spööter o ch i’ n Großraat und i’ n d’Verwaltung vo n mehreren Anstalte n, het er g’luegt, e n richtige n Verchehr z’wäägz’bringe n. Erlḁch, wo jetze n von Eiß mit der Bahn uf Bärn und Neue nburg cha nn fahre n und über Neue nstadt im Summer bis ga n Biel mit ere n ganze n Flottillie n vo n Dampfer und Dampferli, het denn no ch nụ̈ụ̈t g’haa n weder d’Segelschiff und Barche n für wenn öpper dä n dräckig Umwääg über Landere n g’schü̦ü̦cht het. Da̦ het är dra n ’tri̦be n, das s e n Hafe n und e n Ländti erstellt worden isch und het nid lu̦gg g’laa n, bis e n Dampfschiffverbindig zwüschen Erlach und Neue nstadt i n’s Läbe n g’rüeft worden isch. Wo d’s erste n Dampferli «Union» g’fahren isch, het er das scho n ni̦mme̥ hr g’seh n; aber är het doch vorhär no ch alles schön chönne n z’wäg reise n und zum Abschluß bringe n.
176 Und wo n äär du̦ fast sị ns ganze n Vermöge n het im Moos ( S. 182) verlochet g’haa n, het er doch no ch ei ns g’meinnützigs Wärk g’stiftet. Wo dür ch d’Juragewässerkor räkzion der Heide nwääg isch über d’s Wasser choo n ( S. 23), hei n du d’Lüscherzer um d’Petersinsel um müeße n ga n chehre n, wenn sie mit dem G’mües hei n wellen uf Neue nstatt z’Märit fahre n. Für jetze n dene n di verlorni Verbindung mit der andere n Seehälfti wider z’gää, het der Witz e n Kanal la̦ n grabe n, wo si jetz mit de n Schiffli wider dü̦rḁ chönne n. Wil ihm z’grächtem niemmer het welle n hälffe n, het är dä n Durchstich völlmig uf eigeni Chöste n gemacht.
Jez verstande n mer erst, us wel chem Geist ụsḁ äär hinder sị ns Hauptwärk isch, wo sị n Name n treit. Äär und der Jakob Stämpfli, sị n Studie nfründ, hei n der glịịch groß Sinn g’haa: der Uuswandererstrom zrụggz’halte n und dene n Tụụsige n vo n früsche n, junge n Chräfte n, wo dää nwääg dem Land verlore n gange n, es neu’s Amerika i n der Heimat aa nz’wịịse n. Und de nn het mḁ n z’Bärn ja o ch all Tag di Blaauhụ̈sler us dem Zuchthụụs a n der A arbärgergaß und am Bahnhof annḁ gseh z’Chu̦ppele nwịịs mit de n Lastwääge n denen Öölgötzen und sälbstgrächte Pharisäer a n der Nase n vorbịị fahre n und der Räste n vom Ehrg’füehl, wo si no ch g’ha n hei n, verlü̦ü̦re n. Da̦ hei n sie ’dänkt: Was a n dene n z’retten isch, cha nn nummḁ gerettet wärde n, wenn si dem Pavel ab der Nase n und us de n Mụ̈ụ̈ler sịị n. Und so het mḁ n scho n denn sụ̈ụ̈ferli ch dä n Gedanke n g’fasset, wo du̦ frịịlich erst vill spääter verwirklichet worden isch ( S. 183 f.); d’s Zuchthụụs g’hört i n d’s große n Moos! Mir mache n dört e n Mueterkolonịị und gäbe n si als neus Amerika i n Läche n denen e ntlassene n Strääffling, wo wider wei n z’Ehre n choo n und i n der Wält niemmer hei n. Und die im Zuchthụụs solli de nn gäng neui Kolonịịe n gründe n, bis d’s Moos däwääg bevölkeret isch.
Dḁrfü̦ü̦r isch der Witz o ch dem Doktor Schnịịder ( S. 125 f.) mit Liib u nd Seel bịịg’stande n. Är het di hinderhält’sche n und mißtreue n Lụ̈t für d’E ntsumpfung g’suecht z’gwinne n, wi n er chönnen und möge n het. Und wi der Schnịịder der E ntsumpfung d’s Läbe n und ’s meist Vermöge n ( S. 132) g’opferet het, so het der Witz ämmel sị ns Gält i n d’s e ntsumpfte n Moos g’steckt, für daas der Kultur z’erschließe n.
Dä r Maa n het, für daas z’wääg z’bringe n, d’s Mönsche nmü̦gliche n ’taa n. All Daag isch är i n das Moos ụsḁ, für ga̦ n z’luege n und ga̦ n z’bifähle n und ga̦ n z’sorge n. Späätiste ns am fụ̈ụ̈fi isch er ụụf und i n d’s Büroo ga̦ n d’Sach rüste n für d’Schrịịber. Nachhär isch er uf sị ns Burbaki-Schü̦meli, wo n er de n Franzosen An no Eine ndsi̦i̦be nz’g het abg’chauft und zwääg g’fueteret, und hụ̈ụ̈! furt di zwoo Stund i n d’s Moos!
177 Wḁrum z’trotz däm ung’hụ̈ụ̈re n Flịịß, wo n er o ch hie zeigt het, us däm Moos z’erst no ch nụ̈ụ̈d het chönne n wärde n, wei mer jetze n g’seh n. Är sälber het under däm Mißerfolg am meiste n g’litte n. Aber är isch ụụfrächt ’bli̦i̦be n. Wenn är scho n i n däm Witzwil si ns Vermöge n verlochet und däm Undernähme n zäche n volli Jahr vo n sị’m Läbe n g’widmet het, so isch er si ch desse n nie g’reuig g’si̦i̦ n. Dä r Mißerfolg het ’nḁ drückt, aber nid erdrückt und nid erbitteret. Das het d’Freud a n der Arbeit chönne n, und d’Freud am Würke n für d’s G’meinwohl, wo ihn nit verlaa n het bis a n sị n Tod.
Witz und seine Genossen gründeten eine Aktiengesellschaft und erwarben von verschiedenen Gemeinden das mehr als zweutu̦u̦sig Jụụchḁrte n große Gebiet, welches als oberiste rn Egge n des Großen Mooses bis an den Neuenburger See sich hinzieht. Eben Witzwil.
Die Aktien, welche sie wegen Erschöpfung der eigenen Mittel nicht für sich behalten konnten, an Mann bringend, schritten die Unternehmer hoffnungsvoll an ihr Werk. Zu einer Zeit, wo alle Welt geblendet war durch die riesigen Erfolge des Ackerbaus auf dem jungfräulichen Boden Amerikas und der «schwarzen Erde» vo n Rußland ( «Rueßland»)! Was Wunder, daß sie von vornherein annahmen, auch das neue n Amerika brụụchi nụmmḁ n z’Acher fahre ns, um zu einer Goldgrube in Form einer Kornkammer zu werden. Nun handelte es sich aber dort um Böde n mineralischen Ursprungs, welche in den Niederungen der Flußgebiete angeschwemmt waren, während das Große Moos pflanzlichen und tierischen Ursprungs ist ( S. 106 ff.). Es ermangelt mithin vollständig ( kompleet) der zum Pflanzenbau unumgänglich notwendigen Mineralstoffe.
Dies festzustellen, hätte es, wenn nicht eines G’studiente n, so doch eines geübten Praktikers bedurft. Allein, in ihrem Optimismus dachten die Gründer von Witzwil wohl nicht daran, der Bode n la̦ n z’ un͜dersueche n. Si häi n drum nid chönne wüsse n, daß seit 1865 der Gutsbesitzer Rimpau in Kunrau (Preußen) mit großem Erfolg ähnlichen Moorboden urbarisierte und bewirtschaftete, so daß sie sich an seinem Landgut hätti chönnen es Muster näh n. Statt dessen stellten sie selber kostspielige Versuche an, wo ’ne n tụ̈ụ̈r choo n sịị n.
Wenn ihnen aus diesem optimistischen Vorgehen ein Vorwurf gemacht werden kann — si sị n halt e n chläi n drị n g’sprunge n, anstatt als gueti Berner z’dänke n: nụmmḁ nid g’sprängt — so sprechen für sie gewichtige Entlastungsgründe. Z’erst aa nfḁ n mues 178 mḁ n sääge n: Um jene Zeit, ụụsgehnds de r Sächz’gerja̦hr, beschäftigten die wissenschaftliche Erforschung und die Kultur des Moosbode n die Gelehrten noch nicht. Sodann waren die künstlichen Düngmittel noch nicht bekannt, die Salzlager in Staßfurt noch nicht erschlossen. Die Kalisalze feierten überhaupt erst im Jahre 1912 ihr «fünfzigjähriges Jubiläum». Verschwịịge n de nn, daß damals jemand in der Stadt Bern an die im Jahr 1914 endlich ins Werk gesetzte Kehrichtabfuhr nach dem Strandboden von Witzwil gedacht hätte. Es fehlte somit an den Grundbedingungen zum Gedeihen des Unternehmens. Endlich waren weder die Hauptgründer noch die Betriebsleiter Fachleute. Eebe n drum hätte man freilich der Unternehmung den anfänglichen Charakter eines bescheidenen Versuchs geben sollen. Statt dessen fuhr man gleich mit vollen Segeln aus in das unbekannte Land. Es wurde alsbald so viel Erdreich erworben, wi mḁ n nu̦mmḁ n het chönnen überchoo n. Es geschah schon, damit nicht anstoßende Eigentümer nach Erkenntnis der Erfolge ihren Moosbesitz mit den ergü̦ggelete n Vöörtle n angeblich eigener Erfindung bearbeiten. Gerade so gemeinnützig veranlagte Männer wollten verhindern, daß pfiffiger Eigennutz ohne eigene Opfer sich die teuer bezahlten Erfahrungen der Pioniere zunutze mache. Und die Ereignisse der folgenden Jahre kamen ihnen entgegen. Die von ihnen geübte Ausdehnungspolitik stellte sich in den Dienst einer geradezu idealen Gemeinnützigkeit: für den vom Staate Bern eben jetzt in vollem Ernst angestrebten Zweck eines rationellen Strafvollzuges war ein so großes arrondiertes Gut mit so viel Arbeitsaufgaben wie geschaffen ( S. 183).
Zu dem Ende mußten freilich eine Reihe Aufwendungen, die weder für die Gegenwart noch für die Zukunst Vorteile brachten, gründlich aus dem Gutsbetrieb ausgeschaltet werden. Gründlich, weil eben sie den Ruin des Unternehmens beschleunigt hatten und damit als Warner für die Zukunft dastanden.
Der Dampfflueg zunächst konnte trotz den eigens für ihn errichteten Stationen nichts ausrichten, weil einmal dä n lu̦gg Boode n die schwere Last auch so nicht trug, und weil die begreiflich nun erstmals zum Vorschein kommenden eisenharten Äiche nstöck und -stämme ( S. 104) den mit Vehemenz durch seine Furchen gerissenen Flueg verchäibet u nd verplitzget un d i’ n Grund-Booden aachḁ vertụ̈ụ̈flet häi n ( S. 189). Man mußte ihn wieder zu veräußern suchen, wi mḁ n chönnen u nd möge n het.
Ein fernerer Mißgriff war die massenhafte Einführung reinrassiger fremder Schafe ( vo n frönde n Scha̦a̦f) statt der Aufzucht und Haltung vo n rụụche n Tier, welche das schlechte Moosfutter ( S. 153 ff.) wirklich 179 mit Profit in Wolle und Fleisch für bäuerlichen Gebrauch umgesetzt hätten. Die angeschafften Vließträger gingen auf dem Torfboden allesamt zugrunde ( S. 158) a n den Eegle n: am Leberegel. (Vgl. die Tschugger Flur im Ägelwasser.) Mehr Glück hatten die Unternehmer mit den Stiere n: den Zugochsen, deren schwere Arbeit und deren Gedeihen durch Verabreichung besseren Futters ermöglicht wurde.
Mit den großen Guano-Ankäufen ferner wurde das Geld buchstäblich verlochet; denn dieser teure Dünger war grad d’s Gääge ndäil von dem, was der schon an und für sich stickstoffreiche Moorboden ( S. 104) brauchte.
Die Ziegelei endlich, welche in der entferntesten Ecke des Gutes: am Ufer der Broye, angelegt worden war, het si ch nie g’räntiert. Wohl gebrach es ihr an gutem Lätt in nächster Nähe ( Nööchtsḁmi) nicht; allein es existierte kein Zufahrtsweg.
Der Brue̥ije nkanaal war allerdings für die Befahrung mit Baarchche n, also auch mit eigenen Lättbaarche n, angelegt worden; aber seine Offenhaltung isch z’tụ̈ụ̈r choo n. Auch die Seeschiffahrt konnte nicht in Betracht fallen, weil in den von ihr berührten Gegenden niemmer Ziegel g’manglet het.
Ein unglücklicher Stern also schien über dem Unternehmen zu walten. Erst auf seinen Ruinen konnte das neue Witzwil sich erheben und zu der gegenwärtigen Entwicklung gelangen. Hierzu mußten neue Wege eingeschlagen werden. Allein in sehr mancher Hinsicht konnte doch auf dem Fundamente weiter gebaut werden, welches die ersten Besitzer gelegt hatten.
Denn ein großzügiger organisatorischer Geist war ihnen eigen. Und nicht planlos, sondern in wohlerwogener Strategie hatten sie sich die Urbarmachung und Besiedelung der Einöde ausgedacht. So, wie die Wege vor vierz’g Ja̦hr angelegt, die Wohn- und Wirtschaftsgebäude auf dem Gut herum verteilt wurden, bewährt sich die Disposition noch heute. Und für das Verwaltungsgebäude hätte sich kaum eine bessere, glücklichere Lage finden lassen. Wohl in der Rücksicht auf den Baugrund wurde es nicht in den Mittelpunkt des Gutes gestellt, sondern an die westliche Peripherie, wo eine dem Strandboden entlang sich ziehende Sanddüne einen etwas verhööchte n und trochene n Platz zu wählen erlaubte.

|
|
Frau Regierungsrat Scheurer |
An der mit großen Opfern ausgebauten Stra̦a̦ß, die seit den Sechzigerjahren als Verbindung mit dem Mistelach das Moos durchquerte, 180 wurden drei Wohn- und Ökonomiegebäude g’stellt. Ebenso ein Schuelhụụs, das freilich seinem Zwecke nie gedient hat, sondern Mieter aufnahm, wie z. B. einen Torfgräber namens Schnegg, und daher Schnägge nhụụs oder Schnägge nhof geheißen wurde. Ein vierter «Hof» kam an das Ufer der Broye, zwischen den «Fählbaum» und die bereits erwähnte Ziegelei zu stehen. Eine (seither z’seeme n g’heiti) Schööfferhütte n fehlte natürlich nicht. Ebensowenig aber ein Wirtshaus: das nun von einer Aufseherfamilie bewohnte Wi̦i̦rtshụ̈ụ̈sli oder Pịntli, welchem es seinerzeit an Zuspruch nicht gebrach, wenn der Wirt etwa einen Sackgu̦mpet oder Weggliässet veranstaltete.
Aus allem ist ersichtlich: die ganze Anlage sah eine dörfliche Entwicklung vor. Und da das Dorf einen Namen haben mußte, tauschten die Unternehmer unter sich die Vorschläge Witzwil, Stämpflishụ̈ụ̈sere n, Wildbolzried aus. Mit Recht trug der erste der Namen den Sieg davon; und die zeitweilige Benennung nachbarlicher Ansiedlerhütten als Negerdorf konnte ihm nur zur Folie dienen,
Mittlerweile wurden auch den verschiedenen Höfen sinnvolle Namen erteilt. Man entlieh sie dem Kranz von Bäumen, der in eigenartiger Weise jeden der Höfe umgab. Lin͜de nhof hieß der Hauptsitz; an die Landstraße kamen der Nuß-, Platane n-, Tanne n-, Esche n-, 181 Ulme nhof zu liegen. Nur dem Haus an der Broye blieb der prosaische Name Neuhof.

|
|
Regierungsrat Scheurer |
Wilhelm Stämpfli von Wengi, der Sohn des Bundesrates, und Jakob Klening von Vinelz, der spätere Direktor der landwirtschaftlichen Schule Rütti, waren die ersten Verwalter des Witzwiler Gutes. Sie bewohnten den Lindenhof. Diesen kennzeichneten ball d äinisch als den Hauptsitz der Anlage ein geräumiges Wohnhaus, ein sorgfältig angelegter Garten, sowie ein Bạumgarte n, der mit den besten Kern- und Steinobstbäumen bestanden ist und durch dicht ( dick) gepflanzte, schnellwachsende Äsche n (s̆s̆) geschützt wird.
Emmentaler und Buchholterberger waren die ersten Pächter ( Läche nmanne n) der verschiedenen Höfe. Allesamt Lụ̈tli aus den bescheidensten Lebenskreisen, hatten sie wohl gehofft, auf dem schwarzen Boden der Ebene ihr Chorn mit weniger Mühe bauen zu können als an ihren heimatlichen steilen Halden («stotzige n Hạule n», stụtzige n Hoole n, S. 16). Allein, weniger noch als die Leiter der Gesellschaft selber, vermochten sie dem Moos reiche Ernten abzugewinnen. Mit tü̦ü̦rbele n ( S. 169) und durch Raubwirtschaft mußten sie sich durchbringen; und es zeugt von zääijem Ausharren in schwieriger Lage, daß sie sich mit der Zeit gründlich akklimatisiert und ihren Nachkommen das Moos zur Heimat gemacht haben. Für die Witzwil-Gesellschaft bedeuteten natürlich die der 182 Verhältnisse unkundigen, stets mit Schulden ringenden Pächtersleute mehr eine Last als einen Gewinn. Mit ihren Zinse n stets im Hin͜derlig, hatten sie nichts zu verlieren, als im Jahre 1879 der Gältstag angerufen werden mußte.
Verschiedene Banken ( Bänk), die meistbeteiligte Eidgenössische Bank an ihrer Spitze, übernahmen Aktiven und Passiven der aufgelösten Gesellschaft, und Jakob Klening, der technische Leiter, dirigierte nun das Ganze bis zu seiner Wahl als Direktor der Rütti. In der Anstellung seines Nachfolgers Niklans Burri hatten die neuen Besitzer von Witzwil eine überaus glückliche Hand. Obschon nu̦mmḁn en äi nfache r Bụụr, oder vielleicht gerade als solcher, wußte er aus der Domäne zu machen, was unter den damaligen Verhältnissen nu̦mmḁn isch z’mache n g’si̦i̦ n. Er unterließ kostspielige Experimente und nahm nicht mehr Land un͜der de n Flueg, als er mit den vorhandenen Mitteln richtig bewirtschaften konnte. So brachte er es durch seine umsichtige Leitung wenn nicht zu großen Reinerträgen, doch dahin, daß d’s Guet si ch sälber erhalte n het. So lange dieses bestund, war das noch nie vorgekommen. Zur Ausnützung des noch unkultivierten Landes wurden wieder Scha̦a̦f ịị ng’stellt und jeweils im Frühjahr Gu̦sti und Fü̦ü̦lli zur Sömmerung angenommen. Eine Herde von mehr als 500 Hau pt belebte im Sommer die weiten Flächen von der Landstraße an gegen den Schwarzgrabe n hin als die östliche Grenze des Gutes.
Die neuen Besitzer desselben aber, denen es durch den Zwang der Notlage ( si häi n müeße n zieh n) aufgehalst worden, hatten kein Interesse daran ( es isch ’ne n nụ̈ụ̈t dra n g’lääge n g’si̦i̦ n), im Großen Moos ein Kulturwerk zu unterhalten. Sie suchten im Gegenteil von Anfang an auf möglichst günstige Weise der Domäne wieder los zu werden.
Das war allerdings leichter gedacht als getan. Wer sollte den Mut und die Mittel haben, das gewaltige Gut zu kaufen und instand zu stellen? Es war — der Staat Bern, der sich endlich als Liebhaber meldete. Aus den jahrelangen Verhandlungen darüber, ob die Eigentümer von Witzwil die Mehrwertforderung, welche infolge der Korrektion auf ihrem Grund und Boden lastete, und die von ursprünglichen 400,000 Franken mit den Zinsen auf mehr als eine halbe Million angestiegen war, zahlen sollten, entwickelte sich ein Verkaufsangebot. Schließlich kaufte der Staat im Frühjahr 1891 das Gut um 721,000 Franken. 183 Davon entfielen 581,000 Franken auf die Mehrwertforderung; 140,000 Franken wurden in bar ausgerichtet. Um weitere 55,000 Franken erwarb der Staat das Inventar.
Als Vertreter des Staates führte Regierungsrat Alfred Scheurer von Erlach, damals Finanzdirektor, die Verhandlungen. Er kannte als Kind des Landes die Verhältnisse genau. In seiner Heimatstadt 1840 geboren und dort aufgewachsen, hatte er die Wassernöte seiner Zeit miterfahren. Als mittelloser, junger Schrịịber hatte er 1857 das Seeland verlassen; 1878 isch er i n d’Regierig choo̥ n, und da trat er mit sị’r altne n Häimḁt wieder in Berührung; 1882 kehrte er mit seiner Familie in dieselbe zurück. Im nämlichen Jahre half er, dem Unternehmen der Juragewässerkorrektion eine Gestalt zu geben, in welcher es für die zunächst beteiligten Anwohner nicht mehr den Ruin, sondern den Segen bringen konnte ( S. 142). D’s Ja̦hr d’rụụf erwarb er das frühere Kloster Sant Johannse n ( S. 185) für den Staat und half es zu einer Strafanstalt umwandeln. Mit Karl Engel von Twann und Florian Imer von Neue ntstadt der Aufsichtskommission angehörend, gewahrte er, welche Schätze der entsumpfte Boden bei richtiger Bearbeitung hervorzubringen vermöchte. Die gleiche Erfahrung wiederholte sich auf dem Tanne nhof (s. u.), auf welchen er die Gründer des Arbeiterheims aufmerksam gemacht hatte. Und nicht zum wenigsten war diese Überzeugung von der Dankbarkeit des Bodens bestärkt worden durch die Ergebnisse seines eigenen Gutsbetriebs in Gample n. Hier zog man schon seit Jahren aus einigen Moosteilen, die richtig bewirtschaftet wurden, insbesondere aus den Neubụ̈ụ̈n de n ( S. 152), drei- und vierfache Ernten.
Es hatte sich dabei aber auch gezeigt, daß die ausschließliche Arbeitskraft der Moosanwohner nicht ausreichen würde ( nid g’choo̥ n möcht), das gewaltige Kulturwerk durchzuführen. Was vermochten die kleinen Dörfer Gals, Gampele n, Müntschemier, von denen keins fünfhundert Einwohner zählte, zu leisten? Was selbst Eiß mit seinen vierzehnhundert Seelen? Die Leute mußten doch in erster Linie das Fäll d (s. u.): den festen Boden am Rand des Mooses und auf den Höhen ringsetum bearbeiten und durften obendrein die so viel Zeit und Mühe beanspruchenden Rääbe n nid im Sti̦i̦ch la̦a̦ n. Was bedeutete also das chlịịn Hụ̈̆ffli Möntsche n gegenüber der unabsehbaren Ebene!
Und wie gering waren ihre Hilfsmittel! Selber noch mit den schweren Lasten der Mehrwertschatzungen überbürdet, konnten sie nicht daran denken, neues Land zu erwerben und die schweren Opfer auf sich zu nehmen, die mit der Urbarmachung verbunden waren.
184 Hier konnte nur eine stärkere Macht helfen: die Gesamtheit des Volkes — der Staat. Nur der besitzt die Mittel, die ein so großes Unternehmen erfordert: und nur er vermag zu warten, bis d’s Gält voor ummḁ chunnt.
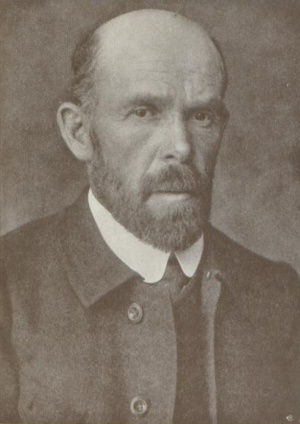
|
|
Direktor Kellerhals, Witzwil |
Die Gunst des Schicksals fügte es, daß grad ääbe n dénn die nötigen Arbeitskräfte sich in Bereitschaft stellten. Die Verlegung des Zuchthauses aus der Bundesstadt war dringend notwendig geworden. Wo nun sollte man die Leute besser unterbringen als im Großen Moos, das nach so vielen, vielen Arbeitskräften verlangte und das mit seiner Einsamkeit, aber auch mit seinen Zukunftsmöglichkeiten der richtige Platz war für eine Energie weckende, zur Ausdauer anspornende und damit den ganzen Menschen bessernde Arbeit!
In diesem Sinn erfolgte 1891 der Ankauf von Witzwil und die Verlegung der Korrektionsanstalt auf die neue Domäne. Die Hoffnungen haben sich in höchst erfreulichem Maße erfüllt. Viele, die vor Jahren mitgearbeitet und mitgehofft haben, sind dahingegangen. Finanzdirektor Alfred Scheurer hat bis heute an der Entwicklung teilnehmen können: bis 1904 als Mitglied des Regierungsrates, seither als unser Nachbar von seinem Bụụre nhof z’Gampele n aus. Er hat auch die Freude erlebt, daß sein Tochtermann, Otto Kellerhals, und dessen Frau, Anna, mit Hilfe tüchtiger Mitarbeiter nunmehr im dritten Jahrzehnt 185 mit vermehrtem Können und unverminderter Treue der riesengroßen Doppelaufgabe leben: dem versumpft gewesenen Erdreich und den auf seine Bearbeitung angewiesenen, teilweis versumpften Menschen den besten Fruchtertrag abzugewinnen.

|
|
Frau Direktor Kellerhals-Scheurer |
Überhaupt dürfen die seeländischen Besserungsanstalten si ch zäige n. Das werden wir z’grächtem noch im Strafkapitel dieses Buches sehen. Hier handelt es sich lediglich noch um eine knappe Ökonomiegeschichte des verstaatlichten Witzwil und seiner Schwesteranstalten.
Mit der Verwendung von Gefangenen zu landwirtschaftlichen Arbeiten im Großen Moos hatte freilich der Staat schon vorher Versuche gemacht. Untenher dem Dorf Ins, am Rand des Mooses — un͜der dem Bandräin —, hatte er eine Strafkolonie angelegt. Ihre Insassen, etwa 39 Arbeitshaussträflinge, wurden beschäftigt mit Tu̦u̦rbe nstäche n, sowie mit Urbarisierung und Bebauung des Moorbodens, welchen die Regierung 1876 von der Gemeinde Ins gekauft hatte.
Im Jahre 1885 sodann ging das frühere Kloster Sant Johannse n an den Staat über ( S. 183). Es wurde in ein Korrektionshaus für zirka achtzig Gefängnissträflinge umgewandelt, deren Hauptbeschäftigung die Bearbeitung des Landbesitzes bildet. Durch Zukauf von Moosstücken wie der Convents- oder Konwäntsmatte n, der (einst dem 186 Kloster Trub gehörenden) Truebmatte n, des Lehn usw. ward dieser bis an das Ufer der Zihl reichende Besitz aus 400 Jucharten gebracht. Als Verwalter der Anstalt ersetzte 1891 Niklaus Burri den verstorbenen Kilchenmann.
Er behielt aber vorläufig auch die Oberleitung über die Domäne Witzwil. Auf dieser selbst aber siedelte sich der junge Adjunkt Otto Kellerhals ( S. 184) mit einigen Angestellten und mit siebenzig Gefangenen an. Für alle mußte das Verwalterwohnhaus Platz bieten, und die Einrichtungen waren primitiv. Strööfflingsarbäit sollte sie verbessern, sollte das Gut kultivieren, sollte den Betrieb profitabel gestalten.
Mit staatlicher Hilfe wurden zuerst die pressierigste n Ökonomiegebäude g’stellt. Dann baute man den Stock als Wohnung des Diräkters und — mit einem Aufwand von 307,000 Franken — die Gaseerne n. Diese konnte im Mai 1895 bezogen werden.
Um diese Zeit wurde Witzwil von St. Johannsen losgetrennt und der Verwaltung des bisherigen Adjunktes unterstellt. Die während zweier Jahre schon einigermaßen konsolidierte Anstalt konnte des bisher gebotenen starken Rückens entraten.
Unter der Voraussetzung, daß er die Mittel zur Aufschließung und Bewirtschaftung des Gutes in dessen Betrieb ohne staatliche Zuschüsse zu finden wisse, hatte der junge Verwalter freiji Hand in der Einrichtung seiner Landwirtschaft und in der Auswahl der Kulturmethoden. Auf die neue Aufgabe war er als Rüttischüeler und durch Studien an der landwirtschaftlichen Hochschule zu Halle einigermaßen beruflich vorbereitet; allein die Landwirtschaft auf Moorboden mußte er gleicherweise vo n neuem ụụf lernen, wie die richtige Behandlung der Gefangenen.
Immerhin bildete anfangs der Neunzigerjahre die Moorkultur den Gegenstand eifriger wissenschaftlicher Forschung, und so konnte der Anstaltsleiter sich auf die Erfahrungen reichsdeutscher und einheimischer Fachleute stützen. In vorsichtigen Versuchen zuerst, dann, wenn’s bi dene n guet ụụsḁchoo n isch, in immer ausgedehnterem Maße kamen na̦a̦ ch und na̦a̦ ch, wi länger wi meh r, die mineralischen Düngstoffe, welche dem Boden fehlten, zur Anwendung. Da das Große Moos ein Grüenlandmoos ist und Milch u nd Fläisch die neuzeitlichen Produktionsziele sind, fiel das Hauptaugenmerk auf die Anlage von Wiesen und Weiden.
187 Im Frühjahr 1895 waren etwa 10% der 2500 Jucharten unter Kultur; der Räste n wartete des Pfluges und wurde mittlerweile g’wäidet oder als Mooshäüland benutzt. Der breite Sandstreifen dem See na̦a̦ ch isch für d’Roß g’si̦i̦ n, uf d’s min͜dere n Land het mḁ n d’Scha̦a̦f g’jagt; d’s bessere n het mḁ n für d’Gu̦sti g’spaart, welche von den Bauern der Umgebung ( Nööchtsḁmi) immer noch zur Sömmerung angenommen wurden. Das Futter war freilich mager. Was vo n wịtem trügerisch wie grüne Weide aussah, war zääiji Lische n, welche sumpfige Löcher verdeckte. Auf allen erhöhten Stellen machten sich Gestrüppe breit von Erlen und Saarbäüm, von Wịịde n und Fäälbäüm ( S. 115), von Zü̦ü̦bele nholz oder Bulverholz (zu Schießpulver verarbeiteten Haseln mit schwarzer Rinde und gelbem Bast). Die Scha̦a̦fwäid wurde zuletzt überhaupt nicht mehr grün, weil die allzeit hungrigen Tiere die Gräser mit Stumpf und Stiel wegfraßen. Wie denn überhaupt d’Scha̦a̦f u nd d’Roß ’s gäng z’täüff neh men. Am Rückgang des Weideertrages waren auch die trochene n Ja̦hr 1893 und 1895 d’Schuld, in denen noch Moosbrände ( S. 167) die sü̦st scho n aa nfḁ n spärliche Grasnarbe z’Blätze nwịịs verzehrten.
Es hieß also jetzt buchstäblich den Kurs ändern, sollten nicht alle die bisherigen Opfer für Trockenlegung und Kultivierung des Mooses für nụ̈ụ̈d gsi̦ n sịị n und das Moos zur Wüste werden.
Für die neue Betriebsart boten sich zwei glückliche Mittel. Einerseits boten die Gefangenen die unerläßlichen billigen Hilfskräfte. Anderseits hatte die Moorversuchsstation Bremen dargelegt, daß der an Kalk und Stickstoff genügend reiche Boden der Zufuhr von Kali und Phosphorsäure bedürfe; und sie hatte auch auf Grund praktischer Erprobung die zur Kultivierung am besten geeigneten Futtergräser namhaft gemacht.
U nd so isch mḁ n dra nhi̦i̦ n. Sobald im Spätherbst das schon aufgebrochene Land besorgt und für das Frühjahr vorbereitet war, wurde äi n Zopfe n um der an͜der des noch rohen Mooses zwecks Urbarmachung in Angriff genommen. Eine Beschreibung auf dem Papier vermag keinen Begriff zu geben von den Hindernissen, die bewältigt, von den Opfern an Müej u nd Zịt u nd Gält, welche gebracht werden mußten, um zweutụụsig Jụụcharte n Ödlandes so umzugestalten, daß es die Aufwendungen reichlich lohnen konnte. Als das Werk begonnen wurde, dachte freilich niemand, daß dies, wie es dann der Fall war, in einem Zeitraum vo n zwänz’g Ja̦hr geschehen würde.
In der Frühe eines Novembermorgens erscheint auf der öden Weite, die sonst um diese Zeit höchstens noch vom Jäger begangen wird, ein Trupp von fünfzig bis siebzig Mann. Die rụ̈tte n vorerst das Gestrüpp und Gesträuch gründlich aus: die Saarbäüm (Schwarz-Pappeln) und Erlen, die Bị̆rche n und Wịịde n und was sụ̈st alls in dem magern Boden seine kümmerliche Nahrung findet. Hierauf graben sie oberflächlich die Erhöhungen ab und stillen mit Hülfe einer Roll-(wagen) bahn die Untiefen aus. Dann machen sie sich an das Wichtigste: die Anlage der Entwässerungsgräben. Eigentlich bestehen diese ja schon, teils von der Juragewässerkorrektion ( S. 144), teils von der Witzwil-Gesellschaft erstellt. Allein sie sind schlecht im Stande gehalten, vom Weide-Vieh vertrappet, von G’jätt überwuchert, und erfüllen ihren Zweck in keiner Weise mehr. Je auf 100 bis 150 m Distanz ( von enan͜dere n) entstehen nun neue Kanäle ( Karnääl). Dann wird das derart vorbereitete Land wo möglich no ch vor dem g’frụ̈ụ̈re n mit schweren Selbsthalterpflügen ( Sälbsthalter) umg’fahre n. Diese Flüeg müssen eigens zu solchem Zwecke gebaut sein. Nachdem noch auf je eine Juchart ( gäng uf ene n Jụụche̥rte n) 100 kg 40%iges Kalisalz und 100 kg 20%iges Thomasmehl ( Schlagge nmähl) gestreut worden, bleibt das Fäll d über Winter in rauher Furche liegen.
Dieser erste Eingriff ist an und für sich ( an ị̆hm sälber) keine besonders schwere Arbeit. Der stark verfilzte Waase n trägt die Pferde leicht. Der Pflug könnte auf dem vorbereiteten Boden ohne Schwierigkeit vorwärts kommen, stieße er nicht dann ḁ nt wann an einen der unzähligen Baumstämme, die, wenig unter der Oberfläche liegend, sich im Moos überall finden. Kommt solch ein Stamme n dem Pflug in die Quere ( z’tromsig drịị n), so müssen die abgespannten Pferde ihn erst mittelst Chöttine n, oft unter Anspannung all ihrer Kräfte, aus seinem Bette reißen ( rị̆sse n) und uf d’Sịte n schläike n. Dies wiederholt sich zuzeiten so mäṇgisch im Daag, daß des umgepflügten Landes wenig ist, wenn es z’Aa̦be nd gääge n häi n zue gäit. Dafür hat aber ein Wald von schwarzen Wurzelstöcken ( Stöck), Stämmen und Ästen ( Nẹst, S. 104) das Feld umsäumt ( ịị ng’fasset).
Sehr früh im nächsten Frühjahr, im Horner lieber weder im Merze n, werden die rauhen Furchen, die durch das ụụf- u nd zueg’frụ̈ụ̈re n schon etwas mu̦u̦rb geworden sind, mit starchen Äichte n z’vol lem verrisse n. Nachher werden sie vo n Han͜d bearbeitet, und de nn tuet ma n Haber sääije n. Daß das neu bestellte Feld etwa ( öppa grad) einen das Auge des Landwirts erfreuenden Anblick biete, 189 chönnt ma n näümḁ n nid grad sääge n. Es starrt vielmehr noch von zääije n Mụtte n, von Wü̦ü̦rze n, von torfigen Knollen und unverwesten ( nid ịị ng’fụụlete n) Grasbüscheln. Es bedarf jahrelanger Kulturarbeit, bis eine glatte, kunstgerechte Ackerkrume als guete r Häärt geschaffen ist. Gleichwohl bringt der Hafer in diesem zum erstenmal bestellten und zum erstenmal gedüngten ( g’mestete n) Boden ausnahmslos Ernten, wie man sie spööter mit aller Mühe nie mehr in solcher Fülle erreicht. Das Unkraut, die pflanzlichen und tierischen Feinde haben sich in dem Neuland eben noch nicht entwickeln und noch nicht der Saat schaden können. Ihnen wird erst das länger kultivierte Moos mit seinem lu̦gge n Bode n zum Dorado.
Nach der Haferernte tritt der Schellflueg in Aktion. Aber der hat nun schwierige Arbeit! Überall stößt er auf die alte, noch nicht verfaulte Grasnarbe. Erst der zwäüt Winter vollendet das Werk der Zersetzung. Und wenn im zịtige n Früehlig, sobald die Erdoberfläche trocken ist, die Schellfu̦u̦r che n wieder g’eg get werden, so läßt sich das schon mit weniger Anstrengung und mit größerem Erfolge tun. Nun erfolgt eine Düngung mit (Stall-) Mist. Die Anwendung desselben ist weniger des Stickstoffs wegen, als deshalb sehr vorteilhaft, weil er den die Bodenfruchtbarkeit bedingenden Bakterien zur Entwicklung verhilft und die Zersetzung des Bodens befördert. Nachdem der Stalldünger un͜derḁ gfahren ist, wird über die rauhe Furche noch (Kunst-) Dünger gesäet, und zwar abermals je 50 Kilo 40%iges Kalisalz und 50 Kilos 20%iges Thomasmehl pro Jucharte. In das soweit vorbereitete Feld werden nun Hä̆rdöpfel (Ins: Hördöpfel) ’pflanzet, die den Sommer über, weil sich noch kein Unkraut einstellt, weeni g z’tüe n gää ben und im Herbst einen gewaltigen Ertrag abwerfen. Das Quantum muß freilich einstweilen die Qualität ersetzen. Die Kartoffeln aus solch torfigem Neuland enthalten wenig Stärkemehl und sind von beschränkter Haltbarkeit: sie blịịbe n ni̦i̦d. Auch möösele n si, si häi n e n Moosg’schmack: sie riechen und schmecken nach dem Moor und werden hauptsächlich deswegen als Mööser den Fäldhärdöpfel hintangesetzt.
Wenn das Feld rechtzeitig abgeerntet werden konnte und ein trockener Herbst die Bestellung gestattet, so wird es nach tiefgründigem ummḁfahre n oder umg’heie n mit Roggen aa ng’sääit. Dieser erhält eine Kunstdüngung wie der Hafer, sowie je nach Jahrgang und Nutzungszweck eine Einsaat von Graassa̦a̦mme n. Verbietet ein nasser Herbst die Winterroggensaat, so wird diese durch Summerrogge n mit Grassaat ersetzt, oder bei mineralreichem und unkrautfreiem ( sụụferem) Boden durch Summerwäize n. So wird aus der Wildnis eine Wiese 190 oder Weide. Die muß aber durch grobe n Mist, z. B. von Härdöpfelstụụde n, oder durch Kunstdünger zum guten Überwintern befähigt werden. Sie kann nach der Getreideernte wohl noch gar g’wäidet oder für einen Grünfutterraub g’määit werden. Bei aufmerksamer Pflege der noch zarte n Grasnarbe kann das junge Grasland fünf bis zehn Jahre bei voller Ertragsfähigkeit bleiben; ja seine Güte steigert sich durch Zunahme der Kleearten.
Läßt der Ertrag nach, so wird der Boden ummḁ n ụụfbroche n, was nun vill ringer gäit, weder z’erst. Die weitere Behandlung muß sich aber nach unausgesetzten Erfahrungen und Beobachtungen, nicht nach starren Regeln und bequemer Routine richten. O ch der Moosbụụr mues gäng frisch studiere n u nd gäng ummḁ n öppis am Bode n mache n.
Der entwässerte Torfboden setzt si ch in wenigen Jahren stellenweise um einen halben Meter. Da müssen die offenen Kanäle na̦a̦chḁb’besseret und täüffer g’läit werden, die kleinern Gräben ịị nzoge n und durch das drenieren ersetzt. Dies ist, nachdem der Boden durch Bearbeitung und Beweidung fester geworden, nicht mehr risgiert. Ist eine Tröcheni zu erwarten, werden die Kanäle gestaut ( g’schwellt), bei anhaltendem Regen die Abflüsse geöffnet. Diese Kunst, d’Bode nfüechti stets auf richtiger Grenze zu halten, setzt allerdings aufmerksame Beobachtung voraus.
Die bisherige Darlegung bezieht sich auf den Moorboden, der etwa neun Zehntel des Witzwiler Gutes ausmacht. Nun zieht sich vo n der Brue̥ije n dänne n längs dem See hin ein Streifen von Kilometerbreite: d’Räckoltere n, die teils aus bloßem San͜d besteht, teils mit Tu̦u̦rbe nhäärt untermischt ist. Die letztere Bodenart ist ebenfalls längst in hoch abträgliches Kulturland umgewandelt, auf welchem die anspruchvollsten Gewächse reiche Ernten einbringen. Dagegen blieb der eigentliche Strandbode n bis in unser Jahrhundert hinein in seinem ursprünglichen Zustande, diente als Weide für Fü̦ü̦lli (Fohlen) und im Herbst zeitweilig auch für Rinder. Auch mußte er das San͜d hergeben zum ụụfschütte n um die Neubauten und zum überfü̆ehre n der Feldwege. Als nun aber der Torfboden nahezu fertig urbarisiert war, drangen Rụ̈tthaue n und Flueg auch hier gäng wịter nordwärts. Da mußte die 80 bis 50 Santimeter tiefe Sandschicht mit dem darunter liegenden Lätt und Torf gemischt werden. Ist dies einmal geschehen und der Stalldünger nicht gespart worden, so gedeihen hier neben Roggen, 191 Hafer und Kartoffeln alle Gemüsearten; und d’Spaargle n (s. u.) werte n chụụm a n ’men Ort so fịịn u nd zart u nd chü̦stig wi dört.
Ein ziemlich großer Teil des Strandbodens, d’Räckholtere bei Witzwil ( S. 118), war bereits von der Gründungsgesellschaft z’Wald aa ng’setzt worden. Der Wald spielt eben auf der allne n Lüft ausgesetzten Moosebene die ungemein wichtige Rolle eines Windbrechers. Deshalb finden sich nunmehr auf der ganzen Länge der Domäne, sowohl gegen Nordosten wie gegen Westen zu, Streifen von Roottanne n, Birche n und Bueche n, deren wohltätige Wirkung von Jahr zu Jahr zunimmt. Auf gehaltreichem, aber mithine n überschwemmtem Land am Ufer der Broye gedeiht eine ausgedehnte Pflanzung von Wịịde n. Die Chorberei beschäftigt mit ihren Ruten, wie die Besenbinderei mit Birkenzweigen viele Sträflinge im Winter.
So ist nun die Domäne vollständig urbarisiert. Je mehr ( wi meh) jetzt aus ihr die Bodenverbesserung fortschreitet, desto ( wi) sorgfältiger soll auch die Pflege der Kulturen sich gestalten, und desto mannigfaltiger soll die Auswahl der Bodenprodukte werden. Wo die Lage geschützt genug ist, wird der schon von den Gründern Witzwils liebevoll gepflegte Obstbau ausgedehnt. Neben dem Obs erlangt d’Pflanzrüstig (das Gemüse, s. u.) mit jedem Jahre größere Bedeutung. Die Viehzucht aber darf nun, seit die Rindviehzahl zu der Betriebsausdehnung in richtigem Verhältnisse steht, auf die Verbesserung der Rasse bedacht sein. Hierzu hilft seit 1906 die zur Anstalt gehörende Kileialp im Diemtigental (s. u.). Hier finden die Tiere ein Futter, wie es auch die bestbewirtschaftete Moosweide nie hervorbringen kann.
Vom frühern Lin͜de nhof aus, dem heutigen Witzwil im engern und nun gewöhnlichen Sinne, ziehen am Morge n früej Arbeiter und Gespanne zum Tagewerk. Von ihm aus laufen die Fäden, welche den komplizierten Betrieb leiten und zusammenhalten. Mit Ausnahme des 1886 durch Feuer zerstörten Ulme nhof existieren noch sämtliche Niederlassungen, welche die Witzwil-Gesellschaft gegründet hat. Zu ihnen sind zwei weitere gekommen: der Erle n- und der Birke nhof (letzterer wie der Esche nhof halb schriftdeutsch benannt). Es muß zur Ehre der Gründer von Witzwil wiederholt werden, daß ihre Idee, da und dort auf der Domäne Pachthöfe zu erstellen, viel zu ihrer raschen Kultivierung beigetragen hat. Der Platane nhof wird, weil zu nahe an der Peripherie des Gutes liegend, bloß als Miethaus für Angestellte benutzt. Sü̦st sị n dü̦r che nwägg auf den Höfen Scheunen und Ställe gebaut 192 worden zur Unterbringung und Verwertung des Futters und zur Erzeugung von Stalldünger. So konnte die Aufschließung des Landes viel rascher vor sich gehen, als wenn von einer Zentralstelle aus dem Land die Nährstoffe hätten zugeführt werden müssen, und wenn eine einzige Kolonie von Ställen und Scheunen zur Aufbewahrung und Verwertung der Produkte gedient hätte.
Früher wäre dies schon deswegen unmöglich gewesen, wil mḁ n fast niene n z’grächtem het chönne n fahre n. Wege, die das Gut durchqueren, waren wohl großenteils schon von den ersten Besitzern planiert. Aber die wirklich angelegten waren höchstens bei trockenem Wetter so beschaffen, das s mḁ n het dü̦ü̦rḁ chönne n. Nun durchzieht ein Netz von Wegen, die auf jede Witterung geeicht sind, die Domäne von ä̆im Egge n zum an͜dere n. War aber schon ihre Anlage müejlig u nd tụ̈ụ̈r, so erfordert auch ihre Instandhaltung fortwährende Aufwendungen, weil der weiche ( lin͜d) und schwammige ( schwummig) Untergrund das ihm zugeführte Material gäng ummḁ n ịị nschlückt. Dieses Material liefern die Sanddünen des Seestrandes und die mächtigen Kieslager der Inser Griengruebe n.
Dem Inserhügel, dessen Anbruch diese Grube ist, entspringt auch das Wasser, das auf allen Höfen und selbst auf der Weide die Brünnlein speist, so daß weder Mensch noch Vieh mehr auf das gelbe Mooswasser angewiesen ist.
Nun die Entwicklung der Landwirtschaft von Witzwil in großen Zügen geschildert ist, mögen zum Schluß einige Zahlen ein Bild geben von den Werten, welche dank der Kultivieruug dem Moos abgewonnen werden. Das Jahr 1911 mag hierzu die Grundlage abgeben. Damals führten allerdings die überaus hohen Preise aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse ein vorher nicht erreichtes günstiges Resultat herbei. Gleichwohl dürfen die hiernach aufgeführten Zahlen als Norm dienen. Denn wenn auch die Preise wieder sinken, so müssen dafür bei der fortgesetzten Bearbeitung des Bodens dessen Erträge ständig noch zunehmen und an Wert gewinnen.

Im Brüttelen-Moos
Auf den nach Abzug von Wald, Wegen, Hausplätzen usw. noch verbleibenden rund 2000 Jucharten Kulturland wurden 1911 dem Markte geliefert: Härdöpfel für Fr. 200,000, Zuckerrüebe n für Fr. 60,000, Häü und Strou für Fr. 20,000, Wurzelgewächse und Gemüse ( Rüstig) für Fr. 20,000, Vieh zum metzge n und zum züchtle n für Fr. 100,000, Milch für Fr. 80,000, Säü für Fr. 40,000. Die Summe von Fr. 520,000 193 ergibt schon eine jährliche Bareinnahme von Fr. 260 vo n der Jụụchḁrte n. In mehreren Gemeinden, wo besonders der Gemüsebau bedeutende Ausdehnung gewonnen hat, wo aber auch der Boden stellenweise von viel besserer Qualität ist als auf der Domäne Witzwil, wird der Ertrag stark überschritten. Wenn aber sämtliche 36,000 Jucharten des Landes, welches im Perimeter der Juragewässerkorrektion liegt, nur in dem Verhältnis ertragsfähig gestaltet werden, wie Witzwil es heute ist, so wird das Erträgnis eines einzigen Jahres schon die Hälfte der Summe repräsentieren, welche für das große Werk einst aufgewendet worden ist. Jedenfalls ist der Beweis erbracht, daß überall da, wo der Moosbode n zu Ehren gezogen und richtig behandelt wird, reicher Segen die Mühe lohnt.
Urbarmachung des Mooses zu Wäid und Grasland, Ausdehnung von Hackfruchtbau und Viehhaltung mit rationellster Milchindustrie, intensiver Gemüse- und Obstbau: 1 das sind die drei Etappen der Moorkultur, in welcher laut fremden Urteils Witzwil vorbildlich geworden ist. Am Ausbau dieses Systems wird fortwährend gearbeitet; mit Mitteln allerdings, die selbst der ausgedehnteste unserer höchstens mittelgroßen bernischen Privatbetriebe nicht zu beschaffen vermöchte; Mitteln aber, die einer ganzen Reihe öffentlicher Interessen zugleich dienen.
Man denke zuvörderst an die zum Windschutz und zur daherigen Klimamilderung angelegten Wäldli, allesamt wenigstens von der Größe der nach ihrer Baumzier benannten Höfe ( S. 180 f.), zu denen für kurze Zeit auch der Ịịslere n-, der Holdere n- und der nach der Ulme ( Ilme n) benannte Hof gehörten. In freiem Felde wiegen sich auf haushohem blinkendem Stamme n zierlich schlanke Krönchen der Birche n; mit ihren bescheidenen Ansprüchen an Bodenkraft zieren sie die Binne ngreebe, und wie eine Leibwache von cheerze ngraade n Grenadieren umstehen sie die jungfräulich frischen Wäldchen. Sehr gut kommen die italienischen Pappeln — Saarbäum — fort und liefern dem Modellschreiner vortreffliches Nutzholz. Kein Alleebaum ist jedoch geschätzt wie die Äsche n (s̆s̆). Selbst wo sie das Pflügen hindert, darf sie stehen bleiben, weil sie bei ihrem raschen Wuchs in kurzem den besten Schutz vor der Bịịse n gewährt. Hauptsächlich gegen den Luft aber: die Westwinde, schützt die allmähliche Aufforstung des der Fü̦ü̦lliwäid 194 entzogenen Seestrandes. Hierbei senkt zunächst ein ziemlich änggs und damit zü̦ü̦gig’s Karnaalbett den Grundwasserstand um 1 m, worauf der dicht verfilzte Rasen ummḁgfahre n wird, um über Winter i n der rụụche n Fu̦u̦r che n z’blịịbe n. Auf die broosmig zerkrümelte Erde werden Dehlle n und Erle n g’setzt, welche zugleich den Boden verbessern und für anspruchsvollere Pflanzen vorbereiten. Zu diesen gehören die Tannen, welche dann aber auch in geschlossenem Bestand bis an͜derhalb Meter lange Schü̦tzlig mache n. 2 Im graulich schimmernden Gezweige des Dickichts aber zwitschert und flötet und geigt das vom Merze ndänne n bis über de n lengste n Daag ü̦ü̦berḁ, wie man es leider anderwärts im Bereich der denkfaul geschützten Chrääijen u nd Spatze n so schwer vermißt.
Zum raschern Emporkommen der Seestrandpflanzungen wird künftig noch die Ablagerung des stadtbernischen Kehrichts helfen. Die bisherigen Anwohner der riesigen G’h̦üderhụ̈̆ffe n werden die ihnen gratis gespendeten balsamischen Düfte mit gutem Willen schon entbehren lernen und das Seeland um die Morgenstimmung nicht beneiden, welche jeweils der mistische Zug als Pendant zu den sommerabendlichen Moosstimmungen herbringt.
Empfänger und Spender des Windschutzes in einem sind in steigendem Maß die Obstbaumanlagen. Vor allem die auf sandigem Boden trefflich gedeihenden Nußbäüm, welche selbst wieder mit ihren breitblättrigen und weit ausladenden Kronen zartere Bäume gleichsam unter ihre Fittiche nehmen. Nur für Chi̦i̦rße n ist das Moos trotz allem Schutze z’zü̦ü̦gig. Um so fröhlicher gedeihen dank der Hügelpflanzung 3 und der Mineraldüngung Quätschger (Zwetschgen) und Frụụmme n, Bi̦i̦ren und Öpfel. Besonders der sechs Jucharten große Baumgarten östlich vom Lindenhof, dessen Wurzeln bei hohem Wasserstand nach der Bräiti ausweichen und die Bäume bloß als Halbhochstämme aufwachsen lassen, liefert sehr schöne Sorten Tafelobst.
Der reiche Flor all der Bäume und Sträucher ermöglicht es einem sehr sympathischen, hochachtungswerten und anstelligen Gefangenen, der vorher noch kaum es Impi (Bäiji) g’seh g’ha n het, im Impe n-hụ̈ụ̈sli 13 Völker rationell zu besorgen.
Daß aber im Moos gleichzeitig Milch und Honig fließen, macht der wachsende Viehstand. Witzwil war bisher in der Chĕserei Gample n, welcher Ort hauptsächlich Rüstig ( S. 205 ff.) baut, mit etwa tausend Litern Milch der Hauptlieferant. Seit dem Frühling 1913 tritt es diese Führerrolle der Anstalt Tanne nhof ( S. 195) ab, in welcher 195 es ebenfalls heißt: das hundert si ch nụ̈ụ̈t, und verarbeitet seine Milch in der eigenen Dampfmolkerei neuster Bauart. Die längst im Betrieb stehende Zäntriffụụge n wird damit ein schmiegsamer Ring in der Kette der Milchverwertung. Die Brönnerei ist dies gleicherweise im Dienst der Hackfrucht- und Obstverwertung, welche d’s chlịịnste n Dinge̥lli z’Ehre n zieht und keine Abfälle dem Gut entfremdet.
Die Ab- und Zufuhr von Gütern hat sich Witzwil im Jahr 1910 erleichtert durch das mit der Eisenbahnstation Gampelen verbundene Industrịịgläüs, allermeist durch Gefangene aus ausgemusterten Schienen der Emmentalbahn erstellt. Seit 1902 hat Witzwil eine Postablaag. Schon 1896 verband der Téliffoon (vgl. «der Téligraaf») die Anstalt mit Ins, seither nun auch das Verwaltungszentrum mit den Außenhöfen.
1
Kell. W. 29.
2
Kell. 16. 20.
3
Ebd. 21.
Gleichsam als verkleinerte Abbilder von Witzwil gründete Freiburg bei Sugiez seine Kolonie Bellechasse unter dem sachverständigen landwirtschaftlichen Leiter Fritz Schwab († 14. Januar 1912), Waadt seine Strafkolonie bei Orbe und die wieder eingegangene Colonie agricole bei Peterlingen. Mehr im Geiste Witzwils verwaltet, haben die Anstalten von Eiß und von Sant Johannse n auf ihren Gütern tüchtige Kulturarbeit geleistet ( S. 185 f.). Mit noch unentwickelten, kindlichen Kräften haben die Erziehungsanstalten für Mädchen in Brüttelen und für Knaben in Erlach zur Seite des Schalte nrä́in und in der Nähe von St. Johannsen das ihnen zugeteilte Moosland zu großer Ertragsfähigkeit gehoben.
Erwachsene, aber der Landarbeit teils Entwöhnte, teils Ungwaneti, der bäuerlichen G’wanig also Entbehrende haben in ebenso achtungswerter Kulturarbeit der Tanne nhof z’wäg’bra̦a̦cht. Innert acht Jahren waren seine beiläufig 100 Jucharten Eigentum und 110 Jucharten gepachtetes Moosland fertig melioriert: umta̦a̦ n. 1 Nun nimmt die Anstalt auch auswärtige Strecken, die der Kultivierung bedürfen, in Pacht, um sie nachher als des Privatbetriebs fähig wieder abzutreten. So 1906 in Vinelz und Erlach, ähnlich wie Witzwil 1911 einen den bernischen Kraftwerken zu Hagneck gehörenden Komplex von 30 Jucharten in Melioration genommen hat.
Wie es zum Ruhm des großen Entsumpfungswerkes gehört, mit lauter einheimischen Kräften ausgeführt worden zu sein, so daß die 196 17 Millionen seiner Kosten im Land ’bli̦i̦be n sịị n, ward und wird auch die Moorkultur mit hiesige n Lụ̈t betrieben. Die paar Polenmädchen (s. u.) wäi n nụ̈ụ̈t seege n im Verhältnis zur Arbeitermenge. Diese, zum Arbeitsgeist derart erzogen, daß si sich e̥käi’r braven Arbäit schämt, spannt sich, wo es nicht anders geht, willig in das Zugseil, um gleich den alten Bauern der Entlebucherberge i n nasse n Summere n über brịịlin͜de n Bode n der Flueg u nd d’Äichte n u nd d’Sääimaschine n sälber z’zieh n. Das durch rạuke n gemütlich gestaltete Werk wird natürlich gleich wenig als erniedrigend empfunden, wie etwa das fröhlich gesellige «Holz zieh n» im Gebirgswald. 2 Dank solchem Arbeitsmut wuchs der Großviehstand des Tannenhofs auf 80 Haupt. Und obschon die Anstellung richtiger Mälcher derart zu den Sorgen der Anstalt gehörte, daß man von der intensiven Milchwirtschaft zum Vorwiegen der Jungviehzucht und Ochsenhaltung übergehen mußte, bilden doch öppḁ drị̆ßg Chüeh das stete Gegengewicht zu zwei Mu̦nine n (Zuchtstieren), sechs Stiere n (Zugochsen), sechs Summerroß und zehn Winterroß.
1
Kell. 30.
2
Gb. 97 f.;
Gw. 179 f.
Wo jetzt die groo̥ßi Schụ̈ụ̈r des Tannenhofs steht, bildete um 1850 ein Wohnhaus den Mittelpunkt des Franze nguet als einer landwirtschaftlichen Probeanstalt. Die konnte der Natur der Sache gemäß gleich wenig fü̦ü̦r choo̥ n wie das erste Witzwiler Unternehmen. Denn beide gehören eben nicht zu jenen Moosgebieten, die ähnlich den Mösern des Oberaargaus und des Konolfingeramts oder wie die höher gelegenen Moosbezirke zwischen A arbeerg, Challnḁch, Treite n, Si̦i̦sele n den Segen der Entsumpfung sogleich erfuhren. Diese wurden fortan von schädigenden Überflutungen verschont und ließen ihren auch mineralisch fruchtbaren Boden sofort ertragreich werden. Ja, schon im Mittelalter durften einzelne Bauern es wagen, auf dem Aareschuttkegel unterhalb Aarberg Niederlassungen wie Chappele n, d’Wäärdthööf, Worbe n, Meie nried u. a. zu gründen. 1
Im Moosstrich zwischen Murten- und Neuenburgersee dagegen konnte nur die eigens studierte Moorkultur ( S. 186 f.) zum Ziele führen, und auch diese bloß mit stark ermäßigten Arbeitslöhnen. Privatfleiß müßte hier grad weege n sị’r Bravhäit verlumpe n, und der Flịịß wurd g’stra̦a̦ft.
197 Besser doch, der Staat stra̦a̦f d’Fụụlhäit durch Arbeitszwang, oder aber die genossenschaftliche Organisation kürze den Weg zwischen Erzeugung und Absatz. So in dem zu Murten gehörenden und durch Oberförster Liechti mit Schutzwald umrahmten Moosteil. Den ihn durchziehenden Frịburgerkanal haben die Unternehmer Suter, Poudret und Vautier mittelst eines Wehrwerks derart gestaut, daß äi’m no ch i n der grösste n Tröcheni d’s Wasser bis a’ n Hals chunnt und sein Spiegel bloß 30 cm tiefer liegt, als das umgebende Land. Dadurch werden auch die Seitenkanäle gefüllt, so daß dä r schwummig Moosbode n kapillarisch d’s Wasser dü̦r ch e nwägg hi nzieht. So häi n d’Wü̦ü̦rzen o ch im tröcheniste n Summer gäng öppis z’trinke n, und die Oberfläche door ret nid ụụs. Kein Wunder, daß dort Rụ̈̆baarbere n, Eerbs, Boo̥hne n, Melone n, Gŭ̦ggu̦mere n ( concombres), Sa̦la̦a̦t von äußerster Zartheit, Her dpeeri, Rüebli, Rüebe n und Spaargle n vorzüglich gedeihen. Auch die Zuckerrüebe ngnosse nschaft Möntschemier-Feisterhenne n (s. u.) ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen.
Privat unternommene Moorkultur kann in dem erwähnten Moosstrich höchstens gedeihen, wenn ein ausgesucht di̦fige r Bụụr mit g’höörigem Satz und mit Anstrengung seiner letzten Kraft nur dem angefangenen Werke lebt. Wenn er am Morge n der Erst un d am Aa̦be nd der Letz̆t isch. Wenn er nach gut seeländischem Spruch zu de n Chnächte n nie säit: ganget! sondern gäng nu̦mma n: chömet (zu der von mir geleiteten Arbeit)! Ist aber der Eigner über nụ̈ụ̈t choo̥ n, dann ist hier wie bei jedem verunglückten Unternehmen hin͜der na̦a̦chḁ n en iedere r g’schịịd. Wir denken hierbei an das nach einem zeitweiligen Pächter so geheißene und 1911 einem Oberaargauer zugeschlagene Linderguet.
1
Walser
Fröhlich dagegen gedeiht unter seinem Lä̆che nmaa n der so vorteilhaft und zugleich anmutig hingebreitete Linde nhof bei Worben. Sein Gründer und Heger und Pfleger war der unvergeßliche Notar Johann Wyß in Lyß (24. Februar 1849 - 1912, 14. Mai), Ehegatte der Marie Schneider von Büren. 2 Der Zimmermannssohn 198 aus dem Grentschel (man sagt: das Grentschel) zu Lyß; der als Konkordianer froh und fleißig studierende Jüngling; der glückliche und treu besorgte Gatte und Vater von acht Chin͜de n; der genau prüfende, human gesinnte und eben darum Familienvernachlässigungen streng verurteilende Amtsrichter, wo dü̦̆r che nwägg rächt dänkt het; der ịịfrig Verwaltungsrat der Brandversicherungsanstalt; der in zündender Beredsamkeit für Liebeswerke und kirchlich fortschrittliches Leben einstehende Chirchg’meinspresidänt und der verschwiegene Helfer in still getragener Not stand als rechtskundiger und welterfahrner Notar, sowie als g’wüsse nhafte r Verwalter der Spar- und Leihkasse Lyß mit Handel und Gewerbe und sonderlich mit der Bụ̆rerei auf vertrautestem Fuß. Drum war er auch Jahre lang der Präsident und immer die Seele des landwirtschaftlichen Vereins des Amts Aarberg; drum gehörte er der bernischen und der schweizerischen Obstbaukommission an; und drum auch lag unter allen Werken, die auf seiner Ehrentafel verzeichnet sind, keins seinem Herzen so nahe, als sein Bụ̆re nhoof: der Linde nhof. Der ist seine ureigenste Schöpfung. Die hat er Scholle für Scholle abgerungen der Wildnis im alten Überschwemmungsgebiet der Aare. Und mit welchem schon jetzt ersichtlichen Erfolg!

|
|
Notar Johannes Wyß in Lyß |
Der Stock (Wohnstock) samt der aa n’baute n Schụ̈ụ̈r, der neue freistehende Öpfelspị̆cher (das Obsthaus) mit der direkten Zufahrt auch in das Öpfelgăde n ob dem Öpfelchäller und der künstliche Hügel mit Wasserreservoir, bilden den innersten Kreis des achtz’g Jụ̆chḁrte n großen Guts. Ein weiterer legt sich an als Haag von Linde n, von Saarbäume n, von Tannen und Döörne n. Die Matte n und Achere n und die Hŏfstḁtt von 600 der auserlesensten Obstbäume, die der Eigner sälber g’setzt het, bilden den Umschwung des schön einheitlich abgerundeten Guts. Ein vierter, äußerster Ring schließt das Ganze ab: Um das strotzend grüne Grasland 199 und die wohlbestellten Äcker legen sich Haag und Holz (Waldstreifen) und das reizend idyllische Eiland a n der Gieße n (an der alten Aare n). Hier lụụße n schlau verborgene Hechte n auf sorglos sich tummelnde Beute. Anmutige Spazierwege führen den im Lusthäuschen ( Gabineetli) Ausgeruhten in das Grien: den künftigen Schache n, wo Wyß mit einem muntern Grooßbueb (Änkel) emsig zwei Lyßer Gärtnern (vón Dach) Nußbäumli ersetzen half, die in der Hitze des Sommers 1911 sị n abdoor ret g’si̦i̦ n. Alles in allem eine der ersten landwirtschaftlichen Sehenswürdigkeiten des Seelandes und eines der schönsten Denkmäler seiner Entsumpfung.
Auch diese Herrlichkeit ist richtig nid von ĭhm sälberchoo n! Ungezählte Stunden des Tages und der Nacht seines arbeitsreichen Lebens hat Wyß dieser seiner Schöpfung geopfert. Und die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß er seinen Todeskeim geholt hat in den dortigen Arbeiten, die, wi n äär sälber g’glaubt het, en Erhŏlig hei n sölle n sịị n von geistiger Überanstrengung. Indes, gibt es für einen Mann ein schöneres Lob als der Vorhalt, er habe zu viel gearbeitet? 3
Aber von Ermüdung schien noch der Dreiundsechziger nichts zu wissen. Elastischen und flinken Schritts, unter Gesprächen und mit einem Stimmklang, die von unverwüstlichem Idealismus redeten, geleitete uns der Mann durch die ganze kleine Welt seiner Schöpfung. Billig bleibt der Beschauer nochmals stehen vor dem Obsthaus mit dem sinnvoll gewählten Lobspruch Emanuel Geibels auf den Bauernstand, und vor dem Wohnhaus, aus welchem Karl Gehri in großzügig symbolischem Doppelbild vom Walten der unheimlichen Mächte des Sumpfs und von der Sieghaftigkeit des neu erweckten organischen Lebens erzählt. 4
Der Abend mahnte zum Rückweg; aber für Wyß war auch der ein Umweg. Rasch noch i n d’s Bụ̈̆roo und hurti g, hurti g no ch uf d’Kasse n! Dann erst ins traute, heimelige Heim. 5
1
Diese Partie mit modern
lyßerischen Mundarteinsätzen.
2
Die gehaltvollen Grabreden an der Auffahrt, gesprochen von Pfarrer Billeter, a. Sekundarlehrer Brechbühler, Gerichtspräsident Zimmermann, Brandversicherungsverwalter Schwab und Oberrichter Fröhlich, sowie das vom Männerchor «Frohsinn» gesungene Grablied sind in einer schönen Erinnerungsschrift, der wir auch das anmutvolle Bildnis entnehmen, vereinigt.
3
Brechbühler.
4
Photographisch wiedergegeben in Dr. Bählers Biographie des Dr. Rudolf Schneider.
5
Vgl. Schwz.-Bauer 1913, Nr. 37, mit Photographien vom Lindenhof. Concordia 1912, Heft 7; Bericht der Spar- und Leihkasse Lyß, 1912.
Einen glücklichen Griff tat Witzwil mit der Kultur von Spaargle n der besten Sorte Argenteuil aus direkt von Lyon bezogenen Samen. Die 1911 auf der Sanddüne bepflanzten fünf Jucharten sind bloß der 200 Anfang eines Goldbergwerks, wie auch die Konservenfabrik Kerzers und die dortige Spargelzuchtgenossenschaft es betreiben. Erstere bepflanzte bereits 1905 über dreißig, die letztere bebaut gegen fünfzig Jucharten mit Chrụ̈tzbärger-Spaargle n. 1 Die Gründung des Spaargle npfaff, mit welchem derben, aber durchaus ehrenhaft verstandenen und ụụfg’haa benne n Namen Pfarrer Samuel Schaffner sich mit jovialem Stolz bezeichnen ließ, hat also der «guten anmühtigen Speiß» 2 und hochschätzenswerten Arzneipflanze zu hoher Bedeutung verholfen. Stations- und Gasthausfeldchen, sowie Heer’e ngeerte n gönnen der im Sommergrün und in der herbstlichen Farbenbuntheit so zierlichen Maiglöckchen-Gattung ebenfalls wi länger wi meh r Platz.
Welch ein Gegensatz zum Gedeihen dieser Pflanze, die si ch wi Zucker ụụfläcket, das Mißlingen der Saffe̥ret-Pflanzungen im Waadtland, von denen noch acht Flur- und Ortsnamen, wie La Safranière u. dgl. 3 zeugen! Aller au safran bedeutet noch heute: sich zugrunde richten.
Eine sehr wichtige Handelspflanze des Seelandes war dagegen der Räps (Raps, «Lĕ́wat»). Der kleinste Teil seines Erträgnisses deckte den Bedarf des Haushalts (s. u.). War das aber auch ein Anblick, wenn im Vorsommer die strotzend gelb blühenden Rapsfelder sich wie Schachbrettquadrate von den Äckern und Wiesen abhoben! — Mehr nicht, als für d’Hüener, wurde dagegen je und je das Mĕrchchoorn, Mäis, Meis (s. u.) angebaut. Es trat damit selbst im bernischen Seeland zurück vor dem Bauerntabak ( Nicotania rustica). Diese Art Murte nchabis kultivierte gleich dem Broyetal in Weinmißjahren und teuren Zeiten auch Ins. An sonnigen Abhängen gewachsen, waren die Blätter sehr gesucht. Der Zehnten konnte den Wert von 1200 Kronen erreichen, und die Übernehmer desselben wußten nicht, wo die Blätter deer re n, bis sie sie im Chilchenesterich häi n döörffen uụf̣hänke n. 4 Hübsche kleine Pflanzungen sieht man noch in Treiten, und wenigstens es P’häckli Aatụback (mittelst der Bezeichnung A als sehr gute Sorte hingestellt) zog man sonst auch in Brüttelen aus eigenem Boden.
Eine Gebrauchs- und Handelspflanze von ganz anderer Bedeutung ist freilich die Kartoffel 5 : der Härdöpfel oder inserisch der Hördöpfel. Kaum ist der 15. Juli da, so drängen sich in Neuenburg die Hausfrauen um die erstmals auf dem Markte zugelassenen Leckerbissen 201 der früeche n Roo̥se n. Später beherrschen den Meerid der Imperatór oder Ämperátor; der nicht mehr so gute Magnum ( Magnum bonum, die zürcherische «Mage nbohne n»); der Brienzer; der mit einer Staude es ganzes Chöörbbli füllende Rooster; der ein Pfund Schwere erreichende Globus; der Chäiserchroon; der ebenfalls sehr gross werdende, aber gerne der Chrankhäit ( Peronospora infestans) erliegende Märker; der dem Magnum ähnliche amerikanisch Franzose nhördöpfel Uptodate ( up to date) mit den glatten Auge n, großwüchsig und sehr ergiebig; der Agnélli; der oder die Aspasia; die Silesia; der Eldorado; die Industrịị als die feinste Sorte; der sehr ausgiebige Profässer Woltmann; der Stäiner: eine zu Ehren des Lehrers Steiner in Kurzenberg so benannte Auswahl aus den hundertfünfzig Sorten, die dieser darob zugrunde gerichtete Mann ansprobierte; der Wältwunder, der sehr groß wird, aber an seinem Setzlig, d. h. am Knospenende, bloß vier bis fünf Auge n statt einer viel größern Zahl haben sollte. — Solches föörtelle n mit derart allergáttige n Hördöpfel wird durch die Vorsicht geboten, nid alli Äier in äi ns Chrättli z’tue n, sondern nach dem Grundsatz: es fehlt nie alls u nd g’ra̦a̦tet nie alls mit dem Einsatz verschiedener Sorten sich der Ungewißheit trockener oder nasser Sommer anzupassen. I n der Nessi chönne n d’Hördöpfel versụ̆ffe n, i n der Tröcheni absta̦a̦ n oder ụụswachse n.
Ist ferner ein Acker von alter Kraft ganz z’Hördöpfel aa ng’setzt, so kann das Unkraut stark überwuchern, wenn nicht die fingerhohen Pflänzlinge sogar mit Döörne n g’eggt werden. Erst dann muß noch der Putzflueg zwei- bis dreimal saubere Arbeit verrichten. Eröffnet sodann der Vreene ndaag nicht einen schönen Herbst, so wird das Hördöpfel graabe n zu der unliepliche n Beschäftigung mit böo̥se n Hördöpfle n. Die werden sofort ’dämpft und bei größern Betrieben in Gruben angesäuert als winterliches Kraftfutter für Galtvieh. Der Bestand an guete n Hördöpfel kann in solchem Falle derart zusammenschmelzen, daß er nicht einmal den eigenen Bedarf deckt und der allmorgendliche Speisezettel die Formel erhält: Hördöpfelröösti, we nn mḁ n si het. Zeitiges na̦a̦chḁzieh n, strecke n (sparen) erfreut aber im Frühling beim abchaiste n (Entfernen des Chäist, des ausgewachsenen Keims) gern mit der Entdeckung, daß der Vorrat über Erwarten langt. Es braucht dann nicht zu einer Erörterung zu kommen wie in jener gemischten (Gesamt-) Schule. Da wollte der Lehrer in der altfränkischen Grammatikstunde sich wiederholen lassen, was der Artikel sei. Keine Antwort. Da erhebt endlich unter den Sechsjährigen, welche 202 schreiben sollen, ein Bübchen schüchtern den Finger. Verwundert und neugierig fragt der Lehrer: Nu, Bänzli, was mäinst du de nn, was en Artikel sịịg? «He, we nn mḁ n käiner Hördöpfel meh het!»
1
BW. 1911, S. 16.
2
Tabernamontanus.
3
Jacc. 65. 402;
Rhv. 9, 180-6.
4
Kal. Ank.
5
Die
truffla, trufflla (
Brid. 317. 383), it.
tartufolo. die «Trüffel» oder die (dissimilierte) «Kartoffel». Als «
terrae tuber» (Erdknolle) oder «Erdapfel» sind ja beide deutbar.
Wir haben die vorgenannten Handelspflanzen unter der Rubrik «Rüstig» vorangestellt, weil zu gegebenen Zeiten auch sie (der bloß an Fabrikagenten oder nunmehr genossenschaftlich verkaufte Tabak natürlich ausgenommen) in kleinern Quantitäten auf die Gemüsemärkte gelangen. Ständige Marktartikel sind aber erst die nachgehends verzeichneten, welche als Pflanzsache n oder als Pflanzrüstig mit einem außerordentlichen Aufwand von Fleiß und Geschick in den Mŏsgeerte n gezogen und als Meeridrüstig für den Markt absatzfähig zubereitet werden.

|
|
Studie von Anker |
Ein wimmelndes Leben in diesen Moosgärten von Mitte Mai an bis tief in den Winter hinein! Nid vor dem zeeche nte n Mäie n! Was vorher dem Moos mit seinen Spätfrösten anvertraut wird, isch i n d’Lotterei ta̦a̦ n. Bis i’ n Bra̦a̦chmoonat (Juni) hinein sieht’s denn auch im Moose fahl aus. Da fällt das erste schöne n, warme n Reege̥lli. Jez wohl, iez chunnt der Sạug (Saftstrom)! Es keimt und sproßt und schießt und wachset, mi g’su̦ch’s förmlich wachse n, we nn mḁ n zueluegti. Da müssen die Pflänzlinge, welche förmlich in ere n Wuet inne n sịị n, fleißig in Schutz und Pflege und Zucht genommen werden; sü̦st wirt nụ̈ụ̈t g’rächts u̦s ’ne n. Die einen vergeilen: sie überchöo̥me n der Schu̦tz u nd stänglen ụụf. Die andern formen sich nicht zu fest geschlossenen Köpfen oder Wurzeln; es gi bt nụmmḁ n so n es Zu̦u̦rpfiweese n. 1
203 Schon die Art der Düngung (1751: das miste n) ist daher öppis, wo mues g’chennt sịị n. Sie richtet sich vor allem nach Zeit und Bodenart. Im April isch d’s San͜d wohl (sehr) troche n, der Torfboden noch flätschnáß. I n der Tröcheni, aber erst um di Vieri abends, hilft man rückständigen Pflanzen mit Chilisalpeter nach. Im schweren Boden ist Ros smist am Platz. Aber den Sand macht er fụ̈ụ̈rig, so daß seine Bepflanzung verbrönnt. Die langsam keimenden Karotten erfordern gleichzeitige Aussaat von Sa̦a̦mmen und Dünger aus dem örtlichen Genossenschaftsverband. (Dieser hält neben [Thomas-] Schlagge n und Kainit auch ụụfg’schlossene n Dünger: Super [phosphat], Kalisalz, wo d’Pflanze n nid verbrönnt, und Chilisalpeter auf Lager.) Andere Pflanzen wollen erst g’mistet sịị n und später b’schüttet, wobei der Dünger i n d’B’schütti g’rüehrt wirt. Da haben d’s B’schüttifaß und d’s B’schü̦ttibü̦cki (kurz: Bücki, Bottich) wenig Ruhe. Besonders wo Blumkohl z’bschütte n und z’düngeren ist, da̦ mueß mḁ n feerm dartue n!
Um so weniger richtet sich in einer Zeit, wo selbst der Bonifaz (5. Juni) nicht mehr als Boo̥hne nmacherdaag zum Stecken ( setze n) der letzten Bohnen einladet und der Medardus (8. Juni) nicht mehr als der zum Heumähen günstige Meederlisdaag gedeutet wird, der berufliche wie der bäuerliche Geertner nach den Zäiche n (des Tierkreises). Bloß die Gebirgsbewohner häi n no ch vill dru̦ff.
Beiderlei Gärtner unterscheiden sich bloß darin, daß der berufliche auch dem Blụ̆eme nkumerß obliegen muß, welcher wieder seine eigenen spitzen Erfahrungen fordert. Der bäuerliche hat genug an der Sorge, daß er nicht, wie der Großbetrieb, in sehr ungünstigen Jahren mit Verlust Rüstig pflanze. Der Blumenkultur wendet er ja ebenfalls, meh us Fräüd, wenn er Zịt het, seine Sorgfalt zu. Er pflegt in Stube oder Garten den Krokus, das Schlüsseli (die Hyazinthe), die Dulipaa, das Väieli ( Viola tricolor maxima), das Stäüfmüeterli ( Pensée), die Verbena ( V. hybrida), das Pfingstneege̥lli ( Dianthus Heddewigi), den Residaat (á), den (halbschriftdeutschen) Hahne nkamm, das Edelwị̆ß, die Win͜de n ( Ipomea), die als Summerfloor bezeichnest Cinerarie, das Läüe n- oder Chlappermụ̈ụ̈li ( Maurandia), das gewöhnlichere Brịmeli ( Primula obonica) und das große n Brịmeli ( P. chinensis fimbriata), das Strạurööseli ( Helichrysum monstruosum, die Immortelle), die Betụụnie n ( Petunia hybrida grandiflora fimbriata), den Fingerhuet ( Campanula Medium), das Neegeli (die Remont-Nelke), die gefüllte Bélsamịne n, das Vergismäinnicht ( Adonis vernalis), das Jumpfere ng’sichtli 204 ( Chrysanthemum carinatum hybridum flore plenum), das Summeraviöönli (die Sommerlevkoje), die Zịklame n ( Cyclamen persicum giganteum), das Garte nbü̦ü̦rstli ( Bellis perennis monstrosa), die längbletterigi großi dünni Aster und die mittelmeeßigi Aster ( Cocardeau), die blaaue n Seebel (Iris). 2 Und an der Blumenpflege schult er sich für den Gemüsegarten und das Gemüsefeld. Auch da ist ihm es n ieders Stụ̈ụ̈deli wi n es chlịị ns Chin͜d, zu welchem abaartig ( à part, ganz besonders) mueß g’luegt sịị n.
Auch mit sorglicher Fernhaltung der Feinde: tierischer wie der pflanzlicher Schädlinge, hat der kleine wie der große Landwirt unausgesetzt zu tun. Man denke an die Scheere n (Maulwürfe), sowie an die entsetzliche Landplage der Stoos- und der Springmụ̈ụ̈s in den Jahren 1912 und 1913! Nachdem virus und Strychninhafer, mit hohen Kosten in den Boden gebracht, neben einer Anzahl Mäuse und damit vergifteten Krähen leider auch Störche, Wildtauben und Eulen zur Strecke gebracht, wendete man mit mehr Glück die zu 16 Rappen aus England eingeführten Müüse nfalle n ( mouse traps) an und ließ Schulbuben je 4 Rappen vom Stück verdienen. Wenig bedeutet daneben der dem Gärtner so verhaßte Ros smü̦ü̦rder 3 (die Maulwurfsgrille).
In tropischer Üppigkeit gedeihen sodann im Moos e npaarigi ( es paar, einige) wüesti Chrụ̈ter. Als erstes solches erscheint im Frühling der Hüennerdarm oder Henne ndarm. Mit Vogelsamenfutter wurden aus Amerika eingeschleppt der Amaranth ( Amaranthus rectiflexus) und das kanadische Berufskraut ( Erigeron canadensis). Viel Mühe verursachen ferner die Distel, der Nü̦schel (s̆s̆) oder das Schläikgras (die Quecke), das Flöhchrụt, wie sowohl der Knöterich als die gelbe Hauhechel geheißen wird.
Da̦ gi bt es z’jätte n! Und zwar mueß mḁ n bi de n Ggarotte n drụ̈ụ̈ Ma̦l d’rüber! Dabei wird aus dem Faulenzen und Plaudern wie beim gemütlichen Flachs jätte n alter Zeiten nichts. Denn die Karotten und andere empfindliche Pflänzchen erfordern bei der Seeländerin, die sowieso si ch z’chrümme n (zu bücken) statt z’grụppe n (zu kauern) gewohnt ist, rasche und doppelt förderliche Handbewegungen in allen möglichen unbequemen ( u nchu̦mmlige n) und mühsamen ( gnietige n) Körperstellungen. Wo die flinke und starke Hand die Unkräuter nicht bewältigt, muß die kurzstielige Jätthạue n oder das Jätthạueli 205 (nicht der zum bequemen wịt recke n geschaffene Fụ́länz) her. Mit ihm gilt es dann und wann drịị nz’schla̦a̦ n — energisch wie das Pferd, welches ausschlagt: ụụfjättet. 4
In der Culture maraichère des 18. Jahrhunderts und schon vorher waren die «Morgärten» (1762 gleich den Beunden) mit Hanf bestellt. Seither geben ihnen, gleich andern Pflanzblätze n, die Gemüse ein anderes Aussehen. Grasbordüren, deren Grün d’Mueter de n Säuli und d’Buebe n de n Chụ̈ụ̈neli zuwenden, schließen der na̦ ch der Schnuer abgeteilte Beete ein, in welcher Kräuter die erste Stelle behaupten. Mit Chrụ̆t oder altinserisch Chrụụd 5 scheint die Sprache alles irgendwie den Sinnen (z. B. als Pfäfferchrụt [ Satureja] dem Geschmack, als «Wịị nchrụ̆t» [ Ruta] dem Geruch), besonders aber dem Auge sich auffällig machende Blattwerk zu bezeichnen. Als solches wird es in der Redensart Chrụt u nd Rüebe n, es isch alls dü̦r ch enan͜dere n wi Chrụt u nd Rüebe n dem auffälligsten Wurzelwerk entgegengestellt. Das Schwellende des Blattwerks, 6 nach welchem auch einer, der «es» oder «sich geschwollen gibt», sich pausbackig geberdet, si ch chrụtig macht, ist besonders sichtbar an dem mundartlich so geheißenen Chrụụd oder Chrụt. Im Altdeutschen gab es u. a. ein rüebekrût, ein muoskrût, ein kölekrût und ein kabezkrût, welchen ungefähr unsere angebauten Kohlarten entsprechen. In einem weitern Sinn aber umfaßt der Chrụtgaarte n auch das Spi̦i̦nḁtchrụụd, so daß der aus Brotteig gebackene und mit Spinat belegte Spinatkuchen geradezu Chrụụdchueche n genannt wird. Seine Stücke ( Chueche nbi̦tze n) werden zum Essen auch bei Tisch unzimperlich zwischen die Finger genommen, woher man mit der Abfertigung: (das isch) e n Handheebi an e n Chrụụdchueche n die Erteilung einer Auskunft verweigert. Auch der Mangold wird als Máṇgu̦dchrụụd bezeichnet. Beliebt war freilich diese einst auch im Seeland den Morgentisch versehende Gartenpflanze nicht. Während eines fürchterlichen Hagelwetters schaute ein Tschugger den Verwüstungen im Garten zu und rief: Nụmmḁ n drụụf, drụụf uf d’s Mangu̦ ldchrụt — b’hüet Gott der Räbstock! — Der Mangold heißt im Emmental, wenn seine Rippen als Chrụtsti̦i̦le 206 eingesäuert werden, Sụrchrụt. Diesen Namen trägt dagegen im Seeland das w ị̆ß Chrụụd oder der Chaabis, d. i. der Weißkohl, wenn er im Sinn des emmentalischen «Sụrchăbis» behandelt worden ist. Es ist dann «die» aus dem Elsäßischen ins Französische übergegangene « choucroûte» und das altdeutsche «tompeskrût», das wie die ostschweizerischen «Gúmpi̦stbire n» als «Kompost», compôt (als mixtum compositum) ịị ng’macht worden ist. Aus Chrụ̈tlisa̦a̦mme n zieht der Seeländer im Chrụ̈̆tli, d. h. im Kohlfeldchen seine gangbarsten Kohlarten als G’chööch.
Das erste «Grün» ( viridia, lombardisch verza, daher «Wirsing») 7 kam urspriinglich als chou de Milan oder als Wirsinger ins Seeland, um als der ganz früechst Früehchöhli neuenburgische Leckermäuler zu erfreuen. Seine Spender sind hauptsächlich die Gampeler und Galser (mit denen wir auch vom Chöhli statt inserisch vom Chöo̥lli sprechen). Im Juni erntet man den gewöhnlichen Früehchöhli, im Spätsommer den Spa̦a̦tchöhli. Bevor die südfranzösische Konkurrenz auch die Schweizer Märkte beherrschte, isch mit dem Bluemchöhli öppis z’mache g’si̦i̦ n. Zu frühest kam di Schneballe n ( boule de neige), dann als mittelfrüh der napolidanisch und als später der im Herbst 1911 sehr ergiebige hol ländisch Blumkohl. Schön ịị np’hackt ist der Primus. In die Erbsen gepflanzt, wachsen die jungen Setzlig sehr vorteilhaft im Schatten auf. Vom Spätherbst bis tief in den Winter hinein geht die Gampelerin und die Galserin für den Markt auf das Feld ga̦ n roose nchöhle n, die Inserin ga̦ n roo̥se nchöo̥lle n.
Als Kohl gilt auch der wegen seiner dicken Wurzel gezogene «Rüebchöhli», Chrụtöpfel, la chou-pomme, die Schụ́pomm oder, drolligerweise mit dem jupon gleichlautend gemacht, das Schụ̈̆pung. Auch le chou-navet oder la chou-rave, galserisch d’Schụ́raav, sonst seeländisch d’Schụraave n gehört dahin. Die zarten gelben Schmalzschụraave n, welche gekocht im Munde schmelzen, werden gegessen, die andern Bodenkohlraben auf der Schnätzelmaschine n für das Vieh g’schnätzlet.
Dagegen sondert das Schweizerische vom Kohl, der nach seinem längern Strunk ( caulis) benannt ist, den durch seinen größern Kopf ( caput) charakterisierten Chaabis aus. 8 Zunächst ist Chabis der wirkliche (menschliche) Kopf. So haben bei Rudolf Manuel Streithähne einem Saufbruder «den Kabis mit trüwen b’rupft», haben ihn bim Chabis g’noo̥ n und ihm, wenn er reklamieren wollte, in verächtlicher 207 Abfertigung der Abchabis g’gee n. Das letztere Wort bedeutet freilich in einem rechten Chabisland wie Pruntrut, wie Seftigen mit seinem «Chabisbähnli», wie die Umgebung Berns usw. 9 zunächst den dem Vieh gereichten Abfall der für Sauerkraut nach Bern und Bümpliz verfrachteten Chabischöpf. Ansehnliche Chabisblätze n zeigt ja freilich auch das Erlachische. Und wenn niemals mehr wie z. B. im Jahr 1651 ein Inser Chabismüeterli (Capis oder Kabis Mütterli) 10 unter dem Ruf «Einer verschreitten Dirnen Ein Zyt lang vmbhergezogen ist», so nimmt dafür der Handel auf dem Markt um so angemessenere Form an. Dies gilt zumal von den Sorten des Iịse nchopf, des Blaukrauts ( roo̥te n Chaabis) und des Sant Dénnĭ̦s ( St. Denis) mit blauen Oberblättern, des Braunschweiger und besonders des Kope nhager. Dieser am alleri längste n sich haltende Weißkohl mit festem Häuptli ist der geschätzteste Sauerkrautlieferant. Als solcher soll er im Herbst wachse n, wi der Wịị n; und am Vreene ndaag gäit der Chaabis z’Ra̦a̦t gleichsam mit sich selber, ob er mit solchem Wachstum es dem Menschen z’lieb oder z’läid halten wolle. Er wird ersteres vorziehen, wenn er nicht der Schleimpilzkrankheit der Knotensucht (dem Chropf) erliegt.
Eine Gattungsgenossin des Kohls ( Brassica oleracea) ist die Rüebe n ( B. rapa), welche aber ihren Namen auch mit dem Gänsefuß, gewächs der Runkelrübe ( Beta vulgaris, s. u.), und in der Verkleinerungsform Rüebli mit dem wieder andersartigen Doldenträger Daucus carota teilt. Gemeinsam ist nämlich allen der knorrige Ansatz ( râpum, rapa, rave, deutsch ruoba, ruoppa) 11 der Wurzel, der auch im Stammansatz des Baumes und in der halbkugeligen Schwanzrüebe n des Rindes erscheint. Dem bis auf die Haarzwiebeln kahl Geschornen ist d’s Ha̦a̦r bis uf d’Rüeben abg’hạue n.
Als Nachfrucht von Roggen und Weizen gepflanzte, im Herbstnebel rasch gewachsene und darum wenig reez, rääz, rääß schmeckend, geben die Rüben eine äußerst angenehme Zukost zu Fleisch und Kartoffeln. Ehemals, als sie auf dem Frühstückstisch die Kartoffeln ersetzen mußten, 12 war das Rüebe n zieh n und Rüebe n (-laub) abhạue n im Rüebe nherbst eine weniger verheißungsvolle Arbeit. Da war der Hungerleider ein Rüebe nrätscher oder, bei Niklaus Manuel, ein «Rüebentröscher»; und den Genfern der Escaladezeit hieß der Herzog von Savoyen der «Rübenkönig» ( le rei dei barbot). 13
Eine allzeit hochgeschätzte Nachfrucht des Roggens ist das Rüebli, die Moorrübe. Moore nwü̦ü̦rze n heißt allerdings bloß die verholzte 208 und eigentümlich scharf nach Pastinaken 14 riechende Pfahlwurzel vergeilter oder als Samenträger ụụfg’stängleter Exemplare. Solche, wie auch chrụ̈ụ̈seligi (krausblättrige) Karotten wachsen gern auf Boden von alter Kraft. Man wählt darum für Rüebli gern früschen Ụụfbru̦u̦ch. Langsam keimend, wird der Same namentlich der sehr zarten geel be n Rüebli oder Mụ̆se n- oder Sooße nrüebli zugleich mit Salat- oder Spinatsamen gesäet. Diese rasch zur Ernte reifenden Blattpflanzen beschatten die junge Saat und ersparen das erdünnere n.
Als Gemüse vor dem Kochen b’schnitte n werden auch die Leguminosen. So nahrhaft zumal ihre Kerne sind: auf dem Markte liebt man d’Cheerne n nit ’plooderet (wie aufgelaufen dick). Sie dürfen nicht si ch zweu Ma̦l vor der Rị̆ffi chee̥hre n 15 und beim Enthülsen 16 oder ụụschi̦i̦fle n von selber ụụsḁdroole n. Zu erwähnen sind unter den Stangenbohnen: Stäcke nboo̥ne n, welche des sti̦chle n mittelst der Sti̦chel (in Gals: Bohne nstäcke n stecke n) bedürfen, die Säänfiagger ( St. Fiacre). Fade nlos, ohni Feede n, wie diese, sind die krumm wachsenden Hööggiboo̥ne n, welche als zart und fein geschätzt werden. Sie heißen nach ihrer Herkunft auch Grangßong. Amerikanischi Ri̦i̦se n, Tessinerboo̥ne n, Zäntnerboo̥ne n sind andere oft genannte Sorten. Die Buschbohnen oder mu̦tze n Boo̥ne n führen über zu den im Feld reihenweise gesäeten Suppe nböo̥nli mit ihren Hauptsorten des (gelben) Schwööfelböo̥nli und des Mădammböo̥nli. Das Verbot des Kifelbrechens am Sonntag (9. Juli) 1685 17 zeigt, wie lang die samt den Chi̦i̦fle n (Kefen) genossenen Chi̦i̦feleerbs ( Pois mange-tout) schon gepflanzt werden. Man unterscheidet eine wị̆ßi (weißblühende) und eine blaaui Spielart. Zu letzterer gehört der Mammut (baslerisch: «Ụụsmachmues»). Eine frühe Sorte von Auskernerbsen oder Zuckereerbs ist der Mäichünig, eine späte die Viktoria. Eine sehr frühe und große Markerbse (mit runzligen Samen) ist der Gradu̦ß (Gradus), eine reichtragende, langschotige die Télifföönler oder Téliffooneerbs, während der Téligraaf sich durch große Schoten auszeichnet. Es handelt sich hier um Konserveneerbs, welche namentlich die Konservenfabrik und die Gemüsebaugenossenschaft zu Kerzers anbauen und anbauen lassen.
Sehr früh wie die Erbsen, steckt man auch die Chlü̦ü̦f. (Der Chlu̦u̦f ist svw. Zwiebel als botanische Form des unterirdischen Stamms.) Denn die als Würze gebaute Zü̦ü̦be̥lle n ist eins der b’süechigste n Markterzeugnisse, wie ja schon der Berner «Zị̆bele nmäärit» beweist. Die 209 Zwiebel hieß früher, wie Rudolf Manuels Sprache dartut, auch hier wie noch in der Mittel- und Ostschweiz «der Böllen». 18 An diese Form lehnte sich Zwibollo, «Zwiebel» und «Z̦ü̦übele n» als Umdeutschung aus caepulla, der Verkleinerung aus ( Allium) Cepa. 19 Nächst verwandt ist der Lạuch, zumal der weiße und fußlang werdende Garánta ( Carentan), sowie das Schărlottli, die Schalotte. Sị̆llerịị ( céleri, baslerisch «Zä̆llerig», Selinum), ferner die erlacherischen Arte̥fụ̈ụ̈fi: die Schwarzwurzeln, scorsonères, Sgŏrße̥neer (baslerisch «Stŏrzenä́ri») und Schịggeree (Cichorie, chicorée als Kaffeesurrogat) sind fernere Nutzwurzeln. Als Salat dagegen dienen der Sụnne nwü̦ü̦rbel (krause Endivie), sowie das dunkelgrüne, vollherzige, löffelblättrige Nüßlichrụt, verschieden von der groben und wullige n oder g’sam mete n französischen doucette.
Wältschi
Gu̦ggu̦mer, dütsche Salat:
Hättisch ’na g’frässe, so weerist e Soldat!
Die Gŭ̦ggu̦mere n führt über zur cucurbita als Chü̦ü̦rps, deren einer gelegentlich am Markt einen mittelgroßen Korb füllt.
1
Vgl. die ahd. Lautverschiebungsformen zu Torf:
S. 167.
2
Von der Familie Kämpf in Gampelen an Hand des Katalogs Altorfer (1912) benannt.
3
Im Wistenlach:
la jardinière, sarkastisch wie etwa am Genfersee gewisse Insekten als Weinbergschädiger «
vignerons» heissen. «Rossmörder» aber sind überhaupt Tiere, die bei aller Kleinheit doch von verwandten oder verwandt scheinenden Arten durch ungewöhnliche Größe sich abheben. Vgl.
Gw. 202.
4
Mhd. (
WB. 1, 538)
jëten, ich
gite, ich
jat, wir
jâten, ich habe
gejëten bedeutet zunächst ein Sondern zwischen guten und unerwünschten Kräutern und ein Auswählen der erstern, ein Ausmerzen der letztern, die ahd. als der
getto (
lolium:
Graff 1, 595), schwz. als das Jätt oder
G’jätt bezeichnet werden. Die Energie, mit der für letztern Zweck das
Jätthauli oder die
Jätthaue, das
jëtisen, jëtisarn gehandhabt wird, lieh dem
jätte
n oder gäten auch die Bedeutung: hart mitnehmen, schleudern und schlagen (
schwz. Id. 3, 82 ff.), sowie intransitiv: dreinschlagen, ausschlagen.
5
Vgl. alle die
chrût im
mhd. WB. 1, 890 f.
6
Vgl. die Urverwandtschaft mit
bryö:
Kluge 264.
7
Kluge 496.
8
Wie
caulis als
kôl, chôlo, chôli, koele,
Chöhli entlehnt wurde (
Kluge 256), so
caput, ml.
caputium als
chapuß, kabeß,
Chabis. Das genferische
kabussa ist Kopflattich.
9
Vgl.
Stat. 10, 2, 85.
10
Chorg.
11
Kluge 378.
12
Lf. 508.
13
Brid. 45.
14
Das Rüebli heißt denn auch in
La Côte patenallha.
15
bisveri:
Brid. 41.
16
déblotta: (zu «blutt»):
Brid. 97.
17
Chorg.
18
Schwz. Id. 4, 1175 f.
19
Kluge 513.
Die Gaarte nrüstig (1759: das Gartenzeug) und die weitern Pflanzsache n vermochten in und um Gampelen dank der bloß dreistündigen Entfernung Neuenburgs schon lange vor der Entsumpfung die gewöhnlichen Haushaltungskosten zu decken: 1 d’Löcher i n der Hụ̆shaltig z’verschoppe n und d’Hụshaltig hälffe n z’spanne n (dü̦ü̦rḁ z’ schläike n).

|
|
Studie von Anker |
Der Triumph der Frauenwelt ist hierbei ein doppelter. Einmal befriedigt solche Deckung der Haushaltungskosten den gerechten Stolz jeder braven Hausfrau, welche es verachtet, nummḁ n dem Maa n 210 sị n Schläipftroog z’sịị n u nd si ch von ĭhm la̦ n z’versorge n, statt daß sie ihm nach Kräften hilft, sich emporz’schla̦a̦ n. Sodann darf es heißen: So lang mier pflanze n, häi n me̥r sälber Gält! Das Meeridgält isch e n Sach, wo d’Fráu aafḁ n z’erst i n de n Fingere n het. Außer Kurs ist dann der ungeschriebene Rechtsparagraph gesetzt: E n Frau tarf käiner Schulde n mache n; aber de̥m Maa n sịner Schulde n zahle n, das cha nn si e dee nn!
Die Raschwüchsigkeit der meisten Gartengewächse gestattet den Hausfrauen, sich den wachsenden Bedürfnissen der Städter in weitgehendem Maß anzupassen und auf die Fragen wie: häit de̥r no ch vo n däm? häit de̥r no ch...? mit Ja zu antworten. Aber der Eisenbahnverkehr und ganz besonders der Dienst der Diräkte n (Bern-Neuenburg, s. im Band «Twann») bringt nun noch ganz andern Fluß in die Sache. Selbst abgesehen von Witzwil und Tannenhof, spediert Gample n drei Viertel, wie Möntschemier zwei Drittel mehr Gemüse als das viel größere Eiß. Sodann gelten die eigenen Gemüsegüterzüge, welche die «Direkte» je am Meendḁ g und Frịta g z’Aabe nd eiuzulegen pflegt, Gesellschaften und Privaten, welche in Sụ̈̆schị̆, Möntschemier und Cheerze rz je zwei Wööge n, in Fere nbalm und Gümmene n je einen Wa̦a̦ge n füllen. Wie, wenn erst auf den Berner «Zi̦bele nmäärit» ( Zü̦ü̦bele nmeerid) ganze Berge von Zü̦ü̦bele ntrü̦tsche n, Si̦llerịị, Chnŏblạuch, Reetig (Randen), Chaabis sich auf die zahllosen Meeridchöörb verteilen, die einen ganzen Einladetag ausfüllen! Am 25. November 1912 versorgten 25 Eisenbahnwagen bloß aus dem Moos diesen Berner Markt. Sodann fordern Großhändler und Grämpler in Biel, z’Sant Immer, z’Tremmlinge n (Tramelan), im Lụgglĭ̦ (Locle) und z’Schŏpfoo (La Chaux-de-Fonds) starke Tribute vom Moos, und zwar zuweilen dreimal in der Woche; sie zahlen aber auch bis 8 Franken für das Dotze nd Carviol- Blueme n. Dafür wird freilich standesgemäß g’vöörtelet. So z. B. daß in den Vierlig Chaabis 26 statt 25 Häuptli ịị n’zellt werden müssen, wogegen der Händler sie nach der Formel 4 x 25 = 100 verkauft. Gleichwohl heißt es bei den Lieferanten guter und rascher Zahler: Jää, we nn mḁ n wo lltt ’zahlt sịị n, so mueß mḁ n d’s Beste n gee n. U nd wenn mḁ n rächt Lụ̈t het, soll mḁn ó ch rächt sịị n! D’s Mees i n der Oor dnig u nd d’Mărschandịịs i n der Oor dnig! (D’Mărschandịịse (s̆s̆) heißt im Seeland auch speziell das gewerblich verarbeitete Rohmaterial, und Marschang nennt sich in Treiten die Nachkommenschaft eines ehemaligen Krämers; so unter ihr der Veteran Marschang-Rüedeli). Auch soll man sich mit den erzielten Preisen einmal zufrieden 211 geben: verg’nüegt sịị n. Man soll nicht immer felse n (feilschen) wi n e n Ju̦u̦d u nd mäine n, es mües s alles gä ng glịịch tụ̈ụ̈r sị n wit d’s vo rder Ja̦hr oder wi am vooräänige n Meerid.
Jurassische Händler machen auch die Märkte in Biel und Neue ntstadt guet. Hierher fahren darum die Lüscherzer zu Schiff oder, wie die Eißer, Galser, Brütteler, Feisterhenner und Si̦i̦seler, zu Wagen.
Der Hauptanziehungspunkt des westseeländischen Gemüsehandels ist freilich Neue nburg mit seinen Gemüsemärkten all Zịịstḁ g, Donnstḁ g und Samftḁ g und insbesondere dem groo̥ße n Donnstḁ g: dem ersten Donnerstag des November. Diese Märkte werden beherrscht durch die Wistenlacherinnen, die Gampeler- und Galserfrauen.
Erstere, les Marmettes geheißen, haben jeweils an ihren großen Tagen ein eigenes großes Dampfschiff zur Verfügung, das sie samt ihren Waren von Murten her in Praz abholt und durch die Broye über Gụ̆derfịị nach Neuenburg, sowie ummḁ häi m führt. Das Nü̦ckli, das sie auf dem Heimweg in der erfrischenden Seeluft sich gönnen, redet von der arbeitsreichen Vornacht dieser musterhaft fleißigen Frauen und Töchter, von denen das Sprichwort umgeht: Wär’s will guet haa n, soll es Miste̥lacherwịịb neh n un d ĭhm es Roß aa nschaffe n.
Aber auch mit einer Gampeler- und Galsertochter fahrt guet, wer selber nicht träg will z’ru̦ggli̦gge n wi n es fụụls Roß a n der Diechsle n, sondern sich tüchtig ins Zeug zu legen begehrt. Das sind allerdings exemplarische Arbeitstage vor dem Markt und Entbehrungstage am Markt!
An jenen gilt es, im Sommer und Herbst dem Gemüsefeld, im Winter dem im Garten ịị ng’lochete n oder verlochete n (eingegrabenen), mit Laden und Säümist frostsicher gehaltenen Loch die Waar zu entheben, welche man z’moornderisch abzusetzen hoffen darf. Dann heißt es: d’Rüstig rangschiere n. Und zwar sụụfer putze n! Denn die Stadtfrauen und zumal die an Zimperligi sie übertreffenden Chöchine n sind durch die Konkurrenz gewaltig verwöhnt. Da gilt es, äi’m i’ n Chratte n z’diene n, bi äi’m im Chratte n oder im Chrättli z’sịị n, den gewohnten Abnehmern z’chrätte̥lle n. Solches b’richte n, reede n, fü̦ü̦rḁgee ben, gäng Mădamm seege n un d en an͜dere n d’Lüt abstehle n, ohne damit seiner Würde etwas zu vergeben: das ist es rächts kunsteriere n!
In peinlichster Sauberkeit also werden von einer Haushaltung bis sächz’g Dotze nd P’hack Rüebli in äi’m Daag g’rüstet; dazu etwa Lạuch in halbfränkige n Bündeln zu zeeche n Stängel usw. 212 So wird ’butzt u nd ’bbutzt bis äm ängle̥fi z’Nacht oder wohl auch bis Mitternacht. Was wird da aus der Bettruhe? D’Gample n-wịịber gange n nid i n d’s Bett, si chnäüle n nu̦mmḁ n dḁrvor. Wie es auch Männer gibt, welche mäṇgi Nacht hin͜der enan͜dere n nid us de n Hoose n chöo̥me n. Geschieht dies jedoch wieder einmal, so heißt’s: D’Manne n hänke n d’Hoose n nummḁn a’ n Bettstolle n; u nd we nn die nịmme hr blampe n, so stan͜de n si u̦mmḁ n ụụf.
Kommt es aber zu wirklicher Ruhe: wi lang ächt? Kaum ist das Bett aa ng’weermt und der Schläfer halbwegs erwaarmet, so schla̦a̦t’s Zwölfi, und es heißt: Ụụf, ga̦ n d’s Roß fuetere n! ga̦ n z’Morge n mache n! Um zwei Uhr: ụụf u nd furt! Es knallen die Peitschen in die Stille der Winternacht oder in das sommerliche Morgengrauen hinaus; es knarren die Räder der leicht gebauten, aber dank einer eigenen Ladekunst sehr ansehnliche, teilweise sperrige Lasten tragenden Wöögeli. In ausgiebigem Schritt oder leichtem Trab, kaum durch ein aufpeitschendes Hụ̈ụ̈! beschleunigt, folget das Pferd der in dichtes Leib- und Kopfgewand gehüllten Meisterin. Leicht findet es seinen Weg auch in dunkler Nacht, dank den polizeilich vorgeschriebenen Lanteerne n, deren je eine den Wagen erhellt. Ist das ein Anblick für einen, der zwischen dem Mărängerfäll d (zu Marin) und der Zi̦hlbrügg, wo die Galserinnen zu den Gampelerfrauen stoßen, die von zahllosen Lichtern illuminierte Straßenschlange überblickt! Mi het albe n vo n wịtem’s chönne n mäine n, es weer e n Fackelzug.
Seltsam aber vermischen sich jetzt Geräusche am Platz des ehemaligen Stadttors. Denn halten muß hier Roß und Rad: da̦ mueß g’waarte n sịị n, bis es vom nächsten Glockenturm feufi schla̦a̦t. So gebietet es die Polizei seit 1907. Und sie hält strenge Wacht. Vorher, wo nächtlich freier Durchpaß gestattet war, fuhren die Gemüsefrauen bereits um Mitternacht ab, für’s chönne n sattliger z’neh n. Nun wird gelegentlich, wo nicht z. B. kostbares Tafelobst verhŏtschlet würde, die eingebüßte Frist durch wildes G’spräng eingeholt. Sobald der Stundenschlag den Paß frei gibt, wird g’sprenggt, vill verflüechter, weder wenn e n Batterịị ụụffahrt. Wo nicht gleichlaufende Gassen den Ansturm zerteilen, sucht man enan͜dere n vorz’fahre n. Ein Wunder nur, daß ’s no ch nie nụ̈ụ̈d g’gee ben het (kein Unglück geschehen ist)! Weniger wundert sich, wer den Seeländer kennt, über die Bereitwilligkeit zu rascher gegenseitiger Handreichung, wo öppḁ n es Rad abgäit oder ein ähnliches Mißgeschick sich ereignet. Denn den Wettstreit um das beste «Plätzchen an der Sonne» begreift ja jeder aus seiner eigenen Geistesverfassung: är nimmt’s ab sịne n Bi̦r nen abb.
213 Bis hundertzwänz’g Fueder nehmen Aufstellung um das Tramhụ̈ụ̈sli auf dem Bụ̈ụ̈ri- ( de Pury) Platz, wie vormals auf dem Schị̆mmnăsblatz ( place du gymnase) als dem viel schönern, wenn auch zü̦ü̦gige n (Zugwinden ausgesetzten) Meeridblatz. Da vollzieht sich, so mancher Kniff auch z’spi̦i̦le n versucht wird, jede Manipulation in militärisch strammer Ordnung. Jede Lenkerin kennt genau ihres Blätzli, das sie als die womöglich zuerst Erschienene sich längst ausersehen hat und nun mittelst eines Halbfränkli sich aufs neue sichert. Num steigt sie lautlos vom Wagen, spannet abb und führt mit einem halblauten chu̦mm! ihr braves Tier seiner Herberge zu. Wäre nicht das Stampfen der Hufe auf dem steinigen Pflaster, man glaubte sich jetzt in die Stille der Mitternacht versetzt. Denn auf den gastlichen Bänken rings um das Tramstationshäuschen holen nun die als Verkäuferinnen Gerüsteten ein Stücklein der so jäh unterbrochenen Ruhe nach, suchen wohl auch ein bißchen Scheerme n vor Regen oder Schnee und Sturm, dem sie nun bald als beneidenswerte Heldinnen bis spät in den Nachmittag hinein völlig schutzlos ausgesetzt sind. Denn äm sächsi kommen die ersten Händler zu feilschen. Vorher darf nicht verkauft werden. (Ja, in Neuenstadt gibt erst äm halbi achti das Glockenzeichen den Kauf frei.) Was am Wagen nicht rasch und willig furt gäit, wird auf dem Marktstand ausgelegt und unter den allgemach sich einfindenden Kennerinnen und die es sein wollen, «an Mann» gebracht.
Es bedarf hierzu der deutschen und welschen Beredsamkeit, welche vor einem halben Jahrhundert die freien Verkäuferinnen auch aus Eiß vor ihren gewohnten und vor neu zu gewinnenden Abnehmerinnen in den Häusern der Stadt entfalteten. Die häi n mier — erzählt eine 84jährige muntere Eißere n 2 — grad d’s ganz G’lü̦mp un͜der äinisch e nwägg g’noo̥ n. I ch bi n nu̦mmḁ n mit dem Wöögeli fụrt un d abmarschiert (die vier Stunden weit) u nd bi n früej im Na̦ chmittag leer ummḁ häi n g’si̦i̦ n. Jää, we nn mḁ n gueti Waar het, mi cha nn si gäng brụụche n! Aber frịịli ch mueß mḁ dḁrzue e n chläi n es guets Mụụl haa n. Das darf mḁ n nit da̦häime n la̦a̦ n oder im Sack haa n. Mi mues si ch de n Lüt biwährt (wert) mache n u nd si umnéh n. B’sun͜ders han i ch ’s de nn mit de n Mägd gar Donnerlis guet chönne n. Mị n Na̦a̦chbụụr hingeege n, dee r isch ung’fel lig g’si̦i̦ n, er het e̥käi n G’fell g’haa n. Är het äi ntweeders d’Sach umma müeße n häi n neh n oder aber sie verschinte n (fast vergeebe n gee n, verhụ̈tze n, in Tschugg: si für Haarz gää n, si verhaarze n). De nn ha n i ch däm o ch 214 no ch Lụ̈t zu si’m Wöögeli zụchḁ g’löökt u nd ha n ’ne n e n chläi n stịịff b’richtet, un d är het siner Sachen im Schnụụß e nwägg g’haa n.
Warum auch solche Neidlosigkeit nicht, wo für alle z’ässe n gnue g un d Arbäit gnue g vorhanden ist? Arbeit auch für die Kinder, die in der so vielfach für sie passenden Beschäftigung vo n chlịịnem ụụf i n d’Arbäit ịịchḁ wachse n und davor bewahrt werden, uf der Gassen umhee̥r z’rönnle n. Dieses Gute kann freilich in ein fatales Gegenteil umschlagen, wenn dem kindlichen Hirn der nötige Schlaf abgebrochen wird und Zeit und Kraft und Lust zur Schule um ihr heiliges Recht kommen. In dem Maße, wie diesem Übelstande vorgebeugt wird, wächst die reine und helle Freude an der Arbeit, sowie die ermutigende Beobachtung, wie dank den Mŏsgeerte n innert zwei Generationen ganze Ortschaften ụụchḁ choo̥ n u nd fü̦ü̦rer (vorwärts) choo̥ n sii n.
1
Nach
Stauffer.
2
Frau Schumacher.
Einst beherbergten auch die Dörfer des Erlacheramts ein Bettelvolk. Haufenweise stellte das sich in Samm Pleesi und besonders in der Pension Mụ́mmeraal ( Montmirail) ein, für ga̦ n Räste n z’räiche n. Es hieß zu Insern: Wenn de nn der Presidänt u nd der Pfaff o ch no ch sị n choo̥ n, so isch de nn d’s ganz Eiß da̦ g’si̦i̦ n! Zu Vinelzern: Dier chöo̥met äin doch o ch alli z’seeme n vor d’Tü̦ü̦r; am Änd chunnt äüe r Pfar rer o ch no ch cho n bättle n! Antwort: Är cheem schoo n, aber är het nu̦mmḁ n äi nen Finke n!
Nun haben alle Bettelhütten gefällig einfachen Klein- oder sogar Mittelbauernhänsern Platz gemacht. Glịịchlen auch einige derselben einander wi n e n Tropf Wasser (dem andern), so erzählen sie doch vom gemeinsamen Emporkommen zum glịịche n Zwäck (d. h. Erfolg). 1 Vo n nụ̈ụ̈t isch mḁ n zur Sau choo̥ n, von da zur Chueh, von der einen Kuh zu zeeche n Stuck Waar und zum Roß. Da hieß es freilich mitunter: Gält uufneh n und a feufi verzinse n. Aber mi het’s ämmel chönne n mache n, und heute sind Haus und Heim schuldenfrei. So u. a. eins, dessen Inhaber von Unglück nichts weniger als verschont geblieben sind. Sie waren vor zwanzig Jahren brunstlịịdig. Den Mann befiel dreimal die Lungie ntzüntung, und aus den acht Kindern riß der Tod eine achtzehnjährige Tochter hinweg.
In solchen Prüfungen bietet Solidarität e n starche n Rügge n,
215 Und ihr Ideal fände diese in einem zwanglosen, aber durch gute Organisation den einzelnen zum Anschluß bewegenden (vgl. einen zụụhabin͜de n) Genossenschaftsverband für Warenabsatz am Ort. Längst hat man an eine Warenniederlage, eine Konservenfabrik oder dergleichen im Moos gedacht. Denn die so überaus häufige und jeweils lange Abwesenheit der Hausfrau, worunter in erster Linie die Kinder zu leiden haben, und um deren willen manch ein «Herr des Hauses» sich ins Wirtshaus getrieben sieht, sind augenfällige Schattseiten des oben beleuchteten Emporkommens. Erst wenn auch hier Licht geworden ist, erstehen im vollsten Sinn des Wortes aus alten Riesensümpfen immer neue Riesengärten.
1
Der «Zweck» in der Schützenscheibe (über diese Grundvorstellung des bildlichen Worts vgl.
Kluge 511) kann sowohl als bereits getroffen, wie als erst ins Auge gefasst betrachtet werden.
Mit des Lebens bitterster Not, bald durch übergroße Tröcheni und bald durch überg’heie n des Wassers hervorgerufen, kämpfen am Strand des Mittelmeeres Gänsefußgewächse 1 um ihr Recht aufs Dasein. Sie wehre n si ch d’s Leebe ns mittelst Entfaltung einer tief eindringenden, dünnen, holzigen, bitter scharfen Wü̦ü̦rze n und langer, spitziger Bletter. Beides befähigt sie, in günstige Lage versetzt und in kundige Pflege genommen, zu hoher Veredlung. Melde, Spi̦i̦nḁt, Mangu̦ ld entwickeln riesige und saftige Speiseblätter; andere Gattungsgenossen lassen ihre Wurzelköpfe zu ziegeneutergroßen Chnü̦ü̦re n, Knorren werden. Diese Grundbedeutung kommt nämlich sowohl der rapa, rave, ruoba, Rüebe n zu ( S. 207), wie auch der keltischen, römischen 2 und deutschen bēta, Beete, bießa, bieße, 3 der Beta vulgaris, Runkelrübe, Runggle n. 4 Diese erfuhr mit der Länge der Jahrhunderte eine Veredlung nach drei Seiten hin. Zu Sa̦la̦a̦t ịi nmache n (zwecks längerer Aufbewahrung) und aa nmache n (zu sofortigem Verspeisen) läßt sich die in dichtem Stand äußerst zart werdende rote Rande, volksmäßig als Reete̥ch bezeichnet. Zu unerchánnter Gröösi und zur Qualität eines milcherzeugenden Viehfutters erwächst der askanische Riese und verdient damit den (später erörterten) Titel abundantia, l’abondance, la bondance, Bụ́ndangße n und Pŏdangße n (Ins, Kerzers), Bŏdangß (Siselen). Als Zuckerrüebe n endlich steigert sie bei sorgfältiger Kultur ihren Rohrzuckergehalt von 2 bis auf 20%; auch im Seeland brachte sie es binnen ihrer kurzen Anbauzeit bereits auf 13 bis 17%.
216 Zwischen ihr und der Futterrübe gibt es eine bereits stark zuckerigi Zwischenstufe: die Halb- oder die halbi Zuckerrüebe n. Zur Zuckergewinnung wäre diese allerdings z’weeni g süeß. Eine rentable «Süeßigkäitsfabrigge n» 5 nimmt nur Erzeugnisse aus den von ihr bezogenen Sa̦a̦mmen an und zahlt nach dem von ihr festgestellten Zuckerprozentsatz. Die ohne Rückfall herausgezüchtete Zuckerrübe hat auch ein eigenes Aussehen. Sie ist grääwtschelig wị̆ß und g’seht schier ụụs wi n e n chlịịne r Zuckerstock (Zuckerhut), wo mḁ n d’s un͜der obe n gstellt het; doch so, daß man sich dessen Boden stark entkantet ( e ntbrääwt) und den Kegelstumpf in die bis 1½ m in lange Sụụgwü̦ü̦rze n auslaufend denken muß. Mi chönnt o ch seege n: wi n e̥s rächt e̥s dicks, öppḁ dreizöllnigs Rüebli. Eben dies untere Ende ist die wichtigste Partie der Rübe. Denn hauptsächlich hier wird i n der Augste nhitz der Zucker g’chochet, welchen die mächtigen, an verlängertem Stiel sitzenden Blätter als Kohlensäure der Luft entnehmen.
Man ersieht hieraus, wie verderblich für die Zuckerrübe die Heerzfụ̈ụ̈li (Herzblattchrankhäit) ist, welche als Peronospora Schachtii mit der Hördöpfelchrankhäit ( P. infestans) und dem faltsche n Meltau ( P. viticola) éiner Gattung ist. Naßkalte Sommer würden also ihre Anpflanzung auf dem gewöhnlichen «guete n Land» oder schweere n Boode n verunmöglichen, während das Moos sie durch alle Witterungslaunen dü̦ü̦rḁschläikt. Das vermag es mit seiner glücklichen Vereinigung von starkem Aufsaugungsvermögen und großer Durchlässigkeit, sowie mit der ausgiebigen Wärmerückstrahlung seines schwarze n Heert. So wird der Un͜derschäid zwischen naßkalten und troche n-häiße n Summere n erheblich mache n z’min͜dere n. Der Moorboden bringt damit uf iede n Fall eine annehmbare Mittelernte. So in dem im übrigen traurigen Jahr 1910, wo d’Hördöpfel ḁ lsó wüest g’fehlt häi n.
Zuckerrüben und Kartoffeln stehen auch sonst in einem wirtschaftlich interessanten Verhältnis. Jene vertụ̈ụ̈re n diese durch zeitweiliges Zurückdrängen ihres Anbaus und lööke n wieder zu letzterem. In ein ähnliches Wechselverhältnis setzt die Abfallverwertung der beiden: die Verfütterung der getrockneten und aufgequellten ( z’ g’schwalle n’ta̦a̦ne n) oder der frisch mit Runkellaub eingesäuerte n (Rüben-) Schnitzel an Jung- und Mastvieh, und die ebensolche Verfütterung der stickstoffreichen Schlempe aus der Brönnerei. Mit dem größern tierzüchterischen Futterwechsel aber geht der erweiterte Turnus der landwirtschaftlichen 217 Fruchtfolge Hand in Hand. Dazu kommt die unmittelbare Bereicherung des Bodens. Der Zucker, der der Rübe entzogen wird, indes ihre ganze übrige Aufbaumasse auf dem Umweg des Tierleibes wieder der Erde zugeführt wird, wird mehr als ersetzt durch aufgeschlossenen Untergrund. In diesen dringt das Saugwurzelsystem der Zuckerrübe metertäüff aachḁ. In dieser Beziehung nimmt si’s ụụf (hebt gleichsam den Handschuh des Wettstreits auf) mit der Esparsette (dem Sängfäng, d. i. saint foin), der Lụ̈seerne n usw. Selbst den Stalldünger darf sich der Rübenpflanzer ersparen dank dem Chalchschlamm, welchen die Zuckersiederei als weiteres Abfallprodukt liefert. Zur Überschüttung mit solchem kaufte die Gemeinde Aarberg vom Staat gegen zehn Jucharten Aarestrand und gab sie i n Leeche n. Kunstdünger überhaupt sichert, einmal g’höörig darta̦a̦ n, Vollerträge für zwei bis drei Jahre. Ja bis vier Ja̦hr na̦ ch n enan͜dere n häig’s d’Rüebe n am glịịchen Ort (halte es aus und gedeihe), wird behauptet.
Zu allem kommt die sichere und kurzfristige Barzahlung für die abgelieferten Rüben: ein prächtiges Mittel für si ch z’chehre n. Um die 273,807 Franken des Auszahlungswinters 1908/09 bewarben sich denn auch sämtliche seeländische Amtsbezirke. 6 Wertvoller noch ist das Steigen des seeländischen Vieh- und Bodenwertes innert der Jahre 1886 und 1907 um beinahe 100%, wie im gesamten Kanton Bern auf 51 und im allgemeinen auf 48%. 7 Wer also auch nur es Hämpfe̥lli Heert besitzt, bepflanzt es mit Zuckerrüben, da doch der Weinbau so häufig Läi lougnet. (Nicht «Farbe bekennt», nicht mit dem Erwarteten «herausrückt».) Er pflanzt Süeßes im Moos anstatt Sụụrs im «guete n Land».
Auch zu dieser stillen Revolution im Bụụre nweese n bedurfte es aber eines Vertrauen erweckenden Anstoßes. Der kam vom Bauersmann Johannes Zesiger (1837-1904) in Bargen, wie nach dem Fabrikbrand ( S. 220) der Anstoß zu neuem Wagnis vom dortigen Großrat Müller und vom Nationalrat Freiburghaus in Spängelried, um bloß Seeländer zu nennen.
Mit Frankreich, mit einer Reihe Schweizerkantone und mit einer Anzahl bernischer Ämter trat denn auch bald das Seeland in lebhaften Mitbewerb. Das grŏß Moos und die Grenchener Wịti sahen Pflanzgenossenschaften entstehen wie die der Zuckerfabrik ( S. 220), die von Challnḁch, Feisterhenne n-Müntschemier (seit 1905 unter Niklaus-Probsts Leitung). Bauen diese Genossenschaften und die 218 Anstalten im Großen, so gewahrt man in der Nähe der Fabrik: in Aarberg und selbst in Lyß Rüebenacherli, auf welchen sich halbgroße Kinder und zuweilen deren Eltern fleißig zu schaffen machen.
Denn d’Rüebe n gee n z’tüe n, mi wäiß nid wie! Die süße Frucht will saure Arbeit.

|
|
Joh. Zesiger in Bargen † 1900 |
Z’erst sääijen i n der Winterfüechti, doch im Moos erst im Meie n (vgl. S. 202). Dafür kommen hier d’Fu̦u̦r chen e n Schueh na̦a̦ch z’seeme n, damit im Hochsommer und Herbst die Blätter eine geschlossene Decke ( Deechi) bilden, unter welcher eine anhaltende toppi Hitz die Zuckerbildung fördert. Auch d’s ha̦cke n, sobaal d d’Pflenze̥lli errunne n sịị n u nd mḁ n d’Räie n g’seht, ist Sache Erwachsener. D’s erdünnere n dagegen, we nn vier Blettli sịị n, ist Sache der Kinder. Die umfassen gäng e n halbe n Schueh von enan͜dere n ein besonders starkes Pflänzchen, das söll blịịbe n sta̦a̦ n, mit der linken Hand und rạupfe n di an͜deren ụụs, indem sie vom Pflänzli dänne n zieh n u nd nit gradụụf. Der zwäüt und dritt Ha̦cket ist wieder nur für Groo̥ßi.
Ebenso das ụụszieh n der Rüben vo n Han͜d oder das ụụsweigge n derselben mit dem zwäüzinggige n Handrübenheber, wenn die geel be n und verlampete n Bletter zur Ernte mahnen. Kinder sodann legen die Pflanzen in Doppelreihen, d’Bletter gegen enan͜dere n, und zwar so, daß die Rübenköpfe genau übereinander liegen. Eine starke Hand ergreift sodann das Rüebe nmässer oder das haarscharfe Geerte̥lli und zwickt mit ebenso geschickten wie flinken Hieben die Blätter samt deren Chappe n von den Rüben ab. Diese nun werden in Mieten zusammengelegt: in Hụ̈̆ffe n, deren jeder drei zweispännige Fuder ergibt, und bis zur Abfuhr mit Rüeblạub bedeckt. Dräckig, wie sie auch nach dieser Behandlung noch bleiben, werden sie mit der fäüfzinggige n Rüebe ngaable n (auch Rüebe nschụụfle n geheißen) auf den Brü̦ü̦giwa̦a̦ge n und von diesem in den Eisenbahnwagen verladen. Die Zuckerfabrik besorgt das Wäsche n in eigener Vorrichtung selber, um Zuckerverluste zu vermeiden.
219 Doch, hier sind wir in den mittelgroßen Betrieb der Genossenschaften und Anstalten hineingeraten, wie z B. die Strasanstalt Witzwil mit ihren Pflanzungen von 200-300 Jucharten ihn pflegt. Aus solchem Areal haben nicht einmal die Gefangenen Zeit zur Rübenpflege. Auch die Arbeiter des Tannenhofes ( S. 195) und natürlich erst recht die aus Landwirten rekrutierten Genossenschaften sind an fremde Hilfe gewiesen.
Die bietet sich in den Pole n und Pole nmäitschi (den norddeutschen «Rübenmädels»), wie auch die verheirateten Polinnen mitgenannt werden. Die landläufige Benennung ist Pólagge n, «Pollagge n- oder Slowagge nmäitli», 8 die ihres Befehlshabers: «Poole nchünig» oder «Polaagge nbaron». Solche Bezeichnungen werden jedoch von jedem vermieden, der da weiß, daß in ihr eine Grobheit steckt, welche die in der Mehrzahl außerordentlich achtungswerten Poolen und Poole nwịịbli nicht verdienen. Mit ihrer natürlichen Lebhaftigkeit, die sich gelegentlich bis zu ungewohnt lauter Jovialität steigern kann, verbinden sie eine einnehmend höfliche, ja graziöse Umgangsart. Dazu kommt die ungemeine Genügsamkeit, mit der z. B. die etwa 60 Arbeiter und Arbeiterinnen von Witzwil im Esche nhof ihren Haushalt führen, und die Abhärtung, welche sie «in Sonnenbrand und Kühle» barfuß und barhaupt ihrer Pflanz- und Erntearbeit nachgehen läßt. Und diese Akkord-Arbäit (um 90 Franken von der Jucharte) besorgen sie mit so viel Anpassung an die difissịịle n Lụụne n der Zuckerrübe und mit solch beharrlichem Fleiß — der sie denn auch einen Taglohn von sächs Fränkli la̦a̦t u̦u̦fḁschla̦a̦ n —, daß ihre Wiederkehr jeden Sommer willkommen ist. Es sind zumal die den Verkehr mit de n Hiesige n vermittelnden Vorarbäiter, welche für die Tüchtigkeit ihrer Volksgenossen einstehen. Sie dürfen es auch. Denn diese «äinzige n Lụ̈t, wo si ch no ch chönne n chrümme n» (bücken), bilden auch ein anmutiges Gegenstück zu dem allerdings keineswegs seeländischen, aber sonst vielfach bernischen «chu̦men i ch nid hü̦t, so chu̦men i ch moorn!» Diese Poole nwịịbli sind auf dem Rübenbauplatz, was die Italiener auf dem Hoch- und Tiefbauplatz. Bei ihrem ersten Einzug in der Schweiz (die Zuckerfabrik Aarberg rief sie 1904 her) waren ihrere n drị̆ßg, 1910 waren es meh weder vierhundert. Ein fernerer Zuwachs wird allerdings durch die russische Auswanderungssperre in Frage gestellt. Das dürfte die gute Folge haben, daß der zur bereits sommerlichen Arbeitslosigkeit getriebene industrielle Arbeiterüberschuß sich doch der Landwirtschaft zuwendete.
220 Die Zuckerrüben gelangen zur Verarbeitung in die Zuckerfabrigge n z’A arbeerg oder i n d’A’rbeergerfabrigge n. Diese wurde 1898 von einer Aktiengesellschaft, an welcher sich die Stadtgemeinde Aarberg mit äußerst empfindlichen Opfern beteiligte, gegründet. Unter Lehmanns († 1910) Leitung ein Lehrblätz für die tausenderlei neuartigen Erfahrungen, het si 1909 müeße n la̦ n ga̦a̦ n: sie ist verkonkuurset (es het si überstellt, si het d’Bäi n obsig g’streckt, si het müeße n la̦ n g’heie n), um unter der bernischen Kantonalbank als erster Pfandgläubigerin sofort eine gedeihlichere Existenz weiterzuführen. Da kam mitten in den Betriebswinter 1911/12, dessen bereits erzielter Betriebsüberschuß von mehr als hundertụụsig Franke n einen drụ̈ụ̈fachte n Abschlußbetrag hätte erwarten lassen, die schlimmste aller Katastrophen.
Am 28. Jäner 1912 ist d’Fabrigge n verbrönnt. Es isch am Sunndḁ g gsi̦i̦ n. Äm Vieri im Na̦ chmittag isch’s ụụsbroche n. I n baar Minuten isch das groo̥ß, mächtig Gebäü äi ns Gluetmeer. Daas praßlet u nd chleefelet i n dene n höo̥che n, bräite n Pfäister! D’Bịịse n pfị̆fft u nd zieht dür ch dä n wịt und höo̥ch leer Rụụm. D’s Fụ̈ụ̈r loderet u nd läcket u nd zünglet nach allne n Site n. Jez chunnt’s a n die Bịịge n vo n volle n Zuckerseck, wo grad häi n solle n furt g’fergget weerte n; mi säit, öppḁ drụ̈hundert Wage nladige n. Das gi bt e n Fụ̈ụ̈rgaarbe n! Z’erst schwarz, de nn graau, de nn roo̥t, de nn wị̆ß. U nd brụụn lauft’s über de n Boden e nwägg, hie n e n Strom, dört e n Bach, am dritten Ort stäit schon e n Schwetti still. I n dä n Sirup aachḁ fallt e n glüeijige rn Ịịse nbalke n, dört o ch äine r. E n Dü̦ü̦r g’heit z’seeme n. Das gi bt neue n Zug. Jez ’chrachet’s i n der Höo̥chi obe n: d’s Dach chunnt aachḁ z’raßle n u nd verdäilt sich i n tụụsig Fätze n. D’s Fụ̈ụ̈r wird zur Sịte n g’jagt u nd reckt ieze z’dür ch e n wägg zu de n Mụụren ụụs. Die chrachen u nd die sprätzle n; es isch, wi we nn’s drin inn sü̦ü̦rmti u nd hụ̈ụ̈leti u nd sung. Hie donneret’s vo n mene n Bitz, wo z’seeme n gheit, da̦ zwängt si ch der Wü̦ü̦rbbel von ere n schwarze n Wulche n dü̦r ch ’ne n Lücke. Dür ch n es Pfäister g’seht mḁn es halb st ube ngroo̥ßes Máschine nrad ganz in ere n wị̆ße n Gluet inne n. En an͜deri Máschine n pfị̆fft i n lụte n, gixige n Töön, wi wenns e̥re n Angst miech. Jez chunnt d’s Fụ̈ụ̈r ó ch a n si e: es nützt ere n nụ̈ụ̈d, si ch z’wehre n. Si flammet ụụf, un d i n di bächschwarze n Wulche n schieße n schmali Bän͜der ụụchḁ, wị̆ß u nd roo̥t u nd violett dür ch enan͜dere n; d’s äint jagt d’s an͜der.
Du̦sse n stan͜de n d’Lụ̈t z’Hunderte n-wịịs. Z’lạuffe n si di äinte n choo̥ n, uf dem Weeloo di an͜dere n, mit dem Zug chöo̥me n si z’ganze n Schaare n. Da̦ stan͜de n si u nd luegen u nd seege n käi ns Wort. Was wette n si o ch 221 seege n, wo n es käini Wort gi bt für n e n söttegi grụụsegi Auge nwäid u nd für nes söttigs Unglück? 9
Das lastete schwer genug zumal auf dem Seeland, welches von der für Rüben jährlich bezahlten Mil lione n fast d’s halbe n empfing, und besonders aus Aarberg mit Umgebung, wohin jährlich gegen 400,000 Franken Arbeitslöhne abflossen. Denn 350 bis 400 Personen fanden von Mitte Oktober ( mitts im Wịị nmonat) bis Ende Februar ( ụụsgänds Hoorner) Beschäftigung in der Fabrik, wo mḁ n dü̦ü̦r ch u nt dü̦ü̦r ch (Tag und Nacht ohne Unterbruch) g’schaffet het. Daher denn auch die gewaltige Verminderung der Armenlast: während fünf Jahren um 4000 Franken einzig in der Nachbargemeinde Seedorf; wie dann in Aarberg und Lyß und nähern Landgemeinden!
«In landwirtschaftlicher Hinsicht ist zu sagen, dass sich der Anbau der Zuckerrübe als die geeignetste Kultur im seeländischen Entsumpfungsgebiet erwiesen hat. Erst der Zuckerrübenkultur war es vorbehalten, den bescheidenen Anfängen der Landwirte in diesem Gebiet eine größere Ausdehnung zu geben.»
Diese Hauptgründe, sodann die Erwägung, daß sonst die für eine Million abg’schatzigete n Maschinenteile müeßti zum alten Ịịse n g’heit weerte n, und endlich die Zusicherung der seeländischen Landwirte, wenigstens 1600 Jucharten z’Rüebe n aa nz’setze n, überstimmten die außerordentlich gewichtigen handelspolitischen Bedenken zugunsten des Wiederaufbaus der Fabrik. Nachdem daher Aarberg aufs neue hunderttụụsig Franke n drị n g’schosse n het und im übrigen Seelande Gemeinden wie z. B. Eiß und Möntschemier je drụ̈tụụsig Franke n g’sproche n g’haa n häi n, beschloß am 22. Oktober 1912 der Groo̥ß Ra̦a̦t eine Aktienbeteiliguug von ere n halbe n Mil lion. Damit ermöglichte er den Neubau der Fabrik und deren Weiterbetrieb unter der Kantonalbank. Die Aktiengesellschaft konstituierte sich ungesäumt; und wenn der Leser dies neue Buch in die Hände bekommt, chan n er di neui Fabrigge n als hundertfach verbessereti «zwäüti Ụụflaag» g’chööre n chụtten u nd cheßle n u nd rumplen u nd su̦u̦re n u nd chleefele n, das s er bi de n Máschine n nid sị ns äige nte n Wort verstäit und doch den freundlich erklärenden Direktor fast chịịsterig macht. Besser also, er lasse sich zunächst vo n den äige nten Auge n möglichst viel sagen. 10
222 Hat der Besucher in vorgerückter Rübenerntezeit die Neebe ngläüs des Aarberger Bahnhofs mit den langen Reihen voll beladener Wööge n glücklich umgangen und sich auch durch alle die Fuehrweerch us der Nööchtsḁmi durchgewunden, so sieht er vor dem Fabrikhof zwei unabsehbar lange, mannshohe Wälme n von Rüben aufgetürmt. Jeder Lieferung ist zunächst eine Probe entnommen und g’rapset worden, um auf Grund des vom Sacchariometer festgestellten Zuckergehaltes d’Bụụre n z’zahle n. Eine mächtige Porzion um die andere gelangt zunächst in die Schwemmrinnen und von da in die unterirdischen Wasserrinnen. Ein Hubrad befördert sie i n d’Rüebe nwesch, ein Elevator in die ebenfalls automatische Wa̦a̦g, eine Senkeinrichtung in die Schneidmaschinen. Die aus diesen hervorgehenden feinen Schnitzel werden in der Saftgewinnungsstation diffundiert: mi nimmt ’ne n der Zucker. Der Rohsaft wird, um eine richtige Mischung mit Kalk zu ermöglichen, g’mässe n und im Vorwärmer aa ng’weermt bis zu 85-90°. So wird er in die Trockenscheidung verschickt. Hier gibt man ihm selbst gebrannten Stückkalk ( Chalchstäi n) bei, der sich mit dem feistere n, trüebe n und schlịịmige n Rohsaft zu hellem und dünnflüssigem Saccharat verbindet. Es werden nämlich ein großer Teil Farbstoffe und organische Säuren in Form unlöslicher Kalksalze ausgeschieden, welche hohe landwirtschaftliche Werte besitzen ( S. 217). In der Saturation wird das Saccharat, welches man zuvor noch im Laveur ’putzt het, mit Kohlensäure behandelt. D’Chole nsụ̈ụ̈ri wandelt den Zuckerkalk und den überschüssigen Chalch um in unlöslichen kohlensauren Kalk. Dabei werden auch noch organische Kalksalze ausgefällt und schleimige Niederschläge, die von der Schäidig herrühren, z’Bode n ’zoge n. In der Filtration richtet ma n der Saft dü̦ü̦r ch. Filtriert, wandert er in den Quadruple effet ( «vierfache Verdampfung»), wo er aus etwa 12-prozentigem Dünnsaft zu 60- bis 63-prozentigem Dicksaft ịị ng’chochet wird. Aus dem Vacuum- (luftarmen) Kochapparat gehen jetzt Zuckerkristalle hervor, welche jedoch noch in Syrup schwimmen. Die also gemischte Füllmasse muß daher in Kristallisatoren erchuele n und nachkristallisieren, um alsdann in der Zentrifugenstation des anhaftenden Syrups sich zu entledigen. Der Syrup wird verchochet und als Melasse zu Bundesschnaps ’brönnt. Der frei gewordene Rohrzucker aber wandert in die Raffinerie, welche in der neuen Fabrik mit dem Adantschen Gußwürfelverfahren ausgerüstet ist. Dieses sichert die größtmögliche Ausbeute an Verkaufsware bei vorzüglicher Löslichkeit. (Der Zucker vergäit gern.) Auch kann die Fabrik nun zueg’chạufte n Einwurfzucker neben dem sälber g’machte n 223 verarbeiten, falls er nicht die Bereitung von zuckeretem Viehfutter ( sucrapaille) vorzieht, um damit die Angestellten länger b’halte n. In der Raffinerie durch Gewebe und Knochenkohle der letzten Farbstoffe und löslichen organischen Stoffe entledigt, wird der abermals dünn gewordene, aber nun fast wasserhell g’lụ̈teret Saft neu kristallisiert und als Raffinade-Füllmasse verchochet. Aus dieser geht der Raffinadezucker hervor, um in verschiedene Formen gebracht zu werden. Zunächst als Chrịịde n-(bitze n-) zucker: als Stange n, barres, grosdéchets, welche besonders im Wältsche n die Zuckerstöck ersetzen. Die letztern werden nun aber ebenfalls g’fabriziert. Andere Stangen aber werden aus Platten g’sa̦a̦gt, wenn sie nachher z’Wü̦ü̦rfle n g’schnitte n in den Kleinhandel gelangen. Und zwar gibt es nun noch weit ausgiebiger als vormals zweupfün͜digi, feufpfün͜digi, zeeche npfün͜digi P’häckli und halb- und ganzzäntnerigi (25 und 50 kg schwere) Chistli vo n g’rangschierte n Wü̦ü̦rfle n. Di ung’rangschierte n chöo̥men i n zäntnerig und doppelzäntnerig (50 und 100 kg schwere) Seck. Es wird ferner hergestellt: Raffinade-Pilé ( Stampfzucker oder Bröösmelizucker), Griesraffinade: grobe r und räine r (Grieszucker), Puderzucker ( pouder sugar), Hagelzucker für Zuckerbecke n.
Die neue Fabrik gedenkt i n viere ndzwänz’g Stun͜d 4000 Doppelzentner Rüben zu verarbeiten. Schon die alte hat täglich 3600 Doppelzentner verschaffet und daraus ungefähr 350 Doppelzentner Zucker gewonnen. Das ergab im Jahr 1911 gegen 350 Bahnwööge n voll. Diese nebst den 2800 Waggons zụụchḁg’füehrti Rüebe n, gegen 470 Waggons abg’füehrti Schnitzel nebst all der übrigen Zu- und Abfuhr ( Chalch, Chohle n, Schlagge n) verschaffte den Bahnen einen jährlichen Frachtumsatz von ung’fähr 180,000 Franken.
1
Schmeil, Botanik 244.
2
Walde 88.
3
Kluge 44;
Graff 3, 233,
mhd. WB. 1, 117.
4
Schwz. Id. 6, 1131 f.
5
Lg. 177.
6
Nebst Bern, Burgdorf, Seftigen, Thun:
Stat. 10, 2, 104.
7
Rigierungsrat Dr. Moser an Volksversammlungen zu Aarberg und Ins 1910 und 1911.
8
Z. T. nach dem «Bund».
9
Ebd.
10
Herr Dr. chem. Kitay, Fabrikdirektor, stellte uns gütigst am 4. Nov. 1911 eine eigens geschriebene «Kurze Skizzierung der Zuckerrübenverarbeitung auf Konsumzucker» zu. Gleich freundlich übermittelte uns das Bureau die gedruckten Anweisungen zum Rübenbau. Eine freundliche Kritik des Probedrucks verdanken wir Herrn Nationalrat Zimmermann in Aarberg, dem selbstlos eifrigen Mitförderer der Fabrik.
Noch einmal (vgl. S. 139) versetzen wir uns in Gedanken auf die drittmals erneute Hagnibrügg. Es ist der 18. August 1878. Da wälzt zu unsern Füßen die alte Schlange der Aar ihre Wellen wie Leibesringe dem See entgegen. Ịị ng’engget in den tiefhohlen, schmalen Einschnitt, kann der Drach, welcher ein Jahrtausend lang das Seeland verwüstet hat, nun nicht mehr schaden. Er versuchte dies, bis ihm auch hier der Mäister ’zäigt worden ist, bloß noch, indem er z’Blätze nwiis in die Kanalsohle Löcher ụụsg’frässe n het bis zu 10 m Tiefe. Ferner haben die beinahe 2½ Millionen Kubikmeter Aushubmasse, 224 welche zur Ersparnis von ungefähr so vielen Franken dem eingezwängten Strom wegzuspülen überlassen worden, bi’m aa npụtsche n an die weiche Süßwassermolasse der Einschnittwände diese so ausgiebig ab’g’nagt, daß bis zur Stunde Abgrabungen das rü̦tsche n verhindern müssen. 1
Wie nun, sagten sich bereits die Ersteller des Korrektionswerkes, wenn mit der Vollendung desselben das Ungetüm des Wassers gezwungen würde, seine Riesenkraft in den Dienst des Menschen zu stellen! Fach-Männer fanden, das beinahe 9 m hohe Gefälle des 900 m langen Hagneckeinschnitts könne und müsse zu einem einzigen Überfall i’ n See̥ verwandelt werden, und die damit gewonnene gewaltige Wasserkraft lasse sich industriell verwerten. Männer wie Uhrensteinfabrikant Samuel Laubscher in Täuffelen und Inschinöör Wolf in Nidau wurden zur denkbar geeignetsten Zeit auf die herrliche Kraftquelle aufmerksam. War es doch um das Jahr 1885, wo die Erfindung des Drehstroms erlaubte, gewerblich verwertbare Hochspannungen mittelst des Umformers im Transformatore nhụ̈ụ̈sli in ungefährliche niedrigere umzuwandeln und hundertfach zu verteilen. Welch wunderbare Kunst, tụụsig Roß mit enan͜dere n dür ch n es Schlüsselloch dü̦rḁ z’jage n, u nd de nn no ch dür ch n es chrumms, wenn es söttigi geeb! Denn der Dra̦ht schlụ̈fft dür che nwegg dü̦ü̦rḁ, er kann alle möglichen Krümmungen annehmen. Man versuche dies mit Göppel u nd Riemme n der gebräuchlichen Drescherei! Der Bäcker verbringt sein Motöörli zum Kneten des Teigs i n menen Egge̥lli a n der Di̦i̦li (Zimmerdecke) obe n, und wenn nicht das Ohr ein gemütlich leises schnu̦u̦ rre n wie das der «spinnenden» Katze vernähme n, so glạubti mḁ n, di ganzi Arbäit gang von ĭhm sälber. Aber selbst der Zwäüpfeerter: der zwäüpfẹẹrdig Motor verlangt nicht mehr Raum als ein Stuhl ohne Lehne; und ein Feufpfeerter: ein Motor vo n feuf Pfeerd brụụcht nummḁ d’s halbe n vo n dem, was ein gleich starker Benzin-Gasmotor, verschwịịge n de nn, was e n Dampfmaschine n. Man bedenke auch, wi liecht so n e n Motor ist! Selbst der elektrische Pflug bedarf keiner Fundamentierung seines Antriebs, wie der Witzwiler Dampfpflug ( S. 178) ihn nötig hatte. Darum eignet sich der Motor auch für ganz kurzen Betrieb eines ausgedehnten Geschäftszweiges. Wenn der Landwirt der Zukunft mit der Eläkterizideet sịner Chüeh g’mu̦lche n het, so wird d’Fruchtbrächi, 225 d’Häckerligmaschine n, d’Rüebe nschnätzmaschine n in Bewegung gesetzt. Am Sommermorgen bringt das unsichtbare Heinzelmännchen des 20. Jahrhunderts ihm den Dangelhammer in Schwung, so daß er nu̦mmḁ n brụụcht der Spiegel (die Brille) aa nz’legge n u nd mit dem Seege̥ze nblatt ummḁ n un d anḁz’fahre n — wenn nicht die Hausfrau ihm unversehens die Kraft für d’Nääjmaschine n wegstibitzt, oder für d’s Gletti̦i̦se n.
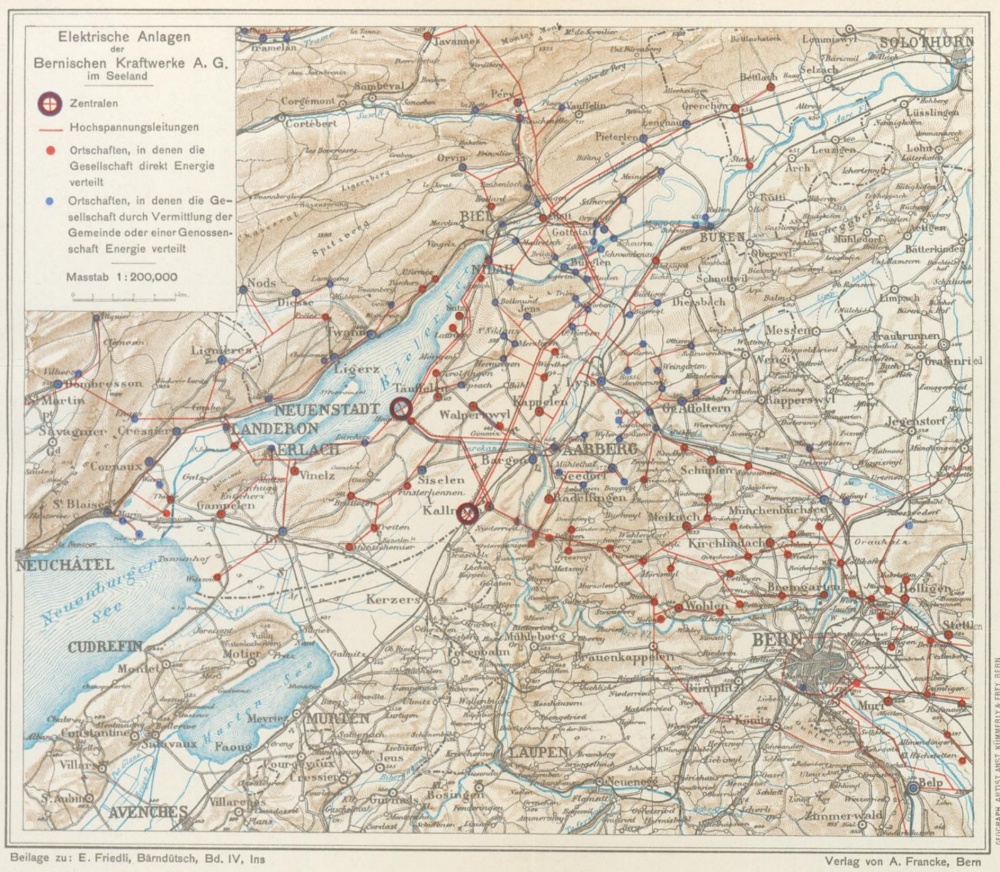
Denn Hand chehrum läßt sich wie d’s eläkterisch Liecht auch die elektrisch vermittelte Kraft umschalten. Und zwar ohne große technische Schulung: dür ch n es nieders Baabi, wo cha nn a n me̥ne n Chnopf drääije n oder uf e̥ne n Chnopf drücke n. Wie leicht läßt sich überhaupt aa nla̦a̦ n: die Kraft auf das eben jetzt gewählte Getriebe «anlassen»! Denn auch bei wechselnder Belastung regelt sich der Strombedarf und damit die Umlaufsgeschwindigkeit von selbst. Die Wartung der Apparats aber beschränkt sich auf das «salbe n», schmiere n (ööle n), der Lager und die richtige Behandlung der Bürste n. Zu all diesen Vorteilen kommt die Reinlichkeit der Handhabung — mi cha nn si’s Motöörli gäng schön sụụfer haa n —, der gänzliche Wegfall der Belästigung durch Rauch und Geruch — es rạuchnet nụ̈ụ̈t u nd schmeckt nụ̈ụ̈t —, sowie aller Feuersgefahr. Wi cha nn mḁ n mit der eläkterische n Chraft schaffen u nd hụụse n!
Diese Vorteile waren bis vor kurzer Zeit den Wenigsten chü̦nds, das isch schó n wahr! Mi cha nn sich o ch gar nid ụụfhalte n druber. Denn wer hätte noch vor einem Vierteljahrhundert ahnen können, welch glänzenden Siegeszug die Elektrizität anzutreten im Begriffe stand!
Glücklicherweise gab es im Seeland doch einige Männer, welche in erfreulichem Maße häi n wị̆t (in Gals: wị̆tem) g’see̥h n. Sie erkannten die Schätze, welche unsere Wasserläufe in sich tragen. Zugleich würdigten sie die Wichtigkeit der neuen elektrotechnischen Errungenschaften für das Gemeinwesen; u nd si sị n uf der Stell drụf choo̥ n, daß die so erfolgreich erschlossenen Naturkräfte von vornherein, ohne daß auch hier zuerst fremde Spekulation d’Nịịdlen oben ab nehm, in den Dienst und unter den Einfluß des Gemeinwesens gestellt werden sollten.
Der Träger dieser hohen Idee war Eduard Will. Erst zu Nidau und dann in dem größern Biel lebte bis zu seiner Übersiedelung nach Bern, der als Handelsmann (Besitzer eines Iselade n), als Kriegsmann ( Oberist), und als Politiker (bernischer Groo̥ßra̦a̦t und schweizerischer Nazionalra̦a̦t) gleich tüchtige und geachtete Mann. Seit dem Jahr 1890 stand er an der Spitze der Bewegung, welche die an Tragweite so reichen Naturschätze der wị̆ße n Chohle n voll und ganz 226 in den Dienst des Volkes zu stellen trachtete. Nachdem der Staat es abgelehnt hatte, das Werk in Hagneck zu bauen, wußte Oberst Will die nächst gelegenen Gemeinden dafür zu interessieren. Äi n G’mäin na̦ ch der an͜dere n het si ch zụhḁg’la̦a̦ n. Zuerst Nidau und Täüffele n-Gerlafinge n (am 9. April 1890). In kurzem folgten Hagneck (3. Mai) und Biel (19. Juli), Erlḁch (8. Mai 1891) und Neue nstadt (25. Mai). Die genannten Gemeinden verlangten die Konzession und erlangten sie am 30. Mai 1896. Damit erhielten ihre und ihrer Vertreter Bestrebungen eine feste Grundlage.
Indes zeigte sich bald, daß die Kraft dieser zumeist doch chlịịne n G’mäinli ( S. 183) nid g’längt het, den Plan durchzuführen. Es mußte Hilfe bei der Privatindustrie gesucht werden. Nach Verhandlungen mit Finanzleuten und Technikern im In- und Ausland, nach Wechselfällen und Enttäuschungen aller Art, wie sie nur zur jugendlichen Leidensgeschichte der gemeinnützigsten Werke gehören können, kam im Jahr 1896 ein für das Unternehmen gedeihlicher Vertrag zustande. Die Gesellschaft «Motor» in Baden baute das Werk.
Das endliche Gelingen war aber mit gewaltigen Änderige n der Pläne verbunden. Statt der vorgesehenen 1000 sollten nun sofort 5-6000 Pferdekräfte erzielt werden. Das Gemeindeunternehmen wurde zum Eigentum einer Privatgesellschaft: der A.-G. Elektrizitätswerk Hagneck. Dieses wurde 1900 eröffnet.
Immerhin war der Gedanke, daß es ein öffentliches Werk sein sollte, nicht begraben. Die Gemeinden waren an ihm beteiligt geblieben. Und wenn ihr Einfluß auch gering war: er bestand zu Recht. Er war ein Samenkorn, das seiner Entwicklung harrte.
Die kam. Und zwar über Erwarten rasch — schier gar wie die Wirkungen der elektrischen Kraft selber, welche mit bisher nie gesehener, unerchannter Flinggi arbeitet. Bereits 1903 verband sich das Hagneckwerk mit dem Elektrizitätswerk an der Kander zu einer einzigen Gesellschaft: den Kander- und Hagneckwerken. Zugleich wurde das neue Unternehmen tatsächlich in den Besitz der Öffentlichkeit übergeführt, indem der Staat Bern die Mehrzahl der Aktien und damit den entscheidenden Einfluß erwarb. Neue Werke schlossen sich an: im Oberland an der obern Kander, im Jura am Doubs, im Seeland zu Challnḁch. Die Gesellschaft der Bernischen Kraftwerke, wie sie hü̦t zu m Daag heißt, ist nunmehr weitaus das größte Unternehmen seiner Art im Kanton Bern, ja, wị̆t dru̦ber ụụs.
An seiner Spitze steht als Diräkter Eduard Will. Für ihn und seine Mitarbeiter ist die gewaltige Entwicklung des Werkes zugleich 227 ein selten glücklicher fachlicher Erfolg und die beste persönliche Genugtuung für die langen Jahre zäaijer Arbeit mit ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, mit ihrem Gelingen und ihren Rückschlägen, mit ihrem Kampfe gegen Widerstände aller Art: von höherer Gewalt bis hinunter zu Menschenunverstand und Menschenbosheit. Die hinter dem Hauptkämpfer und seinen Streitgenossen stehenden Seeländer G’mäine n aber haben sich mit ihrer Tätigkeit ebenfalls Verdienste erworben, deren wahre Bedeutung spätere Zeiten noch viel besser werden würdigen können als unser heutiges Geschlecht. 2

|
|
Oberst Eduard Will |
Im Jahr 1913 gelangte nach Überwindung außerordentlicher Schwierigkeiten das oben erwähnte Challnḁchweerk an der Broyetalbahn zur Vollendung und zum Anschluß an das nunmehr vierknotige Netz der bernischen Kraftwerke.
Das Kallnachwerk ist für die Erzeugung einer Chraft von fü̦̆fzeche n tụụsig Pferd eingerichtet. Die hierzu nötigen sechs Maschineneinheiten, bestehend aus je einer Turbine, einem Generator, Rotor und Stator, beziehen ihr Nettogefälle von 19,55 bis 20,35 m aus dem Aare nchnäü zwischen der Saanemündung und den St. Verenamatten bei Niederried. Der 2078 m lange Zuleitungstunnel (Tu̦nä̆ll) leitet das in überaus großartigen Réserwaar und Stauwehr-Anlagen gesammelte und ii ng’engget Wasser un͜der dem Weierholz des Kallnachwaldes düür ch nach der Zentrale. Das Wehr mit dem Fischpaß, der die durchwandernden Fisch zum gumpe n von Stufe zu Stufe veranlaßt, sowie der Floßgasse zum Durchlaß der zerlegten Flööß dient zugleich als Brügg zu dem von den Kraftwerken angelegten Straßenstück, welches Oltige n samt Umgebung mit dem westlichen Aarufer verbindet. So findet die Stätte des einstigen Grafenschlosses (s. «Twann»), welches sich bisher bloß durch ein primitives Fahr mit der Umwelt verbunden sah, wenigstens zum Teil seine frühere Bedeutung wieder. — Das Wasser wird, nachdem es seine treibende Kraft im Maschinenhaus abgegeben, 228 durch den elektrisch ausgebaggerten Unterwasserkanal nahe der Walpertswilbrügg dem Hagneckkanal zugeführt.
So haben gegen tausend Regiearbeiter unter acht I̦nschi̦nööre n ein Werk erstellt, das seine annähernd nụ̈ụ̈n Mi llione n Choste n in nicht zu ferner Zeit wird ummḁ ’zahlt haa n. Ein Werk zudem, dessen Ersteller jener Mahnung einer forschen Inserin in vollem Maße nachgelebt haben: Mach, daß de̥ de nn seege n taarfsch, du̦u̦ häigisch e̥s g’macht!
Der Zweck unseres mundartkundlichen Buches erlaubt uns in keiner Weise, auf die Einrichtung dieses überwältigend großartigen Werkes näher einzutreten. Leider! möchten wir beifügen, wenn nicht hier wie nirgends die natürliche Kluft gähnte zwischen den erstaunlich wachsenden Errungenschaften der modernen Technik und dem schwindenden Sprachschatz echt mundartlichen Charakters. 3
Die schwierigsten (und auch verdrußreichsten) Partien des Kallnachwerks: die Grundlegung des Stauwehrs, bekommt übrigens auch der Techniker nicht zu sehen: die liegt viele Meter tief un͜der dem Bode n.
Zu den sechs Strahlen, welche bereits das Hagneckwerk in das Seeland und seine Umgebung ausgesandt hat, gehörte als zweiter die Leitung nach Aarberg und Lyß, Büren, Schüpfen, Niederried und Kallnach, Sisele n, Müntschemier, Treite n, Brüttele n und Eiß. Die Dröht von 7 mm Durchmesser werden getragen von den mit Chupfervideriol imprägnierten Holzstangen. Diesen sitzen die porßelaanige n Chachcheli («Tassen») als Isolatoren auf, in der Nähe der Umformer zudem die Hörner oder Geebe̥lli als Blitzableiter. Einerseits mit der Kraftleitung verbunden, anderseits durch die Erdung, die Anerdung oder das Erden 4 eine gefährliche Spannung auf den elektrischen Zustand der Erde zurückversetzend, sichern diese «Gäbelchen» noch eine Spannung von 20,000 Volt.
So konnte z. B. Eiß Licht von 8550 Cheerze n, 30 Pferdekräfte und daneben noch fünf PS. Fabrigge nchraft beziehen, wobei drei Motoren für die Kilowattstunde bezahlen.
Direkte Abnehmer vo n Liecht u nd Chraft hatte das Hagneckwerk 1910 in 136 Ortschaften, in welchen noch keine galvanischen Dauerelemente von Leitungsnetz oder Blockstation unabhängig machten. Das Werk 229 zieht jene Abnehmer mehr und mehr den 47 andern vor, welche damals die Zuleitung durch Vermittlung von Genossenschaften oder Gemeindsbehörden bezogen, weil diese dabei gern vöörtele n (Vorteile erhaschen). Zehller kontrolieren nunmehr den Verbrauch der (nur bei Tageshelle verbrauchten) Tageskraft, der ängle̥fstündige n und der permanenten Kraft.
So stiegen die Einnahmen in den Jahren 1904 bis 1910 von 844,500 auf 2,000,531 Franken. 5
Dabei legte das Werk behufs fast gänzlicher Ausnützung der von ihm erzeugten Kraft im Herbst 1899 zu Nidau eine elektrothermische Fabrik an und beschäftigte darin gegen 40 Arbeiter. Sie verlegte sich zunächst auf die Erzeugung des 1892 entdeckten Calciumkarbid ( Karbid), welches, Wasser zersetzend, das herrlich leuchtende Azetileenliecht abgibt. Gemeinde-Anlagen wie die zu Lạupe n bezeugen die Vortrefflichkeit dieser Beleuchtungsart, an welcher nur die Explosionsgefahr bei unvorsichtiger Behandlung 6 d’Lụ̈t so schröckelig erchlü̦pft het. Leider muß seit 1905 wegen ungünstiger Marktlage diese Fabrikation eingestellt bleiben, bis der Weg gefunden ist, in vorteilhafter Weise aus Acetylen Ammoniak und Alkohol zu gewinnen 7 und damit in giechtig gewordenen Haushaltsfragen (man denke an Holz, Hördöpfel, Mĕrchchoorn) ein entscheidendes Wort mitzusprechen. In der Metallindustrie hinwieder kann die dem Weltmarkt erlegene Erzeugung von Ferrosilicium 8 für Staachel (Stahl) auf neue Wege leiten. Einstweilen können Siliziumkarbide die neuesten Apparate liefern für eläkterisch z’choche n.
Vorderhand jedoch beschränken sich die bernischen Kraftwerke auf Abgabe von Licht und Kraft. Aber wie vielgestaltig!
Im Jahr 1910 hatten die Burgdorf-Thun-, die Bern-Worb-, die Niesenbahn, die Lötschbergbahn, sowie die Tram der Stadt Bern und Nidau-Biel-Bözinge n-Mett ihren Anschluß an die bernischen Kraftwerke. Nur d’s Mu̦u̦rte nbähnli (die Frịịbe̥rg-Murten-Ins-Bahn) bezieht begreiflich seine Kraft aus Hauterive. Dagegen werden die Bahnen Biel-Täuffelen-Ins und Biel-Bụ̈ụ̈re n von Hagneck oder Kallnach aus gespeist werden.
Die erstere Zentrale versieht seit einem Jahrzehnt das Amt Erlach mit bedeutender Kraft für Industrie und Bụụrerei. Nachdem wir die zwei Uhre nstäi nfabrigge n und die Ziegelei in Erlach, Martis 230 Mühli in Brüttele n und die neuen Einrichtungen in Vinelz und Gampelen erwähnt, beschränken wir uns auf die Kraftanlagen der Dorfschaft Eiß. Schon die Einnahmen von 3547 bis 7239 Franken, welche innert der Jahre 1904 bis 1910 aus Ins dem Werk zuflossen, 9 veranschaulichen uns den Aufschwung, welchen die Eläkterizideet gerade auch in einem Bụụre ndorf gewinnen kann. Nehmen wir dazu, daß Ins nebenbei Weinbau treibt, in welchem man e n söttigi neui Chraft gar nụ̈ụ̈t cha nn brụụche n, weder öppḁ n e n chläi n für z’zünte n (zu leuchten).
Der Hauptverbrauch der nach Ins gelieferten und S. 228 detaillierten Pfeerd entfällt mit 20 PS. auf die 1900 gegründete Säge- und Dreschgenossenschaft Ins, welche in ihrem Gebäude an der Brüttelenstraße im Winter tröschet (s̆s̆) un d im Summer sa̦a̦gt, wohl auch beides miteinander betreibt. Die stationäre Dreschmaschine, welche in e̥re n Stund e̥s Fueder Garbe n (etwa 200 solcher) dröschet, sortiert, butzt u nd bin͜dt, im Tag also 2000 Garben bewältigt, brụụcht acht Pfeerd. Zwölf Pferdestärken verlangt die Sa̦a̦gi, wenn sie mit ihrem Vollgatter von 12 Sägeblättern mit einem Mal 12 Lade n von 3 cm Dicke und 9 m Länge liefert und zu einem solchen Gang eine Halbstunde bis drei Viertelstunden Zeit braucht. Wenigstens gleich viel Kraft beansprucht mit ihrer Umdrehungszahl die Frĕse n ( fraise, Scheibensäge), wenn sie in weite Runde ihr Gekreisch und Geheul entsendet.
Feufpferdig Motore n brauchen die Guggersche Fabrik landwirtschaftlicher Feldgeräte ( Räche nmacherei), die mechanische Schreinerei Schwab, die Baugeschäfte Hunziker und Dü̦̆scher (s̆s̆). (Statt des gut mundartlichen Tischmacher sagt man neulich schuldeutsch Schreiner. Natürlich hat man andern Mundarten auch Schrịịner und Schrịịnerei entlehnt.)
Mit einer Kraft von 3,6 PS. treibt der Huf-, Wagen- und Pflug- Schmi̦i̦d Sahli seine Bohrmaschine, Schmirgelscheibe und Brennholzfraise. Zum anke n, Chees rüehre n, holze n, zäntriffugiere n braucht die Eißer Chĕserei (s. u.) 2,7 PS.
Daß der Blooschbalt (Bla̦a̦sbalg) der Kirchenorgel zu Eiß elektrisch getrieben wird, verstäit si ch schier gar von ĭhm sälber.
Nicht so sehr ist dies der Fall in den Räumen, wo irdisches Brot gespendet wird. Und doch sind nur so minime Kräfte erforderlich für die mit Motoren betriebenen Knetereien zu Ins und zu Witzwil. Eine 231 solche Chnättmaschi̦i̦ne n verarbeitet 130 kg Mehl in 15 Minuten zu einem Teig, der vill fịịner ausfällt als der mühsam vo n Han͜d geknetete. Ja, zeeche n Minute n weeri läng gnue g (erklärt der Beck Hiltpold), we nn mḁ n nit zwüschen ịchḁ der Däig müeßt la̦ n rue̥ije n, für das s e̥r e n chläi n zue n ihm sälber chöo̥m.

Studie von Anker
In weitgehendem Maße findet die Elektrizität Anwendung in der Strafanstalt Witzwil. Als Lichtquelle erlaubt sie eine bessere Ausnützung der Arbeitsstunden im Winter, wo je nach Bedarf i n de n Schöpf, auf den Höfen und Holzplätzen herum an hingeleitetem Dra̦a̦t d’Lampe n chönnen uufg’hänkt werte n. Den Gefangenen bedeutet sie gleichzeitig eine unschätzbare Wohltäterin, indem nun ihre Zellen beleuchtet werden können. Wie bald ist gleichzeitig für diese alle aa ndrääit und abdrääit!
Drei Motoren zu 3½, 3½ und 8½ PS. liefern die Kraft der Schmitte n und Schlosserei, der Holzbearbeitungsmaschinen, der 1912/13 errichteten Dampfchĕserei ( S. 195) und der Molkerei, der verbesserten Bäckerei und Wäscherei. Sie treiben d’Wasserpumpe n und d’Mühlli, d’Häckerligmaschine n, den Dangelhammer usw. Wie die Installationen alle von technisch geschulten Gefangenen unter Leitung und Aufsicht sachkundiger Angestellter errichtet wurden, so sind es auch wieder Gefangene, welche die Maschinen bedienen 232 und benutzen. Vom Räche nzan͜d bis zum sinnreich ausgedachten Aktenschranke, von der einfachen Strụụbe n bis zum ịịsige n Drääibank, vom Häckerlighälmli bis zum fürstlichen Zäntriffụụgenanke n wird durch sie ungefähr alles hergestellt, wessen ein Landwirtschaft, Gewerbe und Handel einheitlich umfassender Anstaltsbetrieb bedarf. So können die Gefangenen gleichzeitig zu ihrem eigenen Besten wie zum Gedeihen der Anstalt ihre Kenntnisse und Fähigkeiten betätigen und erweitern. 10
Rächt e n tụụ̈ri G’schicht ist bis heute die elektrische Weermi, da sie für praktischen Gebrauch eine große Stromkraft erfordert. Bei aller Tụ̈ụ̈ri ist sie aber besser ausnutzbar als die durch fụ̈ụ̈re n erzeugte Wärme. Die bernischen Kraftwerke lieferten denn auch im Jahre 1910 1527 Glettịịse n (Bügeleisen) im Kraftbetrag von 554 Kilowatt, sowie 146 Heizapparate (125 KW), dagegen noch keine Vorrichtungen für z’choche n, z’lööte n, z’schmelze n. Eläkterisch z’brüete n isch scho n öpperem z’Sinn choo̥ n, hauptsächlich wegen der leichten und genauen Regulierbarkeit der elektrischen Brutapparate. In der Kettenfabrik «Union» zu Mett werden große und kleine Ketten ( Chöttine n) elektrisch g’schwäizt (geschweißt). 11 Bloß Mathematiker dagegen werden auch in Zukunft eläkterisch rächne n, 12 wogegen der große Landwirt der kommenden Tage eläkterisch — b’schü̦ttet. 13
Nur eine Art der Wärme: die leuchtende, also zum warmen Licht gesteigerte, erfreute sich von Anfang an einer ungemein starken Nachfrage. Diese stieg zwischen den Jahren 1900 und 1910 von 6070 auf 120,470 Glühlampen ( Lämpli), wozu im letztern Jahr 134 Bogenlampen traten. 61,561 Glühlampen brannten noch mit Kohlenfaden (aus gemahlenem Retortengraphit), 64,803 mit Metallfaden. Den letztern ersetzt nunmehr, zumal seit es sich zu festem gezogenem Draht verarbeiten läßt, das Osram (d. h. eine Verbindung der Elemente Os-mium und Wolf-ram). Damit ist ein sogenanntes eläkterisches Liecht geschaffen, welches dem Sunne nliecht nahe kommt und dabei vill hụụsliger (sparsamer) brönnt als jedes andere Liecht. Die Kohlenfadenlampe verbraucht für eine Cheerze n 14 3,5 bis 4,5 Watt, die Osramlampe 233 1,0 bis 1,5 Watt. Die Kraftwerke liefern daher bloß noch letztere und geben die Bi̦i̦re n unter dem Selbkostenpreis ab, um die Verbreitung der Lichtanschlüsse und das hụụse n im Verbrauch in Einklang zu bringen.
So leistet das warme Licht die vorzüglichsten Dienste, bis einst das dem Schịịngueg (Johanniswürmchen) und dem Schịịnholz (des Tannwurzelpilzes) abgelernte, wirklich elektrische Kaltlicht alles zu Erleuchtende in sein Strahlenmeer taucht.
Ein elektrotechnisch so belebter Ort wie Ins dankt sein früh erwachtes Interesse für die belangreichste aller Erfindungen der Anregung, welche schon 1875 der Téligraaf und dann 1893 der Téliffoon (halb «französisch» Téleffong) gebracht hatte. Steht die Schweiz im Telephonwesen in der vordersten Linie (sie zählte 1910: 46,670,000 Lokalgespräche), so hat auch ein Ort wie Ins großen Anteil daran. Die 1910 geschaffene öffentliche Sprechstation des Netzes zählt 1913: 61 Abonnenten, im Dorf 27; ferner 17 Verbindungen mit Erlḁch, 5 mit Gampele n, 3 mit Brüttele n, 3 mit Müntschemier und je eine mit Feisterhénne n, Treite n, Vine̥lz, Lüsche̥rz, Witzwil. Einige der ältern Verbindungen 15 lassen noch immer das lästige Knackgeränsch ( chräschle n u nd chlöpferle n) hören. Auch litten sie stark an Induktion, bis 1911 die lokalen Leitungen im Bereich des Dorfes un͜derirdisch gelegt wurden. Seit dem Mai 1913 cha nn ma n z’Eiß (die Abonnenten) eläkterisch ụụflụ̈te n oder ihnen elektrisch aa nlụ̈te n. Ins gelangt übrigens zu internationaler Bedeutung, indem die telephonische Leitung Berlin-Basel-Mailand auch über diesen Ort und durch das Moos ( dem Hauptkanal na̦a̦ ch) führt. Teliffoniert wurde im Juni 1908 zu Ins 2653, im Juni 1913: 4917 mal; teligrafiert: im Juni 1908: 109, im Juni 1913: 97, im Juni 1912: 128, im Mai 1912: 140 mal.
Bis die «Drahtlose» auch im Fernsprechen Einzug hält, wird die Erfindung des deutschen Lehrers Philipp Reis (1834-74) und des Angloamerikaners Bell zusammen mit dem Telegraph noch manches Mal die 16 Drähte in Anspruch nehmen, welche an neuem Gestäng die Brüttele nstra̦a̦ß begleiten. In Hagneck aber die mächtigen Starkstromleitungen kreuzend, erinnern jene an die folgenschwerste Kulturerrungenschaft, welche mit dem zehmme n der einst so verheerenden Naturmächte die Juragewässerkorrektion gebracht hat.
Auf dem will’s Gott nicht verdenkmälerten Helvetiaplatz in Bern hätte also statt des herrlichen Netzerschen Zeus, dem der Konkurrenzsieg 234 gebührte, auch Neptun mit seinem sieghaft über den Wassern geschwungenen Dreizack Blitze werfen können. 16 Der Seeländer aber sieht jedes Denkmal sich ersetzt durch das Natur- und Kunstgebilde selber, welches er mit einem Blick aus Bergeshöhe überschauen kann. Da breitet sich vor ihm das Moos mit seiner dreißigjährigen Eroberungsgeschichte. Geistesblitze trieben die äffenden Irrlichter aus ihrem unheimlichen Versteck; und wo dessen Sümpfe Krankheit und Tod ausschickten, spenden sie nun als segensreiche Fluren Gedeihen und Wohlstand.
1
Bericht über die Vorstudien des Elektrizitätswerkes Hagneck (Biel, 1899) samt den Jahresberichten desselben, dem «Führer» von 1906 und den Statuten der bernischen Kraftwerke von 1909 uns freundlichst anvertraut von
Oberst Eduard Will, Direktor der bernischen Kraftwerke.
2
Regierungsrat Karl Scheurer.
3
Wir legen den mißlungenen Versuch einer für unser Buch passenden Beschreibung des Kallnachwerkes mit um so mehr Bedauern bei Seite, je größer (am 16. Oktober 1912) das staunende Interesse war, mit welchem die anschaulichen Belehrungen der Herren Direktor Oberst Eduard Will und Oberingenieur
Schafir vom Kommissionspräsidenten Sterchi und vom Bearbeiter des «Bärndütsch», sowie von Herrn Prof. Dr. Geiser, Vorsteher des bernischen Wasserrechtsbureaus. eutgegengenommen wurden.
4
Rinkel 290.
5
Die schöne Stetigkeit der Zahlen 844,500, 969,000. 1,098,000, 1,322,641, 1,584,000, 1,784,000, 2,000,531, 2,250,000 (für 1911 veranschlagt) ist bemerkenswert.
6
Zumal bei Berührung mit Kupfer.
7
Wilke 425.
8
Gußeisen mit Kieselstoff.
9
Man bemerke auch hier die schöne Stetigkeit des Anwachsens: 3547, 4465, 4706, 5729, 5953, 6494, 7239 Franken.
10
Nach Herrn Direktor Kellerhals, dem wir auch die außerordentlich lehrreiche Führung durch das Industriegebäude verdanken.
11
Eine der persönlichen Mitteilungen des Herrn Direktor Will, dem wir auch die sachliche Schlußdurchsicht dieses Abschnitts verdanken.
12
Indem der Apparat von Russel und Wright ihnen gleichartig gebaute Gleichungen auch höherer Grade elektrisch-mechanisch zu lösen gestaltet. (Nach der «Weltchronik».)
13
Installation Schweizer in Cham: Bauernstube 1913, 32.
14
Will sagen: Die Hefnersche Normalkerze oder Hefnerkerze (HK): eine 40 mm hohe Flamme aus Amylacetat an einem Docht von 8 mm Durchmesser. (Vgl. Wilke 135; Rinkel 437.)
15
Welche noch nicht die Glimmer- gegen die Eisenmembran des Hörers getauscht haben.
16
Wie Neptun und Poseidon, trägt auch Siva den Dreizack als Symbol des Wolken zerreißenden Blitzes.
WuS 1, 83.
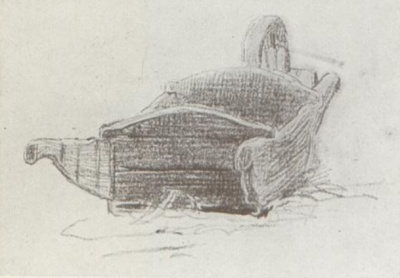
Studie von Anker