
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Nirgends fand ich mich aber tiefer in meinem Innersten gerührt, als in der katholischen Kirche, wo die größte, erhebendste Musik noch zu den andern Künsten tritt, das Herz gewaltsam zu bewegen. Ach, Wilhelmine, unser Gottesdienst ist keiner. Er spricht nur zu dem kalten Verstande, aber zu allen Sinnen ein katholisches Fest. Mitten vor dem Altar, an seinen untersten Stufen, knieete jedesmal ganz isolirt von den Andern, ein gemeiner Mensch, das Haupt auf die höheren Stufen gebückt, betend mit Inbrunst. Ihn quälte kein Zweifel, er glaubt. – Ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht, mich neben ihn niederzuwerfen, und zu weinen. – Ach, nur einen Tropfen Vergessenheit, und mit Wollust würde ich katholisch werden …
Heinrich v. Kleist an seine Braut Wilhelmine v. Zenge, 21. Mai 1801.
Von den Bildern Bruckners ist gut das aus dem März 1885 stammende Münchener Lichtbild Hanfstängls, besser noch das spätere Wiener Bild von Huber mit dem nach links schauenden imperatorischen Gewalthaupt. Das Ölbild von Buche scheint eher einen Gutsbesitzer oder Regierungsrat darzustellen; dagegen gibt die Tilgnersche Büste etwas von Bruckners Kraft und Kampf. Für einen Maler war der Kopf wie geschaffen, und Fritz von Uhde soll ihn als Modell eines Apostels auf einem seiner Christusgemälde genommen haben.

Viktor Tilgner
Der Komponist Anton Bruckner.
Quelle: commons.wikimedia.org
Anton Bruckner bot nicht das Bild eines Künstlers, wie es Zeit und Herkommen dachten. Keine Stehkragen-Physiognomie, auch nicht der wallende Herbeck-Typus oder der Vormärz-Schumann. Keiner der Hauptzüge Johann Christophs würde auf ihn passen. Ein Greis, feierlich wandelnd, in Schuhen, die aus Sankt Florian kamen, in altväterischer Tracht, die der Schneider von Sankt Florian aus schwarzem Bauernloden baute und nach Wien schickte. Die Kleider mußten weit und geräumig sein, ein großes farbiges Sacktuch und die Schnupftabak-Dose gehörten dazu. Es kam vor, daß er diese Dose bei Besuchen auch Damen anbot. Für die Leute der Jours ein unmöglicher Mensch …
Er besaß auch nicht Rede. Sein Wort ist unbeholfen, seine Mundart, namentlich im Affekt, dörperhaft. Es fehlt nicht an Blitzen, die aus dem Gewöhnlichen leuchten. Es mag sein, daß er bei öffentlichem Freuden-Anlaß, im Kreis seiner »Gaudeamuser« etwa, von Wortglück begleitet war. Im Umgang steigt sein Ausdruck nicht hoch.
Auch seine Briefe sagen nichts. Sie schreiben Respektworte mit lateinischen Buchstaben. Genau wie jene Urkunde der Ansfeldner Bauern, die ihn zum Ehrenbürger ernennen. Wo von Gott die Rede ist, stellen sich große Anfangsbuchstaben ein (»Er«, »Seine Gnade«), die Hand kann gar nicht anders, sie meldet eine Ehrfurchtsnatur. Selten enthalten diese Briefe anderes als allgemeine Redewendungen. Sie sind langsam geschrieben, nach einigem Nachdenken, niemals hingewühlt, das Musikalische ist meist Aufführungskritik. Sie rücken an den Angeredeten, wenn er Schüler war, mit dichter Vertraulichkeit heran und schauen ihm in die Augen; aber der ehemalige »Hallawachl« hat es zu etwas gebracht, er wurde »edler Hofkapellmeister« – und der alte Bruckner will den Respekt nicht vergessen, also rückt er wieder in Distanz. Der schöne Überschwang des Künstlers erscheint in diesen Briefen, Dankbarkeit wird zur Verklärungssucht, die Plötzlichkeit der Begeisterungsgewalt bricht durch, auf einmal wird ein »Hoch!« gerufen, das »Genie« des Adressaten gepriesen: Jubellaute und Aufschwungsgebärden. Man möchte sagen: die »Hoch!« sind die Quartsextakkorde des Briefschreibers. – Wie viel sagen doch diese Briefe!
Einmal wendet er sich an seinen Freund Bayer in Stadt Steyr, der die d-Messe aufführte: »… wer hat denn in der Steyrer Zeitung vom 6. April den Orgelpunkt des Brahmsschen Requiems hineingebracht? Ich bin kein Orgelpunkt-Puffer und gebe gar nichts drum. Contrapunkt ist nicht Genialität sondern nur Mittel zum Zweck. Hat mir viele Freude verdorben …« Das will heißen: ich diene nur Gott und spreche mit ihm in den höchsten Formen; aber ohne mein Sprechen sind die Formen wertlos, die höchsten Künste kunstlos. Wer mich mit Formalmusikern vergleicht, hat mich nicht verstanden.
Bruckners Briefe haben keinen »Zug« wie die Wolfs, aber ein Gesicht. Sie tragen Stil, insofern sie ganz unverstellt, ganz unliterarisch, ganz echt sind, Urkunden der innern Wirklichkeit. Bruckners Briefe bedeuten für den Biographen keine Entdeckungen: man kann Daten feststellen, Einzelheiten erfahren – daß Liszt ihn gelobt, Wagner ihn eingeladen habe –, aber nicht mehr. Und doch steht der ganze Bruckner in diesen Briefen: Wenn man sie außerdem im Zusammenhalt mit seiner Musik denkt, erkennt man an der gleichen Gebärde die wunderbaren Zeugnisse eines Sprachlosen.
Einer jungen Linzerin, die ihm gefällt, schickt er als Zeichen seiner Verehrung ein Gebetbuch. Sie warf es über die Stiege. Mit Gebetbüchern kann man Frauen nicht erobern. Aber in den Mannesjahren loht in ihm die Flamme sinnlicher Naturkraft stärker als man glaubt, die ruhig brennende Kirchenkerze wird von heftigen Windstößen bewegt. Frauenerscheinungen bestricken, Wonne und Süße des Weibes durchbeben den Riesen beim ersten Anblick, er empfindet vor diesen Symbolen der Weltschönheit oft »andachtsvolle Scheu«, vielleicht auch den Schmerz des Entsagenmüssenden oder den des Getäuschten, der da heimlich doch gehofft hatte – und Frau Kathi, die alte Wirtschafterin, empfängt dann den Befehl, die Ungetreue, die hinterrücks heiratete, nicht mehr einzulassen. Es dauert freilich nie lange. Er ahnt, als Berufener, Energieverlust und Zersplitterungsgefahr. Ernste Beziehungen zu Frauen, geistige Einflüsse von Frauen gibt es in diesem Leben nicht. Sein Los war das tragische des Ungeliebten. Sie haben ihn »nicht ernst« genommen, gaben ihm nicht von ihrem weichen Wort, ihrem Trost, ihrer wunderbaren Fähigkeit, Anteil zu nehmen, legten nie den Arm um seinen Nacken. Die einzige Frau, an der er hing und die an ihm hing, war seine Mutter. In seinem Leben steht nicht Vittoria Colonna, nicht Minna, Mathilde oder Cosima, seine Kunst besingt nicht Diotima, nicht Clara – er ist fraueneinsam, darum vielleicht der Einsamste, den es gab; denn ist nicht jedes Künstlers tiefster Traum das Ausruhen bei einer Frau? Darf man aus seiner resignierten Haltung, wenn er manchmal am Schultisch saß, das schwere Haupt stumm in der Hand, Schlüsse ziehen, daß Hanslicks »Sekkaturen« sein Leben nur deshalb verbitterten, weil keine Frauenzärtlichkeit die schwirrenden Hummeln von seinem Antlitz jagte? Aber was sagte den Frauen seine feierliche Welt der Frömmigkeiten, die kein Fiebersturm durchschauerte, kein Nervenstrom durchzuckte? Sie kämpften nicht für ihn. Er blieb allein, hat Aphrodite nie umschlungen.
So hat er auch nicht an Frauen jenes tiefste Leid erfahren, das der künstlerische Mann erleiden kann, den Schmerz, mit dem Wagner Minna geliebt hat, den Hebbel erlebt hatte, da er das Wort vom Nichtdrüber-Hinwegkönnen fand, und daher auch nicht die Segnung solchen Schmerzes, der im Gestalten überwindet, heiße die Gestalt Maria Magdalena oder Elisabeth.
Die Leidenschaft jedoch »ist genialen Naturen Notwendigkeit. Selbst die keuschesten, Beethoven, Bruckner, müssen immer lieben. Alle menschlichen Kräfte sind bei ihnen gesteigert; und da bei ihnen die Kräfte im, Bann der Einbildungskraft stehen, so ist ihr Gehirn die Beute beständiger Leidenschaften. Meistens sind es nur vorübergehende Flammen; die eine zerstört die andere, und alle werden durch die große Feuersbrunst des schöpferischen Geistes aufgezehrt. Aber, sobald die Glut der Schmiede die Seele nicht mehr erfüllt, ist sie wehrlos den Leidenschaften ausgeliefert, die sie nicht entbehren kann, sie verlangt sie, sie schafft sie; sie muß von ihnen verzehrt werden …« (Romain Rolland, Johann Christoph am Ziel, S. 371.)
Mit dem »großen Kind« ist also eine Natur wie die Bruckners nicht abgetan. Allmählich klangen die erotischen Wellen ab, nicht allein des Alterns wegen: er blieb einer der großen Unbeweibten, und das bekannte Wort des Junggesellen Brahms müßte man bei seinem Antipoden in die Umkehrung bringen: »Lieber eine Oper schreiben, als heiraten!« Als Kitzler in Wien seine primitive Häuslichkeit und die geniale Unordnung sah und ihn befragte, warum er denn nicht heirate, fertigte ihn Bruckner ganz entsetzt ab: »Lieber Freund, ich hab' ja keine Zeit, ich muß jetzt meine Vierte komponiren!« Der Musik allein gehört Gedanke, Herz, Gefühl. Musikmachen ist Sichdarbringen, dem Herrn dienen. Musik ist Schicksal, Weihe und Entsagung. An zehn oder mehr Stellen seiner Wohnungen, sowohl in der Heßgasse 7, wie später im Kustoden-Trakt des Belvederes lag Notenpapier, Bleistift und Radiergummi: alles war vorbereitet, den Einfall zu empfangen. Die Phantasie, nicht einschläferbar, weckte ihn aus dem Schlafe, oft fuhr er nachts aus dem Bett, um zu notieren.
Wagners Tannhäusermusik wirkt entfachend auf ihn: wie die Erscheinung der Teufelinne in der Klosterzelle. Sie hätte es nicht vermocht, wäre er reiner Asket gewesen, hätte er Anfechtungen nicht gekannt, oder durch Kasteien verjagt. Er verstand die Flamme, der eine andere aus den inneren Klüften entgegenschlug. Und hiermit war der Konflikt des religiösen Helden gegeben, der Gegenstand seines sinfonischen Darstellens. Die Versuchung dessen, der in Gott ruht, und dessen Stimme nach Segnung und Verklärung ruft.
Sein Christentum ist ohne Kirche nicht denkbar. Er vermochte nicht Christ zu sein wie Goethe, der »am Sonntag Bilder ansah oder sich vormusizieren ließ, oder ein Gedicht an eine Wand im Freien schrieb und durch den Wald lief und mit alledem Christo ebenso nahe wie der Kirche fern war«. (Herbert Eulenberg, Schattenbilder, S. 38.) Bruckners Christentum betet in Kirchen, betet an der Orgel, auf dem Bahnhof, zu Hause, beim Notenschreiben. Aber man darf sich ihn nicht als Mönch vorstellen – als Märtyrer, nicht als Priester: Sein Christentum hat nicht die priesterliche Gebärde, es kehrt dem Leben nicht den Rücken. Es ist der freiere, von augustinischer Klosterherrlichkeit abstammende helle Katholizismus, der sich an Welt und Weltdingen zu freuen vermag; florianischer Frohsinn, dem es nichts verschlägt, Sonntag einmal in den Prater zu gehen, bis spät nachts auf dem Ringelspiel zu sausen und auf dem Bock des Fiakers heimzuduseln. Als der junge Bruckner in Sankt Florian mit der Kost unzufrieden ist – er kommt immer als letzter an die Schüssel – spielt er auf der Orgel nichts als auf- und absteigende Tonleitern. Vom Herrn Prälaten zur Rede gestellt, führt er die musikalische Unerquicklichkeit auf die – Ernährungsverhältnisse zurück, und unter Schmunzeln wird ihm ein besserer »Futterplatz« bewilligt: wirksame Ausdruckskunst eines Organisten, der kein Kostverächter war. Und da er in Stadt Steyr etwas tief in ein Mädchenauge gerät, tanzt er mit ihr die ganze Nacht wie der »strammste Bauernbursch«, trotz der 61 auf seinem Buckel, und möchte sie heiraten und spielt ihr am nächsten Tag im Pfarrhof das Adagio seiner Siebenten Sinfonie vor … Alles endet schließlich im Adagio.
Er las keine Bücher. (Schreiber, die sich halbblind lesen müssen, werden ihn klug preisen.) Sechters Werk und Marpurgs Abhandlung wird wohl das einzige, außer den Mexiko- und Polarbüchern, gewesen sein. Mit Staunen kommt Karl Hruby einmal darauf, daß Bruckner auch das Leben Jesu von Strauß kenne. Er hat nicht das Beethovensche Verlangen, geistige Fernen zu durchdringen. Er fühlt diesen Mangel auch nicht als solchen. Sein Gemüt kennt nur eine Richtung, nur eine Sehnsucht, die nach dem Responsum dei. Aber auch das ist Privatsache. Es geht niemanden an, es soll nicht behelligen. Seine Demut läßt jeden auf seine Art selig werden. Als ihn Herbeck vom Linzer Bahnhof abholt, läuten grade die Mittagsglocken. Vom Stift her ist Bruckner an das Lippengebet gewöhnt. Wie bringt er den Hut vom Kopf? Er will sein Gefühl vor dem Weltmann weder demaskieren, noch ihn mit einbeziehen. Er wird verlegen – plötzlich seufzt er auf: »Jesus, a Hitz' hat's heut …!« Es war ein kühler Herbsttag, aber er hatte den schützenden Vorwand, das Haupt zu lüften, gefunden. Rationalisten wollten aus solchen Vorfällen Jesuiten-Geruch spüren. Tiefe Religiosität kennt religiöse Scheu. Durch die Notlüge schimmert Zartheit des Herzens.
Ergreifend war die Haltung Bruckners vor den Großen der Kunst, und man kann sie nicht anders als Ehrfurchts gewalt nennen. Er gehörte zum verschollenen Geschlecht derer, die verehren konnten.
Diese Herzensanhänglichkeit dürfte er aus seinen Stiftszeiten mitgebracht haben, denn die Musikpflege der Lehrer und Schüler in Sankt Florian umfaßte, soweit einige erhaltene Programme verraten, neben modischer und Opernmusik (Auber, Boieldieu, Rossini, Weigl) immer, wenigstens in Bruchstücken Orchester- und Kammerwerke von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, wozu noch Mendelssohn, Hummel und Reissiger traten (Schöpfung, Jahreszeiten, Prometheus, die Ehre Gottes, Freischütz-Ouvertüre und dgl. m.).
Wenn Bruckner auf Palestrina und Jakobus Gallus zu sprechen kam, die in der Hofkapelle so einzig schön zur österlichen Zeit aufgeführt wurden, dann wurde, wie Eckstein berichtet, sein Gesicht schmaler und nahm einen eigenen, ganz veränderten Ausdruck von Furcht und schmerzlicher Entzückung an; er sprach mit unterdrückter Stimme, glänzenden Augen, hochgezogenen Brauen, und die Rechte feierlich erhoben, Daumen und Zeigefinger geschlossen, die anderen Finger weggespreizt, so wie Giotto seine erleuchteten Greise malt, die von Gott Zeugnis geben. In Palestrina, dessen Keuschheit ihm verwandt, dessen Glaube der seine war, erblickte Bruckner vielleicht sein Musikideal, sich mit Beethoven berührend, der es für Unsinn hielt, Palestrina nachzuahmen, ohne dessen Geist und die religiöse Anschauung zu besitzen.
Einmal, an einem trüben Wintertag, fuhr er mit Eckstein im Schlitten nach Klosterneuburg, als krächzend eine Krähe über den Weg flog. Das Landschaftsbild machte seine Schubert-Verehrung lebendig, er legte die hohlen Hände um den Mund und sang mit zittriger Stimme seinem Begleiter die leiderfüllten Worte vor: »Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen …«
Bruckners sinfonisches Höchstbild aber hieß Beethoven. An Beethoven maß er sich, und vor der Neunten fühlte er sich gering wie »ein ganz kleines Hunderl«. Er verwob den geheiligten Namen mit den Zufälligkeiten seines Lebens und fragte im entscheidenden Augenblick, wie Beethoven wohl gehandelt hätte. Er stand bei der Enterdigung Beethovens auf dem alten Währinger Ortsfriedhof und starrte schweigend-ergriffen in den Sarg; aber seine düster-feierliche Stimmung wich später freudiger Rührung, als er bemerkte, daß ein Glas aus seinem Hornzwicker in den Sarg gefallen und bei Beethoven geblieben sei. Er erzählte oft Phantasiegespräche mit Beethoven, Ansprachen, die er an ihn halten möchte, seine Sinfonien vorlegend, und um Entschuldigung bittend, daß er nach dem Recht des Künstlers in der Form über ihn hinausgegangen sei. Aber der »Herr von Beethóven« würde ihn getröstet haben: er habe das gleiche Schicksal erlitten, und die letzten Quartette verstünden auch diejenigen nicht, die sie heute in den Himmel höben … (Karl Hruby, Erinnerungen.)
Wenn das Brucknersche Werk etwas von Wien angenommen hat, dann vielleicht den Barockduft alter Paläste, etwas vom Dämmer der gotischen Stefanskirche, die ihn, wie überliefert wird, zum Plan einer zehnten, einer »gotischen« Sinfonie gestimmt habe. In der Mitte der achtziger Jahre regt sich dort immer stärker der christliche Sozialismus gegen altliberales Wesen. Parteistimmen haben sich wohl Bruckners als eines der Ihren bemächtigt, wogegen der städtische Freisinn Bann- und Schreckworte schleuderte wie das vom »ketzerfleischduftenden Tedeum«. Beides zu Unrecht. In Bruckners Werk hat der religiöse Ton keinerlei Mitklang von der Straße, der Mode, der Politik. Eine reine Gemütsangelegenheit wie das Tedeum nannte Heuberger kein geistliches, sondern ein »Geistlichen-Tedeum«; aber hinter dieser zeitungsliberalen Geste steckt die Besorgnis des kleineren Mitkomponisten … Katholische, protestantische, jüdische Menschen haben von Bruckner künstlerische Erlebnisse empfangen, und so dürfte es sich kaum um »klerikale« Musik gehandelt haben – dies ist wohl unter Geistlichen-Tedeum zu verstehen –, sondern um reine Bekenntnismusik. Bruckner war kein Pater Hartmann, kein Perosi. Sein Werk ist – überflüssig, es zu betonen – confessio im überkonfessionellen Sinn. Wie Franz Marschner überliefert, war Bruckner mit dem Antisemitismus vieler seiner Schüler durchaus nicht einverstanden, verdankte er doch jüdischen Menschen erste Förderung (Levi in München); aber gewiß berührte es ihn als Katholisch-Gläubigen sonderbar oder stillos, als sein Tedeum im Wagner-Verein von Schalks Vorgänger, einem jüdischen Dirigenten, aufgeführt wurde. Das Original in seiner Einfaltspracht machte denn auch gewöhnlich feine Unterscheidungen und sprach in Gegenwart von Respektsjuden immer nur von »den Herren Israeliten …«
So viele Jahre Bruckner auch in Wien zubrachte, er wurde nicht, was von andern gerühmt wurde, ein Wiener. Unverbunden mit der Gesellschaft, blieb er an ihrem Rand, im wesentlichen einsam, von Landluft umweht. Seine Wohnung glich einer Klosterzelle an Einfachheit und Kahlheit. Zwei Zimmer, von denen eins tiefblau angestrichen war, enthielten nur das Allernotwendigste: einen kleinen Tisch, woran er arbeitete, ein wenig benütztes Orgelharmonium, einen uralten Bösendorfer, worauf gewöhnlich die Tristan-Partitur lag, und rings umher Noten, Stöße von Manuskripten. Gas- und Wasserleitung machten ihm Besorgnisse, als traue er ihren Zaubern nicht recht; er kehrte beim Verlassen der Wohnung öfter um, um nochmals nachzusehen. So lebte er in einem Wiener Zinshaus, vier Stockwerke hoch, aber im Grund nicht anders wie damals in Kronstorf oder Linz. Das elegante Atelier Makarts, des Salzburgers, war Stelldichein aller Fraueneleganz; Bruckner »empfing« nie, wurde niemals Großstadtmensch, Gesellschaftstier. Ohne Gemeinsamkeiten, über den Relativitäten des Lebens stehend, glich er jenem Franziskusjünger Ginepor, der in Geduld und Entsagung bis zum äußersten gehend, seine naive Frömmigkeit überall bekundete, – Jesu Spielzeug nannte ihn die heilige Klara.
Auf jede Verstrickung ins Weltgeschehen folgt beim Künstler die Flucht zu sich selbst, der Rückzug, wo ihn Selbstvorwürfe über sein Entweichen, die Plagen, Segnungen und Entzückungen der Arbeit erwarten. Bruckner entwich sich nie, er blieb bei sich, sein Leben kennt keine Generalpause des Fleißes und, mit wachem Herzen schlafend, hörte er die anklopfende Freundin, die Musik.
Er war kein »Geschäftsmann«, kein guter, kein schlechter, hat nie eine Note um Geld geschrieben, oder um irgendwo »vertreten« zu sein, er vermochte in veralteter Reinlichkeit des Denkens zu bereichern, ohne Nutzen daraus zu ziehen. Er unterstützte seine oberösterreichischen Verwandten, denen er wohl als der reiche Onkel vorkam. Er hat Güte und bewährt sie ohne Nachdenken. Als er einmal auf einer Schlittenfahrt einen Betrunkenen auf der Straße liegen sieht, läßt er halten und den Halberstarrten in die nächste Polizeistube bringen und ist noch lange über sich erfreut, daß er ein Leben gerettet habe. Er ist hilfsbedürftig und dem Leben wenig gewachsen; aber in seiner Kinderseele lebt ein großes Vertrauen, das hält ihn, das führt und lohnt ihn: er hat Gott nie verloren.
Seine Eitelkeit reizte nur der Ehrendoktor, und, wenn man will, kann man hierin eine seiner Schwächen finden. Er bemühte sich zuerst selbst, auf Umwegen darum, nicht gerade durch die tauglichste Person, ließ sich's sogar ein Stück Geld kosten, bevor er die Ehrung später rite erreichte. Er gab also den Anstoß dazu, mußte ihn in dieser Zeitatmosphäre wohl auch geben; doch lag die Schwäche hier ebenso auf seiner wie auf Seite der Gesellschaft. Sie hätte nicht im Schlaf daran gedacht, wartete vielmehr erst spontan eingreifende Jünger ab, um ein sigillum scientiae zu verschaffen, das jeder wissenschaftliche Handwerker erklettern kann. Und ist die Gesellschaft nicht grotesk, die sich mit dem Ehrendoktorat schließlich selbst ehren möchte, die Anregung dazu aber verschweigt?
Die Skrupel, die er kannte, sind meist technischer Natur oder betreffen ihn selbst; ob er das würdige Werkzeug Gottes sei. Aus seiner Themenbildung allein läßt sich seine innere Sicherheit, die Gebärde seiner Religion ablesen. Fast alle Kopfthemen tragen ein überindividuelles Gepräge, namentlich die der Ecksätze, und, aus Urschriften – Oktave, Quart, Quint – stammend, stehen sie nervenlos, unerschütterlich, zweifelsfremd da. Aus dieser Symbolik klingt Mittelalter, denn die Welt der Kirchentonarten beruht auf der Teilung der Oktave durch die Quint des Tonartgrundtons (dorisch D. a. d., phrygisch E. h. e.), und diese Teilung übernahm Bruckner als etwas Erlebtes. Unmodisch empfangen, bleiben die Themen unabnützbar.
Aus ihrer Schönheitsart, der Magie der Erfindung, leiten wir, vom Sinnlichen zum Übersinnlichen fortschreitend, ihre Bedeutung ab; die Themen zeigen die melodische Prägungskraft des Musikers, die über unser Gefühl entscheidet, und man kann sich leicht eine Thematik vorstellen, die zwar jene Urschritte auch, doch nicht die Begabung enthält, auf die es schließlich ankommt: das »Was« und das »Wie«.
Aber nicht das Thema allein – auch das thematische Handeln bestätigt die inneren Sicherheiten. Neunmal wird in der f-moll-Messe das Credo als Finalmotiv wiederholt, neunmal in wechselnden Harmonien das felsenfeste Bekenntnis in die Welt gesungen: Credo … et vitam venturi saeculi! Von diesem herrlich-beschämenden Glauben, der das Leben des Künstlers im Gleichgewicht hielt, hat man den Eindruck, daß es derjenige ist, den der heilige Augustinus über das beweisbare Wissen, als die Wahrheit schlechthin stellt. Ihn bekennt Bruckner im Tedeums-Choral »Non confundar in aeternum!«, ihn in dem verwandten Adagio-Choral der Siebenten Sinfonie, und jedesmal entbrennt dabei die Ekstase des Künstlers zu solcher Inbrunst, daß er sich mit feuchten Augen bis an den letzten Grenzausdruck der Musik herankämpft.
»Ich werde nicht zu Schanden werden in Ewigkeit …!«
Kein Sinfoniker hatte es noch gesagt, und welcher durfte es? Diese Musik bezweifelt sich nicht selbst, denn der Musiker glaubt, er ruht im Absoluten. Er ringt mit Gott, aber nur, weil er ihn voraussetzt. Das ist kein Hinneigen, nicht Flucht zur Kirche »auf die alten Tage«, kein Kirchlich-Färben durch alte Tonarten, nicht Gebetbuch-Pietismus, kein Kopf-Christentum – das ist strahlende Gewißheit des Bekenners, Dortsein aus Herzensfrömmigkeit, Freude im Müssen, Müssen in der Freude.
Sein Werk bildet eine geschlossene religiöse Welt ähnlich der Bachs, einen Kern umschließend, von dem die werbende Macht seiner Verkündigung ausgeht. Bruckner kennt nicht konfessionslose Musik, spielerische Kunst, die noch nie Gekonntes kann und ihre eigene Fertigkeit bewundert, kennt nicht das Artistentum unserer Tage, das für den Musiker so viele Reize hat und ihn zuletzt doch mit einem schalen Gefühl entläßt, kennt nicht den technischen Triumph um seiner selbst willen. Dies wäre ethoswidrig. Bruckner schafft aus kraftvoller Demut – »Weisheit ist bei den Demütigen« – und über allem könnte irgendwo stehen: Te Deum laudamus!
Selbst in Nebenwerken wie »Helgoland« – einem Männerchor mit Orchester – gewinnt die Musik dort ihren ethischen Ausdruck, wo der Text sich zu Gott erhebt: »– da ringet den Besten vom Busen sich frei, die brünstige Bitte, zum Himmel geschickt« – zu diesen Worten (nach Buchstaben C des Klavierauszugs) ertönt ein dem Choral der Siebenten Sinfonie paralleler melodischer Gang. Was sollte Brucknern sonst wohl die Insel Helgoland?
Beethoven beginnt Ouvertüre und Sinfonie, ja selbst die große Messe mit dem souveränen Akkordschlag, mit Aufschrei oder rhythmischem Riß. Er sucht den Frieden, den er doch niemals finden wird. »Immer blieb etwas Unerfülltes, Klaffendes, Gespanntes zurück. Wer in seiner Missa Solemnis wahrhafte Überzeugung, innerlichste Vollendung sucht, der wird immer eine Enttäuschung erleben …« (Ernst Ludwig Schellenberg, Merker, 1. September 1919.) Anders die Brucknersche Gebärde. Bei Bruckner kommt das Thema gewöhnlich unter dämmerndem Tremolo wie aus dem Mutterschoß der Musik. Es steigt, entfaltet seine überpersönliche Pracht, erscheint wie die goldstrahlende Monstranz vor den Andächtigen, der erste Satz endet gewöhnlich in Verklärungen dieses Hauptthemas, und seine Finale sind die Apotheosen der Gläubigkeit; das irdische Gewölk zerreißt, die Himmel öffnen sich dem, der sie suchte, die Glorien des Überirdischen leuchten seinem Frieden. Bruckner, der selbst während der Pausen beim Präludieren zu beten pflegte, nähert sich dem Tisch des Herrn mit Ehrfurchtsschauer, er beugt das Haupt und fleht um die Empfängnis der Gnade. So führt er die Musik dorthin zurück, wo sie aufgewachsen und geschützt war, und erweitert den modernen Konzertsaal zur Kirche.
Hierin liegt auch der innere Grund des Spannungsverhältnisses Bruckner-Brahms, wie es die Geistesgeschichte zwischen Schiller und Hölderlin, Goethe und Kleist, Stifter und Hebbel kennt und immer wiederholt. Brahms, vom Protestantismus kommend, hat ein anderes Diesseitsgefühl und eine Leidenschaftsgebärde, die im Anfang ebensowenig gesehen wurde wie die Bruckners: beethovennäher als Bruckner, ist er Individualist, und sein Deutsches Requiem bezeugt den Seelenkampf um die Selbsterlösung.
Die als riesig empfundenen Ausmaße Bruckners, die überhimmlische Länge, sein »langer Atem« entsprechen nur dem Ethos dessen, der nicht in der Zeit versinkend, sich ans Ewige gebunden fühlte, dessen Stimme über die Gesellschaft hinaus in Fernen eindrang, die eine Seelenheimat waren. Nicht Willkür, nicht unbezwungene Form, Mangel an Selbstzucht ist diese Weite, sondern Form des religiösen Phantasie-Menschen. Und es gibt Stellen, wo der Künstler in resignierender Melancholie dies heilige Müssen und Nicht-anders-Können bekennt.
Als Anton Bruckner starb, fragte der obbemeldete Richard Heuberger, was das eigentlich Brucknersche gewesen sei. Er wisse es nicht. Das eigentlich Brucknersche stand schon in der Ersten Sinfonie und wäre in einem Notenbeispiel wiederzugeben. Auch die erschreckten Linzer Hörer der ersten Aufführung hatten die Stimme nicht gehört, und sie war nur Widerhall ihrer eigenen. Nicht als harmonischer Gewalttäter, als Architekt des Unübersehbaren, ist Anton Bruckner so mißhört worden wie als Ethiker der Musik.
Und doch ist seine Gebärde, die Grundhaltung seiner Kunst sehr einfach. Als Bruckner – es war im Fasching des Jahres 1891 – zu nächtlicher Stunde nach Hause zurückkehrte, drang aus den offenen Fenstern eines Schottenringpalais Ballmusik an sein Ohr. Eben war der Dombaumeister Schmidt gestorben und lag aufgebahrt im nahen Sühnhaus, das an Stelle des abgebrannten Ringtheaters erbaut wurde. Daran anknüpfend sprach Bruckner zu dem ihn begleitenden Freund (Göllerich) über die bekannte Fis-dur-Stelle im Finale der Dritten Sinfonie, wo unter einer fast polkahaften, sozusagen praterlichen Melodie der Streicher ein ernster Choral der Bläser durchgeht, der dann in eigenen Modulationen stille Wege weiter wandelt. »Sehen Sie,« sagte Bruckner, »hier im Haus großer Ball – daneben liegt der Meister auf der Totenbahre! So ist's im Leben, und das habe ich im letzten Satz meiner dritten Sinfonie schildern wollen: die Polka bedeutet den Humor und Frohsinn in der Welt – der Choral das Traurige, Schmerzliche in ihr …«
Dieses Wort lichtet nicht nur die oft mißverstandene Stelle in der Dritten Sinfonie. Es gilt von ähnlichen Kombinationen in der Achten und in der Ersten, ja im Grund von seinem gesamten Schaffen. Immer wieder hat der Künstler die beiden Gegensätze gebunden: Erden- und Himmelslust, Endlichkeit-Unendlichkeit, Sinnenwelt und Jenseits, Sehnen und Glauben, Natur und Gott, Leiden und Verklärung. Und das stand schon, deutlich und unverkennbar, im zweiten Satz der Ersten Sinfonie. Nach der mystischen Luft des Anfangs erhebt sich ein zweites Thema der Streicher, Dreivierteltakt, dessen Gebärde ein Hinaufstreben in die sinnliche Welt ist (Buchstabe B der kleinen Partitur). Die zwei Oboen singen es weiter, aber aus der Tiefe, von den Hörnern auf die Streicher überwandelnd, ertönt die stille, choralartige Betrachtung

Ein »Musikführer« würde sagen: zwei Themen vereinigen sich. Es ist aber der Hauptinhalt der Brucknerwelt, der sich hier vereinigt. Strenggenommen hat sie keinen andern. Und hierin liegt der Hauptgrund dafür, weshalb der Organist Sinfoniker geworden ist. Er hätte diese Doppelwelt, die Konflikte des religiösen Heldentums, auf keinem andern Instrument so deutlich machen, auf keinem Bindung und Trennung zugleich erreichen können: erst im Orchester ließ sich Kunst der Gemeinschaft herstellen, das Vielstimmige des Gefühls in zwei, drei Hauptstimmen verdichten, die mit gleichen Stimmenrechten klingen. Die chorische Natur der Orchestergruppen erlaubte ein Zusammenklingen im Ursinn des Worts, des griechischen Symphonein.
Bruckner hat die Verschwisterung distanter Tonsymbole technisch reifer, mit wachsender Erfindung, mit prächtigerer Pracht wiederholt; aber er hat sie wiederholt. Er konnte, kraß ausgedrückt, wenig anderes darstellen. Die intellektuellen Spannungen seines Lebenswerks sind gering, seine Welt vermag die Stunden eines weiten Menschen allein nicht auszufüllen. In Bruckner und Wagner erblickte Wolf die höchsten Wonnen, die einen Musiker sättigen können, er dürstet nach Gott und Eros, Himmelsrast und Sinnenbrand. Darum mag die Schätzung Bruckners, der sich im österreichischen Fühlen erfüllte und begrenzte, in Norddeutschland langsamer und schwerer vor sich gehen.
Es fehlt nicht ganz Erotik. Eine keusche Minne, auch ein heftigeres Verlangen, ein Sehnen, geliebt zu werden – das Urverlangen jedes Künstlers – und die Liebesbereitschaft selbst mag aus manchen Stellen dringen, münde zuletzt auch alles in der Gotteslust. Wer annimmt, daß Empfindung die Mutter der Melodie ist, wer in Vorhalten und Wechselnoten nicht nur Apparat und Formeln sieht, wird, um nur eine Stelle zu nennen, das verlangende Herz aus den sehnsuchtsvollen Violinen in der Scherzo-Thematik der Fünften Sinfonie hören:
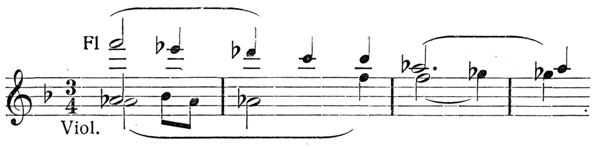
Doch es fehlt das Paradies der Grazie, der Flügel leichten Schwebens, es fehlt das Sentiment der Neunten, der Schwung Beethovenscher Menschenbefreiungs-Kriege – und darum erblickte sich Bruckner vor Beethoven klein wie ein Hündchen. Es fehlt natürlich auch die elegante Weltmannsgebärde Liszts, die Strauß geerbt hat. Nur einmal, ganz zuletzt, öffnen sich die Gärten der Anmut, worin der alte, todverfallene Meister die Sommernachtselfenreigen sieht: in jener Fis-dur-Phantastik des Trios der Neunten Sinfonie mit ihrer Puckschen Märchenlaune, worüber doch ein wehmütiger Glanz von Abschiednehmen liegt.
Er erreicht hier die hohe darüberstehende Heiterkeit alter Künstler, eine von der Art, wie sie Nietzsche liebte, verwandt der Heiterkeit des Fallstaff-Verdi – »Alles ist Spaß auf Erden!« –, ein lächelndes, weltfreies Überschauen, nicht Haydns Stubenvergnügtheit. Hier verrät er, gleichsam in die zweite Jugend gekommen, den anderen, nicht entwickelten, nicht verratenen Bruckner. Fast möchte man deshalb sagen: der Greis starb zu jung. Der »Abschied vom Leben« im Adagio der Neunten Sinfonie gewinnt neue, schmerzliche Bedeutung: es war noch ein Bruckner der Weltgrazie vorhanden, den erst der Mut der höchsten Meisterschaft aus Schwere und Zögern erlöste.
Zum Brucknerschen Inhalt gehört noch die Natur. Er wäre kein großer Musiker gewesen, würde sie nicht in seinem Werk, sein Werk nicht in ihr geruht haben. Wenn man von Ebelsberg, gegen Sankt Florian wandernd, aus fernen Nebelhöhen den bizarren, steinigen Kopf des Traunsteins erblickt, wenn man dann aus den Fenstern des Hochstifts in die Talferne gegen Enns und Lorch schaut, in die verschwimmenden Weiten und Breiten – dann glaubt man diese Landschaft schon zu kennen. Man hat sie gehört, ihre Kontur ist brucknerisch, sie steht im weiträumigen Gesamtwerk.
Es findet sich freilich bei ihm kein ausgeführtes Naturbild wie der Pastorale-Bach, der Wagnersche Rhein, das Wolfsche Abendstädtchen. Er wollte, d. h. er konnte Natur »bloß als Teil des gotterfüllten Alls geben, sinfonisch, nicht dekorativ, wirklich elementar.« Er ist Gebärdenkünstler, nicht Zeichner, er bringt nicht von außen her etwas Mondenschein, etwas Quellgeflüster an. Und es konnte nicht anders geschehen, als daß er »den Rausch elementarer schöpferischer Auswirkung erlebend mitfühlte und ihn dann als Klang und Ton gestaltete. Indem er so die Herrlichkeiten der Schöpfung als Schöpfer gleichsam wiederholte, entstehen seine mystischen Verzückungen, seine Jubelchöre ohnegleichen, der Taumel letzter Seligkeiten, und darin schreitet er so sicher wie Beethoven in seiner Ideenwelt. Beethoven ging vom Menschen aus und gestaltete ihn – sich selbst – im Ringen mit den tragischen Mächten und Leidenschaften seines Innern. Bruckner gewinnt die Höhen durch mystische Entrückung, durch Verklärtwerden, ergriffenes Schauen und Aufgehen im All«. (Oskar Lang.) Nichts Unbrucknerischeres konnte von Jos. Schalk erfunden werden als jener aisschyläische Prometheus, der, wenn er paßte, nur auf Beethoven paßte, nicht auf den tief-katholischen Gottbeschauer, denn
»Was tun die Seligen, so man es sagen kann?
Sie schau'n ohn' Unterlaß die ew'ge Schönheit an …«
Das Süße und Schreckliche der Natur, ihr Gigantisches wie Liebliches, Wildes wie Heiteres klingt. Dem Verfasser wird immer zumut wie vor der Alpenlandschaft, die, in ihrer elementaren Unschuld daliegend, nichts verbirgt, weder von ihrer Schönheit, noch ihrer heroischen Roheit und Kulturferne, weshalb die Römer wohl von der foeditas alpium sprachen. Bruckner ist das Lied vom Hohen Berge, in ihm spiegelt sich die Sonnenaufgangspracht, der Schauer der Weiten und Tiefen und die abendliche Verklärung, über die der ausgestirnte Nachthimmel wächst. Richard Strauß nennt eine seiner Dichtungen »Alpen-Sinfonie«, ein Werk visueller Eingebungen, die Alpen im Maleraug' des Großstädters. Bruckners Sinfonien sind selbst alpig.
Bruckner war ein Sohn, nicht nur ein Enkel der Erde. Es gibt eine berühmte Stelle in seinem Werk, die er von Finken und Meisen gelernt hat: der Seitensatz in der Romantischen Sinfonie, dessen Oberstimme er als den »Vogel Zizibe«, d. i. die oberösterreichische Waldmeise zu bezeichnen pflegte. Dazu schwillt aber als Unterstimme ein seelenvoller Gesang der Bratschen auf, und ihn deutete der Meister als das Glücksgefühl, das die Menschenbrust bei diesem Vogellaut durchströmt. Natur und Mensch werden gebildet, ein sinfonisches Auffangen des Alls – äußere und innere Stimmen – und dies macht auch den sinfonischen Geist seiner Scherzo-Sätze. Hier erscheint sein geliebter Landsmann, der Oberösterreicher, als Tänzer mit allen grobgenagelten Schleifern und Stampfern; aber immer klingt noch eine andere Stimme mit. Bruckner ist nicht Wirklichkeitsschilderer, nicht »Schriftsteller« genug, um nur den Tanzbauern, den ungeschlachten Rüpel zu sehen. Er empfindet ihn als Glied des Alls, als mitschwingenden Teil des kosmischen Rhythmus, und so kommt es, daß unter manchen Tanzthemen ein Kontrapunkt durchläuft, gleichsam ein Choral, der Beine bekommen hat und sich auf den Tanzboden wagt: wieder steht Betrachtung gegen Realismus, Jenseits gegen Diesseits.
Beethoven sieht seinen springenden Niederösterreichern in der Pastorale mit sinnender Ironie zu, er steht über der Vergnügtheit, freiwillig von ihr ausgeschlossen. Bruckner ist mit dabei. So geht's bei uns zu! Ja, ein Rest von heidnischer Naturkraft bricht bei dieser Gelegenheit hervor und poltert und tobt sich aus, als wolle er mit dem Erdball Kegel spielen. Aber zuletzt ist doch auch der Herrgott dabei. So finden sich in diesen Sätzen alle Bestandteile des künstlerischen Ethos.
Im Scherzo der Achten Sinfonie steigert Bruckner seinen Bauern zum Sinnbild des Volkstums, mehr noch: zum Abbild des Erzengelhaft-Beharrlichen, denn er nennt das unter schwirrenden Geigenfiguren in hartnäckiger Gegenbewegung wiederkehrende Grundthema der Bratschen und Celli den »deutschen Michel«. Der Ausdruck geht auf den Erzengel Michael zurück, der schon im Alten Testament als Fürst und streitbarer Held unter den Engeln erscheint, den Satan in Drachengestalt besiegt, und in dessen Namen man später den Sinn des altdeutschen Eigenschaftswortes »michel«, d. h. groß, stark, mächtig, wiederzufinden glaubte. Ganz instinkthaft hatte der große Sprachlose mit dem von Hanslick verhöhnten Wort etwas durchaus Schönes und Gleichnishaftes getroffen: im Michel steckt der Kampf des Lichts mit der Finsternis, des Göttlichen mit dem Teuflischen. So empfand der Musiker das ewige Symbol.
Bruckners Scherzi sind also nicht bloß »Ländlerweisen« aus Oberösterreich; Künstler ist, wer die Banalitäten des Lebens ins Ewige erhöhen kann.
Bruckner hat dies alles nicht »gewußt«. Er sprach seine Musik aus, ein Instrument Gottes, die Form floß aus dem Erlebnis. Wir Nachgeborenen versuchen nur, in Ehrfurcht seine Gebärde ausdeutend, die innere Haltung seiner Kunst zu erraten. Und glauben einen ethischen Kern zu finden, nicht Programme. Zur Programmusik im Lisztschen oder Straußschen Sinn fehlte ihm wohl – zum Glück – die literarische Anlage. Er schätzte Liszt als Sinfoniker nicht sonderlich ein, so wenig er von Liszt sonderlich geschätzt wurde.
Eine weniger gefestete, eine innerlich ungeformte Natur hätte der eben modern gewordenen sinfonischen Dichtung kaum standgehalten. Immerhin war Bruckner von dieser Tendenz der Ausdruckserweiterung etwas berührt. Sein respektvolles, autoritätsgläubiges Wesen hielt die neue Gattung vielleicht doch für die »noblere« und »höhere«, und so unterlegte er da und dort sich selbst »Programme«, d. h. naive Phantasien von Programmen: er gab manchmal »Auslegungen«, die keine waren, und dies meistens vor Laien, nicht vor Musikern. Bezeichnend ist dabei die Art seiner Mitteilungen: mit größter Vorsicht, als vertraue er rasch ein wichtiges Geheimnis an. So sagte er zu Mathilde, der Tochter Theodor Helms, über das Finale der Achten Sinfonie, dessen Vorschlagsnoten in ausgerichteter Reihe wie Reiterfähnlein aussehen: »Olmütz … Drei-Kaiser-Zusammenkunft … Kosaken reiten ein … Nichts sagen!« Von all diesen Zurufen ist der wichtigste der letzte: »Nichts sagen …!« Er war doch nicht sicher. Das Geheimnis mochte größer sein. In diesem Finale findet am Schluß eine Zusammenkunft aller vier Themen der Sinfonie statt, und das war doch' mehr als die drei Kaiser …?
Dem hochwürdigen Herrn Chordirektor von Sankt Florian, Bernhard Deubler, erklärte Bruckner einmal den Anfang der Romantischen Sinfonie: »Mittelalterliche Stadt – Morgendämmerung – Von den Stadtthürmen ertönen Morgenweckrufe – die Thore öffnen sich – Auf stolzen Rossen sprengen die Ritter hinaus ins Freie, der Zauber der Natur umfängt sie – Waldesrauschen – Vogelsang – und so entwickelt sich das romantische Bild weiter …« Auch die andern Sätze hatten eine Art »Programm«, denn er versah eine eigenhändige Niederschrift des ländlerhaften Triothemas in Ges mit dem Titel »Tanzweise während der Mahlzeit zur Jagd«, und ebenso eine Abschrift des Finales mit der Bezeichnung »Volksfest«. Aber schon Theodor Helm, dem wir diese Mitteilungen verdanken, hat Bedenken. (Siehe »Bruckner als sein eigner Interpret«, Neue musikal. Presse vom 7. Januar 1905.) »Damit konnte Bruckner allerdings nur einen Theil des gewaltigen Finales gemeint haben, denn es geht ja mit seinen kühnen, gigantischen Steigerungen, die mitunter alle dämonischen Naturkräfte zu entfesseln scheinen und überdies mit seinem tief tragischen Schluß über die Vorstellung eines Volksfestes weit hinaus … Manche der programmatischen Erläuterungen des Meisters sind aber nur cum grano salis zu rechnen …«
Alle Auslegungen sind so zu verstehen: mit dem gewissen Körnchen Salz. Der Phantasiemensch war bisweilen von mehr oder minder unbestimmten poetischen Bildern heimgesucht – aber seine Musik war stärker als sein Bild. Sie machte aus der mittelalterlichen Stadt das ewige All, die sinfonische Darstellung der Welt. Es klingt nach Möglichkeit, daß Bruckner im Finale der Achten Sinfonie zur »frappanten Gegenüberstellung heldenhaft kühner und tief religiöser Stimmungen … doch ein wenig von der geistigen Nachempfindung der drohenden Kriegsgefahr zu Ende der Siebziger-, und Anfangs der Achtzigerjahre« geführt worden sei; warum nicht? Die Wurzeln jedes Künstlers ruhen im Schoß des Lebens. Aber die wunderbare Gewalt der Musik, das Einzelne zum Gemeingültigen zu erweitern, hat aus Heeren und ihren Herren den Herrn der Heerscharen und aus dem europäischen den Kampf des religiösen Menschen gemacht.
Zusammenfassend: Bruckner steht im primären Erlebnis der Sinfonie-Form – die Klavierauszüge mit ihren klaviersprengenden, aber immer noch klingenden Gewalten geben davon schon ein Bild –, er steht nicht im primären orchestralen Erlebnis wie Richard Strauß, der oft erst im Orchester klingend wird. Seine Musik wird von den ewigen Quellen des Gemütslebens gespeist, nicht von Zeitströmungen; aber mit naiver väterlicher Sorge glaubte er sie schützen zu müssen, sie sollte nicht zurückstehen: – »bei mir ist das ja auch!« – und so erzählt er Geschichten von seinen Sinfonien, versucht sein eigner Musikführer zu werden, und zwar Laien gegenüber, die sich vielleicht nicht zurechtfanden.
»O, der Verstand! Der unglückselige Verstand! Studire nicht zu viel, mein lieber Junge … Folge Deinem Gefühl. Was Dir schön dünkt, das gib auf gut Glück. Es ist ein Wurf wie mit dem Würfel; aber es gibt nichts anderes …!« Kleist, der grade ein Trauerspiel »unter der Feder« hatte, schreibt dies an einen Freund, der eben Racine übersetzte (Rühle v. Lilienstern, 31. Aug. 1806.) Wenn ein Künstler den Wurf mit dem kleistschen Würfel wagte, dann war es Anton Bruckner. Er wußte nicht, was herauskam, er folgte dem Gefühl.
In seinen Erinnerungen läßt Franz Marschner auch einiges von Bruckners Selbstbewußtsein durchblicken: er sei gereizt gewesen, als er, in einer Prager Kirche orgelnd, von niemandem Anerkennungen empfing. Ein Künstler, der nicht nach Zustimmung lechzte, nicht das Gefühl des Eroberthabens kosten wollte – er mag es hundertmal ableugnen – wäre auch kein Künstler. Er muß sich vor der Welt behaupten, er darf sich niemals aufgeben. Was unter so großen Energieverlusten geschaffen ward, in einer Entäußerung, die den Organismus tiefer erschüttert als die Liebesumarmung – das muß das Gleichgewicht wiederherstellen, indem es Lob findet. Es ist ein Zeugnis von Bruckners außerordentlicher Nervenkraft, daß er jahrelang die Verneinung seiner Persönlichkeit ertrug, zumal da er, dem Bauer gleich, doch schwankend wurde, ob der studierte Stadtherr, mochte er ihn innerlich geringschätzen, am Ende nicht doch recht habe. Und sein tiefes Zerknirschtsein in den Selbstbezweiflungsstunden konnte nur durch Augenblicke von erhöhtem Selbstgefühl, ja gewaltsamem Selbstglauben ausgeglichen werden: »Wenn ich mich auch nicht mit Schubert und solchen Geistern vergleichen kann, so weiß ich doch, daß ich wer bin und meine Sachen von Bedeutung sind!« Er brauchte diesen Stolz …
Aber es gibt auch Künstler, die größer sind, als sie denken. Ihr Selbstbewußtsein gilt einem zu klein angenommenen Ich. Ein solcher war der demütige Anton Bruckner.
Ein Mensch wie er, der das Jenseits durchaus im Diesseits empfand, mußte einsam bleiben. Und wahrhaft einsam kann man, wie Jacobsen einmal sagt, nur unter Vielen sein. Das Schicksal mußte ihm die Familie versagen, die Gefährtin verwehren: er war seiner Sendung ausgeliefert wie Jesus. Im Getümmel der wüsten Stadt als Gast weilend, suchte er Freunde zu besitzen, denen er sich doch versagte, und die ihn nicht besaßen. So wird es wohl Augenblicke gegeben haben, wo ihn Ölberg-Verlassenheit anschauerte: wenn er glaubte, nicht genug getan zu haben, wenn er aus Verzückung und seliger Ergriffenheit zur Wirklichkeit zurückerwachte. Davon sprechen als beredte Urkunden seine Werke. Sie sind der Jubelgebärden ebenso voll wie der Einsamkeitszeichen. Im Andante der Vierten Sinfonie wandelt ein Cellothema, c-moll, vor sich hin – in leisem Verlangen immer höher und höher steigend, bleibt es einsam im Tonraum, abgesondert von den scheu begleitenden Pizzikati. Eine zweite Bratschenmelodie setzt diese Stimmung fort bis zur unverkennbaren Melancholie des Nicht-anders-Könnens. Und aus diesen Tonsymbolen wächst allmählich in zwei Variationen des Einsamen Trost: Sich-Aufschwingen in Gottes Schoß und Pracht, entrückte Freude – Posaunenglanz – himmlischer Schalmeienklang –, worauf die Form den Anfang wiederkehren, das Hauptthema wieder einsetzen läßt: alte Verlassenheit umringt Den, der eben Gott geschaut … Reglos lauschen die Instrumente dem versinkenden Symbol. Solche Züge trägt Holbeins Sanct Pantalus, sein Johannes, sein Baseler Christus auf dem Ölberg. –
Von der Abgeschiedenheit Bruckners macht man sich gewöhnlich keine zureichende Vorstellung. Er pflegte seine Tür erst nach langem Zögern zu öffnen, spähte hinter dem grünen Vorhang oft mit einem fast feindselig verzerrten, erschreckenden Antlitz nach dem Störer. Unerwartete ließ er nicht ein, zu spät erscheinende Schüler wies er ab, denn er war seelisch nicht mehr in der Empfangs- oder besser: in Menschenstimmung. Verkehr mit Fremden kostete ihn, namentlich zur Schaffenszeit, Überwindung oder Vorbereitung. Als er nach der Aufführung der Siebenten Sinfonie in Wien ziemlich spät aus dem Freundeskreis nach Hause fuhr, und, im Wagen einnickend, plötzlich aus einem leichten Dämmerzustand – er hatte mancherlei getrunken – aufwachte, fragte er seinen Begleiter klagend, ohne daß die Zensur des Verstandes in diesem Augenblick hemmend wirkte: »Wo sind jetzt meine Freunde …?« Auch sein Bücklingswesen gehört zu seinem Einsamkeitswillen: er wehrte damit oft genug fremde Widrigkeit ab, drängte den anderen in devoter Form gleichsam zur Tür hinaus …
Zu jener Zeit gab es noch einen Einsamen auf dem Berge: Friedrich Nietzsche, der auf Sils Maria »Gedanken fieng«. Aber die Einsamkeit dieses Gottsuchenden ist umweht von der Kühle des theistischen Ablehners. Nietzsche lebt die moderne Einsamkeit, Bruckner die mittelalterliche des Klausners, welche da Wärme hat – sein Gefühl ruht immer in Gott, ja seine Einsamkeit mit Gott ist sein einziger innerer »Geselligkeitstrieb«. Vielleicht berührt sich Bruckner hier mit Mozart, der allerdings der Gesellschaft entstammend, im Rokoko wurzelnd, doch aber darüber hinausschuf und in unerreichbare Fernen geriet, einer der entrücktesten Künstler, die je gelebt haben, entrückt dem Weib, das mit ihm schlief, dem Freund, für den er die Zauberflöte schrieb, gewiß ein armer Schauspieler der Fröhlichkeit. So wußte er sich abgesondert und, wenn auch keineswegs kirchenfromm, war er in Gottnahsein und Glauben doch verwandt dem einsamen Bruckner.
Von seiner Ersten Sinfonie sagte Bruckner einmal zu Theodor Helm: »Mit dem kecken Besen hab ich mich um kein' Katz' 'kümmert, um kein' Kritik und kein Publikum, komponirt, wie's mir grad gfallen hat, nicht um den Leuten zu gfallen …!« Das gilt genau genommen nicht allein von der Unbekümmerten Sinfonie, die eine brave Landstadt in Aufruhr brachte, es gilt von allen, ausgenommen vielleicht die Zweite, die besinnliche, zurückweichende Sinfonie. Natürlich. Nicht um den Leuten zu gefallen. Betrachtete er die Erste als Jugendsturm und Jähe, als freiheitsdurstige Protestmusik, so wich darauf das Pendel nach der andern Seite, und, sich zügelnd, gedachte er dem Hörer nicht Allzuschweres zuzumuten. Heute entnehmen wir beiden Werken Brucknersche Züge, nicht die »echte« Gesammtgebärde. Mit der Dritten Sinfonie, d-moll, hat sich der Künstler ethisch »gefaßt« und seinen Stil entschieden, den der modernen Sinfonia da chiesa. Die geistige Umwandlung des Konzertsaals hat begonnen und hört, von jenem triumphierenden Trompeten-Finale mit den Halleluja-Klängen des wiederkehrenden ersten Allegro-Themas nicht mehr auf. In allen Folgewerken erklingt die gleiche Ausstrahlung des ethischen Ich, die einzige, der er fähig war, sieben Werke von starker Variationsbreite, aber immerhin von innerer Gleichgestalt.
Das einzige, das ihn »kümmerte«, war die klassische Form. Vier Sätze, jeder Satz ein Stimmungsbruchteil des Ganzen und baulich geschlossen. Das Schema war für ihn so feststehend wie die Gliederung der heiligen Messe, sein autoritätsbedürftiges Wesen wird daran eher Entgegenkommen als Hemmung empfunden haben. Seine Messen haben sinfonische, seine Sinfonien messenhafte Züge, und nur die Form unterscheidet, was ethisch zusammengehört.
Und doch gibt es in der ganzen Künstlergeschichte nicht einen Punkt, wo ein Künstlerauge die Form als »fertig«, »ruhend«, »ewig«, unabänderlich betrachtet hätte. Die von Riemann erforschten Vorgeister Abacco, Fasch, Graupner, F. X. Richter haben, beunruhigt und bedrückt vom Unthematischen, die thematische Sonate herausgearbeitet, an ihr arbeitet Haydn, arbeiten die Klassiker weiter: was als Urerlebnis übernommen, wird jedesmal vom Individual-Erlebnis erfüllt und umgestaltet. Jeder ist Vorgeist und Nachgeist, Bewahrer und Sprengtechniker, ja Künstler war immer Der und nur Der, der Formen nicht formeller, Schemen nicht schematischer machte. Bewährtheiten, von denen man ausgeht, Grundfesten, die man bewahrt, gibt es in jeder Kunst. So auch Bruckner: erhaltend und verändernd, respektvoll als Revolutionär, mit Kühnheit konservativ bemächtigt er sich der Überlieferung.
Seine Einflüsse auf das Sinfoniebild beginnen schon beim ersten Satz. Der erste Satz bot bisher das Allegro-Erlebnis. Der Stoff wurde rasch aufgewickelt, der Konflikt entfaltet, die Thematik zu stärkster Geistigkeit erhoben. Für die Beurteilung des Komponisten war vor allem dieser Satz, dann – nach Beethoven – wohl das Adagio maßgebend. Bruckner macht den ersten Satz zur feierlichen Eröffnung, zu einer Art gewaltigen Stufengebets, zur ersten Station. Seine Taktart ist durchweg vierteilig (meist alla breve bezeichnet): – »Allegro moderato«, »mäßiges Allegro«, »Feierlich« lautet die Angabe, das paradoxe »Ruhig bewegt« entspricht seinem Persönlichkeits-Rhythmus, ihn verleiht er der bewegten Unruhe. Eine Übermuts-Tat, einen eigenherrlichen Takt, wie die Dreiviertel des Allegros der Achten Sinfonie, wagte Beethoven, nicht Bruckner. Er, der sich langsam, abschnittweise durchs Leben bewegte, bewegte sich im angeborenen Tempo auch durch die Musik, und was aus dem Innen bestimmt war, wurde durch das Urerlebnis bestätigt: durch das Wandeln kirchlicher Prozessionen, den gewichtigen Schritt der Bischöfe in Sankt Florian, die Lamentationen der Karwoche, die Inbrunst der Vaterunser-Beter. Er hat sein Tempo wie jeder Künstler, es ist ein ethisches: so naht er Gott.
Dann die Zwischenglieder. Im ersten Satz kommen zwischen Seitenthema und Durchführung, auch zwischen Haupt- und Seitenthema kürzere Überleitungsgruppen vor. Bruckner macht daraus längere. Seinem Stil gemäß führt er die breiten Wuchten der Schlußgruppen oder der Zwischensätze ein, zumeist im Brucknerrhythmus:
 – Wo am Schluß etwa ein letztes Atemholen vor dem Kampf um die Höhe stattfindet, eine kurze Fermate andeutend genügt, baut Bruckner taktlange Retardierungssätzchen ein, das demütige Erschauern vor der eignen Kraft (siehe die sechs Takte vor Buchstabe Z, Dritte Sinf., 1. Satz, S. 81 der Part.). So kam es, daß sein florianisch angelegter breitmassiger Bau beim ersten Anblick verbaut schien, und der Hörer, das bisherige sinfonische Tempo im Blut, das alte Allegro in der Erinnerung tragend, einen Ablauf stockend fand, der gleichwohl auf seine Art bewegt war, Risse spürte, die Verbindung waren, woher der Name »Pausen-Sinfonie« entstand. Das Einhören, eine Sache der Gewöhnung, dauerte bei dem Rhythmus, den menschliches Vorurteil nun schon hat, beinahe eine Generation. Und es gab selbst Dirigenten, die ohne Bruckner-Erlebnis, aber mit Vorurteil dirigierten.
– Wo am Schluß etwa ein letztes Atemholen vor dem Kampf um die Höhe stattfindet, eine kurze Fermate andeutend genügt, baut Bruckner taktlange Retardierungssätzchen ein, das demütige Erschauern vor der eignen Kraft (siehe die sechs Takte vor Buchstabe Z, Dritte Sinf., 1. Satz, S. 81 der Part.). So kam es, daß sein florianisch angelegter breitmassiger Bau beim ersten Anblick verbaut schien, und der Hörer, das bisherige sinfonische Tempo im Blut, das alte Allegro in der Erinnerung tragend, einen Ablauf stockend fand, der gleichwohl auf seine Art bewegt war, Risse spürte, die Verbindung waren, woher der Name »Pausen-Sinfonie« entstand. Das Einhören, eine Sache der Gewöhnung, dauerte bei dem Rhythmus, den menschliches Vorurteil nun schon hat, beinahe eine Generation. Und es gab selbst Dirigenten, die ohne Bruckner-Erlebnis, aber mit Vorurteil dirigierten.
Noch ein Vergehen häufte Bruckner zu den vielen andern: er übertrat in der Achten und Neunten Sinfonie das heilige Reprisengesetz, er wiederholte nach der Durchführung keineswegs das Hauptthema. Es geschah freilich aus innern Gründen, und als er im Himmel ankam, wird er vom »Herrn von Beethóven« wohl erfahren haben, daß es auch gleich frei behandelte Beethovensche Sonaten gibt. So rührend das erste schüchterne Auftauchen einer Reprise bei Abacco auch sei, es war damit kein Ewigkeits-Gesetz aufgetaucht: Reprisen wachsen und vergehen, die Künstler bleiben.
So viel vom ersten Satz. Leute, die vom Gebirge herkommen, denken nicht in kleinen Schnörkeln … Der Haupteinfluß Bruckners aber liegt darin, daß er den sinfonischen Schwerpunkt von vorn nach rückwärts verschob, aus dem ersten in den letzten Satz, worauf aufmerksam gemacht zu haben ein Verdienst Max Morolds ist. Als Künstler bedächtiger Entwicklung kommt Bruckner erst nach schwerer Arbeit zu seinen eigentlichen Dingen, als Diener Gottes kann er Gott nicht den Rücken mit einigen humorvollen Bemerkungen wenden: so macht er den leichtesten Teil zum gewichtigsten, nimmt dem Finale Rondo-Fröhlichkeit und Variationenlust und wölbt über seine Domkuppel eine ungeheure, zweite Kuppel, wozu er oft genug Material aus dem Unterbau, dem ersten Satz herbeischleppt. Seine Finale kennen nicht Sechsachtel- oder Zweiviertel-Erlebnisse; es sind überhöhte, überbietende Sätze, die das Feierliche noch feierlicher, das Gewaltige gewaltiger gestalten, nur bisweilen wie in der Siebenten Sinfonie die bewegtere Luft des nahenden Abschlusses erkennen lassend. Die Finale fassen die Konflikte zusammen, als flösse Kraft erst aus Kraft, und erkämpfen das Letzte und Allerbeste: die Antwort Gottes. Das gibt ein stark verändertes Sinfoniebild. Die Verklärungen beenden es – die Leiter Jakobs rührt mit der Spitze an den Himmel und die Engel steigen daran auf und nieder –, und Bruckner konnte seiner Unvollendeten, der Neunten Sinfonie, keine andere Vollendung geben, als durch das Te Deum, das an Stelle eines Finales aufgeführt werden sollte.
Das alte Unterhaltungspublikum der achtziger Jahre sah diese »göttlichen« Finale mit Konzertsaalaugen an und riß aus, zumal da die Brucknerschen Sinfonie-Kathedralen, die Luft und Freiheit und Platz brauchen, mit Ausnahme der Achten, zwischen andere Werke gepfercht waren, oder am Schluß die Raschermüdeten stöhnen machten. Strenggenommen eignet sich Bruckner am besten für Brucknerfeste, eigene Abende, an denen höchstens ein Händelsches Concerto grosso oder eine weltliche Kantate von Bach vorangeht – sein würdigster Platz wäre Salzburg, das österreichische Olympia.
Dazu kommt das Vielheits-Thema. Bruckner kennt nicht die herrische Kürze Beethovens. Er singt. Das Thema strömt, Nebenthemen strömen dazu, es wächst und schwillt aus sich heraus, das Hauptthema muß wiederholt werden, um Größe und Glanz zu zeigen, es braucht andere Vorthemen, um sie zu überwinden, einen Sockel, bis es, in seiner Riesengestalt erschütternd, als Memento erscheint (wie im ersten Satz der Neunten). Diese Gruppigkeit des Themas, die wie das ganze weite Bauverfahren durch das Jugenderlebnis bestimmt ist und die barocke florianische Bauweise genannt werden darf, konnte im Klavierauszug übersehen und geistig geordnet werden – mußte aber von den Hörerscharen, die vorher davonliefen, als Unordnung und Verworrenheit empfunden werden (woran doch mehr das Davonlaufen als die Gruppigkeit schuld trug).
Im Gegensatz zu diesen Erweiterungen einer Kolossalphantasie steht ein anderer Bruckner-Einfluß: die sinfonische Vereinheitlichung. Er wird empfunden haben, daß der erste Satz Beethovens eine Frage, daß jeder Satz Teilstück ist, so daß ein Teil noch nichts vom Ganzen sagt. Bruckner ringt nun die Ecksätze der Sinfonie thematisch ein. Er umgreift das Ganze. Das erste Allegro wird die erste Station eines vier Stationen umfassenden Weges zu Gott. Auch in der ersten, der d-moll-Messe, kehrt sinnvoll ein Friedensthema aus dem Kyrie im Agnus Dei wieder: dort Verheißung, hier Erfüllung. Er beantwortet die Fragen. In der f-moll-Messe klingt das gramvolle Kyrie des Anfangs in frohlockender Dur-Zuversicht zum Schluß des Agnus – Er wird uns Frieden schenken – und dieses Agnus ist noch mit der Gloriafuge motivisch verknüpft. Vielleicht geht diese Einringung, die Wiedergeburt der Kopfthemen auf Bruckners Palestrina-Erlebnis zurück, ist vielleicht Nachklang jener Palestrina-Technik, die die Hauptthematik, wie den Lauda-Sion-Choral, durch mehrere Teile der Messe durchziehen läßt, aus der Messenwelt scheint der Ringgedanke dann in die Sinfonie getreten zu sein.
In der Sinfonie noch einen Schritt weitergehend, verbindet Bruckner auch die Mittelsätze (Adagio und Scherzo der Fünften Sinfonie) und darüber hinaus die ganze Satzreihe: allerdings nicht durch die gleiche Thematik, was Kunstspielerei wäre, sondern durch Motive, die aus einem Geist erzeugt, Familienzüge tragen und dennoch scharf profiliert sind. So hängt das E-dur-Thema der Siebenten Sinfonie mit dem leichteren Aufschwungsthema des Finales, dieses wieder mit den punktierten Motivteilen des cis-moll-Adagio zusammen, und das Scherzothema hat seine Oktavigkeit und Quintigkeit aus den Schrittweiten wieder des Ersten-Satz-Themas. Man kann, abgesehen von den Tonarten, Brucknersche Mittelsätze auch nicht vertauschen, nicht anderswo einsetzen, wie die Lehre von der Verworrenheit wohl glauben machen wollte. Alles fügt sich von innen zu einer Welteinheit. Der schweratmende Adagioanfang der Ersten Sinfonie schließt unmittelbar an die Sturmwinde des ersten Satzes an, an die Zerrissenheit und Wut des Unisono: nun folgt Kreuztragen, Mühseligsein und Stöhnen, worauf im Scherzo die Leidenschaft eines Entfesselten bis zur Unheimlichkeit tobt. Erst das Finale löst das Chaos in C-dur-Helle und Befreiung.
In den Vermittlungsgruppen liebt Bruckner das Orchester-Unisono, auch in Form eines umspielten, eines Halb-Unisono: die Bläser in Pfundnoten, die Streicher in Vierteln oder figurierend, oder die Stimmen synkopisch hintereinander her. In diesen stapfenden Riesengängen meldet sich der Abkömmling ungeschlachter Bauerngeschlechter, die mit Morgenstern und Stangen um Freiheit und Glauben fochten, der Enkel der Stefan Fadinger, Jakob Zeller, David Spat, Wiellinger von Katterhof – der Rolande Österreichs. Aber man kann der künstlerischen Anwendung der als »Rettungstonleitern« verschrienen Unisonopracht sicher sein; sie ist psychologische Vorbereitung, strebt zu einem Gipfelton und leitet in der Regel folgende akkordische Pracht ein, die um so prächtiger klingt, was man in dem Finale der Zweiten, Dritten, besonders schön im ersten Satz der Vierten Sinfonie erlebt. Aus solchen Stellen erfährt man auch den tieferen Unisonosinn: die Einheit der Empfindung wird verkörpert, ja es ist das Fortreißen einer erregten Menge, weshalb die Unisoni gewöhnlich ff oder fff stehen. Der darauf folgende Akkordsatz ist das Gefühlsziel, dem die Masse zutreibt.
So wandelt sich der Mangel des Künstlers in unseren Augen zum Vermögen: Bruckner ist der Meister des Unisonos, wie er der Meister der Pausen geworden ist. Er verwendet die Pausen ethisch, nicht nur vortragstechnisch: in ihrem stummen Klingen liegt das Erschauern der Gemeinde vor dem Gotteswort, das öfter, gleichsam stammelnd, wiederholt wird, wie im Finale der Fünften Sinfonie, wenn zum erstenmal der Choral in den feierlichen Bläsern eintritt, worauf die Streicher in den Tiefen pp erschauernd, die Choralmelodie fortführen. (Buchstabe F der kleinen Partitur-Ausgabe, S. 168.) »Was in unserer heutigen Tonkunst ihrem Urwesen am nächsten rückt, sind die Pausen und die Fermate. Große Vortragskünstler, Improvisatoren wissen auch dieses Ausdruckswerkzeug im höheren und ausgiebigeren Maße zu verwerten. Die spannende Stille zwischen zwei Sätzen, in dieser Umgebung selbst Musik, läßt weiter ahnen, als der bestimmtere, aber deshalb weniger dehnbare Laut vermag …« (Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, S. 36). Die mystischen Pausen Bruckners waren nicht Verlegenheit, sondern Kunstmittel – er rannte nicht durch die Rolle wie aufsagende Schauspieler –, und trügen wir Gehetzten des Lebens nicht die innere Leere so oft im Busen, wir hätten nicht den Sinn für den Pausenklang verloren. Wir haben »keine Zeit« mehr. Der ans Ewige gerückte Künstler hatte sie …
Zur Brucknerschen Tongebärde gehören auch die Sequenzen. Es entspricht seiner bedächtigen Natur, das Eindringliche eindringlicher, das Gleiche auf höherer Stufe zu sagen. Oft werden die kadenzierenden Abschlüsse eines Satzes wiederholt, wie man einen guten Spruch wiederholt, und wieder läßt er bewegte Motive verbreitert und verlangsamt abklingen, um sachte eine neue Gruppe zu berühren. Er will nichts übereilen, des Verstandenwerdens sicher sein, hält in einer Steigerung inne, um Mut zu fassen, sein Selbstvertrauen zu stärken, und was bröckelig, stückelig, zerrissen oder mißgeformt empfunden wurde, ist nichts als sein Ethos. Er will Atemholen und ausruhen, der unendliche Fluß der Empfindung gehört nicht zu seiner Ekstatik. »Ja, sehen Sie, wenn ich etwas Bedeutungsvolles zu sagen hab', muß ich doch vorher Atem schöpfen«, äußerte er zu Nikisch nach der Aufführung der Zweiten Sinfonie, die, wie wir hörten, als Pausensinfonie getadelt wurde.
Brucknerisch ist auch die Melodie mit dem österreichischen Siegel, die, wie bei Schubert, nicht weiß, wo's schöner ist, in Dur oder Moll und in diesen feinen Lichtschwankungen erscheinend, gern auf einen Terzquartakkord geschwungen, vom Gemütvollen ins Heroische gehoben wird. Er war nicht Stubenmusiker, Papierkünstler, und sein ganzes Werk, selbst das abgewandte Adagio, klingt von Heimweh, als ob dem Kind Oberösterreichs in der Wüste der Stadt das Bild von Wiese und Laubwald erschiene, und wie er im Sommer nach Stadt Steyr floh, so kehrt Wiese und Feldsonnenschein, die Enns, die Traun und Stadt Steyr in die Sinfonie zurück. Damit hat seine Welt ihre Gegend bekommen, sie weiß, wie jede rechtschaffene Musik, Stamm und Abkunft.
Die Heimatsthemen schossen ihm in unerschöpflicher Fülle zu: er besaß daran eher ein Zuviel, und seine schaffende Arbeit an den Scherzi war ein Auswählen des Sinfoniewürdigen. Auf Besuch bei einer Klosterneuburger Bürgersfamilie (Schatz) improvisierte er vor den Töchtern des Hauses einmal fast drei Stunden lang »Gstrampfte« und Ländler, in die er ab und zu einen Brucknerschen Kontrapunkt einflocht, und die nach Ecksteins Zeugnis alle sinfoniereif waren. – Noch eine Reihe anderer Siegel gibt es, die wie das Handwerkerzeichen A. B. auf jedem Stück wirken, woran man ihn erkennt wie man Arnold Böcklin erkennt: Manieren sagen die Abgewandten – Gebärde die Zugewendeten.
Die Brucknersche Urgebärde aber tragen die Steigerungen. Sie sind für seine Sinfonie so bezeichnend wie die rhythmischen Rucke und die Schlußstürme für Beethoven. »Wie das sachte beginnt, daß erst nur die Fernen zu erklingen scheinen, dann alles anwächst, als höbe man sich selbst von der Erde und schwebe in die Höhe, mit Wolken und Nebeln, die sich zerteilen, bis allmählich immer mehr Helle durchdringt und endlich das strahlendste Licht uns berauschend umflutet und alles ein großer Sang geworden ist und die Sphären von jubelnden Klängen erbrausen bis an die Enden der Welt – diese Stellen gehören nicht allein bei Bruckner, sondern in der Musikliteratur überhaupt zu den machtvollsten Eindrücken, die man haben kann …« (Oskar Lang, Westermanns Monatshefte 1912, Nr. 7.)
Dies gibt einen sprachmusikalischen Eindruck der Brucknerschen Steigerung, die oft in Staffeln sich erhebt, aus ihren Gewalten neue Gewalten schöpft, bis sie endlich, im Verklärungswillen übermächtig, die Pforten des Himmels erreicht. Von innen gesehen ist sie eine Gebärde seiner Frömmigkeit, und von ihr kann man Hölderlins schönes Wort gebrauchen: »Eine natürliche Unschuld, man möchte sagen eine Moralität des Instinkts und die ihm gleichgestimmte Fantasie ist himmlisch.« Er stand an solchen Stellen in denselben Gluten der Gottesminne wie die alten Mystiker, und ihr Gottschauen war das seine. Er beschrieb einmal – in Ischl – Artur Nikisch die Entstehung solcher Glanzstellen: wie er plötzlich den Himmel sich öffnen, und den lieben Herrgott, die Engelchöre, den heiligen Petrus und den Erzengel Michael im Geiste vor sich gesehen habe … »Beim Zurückrufen solcher Visionen aus anderen Welten weitete sich sein Blick wie ins Unendliche; ganz in seine Phantasien eingesponnen, blickte er die Weite des Tals hinab; man konnte nicht wagen, ihn zu stören.«
Einer Form müssen wir zuletzt noch gedenken, des Allerheiligsten der Brucknerwelt: des Adagio. Es trug ihm den wenig glücklich gewählten Namen des zweiten Beethoven ein, aber immerhin klingt aus dem Schlagwort die richtige Empfindung: nach Beethoven gab es nur noch eine beethovennahe Adagionatur. »Feierlich« oder »sehr feierlich« oder »feierlich langsam« lauten die Überschriften, und mußte Bruckner dem ersten Satz (wie in der Fünften) seinen persönlichen Rhythmus gleichsam auferlegen –, das Adagio kam seinem Urtempo entgegen, es fing ihn und sein sakrales Schreiten auf. Das Feierliche wird noch feierlicher und der Wille hörbar, ins Grenzenlose zu dringen. Das Brucknersche Adagio stellt nicht Domerlebnisse, Kathedralenstimmungen dar, wie Schumann und Debussy sie darstellen: es ist selbst domhaft und, alle Innerlichkeiten sammelnd, sucht es sich mit der Gegenwart Gottes zu erfüllen: Bruckner, der Gothiker …
Meist nimmt das Adagio die zweite Stelle ein – nach den ersten Kämpfen die stille Versenkung –, nur in der Achten und Neunten Sinfonie steht es nach dem Scherzo: in der Achten muß nach einem niederschmetternden Ergebnis in doppeltem Maß um Widerstandskraft gerungen werden; in der Neunten bildet es allerletztes Zusammenfassen, Sichaussagen und Sichaufschließen nach Szenen von entrückter Heiterkeit.
Bezeichnend für das Brucknersche Adagio ist der Reichtum von Gedanken, die aus andern Welten herüberspielen. Im Adagio der Zweiten Sinfonie erklingt als Zitat das Danksagungsmotiv des Genesenen aus dem Benedictus der f-moll-Messe, in das Adagio der Siebenten Sinfonie geht als mitgestaltendes Ereignis der Tod Richard Wagners ein, im Adagio der Achten wird der Geist des jungen Siegfried durch ein Bläserthema beschworen, im Adagio der Neunten nimmt Bruckner durch ein Tubenthema »Abschied vom Leben« und sieht im Scheiden noch einmal zurück auf den Gesang der Achten Sinfonie.
Sichtlich sind die Adagiosätze das Behältnis seines geheimsten Lebens; hier wird er Gottes Kind: sein Adagioton sagt es aus, so handelt er, so ist er. Todesahnung und Auferstehungsglauben, Sündebekennen und Bußetun im katholischen Sinn, schmerzvoller Rückblick, Begnadetsein wollen, Vondannengehen in Verklärung und überall die Herzensgüte –, das sind seine »Inhalte«, umrißhaft gesehen. Hier bekennt er, wenn er sonst nicht bekannt haben sollte, und alles wird denkmalhaft. Wenn Wackenroder die Tonkunst »gewiß das letzte Geheimnis des Glaubens, die Mystik, die durchaus geoffenbarte Religion« genannt hat, so denken wir an die drei letzten Adagios Bruckners, und die Neunte mag das Vorbild jener Mahlerschen Dritten Sinfonie geworden sein, die mit dem Adagio, dem »katholischen Satz« abschließt.
Bei der Fülle des Gefühls mußte der Bau sehr einfach werden, und er wird es, fast bis zur Gleichförmigkeit. In die Adagios sind (wie in der 1., 3. und 7. Sinfonie) Dreiviertelsätze als zweite Kontrastgruppe eingebaut, und in der Hauptsache kehren die Themen rondohaft wieder, meistens variiert oder durchgeführt. Er blieb bei diesen Formen, oder sie blieben bei ihm, nachdem er sie einmal gefunden; er will nicht die Leichtigkeit eines Intermezzo, strebt nicht lockeren rhythmischen Aufbauten zu. – Das Hauptthema steigert sich, von figurierenden Streichern umflutet, bis zur höchsten, machtvollsten Erscheinungsform und erinnert an die wolkengetragenen, engelumgebenen Himmelfahrten mittelalterlicher Bilder. Seinem Adagio entströmt der gleiche tiefe Glückseligkeitsschauer, den die Antlitze Fra Angelicos tragen und aller anderen Meister, die, das Jenseits im Diesseits schon empfindend, reinste Technik mit reinstem Schauen verbanden.
»Wenn ich mir in meinen Arbeiten hier und da einige kühne harmonische Rückungen erlaube, so kehre ich doch immer wieder zur Grundtonart zurück, verliere sie nie ganz aus dem Auge wie ein Bergsteiger, der, couragirt aufwärts dringend, sich eine freiere Aussicht verschaffen will, dabei aber doch in derselben Gegend bleiben will …« Dieses hübsche, aus der Alpenwelt geholte Bild, das wir der Überlieferung Helms verdanken, klingt nach Alt und Neu zugleich. Alt – denn schon 1752 erklärte D'Alembert, »daß das Ohr, das sogleich von der Haupttonart eingenommen worden, allzeit begierig ist, solche wieder zu hören. Je weiter sich also Töne, worin man ausweichet, von dem Hauptton entfernen, desto kürzere Zeit muß man sich darin aufhalten …« Neu – denn hundert Jahre später (1851) konnte Richard Wagner in »Oper und Drama« erklären, daß in einem größeren Tonsatz »die Urverwandtschaft aller Tonarten gleichsam im Licht einer besonderen Haupttonart vorgeführt wird, denn die uns mögliche Melodie hat die unerhört mannigfaltigste Fähigkeit erhalten, vermöge der harmonischen Modulationen die in ihr angeschlagene Haupttonart auch mit den entferntesten Tonfamilien in Verbindung zu setzen …«
Die Brucknersche Selbstkritik klingt demnach ganz – Brucknerisch: revolutionär und besonnen.
Er, der schwerfällig galt im Denken, war als musikalischer Denker so rasch und gelenkig, daß die wenigsten ihm folgen und die Überraschungsgewalt seiner Umdeutung nachempfinden konnten. Submiß im Leben, entwickelt er in der Harmonik seine kühne geistige Wirklichkeit, seinen akkordischen Heroismus, und die Schwerkraft der Töne im Fundamentsteigen überwindend, verrückt er gewichtig lastende Akkordmassen, Quadern der Harmonie mit leichter Hand, ohne Bedenken, und erreicht so Stellen von blendender Lichtstärke. Er wirft den Quartsextakkord, die einfachen, die doppelten Vorhalte frei hin. Dazu die Alterationen, kurz die ganze Phantastik eines Unbegrenzten, die sich naturgemäß der Melodieform mitteilt (welche nur die horizontal gewordene, spannungerfüllte Harmonie ist). Ein rasches, melodisches Durcheilen dreier Tonarten (Scherzo der Vierten Sinfonie: C-dur, As-dur, Fes-dur) war ihm schon zwischen 1870 und 1880 geläufig und bildete die Verlegenheitsstellen seiner ersten Hörer. Er hat den barocken Willen zur Pracht, liebt schwelgende Akkordfolgen und den mundartlich färbenden Terzquartakkord (aus der Tanzmusik), der, gereinigt und veredelt, das »Schleiferische« verliert und durch die Instrumentation zu festlichem Glänzen erhöht wird. Schon 1885 kennt Bruckner die Wirkung der modern gewordenen Quartigkeit (Sechste Sinfonie, erster Satz). Um 1890 bildet er Steigerungen mit aneinandergepreßten Akkorden wie Scriabine (Neunte Sinfonie, erster Satz). Das eigentlich Brucknersche aber sind die Zyklopenstellen, die hoch und höher getürmten Aufbauten synthetischer Akkorde (Dominanten), wie die überwältigende Bläsersteigerung auf dem Fis-Fundament im ersten Satz der Siebenten Sinfonie, die aus dem Schöpfungston (Fis) elementare Gewalten erlöst, ein vollständiges Novum in der sinfonischen Literatur.
Zu Beginn der Neunten Sinfonie stürzt das Hauptthema, nach seiner ersten d-moll-Erscheinung wie von sich selbst weg in ein Fremdgebiet: H-dur, dann e-moll, dann C-dur – – wohin? Aber der nächste Akkord (g. b. d. e.) drückt es mit unterdominantischer Kraft wieder in seine Welt zurück: nie hat die Kühnheit des Bergsteigers die Orientierung verloren. Fachliche Untersuchungen eröffnen da »ein weites Feld«, wie Fontane sagen würde, und wer Geduld und Überwindung hat, kann die Logik des »Unlogischen« an jeder einzelnen getrockneten und aufgespannten Akkordfolge in einem Bruckner-Herbarium studieren (siehe August Halms Buch über die Brucknersche Sinfonie).
Bruckners Harmonik gibt seine kernhafte ethische Gesinnung wieder: er dringt vor, erobert, besetzt – aber er geht bald zurück. Sein Verantwortungsgefühl erwacht, er faßt sich. Ein tolles Exzedieren mit Fundamentalschritten, ein Herumzigeunern wäre unvereinbar mit seinem Heimatgefühl und seiner geistig-religiösen Haltung. Er ist nicht Chromatiker im Sinn der romantischen Künstler: durch seine kühnste Chromatik schimmert immer noch die Diatonik, das geradlinige Urgerüst.
Mit seinem tonalen Gefühl erreicht er Überwirkungen wie im Adagio der Siebenten Sinfonie. Nach langer wiederholter Steigerung gelangt der Choral an die Pforte von cis-moll (Dominantseptakkord gis. his. dis. fis.). Die Phantasie des Künstlers hört diesen Akkord bereits als C-dur-Klang (Unterdominant). Dorthin stürzt er die Tonmasse; der Quartsextakkord (g. c. e.) erscheint wie ein Gipfel in überirdischem Glanz, als sei die Tonart im Augenblick neu erfunden worden, die cis-moll-Umgebung rückt in ein fahlglühendes Halblicht, der Künstler hat den Auferstehungsgedanken angedeutet – ein Ruck, und über Des-dur sinkt alles in die cis-moll-Trauer zurück. Die »Ausweichung« diente der innern Form des Satzes, das Einfache erschien im Gewand des Komplizierten.
Bruckners erste Hörer – es ist manchmal ein Unglück für Künstler, nicht gleich zweite und dritte Hörer zu haben – vermochten aus seiner Welt nur »Wagner« zu hören: Walküre … Tristan … den Feuerzauber … Aus dem Ungewohnten sieht man zuerst das Gewohnte, im Unbekannten fällt das Bekannte auf, und alles moderne Klingen war »wagnerisch«. Jene ersten Hörer unterlegten dazu das szenische Bild der Wagnerschen Oper, das sie im Auge hatten, und das Wort von der Veroperung der Sinfonie wurde laut. Tatsächlich gibt es bei Bruckner Stellen, wo er abhängig und sterblich ist (wie die zwei Takte Quintsextakkord vor dem Eintritt des E-dur-Teils im Adagio der Sechsten Sinfonie) – hier verraten sich seine Ausgangspunkte. Er kommt vom Wagner-Erlebnis, sucht es auch nie zu verleugnen, aber, alles Begegnende durch sein Ethos wandelnd und paralysierend, gelangte er – empirisch – zu einer zwar sekundären, aber eignen harmonischen Welt. Und zuletzt über sich selbst hinauswachsend, gestaltete der Meister eine neue, Brucknersche Harmonik, die ihre originäre Prägung hat, wie die der Neunten Sinfonie und der berühmt gewordenen Anfangstakte des Scherzos (Bildungen auf A-Fundament und D-Fundament) – Erscheinungen, die ein völlig wagnerfremdes Gesicht tragen.
Betrachten wir den Künstler also rückblickend, als letzte Hörer, so müssen wir seine geistige Kraft feststellen, die eher abwehrend als annehmend war, bis sie zuletzt frei wurde. Wir sehen schon in seinen Frühwerken den Erfinder neuer Möglichkeiten und können uns Herbecks verwundertes Gesicht vorstellen, als er zum erstenmal die Mischakkorde, das Ineinander verzitternder Harmonien, die eigentümlichen romantischen Fernklänge am Durchführungsbeginn der Vierten Sinfonie hörte – eine kleine Non, Des, im Vorhalt e. a. c. –, Wirkungen, die wir heute aus Werken moderner und modernster Schulen (Josef Marx, Franz Schreker) kennen.
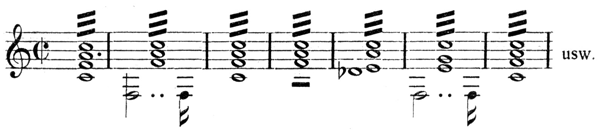
Und um diesen Abschnitt zu beschließen: man kann nicht eine Stimme, nicht eine Note bei Bruckner verändern, ohne daß nicht alles, von ganz wenigen Stellen abgesehen, unbrucknerisch würde.
Beim Gedanken an Bruckners Durchführungstechnik schweben dem Verfasser immer seltsame visuelle Erinnerungen vor: komplizierte Klangbilder, sehr überschaulich, und im Komplizierten wieder gleichartig: eine Art unausgeführten Werkstattzeichens, woran man die Meisterhand erkennt. Brucknersche Grundhaltung ist vor allem das Umkehren des Themas und die Neigung, es in Urform und Verkehrung tönend zu vereinigen. Dazu die weitere Engführungsfreude: ein Thema sich selbst folgen zu lassen, in immer kürzeren Abständen, bis ein thematisches Dickicht erreicht ist, das nur durch die Instrumentation aufgehellt wird: der Punkt, wo der Brucknerdirigent sich zu zeigen hat. Dann gibt es noch Verkehrung und Engführung zugleich, kurz, es kann vor Gott dem Herrn die Tragfähigkeit der Themen und die Gediegenheit der Arbeit nicht eindringlich genug gezeigt werden. Ein echter sinfonischer Denker, zerfeilt, zersägt, zerschlägt er sein langes Riesenthema, bis es nur noch rhythmisch seine Abkunft erraten läßt, oder dehnt und verlangsamt er thematische Werte, meistens an Übergangsstellen, um vorsichtig hinüberzutasten. Diese sich ineinander sehnenden, einander zerstörenden, sterbenden, auferstehenden Themen gewähren ein eigenes Schauspiel; aber immer haben sie Gesetz in sich. Sie dienen der sinfonischen Einheit, und was die moderne Kompositionstechnik durchbrochene Arbeit nennt, kann man in schönen Proben fast überall sehen (Erste Sinfonie, erster Satz, Part. S. 22, Zweite Sinfonie, Andante, Part. S. 70, Vierte Sinfonie, Andante, Part. S. 90, Neunte Sinfonie, Adagio, Part. S. 123. Imitationen der Themen mit rhythmischer Gruppierung der figuralen Begleitung u. a. m.). Alle diese Bilder werden lebendig beim Worte »Durchführung«, und wenn es später bei den »Erläuterungen« gebraucht wird, möge es Siegel sein, das eine Welt von Arbeit deckt.
Dabei ist bedeutsam die Diatonik des Brucknerschen Themas, in das die Durchführungsmöglichkeiten, die beliebten fundamentalen Gegenbewegungen, kurz alle Zukünfte schon mit hineingeboren, also miterfunden sind: eine Gabe, die sich bei Mozart, der die Verflechtbarkeit von fünf Themen voraussah, ins Seherische steigert, womit allerdings die Gipfel unserer Kunst erreicht sind. Von Mozart hat denn Bruckner auch einmal gesagt: »Es gibt einen Grad von Vollendung, der so hoch ist, daß der, der ihn einmal erreicht hat, gar nichts Schlechtes mehr machen kann.«
Daß Sechter bei Bach viel zu viele Freiheiten fand, teilte Bruckner mit dem unverkennbaren Beigeschmack mit, daß ihm diese anscheinenden Freiheiten wohl als innere und höhere Notwendigkeiten vorkommen mochten. Sein eignes Kontrapunktieren zeigte unwiderleglich, daß er gerade in den Geist dieses Bachschen Verfahrens, das höchste Kühnheit und Besonnenheit vereinigte, eingedrungen war wie kaum ein Zweiter. »Ich bin kein Orgelpunktpuffer«, hat er einmal abgewehrt. Und er ist auch kein Kontrapunktpuffer: alles Technische erreicht erst höchste Gewalt von innen her, das Dargestellte mißt sich am Darzustellenden. Und in solchem Verstand hat der Meister denn auch die kontrapunktische Hauptform, die Fuge, verwendet. Nicht als spielerische, als kombinatorische Form, sondern um Tongewalten die denkbarsten geistigen Spannungen zu verleihen wie im Te Deum und der e-moll-Messe. Diese kontrapunktischen Arbeiten sind die Taten des Menschen Bruckner. Kontrapunkt ist Handeln, Individualitäten treten gegeneinander und bilden die Dramatik des »absoluten« Musikers. Er war kühn, und steigert das Kühne im Finale der B-dur-Sinfonie, dessen Fugenwelt vom Choral der heiligen Instrumente Trompeten, Hörner, Posaunen am Schluß überkrönt wird; und von solchen Stellen wiederholen die Beurteiler die gleichen unzulänglich klingenden Worte: gigantisch, grandios und so weiter. Es sind übermusikalische Kühnheiten, solche des Charakters, Taten eines als Organisten verkleideten Imperators und Eroberers, wie die Dramen die bunte Ausstrahlung der verdrängten Untaten des William Shakespeare waren.
Die, die Bruckner einen Zyklopen nannten, waren aber doch auf rechter Spur. Denn in jenen Sturzthemen, wie im Finale der Dritten, im Scherzo der Siebenten Sinfonie, machte sich die von Geschlecht zu Geschlecht vererbte Gesundheit eines heidnischen Menschen Luft, eines Paganen, den das Christentum zwar gebeugt, nicht gebrochen hatte. Hätte heidnische Urkraft nicht in ihm gestrotzt, so hätte er die Milde Palestrinas, nicht die Riesenschlachten seiner Durchführungen leisten können, Sätze, vor denen man halb in Furcht, halb in Freude steht. Gleich Michelangelo dürfte der Meister um dieser furchtbaren Entladungen willen il Terribile heißen, und wir ahnen hinter den Zeichen der Musik einen, der größer war als sein Werk, einen, der sich nicht zu Ende sprach. Bruchstück bleibt auch das Vollendete.
»Wir bauen an dir mit zitternden Händen,
und wir türmen Atom auf Atom,
Aber wer kann dich vollenden,
du Dom!«
Bruckners Kolorit ist keine Zufalls- oder Willkürfarbe. Miterfunden gehört sie seinem Ausdruck an. Die Trompete klang in ihm auf, als er das Thema der Dritten Sinfonie empfing. Der Festklang, nicht dazugemalt, kam von innen, aus den Gewalten der Überzeugung. Sein Orchester verrät im ganzen orgelhafte Abkunft. Es klingt oft, namentlich in Holzbläsergängen, wie registriert, das Urerlebnis wirkte bestimmend auf die Grundfärbung. Doch pflegte er, der klassischen Überlieferung getreu, die Streicher als das Grundgerüst zuerst zu notieren, und seine allererste (bis auf das Andante nicht veröffentlichte) Sinfonie zeigt auch die herkömmliche Figurenwelt. Später bekommen seine Streicherbewegungen eine monumentale, gewölbte Linie, einen lapidaren Zug, denn auch sie werden oft aus Urschriften gebildet; aber was als Steifheit getadelt wurde, empfinden wir als domhaft, ja katholisch: selbst die Nebenerscheinungen seines Stils sind irgendwie vom Ethos berührt.
Das wagnerische Tremolo, dem die moderne Sinfonik mit Recht auszuweichen sucht, benützt er als einheitlichen Spannungszustand stark, fast allzu stark; dagegen sind ihm fremd alle Verwischungs- und Verklecksungszauber, die Farben- oder Tonartenkontrapunkte, ohne die moderne Sensation nicht auskommen kann: sein Partiturbild ist ein Muster an Klarheit, und zwar selbst bei Stellen von anscheinend barocker Überladenheit; man sieht die reine Seele, die sauber zeichnende Hand; ja die wohlordnende Symmetrie von den Klassikern übernehmend, spiegelt er sein bewahrendes und kühnes Wesen, als hätte ein später Beethoven diese schöngruppierten Seiten geschrieben, die, dem Verfasser wenigstens, doch wieder irgendwie den Anblick der reinlichgehaltenen Bogenarchitektur, der katholischen Hausfrauensauberkeit von Sankt Florian zurückrufen.
Er ist Erfinder von Bratschen- und Cellomelodien – selbst aus dem Klavierbild läßt sich oft das Instrument erraten –, vor allem ist er Trompeten- und Posaunenkomponist. Aus ihrer militärischen Laufbahn allmählich in die hieratische geratend, aus der rhythmischen und füllenden in eine führende Glanzstelle vorrückend, wird die Trompete als Brucknertrompete Thementrägerin, das Jubelinstrument, das Werkzeug zum Preise Gottes und ist ihm als solches ein so starkes Erlebnis, daß er auch Singstimmen trompetig verwendet wie im Halleluja des 150. Psalms.
Er braucht ihre starke Gegenwart, nimmt sie zu dreien wie Wagner, von dem er auch die Nibelungentuben später übernimmt. Riemann hat gegen Bruckner u. a. die Verwendung dieser schweren Bläserstimmen als unsinfonisch eingewendet und auf den vorsichtigen Gebrauch verwiesen, den Beethoven und Brahms davon machten: oft nur zur Untermalung, zur Verstärkung und Füllung des Tutti, nicht zur motivischen Mitarbeit. Aber Bruckner ist weder prunksüchtig, noch stilunempfindlich: er kann nicht anders. Er legt von vornherein den Bau so an, daß Pracht niemals die Thematik erdrückt, ja oft schaffen seine Posaunen und Tuben erst die Thematik. Jedes künstlerische Ethos verlangt nach andrer Befreiung aus dem Material, das innere Erlebnis bedingt neue formelle und koloristische Haltung: – ohne die Posaunen- und Trompetenwucht fehlte der Sinfonie das Brucknersche Barock.
Bruckner ist oft der Wagner der Sinfonie genannt worden. Ein Schlagwort, das am Äußern tastet. Es ist wahr: er hat die Tuben, das Tremolo und die Harmonik von Wagner und verband auf die seltsamste Weise katholische Innigkeit mit profaner Pracht. Aber doch gab es nie zwei Menschen, die man in einen bejahenden Akkord weniger vereinigen konnte als Wagner und Bruckner.
Wagner ist der leidenschaftliche Unchrist. Von der ethischen Leerheit des alten Opernspiels angewidert, gab er ihm neue ethische Fülle: mit seinem Sehnsuchtsschrei. Und dieser Schrei, durchdringend, betörend, wird der unsere, wir sagen: Wagner spricht unser Erleben aus. Er spricht es aus – in den gottleeren Stunden. Und Nietzsche hat wohl gefühlt, daß hier kein Gott verkündet wurde, daß ein heißer Eros aus dem nordischen Nebel seine Stimme schickte, daß eine Künstler-Entwicklung in einem letzten Mysterium endete, welches jenen heidnischen Eros mit dem Christentum zu binden suchte.
In Wagner gab es einen christlichen Rest, in Bruckner einen heidnischen. Wagner suchte mit allen Sinnen die Erlösung und endete in der Entsagung. Bruckner endet in der Verklärung. Er hat nie Erlösungen gesucht, ruhte er doch in der Lösung selbst. Er hat seine Musikerzweifel: ob er das instrumentum dei sei, er lechzt nach Vervollkommnung, man hört sein christliches Confiteor, er stammelt sein Miserere, die Naturkraft rebelliert, und er erleidet den Versucher –, aber mögen den heiligen Antonius alle Scheusale der Hölle am Greisenhaar zupfen, er betet mit Kinderaugen seinen Rosenkranz weiter und wird gesegnet. Niemals hat er sich als Unerlösten der Liebe dargestellt. Er braucht nicht das Weib, nicht die Gesellschaft, er braucht kein Buch, er ist ganz versenkt, und alles Sinnenhafte stürzt zuletzt in den Gottabgrund. Wie eine katholische Kirche mit dem Hochaltar gegen Osten gerichtet ist, so die Brucknersche Sinfonie mit ihrem Antlitz der aufgehenden Sonne zu, dem Symbol Christi, des Lichtbringers.
Wagner, der eine einzige Sinfonie schrieb, konnte seinen Eros nur in der Oper entladen: sie war seiner Not die Form und verhundertfachte seine brennende Flamme. Bruckners polyphone Denkungsart setzte in naiver Weise eine Gemeinschaft Mitgläubiger voraus. Er ist nicht Nur-Katholik, sonst hätte er an Kirchenwerken sein Genügen gefunden, seinem Katholizismus fehlt priesterliche »Affektlosigkeit« –, aber sein Diesseits ist durch das Jenseits bedingt, und aus der ursprünglichen Tanz- und Gesellschaftsform, die Beethoven zur Ideenform erhebt, bildet er die Sinfonie als Kultform. Zwei ethische Welten, die sich nie decken. Te dominum laudamus – Zu dir, Frau Venus, kehr ich wieder …!
Wiederholt hat Bruckner davon gesprochen, eine Oper zu komponieren, auch in einem Dankschreiben an König Ludwig von Bayern will er sich »später der dramatischen Komposition« zuwenden. Gewiß schwebte ihm ein übersinfonisches Kunstwerk vor, und öfter äußerte er – der Verfasser hat es selbst gehört – Verlangen nach einem Opernbuch, doch müsse es sein »wie Lohengrin«. Nicht Tannhäuser bezeichnete seinen dramatischen Idealstoff, und er konnte sehr rauh und grimmig werden, wenn ihm aus allen schönen oberösterreichischen Orten Textbücher zuflogen, womit ihm wohlmeinende Dichter im Nebenamt Musik entlocken wollten. Er kannte seine Grenzen aus Instinkt. Wenn er auch an die Bühne dachte, so verhinderte ihn seine innere Festigkeit in Form von äußerlicher Ungelenkigkeit, ein gewandter Nachwagner, ein Macher von Theateropern zu werden.
In dankenswerter Weise hat Wilh. Altmann (Die Musik, Jahrg. 1901/2) einen Opernbriefwechsel Bruckners veröffentlicht, und es bestätigt die geschlossene, geformte Natur des Künstlers, daß er auch darin sagt, was er sonst zu sagen pflegte: ein Lohengrinbuch. Fräulein Elisabeth Bolle, die durch größere Dichtungen in literarischen Kreisen einen geschätzten Namen erwarb und mit Bruckner bekannt war, wandte sich unter dem Namen eines Schriftstellers H. Bolle-Hellmund an den Meister mit einer Opernanfrage. Ohne die Verfasserin hinter dem Decknamen zu erraten, antwortete Bruckner aus Stadt Steyr (5. Sept. 1893): »Ihr herrliches Schreiben zeigt mir den großen Genius, der in Ihnen obwaltet. Ich bin leider immer krank! Auf Befehl der Ärzte muß ich jetzt ganz ausruhen. Dann gedenke ich meine Neunte Sinfonie ganz fertig auszukomponiren, wozu ich fürchte 2 Jahre zu brauchen. Lebe ich dann noch und fühlte die nöthige Kraft, dann will ich herzlich gerne an ein dramatisches Werk gehen. Wünschte mir dann eins a la Lohengrin, rom. (romantisch) religiös-misteriös und besonders frei von allem Unreinen – –«
Nach einiger Zeit bearbeitete Fräulein Bolle die Novelle »Die Toteninsel« von Voß unter dem Titel »Astra« und schickte sie an Bruckner. Die Hoffnung, mit ihm darüber zu verhandeln, erfüllte sich nicht –, seine Kränklichkeit nahm zu, und er rüstete schon zum Abschied vom Leben. Sein Sekretär A. Meißner antwortete der Dichterin am 2. Juli 1895: »… Dr. Bruckner übergab mir Ihr Libretto zu lesen und ist er Ihnen sehr gewogen; doch hab' ich wenig Hoffnung, daß er sich an den gewaltigen Stoff heranmachen wird. Ich vermuthe, daß seinem Genie ein ausgesprochen katholisches Libretto, z. B. eine dramatische Legende, die keineswegs gegen das Dogma verstößt, besser zusagen würde, und müßte die Form entsprechend kürzer gehalten sein, wie z. B. Liszts Legende der heiligen Elisabeth, jedoch gleich für die Bühne gedacht und nicht wie letztere als Oratorium konzipirt und dann in Szene gesetzt, also eine Art Polieucte von Corneille. Leider treffen wenige Dichter unserer Zeit den katholischen Ton, wie ihn die spanischen Dichter, z. B. Calderon, so meisterhaft behandelten und ich könnte Sie nur auf das Aufrichtigste beglückwünschen, wenn es Ihnen gelänge mit Bruckner ein derartiges Werk zu vollbringen. Dies jedoch nur meine Privatäußerung, die ich durchwegs subjectiv gethan, doch muß ich Euer Hochwohlgeboren bemerken, daß sich meine Überzeugungen, speziell religiöse, mit denjenigen des Meisters fast immer decken.«
Und besonders frei von allem Unreinen … Dies ist wohl der wichtigste Satz aus der Episode. Zweifellos hätte Bruckners Dichter, wie Meißner sehr mit Recht äußert, ein Drama gestalten müssen, worin die Tedeumsgläubigkeit, die Credofestigkeit, kurz, sein religiöses Heldentum sich wie in einem szenischen Choral entladen konnte: auch auf der Bühne konnte der letzte christliche Musiker kein anderer werden, als er in Messe und Sinfonie war, und hätte er die Bühne damit gesprengt. Da er den katholischen Dichter nicht zu finden vermochte, fand er auch »seine« Oper nicht, und die Welt blieb um ein Kunstwerk ärmer. Beethoven hat nur einmal seinen Dichter gefunden, den Mann, der, das Beethovensche Ethos erratend, eine fast untheaterhafte Welt der Gattentreue formte, in die Beethoven zuletzt – sich selbst mit dem Bekenntnis der allgemeinen Menschenbefreiung stellte.
Darin liegt wohl auch der Grund, warum Bruckner nicht Chöre, Lieder, Klavierstücke, kurz, nicht Gesellschaftsmusik aller Arten schrieb. Er war keine vielumfassende Natur. Seine Welt ist mehr tief als breit.
Er hat auch keine Chorsinfonie geschrieben. Im Finale seiner Fünften Sinfonie blickt er zwar, die Themen prüfend, auf die Vergangenheit des Werks, die ersten drei Sätze zurück, wie Beethoven in der Neunten. Aber ein Chorfinale? – Hätte Hans von Bülow vom Brucknerschen Ethos gewußt, so hätte er nicht den bissigen Witz gewagt: auch Bruckner werde seine Neunte mit einem Chorfinale schließen müssen.
In der Chorsinfonie, wie sie heute üblich geworden ist, liegt vielleicht das gewaltsame Hereinziehen einer idealen Gemeinde, nach der der Tondichter um so heftiger lechzt, je weniger sie im Konzertsaal vorhanden ist. Als ob außen niemand mehr an diese Musik glaube, sammelt der Tondichter selbst eine Schar Andächtiger um sich. Bruckner mußte aus innersten Gründen davon Abstand nehmen, der Gedanke konnte ihm gar nicht kommen, denn noch vor seiner Gemeinschaft voraussetzenden Sinfonie hatte ihm die Messe die natürliche, singende Bruder- und Schwesterschaft geboten.
Er floh nicht in die Frömmigkeit wie Liszt, er endete nicht bei Gott, er war einer der wenigen, die im technischen Jahrhundert Gott schauen konnten. Sein Ethos erwacht in den Mannesjahren, beseelt Bau und Sprache, seine Reife wird reifer und gibt dem schönen Einfall die Vollendung. Er benützte den zeitlich letzten Musikausdruck, aber in der Treue gegen sein Ethos, im unbewußten Sichreinhalten von jeder »Bewegung« lag die Kraft und Größe seiner Persönlichkeit. Seine Werke sind »Unbekümmerte Sinfonien«, bis auf die Zweite abseits von Tag und Tageskritik geschrieben, die gestern »alt« und »ja nicht modern«, heute »nur modern« und »Anschluß an die Zeit« verlangt …
Sein religiöses Erlebnis bestimmt seinen Stil.
Seine Phantasiegespräche mit Beethoven, sein Sichkleinfühlen vor ihm gewinnen neue Bedeutung: Bruckner ging vom Erlebnis der reinen Sinfonieform aus, er gibt diesen Formen Weite, Gewalt und Höhe; aber er kann nicht dichterische Ideen musikalisch gestalten, er ist kein Gedankenmusiker. Und fühlt irgendwie, daß es bei Beethoven Welten gibt, in die er nie gelangen, deren Fernen er nie gestaltend durchmessen kann. In diesem Bekennen – er sei vor Beethoven »klein wie ein Hündchen« – ahnt sich seine Enge selbst, mißt er am Unbeschränkten das eigne Beschränktsein.
Bruckners Größe und Grenze liegt in seinem Ethos.