
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Sein Unterrichten am Konservatorium war fruchtbarer, als Herbeck vielleicht selbst dachte. Das Urtümliche seiner Erscheinung zog viele Schüler an die Anstalt. Dazu kam des Grundgelehrten schrankenlose Technik und die sonderliche Vortragsart, die sich bald herumsprach. Welches Vergnügen gewährten auch diese Harmonielehre-Stunden, die zur unmöglichsten Zeit, von eins bis drei nachmittags, stattfanden und das Leitwort verdienten: res severa magnum gaudium! Den langen Schultisch umsaßen junge Leute von überall her, sogar Amerikaner fehlten nicht, fast jeder hatte einen Spitznamen von Bruckner, und er selbst thronte am Kopfende, an einen jener gewaltigen bäuerlichen Apostel erinnernd, die den Samen des Worts ausstreuten.
Das Unterrichtenmüssen ist ihm oft Last und Bedrängnis gewesen, und wurde es später immer mehr. Manchmal kam er von Hause, die Ergriffenheit der Schaffensstunden noch im Antlitz.
Bisweilen setzte er sich nach der Stunde zum Klavier, um mit zitternder Hand Gedanken fortzuspinnen, die mit ihm von Hause gekommen waren, es wurden auch Monologe des innerlich mit sich zu Rate gehenden Künstlers laut, woraus dann die Böswilligkeit – was entstellt sie nicht? – mancherlei Legende erfand. Doch darf man sich nicht vorstellen, daß Bruckner, wie es von Schumann erzählt wird, den Unterricht mit innerlicher Abwesenheit erteilt hätte: dazu war er zu sehr »alter Lehrer« und gewissenhafter Pflichtmensch.
Er ließ nicht mit sich spaßen, verlangte von seinen Schülern den Respekt, den er Sechter entgegenbrachte, und konnte, wenn notwendig, recht rauh werden. Er kam pünktlich mit dem akademischen Viertel, verlangte Ordnung bis zur Pedanterie, milderte aber alles durch die Brucknersche Gutmütigkeit, die wie Sonnenschein aus seinem alten Gesicht brach. Belebend wie jener Klavierlehrer, von dem Goethe in Wahrheit und Dichtung erzählt, er habe, um neue Schüler zu gewinnen, Finger, Tasten und Töne mit allerlei komischen Namen versehen, vermenschlichte er die Intervalle auf eine ergötzliche Art und führte sie auf der Tafel wie auf einer kleinen Bühne vor, und die Sept, die ihre Auflösung etwa durch eine andre Stimme besorgen ließ, war »ein großer Herr«, der einen Gutsverwalter angestellt und ihm die Arbeiten übertragen hatte.
Dabei kargte er nicht mit Gedächtnissprüchen, wodurch er die trockenen Regeln der Grammatik einprägsam machte. So zitierte er mit Vorliebe: »Mi contra fa – diabolus in musica!«, ein Kernsatz, der die Abneigung des strengen Satzes gegen den Tritonus-Schritt verkündete. Dann hatte er sogenannte Hausmittel. Eins hieß: alle Vorhalte möglichst weit oben! Ein anderes betraf die musikalische Rechtschreibung: wie weit man mit Kreuzen und Been in einer Tonart gehen darf und dergleichen mehr.
Unfehlbar wurde der Komponist einer allzu kühnen Modulation mit oberösterreichischen Ehrentiteln belegt, der Unglückliche, dem ein unerlaubtes offenes »Oktaverl« oder »Quinterl« unterlief, mit »Backsimperl« gebrandmarkt, wodurch er aus der Reihe der Gelehrten seit Guido und Zarlino ausschied. Trotzdem kannte Bruckner seine Leute ganz genau, seine Schlußnoten bewiesen sein Gerechtigkeitsgefühl. Von der Methode anderer Theorielehrer hielt er nicht viel – was nicht im Sechter stand, stand nicht in der Welt; und schon gar nichts hielt er von den Verfügungen der Direktion in diesem Gegenstand. Wiederholt sprach er seinen Unmut darüber aus, daß die Unterrichtsdauer für Theorie am Konservatorium viel zu kurz bemessen sei. Schon im April 1869 wünschte er, drei von den systemisierten wöchentlichen Orgelstunden der Theorie zuwenden zu dürfen, und die Direktion willigte ein. Im Jahre 1874 richtete er an den Schulausschuß eine Eingabe, worin er »in Folge mehrjähriger Erfahrungen« ersuchte, es möge, wenn tunlich, die frühere Ordnung wieder eingeführt und dem Jahrgang für Kontrapunkt ein zweiter für Fuge und Kanon angehängt werden. Das Gesuch wurde abgelehnt. Auf die Frage Doktor Marschners, wie er sich den Lehrplan dächte, antwortete Bruckner: für Harmonielehre seien unbedingt drei Jahre erforderlich; für die Kompositionslehre dagegen genügten einige Monate, da die Komposition eigentlich nicht lehrbar sei.
Er unterrichtete sehr langsam, so wie er selbst arbeitete, und doch ging ihm alles zu schnell. Aus alten Schulheften, die der Verfasser aufbewahrte, ist zu ersehen, wie streng er die Vorbereitung des (dissonierend gedachten) Quartsext-Akkordes und das stufenweise Fortschreiten seines Basses verlangte, Dinge, die er als Komponist auf den Kopf stellte, und wie lang bei ihm der Weg von der Diatonik zur Chromatik wurde. Sein Schüler Vockner, der zehn Jahre lang bei ihm lernte, dünkte ihm Anlagen zur Gründlichkeit zu haben … Seinem Privatschüler Eckstein riet er nach jahrelangem Studium: »Wenn Sie einmal ordentlich und gründlich Kontrapunkt durcharbeiten wollen, dann schauen Sie, daß Sie das Manuskript von Sechter über den Kontrapunkt zu Gesicht bekommen!« Sechters Abhandlung »Vom einstimmigen Satze« (als Fortsetzung der Abhandlung über die richtige Folge der Grundharmonieen, 1854) schien ihm überhaupt das Heiligste vom Heiligen.
Freiheiten aus Wagners und Liszts Partituren trug er nicht vor. Die Fundamental-Lehre war das alte Testament, die unantastbare Offenbarung selbst. »Wenn die Fundamente in Ordnung sind«, pflegte er zu sagen, »dann ist auch der Satz in Ordnung«. Oder: »Die richtige Ordnung der Fundamente ist das Geheimnis des klassischen Stils«, und nur für die dramatische Musik waren Ausnahmen anerkannt.
Auch spekulative Harmonielehre trug er nicht vor. Er kannte weder Riemann noch Westphal. Die Quint der zweiten Stufe in dur wurde einfach als »unreine Quint« oder mathematisch falsch bezeichnet, weshalb sie im Dreiklang d, f, a fallen und die anderen Stimmen nach sich ziehen müsse:
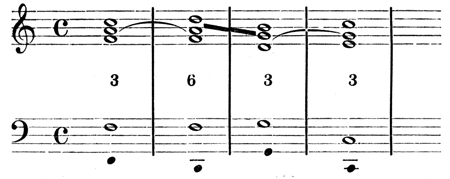
Das gab jedenfalls eine klingende Stimmführung – Privatschülern verriet er auch wohl, daß jenes a um einen Neuntel-Ganzton zu tief sei – im Kurs des Konservatoriums jedoch erfuhr der Hörer ein Warum nicht: weder daß dieser Akkord auch unterdominantisch sein könne (auf F-Fundament bezogen), noch daß das a als Quintintervall um das syntonische Komma höher ist als das Terzintervall – Bruckner hatte es auf das rein Praktische angelegt. Mit eiserner Strenge hielt er darauf, daß die Sechterschen Akkordketten mit Fundamenten geschrieben wurden, und ließ alle Dreiklänge, Sextakkorde, Nebenseptakkorde vierstimmig über allen Fundamentaltönen in Sequenzform verbinden (obwohl sich schon Fétis gegen die Sequenz ausgesprochen hatte.)
Sein Unterrichten war gründlich, aber auch begrenzt. Doch niemals erweiterte er es durch Beispiele aus eigenen Werken: er lehrte nicht »freie« Komposition, nicht seine Kühnheiten. Man kann mit Dr. Franz Marschner zusammenfassen: »Das ungeheure Material der Sechterschen Theorie vereinfachte und verdichtete er in bewunderungswürdiger Weise und konnte als Muster und Vorbild aufgestellt werden, wie man dem Zögling eine verhältnismäßig beschränkte Anzahl von Maximen und Regeln in folgerichtiger Weise zum Eigengut mache …«
Mitunter erzählte er etwas von Hanslick, von den Philharmonikern und schüttete sein Herz aus; aber trotz dem gelegentlichen Abspringen, wobei er seine Angelegenheiten als allbekannt voraussetzte, hat er eine Reihe ausgezeichneter Menschen ins Musikleben entlassen, darunter August Göllerich, den er als seinen Biographen bezeichnete, Camillo Horn, Cyrill Hynais, Gustav Kryzanowski, Ferdinand Löwe, Dr. Franz Marschner, Felix Mottl, Artur Nikisch, Emil Paur und Gustav Mahler, auf den er besondere Stücke hielt, und der auch den ersten Klavierauszug der Dritten Sinfonie machte. Unter ihnen sind tüchtige Kontrapunktiker, namhafte Dirigenten, kurz Männer, die den Ruhm des Konservatoriums bilden. Und fast alle blieben seine Freunde, als sie schon aufgehört hatten, Schüler zu sein, und wurden seine Verkündiger, als sie reif waren. An seinen Früchten …
Unter seinen Lehrkollegen zählte Bruckner nicht zu viel Anhänger. Er konnte sich wenigstens über ein Übermaß von Freundschaft nicht beklagen. Das hing mit dem Liberalismus zusammen, dessen Geist aus dem Konservatorium wörtlich eine Bewahrungsanstalt machte, und man könnte die Stellung Bruckners, der den bäuerlichen Lehrertyp darzustellen schien, der katholisch und ultramodern zugleich war, nach beiden Seiten hin sehr abweichend sich geberdete, kurz als die des Kollegen Crampton bezeichnen. Die Zeit der modern komponierenden Professoren war noch nicht gekommen. Der Direktor Josef Hellmesberger, Herbecks Freund, als Quartettspieler wie als Causeur gleich klassisch, wußte schon, was für ein Musiker in Bruckner stak, war aber vom Lehrer und Organisten weniger begeistert. Bruckner begegnete dem eleganten, witzigen Herrn bei den Jahresprüfungen sehr devot – aber von den Fugenthemen, die Hellmesberger aufgab, Themen, die sich nicht auf Fundamentalschritte zurückführen ließen!, dachte er wieder wenig glorreich. Alles verschwand unter den Bücklingen, die Bruckner auch dem Generalsekretär des Konservatoriums, L. A. Zellner, machte, der eine Musikzeitung herausgab, als Vorgesetzter aber den subalternen Ordnungsmenschen herauskehrte und gelegentlich einen frechen Feuerwächter gegen den Professor in Schutz nahm. Man konnte nicht wissen, der Mann mochte vielleicht schädlich werden. Man kann diese Devotion, die uns nicht immer sympathisch berührt, als Nachklänge aus der Windhager Zeit der Unterwürfigkeit, als Waffe des sonst Unbewehrten im Lebenskampf betrachten – ausgeglichen wird sie nur durch kernhafte Formen von Selbstgefühl, das Bruckner gelegentlich in Originalpracht äußerte. Als der Vertreter eines großen Verlagshauses in Berlin, der die Siebente Sinfonie geprüft hatte, einige Bemerkungen über die »Verworrenheit« des letzten Satzes wagte, war das Stichwort gegeben: »Verworren?« fuhr es aus Bruckners Bauernkehle, »das haben die V… damals auch bei der zweiten Sinfonie von Beethoven gesagt!«
Eine Ausnahme unter den Kollegen am Konservatorium bildete der vornehme Wilhelm Schenner, eine Stifter-Natur, Jugend- und Schulfreund Ludwig Speidels, mit dem er die Brucknerschätzung teilte.
*
Aus einer Mitteilung Gräflingers ersieht man, daß Bruckner in seinen Wiener Anfangszeiten auch Theorielehrer an einem Pädagogium gewesen ist. Wenigstens wird dies durch einen Zwischenfall bekannt, der ein schmähliches Licht auf früh erwachte Machenschaften wirft. Er sprach in einem weiblichen Jahrgang eine Kandidatin, eine Schuhmacherstochter, mit »lieber Schatz« an, so arglos wie er einen Schüler gelegentlich »Viechkerl« oder »Hallawachel« ansprach. Die Betroffene tat auch nichts dergleichen, aber eine moralische Kollegin fühlte sich gedrängt, diesen Ausdruck »anzuzeigen«. Die Folge war eine Untersuchung. Bruckner ging natürlich gerechtfertigt daraus hervor – aber damit war der Fall, der für ihn eine »schwere Heimsuchung« bedeutete, nicht abgetan. An die Untersuchung knüpfte sich eine unterirdische »Aktion«, an denen in Wien nie Mangel ist. Denn in Witts »Fliegenden Blättern für katholische Kirchenmusik« erschien eines schönen Tags (Jahrgang 1872, Nr. 2) eine unschuldig aussehende, aber höchst pharisäische Notiz, die geeignet war, die ganze Rechtfertigung Bruckners zu zerstören: »Jüngst brachte die ›Tonhalle‹ die Nachricht, Bruckner sei seiner Stelle als Professor am Conservatorium in Wien wegen Angriffen auf die Sittlichkeit einer Schülerin entsetzt worden, wobei sie ihn aber verteidigt, indem sie meint, dieser Grund der Entsetzung sei nicht genügend erwiesen. Wir halten demnach Hrn. B. für unschuldig.« Dieses Dokument von feiner Niedertracht war offenbar aus der Hand eines journalistisch Routinierten hervorgegangen und sollte das aliquid haeret zur Folge haben, denn »Entlassung … Sittlichkeitsdelikt … Bruckner …« das blieb wohl im Gedächtnis des Durchschnittslesers haften.
Recht unbehaglich wurde dem Meister manchmal auch ein Amt, das er 1875 antrat, das Lektorat an der Wiener Universität. Er gehörte als Lektor nicht dem Professoren-Kollegium der Hochschule an, hielt aber seinen Kurs in einem öffentlichen Hörsaal. Bruckner glaubte nun, Hanslick verfolge ihn unter anderem deshalb, weil er gegen dessen Willen – Hanslick war Professor der Musikgeschichte und -Ästhetik – ernannt worden sei: »Das wird er mir nie verzeihen …!« Der Verfasser hat es aus Bruckners Mund öfter vernommen, auch Karl Hruby bestätigt es; jedoch fehlen dafür andere Belege. Immerhin mag Bruckner die bloße Annahme bedrückt haben. So gemütlich wie in Linz ging es hier nicht her!
Sein Kolleg war immer stark besucht. Er pflegte dort sogar gewisse Lehren (etwa Sext-Akkordverbindungen) ausführlicher vorzutragen als in seinen anderen Kursen. Die Darstellung, als habe man die Sache nicht ganz ernst genommen – Louis läßt dergleichen durchblicken – bestreitet aufs lebhafteste Friedrich Eckstein, der Bruckners Hörsaal zur Ergänzung seiner Privatstunden zwei Jahre lang besuchte. Bruckner habe wohl manchmal, im Vortrag aussetzend, Dinge berührt, die ihn augenblicklich bewegten wie besonders unartige Presse-Angriffe, und ein Original war er immer, aber er war auch hier der gewissenhafte Lehrer. Auf dem alten dünntönigen Klavierchen im Hörsaal pflegte er u. a. Mendelssohns Herbstlied vorzuspielen, als Beispiel für das Linienschöne der klassischen Komposition, wie er denn überhaupt die löbliche Gewohnheit hatte, Verbesserungen auf dem Klavier zu zeigen und diese Stellen auf der Tafel als Diktat nachschreiben zu lassen.
In diese Zeit fallen auch mehrere Auslandsreisen Bruckners, die man als Orgelreisen bezeichnen könnte. Am 27. April 1869 fand in der Kirche von St. Eprve in Nancy die feierliche Einweihung einer neuen, auf der Pariser Weltausstellung preisgekrönten Orgel statt. Dazu waren mehrere französische und ausländische Organisten erschienen, die an der Prüfung der Orgel und nachfolgendem, feierlichen Probespiel teilnahmen, so u. a. Renaud de Vilbac aus Paris, Stern aus Straßburg, Girod aus Namur, Oberhoffer aus Luxemburg und Anton Bruckner. Er scheint seines gleichen überragt zu haben, denn die Zeitungen und Lokalblätter beschäftigen sich mit ihm: so wird im Journal de la Meurthe et des Vosges gesagt, daß Bruckner Professor am Konservatorium und Organist beim Hofe ist, »den wir nur glücklich schätzen können, einen solchen Künstler zu besitzen«; die Espérance schrieb: er habe die Feier in würdiger Weise durch eine künstlerische, prächtige Phantasie beschlossen und am nächsten Tag mit reicher Klangfülle und ausdrucksvollem Spiel, wie es nur wenigen eigen ist, die österreichische Volkshymne zu Gehör gebracht.
Bruckner selbst berichtet darüber in seiner Weise an ein Direktionsmitglied des Wiener Konservatoriums, wobei er zugleich »inständigst« um eine gnädige Verlängerung seines am 3. Mai endenden Urlaubs bittet, denn die Direktion hatte sich seines »pünktlichen Eintreffens« versehen und er war gewissenhaft; aber »die Herren, die für mich zahlen, bathen mich, doch ja nach Paris zu gehen u. dort noch eine neue, fertige Orgel zu spielen«. Der »Pariserorganist« Vilbac scheint ihm anfänglich, weil in Nancy schon eingeführt, vorgezogen worden zu sein. Beim ersten Konzert hatte Bruckner »die Musikalischen« auf seiner Seite, beim zweiten (29. April) wetteiferten »der hohe Adel, die Pariser, die Deutschen und Belgier in ihren Anerkennungen«, ja was Sachkundige sagten, verbiete ihm die Bescheidenheit mitzuteilen, »liebenswürdige Fräulein aus dem höchsten Adel kamen sogar zur Orgel und bezeigten mir ihre Anerkennung«.
Da der Verfasser selbst Zeuge einer ähnlichen Szene im Wagner-Verein war, wo die jungen Damen des Chors bei einer Tedeum-Probe den alten Meister umdrängten – Parsifal unter den Blumenmädchen, – so ist, zumal bei der brucknerschen Wahrheitsliebe, kein Grund, an dem Bericht zu zweifeln. Er hat in Nancy als Organist Eindruck gemacht, man drängte ihn, auch nach Paris zu fahren, er wollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, und so fuhr er hin, spielte dort im Atelier des Orgelbauers Merklin-Schütz und hierauf in der Notre-Dame-Kirche, wo er ein aufgegebenes Thema eine halbe Stunde lang kunstvoll durchführte. Nach seinen Äußerungen dürfte er auch noch den greisen Auber und den jugendlichen Saint-Saëns kennen gelernt haben.
Die Linzer Zeitung begrüßt Bruckners Rückkehr aus dem Ausland (19. Mai 1869) in einem begeisterten Artikel und verzeichnet »diese Erfolge mit großer Befriedigung, denn die Ehre, welche Bruckner persönlich zu Theil wurde, ist auch eine Auszeichnung für das Land und den Ort, wo dieser liebenswürdige und bescheidene Künstler geboren wurde«. Auch der Bürgermeister von Sankt Florian ließ sich's nicht nehmen und schickte Bruckner ein Glückwunschschreiben. Die Linzer Zeitung spricht geradezu von einem Orgelwettkampf – da sieht man, was ein Linzer kann! – und wer das Zeitungsleben kennt, wird aus der Überschwenglichkeit des Berichts die Überschwenglichkeit des eben heimgekehrten Erzählers – ja, wenn man eine Reise tut! – als Quelle heraushören. Wahrscheinlich hat Bruckner, sich an Florian und Linz erinnernd, in der Ansammlung so vieler Organisten zu Nancy eine Aufforderung zum Sängerkrieg erblickt. Jedenfalls hat er dort gut abgeschnitten, und seine Erfolge gingen, vielleicht ein bißchen aufgebauscht, dann wieder bestritten in die Fachblätter über.
Zwei Jahre darauf fuhr er nach London, wo eben die Weltausstellung abgehalten wurde. Er war bei der Wiener Handels- und Gewerbekammer um die Entsendung nach London eingeschritten, es wurde ein Probespiel der Bewerber am 18. April 1871 in der Pfarrkirche Maria Treu veranstaltet, und die Wahl fiel einstimmig auf Bruckner. Darin lag schon sein Erfolg. In London hatte er, auf Einladung der Royal Commissioners der Albert Hall, an acht verschiedenen Tagen für ein Honorar von 50 Pfund in der Ausstellung zu spielen. An irgend einen Händelschen oder Haydnischen Eindruck des ganz Unbekannten, der im Ausstellungsrummel kaum auffiel, darf man nicht denken. Das große Publikum, das in der Halle aus- und einging, wird wahrscheinlich höchst ahnungslos die Orgel gehört haben, ohne sich zu kümmern, welche Zelebrität gerade spiele; immerhin hat Bruckner den Berufsgenossen und Kritikern Achtung abgerungen, denn er wurde in den Kristallpalast noch zu einem kurzen Orgel-Recital für den 19. August eingeladen, das er auch abhielt. Die Äußerungen der Presse – wahrscheinlich war in der Sommerhitze die zweite Garnitur tätig – lassen mehr gut britische Gesinnung als musikalische Gegenständlichkeit erkennen. Der Ausstellungs-Kommissär wird nebenbei wegen der Auswahl der Organisten angegriffen und Bruckner zwar hervorgehoben, jedoch mit trockenem Witz abgefertigt: »Das offizielle Programm betonte, daß Herrn Bruckners ›starke Seite‹ auf dem Gebiet der klassischen Improvisationen zu suchen sei; demgemäß waren wir darauf vorbereitet, daß die Wiedergabe der Mendelssohnschen Orgelsonate Nro 1 eine ›schwache Seite‹ zeigen werde, und das war thatsächlich der Fall.« Zu Bruckners Entschuldigung wird angeführt, daß er sich vorher mit dem Mechanismus dieser Orgel nicht vertraut machen konnte und später besser spielte. Ein zweiter Bericht (»The Orchestra«) stellt auch fest: »Er hat uns eine unvorbereitete, großartige Fantasie vorgespielt, welche, obzwar nicht sehr originell in Gedanken und Anlage, doch große Gewandtheit verrieth und bemerkenswert war durch den kanonartigen Kontrapunkt und die Überwindung großer technischer Schwierigkeiten in den Pedalpassagen.«
Jedenfalls kam Bruckner noch gut davon, denn die Schilderung der Vorfälle bei einem anderen Ausstellungsorganisten, Johann Schneider, grenzt geradezu an Dickenssche Humoresken. Dieser Schneider wollte nicht aufhören, vergeblich flehte das Komité, vergeblich stöhnte das Publikum. Man packte ihn an den Rockschößen, aber als er noch immer nicht wich und weiterdröhnte, faßten ihn die Herren vom Komité an den Beinen und hoben ihn von seinem Sitz … Aus dem ganzen geht hervor, daß Bruckner zwar nicht London bei dieser Gelegenheit eroberte, aber immerhin seinen Mann stellte, und die Hauptsache für Wien war –: daß er dort gespielt hatte. In einem kleinen Lebensbericht, den er für Dr. Theodor Helm schrieb, erzählt er denn auch, er habe in London sechsmal in der Alberthalle und fünfmal im Kristallpalast »mit größten Erfolgen« gespielt.
Er erhielt nachträglich wie jeder andere eine Anerkennungsmedaille, und damit war dieser Zwischenfall abgetan.
Er verstand kein Wort englisch, fand, in der Riesenstadt umherirrend, nur durch seinen deutschen Friseur nach seinem Quartier, Finsbury Square, zurück und dürfte von den Auslandsreisen überhaupt eine Befruchtung kaum mitgebracht haben. Auch sein großer Zeitgenosse Arnold Böcklin ist in Paris gewesen, und, ohne ihm sonst viel zu geben, hat der Aufenthalt »den Jüngling frei gemacht von allenfalls ererbten Resten kleinstädtischer Engherzigkeit und kleinbürgerlicher Vorurteile, unter welchen er aufgewachsen war.« Gleiches könnte man, ganz abgesehen von der Kürze der Ausflüge, von Bruckner nicht sagen. Die schönen Tage von Nancy, wo ihn die jungen Damen beglückwünschten, hoben gewiß sein Selbstgefühl; aber im Herzen ging er wohl lieber nach Stadt Steyr … Und von Paris und London dürfte er kaum viel mehr gesehen haben als die Orgeln. Übers Meer fahrend änderte er nur den Himmel …
In glücklicher Unkenntnis der Verhältnisse hatte jene französische Zeitung den Wiener Hof beneidenswert geschätzt, der einen Organisten wie Bruckner besaß. Aber diese Besitzergefühle entwickelten sich nur allmählich zu Gedeihlichkeiten. 1868 auf Herbecks Vorschlag zum (unbesoldeten) Expektanten bei der Orgel der k. k. Hofkapelle ernannt, rückt Bruckner nur langsam, nicht »außerturlich« vor. 1875 wird er Vizearchivar der Hofmusikkapelle und zweiter Singlehrer der Hofsängerknaben mit einem Gehalt von jährlich 300 Gulden. Im gleichen Jahr aber wird die erbetene Stelle des Hoforganisten nicht Bruckner, sondern Pius Richter verliehen, und erst 1878 steigt er zum »wirklichen« Hofkapellenmitglied auf (mit 600 Gulden Gehalt, kleinen Zulagen und Quartiergeld von 200 Gulden): – fast zehn Jahre hatte er demnach zu warten. Jedoch genoß er die persönliche Auszeichnung, daß er bei allen Trauungen von Mitgliedern des Kaiserhauses die Orgel spielen mußte: hier schätzte der Hof wirklich seinen Namen und bediente sich seiner gern. Gewiß ist auch, daß Bruckner, den seine Linie vom Florianer Sängerknaben bis zum Lehrer der Hofsängerknaben emporgebracht hatte, immer weniger in der Hofkapelle zu tun hatte und zuletzt nur eine Art Ruheamt ausübte, das ihm wenig Beschwerden machte.
Die Dienstverhältnisse scheinen nicht immer die angenehmsten gewesen zu sein, und zwar, wie es zu gehen pflegt, aus persönlichen Unstimmigkeiten. Dem Hofkapellmeister Hellmesberger lag in erster Linie daran, um die liturgischen Vorschriften glatt herumzukommen, weshalb ihm tüchtige Musikhandwerker lieber waren als Künstler. Ein Dutzendorganist vermochte das rein Dienstliche gewiß auch geschickter zu versehen, als Bruckner der Phantasiemensch, und es wird ihm vorgeworfen, daß er zu Gesang und Orchester »nachzuziehen« pflegte. Wie dem immer sei – auch Liszt war bei der Wiener Aufführung seines Weihnachtsoratoriums durch Rubinstein mit Bruckner an der Orgel wenig zufrieden – er fand in der Hofkapelle einen immer stärker eingeengten Wirkungskreis und wurde zuletzt nur bei den nachmittäglichen Segenmessen, nicht bei den großen Ämtern verwendet. Er fühlte Zurücksetzung und hat sich manchmal bitter beklagt. Dazu kam, daß der katholische Gottesdienst seiner Begabung des freien Improvisierens nicht den weiten Spielraum ließ wie der protestantische. Und was der Gottesdienst noch übrig ließ, nahm Hellmesberger weg, denn in Kinderbetrübnis erzählte eines Abends Bruckner seinen Schülern, Hellmesberger habe ihm bei einer Palestrina-Probe vor dem ganzen Chor gesagt, er dürfe nicht im Palestrina-Stil präludieren, sondern nur in Dreiklängen improvisieren … (August Stradal).
In der Hofkapelle ein Pegasus im Joch, vermochte er bei freiem Phantasieren Menschen mit andauerndem Orgel-Erlebnis zu erfüllen. Allerdings hing seine Orgelkraft wohl stark von Stimmungen ab und war kein immer glatt arbeitender Mechanismus. Dr. Franz Marschner hörte ihn zu Ostern 1884 in Prag auf der neuen Orgel des Rudolfinums, wobei ein zuhörender böhmischer Regens Chori unter enthusiastischen Zwischenrufen den großartigen Fugenaufbau analysierte, der sich da vollzog. War hier der Symphoniker herauszuhören, so spielte Bruckner Tags darauf in der Strahower Kirche ganz anders, etwa in der Art Händels. Bei der Messe in der Domkirche hinwiederum hatte er, erregt und gereizt, mit einer fugierten Improvisation wenig Glück. Dagegen ließ Richard Heuberger, der sich immer durch besonderes Unverstehen Bruckners auszeichnete, in seinem herostratischen Nachruf (Neue Freie Presse vom 13. Okt. 1896) kein gutes Haar an ihm: »Was wir im Laufe der letzten 20 Jahre von ihm zu hören bekamen – so z. B. bei der Einweihung der neuen Orgel im Stephansdom – war nicht bedeutend. Mehr Farbenprunk als innerer Gehalt. Makarts Abundantia auf der Orgel …«
Ein echtes Stück Leben ist aber die Schilderung, die Dr. Hans Kleser (abgedruckt bei Brunner, S. 21) von Bruckner, dem dämonischen Organisten des Herrgotts, hinterlassen hat. Sie waren zusammen an einem heißen Sommertag (1886) dem giftigen Staube Wiens entflohen, um bei den gastlichen Mönchen des nahen Stifts Klosterneuburg einen labenden Trunk alten Weins zu tun. Dort angekommen, ließ Bruckner die Stiftskirche aufschließen und setzte sich an die große Orgel. »Ein paar Mönche, einige wenige Fremde und ich waren die einzigen Zuhörer. Er phantasierte so herrlich, so überraschend erfindungsreich und spielte technisch so überwältigend, daß wir – die Zuhörer – unter der gewaltigen Wirkung förmlich ermüdeten. Wir hatten insgesamt das Gefühl, als seien wir in der Gewalt eines Zauberers, der uns nicht loslassen wollte, dessen wir uns auch nicht erwehren könnten. Endlich war die Aufnahmefähigkeit meines Nervensystems erschöpft, ich stürzte nach der Emporkirche, um Bruckner zu sagen, er solle sich nicht überanstrengen. Da saß der starke Mann mit dem mächtigen Kopf auf der Orgelbank und arbeitete mit Händen und Füßen wie ein Entrückter, ohne mich auch nur zu hören; das Wasser lief ihm den ganzen Körper hinunter; Rock, Weste und Halstuch hatte er natürlich abgelegt, und was ich auch sprach vom Aufhören – es half nichts; noch eine Viertelstunde spielte er weiter, als ob ich nichts gesagt hätte und nicht da wäre; dann endete er mit ein paar bizarren, abgestoßenen, vollen Akkorden, stieß die Register ein, schlug die Orgel zu, zog sich Weste und Rock an und schritt mir voran in den schattigen Klostergarten, wo wir dann in kleiner Gesellschaft einige Flaschen 35er tranken, mit dem liebenswürdigen Meister aber von seinem Spiel kein Wort sprachen, obschon wir fort und fort unter dem Eindruck davon standen.«
Später hat Bruckner nichts mehr für die Orgel geschaffen. Sie liebend, wie von neuen Künstlern außer ihm nur Max Reger, hat er nicht wie Reger irgend ein Werk der Orgelliebe, sei es Passacaglia oder Toccata, hinterlassen. Marschner überliefert eine ziemlich »aufgebrachte« Äußerung: »Nein, die Welt ist zu schlecht, ich schreibe gar nichts mehr für die Orgel …« Vielleicht spürte er den Unglauben einer Gesellschaft, für die Gott hinter sieben Siegeln saß, vielleicht verwirklichte das Instrument nicht mehr sein Selbst und, über sie wegwachsend, griff er in die beweglichen, grenzenlos flutenden Massen des Orchesters.
Vielleicht hängt dies auch mit der Bedeutung zusammen, die sich das Orchester allmählich im modernen Kulturleben zu sichern wußte, »denn wo auch in den spätesten Zeiten die polyphone Musik zu ihren höchsten Möglichkeiten emporstieg wie in der Matthäuspassion, der Eroica und Wagners Tristan und Parsifal, wurde sie mit innerster Notwendigkeit domhaft und kehrte zu ihrer Heimat, zur steinernen Sprache der Kreuzzugszeit, zurück« (Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, S. 282). Bruckner, der sein Orchester oft wie eine Orgel registrierte, suchte unbewußt mit einer gottgerichteten Musik nach Wirkungen im Konzertsaal, die bisher nur die Kirche mit ihren in Glaube und Gefühl zusammengeschlossenen Massen kannte, und bereitete so neues Gotteswissen durch die Musik vor.
Die Zeit erfüllte sich. Nun begann der Sinfoniker Anton Bruckner und damit der Kämpfer und Märtyrer: wenn er ruhig geblieben wäre, unschöpferisch, ein bescheidener, nach Wien hereingewehter Lehrer, ein bißchen orgelnd und kirchenmusizierend, wäre ihm auch nichts geschehen: dem Ungefährlichen hätte Gönnertum die Schulter geklopft. So aber – –.