
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
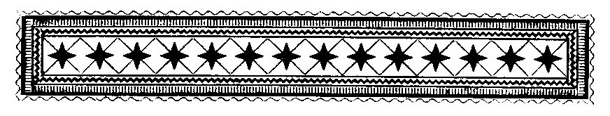
Am andern Morgen fand zwischen dem jungen Ehepaar eine Aussprache statt. Mila trug ein Morgenkleid in hellen, leuchtenden Farben, ihr Haar war sorgfältiger frisiert, ihre ganze Erscheinung hatte etwas Netteres, Anmutigeres als seit Wochen.
Sie saß auf dem Divan und sprach stockend, befangen zu Steinbach, der vor ihr auf- und abging.
»Du wußtest«, unterbrach er sie, »daß ich zur Adolfi gehen wollte, und Du sagtest mir kein Wort davon? Warum sprachst Du denn nicht offen mit mir?«
Sie schlug den Blick nieder. »Weil – weil – ich hätte es nicht fertig bekommen und wenn es mir das Leben gekostet hätte.«
Steinbach blieb vor ihr stehen und betrachtete sie kopfschüttelnd. »Aber – Ihr Frauen seid doch ganz merkwürdige Geschöpfe – warum hättest Du es denn nicht fertig bekommen?«
»Weil –« Ihr Blick haftete noch immer am Boden, während sie zögernd fortfuhr: »Ich schämte mich so sehr.«
Er sah sie erstaunt, fast verblüfft, an. »Du schämtest Dich?«
Sie nickte schweigend. Er nahm seine Wanderung durch das Zimmer wieder auf, kopfschüttelnd, grübelnd. Plötzlich ging ihm das Verständnis auf für den Beweggrund ihrer befremdenden Zurückhaltung. Ihr Zartsinn, ihr fast jungfräuliches Empfinden, das sich darin ausdrückte, rührten ihn.
»Du schämtest Dich für mich«, sagte er, wieder an sie herantretend. »O Du thörichtes, liebes Kind!«
Er küßte sie auf die Stirn und fuhr dann fragend fort: »Aber woher wußtest Du denn eigentlich –?«
»Martha sagte es mir.«
»Martha?« Er blickte erstaunt auf. »Ja, von wannen kam denn der dieses Wissen?«
»Sie hörte es.«
»Nun ja.« Frau Mila errötete. Sie senkte den Blick vor seinen forschend auf sie gerichteten Augen, während sie stammelnd, verschämt sagte: »Sie war dort da in jenem Zimmer. Ihr sprachet wohl etwas laut und –«
»Aha!« Er stieß es heftig, fast zornig heraus. »Sie lauschte, sag's nur frei heraus!«
Erregt ging er auf und ab. In schnellerem Flusse, in festerem Ton, in welchem eine leise Nuance des Vorwurfs lag, fuhr Frau Mila in ihrem Bericht fort: »Sie hörte, wie die Adolfi Dich einlud und wie Du sagtest: Ich komme, in zehn Minuten seh'n Sie mich zu –«
»Zu Ihren Füßen«, vollendete er, als sie stockte.
Sie nickte und erhob den Blick vorwurfsvoll zu ihm. Steinbach aber, ganz und gar von seinen Gedanken in Anspruch genommen, bemerkte es gar nicht. Mit erregten Schritten durchmaß er das Zimmer. Also Martha hatte er es zu danken – – –! Und wenn er nun auch von Herzen froh war, daß die Intrigue der eifersüchtigen alten Jungfer zu einem so guten Ausgang geführt, so konnte doch der egoistische, verwerfliche Beweggrund derselben seinem scharfspürenden Geist nicht verborgen bleiben. Sie hatte zwar Gutes gestiftet, ja, sie hatte ihn indirekt vielleicht vor sich selbst bewahrt, aber daß sie selbst etwas ganz anderes gewollt, darüber war er keinen Augenblick im Unklaren. Es stand sogleich bei ihm fest, daß sie nicht zum zweiten Mal in die Lage kommen durfte, gegen Mila, gegen ihn Unheil zu sinnen.
»Die Martha muß aus dem Hause«, sagte er kurz, bestimmt, »und zwar so bald als möglich.«
»Aber sie that es doch nur aus Freundschaft«, wandte Mila entschuldigend ein.
»Aus Freundschaft?« Der Sprechende lachte laut auf. »O Du unschuldiges Kind!«
Milas geradezu kindliche Arglosigkeit rührte ihn. Es war seine Pflicht, sie über den wahren Charakter der Freundin aufzuklären.
»Tu kennst die Fabel von der Natter, die man an seinem Busen nährt?«
Sie blickte befremdet, verständnislos zu ihm auf. »Wie – Martha?«
»Ist solch eine Natter«, bestätigte er mit starker Entschiedenheit, die keinen Zweifel zuließ – »und darum: Je eher sie aus unserem Hause kommt, desto besser!«
In der jungen Frau dämmerte wohl eine leise Ahnung von dem wahren Sachverhalt, aber es war doch nur eine dunkle, unbestimmte und noch dazu widrige Empfindung, die Arnos Worte in ihr hervorriefen und die von dem Mitgefühl ihres guten Herzens sogleich wieder verdrängt wurde.
»Aber was soll sie anfangen, die Arme«, sagte sie, »wenn wir sie wegschicken?«
Der Angeredete ging nachdenkend auf und ab. Da kam ihm plötzlich eine Idee. War es nicht heute gerade ein Jahr seit dem Todestage von Marthas Onkel?
»Du«, sagte er, vor Mila stehen bleibend, »vielleicht ist Martha gar nicht mehr arm, vielleicht ist sie in diesem Augenblick schon reiche Erbin. Heute ist der zehnte Februar, Du weißt, der Termin der Testamentseröffnung.«
Sie lächelte. »Und wenn sich diese Hoffnung nun nicht erfüllt?«
Der Chemiker zuckte mit den Achseln. »Dann wird sie eben eine Stellung suchen müssen, wie sie sie einst im Hause Deiner Eltern inne hatte: als Erzieherin oder als Gesellschafterin.«
Die junge Frau erhob sich. Sie war noch immer im Unklaren über die eigentlichen Beziehungen Arnos zur Adolfi. Beider Bekanntschaft war doch nur eine ganz oberflächliche, und dem Besuch, den er im Hause der Schauspielerin geplant, mußte doch irgend eine bestimmte Ursache, mindestens ein Vorwand zu Grunde liegen. Sie war sehr geneigt zu glauben, daß Martha verleumdet oder doch sehr übertrieben hatte.
»Arno!« rief Mila, indem sie dicht an Steinbach hinantrat und bittend zu ihm aufblickte, – »nun sage mir auch, was Du eigentlich bei der Adolfi wolltest!«
Ein Lächeln tauchte für einen Moment in seinen Zügen auf, dann machte er eine wichtig geheimnisvolle Miene. »Das muß vorderhand noch Geheimnis bleiben.«
Sie trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Eine unangenehme, widrige Empfindung stieg in ihr auf.
»Geheimnis?« sagte sie, ihn mißtrauisch fixierend. »Du hast etwas vor mir zu verbergen?«
»Nicht ich, aber ein anderer«, beschied er ruhig.
Ihr Befremden, ihr Mißtrauen wuchs. »Ein anderer? Und Du kannst mir wirklich nicht sagen – –«
»Nichts kann ich Dir weiter sagen«, unterbrach er sie fest und bestimmt, »als daß es nicht in meiner, sondern in der Angelegenheit eines andern war, warum ich die Schauspielerin in ihrem Hotel aufsuchen wollte.«
»Und das soll ich Dir so ohne weiteres glauben?«
Er lächelte. »Nun, natürlich.«
Wie ein Schatten legte es sich über ihr Gesicht, und ihre Stimme zitterte, als sie entgegnete: »Und wenn ich es nicht glaube?«
Steinbach zuckte gefühllos mit den Achseln. »Nun, dann glaubst Du es eben nicht«, versetzte er ungerührt.
»Aber – das ist abscheulich!« stieß sie, mit den hervordrängenden Thränen kämpfend, heftig heraus: »Weißt Du, zwischen Mann und Frau soll es kein Geheimnis geben.«
Steinbach aber blieb auch jetzt unerbittlich. Er erinnerte sich des Versprechens, das er Linder gegeben, und dann –: es war hohe Zeit, daß er sich Mila gegenüber wieder fest und energisch zeigte. Nur zu nachgiebig war er gegen sie gewesen. Er mußte sie daran gewöhnen, seiner Einsicht sich zu fügen und seine Entschließungen widerspruchslos hinzunehmen. Er erwiderte ihr Axiom mit einem anderen: »Zwischen Mann und Frau soll volles Vertrauen herrschen.«
Seine Ruhe, seine scheinbare Herzlosigkeit empörten sie. »O – das ist – weißt Du: empörend ist das!« rief sie zornig, die Hände ballend und ihn mit funkelnden Augen messend – »eine unerträgliche Tyrannei ist das und ich – ich –«
Er erwiderte ihren wütenden Blick mit einem Lächeln. »Und Du?«
Das grelle »Rrrr–r« der elektrischen Flurglocke unterbrach die häusliche Scene. Ein Thüröffnen und Zuschlagen, ein kurzes Hin- und Herreden und der laute Aufschrei einer weiblichen Stimme folgten. Kurz darauf stürmte Martha Gründler in das Zimmer, ihr grauer Teint zeigte eine ganz ungewöhnliche, rote Färbung, ihre kleinen Augen waren weit aufgerissen und blitzten, in der erhobenen Hand hielt sie wie triumphierend ein Blatt Papier.
»Eine Depesche – aus Kirchhain!« rief sie und sank atemlos auf einen Sessel.
Steinbach erriet das Ereignis, das die alte Jungfer so sehr aus dem Gleichgewicht gebracht. Kirchhain, das war die Stadt, in der Martha Gründlers Onkel gelebt und gestorben. Sicherlich handelte es sich um die Testamentseröffnung und um eine Erbschaft, die der alten Jungfer zugefallen.
»Man darf also gratulieren?« fragte er, während Mila sich bemühte, ihre Erregung zu bemeistern.
»Denken Sie nur«, stieß die Gefragte, voll Eifer und Freude, hervor, »ich bin als Haupterbin eingesetzt. Onkels Haus und fünfzigtausend Mark bar kommen auf meinen Anteil an der Erbschaft.«
»Fünfzigtausend! Nun, da wünsche ich Ihnen viel Glück,« bemerkte Steinbach kühl.
Es kostete ihm Überwindung, dem Groll, den Milas Geständnis gegen die alte Jungfer in seiner Brust hervorgerufen, nicht offenen Ausdruck zu geben. Desto herzlicher zeigte sich Mila, teils aus Opposition gegen Arno, teils von wirklicher Anteilnahme an dem Glück der Freundin erfüllt. Sie umarmte Martha und küßte sie wiederholt.
Der Chemiker aber hielt den Augenblick für geeignet, seine Ansicht für die zukünftige Gestaltung seiner und Milas Beziehungen zu Martha Gründler, wenn auch in höflicher Form, so doch in unzweideutiger Weise zu erkennen zu geben.
»Sie werden nun natürlich nach Kirchhain übersiedeln,« sagte er, »und Ihres Onkels Haus beziehen?«
Martha erschrak. Sie hatte zwar noch nicht über die Frage, welche Veränderungen in ihrer Lebenslage der unerwartete Glücksfall herbeiführen würde, nachgedacht, aber der Gedanke an ein Scheiden aus dem Steinbachschen Hause machte ihr empfindsames Herz erzittern.
Steinbach aber ließ ihr gar keine Zeit zur Überlegung und zur Antwort; sehr bestimmt fuhr er fort: »Und Sie haben recht: eigner Herd ist Goldes wert. Es ist ein schönes, stolzes Gefühl, wenn man mit dem Engländer ausrufen kann: Mein Haus ist mein Schloß! Ich kann es Ihnen wohl nachempfinden, wie es Sie drängt, je eher je lieber eigenen Boden unter den Füßen zu haben.«
Das war deutlich, und der alten Jungfer blieb nach dieser Erklärung nichts übrig, als sich mit guter Miene in ihr Los zu fügen. Dennoch war sie nicht im stande, eine ruhige Erwiderung hervorzubringen, sie begnügte sich, stumm zu nicken.
Mila aber fühlte sich einerseits durch Steinbachs der Freundin soeben bewiesene Rücksichtslosigkeit empört, andererseits war sie ihm noch ob seiner ihr gegenüber an den Tag gelegten Verschlossenheit und Unnachgiebigkeit gram. Mit ostentativer Herzlichkeit trat sie an Martha heran, umschlang sie mit einem Arm und sagte: »Ich begleite Dich, Martha!«
Die Angeredete blickte überrascht auf, aber auch in Steinbachs Miene prägte sich im ersten Moment ein unwilliges Staunen aus.
»Im Ernst,« bekräftigte die junge Frau mit hastiger Entschiedenheit und warf ihrem Gatten einen trotzigen Blick zu. »Ich bitte Dich um Deine Gastfreundschaft für einige Wochen, ja, vielleicht für einige Monate.«
Die letzten Worte hatte sie etwas langsam und mit starker Betonung gesprochen, indem sie verstohlen beobachtend zu Steinbach hinübersah. Diese Drohung würde gewiß wirken. Nun, da er sah, daß sie sich nicht willenlos seinem Belieben unterwarf, würde er sich gewiß nachgiebig zeigen und ihr offen Rede stehen. Der Chemiker aber nickte ihr mit ruhigster Miene zu. »Du hast recht, mein Kind,« sagte er, während ein kaum bemerkbares ironisches Zucken seiner Mundwinkel seine Worte begleitete, »eine Luftveränderung wird Dir gut thun und besänftigend auf Deine etwas irritierten Nerven wirken.«
Frau Mila konnte nur mühsam ihre Thränen zurückhalten. Sie fühlte sich aufs tiefste gekränkt. »Komm«, sagte sie, Marthas Arm ergreifend und sie mit sich aus dem Zimmer ziehend, »komm, wir wollen packen. Morgen reisen wir!«