
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
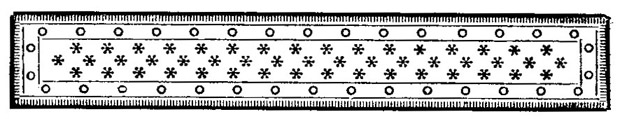
Zwei Wochen waren vergangen. In dieser Spanne Zeit hatte sich in dem Steinbachschen Hause eine tiefgehende, bedeutungsvolle Umwälzung vollzogen. Frau Mila hatte sich wirklich, getreu ihrem Vorsatze, in ihres Gatten Laboratorium installiert. Und der letztere mußte sich, gebunden durch sein Versprechen, mit guter Miene in sein Schicksal fügen.
Wenn er geglaubt hatte, Frau Mila werde bald den Geschmack an der nicht immer angenehmen und appetitlichen Thätigkeit verlieren und zu ihren weniger mühevollen Zerstreuungen zurückkehren, so war er in einem großen Irrtum befangen gewesen, wie er nun zu seinem großen Leidwesen erkennen mußte. Frau Mila hielt sich tapfer; unermüdet ging sie dem Gatten zur Hand und selbst vor der häßlichen, entstellenden Schutzkleidung, die sie der Vorsicht wegen anlegen mußte, schreckte sie nicht zurück.
In erster Linie war es der Reiz der Neuheit, der ihr alles, was sie in dem Laboratorium ihres Gatten sah, hörte und erfuhr, im Lichte des Interessanten, Anziehenden erscheinen ließ. Dann war es ihr Ehrgeiz, ihr Selbstgefühl, das sie antrieb, den Widerwillen, die Unlust, die manchmal in ihr aufsteigen wollten, zu besiegen und in ihrem Bestreben, ihres Gatten Gehilfin zu werden, nicht zu erlahmen.
Dem Chemiker aber, der anfangs seines schönen Weibchens drollige Idee von der komischen Seite aufzufassen geneigt gewesen, wurde bei dieser unerwarteten und nach seiner Ansicht ganz unweiblichen Konsequenz und Ausdauer immer unbehaglicher zu Mute. Ja, diese Unbehaglichkeit steigerte sich zum Erschrecken, als er eines Tages die Wahrnehmung machte, daß ihm Mila nicht mehr das war, was sie ihm bisher gewesen. Sie fing an, nicht nur während der Zeit der Arbeit ihre äußere Erscheinung zu vernachlässigen. Wozu brauchte sie den vergänglichen Leib zu pflegen, zu schmücken, wenn sie hoffen durfte, mit ihren geistigen Eigenschaften nunmehr ihrem Gatten von Wert zu sein?
So wurde dem Chemiker seine Häuslichkeit allmählich ein Ort des Schreckens. Seine Abende gewöhnte er sich, im Restaurant im Kreise von Bekannten zu verbringen, nur um Milas unablässigen, ermüdenden Fragen nach diesem und jenem wissenschaftlichen Gegenstande zu entfliehen. Früher, wenn die Dämmerung hereinbrach und er nach vollbrachtem Tagewerk zu Mila, die er außer bei den Mahlzeiten den ganzen Tag entbehrt hatte, in den traulichen Salon trat, da lebte er förmlich auf.
Wie freudig sie ihm entgegenkam, wie herzlich sie ihn begrüßte! Als ob sie sich eine Ewigkeit nicht gesehen, als ob sie einander stets von neuem geschenkt wurden! Und wie fröhlich und lustig sie war, wie lieb sie ihm von all den kleinen Nichtigkeiten, die damals ihren Interessekreis ausmachten, vorplauderte! Wie angenehm sich dabei der von schwerer Denkarbeit ermüdete Geist ausruhen konnte!
Jetzt aber, nachdem sie den ganzen Tag über sich praktisch an seiner Berufsarbeit beteiligt, verlangte sie, daß er sie des Abends theoretisch in seiner Wissenschaft unterrichte. Mit einer unersättlichen Wißbegierde quälte sie ihn mit ihren Fragen, bis er zuletzt, des trockenen Tones müde, seinen Hut ergriff und ärgerlich davoneilte.
Kein Wunder, daß er bei den eigenen häuslichen Sorgen, die während dieser Unglückswochen in seinen freien Stunden sein Denken in Anspruch nahmen, auch nicht ein einziges Mal sich der Besorgnisse seines Freundes Linder, die dieser an die Anwesenheit Lilly Adolfis in der Stadt knüpfte, erinnert hatte. Erst als ihn der junge Rechtsanwalt mit einer gar trübseligen Miene aufsuchte, kehrten ihm die Einzelheiten von Linders neulichen tragikomischen Geständnissen ins Gedächtnis zurück.
Er saß mit dem Freunde plaudernd in dem neben dem Laboratorium liegenden Salon; eine gewisse Scheu hatte ihn abgehalten, Linder, während ihm Mila in einem nicht gerade empfangsfähigen Kostüm assistierte, in seinem Allerheiligsten zu empfangen.
Der junge Rechtsanwalt hatte dem Freunde einen kurzen Bericht seiner vergeblichen Bemühungen, die Adolfi zu sprechen und zur Herausgabe seines kompromittierenden Tagebuches zu bewegen, mit einer wahren Armensündermiene abgelegt.
»Also sie ist noch immer unerbittlich?« fragte Steinbach, der dem Freunde nur zerstreut zugehört hatte.
Linder seufzte und blickte melancholisch vor sich hin.
»Wie ein Stein,« entgegnete er kleinlaut. »Fast ein dutzendmal war ich nun schon in ihrem Hotel. Immer dasselbe negative Resultat.«
»Einfach unsichtbar?«
»Sie bedauert, mich nicht empfangen zu können. Das ist alles, was sie mir durch den Kellner sagen läßt.«
Steinbach nickte lächelnd. »Ja, ja,« bemerkte er, »sie ist schlechter Laune. Ihr Gastspiel hat nicht den erwarteten Erfolg. Wir in der Provinz sind eben noch nicht Ibsenreif.«
Ohne auf den in den letzten Worten berührten Gegenstand einzugehen – denn zur Zeit hatte er für nichts als seine eigenen Leiden Interesse – fuhr Linder mit der nervösen Erregtheit, die er schon bei seinem Eintritt gezeigt, fort: »Das Schlimmste ist, daß meine Versuche, die Adolfi zu sprechen, in der Stadt schon Aufsehen erregt haben. Wenn Else davon erfährt – ich danke!«
Die in dem letzten Satz ausgesprochene Befürchtung hatte so viel Entsetzeneinflößendes für den jungen Rechtsanwalt, daß er ungestüm aufsprang und aufgeregt im Zimmer auf- und abzugehen begann.
Steinbach, den die nach seiner Ansicht übertriebene Furcht seines Freundes mehr belustigte, als zum Mitgefühl veranlaßte, konnte seine Spottsucht nicht länger zurückhalten: »Freilich,« neckte er, »wenn Deine Braut es erfährt, die ist im stande und wirft Dir den Handschuh ins Gesicht – wie Svava!«
Ärgerlich fuhr Linder auf den Spottenden los: »Mensch, ich erdrossle Dich, wenn Du mir diesen verwünschten Namen noch einmal nennst.«
Eine neue Besorgnis kam ihm. »Apropos,« sagte er, vor dem Chemiker stehen bleibend, »Du hast doch Deiner Frau nichts gesagt?«
»Nicht ein Sterbenswort.«
»Sie ist Elses intimste Freundin, und wenn ich auch nicht glaube, daß Frau Mila plauderhaft ist, so könnte sie sich doch als Freundin für verpflichtet halten – « Der Sprechende unterbrach sich und legte mit bezeichnender Gebärde den Finger auf den Mund. »Deshalb Diskretion!«
Steinbach zuckte lachend mit den Achseln. »Aber selbstverständlich,« sagte er und gab dann mit einer komisch-wichtigen Miene das Axiom zum besten: »Eine Frau verschweigt nur, was sie nicht weiß.«
Der Rechtsanwalt nahm seine Wanderung durch das Zimmer wieder auf. Seine Mienen und Gebärden bekundeten deutlich die ihn beherrschende Ruhelosigkeit. Endlich trat er mit hastigen Schritten vor Steinbach, der ihn stillvergnügt beobachtet hatte, und faßte ihn mit einer Gebärde der Verzweiflung an beiden Schultern.
»Armer Freund!« rief er eindringlich auf ihn ein. »Du mußt mir aus der Klemme helfen. Ich ertrage diesen Zustand beständiger Angst nicht länger. Ein wahres Hundeleben, das ich seit acht Tagen führe. Des Nachts quälen mich böse Träume, des Mittags schmeckt mir das Essen nicht mehr und wenn ich des Abends zu meiner Braut komme, so klopft mir das Herz – «
»Vor Freude?«
»Vor Angst. Im Geiste seh' ich schon das ominöse Buch in ihren Händen. Seit drei Tagen habe ich mich überhaupt vor ihr nicht mehr blicken lassen.«
In Steinbachs Gesicht zuckte es vor mühsam unterdrückter Ironie und Spottlust.
»Du, Deine Memoiren denke ich mir eigentlich hochinteressant, und wenn Du das Buch wieder hast –«
»Verhilf mir erst dazu!« unterbrach ihn der andere dringlich.
»Ich? Ja, was kann ich –«
»Du, gerade Du kannst es, Du und kein anderer. Sie war Euer Gast, Dich kann sie nicht abweisen.«
»Du meinst, ich soll zu ihr gehen?«
»Nun natürlich!«
Steinbach kraute sich mit bedenklicher Miene hinter dem Ohr. »Du, das ist eine gefährliche Sache.«
»Gefährlich? Für Dich doch nicht. Du hast doch keinen Grund, Dich vor ihr zu fürchten. Die Adolfi ist doch am Ende kein Ungeheuer, im Gegenteil. Sie ist, abgesehen von ihrem dummen Haß gegen mich, heiter und unterhaltend. Sie lacht viel –«
»Damit ist gar nichts bewiesen, als daß sie weiße Zähne hat. Frauen, die hübsche Zähne haben, lachen immer.«
»Aber sie ist schön und liebenswürdig,« fuhr Linder eifrig fort.
»Eben weil sie schön und liebenswürdig ist,« erwiderte der andere nachdenklich.
Der junge Rechtsanwalt sah seinen Freund erstaunt und ein wenig mißtrauisch von der Seite an. »Na höre,« bemerkte er, »seit wann fürchtest Du Dich denn vor schönen Frauen?«
Steinbach gedachte seiner häuslichen Misere, der Metamorphose, die mit seiner Frau vorgegangen, und seufzte. Jetzt hantierte sie in seinem Laboratorium in einem Kostüm – brr! Ihn schauderte, wenn er daran dachte! Was war aus Mila geworden, seit er ihrer Laune nachgegeben! Ehemals das lieblichste, anmutigste, aufs geschmackvollste gekleidete junge Frauchen, die Wonne seiner Augen, das Glück seines Lebens. Und jetzt –? Jetzt war sie die reine Karrikatur eines Weibes!
»Seit vierzehn Tagen«, entgegnete er auf Linders Frage.
»Seit –« der junge Rechtsanwalt zuckte immer verwunderter mit den Schultern. »Ich verstehe Dich nicht. Wenn man eine so schöne Frau hat wie Du –!«
Der Angeredete ließ betrübt den Kopf auf die Brust sinken. »Meine Frau ist gar nicht mehr meine Frau.«
»Wie?« Linders Erstaunen wuchs ins Grenzenlose. Er wußte nicht, was er von den Worten seines Freundes zu halten hatte. In diesem Augenblick ließ sich von dem Laboratorium her Frau Milas Stimme vernehmen.
»Arno!«
Ihre Schritte näherten sich der Thür. Steinbach blickte zu dem Freunde hinüber und sagte mit einer Miene der Resignation: »Da kommt sie selbst. Sieh und begreife!«
Die Thür des Laboratoriums ging auf, und ein Wesen trat über die Schwelle, von dem man beim ersten Anblick nicht wußte, ob es männlichen oder weiblichen Geschlechts war. Vor dem Gesicht trug es eine Maske aus Drahtgeflecht, die an den Seiten mit Riemen zugeschnallt war. Unter dem Panzer, der der ganzen Gestalt etwas Unförmiges, Mißgestaltetes gab, das im ersten Augenblick wahrhaft erschreckend wirkte, wurde eine weite, formlose Blouse aus grobem Drillich sichtbar, sowie eine Schürze aus steifem englischen Stout.
Linder war erschrocken von seinem Sitz emporgefahren und starrte die sonderbare Erscheinung mit weit aufgerissenen Augen an. Sie aber eilte, nachdem sie seiner ansichtig geworden, mit freundlich entgegengestreckter Hand auf ihn zu.
»Sieh da, Herr Linder, guten Tag!« redete sie ihn an, und der junge Rechtsanwalt, der die ihm dargebotene Hand mechanisch ergriff, nahm zu seiner Verwunderung wahr, daß die Stimme der umpanzerten Gestalt ganz wie die von Frau Mila klang.
»Sind – ja, sind Sie es denn wirklich, Frau Mila?« brachte er, noch immer ganz verwirrt und befangen, hervor.
»Na freilich.« Frau Mila lachte und nahm die Drahtmaske vom Gesicht. »Sie haben mich wohl nicht gleich erkannt?«
»Bewahre!« gestand Linder aufrichtig.
»Na, wie gefällt Dir die Maskerade?« warf Steinbach ironisch ein.
»O – gar nicht so übel,« log der junge Rechtsanwalt galant. »Jedenfalls sehr originell. Nur bin ich mir nicht recht klar, was es eigentlich vorstellen soll.«
»Vorstellen?« Frau Mila warf dem Fragenden einen erstaunten Blick zu.
»Nun ja. Das ist doch Ihr Kostüm für den Maskenball, der morgen in der Loge stattfindet.«
Steinbach lachte aus vollem Halse.
»Köstlich! Ausgezeichnet!« rief er, während ihm die hellen Thränen in die Augen traten. Frau Mila aber kehrte sich indigniert ab. Betreten blickte Linder von einem zum andern. Steinbach schien sich gar nicht beruhigen zu können. Zuletzt verabschiedete er sich noch gar von dem ratlos dastehenden Freunde und erhöhte dadurch dessen Befangenheit nicht wenig.
»Du entschuldigst mich«, sagte er und verschwand durch die ins Laboratorium führende Thür, um nach dem begonnenen Experiment zu sehen, das Frau Mila im Stich gelassen.
Eine Verlegenheitspause trat zwischen den beiden Zurückbleibenden ein.
»Frau Mila, habe ich eine Dummheit gesagt?« nahm Linder zuerst kleinlaut das Wort.
Die Angeredete hatte einigermaßen ihre Empfindlichkeit überwunden. »O, Sie trifft nicht die Schuld«, entgegnete sie ernst, »es ist die Gesellschaft, in der es für etwas so Wunderbares gilt, wenn eine Frau die ihr gebührende Stellung an der Seite ihres Gatten einnimmt. Ich assistiere meinem Mann«, erklärte sich Frau Mila nunmehr deutlicher. »Ich helfe ihm bei seinen Experimenten. Und da die Gefahr der Explosion nicht ausgeschlossen ist –«
»Aha, ich begreife –: das da sind Schutzvorrichtungen,« fiel der junge Rechtsanwalt ein.
»Freilich. Wir sind nämlich eben dabei, Sauerstoffgas zu entwickeln. Wissen Sie, wie man das macht?«
»Nein,« gestand Linder aufrichtig und setzte höflich hinzu: »Aber das ist gewiß sehr interessant.«
Frau Mila nahm mit naivem Eifer die Gelegenheit wahr, sich im Glanz ihrer neuerworbenen Kenntnisse zu zeigen.
»Ungeheuer interessant!« rief sie lebhaft aus und fuhr in wichtig dozierendem Ton fort: »Man nimmt nämlich chlorsaures Kali –«
»Chlorsaures Kali?« platzte Linder unwillkürlich heraus. »Ich denke, das ist nur zum Gurgeln, wenn man einen schlimmen Hals hat.«
Frau Mila konnte sich eines mitleidigen Lächelns nicht erwehren. »Sie müssen wissen,« belehrte sie, »chlorsaures Kali enthält schauderhaft viel Sauerstoff und deshalb explodiert es auch so leicht.«
»Explodiert! Und da fürchten Sie sich nicht?«
»Keine Spur. – Natürlich muß man verstehen, damit umzugehen.«
»Aha! Und Sie verstehen das?«
»Freilich. Man nimmt nämlich etwas Braunstein dazu.«
»Braunstein?«
»Nun ja. Sehen Sie, der Braunstein verhindert eben die Explosion.«
»Aha.«
»Aber Sie müssen deshalb nicht glauben, daß nun jede Gefahr beseitigt ist. Die Hauptgefahr kommt erst. Nämlich, wenn nun der Sauerstoff entwickelt ist – in Gasform –«
»In Gasform«, warf der junge Rechtsanwalt ein, ein höfliches Interesse an der Sache, die ihn anfing, herzlich zu langweilen, heuchelnd.
»Dann wird es aus dem Gasometer in einen eisernen Cylinder überführt,« fuhr Frau Mila mit Wichtigkeit fort.
»Verstehen Sie das auch? Sonst fange ich noch einmal von vorn an.«
Linder erschrak. »Nein, nein, nicht nötig,« beeilte er sich zu versichern. »Ich verstehe schon. Bitte nur weiter.«
»Gut. Es handelt sich darum, das Gas zu komprimieren. Zu diesem Zweck wird ein Kolben in den Cylinder gedrückt. Jetzt passen Sie auf! Der Kolben wird durch eine hydraulische Presse bewegt. Nimmt man aber den Druck zu stark, so platzt die ganze Geschichte.«
Die letzten Worte sprach die Erklärende mit erhöhter Stimme, während der Eifer des Belehrens ihre Wangen rötete.
»Und das ist dann natürlich gefährlich?« forschte der Rechtsanwalt mit wenig innerem Anteil, nur um etwas zu sagen.
Frau Mila warf sich in die Brust. Sie kam sich in diesem Augenblick ungeheuer wichtig vor.
»Was glauben Sie wohl«, rief sie mit fast triumphierend klingender Stimme – »die Eisenteile fliegen Ihnen nur so um den Kopf.«
»Ich danke. Und das macht Ihnen Spaß?«
»Spaß?« Die Jüngerin der Chemie warf ihrem Gegenüber einen ärgerlich erstaunten Blick zu. »Aber erlauben Sie«, entgegnete sie empfindlich, »die Wissenschaft ist doch nicht dazu da, um Spaß zu machen.«
In diesem Augenblick ertönte Steinbachs Stimme aus dem Laboratorium.
»Sehen Sie«, bemerkte Frau Mila mit stolzem Lächeln und schnell ihren Verdruß vergessend, »er kann ohne mich gar nicht mehr fertig werden.«
Sie nickte dem Rechtsanwalt freundlich zu und enteilte mit geschäftiger Miene in das Laboratorium.
»Nun, was sagst Du dazu?« redete Steinbach, der kurz darauf in den Salon zurückkehrte, den noch wie betäubt dastehenden Freund an.
»Nichts, ich bin sprachlos,« entgegnete dieser und ließ sich, sein Taschentuch ziehend und sich damit die feuchte Stirn trocknend, in einen der um den Sophatisch stehenden Fauteuils fallen.
»Du wirst nun begreifen –«
»Hm, freilich –«
»Ich habe einen Assistenten gewonnen und meine Frau verloren,« erklärte der Chemiker, während er vor dem Freunde auf und ab ging.
»Das ist hart,« pflichtete Linder bei. »Aber Frau Mila wird von ihrer Caprice zurückkommen.«
»Daran ist vorläufig nicht zu denken, wenn nicht ein Wunder geschieht. Du siehst ja: sie schwärmt, sie ist begeistert – Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff: weiter hört man nichts von ihr.«
Der Rechtsanwalt faßte sich an die Stirn. »Ja. ja, mir ist noch ganz wirr davon im Kopf.«
»Weißt Du,« rief Steinbach, vor Linder stehen bleibend, hastig aus: »weißt Du, wenn man seine Frau so den ganzen Tag um sich hat, noch dazu in einem so schauderhaften Kostüm – «
»Kleidsam ist es freilich nicht –«
»Und wenn man dann andere Frauen sieht, so recht ›chic,‹ graziös und lustig, so –«
»So kommt man in Versuchung, die anderen schön zu finden.«
Des Chemikers Stirn legte sich in ernste Falten, seine Augen blickten finster.
»Man ist eben nur ein Mensch,« stieß er mit gepreßter Stimme hervor.
Der beiden Freunde gegenseitiges intimes Aussprechen erfuhr hier eine Unterbrechung. Die Flurglocke ertönte und gleich darauf schallte eine helle, frische Frauenstimme herein, bei deren Klang Linder erschrocken zusammenfuhr.
»Um Himmelswillen, Else!« rief er aus, hastig aufspringend. Ihm wurde sehr unbehaglich zu Mute. Seit drei Tagen war er nicht im Hause ihrer Eltern gewesen. Wenn sie inzwischen erfahren hatte?
»Guten Tag, Doktorchen,« begrüßte Else Willbrand, eintretend, den ihr öffnenden Chemiker freundlich. Als sie aber ihres Bräutigams ansichtig wurde, nahm ihr Blick plötzlich einen frostigen Ausdruck an. Ein bitteres, ironisches Lächeln zuckle um ihre Mundwinkel und in spöttischem Tone redete sie ihn an:
»Ah, sieh da, Herr Rechtsanwalt Linder, welch ein Glück, daß man Ihnen auch einmal begegnet! Ich vermutete sie im Hotel zum »Weißen Schwan«. Das soll ja jetzt ihr Lieblingsaufenthalt sein.«
Dem Angeredeten sank das Herz. Also sie wußte schon. O diese Adolfi! diese Adolfi!
Er näherte sich seiner Braut mit einer Armensündermiene. »Ich bitte Dich, Else!«
Sie aber drehte ihm mit ostentativer Geringschätzung den Rücken und wandte sich an Steinbach, der dieser Scene mir heimlichem Vergnügen folgte.
»Frau Mila ist vermutlich dort?« fragte sie ihn, auf die Thüre deutend, welche zu dem Wohnzimmer führte.
Der Chemiker aber wies nach der gegenüberliegenden Thüre hin. »Bitte, hier!« entgegnete er mit einem resignierten Lächeln. »Mila hat neuerdings ihre Thätigkeit von Küche und Putzzimmer in mein Laboratorium verlegt.«
Verständnislos blickte ihn das junge Mädchen an, das von der im Steinbachschen Hause vorgegangenen Veränderung noch keinerlei Kenntnis hatte; aber sie hielt sich nicht länger mit Fragen und Erkundigungen auf, sondern verließ nach einem letzten vernichtenden Blick auf ihren ratlos dastehenden Verlobten das Zimmer.
Im nächsten Augenblick ertönte ein lauter Schrei im Laboratorium, dem sehr bald ein lustiges Gelächter aus zwei Frauenkehlen folgte.
Linder aber reichte seinem Freunde seufzend die Hand und machte sich eilig aus dem Staube.