
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
bis zur Schöpfung der Salome
(1898-1905)
Eine belangreiche Aufgabe der Lebensbeschreibung bietet die künstlerische Umwelt, die ein Großer bei seiner Berufung nach dem neuen Arbeitsfeld vorfindet, und der manchmal beinahe dramatisch verlaufende Vorgang, wie er dort allmählich seine Persönlichkeit durchsetzt, dem meist durch Unterlassungssünden belasteten Ortsgeist den Stempel seiner Persönlichkeit aufdrückt. Für Weimar war ähnliches bei Strauß zu erwähnen; bei seiner Übersiedlung nach Berlin schienen auf beiden Seiten mehr äußere Beweggründe maßgebend. Die Münchener wirtschaftlichen Grundsätze schlossen ein Angebot wie das, welches Berlin damals machte, aus, ebenso die für Strauß als Gastdirigenten wichtige großzügige Behandlung der Urlaubsfrage, mit der man von dort an ihn herantrat. Man wollte in der Reichshauptstadt den ersten Musiker des Landes haben, wenn auch niemand daran dachte, durch dessen überragende Persönlichkeit etwa die Musikzustände dort auf eine neue Grundlage zu stellen. Vielmehr blieb an der Hofoper das später, Ende März 1911, im Preußischen Abgeordnetenhaus »bureaukratische Laienwirtschaft« genannte Grundwesen des Betriebes dasselbe. Der Kapellmeister hatte im allgemeinen die ihm übertragenen Opern zu leiten, weiter aber nichts zu sagen. Vom 1. November 1898 war Strauß auf zehn Jahre als Königlich preußischer Kapellmeister an das Opernhaus berufen, wo er zeitweise sehr häufig, und zwar so ziemlich den gesamten deutschen Spielplan dirigierte, unter anderen den ganzen Wagner, Mozart – seine Begleitung der Seccorezitative auf dem Klavier im Don Juan erregte Begeisterung, – Weber; Aida, Falstaff; Orpheus von Gluck; Fledermaus (bei Kroll), Lustige Weiber, Wildschütz, Stumme, Robert den Teufel. Letztere Oper hatte er ungestrichen eingeübt, vielleicht, um Intendanz und Hörer damit zu strafen. Wenn das sein Plan war, so schlug er fehl; denn die einfache Plastik dieser Musik gefiel so glänzend, daß er sie etwa dreißigmal dirigieren mußte; das System des »Abgebens« an einen der Nächsten im Rang, wenn eine Oper »geht«, wie in München, war dort damals noch nicht eingeführt. Zum Nibelungenring kam Strauß erst im Juni 1899, und zwar ohne Probe, also ohne seine eigene Auffassung durchgreifend verwirklichen zu können. Ein wenig machte sich sein Einfluß darin geltend, daß unter seiner Leitung auch neuere Werke deutscher Künstler außer denen französischer, italienischer, amerikanischer sowie hochgestellter Liebhaber, auf den Spielplan kamen. Man gab Bärenhäuter, Kain, Barbier von Bagdad, den Armen Heinrich, Rübezahl von Sommer, Pfeifertag von Schillings, den Faulen Hans von Ritter; Feuersnot, Salome, Elektra. Aber die »Annahme von Machwerken schlimmster Art über die Köpfe der Dirigenten hinweg zu verhindern, vermag kein von der Hofbühne abhängiger Beamter«, wie der örtliche Geschichtschreiber Adolf Weißmann seine kurzen Bemerkungen über Strauß in »Berlin als Musikstadt« beschließt. Über das Verhältnis des Kaisers zu seinem ersten Opernkapellmeister und größten Musiker seines Reiches läßt sich wenig sagen. Zwischen zwei Naturen, in deren Leben die Kunst, und die Musik besonders, etwas so Verschiedenes bedeutete, und die gewohnt waren, sich hierüber so offen auszusprechen – woran es Strauß nicht fehlen ließ –, war ein gutes Einvernehmen wohl einzig dadurch möglich, daß dieser kaum eine Note eigentlicher Straußmusik hörte und außer den Militärmärschen nur einige Lieder von ihm kennenlernte. Bei persönlichen Begegnungen war er von achtungsvoller Liebenswürdigkeit; in der Widmung von Märschen für Militär- und Orchestermusik und deren Annahme sprach sich das bleibend freundliche Verhältnis von Fürst und Sänger aus. Eine anderthalbstündige Vorführung alter Militärmärsche, bei welcher der Kaiser mit Strauß zugegen war, regte diesen zur eigenen Schöpfung zweier solcher Märsche, als Widmung an den Kaiser, an, äußerst rasch entworfener Stücke, die ein Berliner Verleger sofort für einen hohen Preis erwarb, und die Strauß, der dem Kaiser auch den »Königsmarsch« gewidmet, den Kronenorden dritter Klasse einbrachten. Die in den Märschen benutzten langen Heroldstrompeten soll Strauß bei einem Militärkonzert in der Flora zu Köln, wo er die Feuersnot leitete, kennengelernt haben. Mehrmals durfte er im Zwischenakt einer von ihm geleiteten Oper die Anerkennung des Kaisers in der Hofloge entgegennehmen. Wie gut sich dieser Straußens Äußerungen über seine eigene Richtung gemerkt hatte, zeigte sich bei dem Männerchorwettstreit in Kassel, als der Kaiser mit den Preisrichtern sprach; er erwähnte gegen Schuch Straußens ausgesprochene Modernheit und fügte gutgelaunt hinzu: »Da habe ich eine schöne Schlange an meinem Busen genährt« – woraus der Berliner Ausdruck Hofbusenschlange entstand.
Als Konzertleiter war Straußens Stellung in der Reichshauptstadt von vornherein sehr ungünstig, indem sein scheidender Vorgänger, Felix von Weingartner, nur die Leitung der Oper niederlegte, die der Konzerte der Königlichen Kapelle aber noch fast zehn Jahre lang als maßlos beliebte Erscheinung beibehielt, während Artur Nikisch in gleicher Weise von seinem festen Wohnsitz Leipzig aus die Berliner Philharmonischen Konzerte beherrschte. Strauß mußte sich mit unendlicher Mühe das technisch erst heranzubildende Berliner Tonkünstlerorchester für seine Aufführungen moderner Werke erziehen. Erst Mitte April 1908 konnte er endlich einen mit dem Herbst beginnenden dreijährigen, später verlängerten Vertrag mit der Königlichen Kapelle, als Leiter ihrer jährlichen zehn Symphoniekonzerte, schließen, da infolge der Unabkömmlichkeit Weingartners als Operndirektor in Wien eine Neubesetzung nötig wurde. Die Hofkapelle wählte sich für diesen Posten selbst ihren Mann, der nur der Bestätigung durch die Intendanz bedurfte. Nachdem Laugs, Schuch und andere als Gastdirigenten erschienen waren und durch geschickte Machenschaften die Übergehung von Strauß so gut wie sicher war, entschied auf dem Pensionsfondskonzert der Philharmoniker der gewaltige Eindruck seiner Darstellung von Beethovens Fünfter die Wahl. Seinen echt genossenschaftlichen Sinn hat Strauß am ausdauerndsten und persönlichsten in dem Spielplan seiner Konzerte betätigt, und hier wieder am meisten da, wo er allein maßgebend war, in seinen »Modernen Konzerten« des auf neunzig Musiker verstärkten »Berliner Tonkünstler-Orchesters«, in denen außer Liszts sämtlichen symphonischen Dichtungen, Bruckners erster und dritter Symphonie und einigen Stücken Alexander Ritters nur Werke Lebender gehört wurden; weitere Ausnahmen veranlaßte Willy Burmester als Sologast. In diesen Konzerten brachte es Strauß unter anderem dahin, Liszts vorher gänzlich abgelehntem Hamlet zu stürmischer Ehrung zu verhelfen. Die Konzerte begannen im Neuen Königlichen Theater (Kroll) Ende Oktober 1901, zunächst sechs im Jahr; das erste brachte Liszts Bergsymphonie, Bruckners Dritte nach 15 Orchesterproben, und Sgambatis Klavierkonzert. Es kamen noch zu Wort: Strauß, Pfitzner, Schillings, Thuille mit dem dritten Akt von Guggeline, Ertel, Schirach, Brecher, »Aus unserer Zeit«; der 19jährige Claus Pringsheim, Bischoff; von Österreichern Mahler, Vierte Symphonie unter Leitung des Autors; Wolf, Hausegger, Reznicek, Ouvertüre Eulenspiegel; ferner Huber, Sinfonia eroica; d'Indy, Charpentier, Bruneau; Tschaikowsky, Paderewski mit Opernszenen; Smetana mit »Tabor«, Stanford, Elgar, Löffler-Boston. Wenn man gegen Strauß über seine Bevorzugung von Werken »ohne Form und Melodie« in diesen Spielfolgen Bedenken äußerte, so entgegnete er, diese Begriffe hätten sich zu allen Zeiten geändert; vieles, das man früher melodie- und formlos genannt, werde heute auf den Straßen gepfiffen. Sein beharrliches Eintreten als Opern- und Konzertleiter für die neudeutschen Musikdramatiker verteidigte er so: nur zwei Arten von Werken brächen sich von selbst Bahn und bedürften daher keiner Förderung: das wirklich Große und der Schund; für die Meister zweiten Ranges aber hinge alles davon ab, daß man für sie tätig sei. Seine kunstpolitische Grundanschauung vertrat er mit ruhiger Beharrlichkeit, wenn er auch die Mühe für seine Schützlinge zuweilen durch äußerste Gleichgültigkeit, ja gelegentlich, im 5. Konzert 1902, Anfang Februar, bei Neuheiten von Ertel und anderen, durch Lärmen und Zischen belohnt sah – ein Mann beurteilt eben sein Tun nicht nach dem Erfolg. Im Februar und März 19Q2 machte er mit dem Orchester eine Reise durch die großen Städte von Süddeutschland, Österreich, Italien, Südfrankreich und der Schweiz. Aufsehn erregte sein Schriftwechsel mit der »Konzertdirektion Gutmann« in Wien, der Strauß die dort gewünschte Spielfolge, mit lauter bekannten Stücken, abschlug. »Bei mir muß man gar keinen Versuch nach der konservativen Richtung machen!« Nach dem Sommer 1903 gab Strauß diese Konzerte auf, da die erzielten Erfolge in keinem Verhältnis zu dem Aufwand an Mühe standen. Sie bleiben trotzdem ein bedeutsames Blatt in der Geschichte des musikalischen Fortschritts.
Eine so reiche Natur wie Strauß mußte in der Reichshauptstadt zu noch vielseitigerer Betätigung Anregung und Boden finden. Von hoher Bedeutung ward nun die alte Freundschaft mit Friedrich Rösch, den er schon vom Gymnasium her, etwa seit 1878, kannte, und der 1890 vom Rechtsbeflissenen und eifrigen Liebhaber zum Berufsmusiker überging. Die Verbindung beider Wissensgebiete machte ihn zum berufenen wirtschaftlichen Vorkämpfer der deutschen Tonsetzer an der Seite von Strauß, eine weittragende Entwicklung, die sich in der folgenden Zeit, von Berlin aus, vollzog, und viel später, erst auf dem Tonkünstlerfest zu Jena, im Juni 1913, durch die Ernennung des Hofrats Rösch zum Doctor juris honoris causa ihre Würdigung durch die Universitätskreise fand. Noch der letzten Münchener Zeit entstammt jenes acht Quartseiten in Steindruck starke Rundschreiben vom August 1898, das zunächst von der Parsifal-Schutzfrage ausgeht. Es zeigt durch seine klare, knappe, stellenweise im Ausdruck starke Darstellung der Tatsachen, Aussichten und Forderungen, die sich aus der Teilnahmslosigkeit der Tonsetzer bei der Mainzer Hauptversammlung 1898 und aus der Benutzung dieses Umstandes durch die dort stark vertretenen Verleger ergaben, ungemein deutlich Straußens Art im Ernstfall; in einer Ausgabe seiner schriftlichen Äußerungen wird das Stück nicht fehlen dürfen. Nun entwickelte er sich in Berlin noch stärker zum genossenschaftlichen Vorkämpfer, welche Eigenschaft einen wichtigen Zug seines künstlerischen Wesens ausmacht. Wie auf anderem Feld, so ist er auch hier den einmal für richtig erkannten Weg stets geradeaus fortgegangen. Zunächst in der wirtschaftlichen Festigung allgemeiner Bestrebungen der Tonsetzer, ihrer Förderung im einzelnen, soweit sie fortschrittlich, also, im Sinne von Strauß, kunstpolitisch die einzig nutzbaren sind. Für dieses Ziel kämpfte er auf zwei Wegen, im Allgemeinen Deutschen Musikverein und in seinen eigenen Konzertspielfolgen, am nachhaltigsten von 1901 ab in den erwähnten, fast ausschließlich zu diesem Zweck von ihm geleiteten Modernen Konzerten des Berliner Tonkünstlerorchesters. Im Jahre 1898 gründete er mit Rösch die Genossenschaft deutscher Tonsetzer, – »Deutscher Komponisten«, wie sie bis zum 14. Januar 1903 hieß, – zur Wahrung und wirtschaftlichen Verwertung der Autorenrechte. Als Grundlage hierzu mußte zunächst ein verbessertes Urheberschutzrecht geschaffen werden, worin Deutschland bis dahin hinter dem besseren Ausland zurückstand. Eine zweitägige Beratung im Reichsjustizamt Mitte Mai 1899, wobei auf Seite der Gründer Strauß, Rösch und Sommer geladen waren, bildete die wichtigste Vorstufe der erfolgreichen Einbringung an den deutschen Reichstag, – womit freilich zahllose Schwierigkeiten nicht einmal gestreift sind. Schon auf dem Mainzer Tonkünstlerfest im Juni 1898 sollte Sommer die Petition an den Reichstag zur Sprache bringen, aber die Komponisten selbst fehlten, wie erwähnt, in der Versammlung, worüber sich Strauß im Leipziger Musikalischen Wochenblatt kräftig äußerte. Auch in der praktischen Anwendung der endlich geschaffenen Grundlage, die sich in einer der Genossenschaft angegliederten Tantièmenanstalt, der Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht, verkörperte, waren nach drei Seiten hin Kämpfe zu bestehn, an denen er mit Wort und Feder unermüdlichen, zuweilen entscheidenden Anteil nahm. Mit den Tonsetzern selbst, mit den Verlegern und den Konzertveranstaltern konnte erst nach unendlichem Ringen eine Verständigung erzielt werden. Der persönliche Verzicht des einzelnen Autors, indem nicht mehr er selbst, sondern die Vertretung der Genossenschaft über das Aufführungsrecht seiner Werke zu verfügen haben sollte, machte viele bedenklich, und Strauß mußte selbst seinen näheren Freunden, wie Schillings, Thuille und anderen, die Notwendigkeit dieser Veränderung mit eindringlichster Deutlichkeit schriftlich auseinandersetzen, um ihres Verständnisses sicher zu werden. Gelegentlich erbittert ihn der hartnäckige Widerstand der Tonsetzergenossen gegen notwendige Maßregeln zu ihrer eigenen Wohlfahrt so sehr, daß er an Schillings voll Unmut schreibt: »Jeder Komponist hat den Verleger, den er verdient. Wenn ich was anderes gelernt hätte – weiß Gott, ich sattelte heute noch um, um aus der Kollegenschaft herauszukommen!« Bei der großen Schwierigkeit, die zur Gründung der Tantièmenanstalt nötigen ansehnlichen Gelder von Männern zu bekommen, auf deren Beharren bei den festgesetzten Zielen zu rechnen war, mußten die Gründer, Strauß, Rösch, Schillings, Sommer, um die Steuerung in ihrer Hand zu behalten, Ende 1902 eigenes Vermögen behufs langsamer Rückzahlung in der Sache anlegen. Nachdem ein kleiner Kreis Überzeugter gewonnen war, nahm der Kampf gegen die erbitterten äußeren Feinde, darunter ein großer Teil der Tonsetzer selbst, seinen Fortgang. Erst nachdem die Anstalt unter Leitung des unermüdlichen Rösch jährlich Hunderttausende als Gewinnanteil an diese abgibt, schien der Widerstand auch auf ihrer Seite im allgemeinen verstummt, und richtete sich 1912 nurmehr gegen die Einbeziehung des Urheberrechts in die Wiedergabe durch mechanische Instrumente; auch trat die Schwesteranstalt, die Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger in Wien, schon 1911 in gegensätzliche Stellung zur Genossenschaft. Die Ausdehnung seines künstlerischen Arbeitsgebiets versagte Strauß eine hervortretende persönliche Anteilnahme an diesen späteren wirtschaftlichen Kämpfen.
Ein zweites Feld genossenschaftlichen Vorkampfes wurde für ihn der Allgemeine Deutsche Musikverein. Um die Jahrhundertwende trat im Geist dieser für das deutsche Tondichterwesen ausschlaggebenden Körperschaft eine Veränderung ein. Angesichts des teilweise konservativen Charakters der zuletzt zur Aufführung auf den Tonkünstlerfesten ausgewählten Werke von Brahms, Bruckner, Berger glaubte Strauß Entscheidendes zur Wiedergewinnung der geistigen Grundlage tun zu müssen, auf der Liszt 1861 den Verein gegründet hatte. Dazu mußte er die gebotene Möglichkeit benützen, selbst an die Spitze zu treten, die ihm tauglich scheinenden Helfer Rösch und Schillings, die sich persönlich vollständig fernstanden, erst einander näherbringen und zur gemeinsamen Arbeit im Vorstand gewinnen. In Heidelberg, Juni 1901, wurde Strauß an Fritz Steinbachs Stelle zum ersten Vorsitzenden gewählt. Die jährlichen Tonkünstlerfeste des Vereins verursachten dem Vorstand endlose Schreibereien, erst an die Tonsetzer wegen der Zusammenstellung der Spielfolgen, an ausübende Künstler, bis zu den schließlichen Dankesschreiben an Festdirigenten, städtische Ortsausschüsse und ähnliches. Vom Musikausschuß, der doch bestenfalls nur einen kleinen Teil der jährlichen etwa 200 Einsendungen zur Aufführung annehmen konnte, wurde gelegentlich auch noch »sachliche Begründung« der Nichtannahme verlangt, die er als außerhalb seiner Sphäre liegend ablehnen mußte. Straußens sonstige Arbeitslast schloß seine Anteilnahme an der Prüfung der Einsendungen aus, hierin mußte er sich auf die weitgehende Opferwilligkeit von Schillings und den unermüdlichen Hofkapellmeister Dr. Aloys Obrist verlassen. Er gab bezüglich der Auswahl nur die Fingerzeige. Schillings als Obmann des Prüfungsausschusses sollte das offensichtlich für die Aufführungen des Vereins Ungeeignete gar nicht erst in Umlauf setzen. Der Rest wurde in Pakete verteilt den einzelnen Mitgliedern zugeschickt und von ihnen mit Bemerkungen versehen, unter deren Berücksichtigung der Obmann dann die Auswahl vornahm. Sie sollte nach Straußens Willen im fortschrittlichen Sinn geschehn, womit eine gewisse Gattung in älterer Stilform gewandter, aber sonst belangloser Arbeiten grundsätzlich ausgeschaltet war. Die Werke selbst blieben ihm bis zur Hauptprobe gewöhnlich unbekannt; das Greulichste waren ihm dann die, welche mißverständlich die äußere Form seiner eigenen Ausdrucksinstrumentation als Selbstzweck auf die Spitze trieben und in Riesenpartituren bis zu 42 Zeilen – Beethoven brauchte 12 – nach Form und Inhalt nur das Gewöhnlichste sagten. Gelegentlich äußerte er, es sei wohl an der Zeit, ein Tonkünstlerfest mit lauter Mozart zu geben, damit Leuten dieser Sorte der Wert der Form und des positiven Könnens überhaupt einmal eindringlich klar werde. In dem starken Schriftwechsel, den er als Vorsitzender mit Schillings als dem Obmann des Musikausschusses führte, tritt eine Fülle von Gerechtigkeit und Wohlwollen zutage, die sich auch in eingehender Behandlung der Unterstützungsfragen offenbart, daneben auch der Ausdruck aller Grade durchaus neidloser sachlich künstlerischer Schätzung. So schreibt er 1904 über ein Werk von Bruno Walter: »Das ist ein außerordentliches Stück, groß im Stil, reich und vornehm in der Erfindung, von starker Empfindung und großzügig.« Er betonte auf das bestimmteste die gemeinsame Pflicht, »sine ira et studio jeden, der nur einigermaßen Berechtigung hat, zu Wort kommen zu lassen – so sehr vielleicht persönliche Neigungen anders locken. Wir müssen uns überhaupt vor Cliquenprotektion hüten und dürfen nicht einmal den Anschein der Einseitigkeit auf uns laden«. Er selbst schreibt am 12. Juli 1903 von den Kämpfen in seiner »zur Objektivität vereidigten Vorstandsseele«. Daß all das aufrichtig gemeint ist, ergibt sich schon daraus, daß es lauter Anweisungen sind, wie gehandelt werden soll. Als er, Anfang Juni 1903 in London erkrankt, zur Erholung nach der Insel Wight gehn muß, bedauert er, daß er an dem Tonkünstlerfest in Basel nicht teilnehmen und sich »daran freuen kann, daß wieder ein paar tüchtige junge Talente ans Tageslicht befördert, und noch nicht genug gewürdigte Leute noch mehr zur verdienten Anerkennung kommen«. In gleichem Sinn wirkt seine Äußerung über Bedenken gegen unverdiente Aufführung: Laßt doch die Zeit richten! Ob man einen überschätzt, das macht nichts! Besser zwanzig zu hoch taxiert, als einem den Weg versperrt. Die Hauptsache ist, daß einer was will und was kann! Bis einschließlich Sommer 1909 blieb Strauß an der Spitze des Vereins. Unter seinem Vorsitz fanden Feste statt in Krefeld 1902, Frankfurt 1904, Graz 1905, Essen 1906, Dresden 1907, München 1908, endlich Stuttgart 1909, und nicht ohne seinen mächtigen Einfluß wiesen die für das Durchdringen eines jungen Tonsetzers in erster Linie maßgebenden Aufführungen des Vereins so viele neue Namen auf. Außer Gustav Mahler, dessen Schaffenserfolgen erst das Fest von 1902 mit der dritten Symphonie den entscheidenden Vorstoß gab, wurden hier unter andern gefördert: Pfitzner, Schillings, Bischoff, Sommer, Dalcroze, Boehe, Scheinpflug, Weismann, Reger, Wolf-Ferrari, Andreae, Hausegger, Lampe, Delius, Braunfels, Klenau, Marteau, Juon, Noren, Sekles, Schönberg. Einzelne Zugeständnisse, die der konservativen Richtung gemacht wurden, waren nicht im Sinn von Strauß, der den grundlegenden fortschrittlichen Zweck des Vereins stets gewahrt wissen wollte. Gerade zu der Zeit, als er wegen Überbürdung vom Vorsitz zurücktrat, ward von Gegnern bemerkt, daß unter ihm der Musikausschuß für die Tonkünstlerfeste häufig Werke ihrer Mitglieder auswählte. Was und wem das geschadet haben sollte, ist nicht einzusehn, da diese ja meist namhafte Tonsetzer waren und es ohnehin schwer genug fiel, die gewöhnlichen fünf Konzerte mit erträglichen neuen Erzeugnissen zu besetzen. Der Vorschlag, daß niemand eine gewisse Zeit vor, während und nach seiner Ausschußmitgliedschaft etwas von sich zur Aufführung einreichen dürfe, hörte sich gut an; das hätte aber zur Folge gehabt, daß man nach Leuten suchen müßte, die ohne eigene tonsetzerische Ader doch ebenso sachverständig sind als die Schaffenden. Diesen wäre es kaum eingefallen, für die Ehre und das zweifelhafte Vergnügen, soviel fremde Partituren durchzusehn und zur Aufführung zu empfehlen, auf die ihrer eigenen und damit auf die wichtigste Förderung zu verzichten. Oder man hätte sich nach solchen umsehn müssen, die etwa keine mehr nötig zu haben glauben. Das zeitweilige Erscheinen vieler Ausländer auf den Spielfolgen der Tonkünstlerfeste unter Straußens Oberleitung bestätigte, daß man, bei der unleugbaren Seltenheit frischer tonsetzerischer Kräfte in neudeutschen Landen, bemüht war, solche von jeder möglichen Seite her wirksam werden zu lassen.
Auch regte sich infolge der vielseitigen Berührungen mit entgegengesetzten Strömungen des Berliner wie des allgemeinen deutschen Musik- und Kunstlebens dank Straußens frisch zugreifender Art der Journalist öfter in ihm. Zwar kann man die Eigenschaft eines Musikschriftstellers von Beruf nicht entschiedener ablehnen, als er es wiederholt getan hat. In der ersten Nummer der Berliner Zeitschrift »Der Morgen«, vom 14. Juni 1907, eines Blattes, das Strauß ins Leben rief und drei Monate lang leitete, gesteht er seine »kaum überwindliche Abneigung gegen schriftstellerische Betätigung«. Und als ihn Leopold Schmidt um ein Geleitwort für sein Buch »Aus dem Musikleben der Gegenwart« angeht, schreibt Strauß darin aus Garmisch, November 1908: »Dies kam mir allerdings anfangs ebenso spaßig vor, als wenn ich Herrn Dr. Leopold Schmidt bäte, eine Ouvertüre zu meiner ›Elektra‹ zu schreiben.« Die Meisterschaft aber, mit der er als Waffe im Aufklärungs- und Gefechtsdienst die Feder führt, hat sich oft bewiesen, und wenn wir diese schriftstellerische wie so ziemlich alle geistigen Strömungen in der Deutschen Musikwelt auf Schumann zurückleiten dürfen, ist er auch hierin sein Jünger. Eine Zeitlang, während seiner zweiten Theatertätigkeit in München, hatte sich Strauß viel von der Unterstützung einer verständnisvollen und wohlgesinnten Fachpresse für die Hebung der Musikzustände versprochen. Bezeichnend schreibt er im Mai 1896 an Schillings: »Da Sie das Glück keiner anderen Tätigkeit als des Komponisten haben, Ihre Zeit also nicht durch Taktschlagen unnütz vergeudet wird.« Er dachte damals daran, sich mit dem ausdrucksgewandten Schillings und dem gleichfalls künstlerisch vornehmen, begüterten Felix vom Rath zur Herausgabe einer fortschrittlichen süddeutschen Musikzeitung zu verbinden. Der Gedanke, der seine ganze, in 28 Jahren vertretene Kunstanschauung ausdrückt, stellt die Wandelbarkeit der künstlerischen Gesichtspunkte im Sinn einer gesetzmäßigen steten Fortentwicklung fest. Unwiderleglich treffend äußert er nach der Tonkünstlerversammlung 1905 in der Grazer Tagespost den Wunsch, »daß die Wiener Kunstrichter von ihren Grazer Kollegen lernen möchten. In der Hauptstadt herrschen leider noch die ewigen Schönheitsgesetze, die unsereins auch gern einmal zu Gesicht bekäme, die aber bis heute als rätselhafte Geheimnisse im Busen der Herren Hanslick und Genossen schlummern«. Diesen Entwicklungsgedanken vertrat er besonders deutlich in der aus Charlottenburg vom 1. Dezember 1903 datierten Vorrede zum ersten Bändchen der von ihm herausgegebenen Sammlung »Die Musik«, Göllerichs »Beethoven«, auf nur vier Druckseiten kleinen Formats. Er sieht darin »in der Geschichte der Tonkunst ein Fortschreiten von der Wiedergabe unbestimmter oder allgemein typischer Vorstellungen zum Ausdruck eines mehr und mehr bestimmten, individuellen und intimen Ideenkreises«. Damit entwickeln sich auch die Formelemente weiter, und Strauß stellt die Rückständigkeit einer Kunstlehre fest, die an irgendeiner Stelle abschließen will, indem sie die Entwicklung leugnet. Am bedeutungsvollsten äußerte er den Fortschrittsgedanken in dem erwähnten »Morgen«-Aufsatz aus Anlaß einer Erwiderung gegen Felix Draeseke, aus Fontainebleau, Pfingsten 1907 datiert, unter dem Titel: »Gibt es eine musikalische Fortschrittspartei?« Als Hindernis des naturgemäßen Fortschritts nennt er die Presse,die sich zwischen den Tonsetzer und den an sich für diesen empfänglichen Hörerkreis stelle. »Der treibende und in letzter Instanz entscheidende Faktor war die große Masse des unbefangen genießenden Publikums, das sich in seiner naiven Empfänglichkeit für jede neue und bedeutende Kunstleistung in der Regel als der zuverlässigste Träger jeglichen Fortschrittgedankens bewährt hat, – sobald ihm nicht von seiten gehässiger Kritik oder geschäftlicher Konkurrenz Vorurteile eingepflanzt werden«. Als Beispiel führt Strauß an, wie Liszt in Dresden mit drei Kompositionsabenden größte Begeisterung erregen konnte, weil die Kritik die Werke noch nicht kannte. Dann heißt es von den Gegnern des Fortschritts: »Zünftige Fachgenossen, die ängstlich besorgt um ihre eigene Wertschätzung ohne schöpferische Potenz, lediglich im Besitz einer gewissen Kompositionstechnik irgendeiner verflossenen Epoche, eigensinnig und gewalttätig gegen jede Erweiterung der Ausdrucksmittel und gegen jede Ausdehnung künstlerischer Tongebiete sich sträuben, Kritiker, deren Kunstanschauung auf einer erstorbenen Ästhetik vergangener Zeiten basiert, wagen sich als festgeschlossene Reaktionspartei mehr und mehr wieder an die Öffentlichkeit und sind eifriger denn je am Werke, den Weiterstrebenden das Leben sauer zu machen.« Die Kundgebung dieser Reaktionäre, fährt Strauß fort, habe die von Draeseke beklagte »Konfusion in der Musik« veranlaßt. Weit milder zeigt er sich allerdings in dem oben erwähnten Vorwort zu Leopold Schmidts Kritiksammlung aus dem Berliner Tageblatt. Dieses Vorwort fesselt, wie alles aus seiner Feder, durch klaren Scharfblick, ausgezeichneten Stil und vornehm wohlwollende Gesinnung. Aber gerade diese beeinflußt ihn hier. Wenn der Löwe die Einleitung zu einem Buch des scharfsinnigen Fuchses schreibt, so wird er nicht gerade von den schlimmen Taten anderer Füchse darin sprechen. Strauß hebt dort den Nutzen der guten Kritik hervor und schlägt den Schaden der schlechten sicher zu gering an. Er führt aus, daß sich zuletzt trotz unberechtigt negativer Kritik das wirklich Gute Bahn bricht. – Wenn der Autor dann aber alt oder schon tot ist, war der Schaden für die Kunst gerade groß genug, so möchte man einwenden. Für eine andere Seite in Straußens Stellung zur Kritik ist auch ein Gespräch mit einem Berichterstatter der Rheinischen Musik- und Theaterzeitung im Jahre 1903 belangreich. Er bezeichnete es da als ihre Aufgabe, für jene Namen zweiten Ranges, wie Spohr, Raff, Volkmann, Cornelius, Ritter, einzutreten, um der heute so einseitigen Vorliebe für einige wenige allererste Meister, etwa Beethoven und Wagner, entgegenzuwirken. Es wäre gut und nützlich, meint Strauß, wenn gerade jenen Meistern gegenüber weniger die Praxis befolgt würde, Unzulänglichkeiten aufzuweisen, als vielmehr das reichlich vorhandene Wertvolle und Echte klar hervorzuheben und dem Publikum mundgerecht zu machen. So manches, was sich in einer anspruchslosen Zeit eingebürgert hat, wird heute in unserem Opernspielplan mit fortgeschleppt, ohne daß jemand daran denkt, festzustellen, wie wenig es einer ernsthaften Kritik standhält. Wird aber der »Cellini« einmal neu einstudiert oder der »Cid« von Cornelius gelegentlich hervorgesucht, oder bringt gar Reznicek einen neuen »Till Eulenspiegel«, so werden alle diese Werke auf Herz und Nieren geprüft, und sofern sie nicht dem höchsten Ideal in allen Stücken entsprechen oder dem Nutzen eines Sonderkreises willig zu dienen imstande sind, werden sie beiseite geschoben oder doch nicht mit der Wärme behandelt, wie es für die Schaffenden sowohl als auch für die ausübenden Künstler, für Dirigenten, Darsteller und nicht zuletzt für Intendanten und Theaterleiter zur Belohnung des Strebens und der Arbeitsfreudigkeit wünschenswert wäre. Das Genie geht immer seinen Weg, nicht selten auch gegen die Kritik; manchem Schund wiederum ist trotz der kräftigsten, schlagfertigsten Kritik das Lebenslicht nicht auszublasen. Jenen »Meistern zweiten Grades« aber, die, ohne daß ihr Wirken gerade einen Gipfelpunkt bedeutete, Gehaltreiches und Gediegenes geschaffen haben, ihrem Schaffen ist durch liebevolles Entgegenkommen seitens der Männer, die der öffentlichen Meinung Winke und Weisungen zu geben in der Lage sind, ganz entschieden ein Boden zu bereiten. Mit dem Verständnis und der Würdigung dieses Schaffens würde sicher das Verständnis für die ganz Großen wachsen und sich vertiefen, vielem Schlechten aber gleichzeitig das Wasser abgegraben. Kunst und Hörerschaft, beide würden ihren Vorteil dabei finden. – Im großen ganzen sind das dieselben Ansichten, mit denen Strauß im Jahr 1905 dem Kaiser gegenüber seine Berliner Spielplanpolitik zu rechtfertigen suchte, als er im Zwischenakt der Neujahrsoper, Aubers »Das eherne Pferd«, in die Hofloge befohlen war. Strauß fügte damals noch hinzu, jene Talente zweiten Ranges hätten ein schweres Dasein, um so mehr, als die deutschen Komponisten ihre Werke nicht so gut zu servieren verständen wie die routinierten Franzosen. Erwähnenswert ist für sein gelegentliches Schriftstellertum noch ein viel späterer Artikel in der Weihnachtsfeiertagsnummer 1910 der Neuen Freien Presse: Mozarts Cosi fan tutte. Er bespricht ausführlich das Verdienst der Ausgabe Levis, nach Eduard Devrients entstellender Bearbeitung den Urtext da Pontes wiederhergestellt zu haben, in dem die beiden Bräute tatsächlich treulos werden. Eingehend und feinsinnig weist Strauß auf dem Unterschied in Mozarts Vertonung beim Ausdruck der gleichen Empfindungen hin, die von Seiten der Damen ganz wahr, von Seiten der in der Maske Komödie spielenden Herren übertrieben und vom Zorn über die leichte Wandelbarkeit ihrer Erkorenen durchsetzt sind. Unter seinen Auslassungen darf auch der schon erwähnte Brief an den Oberbürgermeister von Nürnberg über die dortigen Theaterorchesterverhältnisse nicht fehlen, abgedruckt in der Abendausgabe des Berliner Tageblatts vom 23. Dezember 1913, der mit erfrischender Aufrichtigkeit ein Bild von Straußens Ansicht über die Folgen der Kunstverständigkeit mancher Behörden gibt.
Die geschilderte Betätigung als genossenschaftlicher Vorkämpfer und Musikschriftsteller lief neben der des Berliner Opern- und Konzertkapellmeisters her; inmitten all dieser Unruhe, zu welcher noch die des häufigen Gastdirigierens kam, fand Strauß noch immer die volle Sammlung in seinem Hauptgebiet, dem tonsetzerischen Weiterschaffen. Bis sich die vergleichsweise ruhige große Linie mit der Folge der vier letzten dramatischen Werke darin einstellt, also vom Antritt seines Berliner Postens 1898, bis etwa 1906, ist eine Trennung des Gastdirigierens und eigenen Schaffens in der Darstellung nicht durchzuführen, wenn diese ein auch nur einigermaßen lebendiges Bild geben soll. Wenige Monate nach seiner Übersiedlung, am 27. Dezember (1898), vollendete er in Charlottenburg das noch in München begonnene Heldenleben, ein Werk, dessen beherrschende Stellung in seinem symphonischen Schaffen wie in der Entwicklung der Moderne überhaupt bald erkannt wurde. Durch die Häufigkeit der Kadenz als harmonischer Grundlage steht es von seinen späteren Werken der älteren Form am nächsten, wenn diese auch in den neuartig und kühn erweiterten Bildungen nicht immer sofort erkennbar wird. Auch die einfache, in der älteren Melodiebildung gewohnte Sequenz, die höhere oder tiefere Wiederholung einer melodischen Phrase mit ihrer harmonischen Grundlage, findet sich hier häufiger wieder – Gemeinsamkeiten im Technischen, durch die ein sachlicher Vergleich mit klassischen Werken erleichtert wird, der unter anderem das ganze erste Allegro, die Liebesszene, den langsamen Schlußsatz als »ersten Ranges« erkennen läßt. Einzig ist bis jetzt auch die glückliche Erfindung des Programms, dem eine kleine Anzahl bloßer Satzüberschriften genügt, um den Inhalt fast jedes einzelnen Taktes restlos verständlich zu machen. Wem es natürlich ist, sich und seine Menschlichkeit derart im großen Stil auszusprechen, der ist eben ein großer Mensch, oder war es allermindestens, als er jenes Werk schrieb. Ein prachtvoller knapper Allegrosatz »Der Held«, phantasiereich in der Erfindung und noch mehr in der Entwicklung und gegenseitiger Kontrapunktierung der Motive, auch nach dem Maßstab der klassischen und romantischen ersten Meisterwerke, nach einem längeren gewaltigen Tutti im Fortissimo abbrechend, gibt die Persönlichkeit des Helden in ihren Hauptzügen, dem tatbereiten, gefühlvollen und lebensfreudigen, und ihrem Zusammenwirken wieder. Nach einer einschneidenden Pause zeigt sich sofort die Wirkung dieser machtvoll hingestellten Figur auf die »Widersacher«. In dieser allerdings, dem Gegenstand angemessen, nicht wohllautenden Bläserepisode von nur 18 Takten heben sich die Augenblicksbilder einiger bestimmter Geistesartungen scharf heraus. Der erste dieser kritischen Zuhörer beginnt mit feindseligem Zischlaut, aus dem man süddeutschen Tonfall heraushören kann, etwa mit einer Silbe auf jeder Note:

»Was ist denn dös für dummes, fades« – Der zweite »raunzt« bloß mit verkniffener Miene etwa die beliebte Mißbilligung: »a naa! (aber nein!) a naa!«

Langsames, vernichtendes Kopfschütteln eines Dritten, in den hohlen Quinten nicht ohne Anspielung auf den Inhalt des betreffenden Kopfes, kann etwa mit den hilflosen Worten: »I versteht net!« ausgedeutet werden:

– während ein weiterer sich nur durch halblautes Pfeifen

ausdrückt, und ein anderer der Kumpane das Heldenthema verhöhnt:

als sagte er höhnisch: »Uijeh, der Stra–auß!« Anfangs von innerlichstem Gram über dieses Verhalten der Mitwelt betroffen – sein erstes Thema in düsteres Moll gewandt – rafft sich der Held unter dem immer neu erklingenden Hohn der Widersacher endlich aus seinen Klagen mit überwindendem Schwung auf, dessen Fortissimo plötzlich als Abbruch dieses Teils verstummt, um einen in der Höhe angehaltenen weichen Ton der Solovioline fortklingen zu lassen. Festgebannt – ruhige Akkorde zur Begleitung seines in der Tiefe fortklingenden Motivs – steht der Held dieser neuen Erscheinung der zukünftigen Gefährtin gegenüber. Der folgende Teil nun dürfte nicht galanterweise des Helden Gefährtin, sondern deutlicher des Helden Werbung heißen; dann käme der Hörer nicht in Gefahr, etwa das ernst und würdig, doch immer drängender auftretende Werbemotiv des Helden für die Andeutung einer die wechselnde Laune stets wieder ablösenden ernsteren Seite im Wesen der Gefährtin selbst zu halten. Diesem Motiv antwortet sie, von der Solovioline sprechend dargestellt, abwechselnd übermütig, lachend, derb abweisend, parodierend-sentimental, erzürnt, bis es endlich vollständig siegt. Nun entwickelt sich aus ihm die Liebesszene, eine der herrlichsten Episoden der Symphonik überhaupt, mit deutlicher Mahnung an die Allmutter aller lyrischen Schönheit, die italienische Vokalkantilene. Der wundervolle Ges-dur-Gesang, der erst unbegleitet und sofort wieder in mutwillige Verkleinerung des Themas übergehend, schon in der Solovioline auftrat, wird nun zum ausgeführten Orchesterbild, das mit seinem formvollendeten, langsamen Ausklingen ein ruhig sicheres Versprechen andeutet und in seliger Vergessenheit endigt. Gleichsam aus weiter Ferne, wie aus der Zeitung, die der Held, ganz von der Geliebten hingenommen – unten der fortklingende Grundakkord Ges-dur des Liebesgesanges – gleichgültig überfliegt, klingen pianissimo die alten Schmähungen der Gegner hinein, um1 sich sofort wieder aus seinem Sinn zu verlieren. Da tönen von außen her Trompetenfanfaren in die glückversunkene, träumende Ruhe; langsam ringt sich das Bewußtsein des Helden – dessen Hauptmotiv, aus der Tiefe auftauchend – in die Wirklichkeit zurück; der Schlachtruf der Gegner klingt näher und stärker. Furchtbar prallen die feindlichen Massen aufeinander. Der Kampf, mit dem übrigens sehr an die Schlachtmusik in Händels Judas Makkabäus anklingenden Rhythmus der Schlaginstrumente, erregte und erregt heute noch die Gemüter, z. B. in Berlin, Winter 1911, bis zum Fortgehn ganzer Gruppen! Das Motiv der Geliebten mit der Triole geleitet wie ein wehendes Banner das des Helden durch das Kampfgewühl zwischen dessen Themen und dem vergrößerten ersten Widersachermotiv der Trompeten. Nachdem das Hauptthema endlich im vollsten Glanz der Orchesterfarben erstrahlt, gleichsam den siegreichen, mit seinem Stab über das Schlachtfeld dahersprengenden Helden geleitend, folgt ein feierlich schwungvoller Dankgesang von großer motivischer und harmonischer Schönheit, dem sich dann, durch ein neues Auftreten vom Unverständnismotiv, des dritten der Widersacher, und ein sofort wieder zu ruhevollem Begreifen einlenkendes, vom Zornesthema des Helden unterbrochen, der kurze unvergleichlich melodienreiche Satz der »Friedenswerke« anschließt, in Motiven aus Werken des Autors selbst, was manche Fernerstehende befremdete. Bei welchem anderen Helden hätte denn aber Strauß die Motive, die doch im Stil hereinpassen mußten, entlehnen sollen? Dieser Teil endigt in der Tenortuba mit dem Melos aus Traum durch die Dämmerung, »Ich gehe nicht schnell, ich eile nicht«, im vollen Orchester mit Guntrammotiven. Der Held fügt noch sein eigenes Motiv in prächtigen Klangwogen hinzu, schließt ab und wartet nun – Pause. Die Welt hat sich nicht geändert, das Dummheitsmotiv erklingt rang und leise abermals, und nun: ist es mit seiner ruhigen Fassung endlich vorbei. Über einer Kette von wütenden Dissonanzen rast sein Motiv dahin. Nach diesem letzten furchtbaren Ausbruch zieht sich der Held in die Stille des Landlebens zurück, wo die Schalmei des Schäfers sein Thema zu einer Hirtenweise nimmt und so ihn selbst in dieser Natureinsamkeit aufgehen läßt. Das Zornesthema, jetzt langsam und friedvoll geworden, deutet inneres Abfinden und Versöhnung an. Nun aber naht das Ende. Fieberschauer erfassen ihn; die Raben fliegen krächzend um sein Haus, die Wetterfahne kreischt im Sturm, der letzte, unbezwingliche Widersacher, der Tod, naht sich ihm in einer mit kalter Feierlichkeit harmonisierten Wendung des Gegnermotivs. Nach einem letzten mächtigen Aufbäumen des Heldenmotivs tritt in seiner ganzen früheren Lieblichkeit das Thema der Gefährtin zu ihm, von dem ein still beglückender Friede ausgeht. Unmittelbar eingänglich ist der melodisch beinahe volksliedmäßig fast nur in den Noten der Es-dur-Tonleiter gehaltene Schluß, in dem der Held in den Armen der Geliebten – oder in innigem Gedanken an sie –, bestimmteres vermag die Musik nicht zu geben – hinübergeht. Dieses letzte Zusammensein ist von schlicht ergreifender, weihevoller Schönheit. Der Geist des Geschiedenen erhebt sich dann – sein Motiv in gehaltenen Noten der Trompeten aufsteigend – zu den Sternen; langsames Verklingen. Die Uraufführung des Heldenleben leitete Strauß am 3. März 1899 im Frankfurter Museumskonzert, mit Willy Heß als Violinsolisten; am 22. in Berlin, am Symphonieabend der Hofkapelle zum Besten ihres Witwen- und Waisenfonds, mit Karl Hahr, der den Tod des Helden mit ergreifender innerer Größe, Wärme und Schönheit des Tons spielte. Im gleichen Frühjahr erschien das Werk unter Wüllner in Köln, und wieder unter Strauß selbst auf dem Niederrheinischen Musikfest zu Düsseldorf, wo die von ihm gewünschten zwölf Waldhörner in stattlichen zwei Reihen prangten.
Hier sei eines viel besprochenen, wenn auch an sich nebensächlichen Umstands gedacht, weil der Einblick in die vom Herbst 1907 bis Sommer 1910 laufenden Akten ein durchaus anderes Bild gewährt, als es damals zur Kenntnis der öffentlichen Meinung kam. Der Berliner Tonsetzer Gottlieb Noren hätte in seinen glänzenden Orchestervariationen über ein eigenes Thema »Kaleidoskop« als Huldigung für Strauß auch das Thema des Helden und der Widersacher kontrapunktisch verwertet, weshalb vom Verlag des Heldenlebens Klage auf Verbot der Aufführung erhoben und ein solches auch bis zur Entscheidung des Reichsgerichts, also über Jahre hin, aufrechterhalten wurde. Der Prozeß spielte sich lediglich zwischen den beiden Verlagshäusern ab; die durch Postkarte an Noren von Strauß erteilte Erlaubnis hatte das Landgericht Leipzig und nach ihm das Oberlandesgericht Dresden auf Grund des an den Verlag übertragenen Urheberrechts als ungültig erkannt. Das Gutachten der Sachverständigenkammer für Werke der Tonkunst, das den ersten Instanzen vorlag, sagte allerdings: »Die Geschlossenheit zu einem in sich abgerundeten Ganzen, die Ausbildung zu einem selbständigen abgeschlossenen Tongebilde« fehle dem Heldenthema. Es sei »eine melodische Phrase, aber keine Melodie.« Sehr merkwürdig erscheint dabei, daß der angezogene Wortlaut des Urhebergesetzes die für den Begriff der Melodie wesentliche harmonische Grundlage der vereinfachten oder erweiterten Kadenz vollständig außer acht läßt. Das Widersacherthema wird als »geradezu unmelodische Phrase« nicht weiter herangezogen. Hugo Riemann und Paul Klengel, die das Heldenthema für eine Melodie erklärten, wurden überstimmt. Doch war auch für die Vorinstanzen nicht die Aberkennung der Eigenschaft als Melodie entscheidend, sondern die Erwägung, daß in der Benutzung des Motivs kein schädigender Wettbewerb im Sinn des Gesetzgebers vorlag. Das Reichsgericht selbst kam gar nicht zur Prüfung dieser Fragen; denn sein erster Zivilsenat setzte das von den Vorinstanzen auf dreitausend Mark bewertete Interesse am Streitgegenstand, d. i. dem Aufführungsverbot, auf sechshundert Mark herab, und damit war der Gegenstand als zu geringfügig der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes entzogen; es blieb bei der Entscheidung der Vorinstanz. Dies also der wahre Kern der oft gehörten und gedruckten Bemerkung: das Reichsgericht habe das Verbot aufgehoben, weil das Urheberrecht nur Melodien schütze, das Heldenthema aber »keine Melodie« sei.
Ist das Heldenleben in naheliegendem Sinn »persönlich« zu nennen, so folgten nun einige Vertonungen ernster Gedichte, die den Tonsetzer in weit abliegende andere Welten führten, in Welten, deren Fülle er, seiner Art gemäß, zumeist in dem nachdichtenden Orchester erstehen ließ. Beide Nummern dieses Opus 44 » Zwei größere Gesänge für eine tiefere Singstimme« sind für Bariton oder hohen Baß gedacht. Das erste Stück, »Notturno« von Dehmel, bringt in einer aufs feinste ausgearbeiteten stimmungstiefen Partitur von etwa zweihundertfünfzig notenreichen Takten als einzige im herkömmlichen Sinn melodische Stelle jene, in der die Jugenderinnerung des Empfindenden anklingt, Seite 5 des Auszugs:
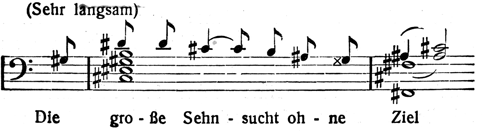
Auch das zweite, Nächtlicher Gang von Rückert, gehört zu jenen Werken, in denen Strauß sein Gefühlsleben eindringlichst in das des Dichters versenkt. Man lese oder spiele es für sich allein, und selbst in heller Sonne wird es einem kalt über die Seele rieseln; mit so furchtbaren Akzenten, und doch im Rahmen edler Kunst, lebt der Tondichter das wesenlose Grauen dieser Spukdichtung nach. Beide Stücke sind Beispiele dafür, wie Strauß als Harmoniker niemals nur Versuche anstellt, sondern im Dienst eines bestimmten Ausdrucks fremdartige Zusammenklänge anwendet. Bemerkenswert ist als Beispiel dieser Ausdrucksharmonik die auch rein schulmäßig belangreiche Vorbereitung des g-moll-Akkords im ersten:
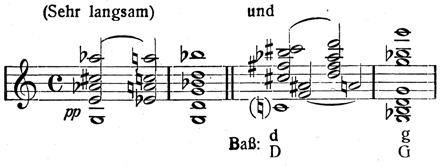
und eine Sequenz im zweiten:

In einfachere Stimmungskreise führen uns zwei andere Gesänge mit Orchesterbegleitung für eine tiefe Baßstimme, Werk 51. Der erste Gesang, Das Tal von Uhland, drei achtzeilige Strophen, »Wie willst du dich mir offenbaren, – Wie ungewohnt, geliebtes Tal?« gibt sich in der musikalischen Empfindung einfach, wie die des Textes, ist, wohlklingend sangbar, auch die Harmonik; wenig bewegt. In der Mitte erscheint eine größere klangliche Steigerung, darin ruhiges Ausklingen. Von einer schönen Stimme vorgetragen, ist das Stück durch die innige Wärme seines stillen Naturdichtens eindrucksvoll. Auch der zweite Gesang, Der Einsame, ein doppelter Vierzeiler Heines, ist ein einfaches, gesanglich getragenes Stück von ruhig schönem Gesamteindruck. Selbst die prachtvolle Schlußzeile, »Nimm mich auf, uralte Nacht!« ist mehr nachdenklich und mit vornehmer Gemessenheit vertont.
Noch einige kleinere Werke für Männerchor fallen in die ersten Berliner Jahre. Straußens Anteil an dieser Gattung wurde durch sein Preisrichteramt bei großen Wettstreiten rege, unter anderen bei dem um den Kaiserpreis in Frankfurt a. M. Als Tonsetzer zeigte er auch hier seine eigene Note, indem er gleich bis zur Grenzmöglichkeit auf die Besonderheit des Stoffes einging; zunächst auf das gänzlich Verschiedene der Konsonanzverhältnisse von denen der, eigentlich doch wohl von der Mittellage des Klaviers ausgehenden, Theorie. Besonders in bewegterem Zeitmaß und kleineren Notenwerten können Stimmführungen bei ihm lebendig und gut wirken, bei denen sich das Auge vergeblich nach einer größeren Zahl konsonanter Intervalle umsieht, ja die auf dem Klavier hart, hohl oder flach klingen, – während freilich manche seiner Zusammenklänge in längeren Noten eingehender Intonationsregelung bedürfen. In den zwei Chören aus Herders Stimmen der Völker, Opus 42, »Liebe« und »Nichts Bessres ist in dieser Welt«, abgedruckt auch im Volksliederbuch für Männerchor, Peters 1906, und Altdeutsches Schlachtlied, »Frisch auf, ihr tapfere Soldaten«, dürfte die Hauptwirkung im Gegensatz zwischen dem ersten, echt lyrischen, und dem zweiten, lebhaft bewegten, Stück liegen. Die kürzeren drei Stücke Opus 45, »Meinem lieben Vater gewidmet«, Schlachtgesang, Lied der Freundschaft und Der Brauttanz, aus Herders Stimmen der Völker, sind im ganzen harmonisch einfach gehalten, wie es dem Geschmack von Franz Strauß entsprach, doch zuweilen mit klanglichen Härten durchsetzt, die nur durch sorgfältigen Intonationsausgleich zu angenehmer Wirkung gelangen.
Endlich fällt in die ersten Jahre der Berliner Tätigkeit eine Nachblüte seines lyrischen Schaffens; ja wir haben vom Sommer 1899-1901 sogar die der Zahl nach liederreichste Zeit, die der sechs Hefte. Werk 41, 43 und 46-49, mit zusammen 31 Liedern. Opus 41 enthält Dehmels »Wiegenlied« – dessen »Wiegenliedchen« ist 49, 3 –

ein melodisches Stück, das jeder andere Autor von Rang geschrieben haben könnte. Opus 43 bringt drei Gesänge älterer deutscher Dichter, darunter den wirkungsvollen »Die Ulme zu Hirsau«, eine in die Verherrlichung Luthers ausklingende Ballade Uhlands, für hohen Tenor, mit der schönen Tonmalerei des Ulmengeflüsters; Bürgers »Muttertändelei«, ein allerliebstes Sprechlied, dessen Kehrreim »Leutchen, habt ihr auch so eins? – Leutchen, nein, ihr habt keins!« unwiderstehlich vorgetragen ist. Opus 46 vertont Rückert, Opus 47 Uhland, die beiden folgenden dagegen Dichtungen Lebender, und es scheint, als ob sich bei Strauß mit dem Geist der ihm tief vertrauten Gegenwartskunst ein innerlich weit stärkerer Zusammenklang ergeben hätte als mit dem der alten Romantik, wenngleich auch hier viel Melodisches und Sinniges entstand. Nur sind es keine neuen Seiten, die er uns hier zeigt. Selbst die beiden launigen Sprechlieder in Opus 46, »Sieben Siegel« von Rückert und Opus 49, »Junggesellenschwur«, aus Des Knaben Wunderhorn, atmen nicht ganz die alte Frische, die sich in köstlich ursprünglicher Weise in den dreizehn Strophen von Uhlands Ballade aus Opus 47, »Von den sieben Zechbrüdern«, findet. Auch dessen »Dichters Abendgang« im gleichen Heft gehört in seiner großen Stimmung zu den Perlen dieser ganzen Reihe. Es war alles eher als berechnend von Strauß, sie ohne Ausnahme zu veröffentlichen, da manche davon seinen Ruhm offensichtlich nicht mehren, Fernstehenden aber ein verkleinertes Bild seines Wesens geben konnten. Von den Vertonungen Lebender seien hervorgehoben: aus Opus 48 Henckells edle getragene »Winterweihe«, dann: »Ich schwebe«, ein besonders für Tenor köstliches echtes Lied, in dem die sinnfällige Lebendigkeit einiger Takte der Einleitung an die von Salomes Lob der Abendkühle erinnert, und die wirklich freundliche und auch entsprechend beliebte »Freundliche Vision« von Bierbaum, deren ungeheure dichterische Anspruchslosigkeit durch Strauß liebenswürdig wird; aus Opus 49 das in seiner Holzschnittmanier urtreffende Charakterbild »Der Steinklopfer« und Dehmels duftig-zartes Wiegenliedchen.
Bei Werk 46-49 ist es schwierig, unter den zwei bis drei Lagen, in denen jedes Lied erschien, die Tonart der ursprünglichen Eingebung festzustellen, die zur stimmlichen und harmonischen Beurteilung oft wesentlich ist; bei Vergleichung der Verlagsnummern dürfte es stets die niederste sein. Ist schon die Verlegersitte oft störend, der Verkäuflichkeit wegen meist nicht anzugeben, für welche der sechs Hauptstimmgattungen der Autor ein Werk gedacht hat, so wäre hier der Zusatz: Urtonart bestimmt zu fordern. – Im Sommer 1903 gab Strauß sein bis 1919 letztes Liederheft, Opus 56, von dessen sechs Nummern die 2-5 seiner Mütter gewidmet sind, heraus. Dieses inhaltsreiche Opus zeigt den Autor von zwei grundverschiedenen Seiten seines Wesens. Die naive, schlicht und herzlich einfache tritt in dem treuherzigen »Gefunden« von Goethe hervor, »Ich ging im Walde so für mich hin«; ebenso in den beiden Heine-Nummern, »Mit deinen blauen Augen siehst du mich lieblich an« und Weihnachtsidyll, »Die heil'gen drei Kön'ge aus Morgenland, sie frugen in jedem Städtchen«, dessen Begleitung er auch für Orchester setzte, mit dem reizvollen längeren Nachspiel. Tieferen Saiten seiner Natur scheinen die drei anderen entklungen, »Blindenklage«, mit dem leisen Weh des Motivs:

das naturstimmungsvolle »Im Spätherbst« von C. F. Meyer und die leidenschaftlich wilde »Frühlingsfeier« von Heine, »Das ist des Frühlings traurige Lust«, das, Sopran und Pianisten ersten Ranges fordernd, aufwogend schmerzliche Farbenglut ergießt.
Entscheidend für die Entfaltung von Straußens Tonsetzerpersönlichkeit war die Wiederhinwendung zur Oper, zu der gleichfalls der Aufenthalt in Berlin durch einen der ursprünglichsten und künstlerisch gedankenreichsten seiner damaligen Bewohner die Anregung gab. Die Feuersnot, das erste in der ganzen folgenden Reihe dramatischer Werke, zu dem ihm Ernst von Wolzogen die Verse schrieb, trägt die Opusnummer 50, gegen die Zahl 25 des Guntram, worin sich der große zeitliche Abstand schon andeutet. Es war um die Zeit der als solche geltenden Jahrhundertwende, Neujahr 1900, als Strauß an dem einaktigen, aber abendfüllenden reizvollen ›Singgedicht‹ arbeitete, dessen Stoff er dem Niederländischen Sagenbuch (Brockhaus 1843) entnahm. Nach dem Guntram hatte er die Absicht, eine Oper zu schreiben, entmutigt aufgegeben. Und jahrelang wartete er dann, bis er in Wolzogen den berufenen Bearbeiter fand. In der Wahl des Stoffes ging bei ihm vielleicht das Gefühl mit: Als ich euch im Guntram mein Bestes gab, habt ihr mich nicht verstanden; jetzt will ich einmal versuchen, gründlich zu euch hinabzusteigen. Als er sich zur Feuersnot entschloß, rechnete er mehr mit den ›Tatsachen‹. Aber sofort ging er in dem Stoff mit seinem ganzen künstlerischen Ernst auf, den auch die Satztechnik der humorvollen Motive und Anspielungen nicht verleugnet, wie in der Orchesterverarbeitung des erst von Diemut bei der Verteilung des Zuckerwerks gesungenen Motivs ›Schleckbißlein für böse Buben‹, als Kunrad in Liebeslust bei ihr in der Kammer ist. Der Text kann als vorzüglich gelten, mit Ausnahme jenes Teils der großen Rede Kunrads, die doch im Grunde nur zur Einführung des Werkes in das Bühnenleben diente und deren Kürzung von Vorteil wäre. Die Musik blüht und glüht nur so; die Kinderchöre sind, wie bei Strauß zu erwarten, für Kinder zu schwer, das Ganze aber ist einzigartig in seinem lebensprühenden Reichtum. Was mit dem einfachen Flammenmotiv:

Seite 95 des Auszugs, erreicht wird, ist unbeschreiblich. Eine lyrische Glanzrolle ist die der Heldin Diemut. Ihr Gesang »Die Sterne stehn und schauen – Froh in mein Fensterlein« läßt uns erkennen, daß das eigentlich Volksliedmäßige im Deutschen die volle Strenge der Silbenmessung, als ein ihm geschichtlich fremdes Element, ausschließt, was der sonst im Betonen so peinliche Strauß hier richtig empfand. In der Feuersnot ist neben dem Wagner-Einschlag der ernsteren Stellen die ganze leichte Anmut und das riesige Können der Eulenspiegelsymphonik auf den Klangkörper der Oper übertragen, wozu sich eine herzenswarme Lyrik von tiefgründiger Steigerungsfähigkeit in glänzendem Orchestergewand verbindend gesellt. Am 21. November 1901 erfolgte in Dresden unter Schuch die Uraufführung mit glänzendem Erfolg. In Berlin fand das Werk erst später und nur vorübergehend Eingang, da Angehörigen allerhöchster Kreise das Gewagte des Stoffes nicht zusagte. In Wien brachte Ende Januar (1902) Mahler eine glanzvolle Aufführung, 1902/03 ging es dann über dreißig deutsche Bühnen.
Zwischen diese hochbedeutsame Stufe seiner musikdramatischen Laufbahn und deren Fortsetzung mit Wildes Salome schieben sich Jahre voll größter äußerer Unruhe. Hatte die im Juni (1901) erfolgte Übernahme des Vorsitzes im Allgemeinen Deutschen Musikverein, vom Herbst ab die Führung des Tonkünstlerorchesters eine Fülle neuer Arbeit, im Oktober die Leitung des Guntram in Prag einen willkommenen Rückblick gebracht, so trat Strauß nach dem vielversprechenden Dresdener Erfolg eine größere Reise mit Ludwig Wüllner zu Straußliederabenden an, der beiden Künstlern reiche Lorbeeren brachte. Nach der Wiener Aufführung der Feuersnot, von der dortige Blätter berichteten, Strauß sei wohl hundertmal herausgerufen worden – trotz der von Hanslick behaupteten »grenzenlosen Angst des Autors vor allem, was Melodie ist« –, gab er einen Liederabend mit seiner Gattin, die als »vollendete Vortragskünstlerin und entschieden seine bessere Hälfte« mehr Gnade als er selbst vor den Augen des alten Herrn fand. Im Februar und März (1902) machte er mit seinem Berliner Tonkünstlerorchester die erwähnte große Reise. Ende Juni war er dann abermals in Wien, wo er mit einem Orchester von hundertdreißig Musikern im Prateretablissement »Venedig in Wien« zwei Konzerte im Freien dirigierte; »mein großer Namensvetter hat es auch getan«. Unter anderem spielte er Schillings' Ödipus-Prolog. Bis zum 2. Mai (1903) arbeitete er an dem Chorwerk Taillefer, Opus 52. Das Werk ist nach Uhlands Ballade für gemischten Chor, mit kleinen Solopartien für Taillefer, Tenor, Normannenherzog Wilhelm, Baß, und großes Orchester geschrieben, und zum Dank für die Erteilung der Würde eines Doctor honoris causa der philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg gewidmet. Wie Strauß selbst bemerkt, ist es für große Massen in großen Räumen gedacht, wie die Heidelberger Stadthalle, zu deren Einweihung es diente. Der Chor wird, wie die Solostellen, in den einfachsten Rhythmen und musikalischen Formen, oft in Oktaven geführt, die Vierstimmigkeit nur in einzelnen Akkorden und Gruppen von wenigen Takten, die dann aber um so glänzender wirken, überschritten, das Orchester, zumal in dem Zwischenspiel, der Schlacht (bei Hastings 1066), den Chormassen entsprechend sehr kräftig behandelt. Strauß leitete das Werk in Heidelberg am 26. Oktober 1903, wo besonders das urkräftige Rolandslied tiefen Eindruck machte. Hier schließe sich gleich die Erwähnung eines gleichfalls der älteren Geschichte seinen Stoff entnehmenden Vokalwerkes an, des etwas später geschriebenen Bardengesangs für Männerchor und Orchester, Werk 55. Den bis auf die letzten drei Strophen geistig nahezu inhaltlosen Text von Klopstock, der nur eine gewisse Grundfarbe gibt, malt die Vertonung in genialem Freskostil aus. Ihr Hauptmittel ist das Nacheinander-Eintreten, Ablösen und Zusammengehn der drei Chöre, meist nur zweistimmig, Tenor und Baß im Unison oder Oktaven, fast stets in einfachen Themen, dazwischen die Signale der einzelnen Heerabteilungen, stets das Motiv

in verschiedenen Tonarten und den Verschachtelungen mehrerer, in Hörnern, Trompeten und Posaunen, hinter dem Podium ferne, näher und ganz nahe aufgestellt, begleitet von bewegten Streicherfiguren und Bläserakkorden, wodurch ein sehr lebhaftes Klangbild entsteht. Von besonders feinem tonmalerischen Reiz ist unter anderem die Stelle: »Auf der Mondglanzwolke eure Väter schweben«, Seite 45 des großen Auszugs.
Zwischen jenen glänzenden Zeitraum fast ununterbrochener musikdramatischer Arbeit, welche die Reihe von Salome bis Ariadne darstellt, und das Vorspiel zu ihr, die Wiederaufnahme der dramatischen Komposition mit der Feuersnot, tritt alsdann noch ein letzter Ausläufer der Reihe von Orchesterdichtungen, ein Werk, das in dieser Eigenschaft bei Strauß zehn, Jahre lang, bis zum »Festlichen Präludium«, ohne Nachfolge blieb. Es zeigt den Meister in der überlegenen, neben Stellen voll tiefster Innigkeit und symphonisch dichterischem Ernst fast übermütig schaltenden spielenden Beherrschung der Ausdrucksmittel des großen Orchesters. Am 31. Dezember des Jahres 1903 vollendete Strauß die Partitur der Symphonia domestica, »Meiner lieben Frau und unserem Jungen gewidmet«, dem am 12. April 1897 geborenen einzigen Kinde Franz. Das in einem Satz geschriebene Werk gliedert sich in vier Abteilungen. Hier hat der Autor selbst den Vorstellungsverlauf, außer der Überschrift, noch in zahlreichen Worten und Zusätzen angedeutet, wie: Themen des Mannes, gemächlich – träumerisch – feurig; – Thema der Frau – des Kindes – Kindliche Spiele, Elternglück – zärtlich bewegt, – Wiegenlied – die Glocke schlägt 7 Uhr abends – Schaffen und Schauen, Liebesszene – die Glocke schlägt 7 Uhr morgens – Erwachen und lustiger Streit – Versöhnung, fröhlicher Beschluß. Der Schwerpunkt der Domestika liegt in der dichterisch-thematischen Verarbeitung. Die Motive selbst sind anspruchlos, zwar an sich einprägsam und ausdrucksstark, aber nicht nach scharfer persönlicher Abgrenzung von ähnlichen strebend. Das Wiegenlied gleicht wohl mit Absicht Mendelssohns gleichfalls in g-moll stehendem Gondellied, Opus 19, 6, das Klarinettenmotiv im »gefühlvollen« Liebesthema klingt an das Hauptmelos von Tschaikowskys zarter Schwermut vollen As-dur-Walzer für Klavier, Werk 40, No. 8, an.

Auch das innig-ruhige Thema am Schluß des zweiten Teils

kommt infolge seiner volksliedmäßigen Art dem Hörer leicht bekannt vor. Die ganze Anlage wird fast beispiellos einheitlich dadurch, daß, ähnlich wie in Saint-Saëns c-moll-Symphonie mit Orgel, gleich der kurze erste Satz alle Hauptthemen aufstellt, die im Verlauf immer wieder auch häufig in Tonart, Lage und Instrumentation des ersten Auftretens wiederkehren, so das »gemächliche« Motiv in f, von Fagotten und Celli, das »feurige« in e, von den hohen Violinen vorgetragen, das »träumerische«, mit dem d¹ der Oboe beginnend,

das im dritten Satz eine thematisch-kontrapunktische Verarbeitung von größter Kunst und Schönheit erfährt; alle Soloinstrumente des Orchesters singen es ausdrucksvoll um die Wette. In dem Hauptteil, der zwischen dem abendlichen und morgendlichen Siebenuhrschlagen liegt, ist dichterisch unheimlich zwingend und mit einem hohen Grad reinmusikalischer Schönheit, nach dem Zubettbringen des Kindes mit dem Wiegenlied die Einsamkeit der gedanken- und empfindungsreichen Dämmerstunde, und vor dem Erwachen das wesenlose Zwischenland zwischen Traum und Wirklichkeit gemalt. An das bescheiden angedeutete Schlagen der Uhr, das unmittelbar stimmungsvoll wirkt und auch über den Ablauf der vorzustellenden äußeren Vorgänge belehrt, konnten sich manche Hörer nicht leicht gewöhnen. Die Schlußfuge hat an strömender Frische wohl kaum an einem seit der Zeit der Klassiker entstandenen Tonwerk ihresgleichen. Auf die schon vor Kenntnisnahme des Werkes vielfach aufgestellte Vermutung, die verborgene Viersätzigkeit bedeute die »Rückkehr zur absoluten Musik«, sei auf den köstlichen Brief an Oskar Bie, Seite 88 verwiesen. Daß hier wie in den anderen Tondichtungen! manche Stellen sind, deren Herauskennen und Verstehen infolge ihres im Programm liegenden Ursprungs Schwierigkeit macht, beweist, daß sich Strauß über diese praktische Frage keine Rechenschaft gab, sondern nach seiner durch den Gegenstand beeinflußten Eingebung als einziger Quelle schuf. Wenn es ihm nun innerlich natürlich war, mit den Mitteln des gewohnten großen Orchesters auch sein eigenes Innenleben auszusprechen, so vermittelt die Natürlichkeit, mit der es geschieht, den etwa vorhandenen Gegensatz. Die eigentliche Schwierigkeit zwischen Gegenstand und Mittel der Darstellung besteht nur in der Betrachtungsweise jenes Hörers, der einen wesentlich der bildenden Kunst angehörenden Gesichtspunkt, den Gegensatz von Größe der Form und dem äußerlich kleinen familienhaften Stoff, auf die Musik überträgt, die doch in der Domestica wesentlich Seelisches gibt. Die räumliche Enge der häuslichen Umwelt heranzuziehn, lehrt durch den Vergleich nur, wie innerlich Strauß ist und wie äußerlich man ihn in diesem Fall nähme. Denn daß er zum Ausdruck des eigenen größten und groß erfaßten Lebensinhalts ein anderes Mittel hätte benützen sollen als das ihm nun einmal zur Aussprache natürliche des großen Orchesters, ist eine unbegründete Forderung. Wenn man aber schon dieses Äußere zum Maßstab nimmt, weshalb sollte hierin das Leben eines berühmten Künstlers hinter dem eines Eulenspiegel oder Don Quixote zurückstehn? Bei unbefangenem, von Kunstgelahrtheit freiem Genießen bietet das Werk unerschöpfliche Freude. Die Uraufführung war dem Neuyorker Symphonieorchester vorbehalten, dessen Leiter, der junge Hermann Hans Wetzler, für Strauß emsig vorstudierte. Dieser kam am 23. Februar 1904 mit dem Schnelldampfer Moltke dort an. Von dem Umfang seiner Tätigkeit bei dieser Reise gibt sein Brief an Schillings einen Begriff: »In 4 Wochen 21 Konzerte mit etwa 20 Orchestern absolviert, dazu Reisen Tag und Nacht, Festdiners und alles Teufelszeug.« Der Erfolg dieser Kunstreise war sehr stark, auch Frau Strauß hatte in jedem Konzert vier bis fünf Lieder zu wiederholen. Im ganzen gab Strauß bis in den April hinein in verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten fünfunddreißig Abende mit seiner Gattin. Am 27. Februar, dem 3., 9. und 21. März fanden in Neuyork selbst vier große Strauß-Festkonzerte statt, in deren letztem Strauß die Domestika als Abschluß eines Zyklus seiner Tondichtungen leitete. Frau Strauß sang eine Reihe von ihm instrumentierter Lieder. Im März bot ihm der Leiter des Warenhauses Wannemaker in Neuyork tausend Dollar für die Leitung von zwei Vormittagskonzerten in einem zum Konzertsaal umgestalteten Stockwerk seines Geschäfts. Nachdem sich Strauß sehr genau vergewissert, daß alle Vorbedingungen zu einer künstlerisch durchaus würdigen Aufführung vorhanden waren, fand er keinerlei Bedenken, hier so gut wie anderswo zu dirigieren, was er später mehrfachen Angriffen gegenüber in seiner frischen Art in der Berliner Allgemeinen Musikzeitung vom 20. April darlegte: »Wahre Kunst adelt jeden Saal, und anständiger Gelderwerb für Frau und Kind schändet nicht – einmal einen Künstler.« Von Amerika aus, ja sogar noch an Bord des Schiffes Blücher, hatte er ausgedehnten Schriftwechsel zu führen wegen des bevorstehenden Tonkünstlerfestes in Frankfurt und der dort geplanten Aufführung der Domestika. Nach Hauseggers Wieland wollte er sie nicht spielen lassen; jener »ist ein vollkräftiges sehr brillantes Stück, nach dem die ganze erste Hälfte der domestica, die ganz in Wasserfarben und Pastell gemalt ist, gar nicht wirken kann«, wie er an Schillings schreibt. Jedenfalls aber gehe bei einer Kollision Hausegger vor, denn »ich bin Vereinspräsident, komme also zuletzt«. Am 28. April reiste er von Neuyork ab und erwies sich erneut als seefest. Anfang Mai leitete er dann auf dem Bayerischen Musikfest in Regensburg unter anderem die Graner Messe und Bruckners Neunte nebst dem Tedeum mit dem Münchener Hoforchester, dann im Sommer noch zweimal die Domestika, auf der Tonkünstlerversammlung zu Frankfurt als erste Aufführung in Deutschland, und am 2. Oktober in Essen bei der Einweihung des neuen Stadtgartensaales. – Ein Jahr ging dahin, neben der Dirigententätigkeit mit einer für den Autor selbst, wie später für die Musikwelt, ganz neuartigen Arbeit, an dem Musikdrama Salome, die Strauß im Sommer 1903 begonnen hatte. Von der nächstjährigen Tonkünstlerversammlung in Graz, 1905, wo er sein Heldenleben leiten sollte, rief ihn der am 2. Juni plötzlich erfolgte Tod seines dreiundachtzigjährigen Vaters ab. Im Anschluß an das Fest gab dann Gustav Mahler in Wien eine Musteraufführung der Feuersnot, neben der von Pfitzners Rose vom Liebesgarten und Liszts Heiliger Elisabeth.
In den bisher glanzvollsten Zeitraum von Straußens Schaffen, den der vier aufeinanderfolgenden Bühnenwerke, der uns sogleich eingehender beschäftigen soll, fiel noch, nach der Uraufführung der Salome, die des bereits erwähnten Bardengesangs durch den Dresdener Lehrergesangverein unter Friedrich Brandes, Ende Januar 1906, und ein großartiger Erfolg der Domestika, Ende März, im Chatelettheater zur Paris. In Wien leitete er im Winter 1907/08 die Anrechtskonzerte der Philharmoniker, in der Academia Santa Caecilia zu Rom, Anfang Februar, gemischte Spielfolgen, die ihm große Triumphe brachten, ebenso Ende März im Colonne-Konzert zu Paris. Im Mai (1908) unternahm er mit den Berliner Philharmonikern eine Rundreise durch Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Schweiz und Süddeutschland, auf welcher er an einunddreißig Tagen in ebensoviel Städten Konzerte gab, und sich trotzdem bis zum letzten Abend als der mit dem Zauber jugendlicher Federkraft und Anmut begnadete Meister erwies. Nach dem letzten Konzert, das den Abschluß dieser ungemein bewegten Zeit bildete, eilte er nach Garmisch bei München, wo ihm nach dem künstlerischen Entwurf Emanuel Seidls sein endlich errungener eigener Wohnsitz, die inmitten eines großen Parkes am Fuße des Kramers gelegene Villa erstanden war – um dort die Elektra zu vollenden.