
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Oktober 1889 bis Juni 1894
Als Strauß aus der unerquicklichen, seiner tatsächlichen damals schon in weiteren Kreisen anerkannten Bedeutung unwürdigen ersten Münchener Anstellung schied, stand sein Wesen als Dirigent und Orchesterkomponist fertig da und wartete nur auf ein geeignetes ständiges Arbeitsfeld seiner Betätigung. Die erste Bearbeitung des Macbeth und der Don Juan lagen im Pult, ebenso die noch unaufgeführte Burleske, der letzte Gruß an die endgültig verlassene Welt eines Brahms. Ganz erfüllt vom Geist des deutschen Fortschritts, mit dessen zu jener Zeit der Entwicklung unvermeidlichen Einseitigkeit, der Geringschätzung des romanischen Elements und der nebensächlichen Beachtung des Vokalen, die damit innig zusammenhängt, war der Fünfundzwanzig jährige ganz Tatkraft, Zielbewußtsein, reiner und hochgestimmter opferfähiger Wille und, im Rahmen der unwiderstehlich fortreißenden Zeitbewegung, schärfster Kunstverstand. Am Ende der für ihn als Theater-, Konzertdirigenten, als Orchester- und Liederkomponisten bedeutungsvollen Weimarer Jahre steht der erste Versuch, sich als Schaffender auch die Bühne zu erobern, der zunächst eben an jenen Grenzen scheiterte. Weimar war bis 1919 das einzige Theater, das Strauß, wenn auch nicht äußerlich, aber doch dem Wesen nach, eine ihm zukommende künstlerisch beherrschende Stellung bot. Es war nicht Hofbühne im schlimmen Sinn.
Im Winter 1888/89 war dem Gepeinigten endlich die Aussicht geworden, die bedrückenden Münchener Theaterverhältnisse loszuwerden. Durch Bülow und Hofkapellmeister Eduard Lassen dem Intendanten Hans v. Bronsart empfohlen, erhielt er die Anstellung als Großherzoglich Sächsischer Kapellmeister, die er am 1. Oktober 1889 antrat, und über deren Verlauf seine Briefe an Ritter viel erzählen. Auch Pauline De Ahna kam bald nach Weimar, um bei Strauß und bei Frau Rosa v. Milde ihre Studien im jugendlich-dramatischen Fach zu vollenden. Nach erfolgreichem Gastspiel als Pamina wurde auch sie verpflichtet. Ein weiterer Schützling von Strauß, mit dem er zuletzt in München eifrig Wagnerpartien studiert hatte, der junge strebsame Heinrich Zeller, wurde als Heldentenor verpflichtet, in welcher Stellung er bis zu seinem Abgang von der Bühne, etwa dreißig Jahre lang, verblieb. Ein dritter Schüler des jugendlichen Meisters endlich, Hermann Bischoff, hielt sich in Weimar auf, um sich unter seiner Leitung weiter auszubilden. Als »Volontärin« nahm Strauß die noch nicht sechzehnjährige kleine Schoder an sein Theater, mit der er öfter studierte und die er in kleinen Partien, ja sogar als erste Dame in der Zauberflöte herausstellte. Er erkannte die starke Anlage in ihr, die ihm später als Gutheil-Schoder eine so hervorragende Elektra sang. Der Intendant v. Bronsart sowohl als der fast sechzigjährige Lassen, der bekannte Liederkomponist, nahmen den jungen Genossen in herzlichster Weise auf. Lassen trat zwar, auch in der Folge, nicht zurück, überließ ihm aber sofort den ganzen deutschen Opernspielplan mit Ausnahme von Fidelio, Holländer, Meistersingern und Nibelungenring, ferner fielen Strauß die vier Anrechtskonzerte im Theater zu. In seiner Antrittsrede an das Orchester erklärte er, hier, wo einst Liszt gestanden, in dessen Geist wirken zu wollen. Solisten, Orchester und der kleine, aber willfährige Chor ordneten sich von vornherein mit aller Hingabe seiner ihnen allen neuen Art der Führung unter. So ließ sich zunächst alles gut für ihn an. Auch fühlte er, wie die Ruhe der kleinen Stadt wohltätig auf sein Nervenleben wirkte. Für die Abende war der reizend gemütliche Künstlerverein da, in dem der neue Kapellmeister alsbald lange zigarettenrauchend beim Spiel aufblieb; auch Lassen hielt gewöhnlich mit. Die Enge der äußeren Verhältnisse war freilich groß. Sein Gehalt betrug zunächst nur 2100, von Neujahr 1890 an 3000 Mark. Im Orchester hatte er nur sechs erste Violinen, für Wagneropern äußerst wenig; einzelne Stimmen waren überdies mit altersmüden Kräften besetzt, die nur Rücksicht auf das geringe Ruhegehalt noch am Pult fest hielt. Der Spielleiter war künstlerisch bejahrt und konnte Straußens Anweisungen nicht mehr folgen; auch dessen Zurruhesetzung konnte er nicht beantragen, da dem Armen dann nur sechshundert Mark jährlich geblieben wären. Getreu der in Meiningen und München gewonnenen Überzeugung, trat er sofort für Wagner und seine Nachfolger ein, so viele Hindernisse sich auch dagegenstellten Die Wagnerausstattung, zum Teil sinnwidrig, machte zum Beispiel im Tannhäuser eine richtige Spielleitung nach Bayreuther Muster unmöglich; über die Landschaft zum ersten Akt des Lohengrin war Strauß so unglücklich, daß er Ende April 1891 den Großherzog bitten ließ, zur Jubelvorstellung aus eigener Tasche für tausend Mark eine neue Malerei bestellen zu dürfen. Der Regent wies den Posten sogleich selbst an, aber Hoftheatermaler Brückner in Koburg erklärte die Zeit für zu kurz, den Auftrag noch ausführen zu können. Auch in Weimar blieb Strauß die wachsende Freude an den Konzert- und Bühnenleistungen seiner beiden Schützlinge, mit denen hingebungsvoll weitergearbeitet wurde. Ja, er hatte die Genugtuung, an der Tannhäuservorstellung eines nahen ersten Hoftheaters zu sehn, daß, trotz guter Leistungen, der Sänger und des Orchesters, in bezug auf Stil seine Weimarer Aufführung auf einem ganz anderen Blatt stand. Pauline De Ahna als Pamina, Fidelio, Elsa, Elisabeth, Isolde, Königin in Ritters »Wem die Krone« als heilige Elisabeth in Liszts dramatisch aufgeführter Legende, endlich als erste Freihild im Guntram, Zeller als Tamino, Tannhäuser, Lohengrin, später als Tristan bereiteten ihm vor allem durch den hohen Ernst und die dadurch erreichte Stileinheit ihrer Darbietungen hohe Befriedigung. Er trat auch an die Spitze der Ortsvertretung des Allgemeinen Richard-Wagner-Vereins, die er zu einem selbständigen Zweigverein ausbaute. Die Bedeutung Wagners hob er in Weimar äußerlich schön dadurch hervor, daß er dessen Opern stehend, die übrigen sitzend leitete. Im Verein erläuterte er die Werke des Meisters durch Klaviervorträge. Obgleich Strauß, wie so viele andere, von einem gleichsam religiösen Glauben an das Musikdrama beseelt war, über dessen praktisch bedenkliche Seiten Wagners flammende Beredsamkeit in seinen Schriften so leicht hinwegtäuscht, blieb er sich doch der Unfruchtbarkeit gedankenloser Wagnernachahmung nach Art vieler Neudeutschen stets kritisch bewußt. Über die eingereichte Arbeit eines Ausländers z. B. schrieb er 1890: »Der ganze Wagner ist nur aus dem Geist der deutschen Sprache voll und innig zu erfassen. – Für das Einfache wie für das Komplizierteste weiß er den richtigen Ausdruck zu treffen.« N. dagegen hält es für genügend, »sich den allerschwierigsten Tristanstil äußerlich anzueignen und in demselben frisch und fröhlich darauf los zu musizieren, gleichviel ob es paßt oder nicht. Bei den einfachsten Vorgängen ergeht er sich in der überreiztesten Harmonik und raffiniertesten Instrumentation, – daß einem ganz übel wird.« Nicht minder kritisch blieb Strauß den eigenen Wagneraufführungen gegenüber, zu denen er als Kapellmeister-Spielleiter im Sinn des Meisters probte, in allen Einzelheiten gesanglich, orchestral, darstellerisch und szenisch gründlich umstudierend. Er berauschte sich nicht nur an der allgemeinen Idee des Gesamtkunstwerks, in dem Wagner, wie Strauß sagte, durch das Einswerden von Wort und Ton die Wege Goethes und Beethovens vereinigte; er blieb sich stets bewußt, daß dieses Ziel unausgesetzt die Zusammenstimmung aller Werkteile des Musikdramatischen fordert, das Ersetzen des gedankenlosen Einerlei in Szene, Geste, Ausdruck und musikalischem Vortrag durch begründete, theatralisch wirksame und technisch gut zu erfüllende Bestimmungen, die aus dem Geist des Ganzen, der Szene wie des einzelnen Satzes oder Wortes heraus und zugleich nach den Gesetzen der natürlichen Gefühlsäußerung erfaßt sind, – kurz, daß sie strenge, rastlose Arbeit heischt, die sich in keinem Moment mit Mattem und Halbem zufriedengibt. In dieser Richtung trat er, alles mit fortreißend, mit größter Bestimmtheit auf, so daß er z. B. im Tannhäuser den Wolfram zwang, während des Gebets der Elisabeth auf der Szene zu bleiben, und einmal den unaufmerksam singenden Choristen auf der Probe drohte, wenn es abends ebenso schlecht ginge, ungeniert den Taktstock nach ihnen zu werfen. Selbst über die Richtigkeit der Gewandung wachte er. »Nach einer umfassenden Kapellmeister-, Solorepetitor-, Dekorationsmaler-, Regisseur- und Theaterschneidertätigkeit«, schreibt er 1894, »endlich ein bißchen zur Ruhe gekommen, kann ich wieder der Pflichten des privaten Lebens gedenken und –« teilt dem Freund seine Verlobung, mit. – Nun endlich setzte er mit Liebe unerfüllt; gebliebene Wagnerträume in die Tat um und gab seinem Herzen durch vervollständigte Aufführungen seiner Lieblingsopern Feste, eine Arbeit, deren unsägliche Schwierigkeit im einzelnen nur der Praktiker ermessen kann. Wenn man in jener Zeit fragte: Was macht Strauß? bekam man unweigerlich zur Antwort: »Strauß macht Striche auf«. In dem fast strichlosen Lohengrin, Oktober 1898, betrug die Dauer des »Aufgemachten« gegen Lassens dreieinhalbstündige Leitung immerhin eine halbe Stunde. Bei der Szenenprobe war Strauß so entsetzt von dem herkömmlichen Spiel, daß er es mit Unterstützung Bronsarts und mit Hilfe des von Mottl nach Angaben von Frau Wagner angefertigten Regieauszugs vollständig umordnete. Das Orchester hatte sich in die anderen Zeitmaße und Stärkegrade zu finden, die Solisten zudem; in die veränderte Spielanweisung. Lohengrin durfte den jungen Schwager Gottfried nicht mehr erst eine Weile gemütlich am Ufer der Schelde spazierenführen, ehe er in den Kahn stieg, Ortrud erst vor dem Ausbruch »Entweihte Götter« ihre sitzende Stellung aufgeben. Bei der ersten Vorstellung ging es freilich wie so oft: die in den Proben sorgfältig ausgemerzten gesanglichen Mißbräuche kamen abends bei den meisten Solisten fast unvermindert »im alten Trab« zum Vorschein. Vor der Lohengrinaufführung des 20. Februar 1890 hatte Strauß »eigentlich gewaltige Manschetten. Wird Frau Wagner durch alle Unzulänglichkeiten hindurch meinen guten Willen erkennen?« Frau Cosima zeigte sich aber bei ihrem Besuch in Weimar tief ergriffen von dem heiligen Ernst, mit dem man hier, bei so viel geringeren Mitteln als in Bayreuth, an das Werk herantrat, und Strauß war überglücklich. Von Pauline De Ahna, die Frau Wagner als Elisabeth in Aussicht genommen, ließ sie sich deren Arie und Gebet vorsingen. Im Tannhäuser, März 1890, blieb in Weimar nichts gestrichen als die dritte Strophe des Venuslieds. Rienzi, November 1891, war nahezu strichlos. Um diese Oper, die Bronsart eine galvanisierte Leiche, Strauß selbst ein herrliches großes Meisterwerk nannte, würdig erstehn zu lassen, gab er dem Spielleiter genaue Anweisungen, dem damit bei den kleinen Bühnenverhältnissen eine riesenhafte Arbeit erwuchs. Am 17. Januar 1892 folgte endlich Tristan. Auch auf den ganzen Opernspielplan nahm Strauß Einfluß, und war hierin, wie stets seit der Wendung zur deutschen Fortschrittspartei, deren tatkräftiger, opferwilliger Vertreter. »Als Engel mit dem heiligen Schwert,« schrieb er schon 1890, »das Einschleichen Meyerbeerscher Opern, Gounods Faust ins Repertoire zu! verhüten, habe ich hier bereits meine Ruh'!« Freilich sah er sich oft vergebens nach deutschen Opern um, die seinen Anforderungen entsprachen. »Viel schlechter übersetzt sind die französischen und italienischen auch nicht, als die deutschen deklamiert.« Von Uraufführungen brachte er unter anderem Sommers geistreiche »Loreley«, Eugen Lindners »Meisterdieb«, Ritters Einakter »Wem die Krone«, von dem er sich gleich die einzelnen fertiggewordenen Teile der Partitur schicken ließ. Gegen den älteren Freund äußerte er sich herzlich begeistert, ebenso später gegen Humperdinck über Hänsel und Gretel, durch ein Schreiben, das sein Herz und seinen Charakter im schönsten Licht zeigt. »Wem die Krone« gab er im Juni 1890 zusammen mit Ritters Faulem Hans, und eine größere Anzahl von Bühnen spielte nach dem Erfolg dieses Abends wenigstens je eins der beiden Werke. Die Uraufführung von Hänsel und Gretel leitete er Weihnachten 1893 mit dem bekannten weittragenden Erfolg. Über die des Guntram wird später zu berichten sein.
Ein wichtiges Dokument aus jener Zeit für Straußens Entwicklung in Hinsicht auf das Gesangliche ist seine Bearbeitung von Glucks Iphigenie auf Tauris für das Weimarer Hoftheater. Die gebräuchliche Peters-Ausgabe hatte in richtiger Würdigung der häufigeren Mitlaute der deutschen Sprache sehr oft zwei Silben des französischen Urtextes in eine deutsche zusammengezogen, während Strauß mit sorgfältigster Ehrlichkeit die Silbenzahl der Ursprache herstellt und dadurch die Knickungen in die melodische Linie erst hineinbringt. Obschon er selbst diesen Irrtum später überwand, wird doch die Lücke neudeutscher Musikerausbildung hierbei deutlich; denn auf den Musikschulen wird auch heute vom Vokalen nicht mehr gelehrt, und es scheint auch nichts zum Selbstunterricht in den praktischen Kenntnissen der deutschen Gesangssprache Geeignetes zu geben, obgleich das Nötigste auf einen kleinen Druckbogen ginge. Ein Beispiel für das oben Gesagte bietet gleich die Übertragung eines Edelsteins dieser Oper, wie der Oper überhaupt, der Tenorarie des Pylades:
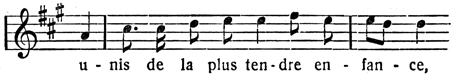
nach Peters: »Nur einen Wunsch, ein Verlangen!«; das Sechzehntel fällt fort; nach Strauß: »Vereint mit dir in frühester Kindheit!« Da sind vier schwer hemmende Mitlaute gegen keinen des Urtexts. Oder die gleichgebaute Zeile:

Peters: Will froh den Streich empfangen; Strauß: Unser Streben nach höchsten Zielen, mit im ganzen neunzehn großenteils hemmenden Mitlauten gegen neun tonhafte oder fördernde des Urtextes. Der schwere Verlust an Formenklarheit, den bei Strauß das Abschaffen des ihm jedenfalls zu äußerlichen Reims bedingt, lockert oft das rhythmische Gefüge; denn der Reim haftet, in schnellerem Tempo, im Ohr und bildet für dieses die natürliche Unterlage zur viertaktigen Unterteilung der Melodie, die aus ihm entstanden ist. Statt des Trochäus findet sich oft der das Versmaß störende schwerfällige Spondeus, der nur für das Auge ähnlich ist; z. B. »Kindheit« für die zwei Endsilben von enfance, »hilfreich« für die von secourables. Ebenso die weibliche Endung statt der männlichen: es ergreifet, statt es ergreift, oder die schwere weibliche statt der leichten, z. B. Opfer statt Altäre, autels. Aus alldem spricht jene gewisse Gesangsfremdheit des empfangenden und schaffenden Vorstellens, die sich bei Strauß erst spät verlor. Er hatte damals jene Reise nach Griechenland noch vor sich, die ihm das Verständnis des Altertums anbahnte; gewiß war auch ein Gedanke der Wagnerverehrung dabei im Spiel, nachdem der Meister die Aulidische Iphigenie seinen musikdramatischen Grundsätzen gemäß überarbeitet hatte, nun auch die Taurische in seinem Geist zu geben. Nur wußte er noch nicht alles, was man von Wagner lernen kann, und nahm nicht jene weiche, sangbare dichterische Sprache zum Muster, mit der schon sein Holländer die deutsche Oper textlich auf neuen Boden stellt. Gerade den dramatisch wuchtigsten Moment in der ersten Soloszene der Iphigenie hat Strauß abgeschafft, indem er in der Traumerzählung die Worte strich, die ihr den Orest zu erdolchen befehlen. Auch gesanglich ist die Stelle durch Verlegung in die tiefere Oktave ihrer einschneidenden Form entkleidet. Die wunderbare Plastik, in der der Frauenchor sein Grauen darüber ausdrückt, störte er durch das, musikalisch wenig schön, gleichzeitig zu singende Rezitativ der Iphigenie. Gesangliche Sonderwerte gehn dadurch verloren. Und das herrliche Gebet, in dem Iphigenie, verhältnismäßig ruhig ihre Lage übersehend, von Diana den Tod erfleht, das Stück, das uns gleich zu Beginn ihren Seelenzustand enthüllt, ließ er hier fort, um es an das Ende des Aktes zu setzen. Inzwischen ist aber ihr innerer Zwiespalt durch die Zumutung, den an Orest gemahnenden Fremdling in der nächsten Stunde zu töten, drängend geworden, und es ist klar, daß Dichter und Komponist an dieser Stelle eine vollständig andere Szene geschrieben hätten. Man sieht an diesem kleinen Beispiel, daß man es endgültig aufgeben sollte, die Werke der drei riesengroßen Altklassiker Bach, Händel, Gluck zu »bearbeiten«. Sie verstehen ist alles! Denn Größeres ward nie geschaffen.
Außer der umfassenden Tätigkeit für die Hofoper lag Strauß in Weimar auch die Leitung der Anrechtskonzerte im großherzoglichen Hoftheater ob; sie ist schon dadurch bedeutungsvoll, daß er im Lauf dieser Jahre seine Tondichtungen Don Juan, Macbeth, Tod und Verklärung zum ersten Male spielte und die in Meiningen und München eingesogenen Überzeugungen selbständig verwirklichte. Wie stets mit den gegebenen Mitteln, so trat er auch hier kräftig für Liszt ein, den er als Orchesterdichter und deutschen Musiker verehrte. Er war der Ansicht, man solle Liszt am besten in ausschließlich ihm gewidmeten Konzerten spielen, eine solche Persönlichkeit müsse von den entsprechenden verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Er rühmt den hohen Gedankenflug und die tiefe Inbrunst des Purgatorio in der Dante-Symphonie; die Benediction nennt, er ein erhabenes, Mazeppa ein herrliches Stück, nach Schumanns Erster (»ja, wir machen schon Konzessionen, so weit heruntergekommen sind wir«) eine Erholung! – Lange Wiederholung derselben rhythmischen Formel nämlich, wie in diesem ersten Satz Schumanns, konnte Strauß immer weniger vertragen; gestaltete sich doch die rhythmische Linie in seinen eigenen Arbeiten aus jener Zeit immer wechsel- und lebensvoller. Von der Heiligen Elisabeth bemerkt er schön und innig: »So wenig Kunstfertigkeit und so viel Poesie, so wenig Kontrapunkt und so viel Musik!« Den ersten Teil der Hunnenschlacht nennt er grandios; der Mephistowalzer sei »von einer Frechheit, die wirklich nur ein Genie sich leisten kann – da ist doch Blut und Leben drin«. Auch das A-dur-Konzert ist einbegriffen, wenn er schreibt: »mir haben die wundervollen Werke tiefen Eindruck gemacht«. – Übrigens sollten solche Äußerungen des sechsundzwanzig- bis siebenundzwanzigjährigen Strauß doch jene etwas nachdenklich machen, die an der Wertlosigkeit der Lisztschen Werke gar nicht zu zweifeln gewohnt sind. Doch hat er Liszt niemals nachgeahmt; das grundsätzlich Polyphone in der Anlage seiner eigenen symphonischen Dichtungen läßt sogar oft viel eher vermuten, daß er ihn hier als Gegenbeispiel zu seinem eigenen Schaffen empfand. Selbst an einen Laien, seinen Onkel Hörburger, schreibt Strauß 1888, er arbeite gegenwärtig an einer Art symphonischen Dichtung (es war Macbeth), »aber nicht nach Liszt«. Indes stand er in Weimar, fern von den Münchener Freunden, mit seiner persönlichen Eigenart unter den Mitmusikern als Nachschaffender ebenso vereinsamt da wie als Tonsetzer. »Meine allerfortschrittlichste Kunstanschauung hat bis jetzt noch keinen Widerstand, aber auch keinen Widerhall gefunden – doch man läßt mich ruhig gewähren,« schrieb er schon im ersten Jahr. Das Verhältnis zu Bronsart litt unter der angedeuteten großen Verschiedenheit; besonders über Straußens »subjektive« Auffassung »seines Beethoven« war der Intendant jedesmal ganz unglücklich. Nach der Eroica, Ende Juni 1892, klagt Strauß: »Wenn ich nur wüßte, wie ich das ›objektive‹ Dirigieren anfangen sollte. Davon habe ich nun wieder keine Ahnung.« Dieser Umstand blieb sich gleich, trotzdem Orchester und Zuhörer begeistert auf seiner Seite waren. Auch die Hoffnung, daß ihm Bronsart seine äußere Stellung »als fünftes Rad neben Lassen« verbessern würde, erfüllte sich nicht. Indes hatte das willige Orchester auch in den Konzertproben einige Mühe, der ungewohnten Art seines neuen Dirigenten zu folgen, und ehe in Bülows Nirwana, die er in Weimar gleich einübte, ein »pp subito« richtig herauskam, hatte ein Taktstock sein junges Leben eingebüßt. Als Klavierspieler fesselte er auch hier, im Vortrag von Mozarts Konzert für zwei Klaviere, mit Lassen als Partner. Im Dezember 1889 schreibt Strauß an Hörburger: Ich hatte vier sehr schöne Konzerte, die trotz der wahnsinnig modernen Programme: Liszt, Wagner, Berlioz, Bülow, Richard Strauß und allerdings in drei Konzerten je einem oder sogar zwei Beethoven und im letzten Schuberts C-dur-Symphonie, sehr besucht waren und großen Beifall fanden. – Das erste Konzert in Weimar, am 20. Oktober 1889, brachte Beethovens Ouvertüre zu König Stephan, Lalos Spanische Symphonie, gespielt von Halir, Bülows Nirwana und Liszts Ideale. Im zweiten, am 11. November, leitete er die Uraufführung seines Don Juan, der ihm fünf Hervorrufe und Wiederholungsverlangen einbrachte, dem er jedoch nicht entsprach. Zwei Tage danach erhielt er den Besuch Bülows, der dann seiner Frau nach Hamburg schrieb: »Strauß hier enorm beliebt. Sein Don Juan vorgestern abend hat einen ganz unerhörten Erfolg gehabt. War diesen Morgen vor 9 mit ihm bei Spitzweg, seine neue symphonische Dichtung ›Tod und Verklärung‹ [am Klavier] zu hören, die mir wieder größeres Zutrauen in seine Entwicklung eingeflößt hat. Sehr bedeutend, trotz allerhand Schlacken auch erquicklich.« – Und doch hatte Strauß den betrübenden Eindruck, daß Bülow nur das Reinmusikalische, ganz abgezogen vom dichterischen Gehalt, in sich aufnehme. Von ihm, wie von Bronsart, hörte er wieder das alte Münchener Leitmotiv Rheinbergers, seine Begabung sei bedeutend genug, um ihn »wieder« auf den richtigen Weg zurückzuführen. Wie ihm das behagte, kann wohl nur ein rassiger Kater ermessen, dem man zärtlich gegen die Haare streicht. Den Abend brachte man zusammen zu, worüber Bülow seiner Frau am folgenden Tag aus Wiesbaden berichtete: »Bronsarts Freundschaftlichkeit war rührend – do. Strauß', den ich als Dirigenten wie Komponisten so glücklich war, herzlich ermutigen zu können.«
Wenige Tage darauf, am 18., vollendete Strauß die Partitur von Tod und Verklärung, Werk 24, das für Jahrzehnte von allen am meisten zu seiner Volkstümlichkeit beitragen sollte. Diese Tondichtung, voll unmittelbar mächtiger Wirkung, heute schon vom Hauch einer gewissen Klassikereigenschaft umweht, war weder durch einen bestimmten Vorgang angeregt, noch hatte sie ein weiteres Programm als den Titel. Das Gedicht von Alexander Ritter ist erst im Anschluß an das fertige Tonwerk geschaffen! Während es vom Zwiespalt des Helden mit der Außenwelt spricht, hatte Strauß nach seiner eigenen Äußerung die Selbstentzweiung einer Natur dabei empfunden, deren innere Kraft größer ist als die äußere. Im Zusammenhalt mit dem Titel werden gewisse, bei der Entstehung tätige Vorstellungen deutlich: Erinnerungsbilder vom Glück der Kindheit und schwärmerischer Jünglingszeit, von äußerlich und innerlich froher Entfaltung frischer Lebenskraft, dann Todesschauer und furchtbarer Kampf mit übermächtigen, zerstörenden Gewalten. Das getragene Motiv, dessen letzte beide Akkorde gleich zu Anfang leise in Moll erklingen, deutet später in leuchtendem zarten Dur die Verklärung an:

das dann in breiter erhebender Steigerung ausklingt. Die Wucht und Größe, aber auch die Innigkeit von Straußens Natur als Orchesterdichter, trat in diesem Werk in solcher Art hervor, daß die unmittelbare tiefe Wirkung eigentlich nur auf jene erschwert war, deren Blick, durch das bloße Staunen über die äußeren Mittel geblendet, zunächst nur an diesen selbst haften blieb. Gerade wenn die Tonkunst über alles Alltägliche erheben, und, wo sie es doch berührt, es mit der Gewalt der Dichtung ins Übergroße erheben soll, ist Tod und Verklärung echteste Musik. Das Gedicht Ritters ist so gut und verständnisvoll, daß es als Ganzes zur vorbereitenden Stimmung sehr wohl beitragen kann.
Gleich dieser erste Winter in Weimar brachte für Strauß eine Fülle von Komponistenerfolgen auch außerhalb seines ständigen Wirkungskreises. Nachdem sein Don Juan gegen Mitte Januar (1890) von der Dresdener Hofkapelle unter Adolf Hagen gespielt worden war, ging er gegen Ende des Monats nach Berlin, um dort das Werk im Philharmonischen Konzert von Bülow dirigiert zu hören. Schon während der Vorproben schrieb ihm der Meister nach Weimar: »Ihr ganz grandioser Don Juan hat zunächst meine Eroberung gemacht.« Für den Februar erwartete er drei Besuche in Weimar, die, obgleich hocherwünscht, ihn in Verlegenheit zu setzen drohten. Frau Wagner wollte er nicht mit Bronsart, Bülow nicht mit seinem Vater zusammentreffen lassen. Dieser kam Anfang des Monats und hatte die Freude zu hören, wie im Tannhäuser gleich der Ouvertüre stürmischer Beifall folgte und am Schluß dem Dirigenten große Ehrungen dargebracht wurden. Kurz darauf kam Bülow, und Strauß schrieb es dankbar Röschs Einfluß zu, daß er am 15. Februar außer dem Es-dur-Konzert von Beethoven auch das von Liszt nebst Klavierstücken dieses Meisters spielte; nur daß er dazwischen die beiden Ouvertüren von Brahms leitete, minderte seine Freude.
Auf diese bewegten Tage in Weimar folgte in nächster Zeit wieder eine Reihe von Kunstreisen im näheren und weiteren Umkreis. Ende Februar (1890) leitete Strauß den Don Juan im Frankfurter Museumskonzert; Ende März führte er im Lisztverein zu Leipzig seine Cellosonate auf, »– was mir furchtbar komisch vorkam, so mit allem Ernst den Leuten ein Stück vorzuspielen, an das man selbst nicht mehr glaubt«. Viel wichtiger war sein Anteil an dem Tonkünstlerfest in Eisenach, obschon er dort in den gleichen Widerstreit zwischen seinen alten und neuen künstlerischen Überzeugungen geriet. In dem gleichen Konzert, am 21. Juni, leitete er dort die ersehnte Uraufführung von Tod und Verklärung, während d'Albert die vier Jahre vorher vollendete Burleske für Klavier und Orchester unter seiner Leitung aus der Taufe hob. Wie sie auf Strauß nun nach seinem großen inneren Umschwung wirkte, zeigt ein Brief vom Oktober, Hainauer wolle das Werk drucken und gut bezahlen: »Nun brauche ich wirklich Geld! Soll ich es tun? Es widerstrebt mir furchtbar, jetzt ein Werk von mir herauszugeben, über das ich weit hinaus bin und für das ich nicht mehr mit voller Überzeugung eintreten kann.« Der zweite Winter in Weimar brachte sogleich im ersten Konzert, am 13. Oktober (1890), die Uraufführung des Macbeth. Schon im Vorjahre hatte Strauß eine ganz neue Partitur davon angelegt, mit den in Tod und Verklärung angewandten orchestertechnischen Errungenschaften; unter anderem setzte er die Baßtrompete hinzu, die so eigenartig wirkt. Über die Aufführung schrieb er: »Einige Menschen waren doch da, die gemerkt haben, daß hinter den greulichen Dissonanzen noch etwas anderes als die absolute Freude am Mißklang, nämlich eine Idee steckt. Bronsart bekannte aufrichtig, daß er mit dem Stück nichts anfangen könne. Lassen applaudierte wütend. Bronsart fragte, ob es ihm gefiele? Nein, sagte Lassen, aber Strauß muß ich doch applaudieren. Beide hatten nur interessante neue Klänge im Macbeth gehört. Wenn ich nur einmal den verfluchten Wohlklang ausrotten könnte!!!« – Die leidenschaftliche Hingabe an seinen Beruf und geringe Rücksicht auf die Gesundheit gehörten sicher zu den vorbereitenden Ursachen einer heftigen Lungenentzündung, die Strauß Anfang Mai (1891) auf das Krankenbett warf; längere Zeit lag er im Sophienhaus, vom 6.-11. in ernster Lebensgefahr. Dort äußerte er zu Arthur Seidl, der ihn besuchte, das Sterben sei wohl nicht so schlimm, fügte aber gleich hinzu: den Tristan möchte ich zuerst noch dirigieren. Vom Krankenlager diktierte er damals: Geistig ausspannen soll ich jetzt? Lieber Onkel Ritter, da müssen Sie mich schon, wenn ich nach München resp. Feldafing komme, selbst darin unterrichten. Wie soll ich meine Gedanken bannen, die mir schon in den ersten Tagen der Rekonvaleszenz halbe Akte Tristan frei aus dem Gedächtnis vortrugen. Sobald der Arzt ihm etwas Arbeit erlaubte, nahm er die Tristanpartitur und versah sie zum Gebrauch im ungedeckten Orchester nach dem Gesichtspunkt der »richtigen Wirkung als Drama« in den einzelnen Instrumenten mit Vortragszeichen, damit die Sänger nirgends gedeckt würden und jedes Wort verständlich blieb. Den Sommer über ließ er diese Zeichen in die Orchesterstimmen eintragen. Im Juni ging er dann zur Erholung zu seinem Onkel Pschorr nach Feldafing; bald darauf konnte er an Hörburger berichten: »Mir ist meine große Krankheit vortrefflich bekommen, ich bin gesünder und frischer als je.« Seine Beziehungen zur Bayreuther- und zur Wagnersache wurden in jener Zeit dadurch noch enger, daß er mit Pauline De Ahna im Sommer 1891 in Bayreuth weilte, wo sie in den ersten beiden Tannhäuservorstellungen die Elisabeth sang. Es ist schwer zu sagen, ob es der an Natur und Offenheit wie an die Lebensluft Gewohnten ganz leicht fiel, sich in dieser etwas stilisierten und im Dienst der dortigen hohen Kunstziele doch wieder dem Nützlichkeitsstandpunkt huldigenden Geisteswelt zu bewegen. Die Weihnachtstage (1891) verlebte Strauß in glücklichster Stimmung bei der Familie Wagner, wobei Frau Cosima ihn zu einem Beitrag für den Sammelartikel »Tannhäuser-Nachklänge« der Bayreuther Blätter anregte. Im folgenden Sommer, 1892, sollte er dort vorkommendenfalls die von ihm noch nie dirigierten Meistersinger abwechselnd mit Richter leiten: seine Erholungsbedürftigkeit entschied die Frage im verneinenden Sinn.
Im Frühjahr 1892 erfolgte eine, für Strauß wenigstens, entscheidende Klärung in seinem Verhältnis zu Bülow. So sehr sich dieser für die Italienische Fantasie einesteils noch begeisterte, so blieb doch seine dauernde und ungeteilte Zuneigung nur der in Form konservativen programmlosen f-moll-Symphonie treu. Auch mit Don Juan, Macbeth, Tod und Verklärung konnte er sich nicht dauernd befreunden. Im Oktober 1888 empfiehlt er Spitzweg den Druck von Straußens Kadenzen zu Mozarts c-moll-Konzert: »Sie tragen zur Popularisierung eines Autors mehr bei als Macbethsche Hexenküchenbrodeleien. Publicus will von der Kunst erquickt werden und ist mit diesem Verlangen in seinem Rechte.« In ähnlichem Sinn erhielt auch Gustav Mahler, etwa zu jener Zeit, einen Brief Bülows, des Inhalts, für Mahlers tonsetzerische Bestrebungen habe er im Augenblick nichts übrig – er lehnte ja auch später geradezu ab, dessen Humoresken für eine Singstimme mit Orchester zu dirigieren – mit einer nicht ganz spitzelosen Wendung: bei Herrn Strauß könne er wahrscheinlich mehr Entgegenkommen finden. Und während er in Hamburg die letzten Proben zu Don Juan hielt, Ende Januar 1890, schrieb er an Bronsart über die symphonischen Dichtungen – ja, dicht geht's darin her – »mehr Licht« möchte man mit eurem sterbenden Hofpoeten [Goethe] häufig exklamieren! – und an Spitzweg im März 1891: »Macbeth?« Hm, gern nehme ich mit Exzellenz Goethe an: In wenig Jahren wird es anders sein. Wenn sich der Most auch ganz absurd gebärdet (Nb. zu stark), es gibt zuletzt doch noch 'nen Wein. Immerhin: Geisteswachstum ist noch unergründlicher als Naturrevolution. – Über die Burleske schreibt Bülow aus Hamburg im Januar 1891 an seine Frau: d'Albert admirabel in dem ebenso interessanten als meist häßlichen Stück von Strauß, das er verschönt und fast dankbar macht. Und am folgenden Tag an Brahms: Strauß' Burleske entschieden genial, aber nach anderer Seite hin erschreckend. In bezug auf die schroffe Wendung, die Strauß ganz von Brahms wegführte, erfuhr Bülow durch einen Freund, Strauß sehe jetzt in Liszt den einzigen Nachfolger von Beethoven als Symphoniker. Nun war aber Bülow Liszts Musik im höchsten Maß verhaßt geworden. Er, dessen tiefste Herzenswunde ja in dem Zwiespalt zwischen seiner Liebe zu Wagners Kunst und dem persönlich durch ihn erfahrenen Leid bestand, empfand es schmerzlich, seinen Liebling im fortschrittlichen Lager zu wissen. An Spitzweg aus Hamburg, Mitte Januar 1891, schreibt Bülow: »Seitdem er sich zum exklusiven [Bayreuth-] Baireitknecht und dedizierten, beinahe fanatischen Brahms-Thersites gemacht – hat er nur noch meine unpersönlichste Sympathie, nämlich wenn er etwas Kunstschönes liefert.« Wie herzlich aber Bülow Strauß zugetan blieb, obgleich er die Stärke von Ritters Einfluß auf ihn kannte, zeigt die Nachschrift eines Briefs an Spitzweg aus Hamburg am 1. Juni 1891 auf die Kunde von seiner Genesung: »Gottlob, daß Strauß gerettet ist! Der hat eine große Zukunft noch, der verdient zu leben.« Und Mitte November: »Überragt er doch an musikalischer Vorbildung wie genialer Phantasie Deine anderen Autoren wie der Münchener den Ingolstädter Bahnhof.« Der Hauptteil von Bülows Verstimmung traf den Einfluß Ritters auf Strauß. »Der Strauß,« schreibt Bülow darüber Ende Januar 1890 an Bronsart, »hat mehr Frische [als B. selbst], der ermutigt selbst den Autor des oberfaulen Hans!« [»Der faule Hans.«] Bülow kannte schon in Meiningen Ritters Abneigung gegen Brahms; nun ging aber dieser in seiner Verachtung so weit, es in Aufsehn erregenden Artikeln der Allgemeinen Musik-Zeitung »Vom Spanisch-Schönen« und »Gut Lenchen, ach, das meint er ja nicht« für unmöglich zu erklären, daß es Bülow mit seinem Eintreten für jenen Ernst sei. Äußerlich blieb die Freundschaft trotzdem fortbestehen. Gegen Ende Januar 1892 überraschte er Strauß durch die Mitteilung, daß er Macbeth auf das Programm seines 8. Philharmonischen Konzerts in Berlin gesetzt habe. Strauß schrieb zurück: »Diesen neuen Beweis Ihrer wohlwollenden Gesinnung für mich begrüße ich mit um so größerer Freude, als Ihre Stellung zu meinen, gegenüber den Zeiten, wo ich noch die Ehre hatte, direkt Ihr Schüler zu sein, veränderten Kunstanschauungen gerade in den letzten Jahren in mir zu meinem großen und aufrichtigen Kummer den Glauben erwecken mußte, Sie wären mir auch persönlich nicht mehr so gut wie ehedem.« Er schreibt dann »von der Leber weg« von einem infamen Verfahren, Bülows Vertrauen zu seiner Ehrlichkeit als Mensch und Künstler zu erschüttern, und versichert, »daß Nichts, Nichts auf dieser Welt je imstande sein wird, meine unbegrenzte Liebe, Verehrung und innigste Dankbarkeit für Sie zu ertöten oder auch nur zur verringern.« Das war auch der Fall, so sehr sich Strauß im einzelnen durch die scharfen Ausfälle gegen Liszt und viele andere verletzt fühlte, und so sehr Ritter ihn künstlerisch gegen Bülow beeinflußte. Dieser entgegnete sofort in einem ungemein liebenswürdigen (ungedruckten) Brief, worin er seine Freude ausdrückte, »daß Sie es der Mühe wert erachten, Ihre persönlichen Beziehungen zu mir von den sachlichen Gegensätzen in unseren Kunstanschauungen zu trennen«. Dies ging auf Ritter, dessen leidenschaftliche Gemütsart sich auf Grund jenes Zwiespalts in der Kunstanschauung auch in persönlicher Abkühlung gegen Bülow zeigte. Am 29. Februar fand das erwähnte Konzert statt, in dem Strauß seinen Macbeth selbst leitete. Bülow schrieb nach einer der letzten Proben an seine Frau: Du, – der Macbeth – ist meist toll und betäubend, aber genial in summo gradu. – Am folgenden Tag, nach der öffentlichen Generalprobe, an Spitzweg: Frohe Botschaft. – Der Erfolg des Macbeth war heute mittag kolossal. Strauß viermal hervorgebrüllt. Das Werk klang auch – überwältigend. Noch nie hat der Komponist solche Aufnahme hier erlebt. – Am 29. an Frau v. Bülow: Imagine-toi: Macbeth énorme succès – je n'en reviens pas. C'est qu'il y a énormement d'electricité dans l'air.
Am 16. März leitete Strauß im Lisztverein zu Leipzig Tod und Verklärung. Der Erfolg machte viel von sich reden. Am nächsten Tag war er schon wieder in Weimar und vollendete dort den Entwurf seines Guntramtextes; auch wieder ein Beweis seines rastlosen, zwischen eigenem Schaffen und dem Aufführen fremder Werke geteilten Fleißes. Abermals jedoch weigerte sich bald darauf sein Körper in ernst mahnender Weise, die hochgesteigerten Anforderungen dieses glühenden Nervenlebens zu ertragen. Vom 5. bis 10. Juni (1892) lag Strauß in Weimar an einer Rippenfellentzündung zu Bett und dirigierte dann, noch hustend, am 12. Sommers Loreley. Drei Tage später, als er zur Erholung in Schwarzburg weilte, spürte er die Folgen und fuhr eilig nach München, wo eine schwere Bronchienentzündung zum Ausbruch kam. Nun zeigte sich, daß die Lunge nicht ausgeheilt war, und man riet ihm dringend, dem nächsten nordischen Winter durch einen längeren Aufenthalt im Süden auszuweichen. Er unterbrach den Aufenthalt in Weimar gern. Denn längst hatte, wie oben berührt, auch hier der Widerstreit zwischen Jugend und Alter, im weiteren Sinn zwischen Fortschritts- und Beharrungsbestreben, offenere Form, angenommen. Im folgenden November reiste er nach Griechenland und nahm den fertigen Text zum Guntram mit, in dessen Zeichen diese ganze Reise steht. Ein Vergleich der Bedeutung dieser Südlandsreise mit der ersten, nach der Meininger Zeit unternommenen, für sein eigenes Schaffen, mutet fast tragisch an: damals schuf er aus sich selbst heraus die glanzvollen, unvergänglichen Gemälde einer sonnigen Welt; diesmal, unter dem Bann der Riesengröße Wagners, auf ein Gebiet gedrängt, das ihm, im Gegensatz zum Konzertorchester, fremder war, die Bühne, schafft er in lang hingedehnter Arbeit Gebilde, denen mindestens auf Jahrzehnte hinaus das heiß ersehnte Leben der künstlerischen Tatsächlichkeit, der erfolgreichen Aufführung, nicht beschieden sein konnte. Erst im Oktober 1890 war der Text in einem ausgearbeiteteren Entwürfe fertig geworden, und Strauß sandte ihn an seinen Vater, dieser an Ritter, um dessen »strenge, unbarmherzige Kritik« der Autor bat, – wozu freilich Ritters Bühnenkenntnis nicht ausreichte. Am 1. Dezember 1891 war der erste Akt beendet, und bald darauf begann Strauß schon die Musik dazu zu entwerfen. »Sie wird riesig einfach,« schrieb er im Mai 1892 an Ritter, »sehr melodisch, nur Cantilene für den Sänger« – äußerst lehrreich in bezug auf das Verhältnis des Eindrucks auf den Schaffenden zu dem des Hörers –; »auf den eigenen Text fließt mir die Musik nur so von der Hand.« Die Proben zu der dissonanzenreichen Loreley Sommers waren für Strauß »ein großes Studium – je mehr Loreleyproben, desto einfacher wird der Guntram«. – Die Reise brachte herrliche Seefahrten: Brindisi – Korfu – Patras, von da mit der Bahn am Korinthischen Meerbusen hin nach Athen, wo er im Hotel des Etrangers abstieg. An Bülow und Ritter übermittelte er häufiger seine Eindrücke. Die Akropolis und besonders Olympia mit seinem Hermes des Praxiteles entzückten ihn: »Ihn kann ich alle Tage sehen, und alle Tage werde ich staunen und tief ergriffen sein.« Wohltätig empfand er, der Weimarer Enge entronnen zu sein, und fühlte wieder die Heiterkeit, Frische, Empfänglichkeit, wie er sie »in den ganzen letzten Jahren der Nervosität und Krankhaftigkeit nicht gekannt«. Auf der Reise las er eifrig Goethe, unter anderem dessen Wilhelm Meister, und freute sich, aus ihm zu lernen, »den Blick aus der einseitigen Richtung des deutschen Musikanten auf alle Dinge dieser Welt zu lenken«, von denen nach Goethe nichts uninteressant und alles der Mühe wert sei, es genau zu betrachten. Er sucht »die große Brille aufzusetzen, durch die unsere größten Geister die Welt gesehen – und selbst eine eigene Brille zu schmieden – die eigene künstlerische Produktion«. Im Dezember ging er dann nach Ägypten und blieb bis März 1893 dort. In Kairo, wo er sich angeregt und glücklich fühlte und das bunte Treiben wie die Bequemlichkeit, es von einem Gasthof ersten Ranges aus anzusehen, mit ganzer Seele genoß, ist von Ende Dezember 1892 ab die Musik zum ersten Akte des Guntram wieder aufgenommen, und dessen Instrumentierung Ende Februar 1893 in Luxor vollendet. Gleichzeitig wurde der dritte Akt entworfen. Schon vorher hatte Strauß von Athen den vollständig umgearbeiteten Text nach München gesandt. Mitglied eines Bundes von Streitern der Liebe, hat Guntram das Blut eines grausamen Fürsten vergossen und wird dafür von seinem Genossen Friedhold als Abgesandtem des Bundes zur Rechenschaft gezogen. Er will jedoch die Sühne nur vom eigenen Gewissen bestimmen lassen, das ihm nicht die Tat selbst, die Tötung eines Ruchlosen in Notwehr, sondern den geheimen Beweggrund, die Liebe zu dessen Weib, als eigentliche Schuld vorhält. Daher lehnt er Friedholds Vorladung vor das Gericht des Bundes ab, verläßt aber freiwillig die seine Neigung glühend erwidernde Witwe des Getöteten. Strauß, weit entfernt, sich selbst in seinem Helden zu schildern, empfand doch den Gang von dessen seelischer Entwicklung als innerlich notwendig und schrieb an Ritter, jetzt komme wenigstens Guntrams »Sparren« zur deutlichsten Anschauung. Ritter aber fand diesen Schluß unchristlich, unmoralisch, ja sprach von Ruchlosigkeit und Irrwegen der Hauptfigur. Von Luxor aus sandte Strauß Anfang Februar 1893 elf große engbeschriebene Seiten an ihn zur Rechtfertigung der Wendung, die von allem Anfang an in dem mehr künstlerischen als christlichen Empfinden der Guntramfigur angelegt gewesen sei. Mit der Vollendung der Instrumentierung wollte er noch warten. »Der dritte Akt bleibt liegen,« heißt es Mitte Mai, »bis ich ihn Ihnen vorgespielt habe; ich habe noch die geheime Hoffnung, daß die Musik dazu Sie versöhnen wird.« Sie »wird viel vom Fehlenden ergänzen, und das nicht mißverständliche Wie wird das lückenhafte und vieldeutige Was ins rechte Licht stellen«. Auch den Vorwurf Ritters, sich von Wagners Geist entfernt zu haben, bekämpft er; er fühle sich im Guntramtext als guter Wagnerianer. Neben der hohen Geistigkeit Ritters, der Jahre hindurch das Empfindungsleben des erdichteten Helden Guntram zu seiner persönlichen ernsten Angelegenheit machte, liegt etwas Rührendes auch im Verhalten von Strauß, der als fast dreißigjähriger fertiger Künstler von weitverbreitetem Ruhm kein angelegentlicheres Bestreben kennt, als dem gründlich verkannten und vereinsamten alten Freund Genüge zu leisten. Von April ab war er auf Sizilien, wo in Palermo im Hotel des Palmes nach Mitte Mai der zweite Akt nahezu vollendet ist. Dort erwog er einen neuerlichen Antrag nach München, wohin ihn so vieles zog: seine Lieben, Ritter, das gute Orchester und der Gedanke, die Oper an einer großen Bühne aufzuführen. Und schließlich (an Ritter): »Wo ist es denn besser? Außer Bayreuth ist's überall derselbe Trödel.« So wagt er sich zum zweitenmal »in den Rachen des Löwen«. »Aber vorsehn will ich mich.« Alles sollte mündlich mit Levi und Possart abgemacht und im Vertrag festgesetzt werden: Spielplan, Unbeschränktheit in Proben und Besetzung, Konzerte, Neuheiten und anderes.
Reizende Wochen verlebte er im Juni, vor seiner Rückkehr nach dem Festland, in Ramacca bei Catania auf der Villa des Grafen Gravina und seiner Gattin Blandine, einer Tochter Bülows. Ausgehungert vom langen Entbehren, stürzte er dort über die Wagnerauszüge her und trieb auch täglich mit der Gräfin Musik. Sein Zimmer, wo er vom Bett aus den Ätna erblickte, sah ihn auch dort bei der Arbeit am Guntram, an dessen zweitem Akt er instrumentierte, während er den dritten in der Skizze weiterführte. »Es ist ein bißchen hitzige Musik geworden; aber 40 Grad Reaumur im Schatten sind auch immerhin mehr, als die Abendtemperatur im Weimarschen Hoftheater, wenn Lassen Hiarne [von Ingeborg von Bronsart] dirigiert,« schrieb er Anfang Juni an Bülow.
Am 20. Januar (1894) sah er dann, eben von seiner Südlandreise zurückgekehrt, in Hamburg den inzwischen akut schwer erkrankten Meister zum letztenmal. Seine letzte schriftliche Erwähnung bei Bülow findet sich in einem Brief an Spitzweg aus Hamburg vom Anfang April 1893: »Für Strauß stets die innigsten Wünsche in Ferne und Nähe. Wollte Gott, ich könnte wieder fähig werden, seiner Geistesentwicklung lebhaften Anteils zu folgen. Nach Ihm [Brahms] doch bei weitem die persönlichste, reichste Persönlichkeit! Ruhm Dir, sie eigentlich entdeckt, zuerst erkannt zu haben. Gott schütze seine Physis, dann ist die Psyche gesichert.« – Die glänzende Wirkung des Aufenthalts in Ägypten auf die Gesundheit seines jungen Freundes gab Bülow Hoffnung, so daß er sich rasch zu der weiten Reise dahin entschloß. Schon wenige Tage darauf begrüßte Strauß den fast schon Sterbenden bei dessen Durchreise in der Halle des Anhalter Bahnhofs zu Berlin inmitten anderer dortiger Freunde. Am 12. Februar verschied der große Dulder in Kairo.
Anfang August vollendete Strauß den letzten Akt des Guntram in Marquartstein, einem in der Nähe des Chiemsees zwischen Bergen reizvoll gelegenen Marktflecken, dem gewöhnlichen Sommeraufenthalt der Familie De Ahna und gelegentlichem auch des Vaters Franz Strauß, einem Ort, den Richard noch bis zur Vollendung der eigenen Villa in Garmisch (1908) bevorzugte. Für diese seine erste Schöpfung auf dem Gebiet der Oper ist Straußens ganze Stellung zum Vokalen, insbesondere zum Sologesang, äußerst wichtig – was freilich trotz seiner Selbstverständlichkeit, heute im Zeitalter der Orchesteroper, solchen, die nicht über die Tagesmode hinausblicken, als seltsamer Widerspruch erscheinen mag. Strauß sang als junger Mann ohne Tonbildungstechnik, aber sehr hübsch und mit viel Charakteristik, in den Sprüngen nach der Höhe mit anmutiger Schwungkraft. Der ganze Barbier von Bagdad, kurz nach seiner Wiederentdeckung, etwa 1885 mit allen Soli und Chören am Klavier bei seinem Onkel Pschorr in Feldafing von ihm unter vier Augen vorgesungen, war ein reizender Genuß. Köstlich markierte er zuweilen seine Lieblingsstellen Beckmessers aus der Szene im dritten Akt mit Sachs. Auch eigene Lieder trug er mit großem Reiz einzelnen Zuhörern vor. In alldem konnte man auch auf diesem Gebiet eine künftige persönliche Art schlummern sehn. Sie kam aber weniger in der Schreibweise für die einzelne Stimme, als in der aufs äußerste durchgebildeten Klang- und Ausdruckswirkung des ganzen Vokalkörpers im unbegleiteten Chor, wo er eben mehr in seiner instrumentalen Art schaffen konnte. In der Behandlung der Solostimme ist er lange nicht in dem Sinn Eigner geworden wie seinem unmittelbaren Ausdrucksmittel, dem Orchester, gegenüber. Und zwar zunächst wohl deshalb, weil die von der Natur so deutlich gezogenen Grenzen der Menschenstimme nicht zu erweitern sind, so sehr auch Strauß noch 1913 in seiner »Deutschen Motette« auch fernliegende Möglichkeiten nach dieser Richtung heranzog. Da nun neue Aufgaben der Geläufigkeit durchaus jenseits des Rahmens jener Zeit und nach Straußens Gefühl auch gewiß jenseits der Stoffe lagen, die er bis zu seiner Ariadne auf Naxos vertonte, fiel die einzige technisch zu steigernde Seite für ihn weg. Dieses Begrenzte, Starre, durch kein inneres Bedürfen, keine Ausdrucksnotwendigkeit, kein Wollen oder Können zu Überwindende ist aber etwas der ganzen Anlage seiner Natur Entgegengesetztes, Sie macht sich das ihr Zusagende mit größter Kraft zu eigen, bemächtigt sich aber anderen Stoffes nur mit unwillkürlicher Auswahl oder schließt ihn aus. Sein vokales Vorstellen bekam nur allmählich, und wohl niemals ganz den unmittelbaren, genial lebendigen Wirklichkeitssinn seines instrumentalen, obgleich er als Opernkapellmeister die Verwertbarkeit der verschiedenen Stimmumfänge natürlich genau kennenlernte. In bezug auf die Sangbarkeit einer Stelle je nach ihrer Lage und dem mehr oder minder starken und raschen Wechsel der Tonhöhen hat es eben jener Tonsetzer am leichtesten, der sich lediglich an das bei anderen Bewährte hält. Strauß fehlt hier jene lückenlose, gleichsam schlafwandelnde Sicherheit aller einer vorwiegend vokal denkenden Umwelt entstammten Tonsetzer, auch bezüglich des Verhältnisses zur Begleitung. All das tritt später selbst in der Salome hervor, in der doch als eigentlicher Gesangsoper die Singstimme aus dem Wort herauswächst und in den lyrischen Stellen auch oft hinreißend schön ist. Wo Strauß starke Orchesterfarben zum Ausdruck der Geschehnisse und der Empfindung braucht, wendet er sie an, auch wenn die Verständlichkeit des gesungenen Melos darunter leidet. In diesem will er zuweilen, wie beim Instrument, den Ausdruck durch die besonders hohe oder tiefe Lage, oft auch durch plötzlichen Wechsel beider geben, obgleich große Sprünge, besonders nach unten hin, schon an sich selbst die Verständlichkeit der melodischen Zeichnung schädigen. Auch manche unsanglichen Synkopen, kleine Notenwerte, wie Triolen mit einer Silbe auf jeder Note, entspringen mehr dem gewohnheitsmäßig instrumental arbeitenden Vorstellen. In alldem zeigt sich Strauß als eine keineswegs in erster Linie praktische Natur; vielmehr kommt es ihm einzig darauf an, was er aus innerem Zwang will, mit größter Schärfe auszudrücken, stellenweise unbekümmert um die äußerlichen klanglichen Bedingungen der Verständlichkeit. Auch hier sehen wir den durchaus ehrlichen künstlerischen Charakter, der keine Zugeständnisse kennt. Wenn er zu schwierigen, unseren Sängern ungewohnten Intervallen greift, entscheidet nicht die Weite der Sprünge; denn diese kennt auch der Belcanto, sondern das harmonisch Entlegene der Intervallnoten. Dies liegt aber anders als die Frage der Stimmgrenze; denn das Treffen ist Sache der Übung, was die einst so gefürchteten Partien eines Mime, Alberich, Beckmesser genügend beweisen. Wenn Strauß in bezug auf eine Stelle aus Elektra geäußert haben soll: »Die treff' ich selber nicht,« so spräche dies nicht gegen ihre Ausführbarkeit durch den Berufssänger. Indes ist er auch auf diesem Gebiet schöpferisch. Eine Grenzerweiterung des gesanglichen Ausdrucks, nach der ernsten wie der grotesken Seite hin, ist an vielen Stellen vorhanden; hier sind die Möglichkeiten noch so wenig erschöpft wie die der Instrumentation. Aus dem deklamatorischen Prinzip, das später in der Salome den ersten Triumph voller Natürlichkeit feiern sollte, ergibt sich der häufige Taktwechsel, während in der eigentlichen Oper, ja selbst beim Lied, sonst gerade die Umwandlung des wechselnden Wortmetrums in ein fortfließendes musikalisches von größtem Interesse und Reiz ist.
Je weniger Guntram heute der Öffentlichkeit gehört, um so eingehender wird ihn jeder kennen müssen, der Strauß kennen will. Er wird dann wenigstens, unbeschadet seines musikalischen Bekenntnisses, wie Schiller schreibt, »den rechtschaffenen Mann in ihm hochschätzen«. Man könnte von dieser Oper sagen, was Strauß mit seinem, manchem unmerklichen, leisen Spott zuletzt einem erwiderte, der ihm Punkt für Punkt Liszts heilige Elisabeth zerpflückte: »Das mußt du aber doch zugeben, daß nur ein grenzenlos anständiger Mensch sie hat schreiben können.« Der tiefe Ernst von Macbeth, von Tod und Verklärung ist im Guntram in großen Maßen, allerdings mehr buch- als bühnenmäßig, fortgesetzt. Die erste Oper bedeutet für jeden Tonsetzer die allbekannte Gefahr. Hier ist er nicht mehr allein mit seiner Kunst und seinen Hörern. Zwischen beide tritt die Dichtung, die ihm die Treuesten entfremden kann. »Schade um die gute Musik,« wird dann bestenfalls das Losungswort. Längst schon reichte Straußens Name hin, ihm bereitwillige Textbuchverfasser von Ruf zu verschaffen, aber sein Herz war zu voll vom Guntramstoff. Er sagte sich auch nicht, daß die Bühnenerfolge der Größten nie auf eigener Erfindung der Vorgänge beruhten. Sie alle entlehnten diese. Das Bekannte, das als solches auf der Plusseite für den Hörer steht, tut dem selbsterfundenen Subjekt Abbruch, wie schon das Anklingen der Ehe der wohltätigen Freihild im Guntram an jene von Liszts heiliger Elisabeth nahelegt. Ein erklärender Blick fällt auch hier auf den damaligen Münchener neudeutschen Geist, der Strauß doch etwas beeinflußte, mit seiner überhebenden Verachtung der überlieferten Form und der einseitigen Betonung der Gesinnung. Das germanische Vorurteil gegen das »Welsche«, gegen das ganze Maß von tatsächlichem Können, das bei den Romanen aufgespeichert als Beispiel daliegt, rächt sich bei einer so sehr im Technischen wurzelnden Kunst, wie die der Bühne ist, nur allzu leicht. Auf einer gewissen Stufe der allgemeinen Wagnererkrankung schlug das hitzige Fieber des Hasses in das der ausschließlichen Verehrung und des Nachschaffens um. Ehrgeiz, ja Ehrensache war es, daß ein musikalisches Bühnenwerk so wenig als möglich an eine Oper erinnerte, deren Schema den Neudeutschen wie ein Steckbrief nur die äußeren Merkmale eines Verbrechers aufzählte. Ein Merkmal des ganzen Krankheitsbildes lag darin, daß man es in Äußerlichkeiten der musikalischen Redeweise genau so machte wie Wagner, in der dramatischen Technik aber, mit der er trotz der Höhenziele seines Schaffens eben wirken wollte, so tat, wie er nie getan hätte. Wenn sich Strauß wirklich mit dem Guntram alle Wagneropern, vom Tannhäuser bis zum Parsifal, vom Hals schrieb, so tat er das natürlich in Straußischer Weise. Schon der Text des Guntram steht hoch über denen der meisten Wagnernachahmer, weil hier ein Teil von Wagners Geist, nicht seiner Geste, der Anfangspunkt war. Sonst kann man oft beobachten, wie der Ausgangspunkt bei mancher Szene eine Bewegung bei ausgehaltener hoher Note ist, und die Verfertiger mit dem Ausdruck innerer Kämpfe, Erlösungssehnsucht und ähnlichem nach den Eindrücken ihrer Wagnerauszüge verfahren, ohne sich die fehlende innere Begründung der Widersprüche klarzumachen. Im Guntram erschwert umgekehrt der reiche psychisch-ethische Gehalt die praktische Theatralik. Besonders wird dem Mienenspiel zu viel zugemutet. Gegen das Gesetz aber, daß die Opernhandlung wesentlich schon pantomimisch verständlich sein muß, verstößt zuweilen wieder die mangelnde sinnliche Darstellbarkeit der dramatischen Motive. Eine so allgemeine Vorstellung wie Der Friede, den Guntram im zweiten Akt besingt, ist weniger bühnengemäß als der nächstbeste konkrete Gegenstand, auf dessen Erscheinen der Hörer vorbereitet werden soll. Die tragische Heldin, Freihild, liebt Guntrams Kraft und Reine, die sich dem Knechter des Landes entgegenstellt; sie ahnt nicht, daß sich diese in der geraden Linie des schwärmenden Verstandesmenschen fortsetzen wird bis zur Bekämpfung der inneren Knechtschaft, der Geschlechtsliebe, bis zum Maßlosen, zur Nacheiferung des Heilandvorbildes. Sein Verzicht auf Freihild hat nicht, wie der Tannhäusers auf Venus oder Lohengrins auf Elsa, einen sinnfälligen Grund; »Mich bestimmt meines Geistes Gesetz; mein Gott spricht durch mich selbst nur zu mir.« In der Anlage dieser Gestalt seines Helden, die in Straußens dreiundzwanzigstem Lebensjahr begann, erkennen wir Gedanken Tolstojscher Herkunft, die mit seiner warmen Gutherzigkeit im Einklang standen. Die dichterische Verarbeitung solcher Anregungen ist aber eine Sonderbegabung der Russen. Im übrigen ist Mitleid, Selbstverneinung, werktätige christliche Liebe meist herzlich undramatisch. Auch dem Zug von Selbständigkeit in der Guntramfigur, die als unwahr erkannte Bundesvorschrift von sich zu weisen, dem Persönlichen, adelig Herrenmenschlichen in ihr – soweit nicht alles doch wieder der Gnade des Heilands zu Füßen gelegt wird – gegenüber dem Herdenmäßigen der Vereinssatzung, entspricht zu wenig äußere Handlung. Das sinnvolle Wort Guntrams: »Arm an Erfahrung, glaubt' ich wohl einst, ein Herz sei durch Gesetze zu leiten« und seine selbsterkennende Reue über die Tötung des Friedensstörers: »Ich erschlug den Mann, dem das holdeste Weib zu eigen«, steht schon an der Grenze des Opernmöglichen; dazu tritt noch die Notwendigkeit des Mitbegreifens und Mitentsagens Freihilds zur vollen Weihe seiner Entsühnung. Weniger einfach als diese textlichen Hemmnisse einer leichten Gewinnung des Publikums waren die musikalischen. Die Gewohnheit, Gruppen von zwei, vier, acht Takten stets zweimal zu bringen, die bei den Klassikerepigonen oft bis zum Eindruck der Gedankenlosigkeit, ja des leichten Blödsinns geht, ist im sogenannten Echospiel geschichtlich begründet, bis in die Anfänge der deutschen Instrumentalmusik zurück. Solche Stileigenheiten sind später unbewußt, wie bei Strauß die, ganze Strecken lange, völlige Vermeidung der Phrasenverdoppelung. Er empfand sie nicht als nötig, deshalb wandte er sie nicht an. Auch die Sequenz, die Wiederholung einer kurzen Phrase in höherer oder tieferer Lage, vermeidet der Guntram streckenweise. Durch seitenlanges Fortdrängen zu einer Dissonanz als sinngemäßer Fortsetzung der anderen entsteht ein Gefühl der Unsicherheit und Ruhelosigkeit. Kommt doch einmal eine Sequenz, so fällt ihr zweiter Teil sicher auf eine weibliche Endung der Singstimme, die zwar deklamatorisch, nicht aber musikalisch schlußfähig ist, im Gesang vielmehr schon wieder auf ein weiteres rhythmisches Element mit männlicher, einsilbiger, Endung hindrängt. Zum Beispiel »bringt Rettung mir!« wäre schlußfähig, »bringt Rettung« ist es nicht. Kommt ein Motiv in sequenzartiger Fortsetzung, wie:

so fühlt sich auch der unbefangene Hörer sofort erleichtert. Aber selbst ein plastisches Leitmotiv, wie:

muß im rascheren Tempo heute noch für die allermeisten gelegentlich zweimal nacheinander kommen, um verstanden zu werden. Ein Hauptpunkt, an den sich die Gegner der Oper hielten, war die durch Weigerung, Absagen oder Heiserwerden der beiden Hauptsolisten mehrfach scheinbar festgestellte Unsanglichkeit, die man mit einer Wendung für oder gegen Wagner betonte. Nun, etwas Teutonenart ist ja dabei: ein Opernkapellmeister schreibt eine Oper, die man »nicht singen kann«. Aber auch dies wurde übertrieben. Ruhig und klar fließt die Baßbaritonstelle Friedholds im dritten Akt hin; die ganze Guntrampartie liegt gesanglich, nur mit allzu wenigen kleinen Pausen durchsetzt, daher leicht ermüdend. Der lyrisch gehaltvolle Frühlingsmonolog und der Friedensgesang sind sogar dankbar, einige unbequeme Stellen leicht zu punktieren, was Strauß ja, wie in der Freihildpartie, auch tat. Schließlich ist im Guntram als wesentlicher »Orchesteroper« nicht jede Einzelheit in der Singstimme unabänderlich. Die Lockerung des musikalischen Gefüges in den Singstimmen durch den Grundsatz richtiger Betonung hatte im Wesen schon mit dem in zahlreichen lyrischen Gesangstellen vorbildlichen Lohengrin begonnen; selbst die formschöne Gebundenheit des Vierzeilers ist dort vom Musiker oft dadurch gebrochen, daß er die sonst dem Sänger überlassenen Ritardandi und Accellerandi nicht mehr der in gleichen Notenwerten fortfließenden Melodie anvertraute, sondern in doppelten und halben einfach ausschrieb. Diesen Hinweis sehn wir im Guntram mit aller Charakterstrenge durchgeführt; selbst solche, weit weniger als im Lohengrin, melodisch gleichgebauten Gebilde, zu denen der in kurzen freien Rhythmen gesetzte Text Anlaß gab, sind oft vermieden. Daß aber Strauß den starken Gedankengehalt seiner Dichtung, von den späteren Werken Wagners beeinflußt, nicht in lyrischen Vierzeilern geäußert hatte, war begreiflich. Etwas von der Lebens- und Schönheitsverneinung, die in den Guntramtext hineinspielt, ging auch in die Form seiner Vertonung über. Auffällig war die Ähnlichkeit einzelner Motive mit solchen des Tristan, wie

die er leicht hätte vermeiden können; daß er nicht daran dachte, ist eben wieder einer der vielen Beweise künstlerischer Unmittelbarkeit; er schrieb, wie er empfand. Die Tonsprache Tristans und Parsifals war damals für ihn nicht die eines einzelnen, sondern eben die dramatische. Gewollte Erinnerung an den Gral spricht aus einer eindrucksvollen Stelle des Vorspiels, Seite 7 des Auszugs, in der drohend das Motiv des strafenden Bundes aufsteigt.

Diese Stelle zeigt deutlich, wie Straußens Harmonik nie dem Klangversuch, sondern lediglich dem Ausdruck dient. Es geht aber durchaus nicht immer in diesem Ton und Stil. Von romantischer Melodik sind einige der Hauptmotive; das stimmungs- und farbenreiche Vorspiel zum ersten Akt und das noch viel eingänglichere zum zweiten, mit seinen prächtigen Motiven der Festesfreude, der Empörung und der stillen Neigung, ist, wie die melodisch erhebungsvolle Schlußszene des drittem Akts aus dem Konzertsaal bekannt, alles Beispiele größerer musikalischer Umgänglichkeit. Äußerst frisch ist auch das den ersten Akt schließende Männerquartett, in Bewegung, Stimmung und Handlung an das ihm dramatisch entsprechende Sextett im Tannhäuser mahnend.
Ein praktischer Zug der Operntechnik ist der Verzicht auf den Chor, wohl infolge persönlicher Weimarer Erfahrung. Nur Männerstimmen singen im Finale des ersten Akts und in den Ensembleszenen des zweiten einige Silben in Oktaven oder einstimmig, dann nurmehr im Beginn des dritten im langsamen Unison hinter der Szene, wobei das Orchester rhythmisch nachzugeben hat und harmonisch nicht einmal streng an den Chor gebunden ist. Dieser Umstand hindert, das Werk, wie es mit Cornelius' gleichfalls sehr chorarmer »Gunlöd« öfter geschieht, in den Konzertsaal zu verpflanzen. Jene Hemmung im Schaffen für die Singstimme scheint ein Tribut, den Strauß einem Fehler seiner Zeit entrichtet, der Sonder-Teutonenart akademischer Vernachlässigung jener Hälfte unserer Kunst, durch die die andere erst verständlich wird, der vokalen; dem Fehler, an Stelle der Beschäftigung mit Lohengrin, wo Wagner in den Partien der »guten« Partei den vorbildlichen deutschen Gesangstil schuf, die mit den späteren Werken zu setzen, in denen der Symphoniker den Vokalschöpfer zuweilen erdrückte. Was Strauß uns in seinem Guntram mit dem Lohengrin als metrisch- und vokal-technischem Vorbild gegeben hätte, ist schwer vorzustellen.
Kurz vor Beschluß seiner Weimarer Tätigkeit, am 12. Mai 1894, leitete Strauß noch die Uraufführung dieses seines Schmerzenskindes, des Guntram. Seine Schüler sangen die Hauptpartien, die er schon damals der anstrengenden Lage wegen nach der zweiten und dritten Aufführung stark punktieren mußte; Zeller gab den Guntram, Pauline De Ahna, mit der er sich kurz vor der Aufführung verlobte, die Freihild. Zur Uraufführung verschickte Strauß gedruckte Einladungskarten. Drei Stunden vor ihrem Beginn besuchte ihn Arthur Seidl, mit dem er sich, als ob gar nichts Besonderes los sei, sehr angeregt über Mackays »Anarchisten« unterhielt, die er eben las, und dem er zwei jüngst gesetzte Vertonungen von Texten dieses Dichters aus dem späteren Opus 27 vorspielte. Die dritte Weimarer Aufführung der Oper leitete er zum Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Auf Strauß selbst wirkte Guntram mit Ausnahme des Fehlens eines verdeckten Orchesters genau so, wie er sich ihn gedacht. »Nun bin ich selber neugierig, wohin das Schifflein treiben wird; denn man wird doch nur gerudert, während man zu rudern glaubt,« schreibt er an Ritter.
Von dieser Zeit an kam er durch mehr äußere Ruhe seines Lebens als Bräutigam und Ehemann zu gesteigerter Arbeit an größeren Werken. Im Sommer 1894 leitete er die ersten Bayreuther Tannhäuservorstellungen, in denen seine Braut die Elisabeth sang, neben Orchesterproben von Tristan und Parsifal. Frau Wagner soll ihn nach dem erstenmal mit den Worten begrüßt haben: »Ei, ei, so modern, und dirigiert doch den Tannhäuser so gut.« Am 10. September 1894 widmete er seiner Gattin zum Vermählungstag das im Winter geschriebene Liederheft, Werk 27, in dem er sich von der älteren Münchener Art weg zur Moderne wandte und durch die verständnisstarke Vertonung lebender Dichter ein neues Feld weitreichenden Ruhmes fand. Das Heft enthält mehrere der erfolgreichsten Gesänge: Ruhe meine Seele von Karl Henckell, Cäcilie von Heinrich Hart: Und wüßtest du –; Heimliche Aufforderung: Auf, hebe die funkelnde Schale!; Morgen: Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, die beiden letzten von Mackay. Das größte Kunstwerk unter ihnen ist wohl der »Morgen«, den Strauß, ebenso wie »Cäcilie«, auch mit einer außerordentlich feinen Orchesterbegleitung, zunächst nur für seine Gattin, versah.
Mit diesem Liederheft trat er in die Reihe der vielgesungenen ersten Meister der Moderne. Auch in der Folge gehört er jedoch nur mit einer ganz bestimmten Anzahl seiner Lieder zu den eigentlichen Lyrikern in dem Sinne, daß er eine wesentliche Seite seiner künstlerischen Persönlichkeit, ohne die deren Bild nicht vollständig bliebe, eben nur im Lied geoffenbart hätte, wie es bei Beethoven trotz der sehr geringen Anzahl eigentlicher Lieder, bei Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms der Fall ist. Ihn als Liedersänger mit den Genannten völlig in eine Gruppe stellen, heißt die Bedeutung des »einschlagenden« melodischen Erfindens und besonders auch die von dessen Häufigkeit, ja Gewohnheitsmäßigkeit, verkennen. Das restlose Aufgehn der schaffenden Vorstellungskunst im Gesanglichen tritt bei ihm selbst in den eigentlichen Liedern, den Lieblingsnummern der Sänger und Hörer, selten ein; auch hier finden wir gewisse, freilich als echt straußisch allen liebe Stellen, wie die seccorezitativartige Unterbrechung der Melodie in den Worten: »Verachte sie nicht zu sehr« in der »Heimlichen Aufforderung«. Im äußeren Rahmen schließt sich das Straußische Lied, abgesehen von ungedruckten Jugendwerken, die zuweilen besonders die Schlußworte wiederholen, fast ohne Ausnahme – eine solche von herrlicher Wirkung findet sich im »Befreit«, Opus 39,4 – ganz der Form des Gedichts an, die es vertont, wie sie ist, während die ältere, die eigentliche Liedkunst, wie Schubert als ihr Großmeister sie pflegte, durch Textwiederholungen, thematischen Ausbau, teilweise befolgte Gleichgebautheit, harmonische und melodische Steigerungen, die im Wort noch keineswegs angelegt waren, ihre selbständig formbildende Kraft betätigt. In seltenen Fällen bringt Strauß einige Worte des Anfangs am Schluß nochmals, wie in Werk 19, 6, Mein Herz ist stumm; Werk 37, 4, Du bist mein Auge. Noch seltener, wie in der Anbetung Werk 36, 4, Wie schön, wie schön, schafft er durch öftere Wiederholung der Schlußworte selbständig eine Art Coda, was z. B. Schuberts Sonderkunst war. Manche Lieder sind unnachahmliche Klavierdichtungen mit Gesang, und gerade bei dieser Art ist es zuweilen die Ausführung durch den Tonsetzer selbst mit seiner wunderweichen Anschlagspoesie, die uns erst das eigentliche Verständnis des Kunstwerks als eines unteilbar Ganzen erschließt. Strauß war bisher auf keinem Gebiet der Mann der Zugeständnisse; sehr früh huldigte er, durch Ritter noch bestärkt, dem Grundsatz der genauen Betonung, weil er in der starken Redlichkeit seines Künstlersinns in akzentmäßig unveränderter Wiedergabe des Textes die Bedingung alles ernsten vokalen Schaffens sah. Wer aber im Deutschen eigentliche Lieder schreiben will, muß entweder gewöhnlich den Zwiespalt, der hier zwischen Sprache und Melos herrscht, naiv übersehen, oder er muß ihm überlegen sein, wie etwa Cornelius in den Weihnachtsliedern. Beides trifft bei Strauß bis 1901, der Zeit, bis zu der er häufiger Lieder schrieb, nicht zu. Der grundsätzlichen Verschiedenheiten zwischen fließender Melodie und genauer Wortbetonung und damit der notwendigen Zugeständnisse sind aber bei näherem Zusehn gar viele und ihre Andeutung für unser Strauß-Verständnis unerläßlich. Der Melodiker braucht erstens als einander entsprechende Taktgruppen solche, die gleich gebaut und noch ohrenfällig rhythmisch ähnlich sind; er ist dadurch in der Anordnung der abgestuften melodischen Betonungen viel mehr gebunden, als der Dichter in jener der Silbenbetonung, deren Stärke er mäßigen oder verschärfen kann. Dann braucht der Melodiker, er nehme, welche Taktart er wolle, meist eine viel größere Anzahl betonter Noten, als, ihm der Dichter gewöhnlich an betonten oder betonungsfähigen Silben bietet. Beispiel eines Ausnahmefalls ist Wolfs eigentlichstes »Lied« Verborgenheit: »Laß, o Welt, o laß mich sein«, wo gleich in der ersten Strophe die meisten Silben betonungsfähig sind. Muß der Musiker die betonten Noten durch zu viele unbetonte trennen, so hört seine Phrase auf, melodisch zu sein; sie wird deklamatorisch zerhackt. Drittens gestattet die ungemein biegsame deutsche Sprache dem Dichter rhythmische Freiheiten, Ungenauigkeiten, ja Fehler, die bei ihm noch erträglich sind, beim Melodiker nicht mehr. Wir sehen daher mit seltenen Ausnahmen jedes eigentliche Lied dadurch entstehen, daß er diese Freiheiten nicht ins Musikalische übersetzt, sondern z. B. im Vierzeiler den Sprachrhythmus der dritten Zeile möglichst auf den der ersten umformt, eben weil er strengeren Gleichbau, ja oft einfache Wiederholung zum Aufriß der Melodie braucht. Ferner, daß er einzelnen Silben ein größeres Maß von Betonung zukommen läßt, als es der Dichter tat. Und drittens, daß er, um seinen Rhythmus nicht aufzugeben, Freiheiten des Dichters auch wieder einfach mitmacht, die einem streng nach der Betonung arbeitenden Heutigen wie Strauß unmöglich sind. Der Ausnahmefall eines Lieds im älteren Sinn tritt also gewöhnlich nurmehr ein, wenn der Dichter, wie Henckell in seinem: »Ich trage meine Minne, vor Wonne stumm«, Opus 32, 1, dem Musiker schon das kaum noch verdeckt zu nennende Melos rhythmisch fertig vorlegt. Unsere deutschen Lieder, von denen ich hier, um klar zu sein, unbedingt einige zum Vergleich heranziehn muß, bieten überall Beispiele für jene drei Punkte. Eines der wundervollsten, Beethovens »Wonne der Wehmut«, ward nur dadurch möglich, daß der Musiker die Veränderung des Rhythmus durch den Dichter nicht mitmachte, sondern forttaktete: »Tränen un- glück-licher Liebe«. Das herrliche Melos von Schumann: »Wär ich nie von euch gegangen« konnte nur dadurch entstehn, daß der Musiker zu den vom Dichter stark betonten Silben noch »Wär« hinzunimmt. Ähnlich: »Ich hört' ein Bächlein rau-schen; Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.« Brahms mußte, um seine vielleicht schönste Melodie: An die Nachtigall: »Geuß nicht so laut!« fortsetzen zu können, »Blüten- ast« betonen. Selbst in dem höchsten, wohl nie nur entfernt zu erreichenden Meisterwerk des deutschen Kunstlieds, Schuberts Winterreise, und gerade in einer der auch im Sprachvortrag herrlichsten Nummern »Auf dem Flusse« sehen wir das Zugeständnis an der ergreifenden Stelle »In deine Rinde grab' ich«. Der Dichter braucht die richtige Betonung auf »Rinde«, der Musiker die falsche auf »deine«; die Gleichreihigkeit erlaubt ihm nicht, drei kurze Silben »In deine« als Auftakt zu nehmen. Das völlig leichte, restlose Zusammengehen von Wort und Ton wird eben durch den Verein von hochgradiger musikalischer und dichterischer Formbegabung am leichtesten bei Einheit des Poeten und Musikers erreicht. Folgerichtig darf dieser kein Gedicht nehmen, das er nicht vorher auf jene Fallstricke und auf die Möglichkeit ihrer Beseitigung im Text angesehen hat. Strauß hätte das nicht gekonnt; denn gerade seine Lieder sind oft Erzeugnisse der lange unbewußt vorbereiteten, drängenden Minute. Fast wörtlich schreibt er etwa 1893 an Friedrich v. Hausegger, wie in dessen »Gedanken eines Schauenden« zu lesen ist: Aus dem musikalischen Gedanken, der sich – weiß Gott, warum – innerlich vorbereitet hat, entsteht, wenn sozusagen das Gefäß bis oben voll ist, im Handumdrehen ein Lied, sobald ich beim Blättern im Gedichtbuch auf ein nur ungefähr im Inhalt korrespondierendes Gedicht stoße. Wenn aber in diesem entscheidenden Augenblick nicht die zwei richtigen Feuersteine zusammenschlugen, wenn sich nicht das ganz entsprechende Gedankengefäß eines Gedichtes findet, so wird der Drang zur Produktion zwar durch ein mir überhaupt komponierbar erscheinendes Gedicht in Töne umgesetzt; aber es geht dann langsam, weil der musikalische Gehalt der schöpferischen Minute sich ummodeln, umdeuten lassen muß, um überhaupt in die Erscheinung zu treten; es wird gekünstelt, die Melodie fließt zäh, die ganze Technik muß herhalten, um etwas von der gestrengen Selbstkritik Bestehendes zustande zu bringen. – Mit der ganzen Treue seines Charakters hat Strauß die als solche von ihm angesehene Verpflichtung zum Grundsatz der richtigen Betonung gewahrt und über dessen eigene Verletzungen sich selbst später unbarmherzig geäußert. Erspart waren sie auch ihm nicht, weil sie in der Natur der Sache liegen, die Scheu davor trieb ihn manchmal zu eckigem Zurechtverbiegen guter melodischer Linien. Für ihn spricht im ersteren Fall die Tatsache, daß die lückenlose Richtigkeit der Betonung beim wirklichen Tonsetzer eben sehr leicht im umgekehrten Verhältnis zur Stärke der Eingebung steht. Wer ohne solche, nur mit der allgemeinen Grundstimmung und etwa einer ihr entsprechenden Klavierfigur an den Text herantritt, der kann sich ja gar nicht im Akzent irren, wenn er Wort um Wort vertont. Entspringt dagegen dem Lesen des Textes eine strömende Melodie, aus ein paar Worten am Anfang oder auch mitten heraus, wie oft bei Strauß, dann hapert es natürlich hernach leicht mit dem Zusammentreffen der einzelnen Noten und Silben. Und nachträglich verbessern läßt sich dies kaum; die Stunde, in der man mit dem Stoff eins war, ist unwiderbringlich dahin, und nun soll man mit gleichsam fremder Hand an dem unbewußt Entstandenen herumschneiden? Der einzige rein sachliche Ausweg, das rücksichtslose Niederschreiben der melodischen Eingebung mit nachträglicher Änderung der dichterischen Vorlage an Stellen, in denen die Betonung dem Melos nicht entspricht, ist heute schon durch unsere Anschauungen und Gesetze über das geistige Eigentum meist ungangbar.