
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Erste Anstellung, Herbst 1886-1889
So war denn Strauß nach abermaligem Besuch Bayreuths, wo der Parsifal ihn weniger begeisterte, Tristan aber zweimal entzückte, nach achtmonatiger künstlerisch unendlich fruchtbarer Abwesenheit vom 1. August 1886 ab in seiner Vaterstadt in fester Stellung. Auch hier fügten es die Umstände, daß er für einige Zeit die Leitung eines Damengesangvereins übernehmen mußte, der, von der Klavierlehrerin der Prinzessin Leopold gegründet, unter dem Schutz der Gattin seines Intendanten stand – keine gerade glänzende Vorbedeutung für diese Münchener Zeit, über deren kleine und große Erlebnisse seine Briefe an Bülow berichten. Die Verhältnisse an der Hofoper lagen für ihn sehr ungünstig. Perfall hatte ihn kommen lassen, wohl seiner Gewohnheit getreu, einheimische Talente, wenn möglich, in München anzustellen. Aber gegen seine musikalische Persönlichkeit als Schüler des dem Intendanten wie dem Hoforchester auf die Dauer recht unbequem gewordenen Bülow lag auf diesen beiden Seiten von vornherein eine verborgene Gereiztheit vor; sie zeigte sich, so oft seine Auffassung und Direktion an die seines Meisters erinnerte. Von den beiden Hofkapellmeistern war Levi oft leidend, der vielseitige Franz Fischer dann aber um so unermüdlicher in der Leitung alter und neuer, deutscher, französischer und italienischer Opern, so daß für Strauß als dritten Dirigenten wenig übrig blieb. Eine Qual für ihn war die lässige Disziplin. »Die Klavierproben mit nicht vollzähligem Personal kenne ich und hasse sie tödlich,« schrieb er an Bülow in einem seiner Münchener Berichte. Vergeblich suchte er mit Hannover anzuknüpfen, wo der ihm durch Bülow freundlich gestimmte Hans v. Bronsart Intendant war. Er sehnte sich von München weg, nach einer Stellung, »wo man nicht immer bei dem geringsten ritenuto in einer klassischen Oper sich im größten Widerspruch mit beiden Kapellmeistern und Personal befindet. So ging es mir wieder mit dem Wasserträger, alles was Lachner nicht gemacht hatte, sollte ich auch bleiben lassen. Um so zu dirigieren, wie ich möchte und fühle, muß man die Autorität einer ersten Stellung und einen Intendanten hinter sich haben, an dem man eine unbedingte Stütze hat.« Als Antrittsoper dirigierte er Johann von Paris, der dort zuletzt unter Bülow gewesen war, dann den Schwarzen Domino, Verdis Maskenball und Troubadour, Cosi fan tutte, Favoritin, Delibes' Le roi l'a dit, das ihn entzückte, Zar und Zimmermann und Lustige Weiber. »Ich habe neulich eine recht hübsche Aufführung herausgebracht; über ein paar recht harmlose Nuancen in der Ouvertüre war alles als einer absoluten Neuheit gegenüber furchtbar erstaunt.« Zöllners noch höchst mangelhaft einstudierten Faust übernahm er von Levi mit nur einer kleinen Probe, mit nur einer Probe auch den Barbier von Bagdad, der ihm viele Freude machte, ferner ohne jede Probe Freischütz und infolge von Levis Erkrankung Sommernachtstraum und Türmers Töchterlein von Rheinberger, das er wohl kaum näher kannte; denn diese harmlos volkstümliche Art war der seinen so entgegengesetzt als möglich. Immerhin war es von Vorteil für ihn, sich mit den dirigiertechnisch schwereren Spielopern in den Theaterdienst einzuüben. Auch in den Antworten des Meisters an Strauß, der in Hamburg Anfang März 1888 zu zehntägigem genußreichen Besuch bei ihm weilte, spiegelt sich einiges aus seinem künstlerischen Erleben jener Münchener Zeit wieder. Bülow schreibt ihm Ende März: »Welch niederhuberliche Wirtschaft! – Mögen Sie in Ihrem Inneren alle die Anregung finden, welche Sie über die Mißstimmung erheben kann, in welche Sie Ihre nächste Umgebung – mit Ausnahme der trefflichen Ritterfamilie versetzen muß.« Kurz darauf kondoliert er ihm zur »Isarathenischen Handwerkerei bzw. Leimsiederei«. Zwar verkehrte Strauß gelegentlich mit dem geistreichen und geselligen Levi und fand dabei manche Anregung, unter anderem spielte er Mahlers ihm noch neue erste Sinfonie mit Levi vierhändig, aber im ganzen fühlte er sich am Theater sehr vereinsamt. Mitte Juni 1888 schienen die Verhältnisse für ihn vollständig unleidlich zu werden. Das einzige Werk, das er in München von Grund aus mit größter Sorgfalt neu einstudierte, und auch dies nur infolge von Levis leidendem Zustand, waren Wagners Feen. Vor Beginn der letzten Proben, als Levi um Verlängerung seines Urlaubs nachsuchte, übertrug Perfall Franz Fischer die Leitung der Oper. In der Unterredung darüber, in der sich Strauß »wie eine Löwin für ihr Junges wehrte«, äußerte der Intendant, er könne überhaupt kein Bülowsches Dirigieren leiden und hielt Strauß die für sein Lebens- und Dienstalter allzu hohen Ansprüche heftig vor. Frau V. Bülow sprach dem Empörten schriftlich, Spitzweg und Ritter mündlich zu, den Münchener Vertrag trotzdem bis zu seinem Ablauf, Herbst 1889, einzuhalten, wozu sich Strauß mit bitterem Schmerz entschloß.
Auswärtige Erfolge, besonders im zweiten und dritten Jahr dieses Münchener Vertrags boten ihm einigen Ersatz für die Unerquicklichkeiten an seinem dienstlichen Wohnsitz und brachten auch äußerlich manche Abwechslung. Die günstige Aufnahme der Sinfonie in Frankfurt bahnte ihr den Weg nach dem Leipziger Gewandhaus, wo sie Mitte Oktober 1887 gespielt wurde. »Eine reizende Bekanntschaft machte ich in Herrn Mahler, der mir als höchst intelligenter Musiker erschien; einer der wenigen modernen Dirigenten, der um Tempomodifikation weiß und überhaupt prächtige Ansichten, besonders über Wagners Tempi (entgegen den jetzt akkreditierten Mozartdirigenten) aufwies.« Anfang Dezember leitete er die Sinfonie zweimal in Mailand, zusammen mit der Euryanthe-Ouvertüre, der zu Leonore I., Kamarinskaja v. Glinka, und Meistersingervorspiel. – »Die Blätter feierten mich weit über Verdienst; vom Orchester wurde mir als Geschenk ein prachtvoller silberner Taktstock mit Dedikation überreicht, ich war sehr glücklich, um so mehr, als ich hier, in der lieben Vaterstadt, mit Wohlwollen und Anerkennung absolut nicht verwöhnt werde.« Das Scherzo der Sinfonie mußte beidemal wiederholt werden. Anfang Januar 1888 dirigierte er in Köln seine Italienische Fantasie, die dort so begeisterte Aufnahme fand, wie nur selten eine Neuheit; ebenso, wenige Tage später in Frankfurt, dazwischen in Mannheim die Sinfonie, die auch unter Bülow das spröde Bremer Publikum ansprach. Weihnachten 1888 leitete er sie in Meiningen, wo Fritz Steinbach jetzt das Zepter führte. In München selbst fühlte er sich immer einsamer und – Mitte Dezember 1887 an Bülow – wie von einem persönlichen Unglück betroffen durch des alternden Levi ihn allzu formhaft gefällig anmutende Leitung der Neunten. Mitte Mai 1888 reiste er mit vierwöchigem Urlaub nach dem Gardasee, Verona, Venedig, Padua und dem wagnerfreundlichen Bologna mit seiner Musikausstellung. Im dortigen Theater kam ihm der gesangliche Charakter von Tristan und Isolde deutlicher als je zum Bewußtsein. »Der ganze Tristan war die prachtvollste Bel canto-Oper, nach der die Herrn Hanslick und Spießgesellen stets so vergebens seufzen,« berichtet er an seinen Onkel Hörburger.
Während er im Winter 1887/88 auf der eingeschlagenen Bahn tonsetzerisch mächtig weiterschritt, mit der Vollendung seines Don Juan, und im stärksten Gegensatz zu dessen glühenden Orchestermalereien das in einfachen Farben gehaltene Liederheft »Schlichte Weisen« schuf, war in seinen äußeren Erfolgen als Tonsetzer mit dem endgültigen Beschreiten des neuen Weges zunächst ein gewisser Stillstand eingetreten. Wehmütig schreibt er Ende August 1888: »Macbeth ruht einstweilen still resigniert in meinem Pult begraben – Don Juan wird ihm vielleicht bald Gesellschaft leisten. Auf beider Grabe erblüht einstens vielleicht jenes posaunenlose Blümlein, mit dessen stiller Poesie im zweifachen Gehölze [doppelte Holzbläser, statt der dreifachen, die er so liebte] ich mich allmählich zu befreunden bemühe.« Zu Beginn des folgenden Winters 1888/89 spielte er mit dem Kölner Konzertmeister Robert Heckmann im Münchener Museumssaal die Violinsonate, die Heckmann bereits in Elberfeld mit Buths aus der Taufe gehoben hatte, bei dem: schwachen Besuch der dortigen Vormittagsmusiken vielleicht die wenigst feierliche Uraufführung, die je ein Stück von Strauß erlebte. Im Sommer 1889 wurde er auf Empfehlung Bülows an Kniese nach! dreimaligem Besuch Bayreuths nun auch aktiv als »musikalische Assistenz« herangezogen. Er begleitete bei den Proben und studierte im Parsifal die »Stimmen aus mittlerer Höhe« ein. Das machte mit dem Zuhören bei anderen Proben täglich acht Stunden Wagner. »Und dabei fühle ich nicht die geringste Nervenabspannung, ich erkläre mir dies durch die strenge Konzentrierung auf einen Meister und seinen Stil; nur das viele Durcheinander, was man sonst in sich hineinschlägt, ermüdet so schrecklich,« schrieb er an Ritter. Im selben Sommer endlich dirigierte er zum erstenmal auf einem Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, in Wiesbaden, und zwar wieder die Italienische Fantasie – ein höchst bedeutsamer Schritt zum Bekanntwerden in ganz Deutschland.
Entscheidend für den inneren Charakter dieser dreijährigen ersten Münchener Dienstzeit war der Einfluß Alexander Ritters. Bülow hielt Ritter für höchst geeignet, als wirklich sachverständiger Kritiker dort nützlich zu sein. Daraus hätte bei der vollkommenen Ehrlichkeit und Ausdruckskraft Ritters im damaligen München wohl kaum etwas werden können, ebensowenig wie aus der Violinistenstelle, die ihm Levi beim Freiwerden einer solchen schon früher in Aussicht gestellt. Ritter machte aus seinem Herzen so wenig eine Mördergrube, daß er zum Beispiel, ohnedies verstimmt durch die infolge mangelnder Vorbereitung wenig gelungene Wiederaufführung seines Faulen Hans, 1887, später seinen »Ehrenpassepartout« an die Hoftheaterintendanz zurücksandte mit einem dankenden Schreiben, die Qualität der Opernaufführungen sei nicht mehr dazu angetan, künstlerisches Interesse zu erregen. Daß man sein, dem Genius Wagners huldigendes Werk mit Mascagnis Cavalleria zusammen gab, schmerzte ihn besonders. Schon durch seine Heirat mit einer Nichte Wagners und seinen Weimarer Verkehr mit Liszt stand Ritter mit seinem flammenden Temperament im fortschrittlichen Lager, und die Grundmelodie seiner Belehrung an Strauß hieß gar oft: Verbrenne, was du angebetet hast. Außer Brahms kamen besonders die alten Romantiker des Konzertsaals, Mendelssohn und Schumann mit ihren »Kindereien«, schlecht bei ihm weg, wobei mehr der glühende Parteimann aus ihm zu sprechen schien als der kompositionstechnisch abwägende Musiker. Er entging nicht jener Ichanbetung der Neudeutschen, alles selber machen zu wollen, den Formenschatz der Jahrhunderte feingeistiger Arbeit italienischer, französischer und deutscher Meister zu übersehen. Gerade die Gefahr, daß ihm die Form zum Abklatsch werde, wäre aber für Strauß, wie für jeden Genialen, die geringste gewesen, und diese allgemeine Verneinung fand denn auch keinen nachhaltigen Boden bei ihm. Er wurde in der Folge milder und vielseitiger im Urteil und ließ immer nur Empfindungen und Gründe wirklich musikalischer Art, nicht solche der Volksart oder der Kultur, für oder gegen ein Kunstwerk gelten. Wenn er später noch gelegentlich die in ihrer Art gewiß meisterhaften Werke romanischen Ursprungs wie Mignon und Cavalleria als »Schund« bezeichnete, so ist dies sicher nicht als abgewogenes künstlerisches Urteil, sondern als temperamentvolle Kürze des Ausdrucks anzusehen. Ein Punkt, in dem sich Ritter bejahend verhielt, wurde auch ihm gefährlich: der Sinn für jene neudeutsche Schreibtisch- und Klavieroper, wo hundert nur beim Lesen wirksame kleine textliche und musikalische Feinheiten in Mittelstimmen, die nicht zu Gehör kommen, und in Nebenrollen, die man überall mit derben Chormitgliedern besetzt, versplittert werden, kurz, wo sich das musik-poetische Wollen in verhängnisvoll unsachlicher Weise mit dem bühnentechnischen Können verwechselt. Deshalb konnte die damals in München wieder hervorgeholte Genovefa Schumanns auf Strauß so lebhaft wirken. Und er selbst hat später, mit der langen Erfolglosigkeit des edelsten Strebens in seinem Guntram, gebüßt. Vielleicht zeigt auch noch das anstandslose Durchkomponieren des Rosenkavaliers Spuren jener nicht frühzeitig geübten Schärfe in der Unterscheidung zwischen dem buch- und bühnenmäßig Wirksamen. Seine musikalische Einbildungskraft scheint sich später gewöhnlich des einmal angenommenen Textes sofort mit derartiger Stärke bemächtigt zu haben, daß es zur Überlegung etwaiger Kürzungen oder Änderungen nur selten kam. – Strauß pflegte in jener Zeit mit Ritter und seinem Vater als festem Stamm einen Dämmerschoppen in der kleinen Weinstube von Leibenfrost am Promenadeplatz, wo man einem herben Serbischen mäßig zusprach. Als dort einmal eine Nebenperson gegen Ritters flammende Parteireden einwarf, diejenigen Sachen von Brahms, die sie näher studierte, hätten ihr gefallen, entgegnete Ritter: »Brahms muß man eben so lang studieren, bis man merkt, daß nichts dahinter ist.«
Diesem Meister gegenüber sprach auch bei ihm gewiß noch dessen öffentlicher Protest« gegen die Fortschrittspartei, die »Neudeutschen«, vom Jahr 1860, mit, wie denn die Folgen dieses wenig Dutzend Zeilen langen, und dazu nicht einmal von Brahms selbst, sondern einem gänzlich Unbeteiligten unbefugt in; Druck gegebenen Zeitungsartikels unzerstörbar scheinen. Und dies, obgleich Brahms, wie aus seinem Briefwechsel mit Joachim hervorgeht, annahm, man könne gar nicht an Wagner dabei denken, sondern an Liszt, und überhaupt nicht das ihm ziemlich gleichgültige Theater, sondern den Konzertsaal vor der neuen Richtung schützen wollte. Aber der alte, einmal angefachte Haß war in Ritter unaustilgbar. Er, der zwar erst im Anfang der Fünfziger stand, aber in gerechtester Verbitterung gegen die künstlerische Mitwelt kaum, mehr etwas von dem bis dahin in unverdienter äußerer Bescheidenheit verbrachten Leben erwartete, ward in Meiningen das Orakel für den zu jener Zeit 21jährigen Strauß, der den ganzen Kampf mit dieser für Ritter innerlich abgetanen Welt noch vor sich hatte. »Der Unsere bist du neu geworden«, konnte der junge Münchener Musikerkreis, der sehr wenig für Brahms übrig hatte, den nun gleichfalls von ihm abgewandten Strauß begrüßen.
So vollendete sich damals in München der in Meiningen begonnene große Umschwung bei ihm, zur Freude der Wagnergemeinde, während seine Hinwendung zu Liszt weniger Verständnis fand. Für den regelrechten Münchener Wagnerianer war Liszt ja nicht mehr als des Meisters Schwiegervater. Die Wendung zu Liszt war Strauß gewiß längst vorbestimmt. Die Reinheit, Güte, Vielseitigkeit, das berufliche Zusammengehörigkeitsgefühl, das Liszts Persönlichkeit, in ihren großen Zügen gesehn, auszeichnet, das Befreiende seiner grundsätzlichen Forderung, der Inhalt eines jeden Tonstücks müsse sich die Form schaffen, der hierdurch gegebene literarische Charakter, der klare Aufbau, die reinliche Übersichtlichkeit seiner Partituren, konnte einen Künstler von Straußens Anlage wohl fesseln, wenn er einmal auf all das hingeleitet war. Außerdem mußte seinem im Scharfen zu einheitlich planmäßigem Aufbau veranlagten Geist die Einsätzigkeit der Lisztschen Tondichtung im Vergleich zur viersätzigen Symphonieform der Klassiker besser entsprechen.
Und dies ist die erste und bisher die letzte Wandlung in dem künstlerischen Glaubensbekenntnis von Richard Strauß als erwachsenem Mann. Alles Folgende bringt nur die Bekräftigung des einmal als richtig Erkannten durch Wort und Tat. Der Sache Wagners, ja Bayreuths, blieb er gleichmäßig treu ohne jede Beeinflussung durch Änderung seiner Beziehungen zum Haus Wahnfried. So forderte er schon fünfzehn Jahre, ehe die Freigabe aktuell wurde, in einem lithographierten Rundschreiben von München, August 1894, zu Schritten auf, die Gesetzgebung im Sinn von Wagners »ausdrücklichem Willen« zu beeinflussen und Parsifal für Bayreuth zu erhalten. Stets blieb er dann in der ersten Reihe der Parsifalschutzbewegung und unterzeichnete 1905 die Protesterklärung gegen die Amsterdamer Aufführung, schlug auch Conrieds Ersuchen ab, das Werk in Neuyork zu leiten. Hier sei auch gleich seine geharnischte Schluß-Kundgebung in dieser Sache angeschlossen, der bekannte Brief an den Wiener Kritiker Ludwig Karpath, aus Garmisch, vom 18. August 1912:
»Für mich gibt es in der Parsifalfrage nur einen Richtungspunkt: Respekt vor dem Willen des Genies.
Leider haben aber in der Frage des Parsifalschutzes nicht Leute zu entscheiden, denen die Steigerung und Verfeinerung unserer Kultur am Herzen liegt, sondern nur Juristen und Politiker, deren Horizont nicht bis zu dem Verständnis von den unbeschränkten Rechten des geistigen Eigentümers reicht.
Ich habe seinerzeit den achttägigen Verhandlungen des Deutschen Reichstages persönlich beigewohnt, wo die Vertreter des deutschen Volkes, mit ganz wenigen Annahmen, in beneidenswerter Unkenntnis der Materie über Urheberrecht und Schutzfrist debattierten. Ich habe selbst gehört, daß ein Herr Eugen Richter in unverschämtesten Lügen die Rechte von armseligen zweihundert deutschen Komponisten – die Erben Richard Wagners mit eingeschlossen – zugunsten von zweihunderttausend deutschen Gastwirten zu Boden trat.
Dies wird auch nicht anders werden, solange das blöde allgemeine Wahlrecht bestehen bleibt, und solange die Stimmen gezählt und nicht gewogen werden, solange nicht beispielsweise die Stimme eines einzigen Richard Wagner hunderttausend und ungefähr zehntausend Hausknechte zusammen eine Stimme bedeuten.
Dann würde ich vielleicht auch im Goethebund nicht mehr die Phrasen hören: von den Rechten der deutschen Nation, die befugt sein soll, das Genie, das sie bei Lebzeiten verbannt und verhöhnt hatte, dreißig Jahre nach seinem Tode auszuplündern und sein Werk in den kleinsten Provinzbühnen zu prostituieren.
Wir wenigen werden vergebens protestieren, und der deutsche Spießbürger wird in zwei Jahren am Sonntagnachmittag zwischen Mittagessen und Abendschoppen, statt fortwährend in den Kintopp und in Operetten zu gehen, auch für fünfzig Pfennig den Parsifal hören.«
Ebenso sei vorausnehmend auch ein Blick darauf geworfen, wie Strauß seinem Liszt-Vorbild treu geblieben ist. Unter den vielen Gelegenheiten, dafür einzutreten, stehen seine Darbietungen im hundertjährigen Geburtsjahr des Meisters obenan, zunächst bei der Liszt-Feier des Allgemeinen Deutschen Musikvereins im Oktober 1911 zu Heidelberg, wo er zusammen mit dem greisen Saint-Saëns an erster Stelle gefeiert wurde. Mit außerordentlichem Eindruck leitete er dort die Bergsymphonie und Tasso, und in den gleichen Monat fiel seine großartige Vorführung der Dante-Symphonie am zweiten Abend der Berliner Königlichen Kapelle. Auch außerhalb der Sache Wagners und Liszts diente sein ganzes Wirken als Komponist, Dirigent, Schriftsteller und Vereinsvorstand fortan selbstlos nur dem Leitgedanken des Fortschritts. Man darf behaupten, daß er niemals einen Künstler ohne Förderung ließ, bei dem er bedeutende Anlagen zur Arbeit in diesem Sinn wahrzunehmen glaubte, wobei seine vollkommene Sachlichkeit stets hervortrat. Kaum daß er irgendeine neue gute Beziehung gewonnen, wie zu Spitzweg, Thomas, Bülow, oder sich einer seiner Freunde zu einer solchen entwickelt hatte, wie später Schillings, so suchte er dies zugunsten eines Gleichstrebenden auszunützen. Immer bekämpfte er das durch seine Mindergüte ihm Unschädliche und förderte, was er für wirklich gut, mithin gegen sich selbst für wettbewerbfähig hielt: Ritter, Mahler, Reger, Pfitzner, unter anderen auch Baußnern, für dessen »Bundschuh« er eifrigst eintrat. Die Frage der Gegenleistung scheint hier ausgeschlossen; von einer Do-ut-des-Politik, die heute ja als immerhin erlaubt gilt, ist kein Beispiel bei ihm bekannt; oft wußten die Betreffenden nicht einmal, daß er für die Aufführung von Werken oder die Beförderung ihrer Verfasser gewirkt hatte. Er nützte manchem auch direkt durch sorgfältig erwogene Ratschläge, stets nach Überzeugung sein Bestes gebend.
Für alle Gebiete seiner Betätigung, die ja mit voller Einheitlichkeit aus seiner Natur hervorgehn, lassen sich bei dem noch im Anfang der zwanziger Jahre Stehenden die Grundlinien der späteren Entwicklung nachweisen. Und wenn man irgendeine der vielen Hunderte von Kundgebungen betrachtet, die in Maßnahmen, Aufsätzen, Schriftstücken, Reden zur Sache des Fortschritts von ihm vorliegen, so wecken diese stets in erster Linie das Gefühl: das ist ein deutscher Mann ohne deutsche Schwerfälligkeit. Von dem Augenblick an, als er zu der neuen Fahne schwur und seine Persönlichkeit mit den Zielen seiner großen Vorgänger Berlioz, Liszt, Wagner eins fühlte, hat er diese in keinem Augenblick mehr aus dem Auge verloren, sondern stets »die Sache um ihrer selbst willen getan«, wie Wagner verlangt. Eine Zeit, ein Volk, in deren Wesen und Zielen die Kunst als Staatsangelegenheit Platz fände, hätte einen solchen Kopf und Charakter unter irgendeiner Form zum Führer in seinem Fach erhoben. Denn er gehört zu der so seltenen Gattung des im Sozialen durch und durch praktischen Idealisten. Seine ganze Tätigkeit drückt seit Jahrzehnten in steingehauener Schrift den Gedanken aus: Wir haben das Erbe unserer Klassiker zu verstehn und zu verarbeiten; sobald wir aber selbst schaffen, dürfen wir nicht in der billigen Eitelkeit zweckloser Wiederkäuerei unsere Namen über Nachahmungen setzen; wir haben nur das Recht, zu komponieren, wenn wir neue Wege gehn. – So gewiß nun jeder Mensch von Sonderwert für die meisten anderen und teilweise für sich selbst ein Geheimnis bleibt, so darf doch hier versucht werden, jene einzelnen Linien bei Strauß zu verfolgen, die auf Innerliches hinweisen, ja die Gewißheit bieten, hier zu Folgerungen tatsächlicher Art zu führen. Um jene Zeit lag seine künstlerische Persönlichkeit, und damit auch bedeutungsvolle Seiten seiner menschlichen, der Mitwelt offen vor, und er ist sich in der Folge ohne jede Abweichung treu geblieben. Alle Grundmerkmale sind schon in diesem Vorspiel zum künftigen Straußbuch klar und unzweifelhaft festzulegen. Stellen doch die Eigenschaften, die einen großen Künstler machen, nur außerordentliche Steigerung der gewöhnlichen Geistes- und Gemütskräfte dar, die Strauß in allen seinen menschlichen Beziehungen stets in tiefer und reicher Arbeit betätigt hat. So selbstverständlich sich bei ihm wie bei jedem Meister Grenzen der Begabung finden lassen, so tritt uns, sobald wir dem aus seinen Werken sprechenden Geist, Gemüt und Stimmungsgehalt nähertreten und seine zahllosen Betätigungen zur öffentlichen Musikpflege überblicken, überall der gerade, große und reine Charakter entgegen. Die Grundlage für sein tonsetzerisches Schaffen bot die ungewöhnlich hohe Entwicklung der beiden Bestandteile jeder künstlerischen Arbeit, bei ihm der Aufnahmefähigkeit auf geistigem Gebiet und der musikalischen Gestaltungskraft. Der erste dieser Bestandteile, die äußerst starke Beeinflußbarkeit, eine Ureigenschaft des Künstlertums, geht schon aus seinem Verhältnis zu den führenden Persönlichkeiten seiner Jugend hervor. Treu studiert er die klassischen Meister, die ihm sein Vater empfiehlt; sorgfältig macht er seine theoretischen Aufgaben für Friedrich Wilhelm Meyer. Daneben erfüllt er fleißig alle Wünsche seiner Lehrer für Klavier und Violine. In seiner Epigonenzeit gibt er sich mit solcher Inbrunst seinen Stilvorbildern Mendelssohn, Schumann, Brahms hin, daß er emsig und dabei virtuos ausgearbeitete Werke in ihrer Schreibart hervorbringt. Am meisten tritt sein Einleben in die unvergleichlich edle Eigenart Schumanns hervor, die durch Jahre hin so viele seiner Themen gestaltet hat. Selbst den Übermut seiner Burleske äußert er mit romantischer Formenkultur und Formenfülle. In Meiningen lebt er sich ganz in die Auffassungs- und Direktionsweise Bülows ein. Dann sind die Eindrücke der italienischen Landschaft derart mächtig, daß sie einen für ihn selbst ganz neuen Kompositionsstil in ihm erzeugen. Eifrigst liest er in der Folge alle von Ritter hochgehaltene Ausdrucks- und Programmusik und die Kunstschriften ihrer Vertreter; in Weimar sehen wir ihn später in stilechten Wagner- und Lisztaufführungen mit äußerster Hingabe aufgehen. Bezüglich des Stoffes aber, der auf ihn als Tonsetzer jeweils eine so fast beispiellos intensive stilbildende Macht ausübte, läßt diese den Entschluß zum Durchkomponieren nur zum kleinsten Teil freiwillig, erscheinen. Es ist ziemlich gleich, ob man betont, der gewählte Stoff habe sein musikalisches Schaffen in neue Ausdrucksbahnen gelenkt, oder er habe ihn wählen müssen im Vorgefühl, daß das geschehen werde.
Das Maß des zweiten, des schöpferischen Moments, äußert sich in einer gleichfalls ungemein gefühlsstarken, dem aufgenommenen Stoff entspringenden tongestaltenden Arbeit. Das Verständnis für diese Grundbedingung seines Schaffens ist erschwert durch die ihm natürliche verhältnismäßig verwickelte musikalische Schreibweise. Solange das Technische eines Werkes beim Hören, Spielen, Lesen so große Verstandesarbeit verursacht, daß dies der einzige Anteil des Empfangenden bleibt, tritt eben dessen Empfindung nicht in Tätigkeit, und er ist leicht geneigt, diesen Sachverhalt ohne weiteres auf das Werk übertragend, dieses selbst für »Verstandesarbeit« zu halten. Auch Straußens im Verkehr mit der Außenwelt schon früh durchaus ruhiges, bescheiden selbstsicheres Wesen, bestätigte manchem diese Ansicht; es gibt genug seltsame Leute, die sich einen Mann, wenn er gesund aussieht, sich gut anzieht, mit Appetit ißt, ohne ihn anderen zu verderben, und auch sonst gepflegte äußere Formen hat, nicht in dem riesenhaften unfreiwilligen Vorgang naturnotwendigen Schaffens denken können. In bezug auf die tonsetzerische Schwierigkeit seiner Schreibweise äußert Strauß in einem Brief an Friedrich v. Hausegger, das Streben nach fruchtbarer Wahrheit dem nach falscher Bescheidenheit weit voranstellend: »Wenn man mir vorwirft, ich schreibe zu kompliziert – zum Teufel! noch einfacher kann ich's nicht ausdrücken, und ich strebe nach möglichster Einfachheit; ein Streben nach Originalität gibt es bei einem wirklichen Künstler nicht. Was meine musikalische Ausdrucksweise oft überfeinert, rhythmisch zu subtil reichhaltig erscheinen läßt, ist wahrscheinlich ein Geschmack, der mir leicht als gewöhnlich, schon oft dagewesen und daher überflüssig, nochmals wiedergekaut zu werden, erscheinen läßt, was anderen, nicht bloß Laien, als höchst modern und dem zwanzigsten Jahrhundert angehörig vorkommt.« Gelegentlich betont Strauß allerdings, daß er es für überflüssig halte, hundertmal Dagewesenes zu wiederholen, das versteht sich aber für einen schöpferisch Veranlagten von selbst, und er will an jener Stelle gerade den Vorwurf des Erklügelten damit abweisen. Wenn unter den blutjungen Leuten anfangs der achtziger Jahre in München jemand über das Erdachte Straußischer Harmonik klagte, wies gewöhnlich einer den Sprecher zurecht: Wenn wir uns Mühe geben müssen, allmählich hinter seine Schreibweise zu kommen, so ist das doch kein Beweis, daß sie ihm nicht ganz natürlich und selbstverständlich war; sein Vorstellungsvermögen fängt »halt« da an zu arbeiten, wo unseres aufhört. Wie bei jedem wahrhaft genialen Künstler, so lag auch in Straußens Natur der unermüdliche, weit über das gewöhnliche Maß hinausgehende Fleiß zu formvollendeter Ausarbeitung seiner Eingebungen. Erstaunlich ist die Fähigkeit andauernd gleichmäßiger Gestaltungsarbeit und emsiger Einzelausführung, die sich in seinen fast korrekturlosen Partituren schon äußerlich darstellt. Die hingebende Sorgfalt, mit der er in einer bis dahin unerhört ausgebildeten Polyphonie die unendlichen Verzweigungen jenes der inneren Notwendigkeit entquellenden Grundrisses seiner Werke im Dienst des Unbewußten, Unerforschlichen ausarbeitete, hat für den sorgsam nachfühlenden Leser seiner Arbeiten etwas von heiligem Amt, etwas ethisch Hohes an sich. Und zu all den gewissenhaften Leistungen des Dirigenten und Tonsetzers kam dann noch die unendlich mühsame Durchsicht der Druckbogen von Partituren und Stimmen der eigenen Werke, eine »gräßliche, krampfhafte«, ja »schauerliche« Tätigkeit, wie sie Strauß in Briefen benennt. Ermöglicht wurde diese außerordentliche Summe von Arbeit durch eine besonders stark entwickelte Gabe willkürlichen Abspannens nach ungewöhnlichen Leistungen des Nervensystems, die so sehr zu dessen Gesunderhaltung beiträgt und auch selbst als Zeichen besonderer Gesundheit gilt. Sofort nach Beendigung irgendeiner Riesenaufgabe als Tonsetzer oder Orchesterleiter war Strauß meist imstande, die höheren Fähigkeiten in Ruhe zu versetzen und mit voller Hingabe einen gemütlichen Skat zu spielen, wie er es z. B. auf der Heimfahrt von Dresden nach Berlin um 10 Uhr vormittags nach der gewiß innerlich genugsam aufregenden Uraufführung der »Salome« tat. Und es ist bekannt, daß er dann nicht »fortdirigiert«, sondern recht gut spielt, »gerissen«, wie die Geldbörse manches Partners zu erzählen weiß. Diese Liebe zum Spiel, besonders Tarok und Skat, trat schon auf dem Gymnasium hervor. Er operierte stets ernsthaft, klug und verwegen und konnte nach Jahren noch bei merksamen Partien den Sitz der Karten, Gang des Spiels und die Fehler der Partner bestimmt angeben. Seine Freunde, wie Thuille, Schillings, waren meist auch hierin seine Gefährten. Für seinen ganzen seelischen Haushalt ist dies von Wichtigkeit. Denn gerade im Spiel ruht sich sein Geist am besten aus; dessen Gang hält ihn fest und bringt den sonst beinahe beständig regen, die bloße Unterhaltung als Aufforderung oder Vorwurf durchklingenden Schaffenstrieb einzig zum wirklichen Schweigen in ihm. Nach beendeter Aufführung war Strauß in Beziehung auf das Verhalten zum Urteil des Nebenmenschen stets von unentwegter Gesundheit. Fern von quälerischer Empfindlichkeit, hielten sich seine Äußerungen stets auch fern von grundsätzlicher Gleichgültigkeit: Ich schreibe, wie ich's empfinde, und der andere sagt, wie es ihm gefällt; beides ist unser natürliches Recht.
Auch erholte er sich von dem ungeheuren Ernst seines Wirkens nach echt süddeutscher Art durch spöttisch-heitere Augenblicke, wie wenn er 1896 in der Münchener »Jugend« ein Lied spendete, später als Opus 31, 2, gedruckt, das in Des steht, aber im freien Ausströmen der Empfindung einen halben Ton höher schließt und unter dem Strich den Vermerk trägt, wer es noch im Lauf des 19. Jahrhunderts singen wolle, möge dies mit dem zur Auswahl beigefügten Schluß in der Haupttonart tun, – was ihm eine Zitation zu seinem damaligen Oberen, Herrn v. Perfall, eintrug, der ihm bedeutete, ein Königlich bayerischer Hofkapellmeister dürfe mit dem Publikum nicht so umgehn. Oder wenn während seines Eulenspiegels begeisterte Jünglinge nach dem scheinbar abschließenden langen Pianissimo vor dem letzten 4/8-Takt Miene machten zu klatschen und er ihnen vom Dirigentenpult aus mit vertraulicher Würde abwinkte. Unnachahmlich wußte er als Vereinsvorsitzender den langsam und feierlich seine Beschwerde einleitenden, stolz-verdrießlichen Schwierigkeitsmeier mit einer herablassend-gemütlichen Wendung zu verblüfftem Schweigen zu bringen und damit endlose Erörterungen abzuschneiden. Aber stets, wenn Strauß im Verkehr seine heitere Ader pulsieren fühlt, zum Beispiel gegenüber irgendeinem unmusikalischen Musikschriftenschnupperer, der sich für wichtiger hält als ihn und ihm Verhaltungsmaßregeln für die nächste Oper gibt, so klingt dabei gewöhnlich ein Zug rein menschlicher Güte durch, der zuweilen gerade die von seinem Spott Gestreiften besonders zu ihm zieht.
Im Sinne unserer gerne mit allgemeinen Sätzen über Kunst auch im Gebiet der Gefühlswerte umherwerfenden Zeit mußte es nun liegen, daß man den hohen, ja teilweise für uns noch maßstablosen Werten, die er uns gab, durch Einordnung in die Gesamtentwicklung ihres Faches rednerisch Begründung zu verleihen suchte. Woher kommen wir, wohin gehen wir, und auf welchem Punkt dieser großen Linie stehen wir mit Strauß? Bei diesem Blick in die Zukunft dürfte man, wie bei jeder Frage der Kunstentwicklung, nicht die Rolle der Gegenwirkungen vergessen. Und hiernach möchte ein gewisser Erfolg, im Gegensatz zu Strauß, künftigen »Primitiven« der Tonkunst beschieden sein. Jedenfalls aber fragt in solchen Dingen die Einbildungskraft mehr, als die Überlegung beantworten kann. Einfache Lösung verhieß die Formel: Strauß ist ein Kind seiner Zeit, also zählen wir die Hauptmerkmale der deutschen Gegenwart auf, um sie sicher in ihm als einem ihrer Hauptvertreter wiederzufinden. Aber selbst wenn wir wüßten, wie diese rein technisch denkfreudige, sonst aber leere Formen jeder Art, mehr als seit langem eine vor ihr, verehrende Epoche mit ihrem Überfluß an bloß wiederholendem Aufzeichnen und ihrem Mangel an selbständiger Geistesarbeit zu bezeichnen sei, so kämen wir dadurch Strauß nur wenig näher. Nicht einmal der Versuch, das Genie als Ausdruck des Besten seiner Zeit anzusehen, bestätigt sich ja in der Musik, viel eher wird die Zeit hier zum Ausdruck des Genies. So wenig Beethoven der Ausdruck des deutschen Tiefsinns ist, indem die deutsche Musikwelt gerade durch ihn um eine ihr bis dahin unbekannte Art von Tiefsinn bereichert wurde, so wenig ist Strauß der Ausdruck unserer Zeit; das Glänzendste an seiner geistigen Erscheinung ist ja gerade die Gegensätzlichkeit zu ihr. Vielmehr sind wir im Begriff, mit einem starken Teil unseres Musikempfindens straußisch zu werden. Das bei Größen des Staats- und Kulturlebens mögliche Bestreben, sie wesentlich aus der Eigenart ihrer Zeit heraus zu verstehen, ist auf den Künstler überhaupt weniger anwendbar, da bei ihm die persönliche Eigenart viel wesentlicher, und diese beim Musiker wohl noch schwerer zu fassen und darzustellen ist als beim Dichter und Maler. Damit sei der luftigen Gedankenwelt der Rücken gekehrt und der Blick der weiteren Folge der Tatsachen zugewandt.
Dieser flüchtige Überblick, der die Einheitlichkeit und strenge Folgerichtigkeit in der Entfaltung von Straußens künstlerischem Naturell vorausnehmend dartun soll, schien ersprießlich vor dem Eingehn auf die Betätigung seiner eigenen Tonsetzerpersönlichkeit, als deren Beginn, – oder, wenn man diesen lieber erst in Don Juan sehen will, – als natürliche Vermittlung, zu deren Beginn die Italienische Fantasie zu gelten hat. Als er von der Reise wiederkam, erwarteten ihn in München die Korrekturbogen von Wanderers Sturmlied und dem Klavierquartett; dann arbeitete er nach den mitgebrachten Skizzen die viersätzige symphonische Fantasie Aus Italien aus. Das in G-dur stehende Werk für großes Orchester nimmt mit seinen Satzüberschriften: Auf der Campagna. – In Roms Ruinen. Phantastische Bilder entschwundener Herrlichkeit, Gefühle der Wehmut und des Schmerzes inmitten sonnigster Gegenwart. – Am Strande von Sorrent. – Neopolitanisches Volksleben (mit dem Lied »funiculi« auf die Vesuv-Dampfbahn) – eine Sonderstellung ein, indem es die Symphonie des ersten Zeitraums und die Programmusik des zweiten noch vereint enthält; von reiner Instrumentalmusik schrieb Strauß in langen Jahren nurmehr die ungleich weniger fortschrittliche Violinsonate Opus 18. Die Italienische Fantasie wird am besten genießen, wer aufmerksam die Überschrift jedes Satzes liest und sich dann unbefangen den Eingebungen des Tonsetzers überläßt. Neben den Strömen glühenden Farbenreichtums, dem in glänzendster Orchestertechnik sprühenden Humor des Finale finden sich Stellen von zartester harmonischer Schönheit, wie im zweiten Satz, in der Durchführung des zweiten Themas:

Bei der Wiederholung liebevoll verändert

Im dritten Satz: »Am Strande von Sorrent« besticht die blendende Naturmalerei; echt italienisch empfunden ist hier unter anderem die a-moll-Melodie der Oboe, Seite 53 des Auszugs für zwei Klaviere. Viel zu selten gelangt diese, Schönheit und Darstellungskunst in hohem Maße vereinigende, unermeßlichen Wohllaut einschließende Partitur zum Klingen; jetzt, nach all den Jahren, in denen der Konzertbesucher so viel – anderes gehört hat, würde ihr mehr werbende Kraft innewohnen als zur Zeit ihres Entstehens. Am 2. März 1887 leitete Strauß das Werk im ersten »Abonnementskonzert« des Hoforchesters. Den lauten Widerspruch, der in diesen Odeonskonzerten zu den eingewurzelten schlechten Gewohnheiten einiger Rückwärtsler gehörte, sah er mit großer Seelenruhe als etwas bei wirklich Neuem Selbstverständliches und fast den Gehalt an Echtem Verbürgendes an. Nach dem Konzert schrieb er an seinen Onkel Hörburger: »Die Aufführung meiner Fantasie über Italien hat großen Rumor hier hervorgerufen – allgemeine Verblüffung und Wut darüber, daß ich nun auch meine eigenen Wege zu gehen anfange, meine eigene Form schaffe und den faulen Menschen Kopfzerbrechen verursache; die ersten drei Sätze fanden noch leidlichen Beifall1; nach dem letzten, Neapolitanisches Volksleben, der allerdings etwas arg toll ist (in Neapel geht's aber auch bunt her), ging neben lebhaftem Beifall auch ordentliches Zischen los, das mir natürlich großen Spaß machte.« Mit dem »Spaß« mußte es wohl stimmen; denn als Vater Strauß bestürzt und empört über die Zischer ins Künstlerzimmer kam, saß sein Sohn auf dem Tisch und baumelte vergnügt mit den Beinen. »Nun, ich tröste mich, bin mir des Weges, den ich machen will, genau bewußt; es ist noch keiner ein großer Künstler geworden, der nicht von Tausenden seiner Mitmenschen für verrückt gehalten worden ist. Pschorrs waren entzückt, sonst gab's auch noch einige Enthusiasten: Levi, Ritter, Kapellmeister Meyer, die waren dafür ganz weg, die waren aber auch die einzigen, die das Werk bereits genau kannten.« Auch an Bülow schrieb Strauß über das Werk: »Der erste Schritt zur Selbständigkeit!« Ihn bat er, die Widmung der Fantasie als kleines Zeichen seiner großen Dankbarkeit anzunehmen, und der Meister entgegnete sofort: »Ihre liebenswürdige Absicht, mir die durch Lokalopposition dekorierte symphonische Fantasie widmen zu wollen, nehme ich mit dem gleichen Enthusiasmus an, den ich sonst gemeiniglich für Ablehnung ähnlicher Auszeichnungen an den Tag zu legen pflege.« An Spitzweg schrieb Bülow dann aus Hamburg über die Fantasie: »Mein künstlerisches Interesse ist so gespannt, als nächst etwa einer Brahmsschen Novität überhaupt mir, der seine Konsumptionsfähigkeit nachgerade zur Neige erschöpft hat, noch möglich ist.« Wenige Monate später freilich äußerte sich Bülow, körperlich leidend und seelisch verstimmt, infolge der schweren Enttäuschung durch die Fronarbeit im Hamburg-Altonaer Theaterdienst, die ihm Strauß durch einen an August Steyl in Frankfurt gerichteten, überaus klugen und die Hamburger Verhältnisse, besonders Pollini, scharf durchschauenden Brief vergeblich zu ersparen gesucht hatte, an Ritter: »Macht mich das Alter so reaktionär? Ich finde eben, daß der geniale Autor bis an die äußerste Grenze des tonlich Möglichen (im Gebiete der Schönheit) gegangen ist, dieselbe eigentlich ohne dringende Not häufig überschritten hat. Ein wundervoller, beneidenswerter Fehler, diese Üppigkeit von Einfällen, dieser Reichtum von Beziehungen, allein … nun, ich erwarte die Aufführung. Die kolossalen Schwierigkeiten der Ausführung beklage ich am meisten.« Der Brief schließt: in Erinnerung an Meiningen und »unseren Phönix Strauß«.
Inzwischen hatte Strauß schon wenige Tage nach der Münchener Uraufführung der Italienischen Fantasie, am 8. März (1887) im Kölner Gürzenichkonzert die von »Wandrers Sturmlied« mit tiefgehendem Eindruck geleitet. In diese erste Münchener Theaterzeit fällt auch die Veröffentlichung von Liedern, die großenteils freilich nur als Vorboten der eigentlichen Straußischen Lyrik anzusprechen sind. Die Münchener Dichter boten ihm noch nicht das, was ihm innerlich verwandt war. Zunächst erschien Opus 15, Madrigal von Michelangelo und vier Lieder von Schack, von dem Strauß in jener Zeit nicht weniger als sechzehn, zum Teil nicht günstige Texte in Musik gesetzt hat. Die zwei Frau Johanna Pschorr zugeeigneten Sopranlieder »Winternacht« und die liebliche »Heimkehr« sind sehr sangbar, die drei Altlieder, Viktoria Blank von der Münchener Hofoper gewidmet, dagegen auf allzu rednerisch zugeschnittene Texte gesetzt.
Im folgenden Heft kehrte er abermals zu dem gedankenreichen, aber ebendeshalb, wie auch in seiner Rhythmik, dem Musiker oft nur wenig entgegenkommenden Schack zurück. Dieses Heft, Opus 17, enthält zwischen fünf anderen, deren mit Sinn überladene und rhythmisch etwas starre Sprache eine fließende Melodik nicht begünstigt, als zweites das berühmte Ständchen »Wach auf, wach auf, doch leise, mein Kind«, dessen unausrottbare Beliebtheit Strauß später manchen Seufzer erpreßte. Oft genug mußte er den gutgemeinten Rat anhören, doch wieder etwas »so Dankbares« zu schreiben. Dieses so oft fälschlich als echtes »Lied« im günstigen und ungünstigen Sinn erwähnte Stück mit seiner zauberhaft duftigen Klavierbegleitung in glücklicher Stunde entstanden, ist geradezu ein Schulbeispiel für den Kampf des Grundsatzes strenger, genauer Betonung mit der musikalischen des Lied-Melos. In dem Anfang: »Wach auf, wach auf, doch leise, mein Kind! Um keinen vom Schlummer zu wecken«, ist, damit »keinem« nicht durch die Länge der Note zu sehr hervorgehoben wird, die lange Silbe in »wecken« um eine Takthälfte verschoben. Bei »Um über die – Blumen zu hüpfen« ist »über« betont. »Mondscheinnacht« hat des gleichmäßigen Versbaus wegen den Ton auf der Endsilbe. Der Dichter sang: »Die Nachtigall uns zu Häupten soll – Von unsren Küssen träumen.« Reizvoll ist hier die Trennung durch den Endreim »soll«, ebenso die Halbbetonung auf »von«, wie oft bei Verhältnisworten! Beides vernichtet die Musik durch sprachlehrmäßiges: »uns zu Häupten – Soll von unsren Küssen träumen«. In der Stelle »Unter den Lindenbäumen« bekommt bei Strauß »bäumen« den Akzent. Der Dichter betont auch natürlich: »Die Rose, wenn sie am Morgen erwacht«, nicht: wenn sie am Morgen. Um in dem Stück die Einheit zwischen dichterischer und musikalischer Rhythmik herzustellen, die das Kunstlied doch anstrebt, müßte man es teilweise umschreiben, d. h. die natürliche Takteinteilung der wertvollen Melodie herstellen und ihr die Textveränderungen anpassen. Was die Notenwerte anlangt, so hat man beim »Ständchen«, wie bei so mancher anderen herrlichen Liedmelodie von Strauß, an einzelnen Stellen das Gefühl: gesungen müßte es so und so lauten; nun aber ist es deklamiert, und deshalb verändert. Strauß hat das berühmte Lied, wie angedeutet, oft genug, wenn auch aus anderen Gründen, kräftig verwünscht, obschon es für Hunderte »kleine Leute« der ganze Richard Strauß ist und sich gerade in diesem Zwitterding von älterem und heutigem Lied glücklich empfundene Taktwechsel finden, die ihrer Zeit vorausweisen. Opus 17, das »Ständchen«-Heft, enthält noch das in Singstimme und Begleitung wundersam duftige »Geheimnis«, eines jener Lieder, die trotz des thematisch lockeren Gefüges der Singstimme durch die Einheit der Stimmung den Eindruck der Geschlossenheit erzielen. Im folgenden Heft dieses ersten Liederfrühlings, Sechs Lieder, Opus 19, aus »Lotosblätter«, abermals von Schack, ist besonders bemerkenswert das zweite: »Breit' über mein Haupt«, ganz in freier Thematik gehalten; auch das Nachspiel des Klaviers klingt nur wie absichtslos an das dankbare Anfangsmotiv der Singstimme an:
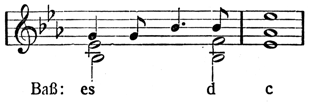
Zunächst folgten dann die »Schlichten Weisen«, Opus 21, Fünf Gedichte von F. Dahn, eine Reihe trefflich zugespitzter Sinngedichte, bei denen der flotte Sinn und die kecke Rhythmik der Sprache, unmittelbar in musikalischen Reiz umgesetzt, im Konzertsaal von sicherster Wirkung ist: All' mein' Gedanken; Du, meines Herzens Krönelein; Ach, weh mir unglückhaftem Mann, die mit den verwandten Liedern Opus 29, 2; 36, 2, 3; 37, 5; 43, 2, lauter glänzende Treffer bedeuten. Gleichfalls der Sphäre des Sinngedichts gehörten Dahns Mädchenblumen, Opus 22, an, vier unendlich reife, mit fesselnden Einzelheiten durchsetzte Gaben lyrischen Sprechgesangs. Ein wirklicher Vortragskünstler mit schöner Stimme kann mit dem ganzen Heft, wie es ist, einsichtigere Hörer in hohem Maß erfreun. Endlich schließen sich hier an Zwei Lieder, Opus 26, nach Lenau, »Frühlingsgedränge« und »O wärst du mein«, beide wirksam deklamiert; der Sangbarkeit steht der Text im Wege, beim ersten durch die Fülle der Silben, beim zweiten durch die des Inhalts. In dieser Vorliebe für Gedankenlyrik und für buchmäßig wertvolle Gedichte steht Strauß von Anbeginn seines Liederschaffens in starkem Gegensatz zu Brahms, der oft, wie bei seinem Liebling Daumer, das formloseste, ungeschickteste Stammeln vertonte, wenn ein Strom heißer Empfindung darin zu fühlen war. Hatte dieser Strom bei Brahms den entsprechenden der Melodie ausgelöst, dann war ihm die Wortbetonung im einzelnen zuweilen herzlich einerlei, während der, von Hause aus allgemein-künstlerisch hochgebildete Strauß stets mit einer gewissen Ängstlichkeit an der sprachlich genau entsprechenden musikalischen Wiedergabe hing. Der Sommer 1887 brachte die mit einfachen Mitteln große Farbenpracht entfaltende Violinsonate, Opus 18, von der oben schon im Zusammenhang die Rede war, das einzige Werk für Kammermusik und damit das letzte aus dem Geist Schumanns geborene, das er nach der Italienischen Fantasie noch schrieb. Es zeigte, wie fest der Einfluß dieser großen Persönlichkeit noch nach den Jahren des inneren Anschlusses an Brahms in ihm wurzelte. Auch die Bayreuther Vorstellungen besuchte er in diesem Sommer wieder.
Nur im fernsten Sinne von Schumann und nur in ganz mittelbarem von Wagner beeinflußt aber zeigt sich das eigentliche Ereignis jener Zeit, der Übergang zur reich- und freigegliederten einsätzigen Form mit deutender Überschrift, in der ersten Bearbeitung der »Tondichtung für großes Orchester« Macbeth, Opus 23. Im Januar 1888 schreibt Strauß an seinen Onkel Hörburger, daß er mit dieser symphonischen Dichtung einen ganz neuen Weg betreten; mit ihm und dem eben entworfenen Don Juan hoffe er seine eigene Bahn gefunden zu haben, zu der die Italienische Fantasie die Brücke war. Den Macbeth widmete er seinem Freund Ritter. Erst im August des Jahres machte Strauß einen eindringlichen brieflichen Versuch, bei seinem Meister Bülow für den neu eingeschlagenen Weg Verständnis zu finden. Er schreibt unter anderem: »Eine Anknüpfung an den Beethoven der Coriolan-, Egmont-Leonore III-Ouvertüre, der Les Adieux, überhaupt an den letzten Beethoven, dessen gesamte Schöpfungen nach meiner Ansicht ohne poetischen Vorwurf wohl unmöglich entstanden wären, scheint mir das einzige, worin eine Zeitlang eine selbständige Fortentwicklung unserer Instrumentalmusik noch möglich ist. – Ich sehe nicht ein, warum wir uns, bevor wir unsere Kraft erprobt haben, die Kunst vielleicht einen kleinen Schritt vorwärts zu bringen, sofort in das Epigonentum hineinreden sollen; wenn's nichts geworden ist – na: dann halte ich es immer noch für besser, nach seiner wahren künstlerischen Überzeugung vielleicht auf einem Irrwege etwas Falsches, als auf der alten, ausgetretenen Landstraße etwas Überflüssiges gesagt zu haben.« – Offenbar von Liszts großem Gedanken beeinflußt, der Inhalt müsse sich bei jedem Tonwerk seine Form selbst schaffen, kommt Strauß zum Wesentlichsten seiner Anschauung: »Will man nun ein in Stimmung und konsequentem Aufbau einheitliches Kunstwerk schaffen und soll dasselbe auf den Zuhörer plastisch einwirken, so muß das, was der Autor sagen wollte, auch plastisch vor seinem geistigen Auge geschwebt haben. Dies ist nur möglich infolge der Befruchtung durch eine poetische Idee, mag dieselbe nun als Programm dem Werke beigefügt werden oder nicht.« Diesem springenden Punkt für Straußens persönliche Kunst hat sich aber der Empfänger, Bülow, damals noch nicht erschlossen; denn er schrieb mit dem ihm wohl eben zur Hand liegenden Rotstift unter den Brief die Worte: »Theorie grau oder grün – aber Praxis heißt: schöne melodiöse Musik machen.« In dieser kurzen Bemerkung liegt der Kern des zeitweise hervorgetretenen Mißverständnisses zwischen beiden Künstlern. In der ersten, unveröffentlichten Bearbeitung schloß der Macbeth, diese erste der »Tondichtungen«, mit einem Triumphmarsch des Macduff in D-dur. Auf die Beanstandung Bülows, da die Tondichtung ja doch Macbeth darstelle, änderte dies der Tondichter. Zum Verständnis des in der furchtbaren Folgerichtigkeit seines Stimmungsgehalts großen Werkes sei auch hier die unmittelbare Hingabe an die Musik, im Gedanken an die Gesamtwirkung; einer vollendeten Macbeth-Vorstellung empfohlen. Ist doch das Werk der Niederschlag des Eindrucks einer prachtvollen Aufführung des Dramas Shakespeares durch die Meininger. Strauß hat in die Partitur nur an zwei Stellen Motivbezeichnungen eingetragen: nach den einleitenden fünf Takten auf der Dominante A und einer Pausenfermate das erste Motiv: »Macbeth«, das später nach dem in der edlen Gemessenheit schottischer Adelsweise gehaltenen Einzug des Königs unheimlich in den Baßinstrumenten erklingt:
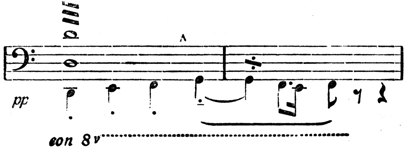
und bald nach dem Beginn das zweite Motiv: »Lady Macbeth«. Weitere Themen führen den Glanz kriegerischer Ehren ein, andere ein Ringen mit ruhelos wühlenden Mächten des Zweifels, Grauens und Strebens zum Entschluß. Ausdrucksvolle Kantilenen, die sich, aus den beiden Motiven entspringend, dazwischenmengen, deuten tiefe Liebesempfindungen als Triebfedern des furchtbaren Spiels an. Tragisch erschütternd wirkt das nach höchstem Glanz gegen den Schluß hin ersterbende Macbethmotiv, wonach ein rasches Crescendo in wenigen Takten zum abschließenden Fortissimoschlag führt. Die nahezu gänzliche Vernachlässigung des gewaltigen eindrucksicheren Werks mit seinem in den Farben äußerer Pracht auftretenden ungemischten Ernst gehört zu den vielen und großen Gedankenlosigkeiten unseres Konzertspielplans.
Auf diese erste Bearbeitung des Macbeth folgte sogleich eine zweite Tondichtung, Don Juan, Werk 20, nach dem Epos Lenaus. Hier treten alle die Eigenschaften, die bis einschließlich der Domestika dem Stil dieser Gebilde aus Straußens Feder eigen sind, in jener glanzvollen Art in die Erscheinung, die sie meist bis heute zu Lieblingsstücken erster Orchesterkonzerte macht: die feinlinige in ihrer lebensvollen, von jeder, bei den früheren Romantikern so oft bemerkbaren, Beharrlichkeit und Schwerbeweglichkeit befreiten beflügelten Rhythmik, die mit neuen Mitteln musikalisch-dichterischer Vorstellung arbeitende kecke Kontrapunktik im Zusammentreffen, Über- und Durcheinanderwegschreiten der Melodienzüge, die leichtbeschwingte Schlankheit der Satzform, in der jede etwa mögliche Gefahr der Umständlichkeit und Absichtlichkeit thematischer Durchführung in weitgeschwungenem Bogen umgangen wird, der mitreißende Wechsel von Neben- und Nacheinander des harmonischen und motivischen Gehalts, das Feuer des Temperaments, in dem scheinbar Unverträgliches zusammenglüht, alles in der eingebungsvollen Vielstimmigkeit einer eindringlichen und kühnen Instrumentation. Im Don Juan genügt es zum Verständnis, sich von den der Partitur vorgesetzten Versen die zwei Zeilen zu merken:
»Hinaus und fort nach immer neuen Siegen
Solang der Jugend Feuerpulse fliegen!«,
und zu beachten, daß alle die teils kurzen, teils ausgeführten Seitenthemen Frauen und ihre Liebe andeuten, die Don Juan genießt, wobei zwischendurch ein in Halbtönen absteigendes Motiv deutlich Überdruß und Unbefriedigung malt, endlich daß das zweite, mit dem Oktavensprung beginnende, im Notenbeispiel unten gegebene Hauptthema ein weiteres: »Zu neuen Siegen!« anstimmt, und mitten in deren Taumel das »Solang« der zweiten Zeile sich verhängnisvoll geltend macht – die Feuerpulse erlahmen, das Ende ist da. In der Tonsprache seines Don Juan hat Strauß zum erstenmal und endgültig gewisse Seiten seines Wesens als Orchesterdichter ausgedrückt. Das Überschäumen sprühendsten Lebenswillens tritt in feinst ausgearbeiteter Technik, Zartheit und höchster Sorgfalt zu ausgesprochener Eigenart zusammen. In der Form ist Don Juan klar, in freier Anlehnung an die Anordnung des Sonatensatzes gebaut. Ein stürmisch jubelndes Hauptthema in E; durch die Doppeldominante fis deutliche Überleitung zu dem ersten ausgeführten, ruhigeren Mittelthema in H. Dann Hauptthema mit frei eingeführten kurzen Entwicklungen; zweites ruhigeres Mittelthema in G. Nun tritt jenes zweite Don Juan-Hauptthema der Hörner in C ein, ein Motiv

von Beethovenscher Prägung. Nach alter Art behandelt, d. h. die ersten vier Takte wiederholt und mit kadenzierendem Schluß, würde es auch dem unbelehrtesten Hörer sofort eingehn. Ein kurzes Einschiebsel (Maskenspiel), dann wieder erstes Hauptthema in E, dem das zweite, gleichfalls in der Haupttonart E, folgt; reich modulierende Verbindung beider bis zu einem Höhepunkt der Kraftentfaltung. Dann plötzlich Pause, und durch die lange pianissimo gehaltene Unterdominante a-moll eingeleitet, Ausklingen in der Haupttonart. Wie genau er alsbald auch die eigenen Werke ausarbeitete, zeigt die, freilich nur an der Hand der – kleinen oder großen – Partitur zu verfolgende Anweisung zum Don Juan, aus Weimar am 15. Januar 1890 geschrieben und auf Bülows ausdrücklichen Wunsch diesem zugestellt: Anf. Halbe 84, Buchst. C = 88, D 76, vor der H-dur-Melodie noch etwas ruhiger beginnend. Die ganze Gruppe bis sieben Takte vor G (Halbe 60) sehr rubato und mehr im Ausdruck als im Tempo steigern. Drei Takte vor G = 76, H = 84, K 92 beginnen L = 76, bei der Modulation vom 22. Takt nach M an sehr zu modifizieren, und vom 7. – 12. Takt nach N bis auf 69 zurückzugehn. A Tempo achtzehn Takte von O = 84 (aber sehr wuchtig), tempo giocoso nach T = 92. Vier Takte nach U 63, aber sehr bald ruhiger werdend. V = 72, Cc 100 beginnen. Acht Takte vor der Generalpause 84 beginnen. – Gleichzeitig bittet Strauß den Meister, zu veranlassen, »daß ja keine thematische Analyse, sondern nur die der 1. Partiturseite vorgedruckten Lenauschen Verse mit allen Gedankenstrichen« ins Programmbuch der Berliner Philharmonischen Konzerte komme. – Die Art, in der dies alles mit dem angedeuteten musikpoetischen Gehalt erfüllt ist, wird jeder leicht selbst herausfühlen, und bis heute zählt Don Juan neben dem folgenden, Tod und Verklärung, zu den in weitesten Kreisen des Konzertsaals »durchgedrungenen« Werken von Strauß. Die Uraufführung des Don Juan wie die des Macbeth erfolgte erst später in Wien.
Ungefähr gleichzeitig mit der inneren großen Wandlung von der rückschauenden Richtung des erstklassig Nachschaffenden nach der Seite des Fortschritts, der »Ausdrucksmusik« hin, beginnt auch in Straußens äußerem Leben eine neue Gestalt aufzutreten: des Helden spätere Gefährtin. Er ging Ende August 1887 auf Urlaub für drei Wochen nach Feldafing, eine Bahnstunde von München entfernt, zu seinem Onkel Georg Pschorr; hier lernte er die nur einige Dutzend Schritte entfernt auf der anderen Seite der Dorfstraße wohnende Familie des bayerischen Generals Adolf de Ahna kennen. Dieser, neben seiner Tätigkeit im Kriegsministerium ein geschulter Musikliebhaber, der seinen weichen und kraftvollen Bariton noch zuweilen im kleinen Kreis, besonders in Wagnerpartien, hören ließ, war als Verehrer von Straußens Talent hocherfreut, ihn kennen zu lernen. Die ältere der beiden Töchter, Pauline, hatte die stimmliche Begabung des Vaters geerbt und ihre Lehrzeit als Opernsopran am Münchener Konservatorium mit dem Prüfungsvortrag der Agathenarie beschlossen, ohne noch den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen. Strauß erkannte die Ergiebigkeit ihrer Anlagen, und bald begannen unter seiner Leitung eingehende Vortragsübungen, während für Fertigstellung der Partien durch Korrepetitoren gesorgt wurde und auf seinen Wunsch Emilie Herzog die gesangstechnische Fortbildung, Frau Franziska Ritter, die Gattin Alexanders, die schauspielerische übernahm. Die Generalstochter, die den Gesang bisher immerhin in den Grenzen betrieben, die sie sich selbst gesetzt, mußte starke innere Wandlungen, bedeutende Steigerungen ihrer Anspannungskraft durchmachen, wenn Strauß, dieser großartige dramatische Lehrer, Wagner mit ihr durchnahm, unerbittlich auf dem scharflinigsten Ausdruck jedes Wortes und Tons bestehend, unermüdlich vormachend und Wiederholung fordernd, sobald ihm das Kleinste des Vortrags aus der Höhenlinie, der von ihm gewollten Steigerung bis zum Äußersten an Empfindung und Ausdruck zu sinken schien. Mit eiserner Macht riß sein Wille den ihren aus der Bequemlichkeit behaglich sinnvoller, formfreudiger Gesangsbetätigung. Rühmenswert tapfer hat die Gefährtin, vorläufig noch Schülerin, bald Freundin, den Lebensweg ihres Helden lange Zeit tätig begleitet und als verständnisvolle Vermittlerin seiner Lieder zur Verbreitung seines Ruhms in der ganzen Musikwelt beigetragen. Und noch eine neue Triebkraft war zu alledem in sein Innenleben getreten. Die nebensächliche Bemerkung in einer kulturgeschichtlichen Abhandlung der Wiener Neuen Freien Presse über geheime künstlerisch-religiöse Orden in Österreich zur Bekämpfung der weltlichen Richtung des Minnesangs ließ in ihm den Stoff zu Guntram erstehen, der alsbald mit der inneren Gewalt eines Erlebnisses sich den in ihm selbst drängenden, durch Lesen philosophischer Werke genährten Gefühlsrichtungen verband. Bülow schreibt Mitte September 1887 aus Hamburg: »Sehr frappiert hat mich Ihre interessante Mitteilung, daß Sie mit einem ›Dramma lirico‹ umgehen. Ich vertraue Ihrer schöpferischen Jugendkraft, und wünsche Ihnen zum Gelingen den erforderlichen Grad künstlerischen – Somnambulismus.« Schon im Oktober schreibt Strauß an ihn: »Außerdem arbeite ich an der Fabrikation eines – erschrecken Sie nicht – selbsterfundenen, tragischen Originaltextes in 3 Akten.« Und Ende März 1888: »Einen vollständigen Entwurf meines Opernstoffes habe ich fertig. – Ritter hat er sogar sehr gefallen.«
Mehr als zwölf Jahre lang, von Ende 1889 bis ins Jahr 1902, stand Strauß in der Musikwelt wesentlich als Schöpfer der programmmäßigen Orchesterdichtungen da. Wenn auch er selbst, wie wir sehn werden, grundsätzlich die Unterscheidung von Programm- und anderer Musik ablehnt, so erfordert doch die erstere Gattung, die er auf eine neue Grundlage stellte, bei ihm näheres Eingehn. Zunächst ihr Verhältnis zu der seiner näheren Vorgänger, Mendelssohn, Saint-Saëns, Raff, die ja in ihrer Art und in ihrem Rahmen Vollendetes boten. Es ist mehr ein großer Sprung, als eine unmittelbar beim Gegebenen ansetzende Entwicklung zu erkennen. Mit der ausgedehnten Programmäßigkeit und dem viel reicheren motivischen Stoff in der von Takt zu Takt zu verfolgenden Darstellung der äußeren und inneren Erlebnisse seiner Helden, schon mit der Zeichnung seines Don Juan, war jene übersichtliche Geschlossenheit Früherer, die kaum über den aus zwei gegensätzlichen Themen gebildeten Symphoniesatz hinausging, nicht vereinbar. Noch Mendelssohn in seiner Sommernachtstraumouvertüre begnügte sich mit den beiden dichterischen Motiven der mondbeglänzten Zaubernacht und des derben Handwerkertums, wie Saint-Saëns mit irgendeinem geradlinig verlaufenden äußeren Vorgang oder Liszt mit einer knappen dichterischen Anführung. Ein Weitergehn über Berlioz ergibt sich durch das grundsätzlich Bestimmende der dichterischen Vorstellung für Strauß, während Berlioz diese bekanntlich nach Maßgabe des ursprünglichen musikalischen Einfalls beliebig umformt; den Fortschritt über Liszt bedeutet die starke Bereicherung, von Inhalt und Form, vor allem in der polyphonen Anlage. Es blieb nicht unbemerkt, daß überragende Gestalten »Helden« für Strauß den Vorwurf bilden. So in Macbeth, Tod und Verklärung, Don Juan, Don Quixote, Eulenspiegel, dieser als Beispiel der geistigen Erhebung über die Masse durch den Humor gedacht, endlich im Heldenleben der Künstler selbst. Daß das kein Zufall sein kann, und daß eine Trennung von Kunstwerk und Künstler im Urteil darüber unmöglich ist, versteht sich. Zugleich aber macht dieses Einleben in eine besonders geartete Persönlichkeit begreiflich, daß das Verständnis für die Allgemeinheit nicht leicht ist. Der Essener Musikverein und andere im Rheinland gaben kürzere der Tondichtungen manchmal in beiden Teilen eines Konzerts. Und beim Don Juan war es dort bemerkenswert, um wieviel der Beifall beim zweitenmal dichter einsetzte und länger anhielt, als eine Stunde vorher. – Was die Beziehungen der Musik zu dem dargestellten oder doch mindestens als Anregung für den Verfasser selbst in Betracht kommenden dichterischen Stoff betrifft, so hat Strauß selbst seinen Tondichtungen außer dem Titel für die Öffentlichkeit keine oder nur sehr spärliche Erläuterungen beigegeben, jedoch Freunden bereitwilligst die Anregung durch! Einzelheiten des Stoffes erläutert. Diese Freunde haben dann mit großer Genauigkeit alles von ihm Empfangene in den bekannten Musikführern niedergelegt. Die »Führer« schieben sich zwischen das Kunstwerk und den Genießenden, und das kann gut oder schlecht sein. Gewiß hatten sie zuerst das Verdienst, das Kothner-Urteil: »Ja, ich verstand gar nichts davon«, unmöglich zu machen; man konnte nicht vorgeben, in Werken, deren Aufbau und Thematik, jedermann billigst zugänglich, dort nachgewiesen war, nichts von Musik und von Gedankeninhalt zu finden. Wertvoll sind solche Erläuterungen schon, weil sie manchen Fingerzeig von Strauß selbst enthalten, den er später, des Erklärtwerdens müde, vielleicht nicht gegeben hätte. Doch kann die Hervorhebung des einzelnen Motivs bei einer grundsätzlich so verwickelten Schreibart für das Verständnis belanglos, ja hinderlich werden; sein inneres Leben gewinnt es erst für den, der sein Auftreten in den verschiedensten Abschattungen kennt. Und das ist eben nicht mit Dampfesschnelle in der Minute zu erreichen, die zur Aufnahme der einstimmigen Formel im »Führer« genügt. Anderseits braucht man gerade bei Strauß zum Verständnis sehr oft nichts als die deutliche Vorstellung des inneren Erlebens, der Empfindung, die er ausdrücken will; dann wird man seiner Musik von innen viel näher kommen, als selbst durch Auswendiglernen der im Vergleich zur lebendigen Wirkung des Ganzen doch unendlich armen Motivtafel von außen. Sie enthält sein dichterisches Musikschaffen so wenig, als etwa die Aufzählung der Instrumente die Wunder seiner Orchesterwirkung, oder manchmal beinahe als der Setzkasten das Wesen einer Dichtung. Selbst die sinnvoll beziehungsreichste Anwendung eines Motivs wirkt tiefer, wenn sie einem mit dem Reinmusikalischen des Werks schon vertrauten Hörer durch die Empfindung von selbst klar wird, als wenn man ihn rein verstandesmäßig darauf hinleitet. Es ist daher falsch, vom Anhören einer Aufführung ohne vorherige Beschäftigung mit dem Führer wie die Hexe im Faust zu sagen: »Wenn es der Mann unvorbereitet trinkt, so kann er, wißt ihr wohl, nicht eine Stunde leben.« Strauß selbst hat ja mit dem Erläutern gewöhnlich erst später dem Fragen der Freunde nachgegeben und hernach die Notwendigkeit der Führer oft genug verneint, selbst in bezug auf die mehr erzählenden Tondichtungen wie Don Juan, Eulenspiegel, Don Quixote. Bei diesem kann man allerdings in Verlegenheit kommen; da hier einige Stellen ohne Programm reinmusikalisch kaum verständlich sind. Das Verhältnis von dichterischem und musikalischem Gehalt der Tondichtungen erfordert ein näheres Eingehen, indem der Hörer auch hier nicht nur mit dem Ohr in die Wunderwelt der Schilderung wie der symphonischen Gestaltung dringen, sondern gerade die Darstellung äußerer Vorgänge im einzelnen genießen will. Die Gefahr, nicht zu wissen, »wo man ist« bedeutet eine gewisse Schwierigkeit, der selbst der Führer nur in Verbindung mit dem Klavierauszug abhilft. Der Vorgang des programmatischen Schaffens selbst aber ist durchaus verständlich, indem die meist durch Lesen gegebene Anregung von der Einbildungskraft des Musikers auf die ihr eigene Weise ausgearbeitet wird, wie es ja in der Instrumentalmusik bei Beethoven und Brahms so oft der Fall war. Daß Strauß über Auswahl und Zweckmäßigkeit der Mitteilungen hierüber nicht nach besonderen Grundsätzen vorging, sondern manches dem Zufall und den Freunden überließ, zeigt nur, daß mit der Niederschrift und Einübung des Werks die Sache wesentlich für ihn erledigt scheint, also eine echt künstlerische Zweckunbewußtheit. In diesem einheitlich entstandenen Gemisch von programmäßigen Anregungen und reinmusikalischen Einfällen gehen beim Schaffen wechselweise einmal diese, einmal jene voraus, ihr Genießen vom Hörer fordert daher eine gewisse Einstellung; ein Mindestmaß vom bloßen Zuhören, ob nicht etwas Gefälliges ans Ohr klinge, genügt nicht. Das Einzigartige im ganzen und einzelnen dieser für Strauß natürlichen zusammengesetzten Schaffensart entschädigt den Empfänglichen reich genug. Es ist also viel zu viel verallgemeinert, wenn man sagt, die Musik als bloß schildernde, als Tonmalerei, werde hier zur Dienerin dichterischer oder dinglicher Vorstellungen, also zur Kunst zweiten Ranges. Fragt man, ein wie großer Teil dieser »Programmusik« ohne Programm nicht mehr wertvoll und verständlich wäre, so handelt es sich meist nur um kurze Strecken, wie die Hammelherde und das Abtropfen der ins Wasser gefallenen Helden in Don Quixote. Und selbst da spielt die Musik mit ihren feinen thematischen Verästelungen nicht etwa gleichsam den Drehorgelmann, der auf die einzelnen Bilder nur hinzeigt. Ebensowenig will Strauß in Tönen bloße Gedankenreihen ausdrücken. Einen seiner Anhänger, Paul Riesenfeld, der Straußischer Musik aus Anlaß einer »Seelenanalyse« im 102. Band von »Nord und Süd« allzuviel Philosophisches untergeschoben, bat Strauß brieflich, doch festzuhalten, »daß er ganz und gar Musiker und immer wieder Musiker sei, für den alle ›Programme‹ nur Anregung zu neuen Formen sind, und nicht mehr«. Ein anderes Mal schreibt er über die Programmfrage aus Anlaß von Besprechungen der Sinfonia domestica an Oskar Bie, wie dieser in seinem Buch »Moderne Musik und Richard Strauß« berichtet: »Ist es nicht wunderschön, wenn es einem einfällt, die dichterische Idee zu verschweigen oder nur anzudeuten, als reuiger, in den Schoß der allein seligmachenden absoluten Musik (wissen Sie vielleicht, was absolute Musik ist? Ich nicht!) zurückkehrender Sohn gefeiert zu werden. Daß man nicht heute der und morgen ein anderer sein kann, sondern immer der sein muß, als der man vom lieben Gott erschaffen wurde, ist ein zu tiefsinniger Gedanke, als daß er im Gehirn eines Ästhetikers Platz hätte.« Man sieht hieraus, wie wenig Wert Strauß auf das rein Gedankliche in der Sache legt und wie unmittelbar sich sein musikalisch-schöpferisches Empfinden in den Tondichtungen auslebt. – Ein naheliegendes Mißverständnis war es, im bloßen Klangbild als solchem den künstlerischen Zweck der Orchesterdichtungen zu sehn. Der unerhörten Klangwirkung vieler Stellen konnte sich auch der Musik-Unbegabte nicht entziehen; durch sie entstand die einseitige, das Verständnis ausschließende Auffassung von Strauß als bloßem Farbenkünstler und Klangfarbenmischer. Schon das Auftauchen der Frage: Wenn Strauß so wunderherrliche Klänge schreiben kann, warum schreibt er oft so häßliche? kann den Denkenden belehren, daß der Klang an sich nicht das Maßgebende für ihn sein konnte. Die Frage greift also im Grund einzig zurück auf die Eigenart des Stoffs, dessen Wahl ja aber zum größten Teil unwillkürlich ist. In keinem Fall war, wie beim älteren echten Romantiker, dafür entscheidend, daß sich die Art dieses Stoffes mit einem besonders hohen Maß von Wohllaut vertrug. Wir verdanken Straußens eigener Feder eine scharfe Beleuchtung dieses Verhältnisses von Mittel und Ausdruck. Im Januar 1889 richtete er an den Musikkritiker Karl Wolff ein dankendes Schreiben über dessen verständnisvolle Besprechung der Fantasie »Aus Italien«, in dem er unter anderem äußert: »Bei der erschreckenden Urteils- und Verständnislosigkeit eines großen Teils der heutigen Männer der Feder lassen sich solche, wie auch ein f großer Teil des Publikums, durch vielleicht blendende, rein nebensächliche Äußerlichkeiten meines Werkes über den eigentlichen Inhalt desselben täuschen, ja übersehen ihn vollständig. Dieser besteht in Empfindungen beim Anblick der herrlichen Naturschönheiten Roms und Neapels, nicht Beschreibungen derselben – ein musikalischer Bädecker Süditaliens, bekam ich einmal zu lesen: – Es ist doch eigentlich zu lächerlich, einem heutigen Komponisten, dem sowohl die Klassiker, insbesondere der letzte Beethoven, als auch Wagner und Liszt Lehrmeister waren, zuzutrauen, daß er ein Werk von einer Länge von dreiviertel Stunden schreibt, um mit einigen pikanten Tonmalereien und glänzender Instrumentation, deren heutzutage beinahe jeder vorgeschrittene Konservatorist mächtig ist, prunken zu wollen. – Ausdruck ist unsere Kunst – und ein Musikwerk, das mir keinen wahrhaft poetischen Gehalt mitzuteilen hat, natürlich einen, der sich eben nur in Tönen wahrhaft darstellen, in Worten allenfalls andeuten, aber nur andeuten läßt, – ist für mich eben – alles andere – als Musik.« –
Daß die Mittel deren sich Strauß zum Ausdruck seines Empfindens in den Tondichtungen bediente, immer vielseitiger wurden, war in seiner ganzen Art und deren Werden tief begründet. Zum großen Instrumentator wurde er vermöge der natürlichen Anlage seiner ungewöhnlichen Klangvorstellung, die sich durch seine äußerst feine Klaviertechnik, das Violinspiel in Kammermusik und Orchester, die Vertrautheit mit mancherlei Instrumenten früh entwickelte. Das Waldhorn war ihm durch seinen Vater bekannt, der häufig zu Haus übte; Freunde spielten Viola, Cello, Flöte und Klarinette, außerdem hörte er Musik aller Art zum Partiturnachlesen. Ehe er nach Meiningen kam, 1885, hatte er schon eine ganze Reihe eigener Werke öffentlich gehört, und dort wurde er durch Bülow mit den Höchstanforderungen an Spiel- und Ausdruckstechnik vertraut, die ihm bei den Holzblasinstrumenten bald neben der des Horns die größten Bereicherungen verdankte. Dazu trug noch bei, daß Strauß, als er hierin schon in flottester Fahrt war, sich um die Bequemlichkeit der Griffe und sonstigen Ausführung nicht kümmerte, auch nicht, nachdem er sie längst eingehend kannte. In der ersten Klarinettenstimme der Salome z. B. brachte er später Figuren an, die zunächst unmöglich scheinen und nur durch sorgfältigstes Austüfteln des Klappenfingersatzes herauszubringen sind. Gerade dadurch, daß er seine nach Ausdruckswirkungen drängende Phantasie nicht durch die Vorstellung der Griffe band, konnte sie sich hier auf neuen Wegen so reich entfalten. In seinen »Tondichtungen« begann er gleich mit den dreifachen Holzbläsern, die er an der Lohengrinpartitur so liebte, und baute dann seinen Orchesterkörper in der Folge schrittweise immer mehr aus bis zu den neununddreißig Bläserstimmen der Elektra. Welch geschlossenen lebenden Körper eine Strauß-Partitur darstellt, und wie sehr darin die Ausdrucksnotwendigkeit und nicht etwa die Instrumentalanwendung das Bestimmende ist, zeigt jeder Versuch, eines der geforderten »exotischen« Instrumente durch den Notbehelf eines anderen zu ersetzen, In F. v. Hauseggers »Gedanken eines Schauenden« ist Seite 396 Strauß' briefliche Äußerung abgedruckt: »Wenn ich also neue Farben im Orchester entdeckt haben soll, was wahrscheinlich gar nicht der Fall ist, aber nehmen wir es einmal an, so muß doch das Bedürfnis vorausgegangen sein, mit diesen ›neuen Farben‹ etwas auszudrücken, was sich mit den alten Farben nicht sagen ließ, – wenn dies nicht der Fall ist, findet man nämlich diese sogenannten ›neuen Farben‹ gar nicht. Da heißt es: wer nicht sucht, der findet.« Wie wenig Strauß gerade als Reformator des Orchesterkörpers gelten will, bezeugt mancher Ausspruch von ihm, in dem er sich nur als Schüler Wagners fühlt. Einem Bewunderer seiner Salome-Instrumentierung entgegnete er, seinerseits etwas erstaunt auf die angezogenen Stellen eingehend, das habe doch im Grund »der alte Herr« schon eingeführt. Im gleichen Sinn spricht, wie ungemein bescheiden er in seiner Neuausgabe von Berlioz' Instrumentationslehre sich selbst behandelt. Von den hunderteinundfünfzig größeren Notenbeispielen sind nur acht seinen eigenen Partituren entnommen, drei aus Feuersnot und Domestika, je eine aus Tod und Verklärung, Eulenspiegel und Zarathustra. Der Bearbeiter von Berlioz kannte ja alle Teufeleien, er vermochte in einer Stunde hundert neue zu ersinnen und im Stimmzimmer ausproben zu lassen, wenn ihm ein einzigesmal um solche zu tun war. Auf seinen Kunstreisen konnte er kennenlernen, was Frankreich und Italien, zumal in den Bläserkapellen, vor uns voraus haben, und auch in Deutschland verwendet ja die Blasmusik Instrumente, die im Orchester wohl benutzbar wären. Die meisten dieser Möglichkeiten ließ Strauß auf sich beruhen, einfach, weil das, was er ausdrücken wollte, nicht in ihren Bereich fiel. Ebensosehr als der Orchesterklang, war für ihn die immer kühner und freier sich entfaltende Harmonik lediglich Ausdrucksmittel. Wenn er hierin in ungemein reichen Abstufungen und frei schaffender Gestaltungskraft den feinsten Unterschieden von Vorstellungen und Gefühlen folgt, spielt auch die schärfere Dissonanz eine gewisse Rolle, für die man das Fremdwort Kakophonie (Mißklang) geprägt hat. Man darf hier aber nicht jene Art der Dissonanz vergessen, deren Begriff seine Entstehung lediglich dem ungepflegten Klavieranschlag verdankt. Gerade unter den beim Lesen auffälligsten, in der Klangeinheit des Klaviers bei hartem Anschlag unerträglichen Straußischen Dissonanzen finden sich feinste orchestrale Wohlklänge, jener Art von Bereicherungen unseres harmonischen Vorstellens, deren erster und unübertroffener Meister Mozart war. Ein Beispiel aus der Domestika, Seite 34 des Auszugs für zwei Klaviere:
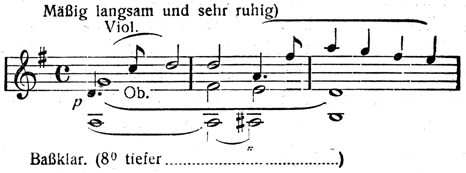
In dieser außerdem nur noch von akkordischen Achteltriolen der Klarinette als vierter Stimme ausgefüllten Stelle klingt das klare a der Violine traumhaft mit dem zwei Oktaven tieferen dumpf-weichen ais der Baßklarinette zusammen. Auch im Orchester hängt dabei unendlich viel von der Einstudierung und der technischen Fähigkeit besonders der Bläser ab. Von der gleichen Stelle kann man aus einer Stadt als dem Inbegriff ungeahnt berückenden Wohllauts, aus der anderen als eitel Ohrenschinderei berichten hören. In seltenen Fällen, wenn brutal Häßliches zu unterstreichen ist, wie in dem Zorn der Herodias über ihre Verunglimpfung durch Jochanaan, ist die Kakophonie als tatsächlicher kurzer Mißklang beabsichtigt. Ähnlich auch bei dem Ausbruch über die verständnislose Gleichgültigkeit der Umwelt im Heldenleben mit der Harmonieschrittkette

Seite 41 des zweihändigen Auszugs, achtmal nacheinander, zweimal um einen Halbton, fünfmal einen Ganzton steigend. In solchen Fällen erhebt, außer der dichterischen Idee, auch die strenge Folgerichtigkeit der Harmonieführung über den augenblicklichen körperlichen Gehörseindruck.
In rein musikalischer Hinsicht hat man an den Tondichtungen einen gewissen Mangel an Erfindung bemerken wollen. Es berührt freilich heute wie eine Sage, daß noch vor kurzem jene Männer in größerer Anzahl in Deutschland lebten, bei denen die ursprüngliche Erfindung, der melodische »Einfall« und damit die durch Kraft, Neuheit und Form bedeutende Zeichnung fast zur Regel, wie bei den Klassikern oder doch, wie bei Brahms, zu den Vorkommnissen gehörte. Das bedingte gerade den mächtigen Eindruck des letzten Teils von Tod und Verklärung, des Mittelsatzes im Don Juan und noch mehr den des Heldenlebens, daß darin im Verein mit Straußischer Eigenart ein Stück jener großen Zeit wiedergekehrt erschien. Im Heldenleben war das erste Allegro, das Ges-dur-Adagio; war der Schlußteil auch mit jenem Maß gemessen, groß, und hätten als Schöpfung jedes unserer teuren Verblichenen mit hohen Ehren bestanden. Sehr oft aber würde man auch im Gegenteil bei Strauß durch Anlegen des klassischen Maßstabs an die feingebaute Linie seiner Melodik hoher Werte verlustig gehn. In höherem Maß als bei den Alten ist es oft erst das Zusammenwirken aller Musikkräfte, Melodik, Harmonik, Rhythmik, Kontrapunktik, Dynamik und Instrumentation, im Zusammenhang mit der Stelle, an der eine gewisse Taktgruppe steht, die deren ganzen Wert für die Empfindung erklären. Einzig in der von vornherein äußerlich wie geistig polyphonen Anlage dieser Gesamtverbindungen, nicht mehr in der Erfindung des einzelnen Motivs, war eine Steigerung noch möglich. Ein flüchtiger Blick über die Geschichte der Tonkunst lehrt, daß die vom Laien meist ausschließlich so genannte »Melodie«, d. h. die in achttaktigen Perioden über der einfachen oder erweiterten Kadenz, den drei Grundakkorden einer Tonart, aufgebaute, im etwaigen zweiten Teil mit der Quinte beginnend, nur ein Sonderfall, nicht die Regel für die Gestaltung der Hauptstimme ist. Ihre zeitweise herrschende Stellung verdankte diese Art Melodie erst der durch die Neapolitanische Schule hindurchgegangenen Oper, und in ihr wieder nicht in letzter Linie deren kurzzeitigem Versbau. Vor dieser Zeit hat jahrhundertelang die edelste und feinste Kunst eines Giovanni Gabrieli, Lasso, Palestrina, Frescobaldi, Monteverdi, Caldara und zahlreicher anderer ohne ihren Zwang bestanden. Ja, das Madrigal verdankt der Abwesenheit dieses Zwangs gerade die feinsten Blüten seiner von der Liedform unterschiedenen Eigenart. Auch Bach kommt in seinen zartesten und großartigsten Werken vielfach ohne ihn aus, und mit den Ecksätzen von Beethovens Fünfter erhebt sich am mächtigsten wieder, wie in früheren Jahrhunderten, das kurze Motiv an sich zu einer umfassenden Geltung, in deren Bann wir heute noch stehn. Strauß verhält sich, was die über dem vollen harmonischen Gerüst ausgeführte »Melodie« betrifft, ganz ähnlich zu Wagner, wie dieser zu seinen großen Vorgängern; bei Wagner stellte sich diese eigentliche Melodie ziffernmäßig viel seltener ein als bei jenen, aber immer dann, wenn er sie brauchte, wenn sie sein Stoff zum Ausdruck dessen, wie er sich ihm dargestellt, forderte. Der Neuheitscharakter des »Einfalls« ist für die Höhenkunst nie allein der Maßstab des Kenners gewesen, eher auf anderen Gebieten, wo dann Offenbach, Gumbert, Sullivan, jeder in seiner Sonderart, Meister der Erfindung sind. Man betrachte dagegen einen der äußersten Höhepunkte künstlerischen Schaffens überhaupt, Beethovens letzte Quartette;, gewiß sind auch da »neue« Motive, aber meist spärlich und kurz. Die berühmte Cavatine in Opus 130 ist dort ein Ausnahmefall breiter Melodiebildung, und auch sie bildet die Kadenz nicht nach der Regel. In dem naheliegenden Vergleich mit großen Werken Älterer wurden auch die übrigen Bestandteile der Tonsetzkunst, thematische Arbeit und Kontrapunkt, mit herangezogen. Natürlich gilt für den letzteren im großen Orchester ein anderer Maßstab als z. B. im Quartettstil, dessen unendliche Feinheit sich dort schon im ganzen Ausdenken nicht einstellen kann. Jenen Beweis kontrapunktischer Erfindungsgabe, der im Satz einer wirkungsvollen Fuge liegt, gab Strauß u. a. in der, gegen den Schluß des angehängten Verzeichnisses der Jugendwerke zu besprechenden, a-moll-Fuge für Klavier, dem Fugato in Opus 3 Nr. 5, der Wissenschaftsfuge in Zarathustra, der Doppelfuge im Finale der Domestika, wie später in dem köstlichen Presto-Fugato in der Einleitung zum dritten Akt des Rosenkavalier. Die thematische Arbeit feiert im Eulenspiegel ihren verständlichsten Triumph, während sie in der Domestika durch innerliche, blühende Schönheit den Kenner entzückt. Einen Begriff von seiner Art, polyphon zu fühlen, gab Strauß in der Vorrede zu seiner Bearbeitung des Buchs von Berlioz, indem er das Geheimnis der Klangpoesie in Tristan, Meistersinger, Siegfriedidyll eben durch ihre polyphone Anlage erklärt, »während selbst die mit so großem Klangsinn aufgebauten Berliozschen Orchesterdramen, die Partituren Webers und Liszts an einer starken Sprödigkeit des Kolorits deutlich erkennen lassen, daß der Chor der Begleitungs- und Füllstimmen vom Tonsetzer nicht melodischer Selbständigkeit für würdig erachtet wurde, daher auch vom Dirigenten nicht zu der seelischen Teilnahme am Ganzen heranzuziehen ist, die zur gleichmäßigen Durchwärmung des gesamten Orchesterkörpers unbedingt nötig wäre«. Diese Stelle gibt eine treffliche Erklärung dafür, weshalb Strauß sein Empfinden nötigte, in den angeführten Partituren, selbst solche Nebenstimmen melodisch selbständig zu gestalten, bei denen man an ein genaues Heraushören aus der Klangmasse des Orchesters kaum denken kann. – Daß es bei einer durch das Programm als solcher gekennzeichneten Sonderkunst, die so ganz besondere Einstellung vom Hörer verlangt, nicht ohne Gegnerschaft abgehn konnte, ist klar. In Eduard Hanslick, fand sich ein witziges und nicht durch thematisches Verständnis beschwertes Haupt für den Kampf der Presse gegen die »Tondichtungen«.