
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
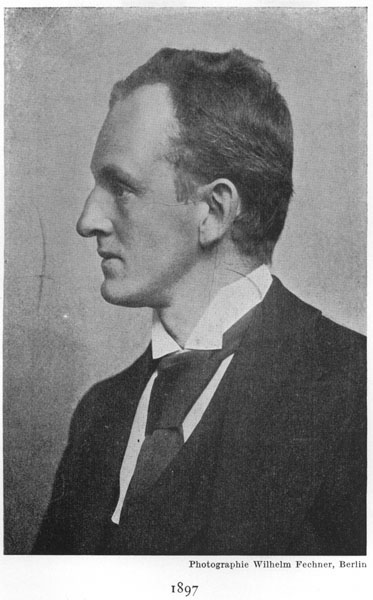
Schon Anfang 1890 erschien »Das Friedensfest« in der kurz vorher von Otto Brahm begründeten Wochenschrift »Freie Bühne für modernes Leben«. Im Juni ward es im Verein Freie Bühne als letzte Vorstellung des ersten Spieljahrs aufgeführt. Es geschah an einem hellen Sommertage der im größten Kontraste stand zu der trostlosen Winterstimmung des Dramas, das dem Publikum weniger Abscheu als Scheu einflößte. Bereits im November desselben Jahres las der Dichter in Charlottenburg sein drittes Drama vor. Es hieß mit einer Kakophonie im Titel »Einsame Menschen«. Ich hab es seither oft aufführen sehen; es sind hervorragende Schauspieler darin aufgetreten, der interessanteste war Ermete Zacconi; aber ich habe von dieser zarten Dichtung nie einen tiefern Eindruck empfangen als damals, da der Dichter selbst vorlas. Das Werk erschien zu Neujahr ebenfalls in der Zeitschrift Freie Bühne und kam auch sofort im Verein Freie Bühne zur ersten Aufführung. Durch dieses Stück eroberte sich Gerhart Hauptmann schon große, vornehme öffentliche Theater. Adolf L'Arronge ließ es, freilich um den mittelsten der fünf Akte schmählich verkürzt, im Deutschen Theater, Max Burckhard ließ es im Hofburgtheater zu Wien aufführen.
Wer vom »sozialen« Drama »Vor Sonnenaufgang« zu diesen »Familienkatastrophen« gelangt, hat das Gefühl, aus Feldern Hof und Garten ins Innere eines Hauses zu treten. Dort war die Familie des Bauern Krause ein Typus. Man sollte sich denken: wie bei Krauses, so geht es auch nebenan bei Müllers, drüben bei Meiers und hinterwärts bei Schulzes zu. Die vier Wände aber, in denen »das Friedensfest« begangen wird, die vier Wände, in denen »Einsame Menschen« leben, lieben und leiden, umschließen ein eigentümliches, absonderliches Menschenschicksal. Hier wie dort drängen sich im engen Raum nur wenige Personen, sechs oder acht, an, auf, gegeneinander. Gerade durch die Enge der Verhältnisse, durch Gleichartigkeit des Bluts bei Altersunterschieden entstehen Reibungen, Erbitterungen, Quälereien, die sich bis zur Unversöhnlichkeit, bis zur Verzweiflung steigern.
»Einfach furchtbar,« wie Doktor Schimmelpfennig von den Zuständen des Witzdorfer Bauernhofes sagte, sind auch im »Friedensfest« die Zustände der Familie Scholz.
Der Vater und die beiden Söhne haben sich jahrelang in der weiten Welt umhergetrieben. Sie konnten die Seelenlast, die sie an heimische Vorgänge drückend mahnt, nicht los werden. Zu Hause sitzen Mutter und Tochter. Beide quält die gleiche Last. Die Selbstqualen arten in Zank und Vorwurf aus. Jeder sucht im andern die Schuld. Jeder ist bereit, sich gegen den andern mit dem dritten und dann wieder gegen den dritten mit dem andern zu verbünden. Und doch gelingt es keinem, sich selbst ganz frei zu sprechen. Alle fünf verbeißen sich im Glauben an eine Schuld und fühlen nur dumpf, wie abhängig sie allesamt von heimlichen Gewalten sind, die in ihrem Fleisch und Blut leben, gegen die ihr Wille nicht ankann, in denen die Unabänderlichkeit ihrer Naturen besteht. So gewähren sie das Bild von Fliegen, die sich im Spinnennetz zu Schanden zappeln. Der sogenannte »gute Wille« zum Familienglück, zum Friedensfest lockt oft genug. Hier schüttelt der Bruder dem Bruder die Hand. Hier schließt der Vater den Sohn in seine Arme. Dort hängt die Tochter am Halse des Vaters, und bald von dem, bald von jenem wird Mutterchen gehätschelt. Aber immer wieder legt sich mit schwerem, unsichtbarem Druck eine Geisterhand auf diese langenden Seelen, und im Handumdrehen ist alles wieder beim schlimmen Alten. Unselige Menschen gehen hoffnungslos durch ihr Schicksal, das an ihre Familienart gebunden ist.
Der alte Vater ist schon nah am Ziel. Unverhofft kehrt er heim, um sich zu überzeugen, daß alles noch beim Selben ist, und unter dem Eindruck, Altes werde wieder neu, stirbt er. Die Mutter wird sich weiter durch ihr elendes Dasein quängeln, und in ihr beschränktes Gehirn wird sich die Frage: »Wer hat Schuld?« so lange einbohren, bis auch sie nicht mehr sich und andere umjammern kann. Der ältere Bruder geht verdrossen und zynisch an irgend ein gleichgültiges Tagesgeschäft. Er wird leben, weil er ohne Hoffnung und ohne Achtung vor sich selbst, ohne Glücksgefühl und ohne Glücksverlangen leben kann. Die Tochter, schon recht säuerlich, ein Geschöpf ohne Anmut des Körpers und der Seele, wird ganz versauern, und ihr dürftiges Herz wird den Trost finden: »Die andern hatten Schuld.« Von allen der Unglücklichste aber ist der jüngere Sohn. Denn er hat den freiesten Blick, das zarteste Gewissen. In ihm liegen Keime zum Glücklichsein und Glücklichmachen. Was in der Natur der Eltern Gutes war, hat sich auf ihn gesteigert vererbt: geniale Züge des Vaters, die musikalische Begabung und Neigung der Mutter. Aber eben darum, weil er feiner fühlt als die anderen, ist auf ihn die schlimmste Erbschaft gekommen. Ihn quälen und reuen knabenhafte Verirrungen zumeist. Er ist der Einzige, der sich zu einer Tat moralischer Empörung aufgerafft hatte, und auch diese Tat, edel in ihren Motiven, frevelhaft in ihrem Ziel, muß er bereuen: er züchtigte mit eigener Hand den Vater, weil dieser die Mutter beschimpft hatte. Gerade in ihm wiederholt sich das Wesen des Vaters. An der Vergangenheit des Vaters sieht er das Bild seiner eigenen Zukunft.
Es liegt in diesem jungen Menschen so viel zur schönen Entwicklung bereit, so viel, was nach Hilfe, nach Rettung ruft, daß es wunderbar wäre, wenn nicht auch Rettungsversuche angestellt würden. Zwei Frauenherzen sind ihm gut. Sie lieben sein zartes, feines, künstlerisch angelegtes Wesen; was dumpf auf ihm lastet, jenes Unheimlich-Heimliche glauben diese naiven Optimisten mit guten, sanften Händen wegstreicheln zu können. Er soll Frieden schließen mit den Seinen, dann wird alles wieder gut, wähnen diese lieben, weltunkundigen, in sich selbst zufriedenen Seelen. Mit milder Gewalt leiten sie ihn am Weihnachtsabend zum Friedensfest ins Elternhaus zurück. Aber ihre Nächstenliebe ist machtlos. Mit Entsetzen sieht die Frau, die dem Geliebten ihrer Tochter mehr als schwiegermütterlich zugetan ist, wie sich ihr treues, reines Kind in fremde Schicksale gefährlich verstrickt. Den zappelnden Fliegen im Spinngeweb flattert ein junges Libellchen zu. Die kleine Ida Buchner handelt anders als Alfred Loth. Sein männischer Egoismus ließ lieben lieben sein und ging bei Zeiten aus der Luft, die er für verseucht hielt. Idas weibliche Hingegebenheit hängt sich, je kränker sie ihn findet, desto inniger an den Liebsten; und in dieser Situation müssen wir am Totenbett des Vaters, dem der Sohn so ähnlich wird, das junge Paar verlassen. So wenig Hoffnung der Dichter gibt, so läßt er doch zuletzt die Frage offen, ob Idas starkem, demütigem Glauben an den Geliebten nicht doch das Rettungswerk glücken wird, das die kleinmütige Zweifelsucht der alten Mutter Scholz nie hat vollbringen können. Vater Scholz ist dem Verfolgungswahn erlegen: schon gaukeln die Gespenster dieser Erbschaft auch durch das Hirn des Sohnes. Wird es einer Frauenhand glücken, sie von dort zu verscheuchen? Der Dichter sagt weder Nein noch Ja.
Verneinen will er die Frage nicht, denn er traut der Frauenliebe viel zu und möchte hoffen. Bejahen kann er die Frage nicht, denn wenn heut und gestern bei sterblichen Menschen noch Glück und Friede war, wer kann wissen, ob nicht morgen schon die Gespenster wiederkehren. Die Menschenkenntnis moderner Seelendichter hält es mit dem alten Philosophen, der keinen vor seinem Tod glücklich pries. Wenn Hauptmanns »Friedensfest« zu seinem dritten Akt noch den oft begehrten vierten hätte, so müßte dieser vierte Akt auf alle Fälle mit dem Tod der beiden Liebenden schließen. Denn, wenn er »glücklich« schlösse, so wäre das Ganze eine »Komödie« gewesen, oder es bliebe die Gefahr bestehen, daß in einem fünften Akt das Glück doch wieder ein Ende hätte. In dieser Unsicherheit liegt bei solchen Familienkatastrophen von allem Tragischen das Tragischste. Kein noch so hoffender Blick in die Zukunft gibt die Gewähr, daß es immer so bleiben wird, und darum kann der Schluß jedes Dramas, das nicht mit dem Tode der Hauptbeteiligten endet, immer nur ein Abschluß des Vorhergegangenen, nicht ein Anfang des Kommenden sein.
Eine düstere und dicke Wolke liegt wie über den Vorgängen, so über den Gemütern in diesem Familiendrama. Der psychiatrische Eindruck waltet vor. Es ist kein Zufall, daß beinah in derselben Zeit, als er dieses Drama schrieb, der Dichter zugleich eine novellistische Studie aufzeichnete, die durchweg aus dem Psychologischen ins Psychiatrische übergreift und mit sicherer Hand das Wesen eines starken, eigenwilligen, aber schwer erkrankten Geistes gestaltet. Es ist auch kein Zufall, daß dieser »Apostel«, der skizzenhafte Vorläufer Emanuel Quints, gerade in Zürich seinem unvermeidlichen Schicksal, dem Irrenhaus, entgegengeht; denn Züricher Eindrücke, der Verkehr mit August Forel und seinen Schülern, haben Hauptmanns Interesse für anormale Geistes- und Seelenzustände gesteigert und durch Erfahrungen bereichert. Jener Apostel, der sich auch äußerlich vom Gros der Menschen unterscheiden will, der sich kleidet wie der Münchner Maler Diefenbach, der ein Gegner der animalischen Kost ist, der auch die Sitten und Gewohnheiten der Menschen auf den einfachsten und reinsten Zustand der Natur zurückführen will, sucht mit einer krankhaften, abnormen Begier das Natürliche und Gesunde, und je mehr er sich in diesem Streben von den Übrigen getrennt sieht, desto mehr wächst ihm das Selbstgefühl; er dünkt sich wie Jesus Christus; ihm ist vor seiner Gottähnlichkeit nicht mehr bange. Wie hier den Größenwahn, so hat der Dichter im »Friedensfest« die Kehrseite des Größenwahns, den Verfolgungswahn, geschildert, nicht wie dort in einem ausgeprägten, entwickelten klinischen Fall, sondern als das nahende Unglück, das, nur halb gefühlt und halb verstanden, wie eine gefürchtete Epidemie die Gemüter der Beteiligten umlauert.
Aus den psychiatrischen Abgründen steigt Gerhart Hauptmann in seinem nächsten Drama »Einsame Menschen« wieder zu der sogenannten normalen Gesundheit der Seelen empor. Aber so wenig wie die Natur in dieser monistischen Welt, so wenig gelangt auch der Dichter an das ideale Ziel solcher Normalität. Ein Nebelstreif aus jenem Abgrund hängt sich vor allem an die Gestalt des Helden dieser neuen Dichtung, des jungen Forschers Johannes Vockerat. Wie Helene Krause in »Vor Sonnenaufgang«, so endet auch er durch Selbstmord. Das Drama seines Lebens hat also den vielbegehrten »Schluß«. Haben auf »Das Friedensfest« in seiner strengern Orts- und Zeiteinheit, seiner festern Geschlossenheit, seiner Einheitlichkeit dumpfer, trüber Stimmung, der Unentrinnbarkeit seines Schicksals, der knechtischen Gebundenheit des menschlichen Willens, in seinem Fluch von Alters her Henrik Ibsens »Gespenster« eingewirkt, so stehen die »Einsamen Menschen« unter dem Einflusse von Ibsens »Rosmersholm«. Auch hier sind, wie in »Rosmersholm«, die Einheiten des Orts und der Zeit nur wenig gelockert. Aber es öffnet sich hier nicht, wie im »Friedensfest« und in den »Gespenstern«, bloß der eine schmale Schicksalspfad, der durch Nacht und Nebel notgedrungen beschritten werden muß. Wie in »Rosmersholm« so gibt es auch in den »Einsamen Menschen« eine reichere Fülle von Möglichkeiten. In diesen späteren Werken der Dichter ist das Leben farbiger und weiter geworden. Freilich ist eben darum die Entwicklung der Vorgänge nicht mehr so zwingend, nicht mehr so überzeugend wie dort. Ibsen wie Hauptmann haben das Motiv der Vererbung jetzt zurückgesetzt. Die Macht der Körperlichkeit wirkt nicht mehr so stark. Dafür treten erworbene geistige Mächte hindernd und verstrickend in den Weg. Nicht mehr Familienblut, sondern Familiengeist führt durch Konflikte zum tragischen Ausgang. Die Menschen scheinen in ihrer geistigen Freiheit nicht mehr nur Sklaven, sondern auch schon Schmiede ihres Schicksals zu sein, wenigstens Schmiedegesellen. Es geschieht kein plumpes Unrecht; es sind lauter gute und anständige Menschen, die hier einander quälen bis auf den Tod. Der Zwiespalt liegt weniger in den Charakteren als in der verschiedenen Auffassung des Lebens. Eltern und Kinder, Mann und Frau, ja sogar die beiden Rivalinnen haben einander von Herzen lieb, aber sie verstehen einander nicht. Und nur weil der durch Sohnespflichten, Gattenpflichten, Vaterpflichten an den engsten Daseinskreis gebundene Mann in seinen tiefsten Empfindungen und höchsten Ideen von einem fremden Mädchen gut verstanden wird, wächst ohne Rücksicht auf den Unterschied der Geschlechter eine Freundschaft auf, die dem kurzen Blick der andern verdächtiger scheint, als sie ist. Aber erst die Furcht vor der Gefahr beschwört die Gefahr herauf. Erst das Warnzeichen weist auf den Abgrund. Ein nur durch sich selbst erklärliches Seelenbündnis wird vor den allgemeinen Sittenkodex gestellt und verliert dadurch seine unbefangene Reinheit. Die Tugendwacht, die auch etwas Zionswacht ist, bläst Feurio, und erst dadurch, daß in die sanften Dämmerungen zweier Seelen ein grelles Licht getragen wird, steht alles in Flammen. Erst als das Herz vom Herzen weggezerrt wird, fangen diese Herzen an zu bluten, und das eine bricht. Aber alles, was so brutal, so blind lärmend, so heimtückisch wirkt, ist aufs Beste gemeint; Liebe wird vernichtet durch Liebe. Die Dichtung durchzittern dunkle Gewalten, die von Mensch zu Mensch herüberwirken, ohne böse Absicht, im besten Glauben, im Namen Gottes.
Der Schauplatz der »Einsamen Menschen« liegt von dem des »Friedensfestes« nicht weit ab. Spielte »Das Friedensfest« in einem imaginären Landhaus auf dem Schützenhügel bei Erkner, so spielen die »Einsamen Menschen« in einer Villa zu Friedrichshagen, wo damals die Bölsche und Wille, die Brüder Hart u.a. ihre zigeunerhaft leichten Zelte aufschlugen. Von der Veranda übersieht man den Müggelsee. Aus der Ferne hört man bei günstigem Wind das Läuten der Bahnhofsglocke, das Pfeifen des Zuges. Ein junger, begabter, nicht unbemittelter Naturforscher, Johannes Vockerat, hat sich in diese nervenstärkende Ländlichkeit zurückgezogen, um sein Erstlingswerk über psychophysische Probleme abzuschließen.
Dort draußen am Müggelsee gebar Frau Käte Vockerat den Stammhalter. Vockerats Eltern sind von ihrem Gut zur Taufe gekommen. Auch noch ein anderer Taufgast ist da, der Maler Braun, ein Studienfreund des jungen Vockerat. Kein größerer Gegensatz als zwischen ihm und den beiden Alten! Alle drei gute Seelen, stehen sie sich gegenüber wie »die liebe alte Zeit«, an die man sich lächelnd erinnert, und die Verdrießlichkeit des Augenblicks, den man just erlebt. Die Alten gehen in herrnhutischer Lebensweisheit und Lebensweise auf. Sie lieben die Welt um Gottes und Gott um der Welt willen. Ohne Muckerei, Starrheit und Duckmäuserei haben sie ihr »Vergnügen in Gott«. Sie beten und arbeiten und sind nicht ängstlich, auch mal auf einem dummen Witzchen oder sonstiger kleiner Weltlichkeit ertappt zu werden. Denn ihr lieber Gott ist ein leutseliger Herr, der den Gläubigen eins durch die Finger sieht: freilich – merk dir das Johannes – nur den Gläubigen!
Frisch, froh und fromm haben die alten Vockerats bei Gottes Wort und gutem Landschinken ihr einziges Kind erzogen, ihren Johannes. Aber dieser Knabe wuchs mit eigenem Sinn in eine neue Zeit und in neue Gedanken hinein. Von Geroks Palmblättern ging er zum Darwindeuter Haeckel. Und in derselben Sphäre, wo das harmlose Faultier Braun ohne viel Federlesens ein platter Gottesleugner wurde, rang sich Johannes Vockerat in peinvollem Seelenkampf den Glauben der Väter vom Herzblut weg. Er ward ein gewissenhafter Evolutionist und Monist, der sich auf seinem angenommenen Standpunkt noch nicht heimisch fühlt und darum desto hitziger streitet, je weniger er in sich selbst sicher ist. Die Wunde blutet fort, da er sein Weib nahm, ein indifferentes liebes Wesen, und sein Kind bekam. Auch jetzt, da er das Söhnchen nach dem Wunsche der Großeltern kirchlich taufen läßt, findet er zwischen Lebensgewohnheit und Weltanschauung keinen Ausgleich. Dieser Mangel an geistiger Überlegenheit und ethischer Freiheit verstimmt ihn selbst. Wie an seiner Stubenwand neben Priestern im Talar moderne Forscher hängen, so hängen in seiner Brust durcheinander anerzogene Gefühle und selbsterworbene Ansichten. Das macht den Reizbaren innerlich krank. Wer aber am tiefsten darunter leidet, ist die kleine, vom Wochenbett noch angegriffene Frau, die sich nur auf ihn stützt und mit der wankenden Stütze selber wankt.
Es ist Stickluft in dieser nur von guten Menschen bewohnten Stube. Wenn aber die Tür aufschlägt, wer weiß, ob der Zugwind beleben oder erkälten wird? Die Tür geht auf. Herein zieht im Herbstwind von ungefähr, wer weiß woher, ein fremder Gast. Fräulein Anna bleibt zum Gevatterschmaus, sie bleibt über Nacht, sie bleibt tagelang, wochenlang. Sie hilft der Mama Vockerat in Hausgeschäften, sie schließt mit Frau Käte Duzfreundschaft; mit Johannes rudert sie auf dem See, wandelt sie durch den Wald, durchprüft sie seine Arbeit, plaudert und diskutiert sie. Er fand endlich einen Widerhall seines Innern und ist glückselig. Nicht nur sein Geist, auch seine Nerven erfrischen sich. Sein Herz aber schweigt noch. Beide denken nichts Schlimmes. Es bleibt bei »Fräulein Anna« und »Herr Doktor« auch im Zwiegespräch und in der Dunkelstunde, bis zuletzt. Und als sie eines Tages merken, daß Braun in den Bart brümmelt, daß Mama Vockerat ihren ehrlichen Altweiberkopf schüttelt, daß Frau Käte sich härmt, daß »die Leute schon darüber reden«; daß Galeotto unterwegs ist – da sind sie schwer betroffen. Die Notwendigkeit einer Trennung zeigt ihnen erst, wie nah sie sich getreten sind. Und je angstvoller sies vor einander verbergen wollen, desto schmerzlicher brichts hervor. Der Mann wird reizbarer, launischer, ungemütlicher denn je; das Mädchen hält ihr tapferes Herz krampfhaft fest. Aber auch sie kann nicht hindern, daß sichs immer schwerer und immer dichter über ihnen wölkt. Sie vermag nicht ganz ihre stürmische Brust der Gattin des Freundes zu verschließen, und dem kurzsichtigen Kleinmut der guten Mutter zeigen sich sündhafte Gespenster. Aus dem unrechten Glauben sieht diese »alte erfahrene Frau« in der Befangenheit ihres Herzens unrechte Werke kommen; sie ruft sich ihren Mann zu Hilfe, und die das Unglück verhüten wollen, führen es herbei. Der Argwohn der andern erst bringt etwas Gefährliches in dieses Verhältnis. Aber Fräulein Anna geht nach einigem Zögern wirklich. Die Trennung besiegelt der erste und einzige, der »brüderliche« Kuß. Das Mädchen geht, woher sie kam, ins ungewisse Weite. Wird ihr starker Sinn überwinden? Wer weiß es? Ihr Wille war freier in der Einsamkeit ihrer Seele. Der Wille des Mannes dagegen war gebunden an Verhältnisse, die ihn mit dem stärksten Kitt, dem Herzen, halten: durch Eltern, Weib, Kind. So kommt er, äußerlich getrennt von der geliebten Freundin, innerlich getrennt von seinen Nächsten, gebrochen durch Sehnsucht und Elterngram, in eine Seelenverfassung, die ihn zum Selbstmord treibt. Er stürzt sich in den Müggelsee. War das, wie Papa Vockerat deuten wird, der unerforschliche Ratschluß eines strafenden Gottes? Oder war es, wie Anna in der Ferne denken wird, der zarte, vom Kampf der heiligsten Empfindungen zerriebene Lebensnerv, den keine Willenskraft, keine Willensfreiheit stählte? Der Dichter löst diese ewige Frage nicht; aber er zieht doch aus seinem Drama einen Schluß. Die kleine verlassene Frau, die Einfältigste von allen, hat plötzlich die klarste Vorstellung, wie es kam. Ihre reine Neigung zeigt ihr plötzlich alles deutlich. In ihrer Herzensangst um den Verlorenen, dem sie »nichts zu verzeihen hatte«, rafft sie sich zum erstenmal zu einer entschlossenen eignen Meinung auf und ruft, doch wohl mit des Dichters Stimme: »Mutter! Vater! Ihr habt ihn zum Äußersten getrieben! Warum habt Ihr das getan?« Der Vorwurf kommt zu spät. Johannes liegt draußen im See. In der Widmung des Buches erklärt Gerhart Hauptmann, er lege sein Drama in die Hände derjenigen, die es gelebt haben. Schon damit deutet er an, daß nicht alle, die es lebten, wie Johannes Vockerat, den Tod fanden. Die meisten kommen mit blauem Auge davon; denn die meisten trösten sich und überwinden, resignieren und kompromittieren. Aber unter Hunderten ist immer einer, der dran glauben muß, der die Schlußfolgerungen seines Schicksals zieht. Das ist dann, so individuell und besonders sich dieses Schicksal auch gestalten mag, der typische Fall, das von der Natur statuierte Exempel, die große einzige dichterische Eins, welche all die vielen Zufallsnullen der Wirklichkeit hinter sich her führt und ihnen erst den hohen Nennwert gibt. Auch der sogenannte Naturalismus, sofern er poetische Rechte besaß, mußte über die Nullen fort auf die große Eins losgehen. Das hat Gerhart Hauptmann von allem Anfang seiner steigenden Dichterkraft gefühlt und durch sein drittes Drama in freier Herrschaft über die natürliche Kunstform erreicht. In den »Einsamen Menschen«, aus dem Wiegenliede des kleinsten Vockerat, aus dem Abschiedsliede des fliehenden Mädchens konnte schon ein Ton der »Versunkenen Glocke« herausklingen. Die Empfindung, die dort im Wohllaut gebundener Worte üppig daherrauscht, tritt hier schlichter, reiner, näher, menschlicher ans Herz. Die Verse und Bilder des Märchendramas tragen den, dem sie sich einmal geneigt haben, leichtern Flugs über sich selbst empor. Viel schwerer scheint es, und von Zeit zu Zeit ist es verdienstvoller, das Gold der Poesie in der Sprache des Lebens, in den Wesenszügen der Nächsten, in den Schicksalen des Alltags zu finden. Das ist dem Dichter der »Versunkenen Glocke« in den »Einsamen Menschen« schon sechs Jahre früher geglückt. Ohne seinen Schritt metrisch zu beflügeln, trat er vor die Tür des eigenen Hauses, aufs eigene Gartenland, im Hausrock und ungespornt, und grub dort mit seinem Spaten das Schicksal ringender Menschen unseres Lebens ans Licht.
Hier wie dort, im Märchen wie im Leben, dasselbe Schicksal, aus ähnlichen Naturen geboren! Ein jüngerer Mann, der (Künstler oder Forscher) zu Höherem geistig aufstrebt, wird durch seine liebevolle, auch von ihm herzlich wieder geliebte Umgebung gewaltsam seinem Ziel entzogen. Seine Hausfrau bleibt nicht auch die Gefährtin seines seelischen Lebens. Ein anderes Frauenbild tritt an ihn heran, aus einer fremden Welt, und öffnet ihm die Augen für weitere Fernen. In der Berührung mit ihr fühlt er sich seinem Ideal entgegengewachsen. Wäre er frei, so würde sie vielleicht sein guter Engel. Dem Gebundenen aber, dem Verpflichteten, wird sie zum Dämon. Im Steigen, im Folgen stürzt er und geht zerrieben unter.
Wer von diesem gemeinsamen Grundmotiv aus das Märchendrama wie das Lebensdrama ansieht, für den wird das Lebensdrama viel gewinnen. Denn es ist leichter, an der Hand mythischer Überlieferungen störende Naturkräfte von außen her körperlich wirken zu lassen, als unsichtbare Mächte, die im eigenen Busen walten, nur aus ihrer inneren Seelenkraft heraus unkörperlich zur dramatischen Anschauung zu bringen. Sinnbilder, auch wenn sie einer Fabelwelt gehören, nehmen die Formen des menschlichen Leibes an und bringen so ihre eigene Plastik mit sich. Innere Zustände und Vorgänge der Seele, die dieses bequemeren Hilfsmittels entbehren, bedürfen einer feineren, zarteren Kunst, um verstanden und nachempfunden zu werden.
Die Gewissensqualen Heinrichs des Glockengießers werden uns sehr deutlich, wenn ihm Nickelmann im Traum erscheint, wenn die Seelchen seiner Kinder den Krug mit Mutters Tränen zu ihm heraufschleppen. Einen so wundervollen Zauber durfte der Dichter seinen beiden einsamen Menschen, der Züricher Studentin und dem Darwinisten, nicht aufbauen. Hier mußte er sich seine poetischen Stimmungsmittel aus der Alltagswirklichkeit holen, wo sie schwerer zu finden sind, weil sie gekettet tief im Grunde der Seelen liegen, und nicht schon die äußere Situation sie verklärt. Hier werden die Menschentränen nicht im Krüglein gesammelt und über Berg und Tal getragen. Man muß sie einzeln in ihrer Verlorenheit blinken und perlen sehen; aber wer auch nur eine einzige davon erlauscht und wehmütig einfängt, den dünkt sie das Poetischste von allem; poetisch wie Tropfen Tau im Grashalm.
Eine solche Tautropfenpoesie zittert und schimmert durch die »Einsamen Menschen«. Wenn Anna Mahr »das dünne Hälschen« der armen Frau Käte halb häßlich behöhnt, halb liebevoll vertröstet, und Kätchen der geistig überlegenen Rivalin antwortet: »Es hat nicht viel Gescheits zu tragen, Anna!«, wenn die unfrommen Arbeitsmenschen zwar die Wespe, aber nicht das Bienchen vom Frühstückstische scheuchen, so ist dies nicht minder poetisch als Rautendelein, das elbische Wesen.
In der dramatischen Konstruktion könnten hinter dem fest und knapp gefügten »Friedensfest« her die »Einsamen Menschen« als künstlerischer Rückschritt gelten. Wie unruhig und unwillkürlich in dem Friedrichshagener Gartenzimmer die Türen geöffnet und geschlossen werden, fiel mir am störendsten bei einer holländischen Vorstellung auf, wo die Sprache einige Schwierigkeit machte und durch das, was sich dem Ohr entzog, das Auge desto schärfer und achtsamer wurde. Ein Theaterroutinier, der auf Schlag und Gegenschlag sinnt, ist Gerhart Hauptmann nicht. Man schiebt das gewöhnlich auf Mangel an sogenannter Handlung. Auf diesen Vorwurf erwidert im Motto zum »Friedensfest« der Dichter selbst mit Worten Lessings aus dessen Abhandlung über die Fabel.
So wenig die moderne Ästhetik mit Recht auf Definitionen ausgeht, so sehr sie sich gerade durch die Mißachtung der Definition auch von Lessing unterscheidet, so möchte ich doch gegenüber dem Vorwurf der Handlungslosigkeit, der auch noch späteren Werken Hauptmanns gemacht worden ist, an Lessings Definition der poetischen Handlung nicht ganz vorübergehen. Handlung nennt Lessing »eine Folge von Veränderungen, die zusammen ein Ganzes ausmachen«. Zur Handlung genügt für Lessing nicht eine Veränderung, genügen nicht mehrere Veränderungen, die nur nebeneinander, sondern bloß solche Veränderungen, die aufeinander folgen. Wer von dieser Doktrin aus die beiden Familienkatastrophen Hauptmanns durchnimmt, wird finden, daß sie der Lessingischen Forderung entsprechen und im Sinne des großen Kritikers eine Handlung haben. Im »Friedensfest« das Erscheinen der Buchnerschen Familie, die unerwartete Rückkehr des Vaters, die Rückkehr des jüngeren Sohnes, die Abbitte dieses Sohnes und ihre seelische Einwirkung auf dessen physische Natur, die plötzlich aufwachende Sorge der Vaterliebe um das Leben dieses scheinbar gehaßten Kindes, das Heraufsteigen alter schlimmer Leidenschaften in allen, der durch die Aufregung darüber entstandene Schlaganfall und Tod des Vaters, der Eindruck, den dieser Tod auf die drei Kinder macht, alles das ist ein Ganzes, in welchem die Veränderungen nicht nur zeitlich und räumlich, sondern auch ursächlich aufeinanderfolgen. In den »Einsamen Menschen« fehlt es sogar an einer eigentlichen Vorgeschichte, wie sie im »Friedensfest« erst analytisch herausgewickelt wird. Das völlig unerwartete, zufällige Erscheinen des fremden Fräuleins wühlt alles auf, was verborgen lag und wandelt alles um, was gewesen ist. Die Dinge verändern sich stetig und unaufhaltsam. Eins folgt unmittelbar aus dem anderen. Wie weit ist beispielsweise der liebevolle, heitere Papa Vockerat des Taufschmauses vom streng strafenden Vater entfernt, dessen heiliger Eifer den Sohn vernichtet! Und doch zieht sich von einem zum andern innerhalb derselben Menschenseele eine Kette natürlicher Folgen.
An der von Hauptmann herangezogenen Stelle fragt Lessing: »Gibt es aber doch wohl Kunstrichter, welche einen noch engeren, und zwar so materiellen Begriff mit dem Worte Handlung verbinden, daß sie nirgends Handlung sehen, als wo die Körper so tätig sind, daß sie eine gewisse Veränderung des Raumes erfordern? Sie finden in keinem Trauerspiele Handlung, als wo der Liebhaber zu Füßen fällt, die Prinzessin ohnmächtig wird, die Helden sich balgen; und in keiner Fabel, als wo der Fuchs springt, der Wolf zerreißet und der Frosch die Maus sich an das Bein bindet. Es hat ihnen nie beifallen wollen, daß auch jeder innere Kampf von Leidenschaften, jede Folge von verschiedenen Gedanken, wo eine die andere aufhebt, eine Handlung sei; vielleicht weil sie viel zu mechanisch denken und fühlen, als daß sie sich irgendeiner Tätigkeit dabei bewußt wären. – Ernsthafter sie zu widerlegen, würde eine unnütze Mühe sein.«
Auch wir wollen uns diese Mühe nicht geben, alle jene Zweifel, ob Hauptmanns Werke: »wirkliche« Dramen, wirkliche »Theaterstücke« seien, ernsthaft zu widerlegen. Aber mit dem vieldeutigen Wort Handlung wird soviel Mißbrauch getrieben, daß ich darauf hinweisen will, wie wenig es in Hauptmanns beiden Familiendramen auch an jenen äußern »Veränderungen des Raumes« fehlt, die für Lessing durchaus keine Vorbedingung einer Handlung waren. Man denke z.B. an die Szene im »Friedensfest«, wo Robert Scholz unter dem Weihnachtsbaum Idas Geschenk zurückweist, und sein Bruder, der diese Verlegenheit für Gefühlsroheit hält, wütend auf ihn losfahren will. Man denke an die Szene in den »Einsamen Menschen«, wo Johannes nach dem Abschied vom Fräulein zum See läuft, dann wiederkehrt, die Scheideworte schreibt und ins Boot rennt, den Tod zu suchen. Solcher äußerlich, räumlich, »materiell« bewegten Szenen gibt es in beiden Stücken genug. Aber darauf kann es bloß denen ankommen, die »mechanisch« denken und fühlen und von dem »inneren Kampf der Leidenschaften«, der in beiden Stücken tobt, nichts merken. Wer von diesem Kampfe nicht ergriffen wird, den wird »Das Friedensfest« peinigen, den werden die »Einsamen Menschen«, die allerdings von technisch unbeholfenen Retardationen und Wiederholungen nicht frei sind, ermüden. Die »Einsamen Menschen« sind oft und in verschiedenen Sprachen gegeben worden. Aber zu einer großen literarischen Tat sind auch sie noch nicht geworden. Das blieb dem nächsten Werke Gerhart Hauptmanns vorbehalten, das wie kein anderes zuvor aus den starken Wurzeln seiner Kraft entstanden ist.