
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
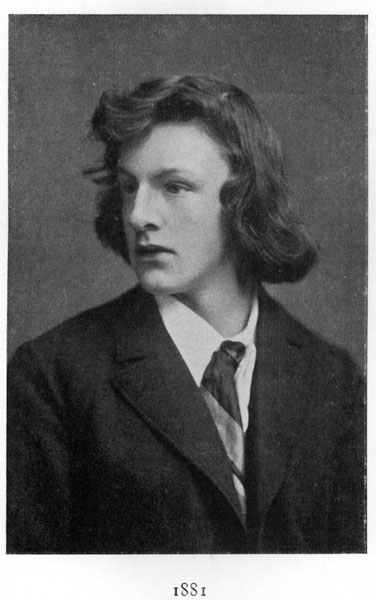
In Rom hatte den werdenden Dichter die große Vergangenheit der Stadt beschäftigt. Er vertiefte sich in Rankes Geschichte der Päpste und befaßte sich auch mit der klassischen Zeit. Es entstand in G. A. Bürgers Balladenton ein Gedicht auf »den Tod des Gracchus«, das schon vom sozialen Mitleid für die Mühseligen und Beladenen erfüllt ist, aber auch das tragische Ende des revolutionären Volksbeglückers bringt, den sein feiges Volk im Stiche läßt.
Auch Adolf Stahrs Rettung des Tiberius, die damals noch der Rede wert schien, fiel ihm in die Hand. Ein verkannter, zu Unrecht dem Haß und Abscheu der Menge ausgesetzter Held war der rechte Gegenstand für das Mitgefühl des Weltbeglückers. Er schrieb ein dramatisches Gedicht, »Das Erbe des Tiberius«. Es wurde von Hohenhaus am 25. Oktober 1884 an Adolf L'Arronge nach Berlin geschickt, damit er es im Deutschen Theater aufführe. L'Arronge und sein Dramaturg Moriz Ehrlich, der gedacht haben wird: »Schon wieder ein Tiberius«, lehnten ab. Trotzdem machte der junge Poet Anfang 1885 noch einen zweiten Versuch, die Bühne schon jetzt zu erobern. Er sandte die Handschrift Otto Devrient, an den er aus seiner Jenaer Studienzeit angenehme Erinnerungen hegte. Devrient hatte in Jena Vorlesungen über die Geschichte des Dramas gehalten, wobei er im Wesentlichen seine Rezitationskunst leuchten ließ; die Brüder Hauptmann bewunderten die Geschicklichkeit, mit der in bewegten Szenen die mannigfaltigsten Stimmen charakteristisch auseinandergehalten wurden. Den stärksten Eindruck machte auf sie die Vorlesung der »Frösche« des Aristophanes, die noch in Nickelmanns populär gewordenen Naturlauten nachwirkt. Auf diese etwas einseitige Beziehung hin wandte sich Gerhart mit seinem Tiberius an den Luthermann, der damals gerade die Direktion des Hoftheaters in Oldenburg angenommen hatte. Bei Devrient verschwand das Heft. Trotz Stahr und Hauptmann schien Tiberius rettungslos verloren zu sein. Nach Jahr und Tag aber kam er im Gewahrsam des Oldenburger Direktors doch wieder zum Vorschein. Unter mancherlei Belobigung lehnte Devrient die Aufführung ab, da in Ausdruck und Inhalt zuviel vorginge, was für ein Hoftheater nicht tauge. Seitdem ist Tiberius wirklich verschwunden. Devrient mag sich des Stückes kaum mehr entsonnen haben, als drei Jahre später, während seiner Episode im Berliner Hofschauspiel, nun wirklich ein Drama seines einstigen Zuhörers aufs Theater kam. Unter denen, die damals in Berlin am sittlichsten entrüstet waren, gehörte Direktor Devrient zu den allersittlichst Entrüsteten. Devrient ist in sein Grab gegangen, ohne zu ahnen, eine wie fruchtbare Erinnerung der verschmähte Sonnenaufgangsdichter an seine Vortragskunst bewahrt hat. An Nickelmanns Quorax und Breckeckex hätte er, im Gedanken an seine aristophanischen Frösche, Freude gehabt.
Und wenn er das Epos gelesen hätte, mit dem Gerhart Hauptmann zum erstenmal vor die Öffentlichkeit treten wollte, so hätte er in Stoff und Form auch noch keine Abweichung vom poetischen Brauch bemerkt, obgleich von diesem »Promethidenlos« Karl Bleibtreu verkündigte, daß es »an Größe der Konzeption, Adel und Schwung der Sprache das verkrüppelte Knieholz der üblichen Poetasterei titanenhaft überrage«. Der Dichter selbst dachte bald von dieser Byronimitation nicht so günstig. Er zog das Epos, kaum daß es (durch W. Ißleib, Berlin) im Sommer 1885 in den Buchhandel gekommen war, wieder zurück und ließ den Vorrat einstampfen.
Nach dieser vernichtenden Kritik des Dichters selbst steht uns kein Recht mehr zu, ihm metrische, prosodische und sonstige sprachliche Mängel der Erstgeburt tadelnd vorzuhalten. Das Ganze war locker, verschwimmend, formlos. Der Faden ließ sich leicht greifen, aber schwer festhalten. Es fehlte ein klarer Grundgedanke. Den magern Stoff für seine Ausgestaltung bot dem Dichter jene Seereise nach Italien. Im Meere spiegelt sich seine eigne Stimmung. Er legt sich die Maske eines knabenhaften Jünglings vor, den er Selin nennt. Vertauscht man die beiden Silben, so ergibt sich das Wort Insel. Bewußt oder unbewußt geheimniste der Dichter das Isolierte seines innern Wesens und Lebens hinein, jene seelische Einsamkeit, von der viele Jahre später sein Michael Kramer sagt: »Das Eigne, das Echte, Tiefe und Kräftige, das wird nur in Einsiedeleien geboren. Der Künstler ist immer der wahre Einsiedler.« Was diesen Selin vom Lande fort über die Meere treibt, waren des Dichters eigne Schmerzen. Was Selin an Bord und in den südlichen Küstenstädten erlebte, sind des Dichters eigne Reiseerinnerungen. Aber die äußern Erlebnisse sind dürftig. Noch nirgend geht der Dichter ins realistische Detail. Viel breiter und beredter entladen sich einzelne seelische Vorgänge des Reisenden. Der Einfluß des Childe Harold von Byron ist nicht nur in den Versmaßen, sondern auch im ganzen Stil, in Stimmung und Inhalt fühlbar. Nach alter Epikerweise ruft er die Muse an und den Zaubergeist des Traumes. Auch in der Wahl seiner Gleichnisse (Baumwuchs und Quellwasser) ist er wenig originell. Die Allegorie macht unklare Vorstellungen nicht klarer. Dichterisch stark aber ist die Begegnung des Jünglings mit einem jener Wesen, die am gütigsten dann sind, wenn sie selber vor dem Umgang mit sich warnen. Hier zerstreut sich die Achtzahl der Reimbündel zum tragischen Blankvers und nähert sich dem dramatischen Dialog. Fast scheint es, als habe sich hier das Überbleibsel einer Szene jenes gescheiterten Tiberiusdramas in den epischen Sang hereingeflüchtet. Und man wird ebenfalls an Tiberius denken dürfen, wenn im »Promethidenlos« (auch der römische Kaiser mag für Hauptmanns Auffassung ein »Promethide« gewesen sein) im geistigen Hinblick auf Rom die Vision eines »heimlichen Kaisers« empordämmert. Was dieser spricht, ist der dunkle, in jedem Sinn dunkle Grundtext der ganzen Jugendseelendichtung, durch die sich aber doch erkennbar im Seelenleben des jungen Dichters eine große, entscheidende Wandlung vollzieht: die Wandlung vom Mitleid mit sich selbst zu einem Mitleid mit der Menschheit, vom egoistischen zum altruistischen Weh, vom Seelenschmerz zum Weltweh. Nun findet der kummervoll Wandernde, der bisher bloß von sich selbst Gequälte, schon den Vorsatz, zu kämpfen, zu helfen, zu retten, zu befreien. Und seine Waffe sei das Lied:
Du lerntest lieben und du lerntest hassen,
Jetzt lerne, Jüngling, deine Laute fassen.
Kannst Du entsagen, Jüngling? Singe, dichte:
Das ist der Mut, den wir anjetzt bedürfen.
Die Dichter sind die Tränen der Geschichte,
Die heiße Zeiten mit Begierde schlürfen.
Aber erst 1888 ließ Hauptmann eine kleine Sammlung von Gedichten herstellen, die er » Das bunte Buch« nannte, und die in einem als Verlagsort fast unwahrscheinlichen Städtchen des Odenwalds ans Licht treten sollte. Als der Schriftsatz eben beendigt, aber das Druckpapier noch nicht angeschafft war, geriet der Verleger in Konkurs, und der Dichter erhielt von ihm nur eine lose Zusammenheftung der Korrekturbogen auf schlechtem Papier. Über diesen Mißhelligkeiten verlor er alle Lust am Werkchen und ließ den Schriftsatz ungenutzt wieder auseinandernehmen. Nur in ganz wenigen behutsamen Freundeshänden werden die vergilbenden Blätter dieses »Bunten Buchs« geheimnisvoll aufbewahrt. Manches allzu weichlich, allzu tränenselig geratene Gedicht verdiente sein Schicksal, vom eignen Autor totgedrückt zu werden. Anderes hat sich im öffentlichen Vortrage bewährt. Kleine Lyrika hat Robert Kahn in Musik gesetzt, und Amalie Joachim nahm diese Lieder in ihr Konzertprogramm auf. Auch in der Dichtung schon schwingen die sanften Verse wie Geigenakkorde. Eindrücke der äußeren Natur finden in kurzen, knappen, oft nur gestammelten, oft nur hingehauchten Lauten einen Widerhall im Gemüte des Dichters, der still seufzend beim Blätterfall durch die Herbstnacht wandelt oder im Dämmerlicht des Föhrenwalds vor einem Jünglingsgrabe weilt. Der Dichter vertieft sich in die Stimmungen der Selbstmörder, deren Geisterchor aus dem Grunewald gegen die nahe Riesenstadt, ihre Verderberin, flucht. Nacht, Nebel, Herbstwind, ein Schmetterling im Schnee, eine singende Lerche im Mondschein, schwache Hoffnungen auf Licht und Lenz, das »alles will zusammenstimmen in einen einzigen Sterbelaut«. In diese absterbenden Natureindrücke drängt sich manchmal eine unvermittelte literarische Reminiszenz ein. Ein kleines Lied, worin schon das Motiv der »Versunkenen Glocke« anschlägt, fängt mit einem Heinevers an:
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß meine Träne rinnt
Zuweilen, wenn ferne das Läuten
Der Glocke, der Glocke beginnt.
Ein Mondlied schließt goethisch:
Meine Seele, schlummerleer,
Wandelt durch die Nacht.
Das müde, sanfte Träumen wird visionärer, aufgeregter, wilder, wenn der Dichter aus Heideland und Föhrenwald ans Meer kommt, das in Gewittern steht. Man denkt an jenes rote Götterbildwerk aus dem Breslauer Atelier, wenn man liest:
Immer schneller und schneller
Jagen die Rosse der Flut;
Immer heller und heller
Bricht aus den Wolken die Glut.
Und man denkt zurück ans »Promethidenlos«, wenn man weiter liest:
Die alte Esche orgelt wild
Und sträubt ihr Blattgefieder,
Und um das dunkle Eiland brüllt
Das Meer Titanenlieder.
Titanenlieder, die kein Spott
Des Spötters kann bezwingen,
Titanenlieder, die kein Gott
Kann zum Verstummen bringen.
Selten nur wird die Natur durch einen Tierlaut belebt. Noch seltner schallt aus diesen Liedern neben des Dichters eignem Seelenton eine Menschenstimme. Beim leisen Sang des nordischen Fischerkinds, beim kühlen, bleichen Bernstein in ihren blonden Locken verliert der Jüngling die Korallenketten, die ihm einst aus dunklen Südlandslocken entgegenglühten. Ein andermal beklagt er in noch recht eckigen Versen Annas »tauschönes Bild«, das ihm nur ein Bild geblieben ist. Flotter, wilder, heißer, malerischer sind die kurzen Reimpaare, darin sich beim Hochzeitmahl ein Zigeuner der Braut des ungeliebten Mannes ins Herz fiedelt:
Auf leuchtet sein Auge,
Als sei es im Dunkel,
Und sengt mit Gefunkel
Den Busen der Braut.
Antwort fordert auch die Frage aller Fragen
Nie noch sah ich unsre Gottheit,
Die uns schützt und die uns führet,
Sage mir, wie denk ich jenen
Gott mir? Zeige mir den Gott!
»Hoch im Bergland von Arkadien« richtet sie der Frager an einen alten Priester des pelasgischen Zeus. Und die Antwort lautet:
Siehst du nicht, nun denn, so schweige!
Geh ins Tal und schweige, Jüngling.
Im Tal aber bilden sich die Menschen nach ihren eignen winzigen Vorstellungen ihre eignen winzigen Götterchen:
Und bald trug ein jeder sorglich
In der hohlen Hand sein Göttlein,
In der hohlen Hand nach Hause.
Hoch im Bergland von Arkadien aber geht der pelasgische Zeus und »fürchtet die neuen Götter nicht und zürnt nicht den Menschen«. Nur sein alter Priester hört ihn. Keiner sieht ihn.
Nachdem Gerhart Hauptmann sein »Buntes Buch« hatte vernichten lassen, beschäftigte ihn jener autobiographische Roman, den er 1888 in Zürich begonnen hatte. Berlin und Umgegend hatten Hauptmanns Kenntnis der Welt bereichert. In Zürich sah er das menschliche Leben wissenschaftlich durchforscht. So mochte er sich gerüstet fühlen, objektiver das Ich zu verstehen. Doch auch dieses Werk kam nicht zustande. Vieles daraus ist aber in den späteren Werken verwertet worden. Dieser totgesagte Roman scheint die Urzelle gewesen zu sein, aus der nun des Dichters lebendige Poesie entstand.