
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Zwei Warnungstafeln im Buche deutscher Geschichte. – Wien und Berlin. – Schiller und Napoleon. – Studien für den Tell. – Hegel. – Klopstock's, Herder's und Kant's Tod. – Anne Louise Germaine de Staël. – Der Tell vollendet und auf der Bühne. – Charakter des Gedichts. – Der Dichter am Trinktisch. – In der preußischen Hauptstadt. – Henriette Herz über Schiller. – Ein lockender Antrag. – Ablehnung. – Geburt einer zweiten Tochter. – Der Dichter als Mensch und Vater. – Groß und gut. – Die Huldigung der Künste. – Der letzte Winter. – Uebersetzung von Racine's Phädra. – Demetrius. – Letzte Lebenstage und Tod des Dichters. – Göthe's Schmerz. – Die Bestattung. – Die Trauer. – Lotte und Karoline. – Die Fürstengruft. – Die Apotheose. – Schluß.
Wenn zu Anfang des 19. Jahrhunderts von einer deutschen Geschichte überhaupt gesprochen werden kann, so war sie kaum etwas Anderes denn eine Chronik voll von Aergerniß und Beschämung. Beschöniger dürfte jene Periode nicht mehr viele finden, Lobpreiser keinen. Lehren voll düsterer Warnung hat sie in Fülle hinterlassen und von Beachtung oder Nichtbeachtung derselben wird ein gut Theil der Zukunft Deutschlands abhängen. Es stehen da zwei Warnungstafeln: Austerlitz und Jena, auf welche man nicht oft genug hinweisen kann. Nur Oestreich und Preußen kommen in Betracht. Was in den kleineren Staaten Gutes oder Schlimmes geschah, war auf die Weltstellung Deutschlands weiter von keinem Einfluß, und diese Kleinstaaten selbst erfüllten, als die Verhängnisse kamen, nur das unumgängliche Geschick der Schwäche, dem zuzufallen, welcher gerade der Stärkste war . . . . In Oestreich war Joseph's aufgeklärtem Despotismus, der zuletzt an sich selber hatte verzweifeln müssen, die Leopold-Franz'sche Reaction gefolgt. Die Thugut und Cobenzl regierten. Systematisch wurde Alles niedergetreten, was Joseph zu Gunsten einer höheren Geistesbildung gepflanzt hatte. Das Wüthen der Censur gegen alles Freie, Große, Schöne ging ins Abgeschmackte. Die Werke eines Lessing, Herder, Göthe, Schiller durften nur arg verstümmelt cursiren. Die Bühne war der Kotzebue'schen Schminke und Entnervung oder den rohen Kasperlespässen preisgegeben. Macbeth durfte nicht gespielt werden, damit sich das Publicum nicht an die Ermordung von Königen gewöhne; Lear nicht, damit man nicht glaube, Fürsten könnten im Unglück den Verstand einbüßen; Maria Stuart nicht, weil darin eine Anspielung auf Marie Antoinette liegen könnte; Egmont, Fiesco, Wallenstein nicht, weil sie revolutionäre Emotionen erregen, der Kaufmann von Venedig nicht, weil er einen Hepp-Hepp-Tumult veranlassen könnte. Aber selbst ein Kotzebue war nicht immer hinlänglich »gesinnungstüchtig«, d. h. seine Schurkencharaktere wurden degradirt: sie durften nicht über den Freiherrnstand hinaufgehen. Die Wiener Gesellschaft, ganz wieder auf das Gebiet der Sinnlichkeit hingewiesen, erschien damals fremden und einheimischen Beobachtern ebenso bildungslos als zuchtlos. Unwissenden Priestern überlassen, hatte die Erziehung der Jugend beklagenswertheste Resultate: dreizehnjährige Knaben spielten schon die Wüstlinge und durften sie spielen. Die Familienbande zerrissen, sogar die Frauen bei ihren Vergnügungen häufig alle Gesetze des Anstands, geschweige der Sitte, bei Seite setzend. Das Volk aller und jeder Ahnung vom Staatsbürgerthum entwöhnt, die Bureaukratie dumm, faul und feil, die Armee Leuten wie Mack anvertraut, die Finanzen in gränzenloser Unordnung: so schwankte der Staat den Katastrophen von Ulm und Austerlitz entgegen. Wie laut sprachen die Erfahrungen, welche Deutschland dem revolutionären und bonaparte'schen Frankreich gegenüber bisher gemacht hatte! Aber sie sprachen vergebens und umsonst bot ein Gentz, welcher damals den Lustbecher seines Epikuräerlebens noch nicht bis dahin geleert hatte, wo er auf dem Grunde desselben nur noch feile Blasirtheit vorfand, – umsonst bot er alle Logik und Beredtsamkeit seines Styls auf, um gegen die auf Deutschlands Vernichtung ausgehende Eroberungspolitik Napoleon's das einzig Rettende zuwegezubringen: einen festen und treuen Bund zwischen Oestreich und Preußen.
Man war mit Blindheit geschlagen, wie in Wien, so in Berlin. Wie dort eine aus blinder Angst grausame Gespensterfurcht vor den Ideen der Zeit, so beherrschte hier die unheilvolle Illusion, daß die Tage Friedrich's des Großen noch nicht vorüber seien, die entscheidenden Kreise. Preußen konnte nicht von der Höhe herabfallen, auf welche der große König es gehoben, – diese Idee war zu einer fixen geworden und sie galt noch, als Friedrich Wilhelm III. den Thron bestiegen hatte. In der musterhaften Häuslichkeit, welche der junge Monarch mit seiner Gemahlin darstellte, lag wenigstens ein preiswürdiger Gegensatz zu dem zügellosen Sittenverderbniß, welches damals in der preußischen Hauptstadt daheim war, ein Erbtheil der vorhergegangenen Regierung. Der König war wohlmeinend und er fühlte auch instinctmäßig, daß nicht nur Etwas, sondern Vieles im Staate faul sei. Aber sein Blick war lange nicht scharf genug, die fußdicke Schichte von Kanzleistaub zu durchdringen, womit bureaukratische Routine die Schäden bedeckte. Die Nachtheile der Regierungsweise Friedrich's des Großen machten sich jetzt erst recht geltend. In dem Schatten, welchen seine Größe geworfen, hatte keine Männersaat gedeihen können. Seine eifersüchtige Autokratie hatte die Heranbildung von staatsmännischen Charakteren eher verhindert als begünstigt. So konnte es geschehen, daß ein Dreiviertelsfranzos, den man an Frankreich, ein Italiener, den man mit ebenso gutem Grund an Rußland verkauft glaubte, und endlich ein Dritter, von welchem Lavater geurtheilt hatte, es sei ihm nie ein zweiter Mensch vorgekommen, welcher »hinter der Larve eines Christuskopfes so viel Immoralität verberge wie dieser,« in einer Zeit voll Gefahr mitsammen die Geschicke des preußischen Staates lenkten oder vielmehr gehen ließen, wie sie eben gehen wollten. Es herrschte hier keine unbedingte Verwerfung und Befehdung der zeitbewegenden Anschauungen, wie in Oestreich. Im Gegentheil, diese Anschauungen waren selbst in die privilegirten Stände eingedrungen und man ließ sich die politischen Ideen, welche die Aufklärungsperiode gereift hatte, wenigstens theoretisch gefallen. Ja, zur gleichen Zeit, wo das preußische Junkerthum seine bevorrechtete Stellung noch immer so anmaßlich und patzig zur Schau trug, daß in den bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen der Wunsch sich regte, die Junker möchten von den Franzosen recht tüchtige Schläge bekommen, zur gleichen Zeit tändelte man in den Berliner Salons mit demokratischen Gedanken. Auf der andern Seite charakterisirt es die allgemeine Unklarheit, Zerfahrenheit und Verblasenheit, daß ein großer Theil der Berliner Gesellschaft noch immer für Napoleon schwärmte, als dieser schon sich anschickte, den preußischen Staat zu zertrümmern. Allerdings gab es auch eine franzosenfeindliche Partei, welche von der Königin ihre Inspiration empfing. Aber weder wußten die Franzosenfeinde klar, was sie wollten, noch besaßen sie Festigkeit genug, das, was sie etwa wollten, zu thun, und so konnte das Haupt dieser Partei, der geistvolle Prinz Louis Ferdinand, dazu kommen, seine Kraft in Gelagen zu vertoben, mit Gesellschaftern wie Johannes von Müller, dessen »zerflossene Züge und stets wie mit Fett bestrichener Mund«Henriette Herz, a. a. O. 202. vortrefflich den Mann charakterisirten, welchen Napoleon vermittelst einer Audienz von zehn Minuten aus einem glühenden Hasser in einen glühenden Vergötterer verwandeln sollte. Zuletzt, nachdem der günstige Moment, im Bunde mit Oestreich dem Franzosenkaiser Widerstand entgegenzustellen, verpaßt war, wurde im Vertrauen auf Rußlands Freundschaft, welche dann im Friedensschluß von Tilsit recht klärlich zu Tage kommen sollte, die ewig zwischen Ordres und Contreordres schwankende Neutralitätspolitik aufgegeben und die Fiction von einem unbesiegbaren Friedrich'schen Preußen trat activ auf. Die Kokarde, die Fahne, der Zopf, der Puder, die Kamaschen, die junkerliche Fuchtelklinge, Alles war noch da wie in des großen Königs Tagen. Nur der Geist, der diese Dinge beseelt hatte, war todt, weil die Zeit inzwischen eine andere geworden. Lauter ausgelebte Formen, Schemen, hohler Spuk. Vom Podagra gelähmte Greise als Commandanten der Festungen, rathlose Invaliden an der Spitze der Armee, nirgends Plan, Einheit und Sicherheit in dem verrotteten Organismus, ein veraltetes Exercitium, der Soldat schlecht gekleidet, schlecht genährt, schlecht bewaffnet, schlecht geführt, und als nun der von einer genialen Hand geleitete Stoß auf dieses mumisirte Altpreußenthum bei Jena erfolgte, da brach der Golem, dem man das Zauberwort »Friedrich« umsonst auf die Stirne geschrieben, in sich zusammen und eine Zeit voll Elend und Schmach für Preußen, für Deutschland hob an . . . .
Schiller sollte das Unheil nicht mehr erleben. Dieser Schmerz wenigstens ist ihm erspart worden, das Vaterland in einer Erniedrigung zu sehen, welche die Insolenz französischer Generale ermuthigte, von deutschen Fürsten und Königen wie von Lakaien zu redenZu Anfang Oktobers 1806 beschied Napoleon den König von Würtemberg zu sich nach Würzburg. Ludwig von Wolzogen – damals in Diensten des Letzteren – erzählt in seinen Memoiren (S. 35): »Es kostete viel Mühe, in Würzburg ein Quartier für den König ausfindig zu machen, weil der Marschall Lannes das Haus, welches für den König bestimmt war und dem Geheimrath Seyffert gehörte, nicht räumen wollte. Als ich deshalb mit ihm zu unterhandeln beauftragt wurde, sagte er mir: ›ich solle zum Teufel gehen, mein Herr sei nur ein König, er aber ein Marschall.‹«. Er sollte es nicht erleben, daß nach dem Schicksalstag von Jena sein Beschützer und Freund, Karl August, weil derselbe seine Pflicht als deutscher Fürst und preußischer General brav gethan, ins Angesicht seiner Gemahlin, der Herzogin, von dem brutalen Eroberer »un fou«, »un mauvais sujet« gescholten wurdeIn jener trüben Stunde imponirte die gefaßte Würde der Herzogin Luise Napoleon so sehr, daß er unwillkürlich zu seiner Umgebung sagte: »Voilà une femme à laquelle nos deux cent canons n'ont pas pu faire peur.«. Aber in unserem Dichter lebte die prophetische Ahnung der heraneilenden Verhängnisse. Zur Zeit, als noch alle Welt von dem jungen Ruhm Bonaparte's berauscht war, als auch in Schiller's nächster Umgebung nur Stimmen des Beifalls über den Bändiger der Anarchie, über den Wiederhersteller der Monarchie in Frankreich laut wurden, da sagte er zu Karoline von Wolzogen: »Wenn ich mich nur für ihn interessiren könnte! Alles ist ja sonst todt – aber ich vermag's nicht; dieser Charakter ist mir durchaus zuwider – keine einzige heitere Aeußerung vernimmt man von ihm.« Der finstere Despotengeist in Napoleon also war es, was den Dichter anwiderte. Seine Seele hörte die Ketten klirren, womit der gewaltige Schlachtenmeister Europa bedrohte. Was die Völker dieser Alles verschlingenden Eroberungsgier, dieser schrecklichen Verzerrung der kosmopolitischen Idee gegenüber zu thun hätten, es hatte schon in der Jungfrau von Orleans prophetisch angeklungen. Jetzt, nachdem er durch die Braut von Messina den Forderungen reinidealer Künstlerschaft Genüge gethan, kehrte Schiller mit gereifter Kraft, mit geläutertem Enthusiasmus zu dem großen Problem zurück, von welchem all sein Denken und Dichten ausgegangen, – zu dem Problem sittlicher Menschenwürde und staatsbürgerlicher Freiheit. Mit dem Instinct des Genius hatte er im Wallenstein seine Nation auf ein ungeheures Kriegsspiel vorbereitet; jetzt schuf er den Tell, wie um ihr zu zeigen, daß und wie ein unterjochtes Volk sich befreien muß und kann. Sein Erstling, die Räubertragödie, war ein weltbürgerlicher Nothschrei gegen die Unfreiheit und Verkrüppelung des deutschen Lebens gewesen; sein letztes großes Gedicht war ein glorreiches Lied vom Vaterland. Das ist mehr als Zufall. Es ist der vorschauende Blick eines Propheten, welcher die Stadien der geschichtlichen Entwicklung zum Voraus durchläuft und hinter dem blutigen Wirrsal heranziehender Niederlagen schon die Siegesfahnen wehen sieht.
Unmittelbar nach Beendigung der Braut von Messina hatte der Dichter zu seiner »Erholung und um der theatralischen Novität willen« jene zwei Lustspiele, die sich unter den Titeln »der Parasit« und »der Neffe als Onkel« unter seinen Werken vorfinden, nach dem Französischen frei bearbeitet. Mit dem Tell beschäftigte er sich aber keineswegs erst nach seiner Heimkunft aus Lauchstädt im Sommer 1803 angelegentlich; denn schon unterm 9. September 1802 hatte er darüber ausführlich an Körner geschrieben. Es lief damals ein Gerücht um, Schiller habe einen Tell gedichtet, und von den Bühnen zu Hamburg und Berlin ergingen diesfällige Anfragen an den Dichter. Dadurch, berichtete er dem Freunde in Dresden, sei er aufmerksam geworden und habe Tschudi's Schweizerchronik zu studiren angefangen. Da sei ihm ein Licht aufgegangen, weil der treuherzige, herodotische, ja fast homerische Geist dieses Chronisten ihn poetisch gestimmt. »Ob nun gleich – fuhr er fort – der Tell einer dramatischen Behandlung nichts weniger als günstig scheint, da die Handlung dem Ort und der Zeit nach ganz zerstreut auseinander liegt, da sie großentheils eine Staatsaction ist und, das Märchen mit dem Hut und Apfel ausgenommen, der Darstellung widerstrebt, so habe ich doch bis jetzt so viel poetische Operationen damit vorgenommen, daß sie aus dem Historischen heraus und ins Poetische eingetreten ist. Uebrigens brauche ich dir nicht zu sagen, daß es eine verteufelte Aufgabe ist; denn wenn ich auch von allen Erwartungen, die das Publicum und das Zeitalter gerade zu diesem Stoffe mitbringt, wie billig abstrahire, so bleibt doch eine sehr hohe poetische Forderung zu erfüllen, weil hier ein ganzes localbedingtes Volk, ein ganzes und entferntes Zeitalter und, was die Hauptsache ist, ein ganz örtliches, ja beinahe individuelles und einziges Phänomen mit dem Charakter der höchsten Nothwendigkeit und Wahrheit soll zur Anschauung gebracht werden. Indeß stehen schon die Säulen des Gebäudes fest und ich hoffe einen soliden Bau zu Stande zu bringen.« Dieser Brief ist für die richtige Würdigung des Tell sehr wichtig. Man beachte insbesondere, daß der Dichter mit Bewußtsein darauf ausging, in seinem Drama »ein ganzes Volk« zur Anschauung zu bringen. Einer brieflichen Aeußerung Schiller's gegen Humboldt vom August 1803 zufolge war es eben die »Volksmäßigkeit« des Gegenstandes, welche den Dichter besonders reizte, keine Anstrengung zu scheuen, um den »widerstrebenden Stoff dennoch zu überwältigen.« Seine Studien zu diesem Zwecke waren umfassende und er bemühte sich so ziemlich um alle damals vorhandenen oder wenigstens für ihn zugänglichen Hülfsmittel, welche das Historische und Topographische des Gegenstandes ihm näher bringen konnten. So las er außer Tschudi auch Etterlin und Stumpf, dann Johannes von Müller, Scheuchzer und Ebel. Dazu kamen die landschaftlichen Schilderungen Göthe's, welcher ja, wie wir sahen, bei Gelegenheit seiner Schweizerreise von 1797 auf den Gedanken gekommen war, die Tellsage episch zu behandeln. Es scheint aber, daß Schiller ganz unabhängig davon die Idee zu seinem Drama gefaßt habe, und Göthe selbst bezeugt in seinen Jahresheften (1804), daß der Freund ihm »Nichts als die Anregung und eine lebendigere Anschauung,« nämlich von Land und Volk, schuldig sei. An der nämlichen Stelle bemerkt Göthe ausdrücklich, daß Schiller, loyal und zartfühlend wie immer, den Freund von seiner Absicht mit dem Tell sofort in Kenntniß gesetzt hatte.
Im Spätsommer und Herbst von 1803 machten sich die beiden Freunde angelegentlich damit zu thun, wie der Universität Jena wieder aufzuhelfen wäre, deren Glanz durch den Wegzug von Loder, Hufeland, Paulus und Schelling, wie durch den Tod von Batsch und die hoffnungslose Erkrankung Griesbach's sehr bedroht war. Göthe weilte damals viel in Jena und verkehrte häufig mit Hegel, an welchem er nur »Klarheit der Aeußerung« vermißte. Schiller meinte dazu, diese Klarheit dürfte dem Philosophen »schwerlich gegeben werden können, aber der Mangel an Darstellungsgabe sei ein deutscher Nationalfehler und compensire sich, wenigstens deutschen Zuhörern gegenüber, durch die deutsche Tugend der Gründlichkeit und des redlichen Ernstes.« Man sieht, der Dichter hat seinen philosophischen Landsmann richtig beurtheilt, insofern dieser in der That sein Lebenlang nie zur Klarheit des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks gelangen konnte. Aber es war doch gut, daß ein Mann wie Hegel in den Kreis unserer Geistesheroen eintrat, welcher sich gerade zu dieser Zeit bedeutend lichtete. Am 14. März 1803 war Klopstock gestorben und das kaufmännische Hamburg hatte noch mehr sich selbst als den großen Todten geehrt, indem es den Messiassänger mit allem Pomp zu Grabe brachte, über welchen ein republikanisches Gemeinwesen verfügen konnte. Niemals wieder ist ein deutscher Dichter so feierlich bestattet wordenDer authentische, von Dr. F. L. W. Meyer herrührende Bericht über Klopstock's prächtigen Leichenconduct ist mitgetheilt in Wehl's »Literaturleben Hamburgs im 18. Jahrhundert.«. Am 18. Dezember starb Herder, nachdem er noch den Romanzenkranz vom Cid seinem Volke als ein kostbares Vermächtniß gegeben hatte. Der arme Herder! Bei allen seinen großen Eigenschaften und Verdiensten ist er nie glücklich gewesen und wie eine herzzerreißende Klage über ein verfehltes Leben lautet es, wenn er nach der Lectüre von Trenck's Selbstbiographie in der letzten Zeit gegen Knebel äußerte: »Was will das heißen zehn Jahre an der Kette sitzen! Ich sitze dreißig daran.« Schiller blickte versöhnten Gemüthes auf das Grab des Gegners. »Hier ist – schrieb er am 5. Januar 1804 an seine Schwester Christophine – kürzlich Herder gestorben, was ein wahrer Verlust nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt ist.« Am 12. Februar des nämlichen Jahres verschied droben in Königsberg der achtzigjährige Kant und vertauschte seine stille Gartenwohnung mit der noch stilleren im Professorengewölbe neben der Domkirche. Ja, der Kreis der Heroen lichtete sich: nur vierzehn Monate später sollte dem großen Lehrer sein großer Schüler folgen.
Aber noch blühte diesem reich und voll das Dasein. Während er an seinem großen Volksdrama dichtete, war im Winter von 1803–4 die Weimarer Gesellschaft durch die Ankunft eines berühmten Gastes in ungewöhnliche Aufregung versetzt worden. Anne Louise Germaine de Staël, eines berühmten Vaters berühmtere Tochter, hatte sich durch Bücher, welche zusammen mit den gleichzeitigen Schriften Chateaubriand's für Frankreich eine neue literarische Epoche begründeten, einen Ruf erworben, der über die gewöhnliche Sphäre weiblicher Autorschaft weit hinausging. So insbesondere durch ihren Roman Delphine (1802). Aber die geniale Frau, durch den Gang der Revolution keineswegs zur Verzweiflung an ihren Idealen gebracht, wollte mehr als schreiben: sie wollte auch rathend und handelnd in die Wirklichkeit eingreifen, und als der Machthaber von Frankreich dies unbequem und störsam fand, spitzte sich ihr Enthusiasmus zu prickelnden Epigrammen zu. Allein weder für Enthusiasmus noch für constitutionelle Epigramme war in dem uniformen Mechanismus der Bonaparte'schen Tyrannis Raum. Der kühnen Dame ging ein Ausweisungsdecret zu und so kam sie, mit einem neuen Nimbus ausgestattet, als Verbannte nach Deutschland. Sie wollte die unfreiwillige Muße des Exils zu gründlichen Studien über das Land benützen, welches damals für die Franzosen noch geradezu eine terra ignota war. Sie hatte dunkle Sagen von deutscher Sitte, Art und Kunst, von deutschen Denkern und Dichtern vernommen und sie wollte sich nun das räthselhafte Land der Philosophie und Poesie näher ansehen. In Wahrheit, sie sah es näher, viel näher an, als bis dahin ein Franzos gethan hatte, und das Resultat ihrer Beobachtungen, das später (1810) erschienene berühmte Buch De l'Allemagne ist bei allen großen Irrungen und Fehlgriffen im Einzelnen doch im Ganzen als der erste ernstliche Versuch von französischer Seite anzuerkennen, den Deutschen gerecht zu werden und den Franzosen eine Vorstellung von Deutschland zu geben. Schon der Umstand zeugt glänzend für den Werth des Unternehmens, daß das Buch dem Napoleon, welcher ja mit cynischer Offenheit »die Vernichtung der deutschen Nationalität als die Hauptaufgabe seiner Politik« betrachtete, ein scharfer Dorn im Auge war. Natürlich hatte sich die Aufmerksamkeit der Staël insbesondere auf Weimar richten müssen und sie kam, von einer zweiten literarischen und politischen Notabilität ihres Landes, von Benjamin Constant begleitet, im Dezember 1803 daselbst an. Göthe, mit einem heftigen Katarrh von Jena zurückgekehrt, war in seine Stube gebannt und so hatte in der ersten Zeit ihres Aufenthalts Schiller die bei seiner Ungeübtheit in französischer Conversation doppelt schwierige Aufgabe, der berühmten Reisenden die Honneurs der Musenstadt zu machen. Frau von Staël hat von den deutschen Frauen gesagt: »Sie besitzen einen Reiz, der ihnen eigenthümlich ist, einen süßen Ton in ihrer Stimme, blonde Haare, einen blendenden Teint; sie sind bescheiden, ihre Gefühle sind wahr, ihr Benehmen ist einfach, ihre sorgfältige Erziehung und die ihnen natürliche Reinheit der Seele machen den Zauber, den sie ausüben.« Mit solchen Frauen zu verkehren war unser Dichter gewohnt und nun denke man sich ihn der »französischen Philosophin« gegenüber, welche, wie er unterm 4. Januar 1804 an Körner schrieb, »unter allen lebendigen Wesen, die ihm noch vorgekommen, das beweglichste, streitfertigste und redseligste war, eine unserm deutschen Wesen ganz entgegengesetzte, auf dem Gipfel französischer Kultur stehende, aus einer ganz andern Welt zu uns hergeschleuderte Erscheinung.« Aber sie zog ihn doch an und er, zu welchem die geniale Frau in einem ihrer Einladungsbillete sagte: »Vous qui êtes aussi simple dans vos manières qu'illustre par votre génie« . . . . er seinerseits erweckte seinem brüchigen Französisch zum Trotz in ihr bekanntlich eine begeisterte Sympathie. In einem Schreiben an Göthe vom 21. Dezember hat er so über sie geurtheilt: »Es ist Alles aus einem Stück und kein fremder pathologischer Zug an ihr. Dies macht, daß man sich trotz des immensen Abstandes der Naturen und Denkweisen vollkommen wohl bei ihr befindet, daß man Alles von ihr hören und ihr Alles sagen mag. Die französische Geistesbildung stellt sie rein und in einem höchst interessanten Lichte dar. In Allem, was wir Philosophie nennen, folglich in allen letzten und höchsten Instanzen, ist man mit ihr im Streit. Aber ihr Naturell und Gefühl ist besser als ihre Metaphysik und ihr schöner Verstand erhebt sich zu einem genialischen Vermögen. Sie will Alles erklären, einsehen, ausmessen, sie statuirt nichts Dunkles, Unzugängliches, und wohin sie nicht mit ihrer Fackel leuchten kann, da ist Nichts für sie vorhanden. Für das, was wir Poesie nennen, ist kein Sinn in ihr; sie kann sich von solchen Werken nur das Leidenschaftliche, Rednerische und Allgemeine zueignen; aber sie wird nichts Falsches schätzen, nur das Rechte nicht immer erkennenWas Schiller meinte, wenn er sagte, die Staël habe keinen Sinn für Poesie, wird durch Karoline v. Wolzogen commentirt, welche die Notiz gibt (Sch. L. II, 258), die berühmte Genferin habe bei jedem Dichtungswerke gefragt: »Quel en est le but?« d. h. sie hatte keine Idee davon, daß die Kunst Selbstzweck sein könne.. Die Klarheit, Entschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur können nur wohlthätig wirken. Das einzige Lästige ist die ganz ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Zunge; man muß sich ganz in ein Gehörorgan verwandeln, um ihr folgen zu können.« Göthe scheint sich in der Gesellschaft der lebhaften Dame weniger behagt zu haben als der Freund, dem sie doch auch mitunter »ganz unerträglich« wurde. Es mißfiel Jenem, daß sie, wie er sich an der bezüglichen Stelle der Jahreshefte ausdrückt, »Leidenschaft erregen wollte, gleichviel welche.« Ihr ganzes Wesen war ihm zu unruhig, zu springend, zu turbulent. Er ließ es ihr auch nicht hingehen, wenn sie sich Etwas gegen ihn herausnahm und sich über seine Schweigsamkeit moquirte. Bei einem Abendessen im Palais der Herzogin Amalia entfuhr im Hinblick auf die Zurückhaltung des Dichters der Staël die Aeußerung: »Ueberhaupt mag ich Göthe nicht, wenn er nicht eine Bouteille Champagner getrunken hat« – worauf der Dichter vernehmlich genug den Trumpf setzte: »Da müssen wir uns denn doch schon manchmal zusammen bespitzt haben.« Sehr beachtenswerth ist die Aeußerung Schiller's in seinem letzten Brief an Humboldt (vom 2. April 1805), Frau von Staël habe ihn »in seiner Deutschheit aufs Neue bestärkt.« Uebrigens wirkte die Anwesenheit der berühmten Schriftstellerin doch wie ein erfrischender Luftzug auf die Gesellschaft von Weimar, von wo sie gegen das Frühjahr zu nach Berlin ging, um den dortigen Damen zu zeigen, wie man einen literarischen Salon halten müsse.
Zu Anfang des Jahres 1804 war der Tell so weit gefördert, daß der erste Act in Reinschrift Göthe mitgetheilt und an Iffland nach Berlin geschickt werden konnte. Jener äußerte mit gewohntem Lakonismus: »Das ist denn freilich kein erster Act, sondern ein ganzes Stück und zwar ein fürtreffliches, wozu ich von Herzen Glück wünsche.« Iffland schrieb mit gewohntem Enthusiasmus: »Ich habe gelesen, verschlungen, meine Kniee gebogen, und mein Herz, meine Thränen, mein jagendes Blut haben Ihrem Geist, Ihrem Herzen mit Entzücken gehuldigt. O, bald, bald mehr! Welch ein Werk! Welche Fülle, Kraft, Blüthe und Allgewalt! Gott erhalte Sie! Amen.« Mit außerordentlicher Energie arbeitend vollendete Schiller, Krankheitsanfälle und sonstige Störungen überwindend, zwischen dem 16. und 19. Februar sein Drama. Sofort wurde mit Eifer an die Einstudirung gegangen und schon am 17. März beschritt der Tell die Weimarer Bühne. Unmittelbar darauf war große Noth im Hause des Dichters, indem Lotte und alle drei Kinder zugleich »an einer Art Keuchhusten mit Fieber« daniederlagen. Erst unterm 12. April konnte er dazu kommen, an Körner zu schreiben: »Der Tell hat auf dem Theater einen größeren Effect als meine anderen Stücke und die Vorstellung hat mir große Freude gemacht.« Zu Anfang Juli's ging das neue Drama auch in Berlin in Szene und Zelter schrieb darüber an Göthe: »Schiller's Tell ist mit sehr lebhaftem Beifall aufgenommen und seit acht Tagen schon drei Mal gespielt worden; der Apfel schmeckt uns nicht schlecht.« Er schmeckte überall gut. Man kann ohne Phrase sagen, daß das Prophetische, das Providentielle im Tell alle Gebildeten in Deutschland elektrisch berührte und auch die Ungebildeteren wie eine Ahnung von Schicksalsmächtigem durchschauerte. Unter solchem Eindruck wagte sich selbst die Nörgelei der Romantiker wenigstens nicht laut hervor und A. W. Schlegel meinte sogar, dieses nach seiner Ansicht »vortrefflichste« von Schiller's Werken, diese »herzerhebende« Dichtung sollte »im Angesichte von Tell's Kapelle, am Ufer des Vierwaldstättersee's, unter freiem Himmel, die Alpen zum Hintergrunde,« dargestellt werden.
Die historische Kritik hat sich mit der Sage vom Tell viel zu schaffen gemacht und heutzutage gilt für feststehend, daß dieselbe nur die locale Auszweigung eines über die ganze altgermanische Welt verbreiteten und sogar bis in den alten Orient hineinreichenden Mythus sei. Daß auch Schiller schon hinsichtlich des geschichtlichen Gehalts der Sage in keiner Täuschung befangen war, erhellt aus seiner oben berührten Bezeichnung der Geschichte vom Apfelschuß als eines Märchens. Den Dichter konnte das freilich weiter nicht berühren und es wäre für ihn von keinem Belang gewesen, wenn er gewußt hätte, daß in Uri selbst urkundlich nur ein einziger Anklang an den Namen Tell existirtIm Jahrzeitbuch zu Attinghusen, wo S. 14 zu lesen ist: »Richenza die hat gesetzt ein fiertel nussen von einem acherli dz heist tellingen ze Riphusen.« H. von Liebenau hat diese Stelle in seiner Abhandlung: »Die geschichtl. Ursachen der Entstehung einer schweizer. Eidgenossenschaft« (Neujahrsblatt aus der Urschweiz, 1857, S. 24, Num. 2) beigebracht. Tellingen heißt: »das Gut des Tell« oder vielmehr Tello, ein altalemannischer Name, welcher aber kein Geschlechts-, sondern ein Taufname war, so daß allerdings schon der Name »Wilhelm Tell« historische Bedenken erregen muß. – Die der Sage vom Tell analogen Schützenmythen finden sich bündig zusammengestellt bei Grimm, Deutsche Mythologie, 3. A. 353 fg. und 1214. Einläßliche kritische Untersuchungen der Tellssage haben bekanntlich Ideler (1836) und Häusser (1840) unternommen.. Es hätte seinen poetischen Plan auch nicht beeinflussen können, wenn ihm bekannt gewesen wäre, was jetzt bekannt ist, daß nämlich keineswegs »ein harmlos Volk von Hirten,« sondern vorwiegend der reichsfreie Adel der Waldstätte jene Eidgenossenschaft vom 1. August 1291 gestiftet, deren lateinisch geschriebener Originalbrief im Archiv von Schwyz verwahrt wird und aus welcher allmälig der Schweizerbund erwachsen ist. Das Wort Adel darf dabei freilich nicht im heutigen Sinne verstanden werden. Es waren die Gemeinfreien – (die Ingenui oder Liberi der altdeutschen Rechtsbücher) – der drei Waldstätte, welche jene Eidgenossenschaft gründeten und zwar in ganz diplomatisch-prosaischer Weise. Allerdings fällt damit noch nicht die historische Existenz des Rütlibundes, denn jenem Territorialbündniß konnte recht wohl ein Personalbündniß vorhergehen oder auch nachfolgen. Für Schiller war, den historischen Hintergrund seines dramatischen Gedichtes betreffend, die Hauptsache, daß er, und zwar ganz richtig, die Waldstätte als Reichsgebiete faßte, welche dynastischen Sonderinteressen und Gelüsten gegenüber zur Behauptung ihrer altherkömmlichen Reichsangehörigkeit und Reichsfreiheit sich verbanden. Es ist demnach die Idee des Rechts, des Reichsrechts, auf welcher das ganze Drama sich aufbaut, und denkwürdig, ja prophetisch auf die Zukunft weisend muß es genannt werden, daß unser Dichter gerade zur Zeit, wo der Name des deutschen Reiches von der Karte Europa's zu verschwinden im Begriffe war, die Reichsidee, d. h. die Idee der Einheit Deutschlands, dichterisch verklärte. Unter diesem Gesichtspunkte dürfte auch die vielgetadelte Episode vom Johann Parricida im Tell eine andere, d. h. ihre richtige Bedeutung gewinnen. Parricida, welcher aus dynastischer Selbstsucht zum Verräther und Mörder am Reichsoberhaupt geworden, konnte dem Tell, welcher die Hand gegen einen Brecher der Reichsgesetze, der sich durch seinen Frevel außerhalb des Reichsfriedens gestellt, erhoben hatte, nicht allein ein sittliches, sondern auch ein politisches Relief geben.
Gegen den Charakter von Schiller's Tell sind große Bedenken erhoben worden und als Heldencharakter läßt er sich auch wirklich nicht halten. Aber Schiller's Tell ist gar kein Held; vielmehr ist er so recht ein Privatmensch, ein Bauer, der sich bäuerisch schlau den Verhältnissen scheinbar fügt, um sie nach seinem Sinne zu wenden, und der auch seinen Feind nicht heldisch von Angesicht zu Angesicht, sondern bäuerisch pfiffig hinter dem Busche hervor angreift. Zu diesem bäuerischen Wesen stimmt dann freilich der berühmte sentimental-philosophische Monolog schlecht. Auf diesen, meine ich, passe es viel besser als auf die Einführung des Parricida, wenn Göthe am 16. März 1831 gegen Eckermann äußerte, Schiller habe bei Schaffung des Tell dem Einfluß der Frauen da und dort zu viel nachgegeben. Tell ist aber auch im Sinne der poetischen Technik nicht der Held des Stückes. Der wirkliche Held des Gedichtes ist das ganze Volk. Wenn man das festhält, so erledigt sich nicht nur der Tadel, das Drama ermangele der Einheit, sondern auch der weitere, die Episode von Rudenz und Bertha sei willkürlich und störend. Auch dem Adel, und zwar nach seinen verschiedenen Parteiansichten repräsentirt, gebührte eine Stelle in dem Drama, welches mit unvergleichlicher Kunst, wie es alle Nuancen des deutschen Volkscharakters veranschaulicht, so auch alle Volksclassen zu einer nationalen Handlung vereinigt. Ja, ein ganzes Volk ist der Held des Schauspiels, welches darum auch seinen sittlichen und dichterischen Höhepunkt in jener Rütliszene erreicht, deren einfacher Größe und herzbewegender Macht ich in alter und neuer Literatur Nichts an die Seite zu stellen wüßte. Selbst Göthe, dem doch gewiß keine demokratischen Sympathieen zugeschrieben werden können, hat die Darstellung der Landsgemeinde einen außerordentlich glücklichen Griff genannt. Hier weht der Geist echter, d. i. gesetzmäßiger Freiheit, hier hat Schiller's Republikanismus seine schönste Offenbarung gefunden. Da ist auch ein Stück Revolution, aber man beachte, romanisch-blinder Wütherei gegenüber, den durch und durch germanischen Charakter derselben. Die Männer vom Rütli sie stehen auf dem Boden des Rechtes, des Gesetzes. Diesen wollen sie behaupten, im Nothfall auch mit dem Schwert, gegen List wie gegen Gewalt. Jene berühmten Verse voll ewigen Gehalts, welche der Dichter mit feinstem Takte nicht etwa dem jugendlich brausenden Melchthal, sondern dem besonnen abwägenden Rechtsbodenmann Stauffacher in den Mund legt, jene Verse von den »ew'gen Rechten, die unzerbrechlich und unveräußerlich wie die Sterne selbst droben am Himmel hangen,« und vom letzten Mittel zu ihrer Behauptung, vom gegen Rechtsbruch und Willkür zu kehrenden Schwert, sie sind die deutsche Verkündigung der »Menschenrechte«. Von dem Realismus zu reden, womit unser Dichter den landschaftlichen Charakter der Oertlichkeit seines Drama's wiedergegeben, ist überflüssig. Kein Gebildeter deutscher Zunge fährt über den Vierwaldstättersee, steht auf der Rütlimatte oder steigt die Gotthardstraße hinan, ohne daß rings um ihn her jene Schilderungen lebendig würden, in welchen Schiller, der die Schweiz nie gesehen, vermöge einer ans Wunderbare gränzenden dichterischen Intuition die Größe und Schönheit der Alpenwelt in seinem heroischen Idyll vom Tell verherrlicht hat. Es ist da überall mehr als das bloße Bild, es ist mit diesem zugleich die Stimmung, die Seele der Landschaft gegeben. Endlich bedarf auch die hohe sprachliche Vollendung des Gedichtes, dessen Tonfall und Schmelz dem Gedächtniß schon so vieler Generationen sich eingeprägt hat, keines Lobes. Unser Dichter fand im Tell für Alles und Jedes in seiner Brust den entsprechenden Ton und sehr glücklich hat er passenden Ortes auch von dem volksmäßig Charakteristischen in unserem Sprachschatze Gebrauch zu machen verstanden.
Im vorletzten Winter seines Lebens, während er den Tell vollendete, scheint sich Schiller's Gesundheit ziemlich gut gehalten zu haben, weil er zu dieser Zeit häufiger als sonst an geselligen Zusammenkünften sich betheiligte. Heinrich Voß, des »Eutinischen Leuen« wohlgerathener Sohn, welcher damals eine Lehrstelle am Weimarer Gymnasium bekleidete, hat seine Erlebnisse im Winter von 1803–4 in einer Reihe von Briefen an seinen Freund Börm in Holstein geschildert. Darin spricht er auch viel von Schiller, dem »sanften und anmuthigen« Mann. »Ein paar mal – schrieb der junge Voß am 2. Mai 1804 – ging ich mit ihm spazieren, wo er ganz allerliebst war. Er spricht am liebsten über Gegenstände des gewöhnlichen Gesprächs, wenigstens dann, wann er, von seinen Geschäften ausruhend, Kräfte zu neuen Anstrengungen sammelt. Der Mann ist durchaus hingebender Natur, sanft und freundlich. Einmal habe ich ihn sehr kalt und einsylbig gesehen, als ihm im Café ein Jeder Complimente über seine Maria Stuart machte. Wer aber in ihm aus wahrer Neigung des Herzens den Menschen sucht, der ist ihm lieb und kann auf jede Auszeichnung rechnen.« Voß erzählt dann, daß er mit einigen Freunden den Dichter auf die Maskerade eingeladen habe, und »denke dir den freundlichen Mann, er folgte. Wir saßen in der Ecke dicht an dem Zimmer, wo die Farobank ist, und poculirten. Wir tranken laut seine Gesundheit und klingten an auf sein Wohlsein. Schiller ward so aufgeweckt, daß er sein Stück: »So leben wir« – intonirte, worüber sich einige Studenten, die zugegen waren, höchlichst verwunderten«Morgenblatt f. 1857, S. 630. Vgl. Weimarer Sonntagsblatt für 1857, S. 359 fg.. Da haben wir also unsern Dichter am Trinktisch und so mag gerade ein Wort über die früher weit verbreitete Sage, Schiller sei ein Trinker bis zum Uebermaß gewesen, hier eingeflochten werden. Die unlautere Quelle dieser Sage brauchen wir nicht aufzuspüren. Genug, am 18. Januar 1827 sagte Göthe zu Eckermann: »Schiller hat nie viel getrunken, er war sehr mäßig, aber in Augenblicken körperlicher Schwäche suchte er seine Kräfte durch etwas Liqueur oder ähnliches Spirituoses zu steigern.« Des Dichters Schwägerin ihrerseits bemerkt: »Beim fröhlichen Mahl im Kreise vertrauter, ihn ansprechender Menschen überließ er sich gern einem heitern, aber mäßigen Genusse des Weines. Das Unmaß floh er immer, da ihm, wie er sagte, ein Glas zu viel gleich den Kopf zerstöre. Beim Schreiben trank er nie Wein – (also directe Widerlegung eines weitverbreiteten Klatsches) – aber oft Kaffee, der ermunternd auf ihn wirkte. Wenn er sich einem Genusse überließ, so lag eine so unschuldige Fröhlichkeit in seiner Art zu genießen, daß man sich derselben mit erfreuen mußte, wie man sich an dem Genusse eines heitern, glücklichen Kindes ergötzt.« Es thut ordentlich wohl, zu vernehmen, daß es gerade den letzten Lebensjahren des Dichters an solchen Silberblicken von Glück und Wohlbehagen nicht gefehlt hat.
Seine schöpferische Kraft schien unermattet, schien der Ermattung gar nicht fähig zu sein. Kaum hatte er den letzten Federzug am Tell gethan, als ihn bereits wieder ein neues tragisches Thema beschäftigte. Schon am 10. März 1804 schrieb er in sein Notizenbuch: »Mich zum Demetrius entschlossen.« Da gab aber der gute Iffland, welcher den Dichter schon lange gern in Berlin gehabt hätte, keine Ruhe mehr»Iffland, der seine (Schiller's) Reise (nach Berlin) veranlaßte.« Karol, v. Wolzogen, Sch. L. II, 260. und Schiller machte sich mit Lotte und den zwei älteren Kindern am 26. April nach der preußischen Hauptstadt auf. Ueber Leipzig, Wittenberg und Potsdam erreichten die Reisenden am 1. Mai Berlin, wo dem Dichter »allgemeine Bewunderung, begeisterte Anerkennung und herzliche Theilnahme« entgegenkam. Er traf hier von alten Freunden Fichte, Woltmann, Hufeland, er verlebte »viele vergnügte Stunden« mit Zelter, er sah im Theater den Wallenstein, die Jungfrau und die Braut mit der höchsten szenischen Vollendung aufführen, welche Iffland's begeisterte Sorgfalt der Darstellung zu geben vermochte. Der Prinz Louis Ferdinand, der so bald darauf heldenhaft wie Max Piccolomini bei Saalfeld fallen sollte, zog den Dichter zur Tafel, die Königin Luise empfing ihn voll Huld. Ueber den edlen Eindruck, den seine Persönlichkeit bei Allen, die ihm nahekamen, hinterließ, hat uns aus jenen Tagen eine geistvolle Beobachterin, Henriette Herz, diesen Bericht gegeben: – »Schiller mußte auf die Mehrzahl der Menschen nothwendig einen angenehmeren Eindruck machen als Göthe. Die äußere Erscheinung sprach allerdings im ersten Augenblick mehr für den Letzteren; aber auch Schiller's Aeußere war jedenfalls bedeutend. Er war von hohem Wuchse, das Profil des oberen Theils seines Gesichtes war sehr edel. Aber seine bleiche Farbe und das röthliche Haar störten einigermaßen den Eindruck. Belebten sich jedoch im Laufe der Unterhaltung seine Züge, überflog dann ein leichtes Roth seine Wangen und erhöhte sich der Glanz seines blauen Auges, so war es unmöglich, irgend etwas Störendes in seiner äußeren Erscheinung zu finden«Henriette Herz, a. a. O. 221 fg.. Am 21. Mai war der Dichter wieder in Weimar und am 28. Mai schrieb er an Körner: »Daß ich bei dieser Reise nicht bloß mein Vergnügen beabsichtigte, kannst du dir leicht denken; es war um mehr zu thun und allerdings habe ich es jetzt in meiner Hand, eine wesentliche Verbesserung in meiner Lage vorzunehmen.« Das hing so zusammen. Die Verehrer und Freunde Schiller's in Berlin hatten den Plan gefaßt, ihn zu beständigem Aufenthalt dorthin zu ziehen, und dieser Plan wurde ohne Zweifel durch die Königin Luise wesentlich gefördert, falls er nicht überhaupt von ihr ausgegangen sein sollteBriefw. zw. Göthe und Zelter, I, 56.. Feinfühlend, großgesinnt, voll Patriotismus, wie sie war, hatte die Königin von Schiller's Dichtungen nachhaltigste Eindrücke empfangen und sie empfand das Bedürfniß, sich dankbar zu bezeigen. Der sehr einflußreiche Geheime Kabinetsrath Beyme nahm sich der Sache ebenfalls mit Eifer an und so wurde von Friedrich Wilhelm III. erwirkt, daß unserm Dichter, wenn er sich in Berlin niederlassen wollte, ein Jahresgehalt von 3000 Thalern nebst freiem Gebrauch einer Hofequipage förmlich angeboten, daneben auch ein Platz in der Berliner Akademie in Aussicht gestellt ward.
Der Antrag war lockend, um so mehr, da es Schiller und seiner Frau in Berlin besser gefallen, als sie erwartet hatten, wie er denn gegen Körner die dortige »große persönliche Freiheit und die Ungezwungenheit im bürgerlichen Leben« zu rühmen sich veranlaßt sah. Die Anschauung der Verhältnisse der großen Stadt hatte offenbar seine Phantasie günstig angesprochen. »Ich habe – schrieb er nach seiner Heimkehr an Schwager Wolzogen – ein Bedürfniß gefühlt, mich in einer fremden und großen Stadt zu bewegen. Einmal ist es meine Bestimmung, für eine größere Welt zu schreiben; meine dramatischen Arbeiten sollen auf sie wirken und ich sehe mich hier in so engen kleinen Verhältnissen, daß es ein Wunder ist, wie ich nur einigermaßen Etwas leisten kann, das für die größere Welt ist.« Aber »auf der andern Seite – äußerte er gegen Körner – zerreiße ich höchst ungern alte Verhältnisse, und in neue mich zu begeben schreckt meine Bequemlichkeit (und Kränklichkeit). Hier in Weimar bin ich absolut frei und im eigentlichsten Sinne zu Hause. Gegen den Herzog habe ich Verbindlichkeiten, und ob ich gleich mit ganz guter Art mich loszumachen hoffen kann, so würde mir's doch wehe thun, zu gehen. Wenn er mir also einen nur etwas bedeutenden Ersatz bietet, so habe ich Lust, zu bleiben.« Und er blieb wirklich. Mit der Loyalität, die ihm eigen, legte er die ganze Angelegenheit dem Herzog vor, mit dem Bemerken, daß es sein Wunsch wäre, zu bleiben, wenn der Fürst es thunlich fände, seinen Jahresgehalt um 400 Thaler zu erhöhen. Karl August beeilte sich, diesem Gesuche zu entsprechen, und schrieb dazu: »Von Ihrem Herzen erwartete ich, daß Sie so handeln würden. Empfangen Sie, werthester Freund, meinen wärmsten Dank; ich freue mich unendlich, Sie für immer den Unsrigen nennen zu können.« Froh dieses Ausgangs der Sache, meldete Schiller, als »ein ordentlicher Hausvater,« die Erhöhung seines Gehaltes an Humboldt, mit dem Beifügen: »Da ich nun auch für meine dramatischen Schriften mit Cotta und mit den Theatern gute Accorde gemacht, so bin ich in den Stand gesetzt, Etwas für meine Kinder zu erwerben, und wenn ich nur bis in mein fünfzigstes Jahr so fortfahre, darf ich hoffen, ihnen die nöthige Unabhängigkeit zu verschaffen.«
Voß der Jüngere hatte in dem oben angezogenen Briefe bemerkt, Lotte »denke ihrem Gatten ein neues Knäblein zu schenken, worüber er sich im Voraus fast über die Maßen freue,« und da die »kleine Frau« bei obwaltenden Umständen für den alten Hausarzt Starke in Jena »ein ausschließendes Vertrauen« hegte, so siedelte Schiller mit ihr und den Kindern im Juli für einige Monate in die Universitätsstadt hinüber. Gerade zur Zeit, wo Lotte's Niederkunft erwartet wurde, zog eine Erkältung dem Dichter einen heftigen Anfall seiner Unterleibskrämpfe zu, und während ihn die Schmerzen auf dem Lager hielten, kam zwar nicht ein drittes Knäblein, aber ein zweites Töchterlein an, welches am 7. August Emilie Henriette Luise getauft wurde. Schwägerin Karoline brachte dem kranken Vater die Neugeborene, »die er mit der lebhaftesten Freude empfing.« Es ist geradezu unbegreiflich, wie man den klarsten Zeugnissen entgegen jemals an Schiller's Herzensgüte und an seiner Zärtlichkeit als Gatte und Vater hat zweifeln können. »Wie konnte er seine Kinder herzen und küssen, sich mit ihnen auf der Erde wälzen! schreibt Voß der Jüngere. Nie vergesse ich den innigen Blick, den er manchmal auf seine jüngstgeborene Emilie warf. Es war, als könne er sein ganzes Glück nicht ausschöpfen, mit solcher Wehmuth, Freude und Innigkeit hingen seine Augen an ihr«Weimarer Sonntagsblatt f. 1857, S. 461.. Schnorr von Carolsfeld erzählt: »Als ich drei Jahre vor Schiller's Hinscheiden gegen Abend in Weimar angekommen war, wandelte ich nach seiner Wohnung und da fand ich ihn, seine Tochter Karoline auf den Armen, das Köpfchen an des Vaters Gesicht gelehnt, die Aermchen um dessen Hals geschlungen, in dem dämmernden Zimmer gleichsam tanzend herumschreiten«Schiller's Album, S. 207. Ueber des Dichters väterliche Zärtlichkeit vgl. auch »Gedenkbuch an Fr. Sch.« 123.. Sehr schön hat nach des Dichters Hingang Frau Griesbach gesagt: »Die Meisten denken sich den großen Mann, wir beweinen den guten.« Gerade in den letzten Jahren seines Lebens hatte sich der Adel seiner Natur zur höchsten Humanität und Liebenswürdigkeit herausgebildet, und wie der Dichter Bewunderung erregte, so erregte der Mann Zuneigung, wohin er trat. »Schiller scheint mir ein sehr edler Mensch,« schrieb Voß der Vater im Dezember 1802 an Esmarch, nachdem er den Dichter näher kennen gelernt hatte. Es ist uns bezeugt, daß noch fünfundzwanzig Jahre nach seinem Tode schlichte Bürger von Weimar mit Verehrung und Liebe von Schiller dem Menschen redetenSchiller's Album, S. 269.. In Göthe's Andenken lebte der Freund als das Ideal eines Menschen fort. So schrieb er unterm 9. November 1830 an Zelter: »Schiller'n war die Christus-Tendenz eingeboren, daß er nichts Gemeines berührte, ohne es zu veredeln,« und so äußerte er zwei Jahre früher (am 11. September 1828) gegen Eckermann: »Schiller erschien immer im absoluten Besitz seiner erhabenen Natur. Er war so groß am Theetisch, wie er es im Staatsrathe gewesen sein würde. Nichts genirte ihn, Nichts engte ihn ein, Nichts zog den Flug seiner Gedanken herab; was in ihm von großen Ansichten lebte, ging immer frei heraus ohne Rücksicht und ohne Bedenken. Das war ein rechter Mensch und so sollte man auch sein!« Es galt auch ebenso sehr dem Menschen wie dem Dichter Schiller, wenn ihm Wilhelm von Humboldt im Oktober 1803 aus Rom schrieb: »Sie haben das Höchste ergriffen und besitzen Kraft, es festzuhalten. Es ist Ihre Region geworden, und nicht genug, daß das gewöhnliche Leben Sie nicht darin stört, so führen Sie aus jenem besseren eine Güte, eine Milde, eine Klarheit und Wärme in dieses herüber, die unverkennbar ihre Abkunft verrathen. So wie Sie in Ideen fester, in der Production sicherer geworden, hat das zugenommen. Für Sie braucht man das Schicksal nur um Leben zu bitten.«
Aber das Schicksal war unerbittlich. Der Dichter sollte von dem heftigen Krankheitsanfall, welcher ihn zu Jena betroffen, nie wieder recht genesen. Als er mit seiner Familie von der alten Universitätsstadt, wo ihn diesmal besonders der Verkehr mit Johann Heinrich Voß, dem Pathen der kleinen Emilie, erfreut hatte, nach Weimar zurückgekehrt war, schrieb er unterm 4. September an Körner, er fühle sich noch immer sehr schwach und es sei ihm selbst nach der schwersten Krankheit nie so übel zu Muthe gewesen. Am 11. Oktober konnte er zwar dem Freunde in Dresden melden, daß er anfange, sich wieder zu erholen und einen Glauben an seine Genesung zu bekommen; allein Karoline von Wolzogen berichtet aus derselben Zeit, daß die physischen Kräfte des geliebten Schwagers sichtlich abgenommen hätten und daß sie durch seine veränderte, ins Graue spielende Gesichtsfarbe oft erschreckt worden sei. Wie licht und warm in der zerfallenden Hülle der Geist noch flammte, bezeugt das Festspiel »die Huldigung der Künste«, welches Schiller auf Göthe's lebhaftes Andringen zur Begrüßung der Braut des Erbprinzen binnen wenigen Tagen, vom 4. bis zum 8. November, gedichtet hat. Schiller legte auf dieses »Werk des Moments«, auf das »Machwerk«, wie er es gegen Humboldt und Körner nannte, keinen Werth, und doch gehört dieses kleine lyrische Spiel zu den freundlichsten Blüthen seiner Kunst. Was haben sich die Romantiker Mühe gegeben, die Poesie und die übrigen Künste poetisch zu verherrlichen; aber wie leicht fallen alle ihre bezüglichen Sonette und Ottaven in die Wagschale gegen die Schiller'sche Charakterisirung der Künste, gegen seine prachtvolle Strophe über die Poesie! Und wie edel ist die ganze Huldigung gehalten! Er konnte freilich zur Schmeichelei sich nicht erniedrigen. Sein Schwager Wolzogen, welcher das neuvermählte Paar aus Petersburg nach Weimar geleitet, hatte ihm von der Kaiserin von Rußland, die besonders an dem Don Carlos Gefallen gefunden, einen kostbaren Ring mitgebracht. Dankbar äußerte darauf der Dichter: »Ich hätte eine sehr passende Gelegenheit, in der Person des jungen Romanow, der eine edle Rolle im Demetrius spielt, der Kaiserfamilie viel Schönes zu sagen.« Aber am folgenden Tage sagte er: »Nein, ich thue es nicht; die Dichtung muß ganz rein bleiben.« Am 9. November führte der Erbprinz in festlichem Aufzug seine junge Gemahlin, die Großfürstin Maria Paulowna, in Weimar ein und zehn Tage lang war die Stadt festlich bewegt. Am 12. November kam die Huldigung der Künste, gewiß die passendste Hochzeitsgabe der Musenstadt, zur Darstellung und wir wissen, daß die fürstliche Frau, welcher die Künste huldigten, noch nach Jahren dankbar des erhebenden Eindrucks gedachte, welchen sie an jenem Festabend von der Muse Schiller's empfing.
Die Nachrichten über den letzten Winter des Dichters sind dürftig und es dürfte daher vergeblich sein, aus denselben ein volles Lebensbild gewinnen zu wollen. Wir müssen uns ihn denken, wie seit lange, arbeitend und leidend. Völlig schmerzloser Tage scheint er sich in dieser Zeit gar nicht mehr erfreut zu haben. Die peinlichen Krämpfe in den Eingeweiden nahmen an Heftigkeit zu und das häufige Fasten, womit er sie zu bändigen trachtete, vermehrte nur seine Hinfälligkeit. Um Weihnacht und Neujahr wurden die Anfälle schon höchst bedenklich. Eines Abends wachten Lotte und Heinrich Voß bei dem Schlaflosen. Gegen Mitternacht bat er seine Frau, hinunter zu gehen und sich zur Ruhe zu begeben. Sie zögerte, bis er den Wunsch dringender und zuletzt heftig wiederholte. Aber kaum war Lotte die Treppe hinab, so sank der Kranke bewußtlos in die Arme des jungen Freundes. Als ihn dieser durch Anwendung geeigneter Mittel ins Bewußtsein zurückgebracht hatte, fragte er sogleich: »Voß, hat meine Frau Etwas gemerkt?« Er hatte die Ohnmacht kommen gefühlt und ihr den schmerzlichen Anblick ersparen wollen. Aber zu leben ohne zu arbeiten, war ihm unmöglich. Am 14. Januar 1805 meldete er Göthe, er versuche, sich für den Demetrius in die gehörige Stimmung zu setzen, und außer diesem Thema beschäftigten damals noch zwei andere dramatische Pläne seine Phantasie. Der eine, welcher den Tod des Themistokles zum Vorwurf haben sollte, ist nur ein flüchtiger Gedanke geblieben; der andere ist unter dem Titel »die Kinder des Hauses« skizzirt worden. Am 20. Januar schrieb er an Körner: »Sowie das Eis wieder anfängt aufzuthauen, geht auch mein Herz und mein Denkvermögen wieder auf, welches Beides in den harten Wintertagen ganz erstarrt war.« Da ihm aber sein leidender Zustand selbstständiges Schaffen fortwährend verwehrte, so hatte er sich, um »doch nicht ganz müssig zu sein,« den Winter über daran gemacht, die Phädra des Racine metrisch zu übersetzen. Er sagt von diesem »Paradepferd der französischen Bühne,« wie er das Stück nennt, es habe viele Verdienste und könne, die Manier einmal zugegeben, sogar »fürtrefflich« heißen. Daß außerdem eine wohlbegründete Rücksicht auf die Vorliebe Karl August's für das französische Drama bei dieser Arbeit mitwirksam gewesen, ist unbedenklich anzunehmen. Der Herzog hatte auch, wie seine Briefe vom 29. Januar und 5. Februar an Schiller darthun, eine große Freude an der wohlgelungenen Uebersetzung, welche schon am 30. Januar zur Aufführung gelangte. Mit einem wahren Heroismus, gelassen und selbst heiter, trug der Dichter seine winterlichen Leiden. »Eine unaussprechliche Milde – erzählt Karoline von Wolzogen – durchdrang im letzten Winter Schiller's ganzes Wesen und gab sich kund in all seinem Empfinden und Urtheilen; es war ein wahrer Gottesfrieden in ihm.« In Wahrheit, er war im Frieden mit sich und der Welt und so sollte er scheiden.
Nachdem er zu Anfang des März mehrtägigen Fieberparoxysmen unterworfen gewesen, richtete er sich an dem großen Plane zu seiner Tragödie Demetrius zu neuer Lebenshoffnung auf. »Ich habe mich – schrieb er am 27. März an Göthe – mit ganzem Ernst an meine Arbeit angeklammert und denke nun nicht mehr so leicht zerstreut zu werden. Es hat schwer gehalten, nach so langen Pausen und unglücklichen Zwischenfällen wieder Posto zu fassen, und ich mußte mir Gewalt anthun. Jetzt aber bin ich im Zuge.« Wie rührend ist an der schon halb geöffneten Pforte des Todes diese Energie des rastlos Strebenden, seinem Lande und der Welt ein unsterbliches Werk mehr zu geben! Man glaubt den kranken Dichter zu sehen, wie er sich in seinen schlaflosen Nächten auf seiner niedrigen Bettstelle aufrichtet und die erhabenen Phantasiegebilde, die ihn umschweben, festzuhalten strebt und wie er sich dann an den Schreibtisch schleppt, an den armen alten Schreibtisch aus den Jenenser Junggesellentagen, um mit zitternder Hand leuchtende Gedanken, unvergeßliche Worte, die er den Schmerzen, die er dem Tode abgerungen, aufs Papier zu bannen. Allein er konnte sein letztes Werk nicht vollenden. Der Demetrius ist Torso geblieben, aber ein Torso, der ein Kunstwerk von höchster Vollendung ahnen läßt. Idee und Anlage, wie die Ausführung der vorhandenen Szenen, Alles bezeugt noch die Vollkraft des Genius. Es ist, wie wenn die Sonne, im Untergehen herrlich aufleuchtend, noch einmal ihre ganze Stralenmasse über den Abendhimmel hingießt; aber bevor die Goldhelle Zeit gehabt, das ganze Firmament zu erfüllen, ist das rothglühende Gestirn am Horizont hinabgesunken.
Die milderen Lüfte des Frühlings schienen die ermatteten Lebenskräfte des Dichters noch einmal anfrischen zu wollen. »Die bessere Jahreszeit – schrieb er am 25. April an Körner – läßt sich endlich auch bei uns fühlen und bringt wieder Muth und Stimmung; aber ich werde Mühe haben, die harten Stöße seit neun Monaten zu verwinden, und ich fürchte, daß doch Etwas davon zurückbleibt. Die Natur hilft sich zwischen vierzig und fünfzig nicht mehr so wie im dreißigsten Jahre. Indessen will ich mich zufrieden geben, wenn mir nur Leben und leidliche Gesundheit bis zum fünfzigsten Jahre aushält.« Der Brief, dessen Eingang diese Worte bilden, war der letzte, welchen er an Körner schrieb. Vom Tage zuvor datirt seine letzte Zuschrift an Göthe, welche dieser wie ein »Heiligthum« bewahrte. Sie war in »schönen und kühnen« Schriftzügen entworfen, und wenn Göthe in seinen alten Tagen vertrauten Freunden diesen Brief zeigte, pflegte er von dem Urheber desselben zu sagen: »Er war ein prächtiger Mensch und bei völligen Kräften ist er von uns gegangen«Vgl. Göthe's Gespräch mit Eckermann vom 18. Januar 1825.. Der Gedanke, daß er höchstens fünfzig Jahre alt werden würde, kehrte in seiner letzten Lebenszeit oft bei unserem Dichter ein. Bis dahin, hoffte er, würde er bei fortdauernder Arbeitsfähigkeit seine Kinder einigermaßen unabhängig stellen können. Ueber den Tod sprach er sich mit der Gelassenheit aus, die einem weisen Manne ziemt. Ein bezügliches Gespräch mit seiner Schwägerin schloß er mit den Worten: »Der Tod kann kein Uebel sein, da er etwas Allgemeines ist.« Für so nahe bevorstehend hielt er jedoch sein Ende nicht, um so weniger, da er sich in der zweiten Hälfte des Aprils eines Scheins von Genesung erfreuen durfte. Er empfand Reiselust, bei Kranken bekanntlich oft ein Vorzeichen der letzten großen Reise. Eine lebhafte Sehnsucht, die Schweiz zu sehen, bemächtigte sich seiner. Dann sehnte er sich auch wieder nach dem Wiesengrün und den Waldschatten von Bauerbach, wo einst der Flüchtling Rast gefunden. Als die milde Witterung Bewegung in freier Luft erlaubte, ging er mit Lotte und Karoline mehrmals im Parke spazieren. Aber sein erster Gang galt Göthe, welcher sich ebenfalls von einer harten Krankheit, einer Nierenkolik, nur langsam erholte. Heinrich Voß war bei dieser Zusammenkunft zugegen und konnte nie ohne Rührung daran zurückdenken. Die zwei großen Freunde fielen sich um den Hals und küßten sich mit einem langen herzlichen Kusse, bevor Einer ein Wort hervorbrachte. Auch sprach Keiner weder von der eigenen noch von des Anderen Krankheit, sondern Beide überließen sich der ungemischten Freude, endlich wieder mit heiterem Geiste vereint zu sein. Am 28. April war Schiller zum letztenmal bei Hofe. Voß war ihm bei seiner Toilette behülflich und freute sich der stattlichen Figur, welche der Dichter im grünen Galakleide machte. Am folgenden Tage erhielt Schiller, eben im Begriff ins Theater zu gehen, einen Besuch von Göthe, der zum erstenmal wieder ausgegangen war, sich aber noch so mißbehaglich fühlte, daß er den Freund nicht ins Theater begleitete, sondern an dessen Hausthüre von ihm Abschied nahm – auf immer. Denn sie sollten sich nicht wieder sehen. Karoline holte mit ihrem Wagen den Schwager ins Theater ab und auf dem Wege sagte er ihr, sein Zustand sei ganz seltsam; in der linken Seite, wo er seit langen Jahren immer Schmerz gefühlt, fühle er nun gar Nichts mehr. Der Grund hievon war ein nur zu trauriger: der seit Jahren kranke linke Lungenflügel hatte aufgehört, zu schmerzen, weil er total zerstört warDie Section von Schiller's Leichnam ergab überhaupt eine solche Desorganisation und Zerstörung des Innern, daß es einem Wunder gleichsah, wie der Dichter auch nur so lange hatte leben können. Von allen Organen befanden sich nur noch Magen und Blase im natürlichen Zustand. S. den vollst. Sectionsbericht bei Hoffmeister, Sch. L. V, 329..
Die Illusion einer Genesung verschwand rasch. »Da liege ich wieder!« sagte der Dichter von seinem Kanapee aus mit hohler Stimme zu Heinrich Voß, als dieser am 1. Mai bei ihm eintrat. Mit dem Freunde waren die drei älteren Kinder heraufgekommen, aber sie vermochten dem Vater keine Theilnahme abzugewinnen. Das war ein Zeichen, daß seine Wiedererkrankung etwas Bedenklicheres war als ein bloßes Katarrhfieber, für was er selbst sie Anfangs hielt. Doch glomm die erlöschende Lebenslampe in den nächstfolgenden Tagen noch einmal soweit auf, daß der Kranke mehrere Freunde, darunter seinen durchreisenden Verleger Cotta, empfangen konnte. Er traf auch keinerlei Anordnungen, welche auf ein Vorgefühl des nahen Todes gedeutet hätten; nur verlangte er lebhaft, seinen Schwager Wolzogen, welcher die Erbprinzessin zur Leipziger Messe begleitet hatte, heimkehren zu sehen. Am 6. Mai nahm aber die Krankheit eine schlimmere Wendung. Der bis dahin ganz frei gewesene Kopf begann zeitweilig wirre zu werden, die Sprache abgebrochen. An diesem oder einem der zwei folgenden Tage traf Voß den Göthe weinend in dessen Garten und erzählte ihm von Schiller's bedrohlichem Befinden. »Das Schicksal ist unerbittlich und der Mensch wenig!« hat Göthe darauf gesagt. Als am Abend des 7. Mai Karoline dem Kranken Gute Nacht bot, erwiderte er fast mit den Worten Wallenstein's: »Ich denke diese Nacht gut zu schlafen.« Bei Tage wollte er nur seine Frau und seine Schwägerin um sich haben, bei Nacht nur seinen treuen Diener Rudolf. Dieser hat in den letzten Nächten den Kranken viel im Halbschlummer reden gehört, meist vom Demetrius. Der scheidende Genius wollte von seinem letzten Werke nicht ablassen. Als er geschieden, fand man den herrlichen Monolog der Marfa auf des Dichters Schreibtisch und so sind diese glühenden Zeilen wahrscheinlich das Letzte, was er gedichtet. Als am Morgen des 8. Mai Karoline an sein Lager trat und nach seinem Befinden fragte, gab er zur Antwort: »Immer besser, immer heiterer!« Als man darauf die kleine Emilie heraufbrachte, betrachtete er sie mit Freude und Wohlgefallen und es war der Mutter, als wollte er dem Kinde seinen Segen geben. Gegen Abend zu verlangte er die Sonne zu sehen. Man öffnete den Vorhang, mit heiterem Auge blickte er in den schönen Abendhimmel hinaus und »die Natur empfing seinen Scheidegruß.« Am folgenden Tage unterzog er sich Morgens geduldig den Vorschriften des Arztes, welcher ein Bad und dann zur Stärkung ein Glas Champagner verordnete. Aber die Schwäche nahm zu und immer zu. Er forderte mit gebrochener Stimme Naphtha, doch die letzte Sylbe erstarb auf seinen Lippen. Vorher hatte er noch unzusammenhängend phantasirt, meist in lateinischer Sprache. Gegen 3 Uhr Nachmittags wurde das Athmen des Kranken unregelmäßig und stockend. Gesprochen hat er dann Nichts mehr. Karoline stand mit dem Arzt am Fuße des Bettes und hüllte die erkaltenden Füße des Sterbenden in gewärmte Kissen. Die Kinder waren da: Karl lag schluchzend am Boden, Ernst weinte still in einer Ecke, Karoline hielt sich neben der Mutter, die an dem Lager kniete. Ihr hat er noch in der Agonie letzte Liebeszeichen gegeben, indem er ihr die Hand drückte, sie anlächelte und sie küßte. Das Ende sollte schmerzlos und sanft sein. In der sechsten Abendstunde war es, da fuhr Etwas wie ein elektrischer Schlag über die Züge des Sterbenden. Dann sank sein Haupt zurück und auf seinem Antlitz lag die Ruhe des TodesIch habe mich in meinem Bericht über die letzten Tage und den Tod Schiller's genau an die Aufzeichnungen von Lotte (Brief an Fischenich vom 4. Juni 1805), von Karoline von Wolzogen, Göthe und Heinrich Voß gehalten, die nur in Unwesentlichem von einander abweichen. So z. B. wenn Göthe (Annalen 1805) seinen letzten Besuch bei Schiller, welcher am 29. April stattfand, irrthümlich in den Anfang des Mai setzt. . . . . . . So starb Friedrich Schiller, fünfundvierzig Jahre, fünf Monate und neunundzwanzig Tage alt, am 9. Mai 1805.

32. Schiller auf dem Sterbebette.
Originalzeichnung von G. Hartmann. Geschnitten von J. G. Flegel
Dem kranken Göthe die Todesbotschaft zu bringen, hatte Niemand den Muth. Meyer war bei ihm, als draußen die Nachricht von Schiller's Hingang eintraf. Meyer wurde hinausgerufen, aber er brachte es nicht über sich, zu Göthe zurückzukehren. Die Einsamkeit, in welcher dieser sich befindet, die Verwirrung, die er überall wahrnimmt, das Bestreben, ihm auszuweichen, – Alles dieses läßt ihn wenig Tröstliches erwarten. »Ich merke schon, sagte er endlich, Schiller muß sehr krank sein.« Die übrige Zeit des Abends war er in sich gekehrt. Er muß geahnt haben, was geschehen war, denn man hörte ihn in der Nacht weinen. Am Morgen sagte er zu einer Freundin: »Nicht wahr, Schiller war gestern sehr krank?« Der Nachdruck, womit er das »sehr« aussprach, wirkt so heftig auf Jene, daß sie sich nicht länger halten kann, sondern in Thränen ausbricht. »Er ist todt?« fragte Göthe mit Heftigkeit. »Sie haben es selbst ausgesprochen,« entgegnete sie. »Er ist todt!« wiederholte er und schlug die Hände vor das GesichtBriefe von Heinrich Voß, 2. Heft, S. 60 fg..
Es war bestimmt worden, daß die Bestattung des großen Todten Sonntags den 12. Mai stattfinden sollte. Weil aber der Leichnam zu schnell in Verwesung überging, wurde er in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag zu Grabe gebracht. Die trauernde Familie hatte die Beerdigung dem Oberconsistorialrath Günther übertragen. Der Sarg sollte nach gewohntem Brauch durch Handwerker getragen werden. Aber auf Anregung des nachmaligen Bürgermeisters von Weimar Karl Leberecht Schwabe vereinigten sich zwanzig junge Männer, Gelehrte, Künstler und Beamte, zu diesem Liebes- und Ehrendienst. Ein Sohn des Genannten hat aus dem handschriftlichen Nachlasse seines Vaters die folgende authentische Erzählung der Bestattung des Dichters veröffentlicht. »Still und ernst begab sich nach Mitternacht der kleine Zug von Schwabe's Wohnung nach Schiller's Haus. Es war eine mondhelle Mainacht, nur einzelne Wolken verhüllten bisweilen den Mond»Es war eine schöne Mainacht. Nie habe ich einen so anhaltenden und volltönenden Gesang der Nachtigallen gehört als in ihr.« Karol. v. Wolzogen, II, 280.. Still war das Todtenhaus, nur aus einem Zimmer desselben tönte dumpfes Weinen und Schluchzen. Während die Freunde die Treppe hinab vorangingen, wurde der Sarg hinuntergetragen und vor der Hausthüre von ihnen aufgenommen. Kein Mensch war vor dem Hause oder in den Straßen; tiefe, lautlose Stille herrschte in der Stadt. So ging der Zug durch die Esplanade, über den Markt und durch die Jakobsgasse nach dem alten Kirchhofe vor der St. Jakobskirche. Gleich rechts am Eingange befindet sich noch jetzt das sogenannte Kassengewölbe, vor dessen Thüre die Träger die Bahre mit dem Sarge niedersetzten. Hell durchbrach in diesem Augenblicke der Mond die verhüllenden Wolken und übergoß mit seinem Lichte den Sarg des Dichters. Gleich darauf verbarg sich die Lichtscheibe wieder hinter den rasch am Himmel dahin eilenden Wolken und hörbar rauschte der Wind über Dächer und Bäume dahin. Nun öffnete sich die Pforte des düstern Gewölbes, der Todtengräber und seine drei Gehülfen nahmen den Sarg auf, trugen ihn hinein, öffneten eine Fallthüre und der theure Todte wurde an Seilen in die unterirdische, von keinem Lichtstral erhellte Gruft hinabgesenkt. Die Fallthüre ward wieder niedergelassen und dann das äußere Thor des Grabgewölbes wieder verschlossen. Kein Trauergesang, kein dem Andenken des eben Begrabenen geweihtes Wort unterbrach die Stille der Mitternacht. Still wollten sich die Männer des Trauergeleites vom Kirchhof entfernen, als Aller Aufmerksamkeit durch eine hohe, in einen Mantel tief verhüllte Männergestalt angezogen wurde, welche zwischen den dem Kassengewölbe nahen Grabhügeln herumirrte und durch Gebärden und lautes Schluchzen ihre innige Theilnahme an dem eben hier Vollbrachten zu erkennen gabDr. J. Schwabe, Schiller's Beerdigung und die Aufsuchung und Beisetzung seiner Gebeine, S. 17 fg. Froriep sagt im Schiller-Album (S. 77), daß er und ein Unbekannter – (eben Wolzogen) – die Einzigen gewesen seien, welche dem Sarge folgten.. Dieser Trauernde, dessen Anwesenheit später Sage und Novellistik in einem romantischen Lichte erscheinen zu lassen versuchten, war kein Anderer als Wilhelm von Wolzogen, welcher, auf der Rückreise von Leipzig begriffen, zu Naumburg den Tod des theuren Schwagers erfahren, sich sofort auf ein Pferd geworfen und Weimar gerade noch zur rechten Stunde erreicht hatte, um sich unvermerkt dem kleinen Leichenzug anzuschließen . . . . Man hat es damals und später noch bitter getadelt, daß die Musenstadt Weimar unseren Dichter in einer Weise bestattete, welche die Vergleichung mit der Bestattung, die unlange zuvor die Kaufmannsstadt Hamburg Klopstock bereitet hatte, herausfordern mußte. Auf die in den Zeitungen darüber laut gewordenen Anklagen gab Göthe, wenigstens mittelbar, die Antwort: »Eben das ist es, was mir an Schiller's Hingang so ausnehmend gefällt. Unangemeldet und ohne Aufsehen zu machen kam er nach Weimar und ohne Aufsehen zu machen ist er auch wieder von hinnen gegangen. Die Paraden im Tode sind nicht, was ich liebe«Falk, a. a. O. 61.. Es liegt etwas Großes darin, daß der Mann, dessen Geistesreichthum den Kulturschatz der Menschheit mehrte und fortwährend mehrt, die Welt so arm und einfach verließ, wie er sie betreten hatte. Am Ufer des Neckars in einer dürftigen Bäckerstube geboren, ist er am Ufer der Ilm in einem Sarge, welcher drei Thaler kostete, zu Grabe getragen worden. Uebrigens wurde am 12. Mai zu Ehren des großen Todten in der St. Jakobskirche eine kirchliche Feier begangen, wobei die herzogliche Kapelle Mozart's Requiem aufführte und der Generalsuperintendent Voigt die Gedächtnißrede hielt. Die Kirche vermochte die Menge der Theilnehmenden nicht zu fassen.
Allgemein, tief und herzlich war die Trauer um den Dahingegangenen, in der Nähe und Ferne. Es ging ein Ton der Klage durch das ganze Vaterland. Henriette von Knebel, die Erzieherin der Prinzessin Karoline von Weimar, schrieb unterm 15. Mai an ihren Bruder: »Das schmerzhafte Ereigniß von Schiller's unvermuthetem Tod hat mein Herz so verwundet, daß mir der Balsam der Freundschaft sehr nothwendig ist. Wir haben die Nachricht von Schiller's Tod in Auerstädt erfahren. Meiner armen Prinzeß kam dieser Fall zu unerwartet. Sie weinte und schluchzte und konnte sich kaum fassen, obgleich die Erbprinzessin, der es auch sehr nahe ging, Alles that, um sie zu trösten. Wir sind fast täglich bei Frau Schiller, deren Schmerz zwar tief, aber doch sanft ist. Die Wolzogen ist viel heftiger.« Die Erbprinzessin bezeugte der vaterlosen Familie ihre Theilnahme in hochsinniger Weise, indem sie sofort die Kosten der Erziehung von Schiller's Söhnen übernahmKarol. v. Wolzogen, Sch. L. II, 281. Fräul. v. Göchhausen an Böttiger, Literar. Zust. u. Zeitg. II, 251. – Schiller's ältester Sohn, Karl, widmete sich dem Forstfache, trat als Forstmann in den würtembergischen Staatsdienst, wurde später für sich und seine Nachkommen durch König Wilhelm von Würtemberg in den Freiherrnstand erhoben und starb am 21. Juni 1857. Sein einziger Sohn, Ernst Friedrich, geb. 1826 zu Rottweil, ist der einzige von Schiller's Enkeln, welcher seinen Namen fortpflanzt. Er ist zur Zeit, wo ich dieses schreibe, Rittmeister in einem östreichischen Kürassierregiment. Der zweite Sohn des Dichters, Ernst, studirte Jurisprudenz, trat in preußische Dienste und starb als Appellationsgerichtsrath, ohne Nachkommenschaft zu hinterlassen, am 19. Mai 1841 zu Vilich bei Bonn. Die ältere Tochter Schiller's, Karoline, war seit 1838 mit dem Bergrath Junot auf der Katzhütte bei Rudolstadt verheiratet und starb kinderlos am 19. Dezember 1850 in Würzburg. Die jüngere Tochter, Emilie, verehelichte sich 1828 mit dem Sohn der Jugendfreundin ihrer Mutter, Freiherrn Heinrich von Gleichen-Rußwurm auf Greifenstein im Untermainkreis. Schiller's älteste Schwester, Christophine, starb erst im hohen Alter 1847 in Meiningen. Seine zweite Schwester, Luise, war 1839 zu Möckmühl gestorben.. Dannecker, der Akademiegenosse des Dichters, schrieb im Mai aus Stuttgart an Wilhelm von Wolzogen: »Schiller's Tod hat mich sehr niedergedrückt. Durch Kapellmeister Granz kam die fürchterliche Nachricht zuerst hieher. Im ersten Moment konnte ich kein Wort hervorbringen, es erstickte in mir. Ich glaubte, die Brust müßte mir zerspringen, und so plagte mich's den ganzen Tag. Den andern Morgen beim Erwachen war der göttliche Mann vor meinen Augen und da kam mir's in den Sinn, ich will Schiller lebig machen; aber der kann nicht anders lebig sein als kolossal. Schiller muß kolossal in der Bildhauerei leben, ich will eine Apotheose!« Und zu dem Churfürsten von Würtemberg hat der edle Künstler gesagt: »Ihr Durchlaucht, der Schwab muß dem Schwaben ein Monument machen!« und wenn auch die Ungunst der Zeit die Ausführung dieses Gedankens verwehrte, so konnte sie Dannecker doch nicht verhindern, seine berühmte Kolossalbüste des Dichters zu schaffen. Aus Erlangen schrieb Fichte unterm 1. Juni 1805 an Wolzogen: »Innigst erschüttert hat mich und meine Frau die Nachricht von dem Tode unseres theuren Schiller. Ich hatte an ihm noch einen der höchst seltenen Gleichgesinnten über geistige Angelegenheiten. Er ist hin. Ich achte, daß in ihm ein Glied meiner geistigen Existenz mir abgestorben sei.« Zelter schrieb aus Berlin an Göthe: »Der unvermuthete Tod unseres lieben Schiller hat bei uns eine allgemeine und starke Sensation erregt.« Iffland veranstaltete in der preußischen Hauptstadt zur Todtenfeier des Dichters die Aufführung einer Reihenfolge seiner Dramen. Göthe schrieb unterm 1. Juni an Zelter: »Ich dachte mich selbst zu verlieren und verliere nun den Freund und in demselben die Hälfte meines Daseins.« Als er sich ermannt hatte, erzählt er in seinen Annalen, blickte er nach einer entschiedenen, großen Thätigkeit umher und da war sein erster Gedanke, den Demetrius zu vollenden, um so »dem Tode zum Trotz die Unterhaltung mit dem Freunde fortzusetzen, dessen Gedanken, Ansichten und Absichten bis ins Einzelne zu bewahren und ein herkömmliches Zusammenarbeiten hier zum letztenmal auf seinem höchsten Gipfel zu zeigen.« Dieser so vollendete Demetrius sollte dann als Todtenfeier Schiller's auf allen Theatern zugleich gespielt werden. Aeußerliche und wohl auch innerliche Hindernisse ließen den großen Plan nicht zur Verwirklichung kommen. Aber ohne Todtenopfer ließ er das Grab des Freundes doch nicht, nein, er brachte ihm das schönste, welches je ein Dichter einem Dichter dargebracht hat: – den herrlichen »Epilog zu Schiller's Glocke.« Derselbe wurde zuerst am 10. August 1805 gesprochen, wo das Glockenlied zum Gedächtniß seines Schöpfers auf der Bühne zu Lauchstädt dramatisch dargestellt ward. So innige und mächtige Herzenstöne wie in diesem Gedicht hat Göthe nachher nie mehr gefunden. Wie Klage und Triumph zugleich scholl das in dem Epilog mehrmals wiederkehrende: »Er war unser!« über Deutschland hin. Er hatte das Gedicht der Schauspielerin Wolf, die es als Muse sprechen sollte, selber eingelernt. Aber bei einer besonders ergreifenden Stelle überwältigte ihn sein Gefühl so sehr, daß er sie bat, innezuhalten, und mit Thränen in den Augen in die Worte ausbrach: »Ich kann, ich kann den Menschen nicht vergessen!«Weimarer Sonntagsblatt für 1857, S. 294. Nach dem Zeugniß von Göthe's letztem Secretair soll er auch in den Fieberphantasieen seiner letzten Stunden noch von »seinem Schiller, seinem Geliebten« gesprochen haben. Vgl. Gedenkb. an Schiller, S. 91. Lotte hatte in der Bitterkeit des ersten Schmerzes an Fischenich geschrieben: »Ich habe das Schrecklichste erlebt, habe Schiller sterben sehen! Die Erde ist mir nun Nichts mehr, ich finde keinen Ruhepunkt mehr!« Einen Monat später (3. Juli) ergoß sich ihre Trauer in sanfteren Worten gegen den genannten vertrauten Freund von Jena her. »Ach, Sie kannten ihn nur halb – schrieb sie – denn in dem letzten Theil seines Lebens, wo seine Seele frei auch unter dem drückenden Gefühl seiner Krankheit sich erhob, wo er immer milder, immer liebender wurde, sein Herz an dem unschuldigen Leben seiner Kinder erfreute, war er ganz anders, als da Sie mit uns lebten. Diese Liebe, diese Freude an den lieben Geschöpfen, diese Heiterkeit würde Ihrem Herzen wohlgethan haben. Das lange Zusammensein mit ihm hatte auch mein Gefühl auf eine glückliche Höhe gestellt; bei ihm, mit ihm war ich über das Leben hinweg . . . Es hat Niemand, kann ich behaupten, dieses edle, hohe Wesen so verstanden, als ich, denn keine Nuance entging mir. Ich wußte mir seinen Charakter, die Triebfedern seines Handelns zu erklären, zurechtzulegen wie Niemand. Die Jahre verbanden uns immer fester, denn er fühlte, daß ich durch das Leben mit ihm seine Ansichten auf meinem eigenen Wege gewann und ihn verstand wie keiner seiner Freunde. Ich war ihm so nöthig zu seiner Existenz als er mir. Er freute sich, wenn ich mit ihm zufrieden war, wenn ich ihn verstand. Dieses geistige Mitwirken, Fortschreiten war ein Band, das uns immer fester verknüpfte. Ich würde zu keinem Menschen sonst so sprechen, lieber Freund, so sprechen können. Aber Sie sollen mir fühlen, daß ich Unersetzliches verlor, daß ich alle Kräfte meines Geistes zusammenrufen muß, um dieses Leben zu ertragen. Sie sollen Zeuge meines Lebens sein, daß ich nicht unwerth bin, die Gefährtin eines solchen Geistes zu sein, daß ich jetzt durch meinen Muth, durch meine Resignation auch zeigen will, daß ich meinen Geist an Schiller's Beispiel zu stärken verstand.« Sie hat Wort gehalten. Mit religiöser Innigkeit das Andenken ihres großen Gatten pflegend und mit aufopfernder Sorgfalt die Erziehung ihrer Kinder leitend, lebte sie, im regen geistigen Verkehr mit vielen der Besten ihrer Zeit, geachtet und geliebt bis zum Jahre 1826. Da ist sie am 9. Juli in den Armen ihres Sohnes Ernst zu Bonn gestorben und so hat die bescheidene, keusche, verständniß- und liebevolle Lebensgefährtin Schiller's am schönen Rheinstrom ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ihre Schwester Karoline sollte sie um zwanzig Jahre überleben. Denn erst am 11. Januar 1847 starb Frau von Wolzogen, nahezu vierundachtzigjährig, nachdem sie 1809 den Gatten, 1825 den einzigen Sohn verloren und lange Jahre in Schiller's ehemaligem Gartenhaus zu Jena ihren Erinnerungen gelebt hatte. Dort hat sie auch die warmgefühlte Lebensgeschichte ihres großen Schwagers geschrieben. Die Drei, welche im Leben so innig, so treu verbunden waren, sollten im Tode getrennt werden: Karoline ruht in Jena, Lotte in Bonn, Schiller in der Fürstengruft zu Weimar.
Einundzwanzig Jahre lang hielt das Kassengewölbe auf dem Friedhof der Jakobskirche die irdischen Ueberreste des Dichters verschlossen. Im März 1826 erfuhr Karl Leberecht Schwabe, Bürgermeister von Weimar, daß das Landschaftscollegium damit umgehe, das Kassengewölbe »in der Kürze aufräumen zu lassen.« Der treffliche Mann konnte den Gedanken nicht ertragen, daß Schiller's Gebeine bei dieser Gelegenheit für immer verloren gehen könnten, ja müßten, und er setzte sofort Alles in Bewegung, um den Untergang der geweihten Reste zu verhindern. So wurde denn in der Nacht vom 19. März das Kassengewölbe von Sachkundigen durchsucht und aus dreiundzwanzig Todtenschädeln der Schiller'sche herausgefunden. Die genaueste, unter Beiziehung von Anatomen vorgenommene Untersuchung stellte die Echtheit der Reliquie festBei dieser Gelegenheit schrieb Göthe seine Terzinen »Bei Betrachtung von Schiller's Schädel,« wo sein Gefühl für den verewigten Freund noch einmal so innig sich kundgab, besonders in den schönen Zeilen:
Wie mich geheimnißvoll die Form entzückte!
Die gottgedachte Spur, die sich erhalten!
Ein Blick, der mich an jenes Meer entrückte,
Das flutend strömt gesteigerte Gestalten.
Geheim Gefäß, Orakelsprüche spendend,
Wie bin ich werth, dich in der Hand zu halten?. Im September gelang es dann auch, die meisten Theile des übrigen Skeletts aufzufinden, zu verifiziren und zusammenzusetzen. Der Schädel selbst wurde in Anwesenheit von Schiller's Sohn Ernst mit angemessener Feierlichkeit in dem hohen Piedestal der Schillerbüste von Dannecker niedergelegt, welche der Künstler der Familie seines großen Freundes zum Geschenk gemacht, Karl August von dieser käuflich erworben und im Bibliotheksaale der Büste Göthe's gegenüber hatte aufstellen lassen. Indessen erregte diese Trennung des Schädels von den übrigen Gebeinen manche Bedenken im Publicum und auch König Ludwig von Baiern sprach bei einem Besuche in Weimar eine Mißbilligung aus. So befahl denn Karl August, die verehrten Ueberreste sollten wieder vereinigt und in der Fürstengruft, welche er für sein Geschlecht auf dem neuen Friedhof erbaut hatte, bestattet werden. In der Morgenfrühe des 16. Dezember 1827 wurden demzufolge Schiller's Gebeine in einem nach einer Zeichnung von Göthe gefertigten Sarkophag in der Fürstengruft beigesetztDie ausführliche, mit Urkunden belegte Erzählung der Aufsuchung und schließlichen Bestattung von Schiller's Ueberresten s. bei Schwabe, a. a. O. 38–130.. Hier gesellte sich dem Sarge Schiller's am 28. Juni 1828 der Karl August's, am 8. Februar 1830 der Sarg der Herzogin Luise, am 26. März 1832 der Sarg Göthe's. In der Mitte des Friedhofs, auf einer sanftansteigenden Erhöhung, steht der einfache Grabtempel mit Vordach und Säulen. Aus dem innern Raume, einer schmucklosen, von oben erhellten Rotunde, führt zur Linken eine steinerne Treppe in das Gewölbe hinab. Etwa in der Mitte desselben steht der Sarkophag von Erz, in welchem der treffliche Fürst ruht, und ihm zur Seite der Sarg seiner hochgesinnten Gemahlin. Links von der Treppe erblickt man auf gemauerten Unterlagen zwei ganz gleiche Sarkophage von braungebeiztem Eichenholz neben einander. Auf dem einen ist in Metallbuchstaben zu lesen: Schiller, auf dem andern: Goethe. Sonst kein Schmuck, außer auf jedem der Särge ein von Zeit zu Zeit fromm erneuerter Kranz von Lorbeer und Eppich.

33. Die Fürstengruft in Weimar.
Originalzeichnung von G. Hartmann. Geschnitten von J. G. Flegel
Der würdigen Bestattung des Dichters folgte nach zwölf Jahren die Apotheose. In Stuttgart hatte sich ein Verein gebildet, welcher alljährlich den Todestag Schiller's feierlich beging. Von diesem Kreise ging der Gedanke aus, dem geliebtesten Heros der Nation ein seines Namens würdiges Denkmal aufzurichten. Der Gedanke reifte zur That und am 8. Mai 1839 feierte auf demselben Platze, wo er vor achtundfünfzig Jahren, in der kümmerlichen Uniform eines Feldscherers bei der Parade erscheinend, halb das Mitleid halb den Spott seiner Kameraden erregt hatte, der große Todte durch die Liebe der Nation und durch die Kunst eine monumentale Auferstehung. Der Raum zwischen der Stiftskirche und dem alten Schloß mit seinen mittelalterlichen Thürmen war Kopf an Kopf von den Festgästen besetzt, unter welchen auch die zwei Söhne des Dichters nicht fehlten. Mörike's schöner Festhymnus erklang; dann zog der Enkel die bergende Hülle von dem Erzbild des Großvaters und, von feierlichem Glockengeläute begrüßt, blickte Thorwaldsen's Schiller auf das ehrfurchtsvoll lauschende Volk nieder.
Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,
Wenn er, am skäischen Thor fallend, sein Schicksal erfüllt.
Diese Anspielung auf Achill's Geschick in Schiller's »Nänie« schwebte ohne Zweifel Göthe vor, als er in die allgemeine Todtenklage um den großen Freund hinein die herrlichen Trostworte sprach: »Wir dürfen ihn wohl glücklich preisen, daß er von dem Gipfel des menschlichen Daseins zu den Seligen emporgestiegen. Die Gebrechen des Alters, die Abnahme der Geisteskräfte hat er nicht empfunden. Er hat als ein Mann gelebt und als ein vollkommener Mann ist er von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken der Nachwelt den Vortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen. Denn in der Gestalt, wie der Mensch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten und so bleibt uns Achill als ein ewig strebender Jüngling gegenwärtig. Daß Schiller frühe hinwegschied, kommt auch uns zu gute. Von seinem Grabe her stärkt auch uns der Anhauch seiner Kraft und erregt in uns den lebhaftesten Drang, das, was er begonnen, mit Liebe fort- und immer fortzusetzen. So wird er in dem, was er gewollt und gewirkt, stets seinem Volke und der Menschheit leben« . . . . . Sehr glücklich, scheint mir, ist in dieser ganz hellenischen Grabrede das getroffen, was unseres Dichters Werken in hohem und höchstem Grade eigenthümlich. Ich meine das Ewig-Jugendliche, das Thaten Zeugende. Nur die Schöpfungen von wenigen Auserwählten besitzen diesen nie veraltenden Zauber. Sie stehen am Eingange neuer Weltperioden und formuliren, vorschauend, die höchsten Ziele derselben auf Jahrhunderte und wieder Jahrhunderte hinaus. Diese seltenen Geister sind die eigentlichen Helden der Menschheit, weil sie ihre Erzieher und Bildner sind. So ein Heros ist Friedrich Schiller. Man kann ohne Anmaßung sagen, daß seit den Tagen Homer's kein Dichter aufgestanden, der in solchem Grade wie Schiller die Geltung eines Völkerlehrers gehabt hätte. Zu ihm, der sich mit beispielloser Energie aus der Region des ungestümen Naturalismus zur Höhe der idealen Kunstform emporgeschwungen, hat vom Erscheinen des Wallenstein an die deutsche Jugend hinaufgeblickt als zu einem »Wesen höherer Art.« Ihr hinterließ er scheidend ein theures Vermächtniß, den Tell, der in der deutschen Geschichte wahrlich nicht bloß eine literarische Bedeutung hat. In jener Unglückszeit, als der Grundgedanke von Napoleon's Politik, die Vernichtung Deutschlands, erfüllt schien, zu jener Zeit, wo ein Patriot wie Stein keine Fußbreite deutschen Bodens mehr fand, darauf zu stehen, zur Zeit, wo ein Poet ersten Ranges, ein Mann von Genie und Herz, Heinrich von Kleist, sich selber den Tod gab, um das überwältigende Elend nicht länger mitansehen zu müssen, – zur Zeit, wo Deutsche gegen Deutsche kämpfen mußten wie Gladiatorenbanden und alle Länder für fremde Interessen mit ihrem Blute düngten, – zu dieser Zeit voll Druck, Noth und Schmach haben sich am Tell und anderen Schöpfungen Schiller's die Gemüther erquickt, die Geister wieder aufgerichtet zu vaterländischem Fühlen, zu opferfreudigem Handeln. Auf jeder Seite jener ruhmreichen Kampfgeschichte, die von der Katzbach bis nach Waterloo reicht, leuchtet für Jeden, der Augen hat, der Name unseres Dichters und er wird auch für alle Zukunft in der deutschen Geschichte da leuchten, wo immer Großes geschieht. Denn in seinen Werken ist, ich wiederhole es, ewige Jugend, Mannheit und Thaten zeugende Kraft. Den ganzen Werth und Umfang dieses Genius erkennt man erst, wenn man als reiferer Mann wieder zu ihm zurückkehrt. Da erst lernt man den Idealismus des Dichters, hinter dem »im wechsellosen Scheine alles Gemeine« weit zurückgeblieben, so recht kennen, bewundern, lieben; da erst gewinnen alle seine hohen Worte, die uns vertraut sind wie süßeste Jugenderinnerungen, ihre volle Bedeutung; da erst stimmt man dankbaren Herzens in den Ausspruch jenes Aesthetikers ein, welcher gesagt hat, Schiller habe »die Erziehung des Volkes zum Idealismus nicht nur vorgeschlagen, sondern durch seine Werke auch begonnen; er habe die Ideale der Nation geschaffen und den Volksgeist im Sinne der großen humanen Idee umgebildet.« Und was ist das Grundmotiv dieser erstaunlichen, aus allen zeitweiligen Verdunkelungen immer wieder siegreich aufleuchtenden Wirksamkeit? Kein anderes als die sittliche Begeisterung, welche in Schiller lebte, der unwandelbare Glaube an den »göttlichen Lichtgedanken«, die Seele der Geschichte der MenschheitVon dem allerersten Werden
Der unendlichen Natur
Alles Göttliche auf Erden
Ist ein Lichtgedanke nur.
Sch. W. I, 235. In diesem hohen Sinne, im Sinne einer rastlosen Entwicklung seines Volkes und aller Völker zum Menschlich-Freien, Großen, Guten, Schönen, war Schiller Dichter, war er Seher und Prophet. Und so sei er es immer und immer! Mit Stolz hat Göthe über das Grab des großen Freundes hinweg der Nation zugerufen: »Er war unser!« Ich vertraue meinem Volke, daß es nie aufhören werde, mit Liebe und Stolz zu fühlen und zu sprechen: – »Er ist unser!«

34. Schiller's Denkmal in Stuttgart.
Geschnitten von Adé
Belege und Erläuterungen eingearbeitet. joe_ebc für Gutenberg
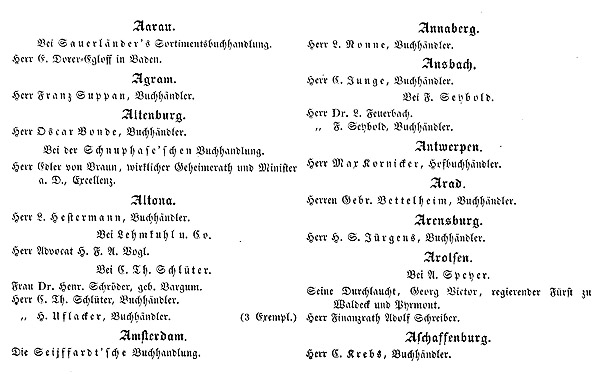
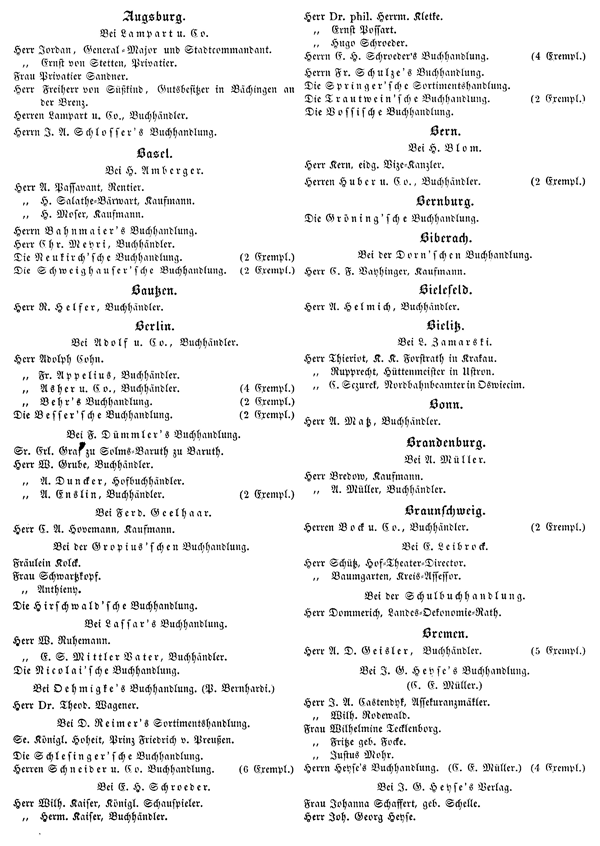
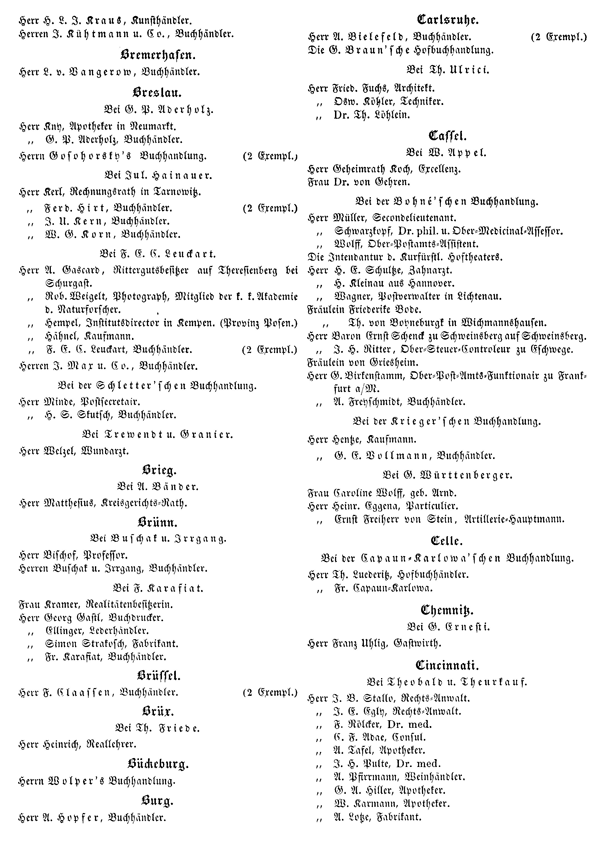
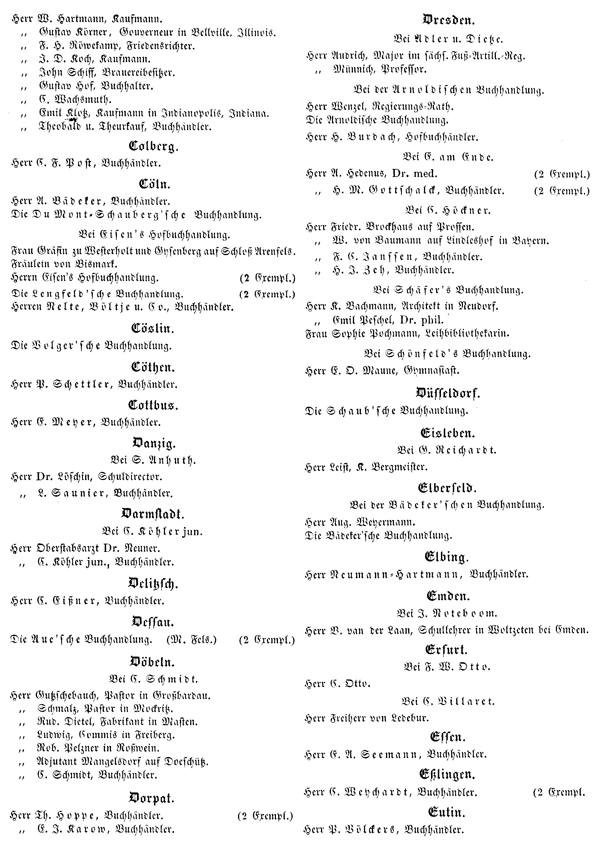
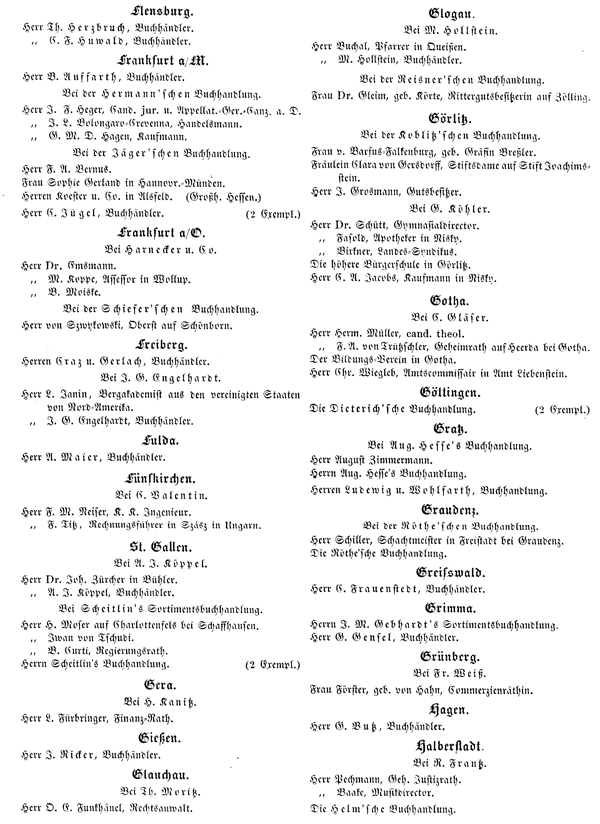
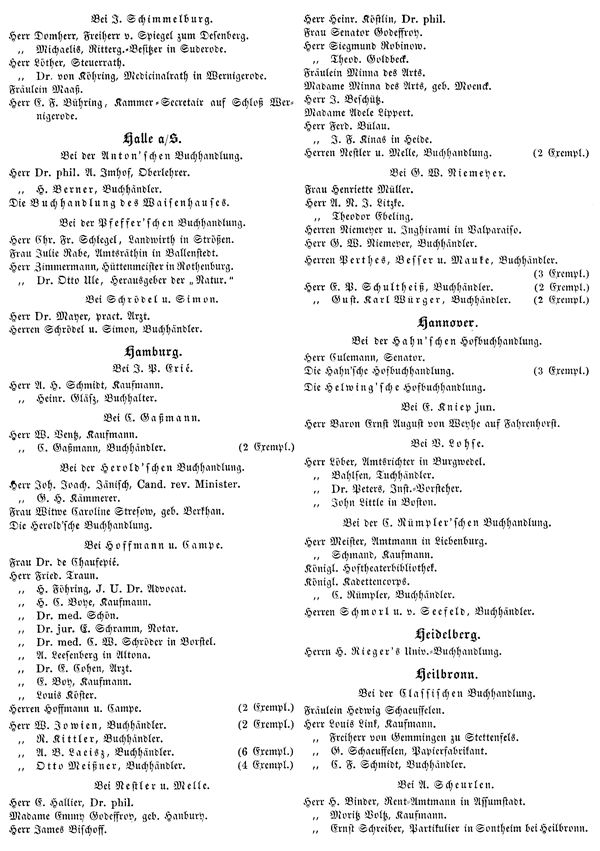
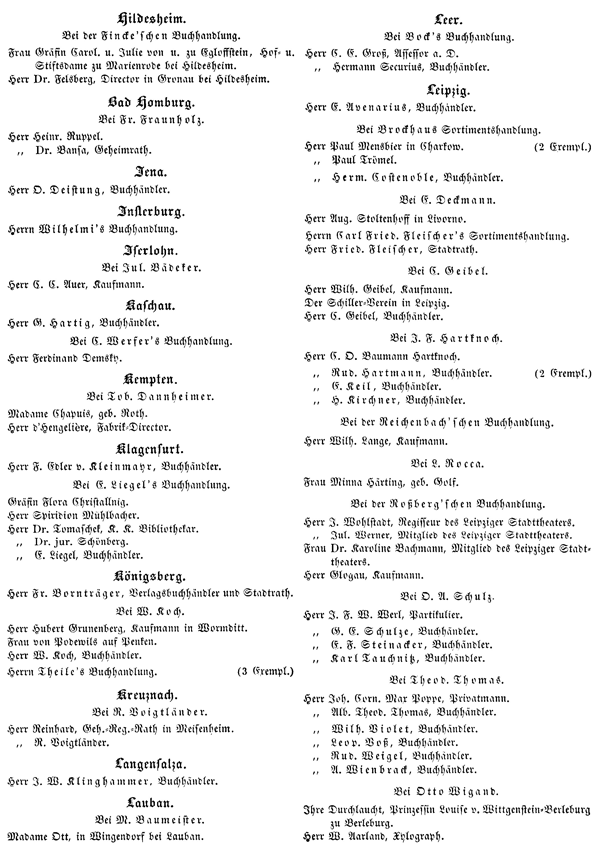
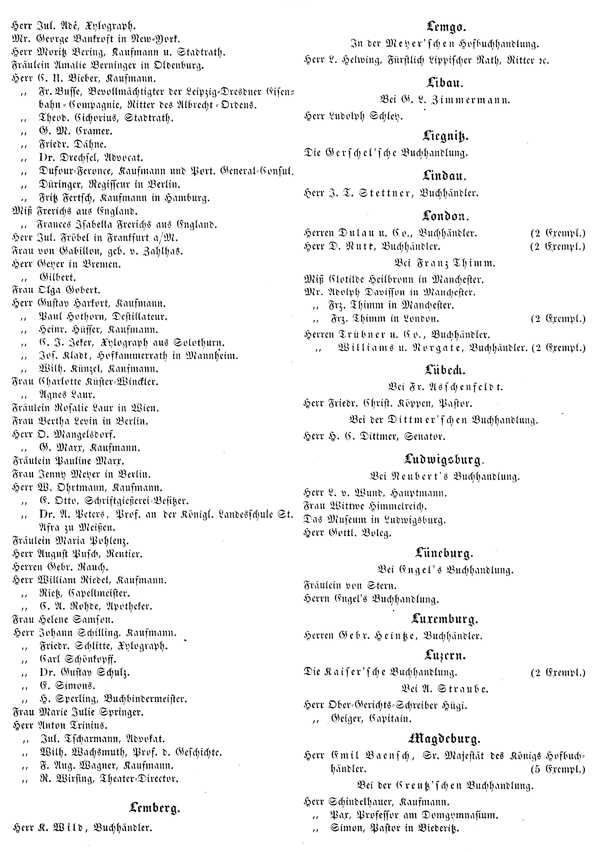
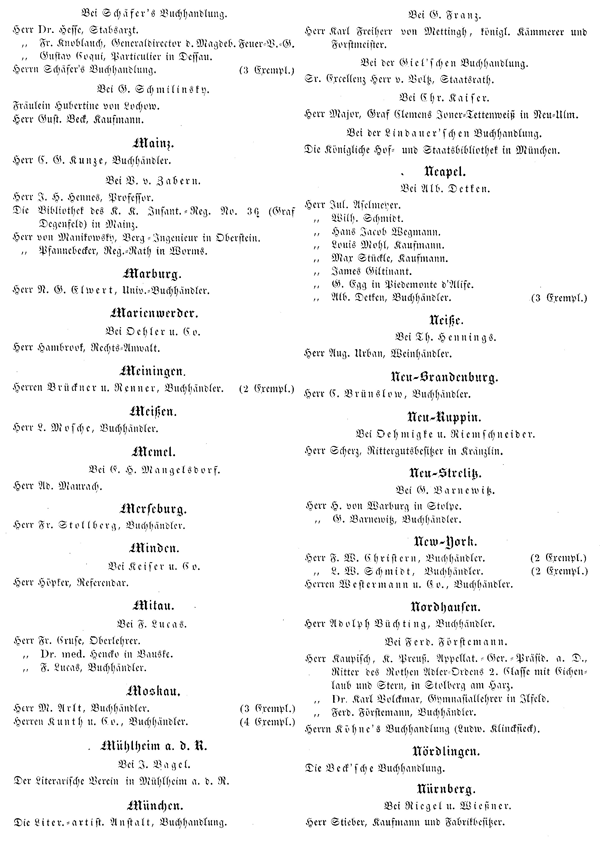
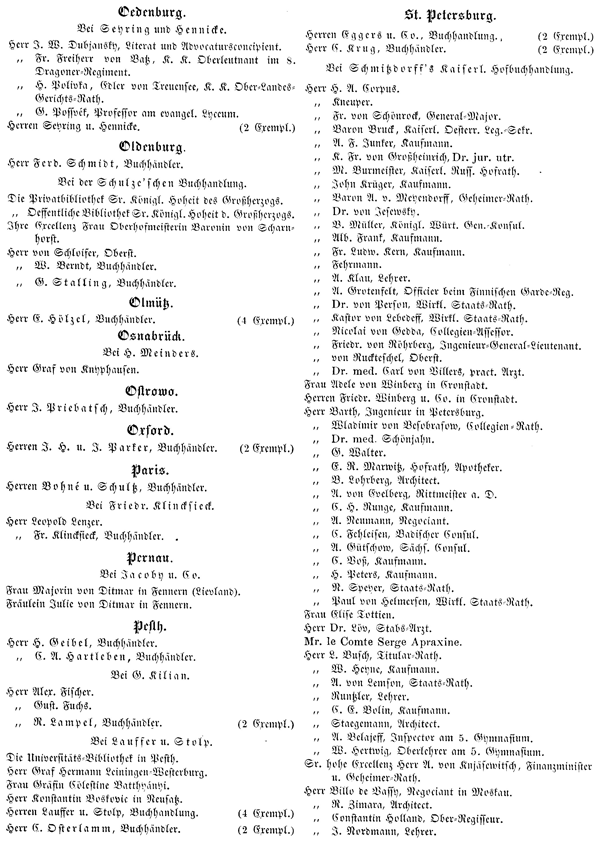
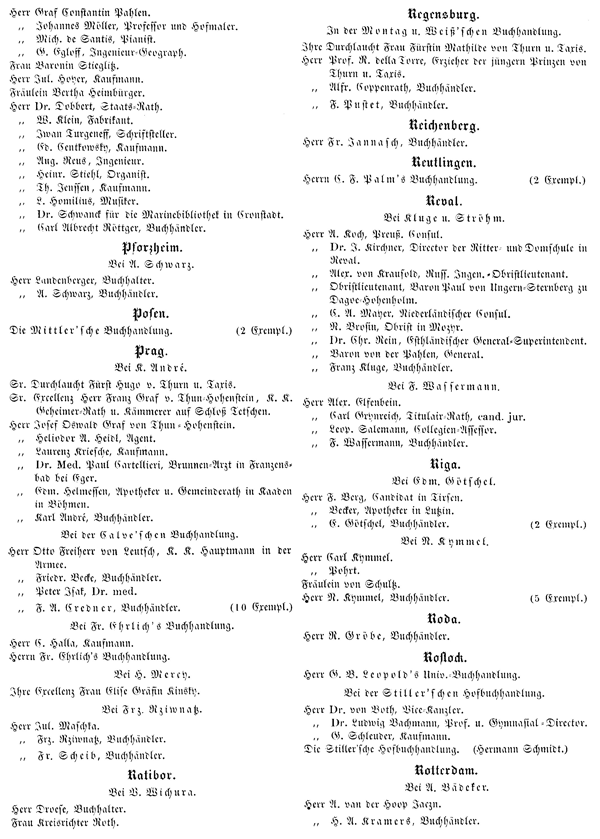
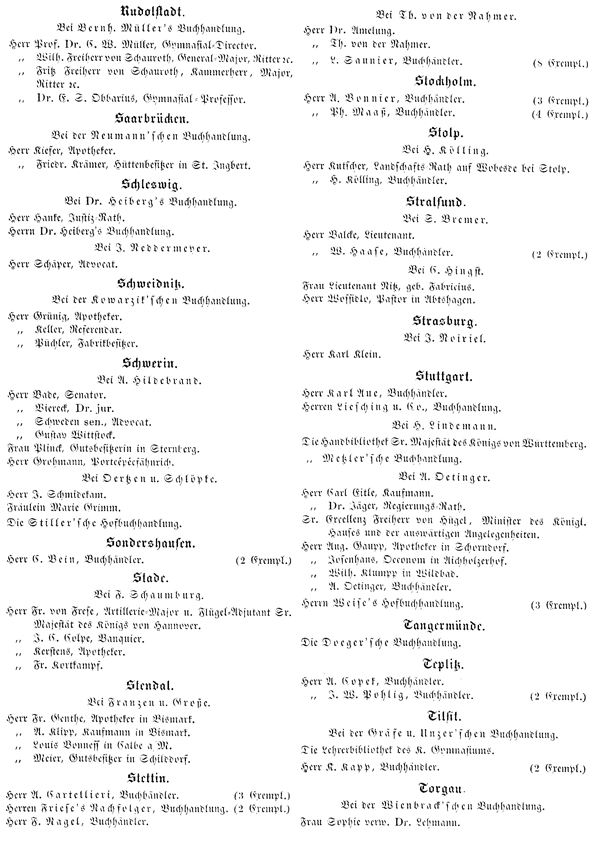
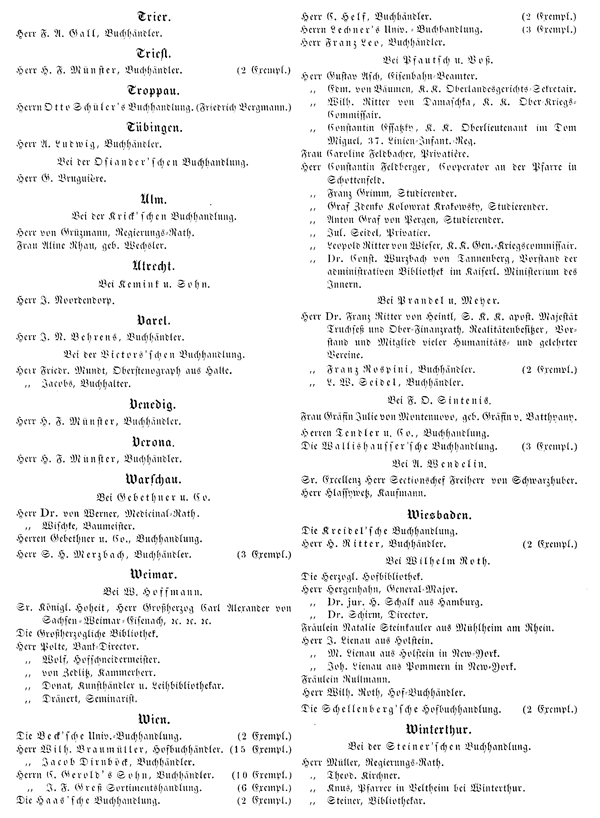
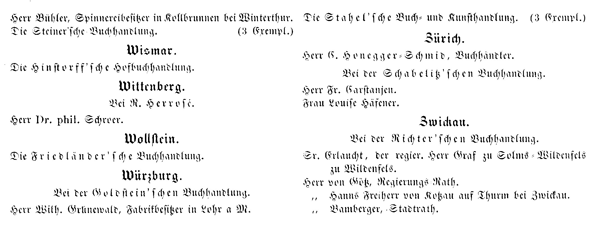

Ende