
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
«Warum ich "Jä gäll, so geit's!" berndeutsch verfasste, weiss ich nicht; es war ein glücklicher Einfall. Ich hatte damit mein ureigenes Gebiet entdeckt.»
Dies ist Tavels Erklärung, kurz und bündig, und wir haben uns an sie zu halten. Warum auch nicht? Glückhafte Entdeckungen können sehr wohl die Folge glücklicher Ein- und Zufälle sein. Trotzdem drängt es uns, dort weiter nachzugrübeln, wo der Dichter sich, begreiflich genug, mit der Tatsache zufrieden gab.
Hatte er nicht schon früher Stoffe aus der bernischen Geschichte bearbeitet, den Major Davel, den Johannes Steiger, und nicht im geringsten daran gedacht, diese Dramen, in denen es doch auf unmittelbarste Wirkung ankam, in der realistischen Mundart zu schreiben? Hier mag die schulmässige Überlieferung vom klassischen Drama mit seinen Formgesetzen von so zwingendem Einfluss gewesen sein, dass ein «glücklicher Einfall» gar nicht in Frage kam. Anderseits würzte der Student Tavel 172 seine Briefe immer gern mit berndeutschen Ausdrücken, wenn es galt, drastische Situationen treffsicher zu beschreiben, und der Journalist bediente sich bei gemütvollen oder witzigen Wendungen des gleichen Mittels.
Das Berndeutsch seines Standes, stark mit französischen Brocken durchsetzt, nicht eigentlich die Sprache der städtischen Bevölkerung, sondern die der alten Junkerngasse und der Schosshalde und der «Campagnen» nah und fern der Stadt, war für Rudolf von Tavel zeitlebens nicht nur im täglichen Gebrauch, sondern ebenso gut bei literarkritischen Erörterungen oder in kirchenpolitischen Debatten das präziseste Instrument des Ausdrucks, für seine Gedanken der schmiegsamste Wortkörper. Was ihm glückte, war, diese ausdrucksfähige Mundart, die bis in wendige Einzelheiten und zarteste Färbungen sein persönlichster Besitz schien, unverbogen und unverblasst in die schriftliche Form zu übertragen. Er entging der Gefahr, die auf jeden Schriftsteller und nicht am wenigsten auf den Mundartdichter lauert: den Ausdruck zwischen Gedanke und Form sich versteifen, erstarren zu lassen. Mit andern Worten: sein berndeutscher Ausdruck ist ein durchaus gesprochener, kein geschriebener, und sein ganzes berndeutsches Werk kann und muss 173 gehört, nicht gelesen werden, wenn es in seiner Pracht und Macht, lieblich und stark zugleich, auf uns wirken soll. Darum war auch keiner besser als er selber geeignet, dieses Werk vorzulesen, das so deutlich spürbar den Atem seines Schöpfers atmet und das Gefälle seines Temperaments im Flussbett der Erzählung aufgefangen hat. Ist es bernisches Gemüt und bernische Seele schlechthin, die hier ihren stilistischen Ausdruck gefunden hat? Man möchte dies nicht wohl behaupten dürfen oder beweisen können. Zu geschmeidig im Beschreiben, zu gefällig im Umschreiben gar ist diese Dichtersprache, der es, wie Otto von Greyerz als zuständiger Beurteiler lobte, gelungen ist, dem hartkörnigen Material mit den Kunstgriffen eines feinern Meissels weiche, spielerische Formen zu geben. So ist das Berndeutsche, das Tavels erzählerisches Werk zu einem Sonderfall im schweizerischen Schrifttum macht, durchaus persönlichen Gepräges, auch wenn es dem Volkstum natürlich enger als jeder schriftdeutsche Ausdruck verhaftet ist.
Man mag es vielleicht bedauern, dass wir kein berndeutsches Gegenwartswerk besitzen, das Tavels Dichterhand geformt hat. Dafür hat er uns eine dramatische Skizze hinterlassen, die sein Bemühen um das reine Berndeutsch in humoristischer Selbstbespiegelung zeigt, und 174 eine Schallplatte bewahrt uns den Tonfall seiner eigenen Sprache auf. In beiden Kleinwerken, liebenswürdigen Gelegenheitsprodukten, schlägt das Herzblut dieses Sprachmeisters; und hören wir durch die historischen Epen das Blut der früheren Generationen mitrauschen, so lauschen wir hier um so bewegter dem intimen Ton seiner Sprache, sehen ihn selber sozusagen bei der Handhabung seines Meisterwerkzeuges zum Privatgebrauch.
An einem Altjahrabend wurde im weiteren Familienkreis von jugendlichen Spielern die köstliche Szene aufgeführt, in der Scherz, Ironie und tiefere Bedeutung sich durcheinander tummeln, scheinbar ganz spielerisch an der Oberfläche; aber im Grunde rühren sie doch an den Nerv der Tavelschen Kunst, und man kann spüren, dass er ihm ab und zu empfindlich juckte. Dann stiess sein sonst so geduldiger Mund wohl aus, was er ein für allemal nannte:
E Schosshaldesüüfzer
Er: Es isch doch o-n-es Eländ mit där brotlose Chunscht. Me het nume ds Tüüfels Dank! Jitz fahrt me wieder über mi här wäge der «Mundart der Hauptstadt», da seit me si syg im Gägesatz zur Buresprach abgschliffe, verwässeret und mit Hochdütsch vermischt. Und 175 das schrybt me de juschtemänt im Ougeblick, wo si z'Zürich uf jedi Glägeheit passe, für üs als Heimatdichter abz'tue. Es isch rächt ergerlech!
Sie: Ja lue, my Liebe, mi muess sech mit däm Literatevolk nid y la. I ha dir geng grate, du söllisch dy Sach mache und se la brüele!
Er: Du bisch guet, nid y la! Du channsch lang di nid wellen y la, wenn si sech mit eim y la . . . weisch, so i de Zytunge . . . Das sy halt Sache!
Sie: Ja, ja, das sy Sache.
Er: Je meh me sech Müej git, descht weniger merke si's. I wott gar nüt säge vo de Skribifaxe, wo vom Land yne chömen und gar nid wüsse, was üses Stadtbärndütsch isch. Die meine, wenn öpper «rärret», so syg er e Patrizier, und wenn er rr seit, so syg's en andere Stärbleche. Ja, so sy si, di Kaffere! Vo de halbe Sache wüsse si nümme, was es isch! Was weiss e so eine vo Peristyle, Pente à l'air, Servante, Chauffe-pieds, Cabarets, Barille! Wie gröber, descht besser, meine si. Geng suecht eine der ander mit Urwüchsigkeit z'übertrumpfe, und ob allem däm merke si gar nid, dass nen all Ougeblick öppis i d'Fädere louft, wo nüt weniger als bärndütsch isch.
Es isch es wahrs Glück, dass men emel no i 176 üsne Familie chly druuf achtet und Sorg het zum gueten alte subere Bärndütsch!
(Charlotte kommt herein)
Sie: Eh, wär chunnt jitz da? Ds Lotti! Grüess di, was hesch du uf em Härz?
Lotti: Grüess di, Tante, grüess di, Unggle.
Er: Grüess di, wie geit's? Du gsehsch grad uus, wie wenn du öppis im Schild füehrtisch.
Lotti: He ja. Der Papa lat la frage, ob du öppe ne Landcharte vo Fryburg hättisch. Mer göh dä Namittag . . .
Er und Sie: Was?! Was weit dr dä Namittag?
Lotti: Mer göh . . .
Er (aufspringend): Los jitz! Los jitz! Üses eige Fleisch und Bluet! Hesch ghört?
Sie: Aber, Lotti!
Er: Hesch ghört? Mer göh – mer stöh –
mer löh! Das bysst eim ja wie Flöh!
Lotti: E – wie seit me de?
Sie: Das söttisch du wüsse. Allons, bsinn di chly!
Lotti: Aha, wohl i weiss . . . mer gönge . . .
Er: Los mer jitz e so öppis! Es jagt eim ja d'Wänd uuf. Anno 1923 seit e Bärner Patrizierstochter: mer göh, mer gönge. Es isch nümme zum Derbysy. – I gibe dir kei Landcharte, bis du rächt lehrsch bärndütsch rede.
177 Lotti: Ja nu, so gange mer . . .
Sie: Aha, los, me cha, wenn me wott.
Lotti: . . . i'ren andere Richtig . . .
Er: So! Da hei mer's wieder: i're – i're – warum nid Irrenanstalt? Und Richtig! Was söll das sy? Richtig isch äbe nid richtig! La gseh, wie seit me?
Lotti: I nen anderi – Diräktion.
Sie: Aha, du wettisch dem Unggle druusschlüüfe, gäll?
Lotti: E mira Richtung.
Er: A la bonne heure! So, jitz will i's la gälte! – Lue, da isch e Charte! Wo weit dr düre?
Lotti: Über Chehrsatz.
Er: Was, wo düre? Weisch nid, dass me z'Bärn Chäsertz seit?
Lotti: Also über Chäsertz.
Er: Aber de müesst dr ech uf d'Bei mache, das isch wyt.
Lotti: Sowieso.
Er: Los jitz! Los jitz! Jitz chunnt das o no mit däm donschtigs Sowieso! Wär het o das uufbracht? Öppis Dumms e so!
Sie: Dir hättet scho vor nere Stund söllen ufbräche.
Lotti: Es sy drum zwöi Herre bim Papa.
Er: Tante, reich mer es Pfund Watte, i muess mer d'Ohre verschoppe. Zwöi Herre, 178 drü Froue, zwee Chinder, zwo Manne! Was ächt no? D'Tanten und du und i sy wieviel Möntsche?
Lotti: He drü . . .
Er: Äbe, da hei mer's! Drü Möntsche! Los jitz, i will dir es Värsli säge:
Es hei zwee Manne zwo Froue gha
Und jedi dervo zwöi Chinder.
Und hätte drei Manne drei Froue gnoh
Und vo dene dreie drü Chinder übercho,
So hätte si dänk nid minder?
Stimmt's?
Lotti: I muess zerscht nacherächne!
Er: So? Das wär guet! Wenn sech nume d'Lüt mit dem Läse vo myne Büecher o chly wette Zyt näh! Het mer nid öpper gseit, er läsi so nes Bändli i eim Abe düre, wo-n-i doch meh als dreihundertfüfesächzig Tag dranne schrybe.
Lotti: So lang schrybsch du a menen einzige Buech?
Sie: Ja meinsch du, der Unggle chönni das alles so us em Ermel schüttle?
Er: Nei – i weiss scho, was d'Lüt meine: Me schicki mir Witzen und Güntli schübelswys! I bruuchi nume der Briefchaschte ga z'läären und alles schön zsäme z'hänke, wie Chrälli a mene Fade, und ds Buech sygi fertig. So stellet dir ech das Gschäft vor, und dernah chönn i d'Füflibere vo däm Faden abstreife, 179 wie düri Bohne, und bi de guete Wärk, wo a Gäldmangel lyde, gloube si, i heig Abrysskaländer vo Tuuseternötli zum Abrupfe. So – jitz muess i gah! Chansch jitz ds Värsli no?
Lotti: Es hei zwöi Manne drü Froue gha . . .
Er: Da hei mer's! Mit euch isch halt nüt az'fah.
I gloub, i tüej besser uf ds Bärndütsch verzichte
Und fürder chinesisch mit ech brichte.
Gäll, öppe so: Gring – Hung – Hang?
Aber eigetlech isch es halt doch e Schang!
*
Der Hinweis auf das derbere Landberndeutsch, von dem Tavel hier schalkhaft drei Wortformen (für Kopf, Hund und Hand) als chinesisch zitiert, soll natürlich kein abfälliges Urteil über die Sprache der Bauern sein. Er kannte und schätzte auch sie, er wusste sie sehr wohl in seinen Erzählungen dort zu verwenden, wo sie am Platze war, und scheute dann auch vor ihren Derbheiten nicht zurück. Aber sich dieser Mundart nur zu dem Zwecke zu bedienen, um mit ihren patinierten Absonderlichkeiten und ungehobelten Kraftausdrücken billige Erfolge zu erzielen, die mit dichterischer Gestaltung nichts zu schaffen haben: das ging ihm völlig wider den Strich, 180 und es schmerzte ihn, hier gelegentlich das Opfer von Verwechslungen zu werden.
Beispiele von eingestreutem Bauernberndeutsch, oberländischem wie emmentalischem, finden sich in seinen Werken häufig. Auf der Schallplatte, die Tavel selber mit einer lustigen Anekdote besprach, dient es zur unmissverständlichen Charakterisierung des ländlichen Handwerkers, der beim städtischen Zuckerbäcker so umständlich wie möglich einen Lebkuchen mit Zuckerguss bestellt. Da diese Anekdote in die Form einer Kindheitserinnerung gekleidet ist, gehört sie mit «Noah und Napoleon» zum Erlebnisschatz der frühen Jugend, der eine künstlerische Behandlung und, in diesem Falle zweifellos, auch eine künstliche Verwandlung erfahren hat. Aber Selbsterlebtes gab wenigstens doch auch die Atmosphäre her zu dieser heiteren Geschichte, die Rudolf von Tavel unvergesslich vortragen konnte, mit dem ersten Worte schon den Hörer unwiderstehlich fesselnd:
Der Läbchueche
Wo-n-i no-n-e Bueb gsi bi, hei mr z'Bärn am üssere Bollwärk gwohnt, grediübere vo der Chilche. Undeninne het e Paschtetebeck sy Lade gha. Aber er het nid nume Paschtete gmacht. Da het's allerhand gueti Sache gä. Me 181 het o Glacen übercho, und i menen Egge vom Laden isch Tee und Chocolat serviert worde, und bsunders berüehmt isch der Papa Durheim gsi für syni Bärner Läbchueche.
Der Lade het usgseh wie-n-es Märli. Uf em grosse Tisch i der Mitti sy d'Süessigkeiten arrangiert gsi wie Gartebeet und Bluemegroupes. I allne Farbe hei si ein aglachet. Und wär weiss, me hätti sech nid mögen ebha, mit beidne Hände da dry z'fahre, wäri nid der Zouberer, der Herr Durheim sälber, i sym bländig wysse Zuckerbeck-Costüme derhinder gstande! A de Wände zringsetum hei glesigi Türmli glänzt voll grüeni, roti, gääli Täfeli, drunder zueche gheimnisvolli Schublädli, wahri Schatzchammere, Bärgwärk vo Chocolat. Und gschmöckt het's, i sägen ech, gschmöckt . . . !
He nu, da isch einisch, a mene Zyschtig, d'Frou alt-Läheskommissäri Dufresne cho Sache bstelle für ne Soirée, Baselweggli, Schulthesse-Brötli, Röschtiwys, und was weiss i sünsch no alles! Und wil das het gä z'brichte, het si sech du im Laden etabliert und sech e Tasse Chocolat la serviere. Chuum isch si abgsässe, geit d'Türen uuf, und e Ma vom Land chunnt yne, e Buur und doch nid ganz e Buur, me het nid rächt gwüsst, was men us ihm mache söll.
182 «Was wär gfellig?» fragt d'Ladejumpfere mit menen übersühnige Tönli i der Stimm. Es het se würklech wundergnoh, was so-n-en eltere Halblynige da suechi.
«E Läbchueche», seit er, «aber de e schöne, tolle, grosse!»
Es isch nid juscht vor Wiehnachte gsi, aber wäge de Frömde het me geng öppen öppis im Vorrat gha. D'Ladejumpfere nimmt e Läbchuechen us der Montere. Si dänkt, dä Ma heig ne villicht im Vorbygah gseh und sygi drob gluschtig worde. «So öppis?» fragt si und het ihm ne dar.
«Wie tüür dä?»
D'Ladejumpfere schilet zum Herr Durheim übere, wo wie-n-e früsch ufbouete Schneedoggel hinder sym Güetzigarte steit und o dänkt: du wirsch wohl sövel a ne Läbchueche wage!
«Drüü füfesibezg», seit er schier chly obenabe.
«So?» antwortet der Buur, «drüü föifesibezg? Hiit Dr kener grössere? Uf ne Föifedryssger chunnt's mr nid a.»
«Bhüet is wohl. – Bis zu're halbe Jucherte», seit der Herr Durheim und nimmt en allmänds Bärner Läckerli-Tafelen us em Glasschäftli. «So öppis?»
«Prezis, da isch es si emel de o derwärt, dryz'bysse. Wie tüür dä?»
183 «Dä chunnt Ech uf füüf.»
«Henusode. Weder äbe. – Es cha mer's nüt, was da druffe stiit. – "Gruess aus Bärn." Da'sch dumm.»
«Ja, was sötti de druffe sy?»
«He, my Name. – Adouf.»
«Das cha men Ech ja mache.»
«Jä, wie lang giit de das?»
«He, we' Dr öppen e Stund chönnet warte . . . Gmacht isch es gly, aber wägem Trochne . . .»
«He ja, i chönnt ja zwüschenyhe no hurti i "Stärne" hingere, i mangleti dert no mit iim ga z'rede.»
«Guet», seit der Papa Durheim, «machet Dir das!»
«Jä chan i de druuf zelle?» fragt der Buur. «Also i're Stung?» Derzue luegt er dür d'Lademonteren a ds Chilchezyt ufe.
«Parole d'honneur», antwortet der Zuckerbeck, «am halbi vieri lyt Eue Läbchueche fix und fertig da.»
Vor der Ladetüren ussen isch der Buur no blybe stah, het i d'Montere gluegt und du no einisch uf ds Chilchezyt, und du isch er langsam dür ds Bollwärk uus gange. –
«Nei, was es doch für wunderlechi Lüt git!» seit d'Frou Läheskommissäri.
«Ja, ja», meint der Herr Durheim, «Dir machet Ech kei Begriff, Frou Dufresni, was da 184 mängisch für Kundine chöme, öppe so a mene Märittag. – Eh, loset, Roseli, tüet dä wieder, wo-n-er highört. Mr nähme de da eine vo denen ohni Décor. Di Sach isch ja grad richtig.»
«Dä het e Schatz. Dä het eifach e Schatz», fahrt d'Frou Läheskommissäri furt. «Was will i wette, dä het e Schatz! Aber dass er de nid däm sy Name bstellt het! Quel drôle d'individu! E Buur isch es nid.»
«I weiss nid, wo-n-i ne hi tue söll», seit der Zuckerbeck, «öppen e Handwärchsma vom Land wird es sy, de Chnode nah e Schuehmacher oder sünscht öppis eso.»
«Es nähm mi wunder, wie das de no wyter geit, aber i cha nid druuf warte. Weit Dr mr säge, was i schuldig bi, Herr Durheim?»
«Eh, mi nimmt de dä Chocolat uf ds Nötli.»
Das het d'Frou Dufresne nid begährt. Si het zahlt und isch gange, und der Zuckerbeck het uf dä Läbchueche gross und prächtig la schrybe: Adolf.
Ne Momänt het me sech gfragt, ob nid am Änd dä Bsteller se für e Narre heig. Aber item, di Sach isch emel du gmacht worde, und wo der Ma umecho isch, het ihm d'Ladejumpfere der Läbchueche dargstreckt und derzue nes Gsicht gmacht, wie-n-es Schuelmeitschi, wo ne ganz e schöni Exameschrift abgit.
185 «Isch es öppe nid rächt?» fragt si, wo der Bsteller der Läbchuechen aluegt und aluegt und mit der Sprach nid wott userücke.
«Hm», macht er, «hm . . . Adouf hiess es jetze. Weder äbe, i hiisse drum nid eso.»
«So? wie de? Dir heit doch gseit, me söll "Adolf" druuf mache. Oder öppe nid?»
«He ja, sälb wohl, aber das schrybt me drum angers. Mit eme ph hinger dranne. So wie Dir's jitz da gmacht hiit, mit emen f, dörft i's nume niemerem ziige.»
«Eh, das het dänk öppe nüt z'säge!» wott der Herr Durheim sy neue Chund brichte. «Das isch halt jitz di neui Mode. I ha's emel e so glehrt.»
«Un i ha's der anger Wäg glehrt. U so wott i's ha. U fertig! Süsch frässit miera dä Läbchueche säuber.»
«Hehe! Nume nid grad so ruuch, Mano! Me chan Ech ja das ändere, we' Dr drann hanget.»
«He nu guet. So machit! Angers wott ne nid.»
«Also guet». Der Läbchuechen isch wieder i d'Bachstube gwanderet.
«Jä, wie lang giit de das?»
«Nid lang. Es isch grad richtig. Sitzet Dir es Ougeblickli da zueche. – Näht Dr öppe nes Glesli Anisette?»
186 «I wiiss nid, was das isch. Weder es wird öppe scho rächt sy.»
Der Herr Durheim schänkt ihm y. Und der Herr Adolf probiert. «Da'sch guete Züüg», seit er, «chly wohl süess, aber i ha's de no gärn.»
«Nähmet no eis!»
«Dank hiigit!»
Er schläcket no der Schnouz, wo men ihm der Läbchueche mit dem verbessereten Adolph bringt.
«Jitz isch rächt», seit er, «jitz wohl», und leit sy Füüfliber uf e Tisch. «U de da dä Glesu – i wiiss nümme, wie Dr ihm sägit.»
«Das isch de drübery.»
«So? He nu, so Dank hiigit!»
«Sooli», seit d'Ladejumpferen und nimmt e rosefarbige Papierboge vüre, «jitz wei mr Euch dä Läbchueche schön ypacke.» Si dänkt, er machi de däm Schatz deschtmeh Ydruck.
«Es manglet's nid», wehrt der Herr Adolf ab, «löit das nume la sy. I ha ne für mi säuber gchuuft, un i isse ne grad uf em Heiwäg. – Nüt für unguet! U bhüet Ech der lieb Gott auisame. Adie.»
Dermit isch er use, mit dem Läbchuechen i der Hand. Wo-n-er der erscht Egge dervo abbisse het, weiss i nid.
*
187 Wenn auch sicher kein Zweifel besteht, dass hier die Mundart ein Element behaglichen Humors ist, so täte man doch Tavels künstlerischer Überzeugung und seinem schöpferischen Ernst ein Unrecht an, wenn man glaubte, er habe auf diesem, allerdings stark begangenen Weg seine Entwicklung zum mundartlichen Ausdruck durchgemacht. Als ihn der «Bund» einmal anfragte, warum er Mundart schreibe, liess er sich ausführlich darüber aus, mit der Versicherung, er sei der Redaktion von Herzen dankbar, dass sie ihm Gelegenheit gebe, den Verdacht zu entkräften, er spekuliere auf die Lachlust der Leser. «Es wäre dies übrigens eine sehr unglückliche Spekulation, denn es ist uns wohl bewusst, dass wir durch die Pflege der Mundart die Grenzen unseres Leserkreises ganz bedeutend verengern.» Tavel fährt in jenem Aufsatz, der 1928 im «Bund» veröffentlicht wurde, mit folgenden Ausführungen fort, die gleichzeitig wichtige Aufschlüsse über das Entstehen seines berndeutschen Erstlings und über dessen Fortsetzung enthalten:
«Bezeichnenderweise sind meinem ersten Versuch, dem Humor in einer Erzählung Luft zu machen, Wochen, ja Monate tiefster innerer Zerrissenheit und Niedergeschlagenheit vorausgegangen, deren Grund ich hier 188 nicht mitteilen kann. Da kam mir eines Tages ganz unverhofft – ein Gottesgeschenk – der glückliche Einfall, aus welchem "Jä gäll, so geit's!" wurde. Ein paar Tage trug ich die Geschichte im Kopfe herum. An Gustav Freytags Technik des Dramas geschult, entwarf ich mir, wie ich es heute noch tue, die einzelnen Figuren, erkannte, dass es klappen würde, und nun erhob sich die Frage, welcher Ton da anzuschlagen sei. Daraus ergab sich ganz von selbst die Notwendigkeit, es einmal mit der Mundart zu probieren, weil im Bereiche meines Könnens kein anderes Ausdrucksmittel dem Inhalt der Novelle besser entsprochen hätte. Der Erfolg hat dem Entschluss recht gegeben. Trotzdem habe ich mir in der Wahl der sprachlichen Mittel die volle Freiheit gewahrt. Lange noch beschäftigte mich das Problem sehr intensiv. Das Manuskript des "Houpme Lombach" blieb monatelang unvollendet verpackt und verschnürt im Kasten liegen, weil ich erst mit meinem ethischen und künstlerischen Gewissen ganz ins Reine kommen wollte. Erst im Laufe der Jahre klärte sich das alles völlig ab.
Heute brauche ich nicht lange über die Frage nachzudenken, ob ich einen Stoff hochdeutsch oder bärndeutsch verarbeiten wolle. Sie löst sich ganz von selbst, indem schon beim 189 Aufreissen der Charaktere die Ausprägung ihres Wesens automatisch den sprachlichen Ausdruck bestimmt. Die Handlung entsteht durch das Reagieren der verschiedenen Charaktere aufeinander, und da stellen sich schon bei den ersten Notizen Worte und Sätze ein. Diese ersten Notizen gestalten sich oft zu Dialogen, die mit geringen Veränderungen in das definitive Manuskript übergehen. Hier löst sich also die Frage, ob eine Erzählung hochdeutsch oder in der Mundart zu schreiben sei. Ich bin so frei zu behaupten, dass man einen Satz von ganz bestimmter Nuance nicht in zwei Sprachen genau gleich formulieren kann. Da nun die meisten meiner Figuren Berner sind, so komme ich der Vollkommenheit ihrer Darstellung am nächsten, wenn ich sie bärndütsch reden lasse. Ich könnte sie freilich auch hochdeutsch miteinander reden lassen, aber dann sind sie eben firnisiert. Ich finde das bloss Gewichste schöner, und manchmal ist auch eine ungehobelte Fläche am Platz.
Ich schreibe also nicht Mundart, weil mir das Bärndütsch Spass macht, sondern weil die Mundart der wirksamste Ausdruck für das ist, was ich sagen möchte, und mir am besten hilft, aus meiner Erfindung ein echtes Kunstwerk zu machen.»
Mundart ist an und für sich ein realistisches 190 Ausdrucksmittel. Sie reisst die Ereignisse, die sie schildert, in die Gegenwart, in den Alltag herein. Das mochte für den Erzähler historischer Zustände und Begebenheiten ein willkommener Kunstgriff nach dem zeitlich Fernliegenden sein, eine Überbrückung jener Kluft, die der Leser historischer Romane so häufig und so störend zwischen sich und dem dargestellten Gegenstand empfindet. Die Mundart bedeutet in Tavels Werk eine beständige Verzauberung – nicht der Gestalten, die der Leser sieht, sondern des Lesers, der diese Gestalten so sprechen hört, als ob sie von heute wären. Dies weckt das Gefühl der Blutsverwandtschaft mit jenen Rotröcken, die unter Napoleon an der Beresina kämpften, mit den aufständischen Bauern und den Stadtbürgern, die Niklaus Manuels Fastnachtspielen lauschten; einer Blutsverwandtschaft, die ja echt genug und wirklich ist, hier aber in erhöhtem Mass durch den Laut der gemeinsamen Sprache beglaubigt wird. Die historische Perspektive verflüchtigt sich wie ein Herbstnebel vor den warmen Strahlen der Sonne. So erschloss Rudolf von Tavel dem bernischen Leser – dem deutschschweizerischen überhaupt und, das sei nicht vergessen, wie vielen welschsprachigen und reichsdeutschen, die den Schlüssel zu diesem Schatz zu gebrauchen 191 lernten! – eine Vergangenheit, die Jahrhunderte umspannt. Aus dem «glücklichen Einfall» des schmalen Erstlings entfaltete sich im Lauf von mehr als dreissig Jahren das vielhundertseitige Epos der Vaterstadt, ein dichterisches Denkmal, wie es seit den Chronisten kein Sohn dieser Stadt geschaffen und ihr dargebracht hat und um das sie manches Geschwister in deutschen und welschen Landen beneiden mag.
«Solang es ein Bern und eine Berner Sprache gibt, solange wird Ihre Dichtung das schönste Kleinod mundartlicher Literatur sein und bleiben», schrieb in prophetischem Überschwang J. V. Widmann dem Dichter in einem Brief schon nach dem ersten Buch. «Und, wie Sie an meiner Frau und mir wieder sehen, können auch Deutschschweizer aus andern Kantonen es vollkommen würdigen; ja, Sie gewinnen durch Ihre Dichtung die Herzen nicht nur Ihrem Buche, sondern auch Ihrer Vaterstadt, deren eigenstes Wesen Sie so liebenswürdig schildern; Bern wird einem noch viel lieber, wenn man Ihre herrliche Erzählung gelesen hat.» Widmann konnte, als er diesen spontanen Dankesbrief für «Jä gäll, so geit's!» entsandte, nicht ahnen, in welch reichem Masse die Zukunft von Tavels Werk seinem raschen, aber sichern Urteil recht 192 geben würde. So unbezweifelbar war für den erfahrenen Kritiker die Wirkung, die von dem Erstling ausging.
Die Verleger waren vorsichtiger gewesen. Einer, der damals zu den Unternehmendsten gehörte, bot dem Verfasser ein Honorar von 75 Franken an gegen endgültige Abtretung aller Rechte. Auch Alexander Francke, an den Rudolf von Tavel sich alsdann wandte, wagte bloss eine kleine Auflage; da aber die 500 Exemplare mit den Bildchen von Walter von May sofort vergriffen waren, fasste er Mut und legte das Werklein neu auf, in einer neuen, von Rudolf Münger und Gustav von Steiger besorgten Ausstattung. «Soweit unsere Erfahrung reicht, steht solcher Erfolg eines berndeutschen Buches einzig da», schrieb der Verleger dem Dichter.
Der gute Stern, unter dem das erste berndeutsche Werk Tavels stand, strahlte nicht nur über den vierzehn andern, die ihm folgten, sondern auch über dem Verhältnis zwischen Dichter und Verleger, das ein musterhaftes Beispiel von gegenseitigem Verstehen und Vertrauen war. «Fünfundzwanzig Jahre lang hatte ich das Glück», schrieb Tavel beim Tode Franckes, «in dem Verstorbenen einen Mann an meiner Seite zu wissen, der gerade das, worüber so unendlich viel gutes 193 Einvernehmen und Lebensfreude zugrunde gehen kann, die materielle Seite eines idealen Berufes, dazu benützte, mir lauterste Freundschaft zu erweisen und unverbrüchlich zu bewahren. Er hat für mich gewagt, mit mir gekämpft und gelitten um den Sieg dessen, was uns beide im tiefsten Herzen bewegte.» Francke hatte ähnlich empfunden, wenn er an seinem 70. Geburtstag dem Dichter schrieb: «Das ist wohl das Höchste, was ein Verleger sich wünschen kann, sich eins zu wissen mit einem edel gesinnten Autor und mit ihm vereint für das Gemeinwohl des Volkes zu arbeiten.» Tavels Werke gaben aber auch in der weiten Leserschaft dem Verlag Francke sein ausgesprochenes Profil und zusammen mit Emanuel Friedlis monumentalem «Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums» und Otto von Greyerz' «Im Röseligarte» den Charakter einer Stätte der Bewahrung und Pflege gesunden Volkstums.
Es ging Rudolf von Tavel mit seinem jungen Brautpaar am Ende des ersten Buches gerade so wie Gotthelf, der einmal seufzte, es sei schwer, mit einer Geschichte Schluss zu machen, da sie doch, wie das Leben, immer eine Fortsetzung habe. Bethli Vilbrecht wandelt mit ihrer weltklugen Güte und Grazie als «di legitimschti Majestät uf Gottes Ärdbode» 194 noch durch zwei Fortsetzungen: «Der Houpme Lombach» 1903 und «Götti und Gotteli» 1906, die dann gesammelt unter dem Titel «Familie Landorfer» die Leser von der Franzosenzeit durch Helvetik und Mediation bis in die Restauration der 30er Jahre führte. Familientradition und eigene Jugenderinnerung steuerten der Phantasie des Erzählers bei, der in einem Brief an Fräulein E. R. über den Houpme Lombach schrieb: «Eine gewisse Wärme und Lebendigkeit in dieser Erzählung ist ohne Zweifel darauf zurückzuführen, dass indirekt etwas von dem russischen Feldzug in meine Kindheit hineingespielt hat. Ein Bruder meines Grossvaters, Oberst von Tavel, hat den Krieg als ganz junger bayrischer Leutnant mitgemacht bis zur Schlacht von Polotzk, in welcher er ziemlich schwer verwundet wurde. Das rettete ihm vermutlich das Leben. Er kam unter vielen Abenteuern auf weiten Umwegen in die Heimat zurück und trat dann mit meinem Grossvater in holländischen Militärdienst. Ob ich ihn je gesehen, weiss ich nicht. Ich kann mich nur blass erinnern, einmal als ganz kleiner Bub bei einem majestätischen Grossonkel gewesen zu sein, komme aber nicht ins Klare, ob es der oder ein anderer gewesen. Aber der Onkel Oberst schwebte immer wie ein sagenhaftes 195 Wesen hinter den Familiengesprächen. Man erzählte dies und jenes von ihm, was mir in meiner Kindheitsempfänglichkeit einen ungeheuren Eindruck machte. Ein Napoleonbuch mit kolorierten Schlachtenbildern tat das übrige hinzu, so dass ich in meinen Phantasien recht oft jenseits des Njemen weilte. Wenn man sich so in eine Zeit hineingelebt hat, so ergibt sich die Anschaulichkeit von selbst.»
Vorerst verliess aber Tavel diese Zeit wieder, um sich in die Geschichte des 17. Jahrhunderts zu vertiefen. Im «Schtärn vo Buebebärg» und in den Fortsetzungsbänden «D'Frou Kätheli und ihri Buebe», 1907 und 1909 erschienen, werden wieder die Schicksale einer Familie, des Obersten Wendschatz und seiner Frau, geborene Willading, vor dem dunklen Hintergrund des Bauernkriegs und der nachfolgenden Ereignisse bis zur zweiten Villmergerschlacht geschildert. Dem Obersten Wendschatz, durch den Rudolf von Tavel eigenste Gedanken aussprechen liess, hatte er das Bild jenes Hans Rudolf von May von Rued unterlegt, den er in Tilliers Geschichte des Freistaates Bern als einen tüchtigen Kriegsmann mit dem Herzen auf dem rechten Fleck kennengelernt hatte. Er schrieb über diese Gestalt, die unter dem unverrückbaren Stern 196 seines Ideals, der Bubenberge, stand, folgende wichtige Auskunft an Fräulein E. R.: «Und nun möchte ich Ihnen erklären, wie ich zu meinem Oberst Wendschatz gekommen bin. Sie wollen es mir nicht als Unbescheidenheit auslegen, wenn ich ein wenig den Deckel meines eigenen Herzens ablüpfe. Von jeher hatte ich eine besondere Sympathie für Menschen, die in stiller Pflichterfüllung ihrem Volk dienen, ohne nach klingendem Erfolg zu haschen. Diese Sympathie verstärkte sich und vertiefte sich noch ganz bedeutend während der Jahre, da ich am politischen Leben aktiven Anteil nahm. Es steigerte sich, je mehr ich Einblick gewann, meine Abneigung gegen die Erfolgmenschen bis zu Hass und Verachtung, meine Neigung zum Schaffen und Tragen in der Stille bis zum Leiden. Diesen Gefühlen musste ich Luft machen. Ich suchte den künstlerischen Ausdruck dafür in einem Roman. Keine Epoche schien mir als geschichtlicher Hintergrund dafür passender, als diejenige des Bauernkriegs mit den darauffolgenden Villmergerkriegen. Es musste ein dunkler Hintergrund sein, eine Zeit der Niederlagen. Als Schauplatz wollte ich eine Gegend haben, die mir völlig vertraut war und die in mir warme Gefühle erweckte. So kam ich auf Hünigen und seine Umgebung, wo ich in den Jahren der besten 197 Empfänglichkeit so viele Eindrücke in mich aufgenommen habe.
Durch diese beiden Momente: historischer Hintergrund und wirkliche Gegend im Bernerland, wurde ich genötigt, auch in der Person des Helden eine Figur zu suchen, die ihrem Wesen nach als Vertreter jener Zeit gelten kann. Sie musste zugleich eine Verbindung herstellen zwischen dem Aargau und Hünigen. Dazu eignete sich dieser Hans Rudolf May vorzüglich, obschon er meines Wissens nie Eigentümer von Hünigen gewesen. Er musste mir nur als Kostümfigur dienen. Den ganzen seelischen Inhalt wollte ich ihm nach freiem Ermessen geben. Um auch ganz frei zu sein, gab ich ihm einen andern Namen. Die Vorbemerkung in dem Buch dient eigentlich nur als Schild gegen den Einwurf, ich hätte in diesem und jenem Punkt Begebenheiten einer wirklich historischen Persönlichkeit herangezogen. Es ist herzwenig. Wenn trotzdem die Figur des Oberst Wendschatz einigermassen Fleisch und Blut angenommen hat, so ist das lediglich dem Umstande zuzuschreiben, dass ich aus vollem Herzen schreiben konnte.
Meine Gefühle sind seither nicht anders geworden. Sie haben sich wohl in der gleichen Richtung weiter vertieft, aber ich stehe diesen Empfindungen heute gelassener gegenüber. Ich 198 weiss, dass die rücksichtslos egoistischen Erfolgmenschen obenan stehen werden und dass andere dafür tragen und leiden werden, solange dieses Menschengeschlecht die Erde belebt. Man findet sich mit dieser Tatsache um so leichter ab, je tiefer man in das Bewusstsein hineinwächst, dass unser wahres Leben nicht hienieden sich abspielt, wenngleich, wie ich in "Heinz Tillmann" andeutete, die goldenen Gassen schon hier betreten werden können.» Der Brief ist 1921 geschrieben.
Dass Tavel mit diesem Werk sein Schaffen ungemein vertieft hatte, spürte seine Leserschaft in beglücktem Miterleben. Widmann attestierte: «Wenn "Jä gäll, so geit's!" ein genialer Wurf war, bei dem der Verfasser vielleicht wirklich wie im Traum, d. h. naiv das Rechte traf, so ist "Der Schtärn vo Buebebärg" das erste eigentliche Meisterwerk des Dichters.» Einige Freunde, «gar guet bschlage» in seinen Schriften, hatten ihm zum Dank durch Rudolf Münger ein Bild malen lassen, das darstellte, wie der Oberst seinem Töldi das Porträt der Lenzburger Tante zeigt, und überreichten es dem Dichter bei einem festlichen Freundschaftsmahl in der Zunftstube zu Schmieden. Die Ehrung freute Rudolf von Tavel ungemein.
Noch tiefer zurück in die Vergangenheit 199 griff die Erzählung «Gueti Gschpane», die er 1912 herausgab. Die Reformation und die Mailänder Feldzüge bilden den geschichtlichen Hintergrund, die kräftigen Gestalten eines Niklaus Manuel und Albrecht vom Stein heben sich gross davon ab. Hier hatte sich der Dichter «gewissermassen in zwei Persönlichkeiten zerlegt, wovon die eine beherrscht ist vom brutalen Streben nach Erfolg, die andere vom Glauben an den Sieg der selbstlosen Pflichterfüllung». Das Zeugnis des Dichters selbst rückt also auch diese Erzählung und die Gestalt Niklaus Manuels unter das Licht des Bubenbergsterns, der ihm fürderhin nicht mehr verblassen sollte. Scharfe Angriffe von katholischer Seite, die das Buch erfuhr, machten ihn nicht irre an seinem Glauben, dass «die treuen Christen beider Konfessionen einmal wieder eins werden», ebensowenig aber an der Wahrheitstreue der Chronisten, nach denen er den Zerfall der Kirche und den Bildersturm schilderte.
Im Kriegsjahr 1915 schrieb er den «Donnergueg», der nun wieder zeitlich eine Fortsetzung der «Familie Landorfer» ist und die historische Episode der Schweizersöldner in Neapel schildert. Diesmal steht wieder ein Frauenwesen im Mittelpunkt, eine von den Sanftmütigen, die das Erdreich besitzen 200 werden; wenn man sie im Dorf Gerzensee den Donnergueg nennt, so ist das, weil sie es nach der Behauptung der Pächtersfrau «ghört i de Gringe donnere, wenn z'änetum no niemer e keis Wüukli gseht». Diese Annemarie Sunnefroh verliert zwar ihre zwei Freier, gewinnt aber dafür mehr und mehr das Bewusstsein ihrer ewigen Bestimmung und damit ein neues Wertverhältnis von Zeit und Ewigkeit. Deutlich münden die inneren Erfahrungen Tavels in diese Perspektive des Romans, den er fern von der täglichen Befassung mit Kriegsnachrichten und Gefangenenelend im stillen Schloss Wildenstein vollendete.

Gemälde von R. Münger
. . . Nume dem Töldi het's der Oberscht zeigt und ne gfragt:
"Weisch no, wär das isch?". . . . .
Aus dem "Schtärn vo Buebebärg"
In die Zeiten des Übergangs und der Helvetik leiteten noch einmal die beiden Romane «D'Haselmuus» und «Unspunne» zurück, die er 1921 und 1923 veröffentlichte. Eine Fortsetzung des ersten Buches war zuerst nicht geplant, aber, sagt Tavel, «das Gefühl, Xandi komme schliesslich doch zu unverdient in den Besitz seiner Geliebten, veranlasste mich, die Geschichte weiter zu spinnen. Doch legte ich dem Ganzen ein anderes Ziel zugrunde und benannte demgemäss das zum Zeitgemälde ausgewachsene Buch Unspunne, womit der Grundgedanke ausgesprochen ist». Künstlernaturen, wie der Schriftsteller und Historiker Sigmund Wagner, der Maler König, der Sigriswiler 201 Pfarrhelfer und Liederdichter Kuhn und Hans Rudolf Wyss, der Herausgeber der «Alpenrosen», denken diesen Grundgedanken zuerst und der Wirklichkeit voraus: «Mer wei jitz Liecht machen und dem Volk zeige, dass Grund gnue da isch, sech z'freue, dass es es Land het, wo's wärt isch, sech derfür z'wehre, und dass es imstand isch, sech z'wehre, ohni frömdi Hülf und frömdi Regänte. D'Schwyz isch es Glück für d'Wält, aber nume so lang si äbe d'Schwyz blybt. Sobald si den andere Länder glych wird, isch si nümme, was si sy söll. D'Schwyz i ihrer Freiheit isch e Gottesoffebarung, und wenn men ere d'Freiheit nimmt, so isch es Wunderwärk gschändet. Drum wei mir a d'Arbeit und im Ougschte z'Unspunnen obe ds Volk la i Spiegel luege. Da müesset dir, Chünschtler und Poete, vora!» Unschwer spürt man aus solchen Worten wiederum den Druck der Gegenwart, die schwere moralische Last der Nachkriegsjahre auf Rudolf von Tavels Dichterherz. Auch dieses Werk wollte erziehen, indem es unterhielt und erfreute.
Immer schwerere Akzente setzte er auf seine Dichtungen. Die letzten fünf grossen Romane bieten breit angelegte Charakter und Entwicklungsstudien, gründliche Seelenanalysen, die aber durchaus künstlerisch in Handlung und Schilderung aufgelöst sind. In den Jahren 1924 und 1925 schrieb er «Ds verlorne Lied», einen eigentlichen Erziehungsroman, dessen Schauplätze das Gürbetal und Lothringen sind, und wozu er einige Anregung von dem «Leben Johannes Justingers» empfing, einer autobiographischen Veröffentlichung des Georg Samuel von Werdt von Toffen, die dieser 1785 in Berlin hatte drucken lassen. Tavel gewährte während der Arbeit Fräulein E. R. Einblick in seine Werkstatt, indem er ihr von seinen Bemühungen um den Helden des Romans, den Junker Raffael Senno, berichtete: «Also . . . mein Raffi wächst wie eine Pflanze in gutem Erdreich, und ich mache alle Sorgen mit ihm durch, die man mit so einem Buch allemal wieder durchmachen muss. Einen Tag kommt's mir vor, als müsste gerade dieser Roman das Beste werden, was mir in die Feder gekommen ist, andern Tags beschleichen mich wieder bange Zweifel. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass mir je bei einer früheren Arbeit so viele dankbare Nebenkonflikte aus dem Hauptkonflikt herausgewachsen wären. Da heisst es, immer auf Beschränkung bedacht sein . . . Je tiefer die Konflikte greifen, desto schwieriger gestaltet sich die Lösung, und manchmal scheint es, als wüsste niemand anders einen Ausweg als der Gevatter Tod. Da reizt 203 mich nun just die Schwierigkeit der Aufgabe, und ich will es versuchen, ob nicht mit Umgehung aller durch den Tod herbeizuführenden Lösungen die wachsende sittliche Kraft Raffis all diese Situationen siegreich zu überwinden vermag. Ich fange an, daran zu glauben. Diese sittliche Kraft ist im Grunde genommen bei ihm nichts anderes als der Glaube an die Weltüberwindung durch Jesus.» Und als der Roman vollendet war, kehrte Tavel noch einmal zu der Gestalt des Helden zurück: «Allerdings habe ich in den Raffi am meisten von meinem Bein hineingetan, und drum ist er – nicht kräftiger geworden. Was Gutes und Grosses an ihm ist, ist leider bei mir immer noch Programmnummer anstatt Fleisch und Blut. Und bald bin ich zu alt, um Erträumtes und Erstrebtes Gestalt werden zu lassen.» Eine pessimistische Anwandlung, die, auf sein künstlerisches Schaffen bezogen, durch die nächsten Werke widerlegt wurde.
Im Herbst 1927 erschien der Roman «Veteranezyt», an den er im Frühling auf den Maiensässen ob Sitten die letzte Hand gelegt hatte. Das Buch ist gesättigt voll von der seligen Atmosphäre seiner frühesten Jugend, die Handlung spielt auf den Besitzungen draussen vor der Stadt Bern in den Sechzigerjahren und endigt mit dem deutsch-französischen 204 Krieg. «D'Gandegg isch voll desoeuvrierti Offizier gsi, Veteranen us frömde Dienschte, bsunders Napolitaner.» Darf man aber nicht vielmehr sagen, dass hier ein Gemeiner vor allen Offizieren die Hauptrolle spielt? Peter Wyme, der stattliche Kutscher, der zweien Herren zu dienen hat, gewinnt mit seinem abenteuerlichen und schweren Schicksal unsere Anteilnahme in stärkerem Mass als die ganze, doch so bunte, sozial schon etwas zusammengewürfelte Nachbarngesellschaft der Patrizier Rhagor und Doxat und des Gerichtspräsidenten Bürki, «konservativ bis i d'Zahndwürze ynen und e brave Ma, aber e Demokrat, eifach e Demokrat, der einzig i der ganze Gandegg». Und nun bekennt Rudolf von Tavel zu allem Überfluss schon während der Niederschrift des Romans in einem Briefe noch: «Natürlich wird die Seele dieses Peter auch die Züge meiner Seele tragen, aber du wirst mich von einer andern, neuen Seite kennen lernen und sagen, so ein Mensch sei ich doch nicht. Und doch bin ich's. Aber du wirst dann hoffentlich aus dem Buch auch sehen, was die Liebe, die mir zuteil wurde, aus dem Menschen machen kann und auch aus mir innerlich gemacht hat.» Der leise Hinweis soll nicht überhört werden.
Das nächste Jahr brachte eine Sammlung 205 von sieben Novellen, die er unter dem Titel «Am Kaminfüür» seinen Patenkindern zueignete. Auch diese Geschichten erzählen zum Teil von den Altvorderen; denn kenne man die, so lerne man die Gegenwart erst recht verstehen. «D'Möntsche sy, wie si geng gsi sy. Gäb was d'Möntschheit düregmacht het, glehrt het si nüt. Me chönnt's anders ha.»
Während Tavel mit der Zusammenstellung dieser Erzählungen beschäftigt war, umkreiste sein schaffender Geist ein Problem, das seit dem «Söldner»-Drama im innersten Ring seiner Gedanken gestanden hatte, und eine Zeit, die mit ihrem wandernden Soldatentum immer seine Phantasie angelockt hatte. Ein Besuch auf Schloss Wildenstein, wo er seinerzeit den «Donnergueg» niedergeschrieben, liess auf ihn wieder die «wundervolle historische Landschaft» des Aargau wirken, was er in einem Brief an Fräulein E. R. schon im November 1927 zum Anlass dazu nahm, die verständnisvolle Freundin in seine neuen Pläne einzuweihen und ihr in grossem Überblick sein Berufsleben zu charakterisieren, das ihn von 1905 bis 1915 wieder in die Redaktion des «Berner Tagblattes» geführt hatte: «Ich bin froh, dass ich den Blick auffrischen konnte, denn meine Pläne führen mich abermals in die Zeit des dreissigjährigen Krieges, 206 der mich schon in meinen Knabenjahren in ganz besondere Stimmungen zu versetzen vermochte. Wenn's mir, wie ich hoffe, gelingt, das richtige Trom zu erfassen, so möchte ich den Faden nach Venedig und in dessen Türkenkriege hineinspinnen. Die Hauptfiguren habe ich schon ziemlich klar im Kopf. Den leitenden Gedanken brauche ich nicht mehr zu suchen. Es ist das Heimkehrmotiv, das mich nicht mehr loslassen wird, solange ich hienieden lebe. Ich habe mich seit dreissig Jahren damit befasst, und es zieht sich im Untergrund durch alles, was ich schrieb, nur bin ich heute besser imstande, mich in die Rolle dessen einzufühlen, der mit zerbrochenen Masten, zerrissenen Fahnen und zunichte gewordenen Plänen aus der Fremde in die Heimat zurückkehrt. Ich kann das jetzt besser fühlen, nicht weil ich erfolglos hinter den Ofen des Stöckli kriechen müsste – es geht mir ja gut – aber am inwendigsten Menschen habe ich es verstehen gelernt.
Als ich mein Söldnerdrama schrieb, beherrschte mich die Überzeugung, der Christ solle nie in die Fremde gehen, nie in einen Beruf sich einnisten, der nicht die beste Möglichkeit bietet, da zu bleiben, wo er gewissermassen sich ununterbrochen vor Gottes Angesicht sieht. Es bedeutete damals für mich: 207 einen Beruf wählen, der es gestattet, direkt für das Reich Gottes zu werben oder wenigstens sich aller Tätigkeit zu enthalten, die Gefahren für die religiöse Entwicklung bietet . . .
Heute denke ich darüber ganz anders. Gott führt uns eben andere Wege. Gewöhnlich zeigt uns das Werkzeug, das er uns in die Hand gibt – die natürliche Begabung – den Weg, den wir zu gehen haben. Aber nicht selten führt er uns in ein Land, wo wir mit diesem Werkzeug nichts anzufangen wissen, wo uns scheint, wir seien am lätzen Ort. Wir müssen unser mitgebrachtes Werkzeug zur Seite legen und mit einem uns fremden arbeiten. Das hat aber sein Gutes. Jetzt erst lernen wir unser Werkzeug lieben und schätzen. Es ist, als ob Gott es uns zeitweilig wegnähme, um uns deutlicher empfinden zu lassen, was wir daran haben. So wird die Sehnsucht, mit dem uns speziell Verliehenen fruchtbar zu werden, angespannt; sie wird jetzt erst recht zur Kraft.
Mir ist es ganz deutlich so gegangen! Solange ich auf der Redaktion des "Tagblattes" war, blieb ich in einer Halbheit. Ich konnte meine Gabe verwerten und doch nicht recht, weil ich ihr nicht ganz leben konnte. Dann kam ich neun Jahre nach – "Ägyptenland", in die Dürre des Versicherungswesens, damit die Sehnsucht nach meiner Bestimmung zur 208 Kraft werde. Dann ging's weitere neun Jahre wieder in die Halbheit, die Redaktionsstube, die mir mehr und mehr zum zweiten Aufenthalt in der Wüste wurde, und dann brach der Tag an, an dem ich auf den mir zugewiesenen Acker gehen durfte. Wie oft dachte ich doch, es hätte kürzere Wege zu diesem Äckerlein gegeben. Aber jetzt sehe ich immer deutlicher, dass nichts verloren ging. Der Aufenthalt in der Wüste hatte sein Gutes, hat die Sehne gespannt und mit dem Wüstensand manches geputzt . . .»
Als von Tavel 1927 diesen Brief schrieb, arbeitete er bereits am «Frondeur». Dieser wurde 1929 auf dem Stauffen vollendet, einem Weidberg bei Röthenbach im Emmental, nicht fern von den Jagdgründen seiner unvergesslichen Diessbacher Verbannung. Aber die Quintessenz der neuen Auffassung, die er in jenem Brief bekannte, fanden seine Leser schon auf der letzten Seite der eben erschienenen «Veteranezyt», wo die Jungfer Carlotta ein Rätsel aufgibt: «Was isch überall a sym Platz und doch niene daheim?» Der Kutscher Peter hätte gerne gesagt: ein Soldat, und Frau Marianne: eine Krankenschwester. Aber die Jungfer Carlotta antwortete selber auf ihre Frage: «I will ech's säge: e Chrischtemöntsch.» So verflechten 209 Tavels Grundprobleme seine Schöpfungen aus reifster Zeit mit seinen Jugendwerken, tauchen bald in dieser, bald in jener Form früh oder später auf und leiten seiner Kunst das nährende Herzblut seiner Überzeugung und seines Bekenntnisses zu.
Der «Frondeur», der dem Dichter den stillen Dank der Täufergemeinde in bernischen Landen und einen Buchpreis der Schweizerischen Schillerstiftung eintrug, hätte ursprünglich in eine Rahmenhandlung hineingestellt werden sollen, die das moderne Parallelschicksal in einer Bauernfamilie aufgezeigt hätte. Der Dichter des Heros-Romans hätte diesen selbst erzählt, und zwar an einer Reihe von Abenden im Chuderhüsi, einem Gasthof auf aussichtsreicher Höhe im Emmental, wo gerade eine nationalrätliche Kommission tagt. «Durch das Anhören angeregt, hätte eine, das Land in Wahrheit repräsentierende Bäuerin ihres Sohnes Geschichte derb, schlicht und bieder zum besten gegeben. Darüber wäre es mit den Parlamentariern zur Diskussion gekommen, und das Weib hätte den Ratsherren von heutzutage unter Hinweis auf die einstigen alle Schande gesagt.» Das Notizenheft zum «Frondeur» enthält über diese Rahmenerzählung ausführliche Einzelheiten, die an Deutlichkeit der Gesinnung 210 nicht nur der Bäuerin, sondern auch des Dichters keinen Zweifel gestatten, und am Ende die knappe Bemerkung: «Ich liess dann den Rahmen weg, weil es wohl nicht der Moment war, die zwar verdiente Bloßstellung der Nationalräte vorzunehmen.»
Statt der verurteilenden Kritik wandte sich Rudolf von Tavel der mahnenden Darstellung des grossen Beispiels zu. Es hiess für ihn: Bubenberg! Und er gestaltete es im grossen Roman «Ring i der Chetti», der 1931 erschien und dem Andenken an den getreuen Freund Rudolf Münger gewidmet war. Der Maler, der so viele Bücher Tavels mit seiner Kunst ausgestattet hatte und seinem Schaffen immer mit leidenschaftlicher Teilnahme gefolgt war, hatte ihm wiederholt nahegelegt, einen Bubenbergroman zu schreiben, zuletzt noch wenige Tage vor seinem Hinschied im September 1929. Bald darauf machte sich Tavel an die Arbeit. Für die oberländischen Stellen war ihm Pfarrer Egger in Äschi kritischer Ratgeber. Der Roman erschien zuerst im Feuilleton der «Neuen Zürcher Zeitung», wodurch sich Tavels Mundartkunst in der Ostschweiz eine Leserschaft eroberte, die bisher der berndeutschen Sprachform eines Romans voll ungerechtfertigter Zurückhaltung oder gar in Ablehnung gegenübergestanden hatte.
211 Schon im Januar 1927 schrieb Tavel an Fräulein E. R.: «Ich weiss nicht, ob ich nicht eines Tages einen zweiten "Schtärn vo Buebebärg" schreiben werde, um noch einmal unsern Demagogen recht vor Augen zu halten, wie sie die Demokratie ad absurdum führen. Im Kanton Bern gibt es zwei hochmoderne Tänze, die noch viel schlimmer sind als die importierten Negertänze: den um das goldene Kalb, getreulich mitgetanzt von manchem, der Lobeshymnen auf den heiligen Franz singt, und den um das Simmentaler Fleckviehkalb. Und trotzdem liebe ich ja das Bernervolk von Herzen und immer mehr, woraus sich ein tiefgehender Konflikt entwickelt. Ob ich die Kraft aufbringe, dem noch einmal Gestalt zu geben? Nun, wenn es Gottes Wille ist, wird's seinerzeit dazu kommen.» Als er dann zwei Jahre später die Arbeit unternahm, mit gründlichen Vorstudien auf dem geschichtlichen Gebiet, das ihm übrigens schon von früher her gut vertraut war, gab ihm die Gestaltung diesmal besonders viel zu schaffen, weil er einerseits historische Biographie und künstlerisches Lebensbild in Einklang zu bringen, anderseits aus der Vielgestaltigkeit des gegebenen Stoffes die möglichst einfache, alles Nötige klar und vollständig aussagende Form herauszuprägen hatte. Denn dieses 212 stellte er sich hier als besondere Aufgabe: das Bild zu zeichnen, das «für den Sehenden alles enthält und dem schlichten Menschen so verständlich ist, dass er, auch wenn er's nie in Worte prägen könnte, seinen ganzen Inhalt fühlt und ahnt». Obwohl verschiedene, zum Teil grosse und wichtige Nebenarbeiten wie der Generalbericht des Synodalrates für das Jahrzehnt 1920 bis 1930 ihn gelegentlich stark ablenkten, rückte der Roman dennoch ruhig und stetig vor: «All das Gestürm der letzten Wochen hat mich nicht einmal so draus gebracht. Je mehr ich mich einlebe in die Hauptgestalt, desto menschlicher wird mir Adrian, und doch wird er hoch ins Heroische wachsen», schrieb er Ende 1930 und fügte, seine eigene Begeisterung nachsichtig verulkend, die Glosse bei: «Ich bin sogar so voller Huldigung an meinen Helden, dass ich neulich abends an der Stelle, wo früher sein Denkmal stand, nicht nur das Knie bog, sondern mich platt auf den Bauch legte, quer über die Tramschienen; dass gerade kein Tram kam, ist ein gutes Omen für den Roman.» Das Standbild Bubenbergs war in jenem Jahr aus Rücksicht auf den wachsenden Verkehr, dem es im Wege stand, vom Bubenbergplatz an den benachbarten Hirschengraben verlegt worden.
213 Über grundsätzliche Fragen der dichterischen Arbeit, die ihn so tief bewegte, gab sich Rudolf von Tavel Rechenschaft in einem Brief an Fräulein E. R., der Ende Juli 1931 geschrieben wurde, als der endgültige Abschluss in Sicht stand: «Es war eben wieder einmal eine Zeit voll Arbeit und Unruhe. Auf dem Mont Pélerin konnte ich wohl tüchtig vorwärts machen mit meinem Bubenberg, aber fertig wurde ich noch lange nicht. Gerade der sehr schwierige Schluss gab mir viel zu denken und zu schaffen. Man sollte einen derartigen Stoff ein Jahrzehnt mit sich herumtragen können, bevor man ans Niederschreiben geht. Ich habe ja freilich schon vor Jahren daran gedacht, aber so recht in die Bubenberghaut hineingewachsen bin ich dann doch erst bei der Ergründung des historischen Stoffes, der gross und weitschichtig ist und in bezug auf die Figur Adrians schwere Rätsel aufgibt. Da man in wesentlichen Fragen ganz auf Vermutungen angewiesen ist, wäre ja der dichterischen Phantasie volle Freiheit gewährt, aber es widerstrebte mir, aus Adrian eine romantische Idealfigur zu machen, die unserm bernischen Empfinden gar nicht entspräche. Es bleibt übrigens auch bei Weglassung aller Vergötterungsversuche des Grossen noch reichlich genug, namentlich Züge, die vielleicht von 214 unserer Generation nicht als besonders gross empfunden werden, es aber in Wahrheit sind. Manchem Leser mag das Buch eine Enttäuschung sein, weil er sich von Helden nach den landläufigen Überlieferungen eine ganz andere Vorstellung macht. Tant pis! Gegen meine Überzeugung schreiben kann ich nicht.
Eine grosse Schwierigkeit bot die Rücksichtnahme auf den heutigen Durchschnittleser, bei dem man so wenig geschichtliche Kenntnis voraussetzen darf und der sich auch nicht die Mühe nimmt, zum Geschichtsbuch zu greifen, um den Zusammenhang zu verstehen. So war ich genötigt, allerhand einzuflechten, was die Rundung des Romanbildes eher beeinträchtigen muss. Die damalige Zeit ist überreich an Geschehnissen, ungeheuer bewegt, und die politische Situation ist so kompliziert wie nur möglich und für den nicht historisch Unterrichteten schon deshalb schwer zu verstehen, weil ja die Staatengebilde gar nicht den heutigen entsprechen. Es ist überhaupt alles anders, das Kulturelle, die Rechtsverhältnisse, die Mentalität usw.
Und doch – wie merkwürdig gleichen die Zeiterscheinungen in manchem Punkt der heutigen Nachkriegszeit! Gleiche Ursachen erzeugten gleiche Folgen, so dass Bubenbergs letzte Sorge sein musste, im Interesse der 215 gesunden Fortentwicklung des eidgenössischen Gedankens und der Stadt Bern der durch die Kriegswirren heraufbeschworenen Korruption zu wehren. An wen sollte er sich wenden, um seinen Ideen zum Durchbruch zu verhelfen? Alle führenden Männer mussten dem Volk als der Bestechung durch Pensionen, als dem Mammonismus verfallen erscheinen. Und da Adrian selber zwar als verschuldet, aber doch als reich galt, musste auch das Vertrauen in ihn gefährdet sein. So wenigstens musste ihm selber die Situation erscheinen. Notgedrungen muss er auf den hinweisen, der aller Korruption unzugänglich war, weil auf allen Gewinn und Genuss verzichtend, auf einen unbestechlichen Richter in Israel. Er kannte ihn nicht, aber er war bereits da, in der Gestalt des Niklaus von der Flüeh, den ich nur noch wie ein Phantom andeuten konnte.
Und heute? Wartet nicht unsere Zeit auf den, der den Mut hat zu lehren und zu beweisen, dass die Lösung der sozialen Frage nicht in der allgemeinen Besserstellung (die ich ja jedem von Herzen gönne), sondern in der Fähigkeit und im Willen zum Verzicht zu suchen ist?»
Der Hinweis auf den Bruder Klaus fand übrigens im Buche selbst Ausdruck in einer Schlussvignette, die der Berner Maler Fritz 216 Traffelet zeichnete. Und wiederum stand der Bruder Klaus unsichthar mitten in der Arbeit, die alsobald in Angriff genommen wurde, kaum war der Bubenberg-Roman erschienen. Zwar, auf dem grauen Notizenheft stehen die Initialen des Niklaus Manuel Deutsch und des Caspar von Mülinen und beim Maler das Zeichen des Dolches, womit er seine Bilder signierte, beim Ritter das Wappen; aber die gotterfüllte Weltweisheit: «Dä wo nüt het, cha alles!» stammt aus dem Tun und Lassen des Klausners im Ranft, wenn eine Notiz Tavels sie auch dem Maler und Reformationsdichter zuschreibt: «Manuel sieht das Nüt ha als Voraussetzung und geht so weit, dass man auch die anvertrauten Talente haben muss, als hätte man sie nicht, so dass man frei ist zu jeder Aufgabe.» Und im Vorspruch zum neuen Roman «Meischter und Ritter», der im Herbst 1933 erschien, wurde der Bruder Klaus fast wie ein Schutzheiliger für das Buch angerufen: «Hie und da stellt der lieb Gott eine zwüschenyne, wo grad bliben isch, wie-n-e Tanne, fescht gwachsen im Heimetboden und mit dem Trib der Sunne zue. So einen isch der Brueder Chlous gsi. A däm gmässe sy mr allizsäme glych weneli nutz, die vo dennzumalen und di Jüngschten i der Schwyz, ob Meischter oder Ritter.»
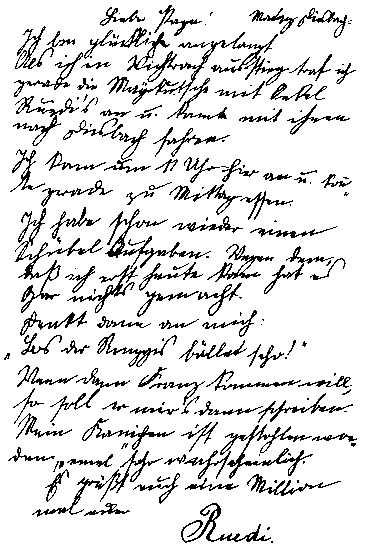
Die Handschrift des Schülers
Diessbach, 26. September 1881
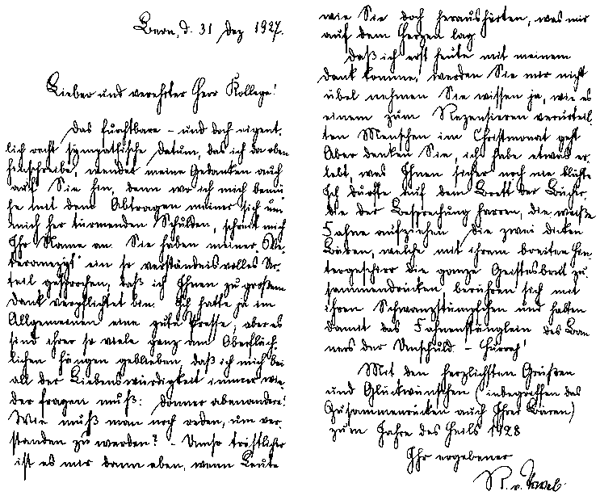
Die Handschrift des Mannes
217 Tavels letzter Roman birgt der Probleme womöglich noch mehr als der Bubenberg. «Rätsel um Niklaus Manuel» betitelte Tavel einen Aufsatz, den er in jener Zeit schrieb, und er meinte dort vorwiegend diejenigen, die seine künstlerische Persönlichkeit umgeben; aber die menschlichen, waren die nicht noch tiefer? Es lockte ihn, diese Künstlergestalt zu beschwören, die als «Läufer Gottes» mit dem höchsten Amt belehnt ist. Den Geistesmenschen stellte er dem Mächtigen dieser Welt gegenüber, den Künstler dem Politiker. Dieser Gegensatz bedeutete in den Zeiten der Reformation so gut ein Zeichen der Krise, wie er es heute ist. Die Kluft im Sinnbild zu überbrücken, war Rudolf von Tavels letzte künstlerische Aufgabe. Es ist das Grundproblem aller verantwortungsbewussten Kunst, die wirken, erziehen, Menschenherzen bilden und nicht nur unterhalten will.
Welchen gewaltigen Weg hat der Epiker von dem graziösen Auftakt «Jä gäll, so geit's!» bis zum monumentalen Schlussgesang im «Meischter und Ritter» zurückgelegt! Durch wie viele Menschenleben, Schicksale, aufblühende und gebrochene Herzen, über wie viele Schlachtfelder Europas und der verzagten und siegenden Seele führte der Weg ihn und uns, seine Leser. Bald war es eine Avenue 218 enchanteresse, wie er den Muristalden einmal nennt, der im Angesicht der altersgrauen stolzen Stadt die grüne Halde langsam erklimmt, bald eine Via triumphalis, als welche er die Alleen besingt, die aus der Stadt hinaus ins fruchtbare Land und unter den Fernglanz der ewigen Berge führen; bald aber auch nur der abseitige Pfad eines Einsamen, eine dunkle Hintergasse durch Not und Elend. Nichts wäre irriger, als aus Tavels Romanen nur den zierlichen Ton gemessener Menuette oder das Harnischklirren heisser Schlachten vernehmen zu wollen. Ihm ging es um die verschwiegenere Sprache der Herzen. Und um das Windessausen der Ewigkeit durch der Menschen Leben, das da ist wie Gras.
Um seiner Kunst diesen höchsten Ausdruck abzuringen, war ihm das Mittel der berndeutschen Mundart recht und gut genug. Über ihre Möglichkeiten und Grenzen gab er sich früh schon Rechenschaft, aber nichts freute ihn mehr, als dass sich seine Leser im Lauf der Jahre davon überzeugen liessen, der Mundart sei kein tiefstes Gefühl unaussprechlich. Allerdings fand er noch am Ende seines Schaffens die frühe Überzeugung bestätigt, «dass verschiedenartiges Schweigen der bei den Bernern am meisten gebrauchte Ausdruck für pathetische Empfindung ist». So schrieb er Charly 219 Clerc, dem besten welschen Kenner des zeitgenössischen deutsch-schweizerischen Schrifttums, der mit Ausdauer und erstaunlicher Einfühlung auch Tavels Mundartwerke zu würdigen wusste. Noch im Todesjahr hatte der Dichter die Genugtuung, dass sein welscher Kritiker die Möglichkeit gelten lassen musste, im Berndeutschen auch tragische Töne mit Erfolg anzuschlagen. «Sollten Sie ein Vorurteil überwunden haben, so habe ohne jeden Zweifel auch ich im Laufe der Jahre etwas gelernt», schrieb ihm Tavel mit feinem Augenzwinkern.
Den kenntnisreichsten und zuständigsten Beurteiler seines sprachlichen Ausdrucks schätzte er in Otto von Greyerz. An ihn, den «zutraulichen Weggenossen», wandte er sich gelegentlich in mundartlichen Fragen – und etwa auch mitten aus eifriger Arbeit mit dem Stoßseufzer: «Berndeutsch – je mehr ich's pflege, desto heikler kommt's mir vor!» Ihm sprach er auch bei der öffentlichen Feier seines 70. Geburtstages den Dank für die unentwegte Erfüllung seiner Sendung aus, die darin bestanden habe, sich als Akademiker für die Sache der Mundart einzusetzen und «der so oft missverstandenen und in ihrer künstlerischen und kulturellen Bedeutung unterschätzten Bewegung die ihr gebührende Achtung 220 auch in den Kreisen der Gelehrten zu verschaffen». In Otto von Greyerz sah er aber auch 1916 «den Arzt, der selbst gespürt hat, wie's weh tut». Was tat weh, was war geschehen?
Rudolf von Tavel hatte einen hochdeutsch geschriebenen Roman herausgegeben: «Die heilige Flamme», der in bäuerlichem Milieu während der Zeit des grossen Krieges und der Grenzbesetzung spielt. Sein Verleger, Dr. Francke, hatte ihm während der Arbeit, nach Lektüre einiger Teile des Manuskripts geschrieben: «Ich habe es ohne jedes Vorurteil als eine gegebene Tatsache hingenommen, dass der Roman schriftdeutsch geschrieben ist. Je weiter ich aber beim Lesen kam, um so stärker stieg mir das Bedauern auf, dass Sie sich nicht unseres lieben Berndeutsch bedient haben . . . Denn damit sage ich Ihnen nichts Neues, wenn ich feststelle, dass die Anhänglichkeit und Liebe der deutschen Schweiz, insonderheit des Berner Volks, dem Bärndütschdichter gilt, der die Mundart aus der Tiefe des Unbeachtetseins hervorgeholt und durch seine Prägung zu neuem Leben erweckt hat. Wie Sie den Patrizier, den Städter, den Bauern reden lassen, das ist Ihr Verdienst und Ihre Eigenart, das klingt in den Ohren so heimelig wie keine andre Sprache und ist dem Berner eine Musik, 221 der sich nichts anderes vergleichen lässt. Und darauf wollen Sie verzichten? Ohne zwingenden Grund? Glauben Sie mir, es ist nicht nur das Was, es ist ebensosehr das Wie, das die Herzen höher schlagen lässt beim Lesen Ihrer Bücher, an deren Seite das neue in seinem fremden Gewand wie ein – Stiefbruder erscheinen würde . . . Hier stehe ich, ich kann nicht anders! Es hat mich schwere Stunden gekostet, bis ich mich entschloss, Ihnen dies Geständnis zu machen. Nehmen Sie mein Wort als das, was es ist: die Herzenserleichterung eines Ihnen treu ergebenen Mannes.»
Es war mehr als das: ein Appell, dem Tavel kaum widerstand, kam er doch aus dem Munde nicht nur des besorgten Verlegers, sondern eines wahrhaft freundschaftlich gesinnten Verehrers seiner Werke, der besser als viele andere in die Werkstatt des Dichters Einblick hatte. Dennoch blieb Tavel bei seinem Entschluss. Er hatte ja, gerade in den Jahren, die vorangingen, eine Anzahl Geschichten für Zeitschriften, Kalender und auf Anfragen anderer Verlage in hochdeutscher Sprache geschrieben. Der Verleger musste feststellen, dass es «im Grunde also die Erfüllung eines alten Wunsches» sei, wenn Tavel mit einem grösseren schriftdeutschen Werk vor die 222 Leserwelt trete; aber selbst als das Werk erschienen war und grossen Erfolg hatte, wollte sich Dr. Francke noch immer nicht recht über das Preisgeben der Mundart trösten lassen, wie der Dichter dem Kritiker Otto von Greyerz mitteilte.
Trotzdem behielt Tavel die hochdeutsche Sprache auch für den drei Jahre später erscheinenden Roman «Heinz Tillmann» bei, das Gegenstück zur «Heiligen Flamme», sowie für eine Reihe kleinerer und grösserer Erzählungen, die in den letzten Kriegsjahren und seither geschrieben wurden. Den äusseren Anlass zu ihrer Niederschrift mag in manchen Fällen der Umstand geboten haben, dass Rudolf von Tavel im Frühjahr 1917 die Redaktion einer vom Verleger Friedrich Reinhardt in Basel neu gegründeten Zeitschrift übernahm, die auf Tavels Vorschlag den Namen «Die Garbe» erhielt. In ihr veröffentlichte er zahlreiche Novellen, teils historischen Inhalts wie «Mutter und Heldin» (nach den Memoiren der Marquise de Bonchamps) oder «Amor im Burgunderkrieg» (in der Buchausgabe «Amors Rache» betitelt), teils aus der problemgesättigten Gegenwart oder aus der froh und frei spielenden Phantasie erdichtet wie «Düss», eine Pfarrergeschichte, oder «Heimgefunden» und «Die Sonntagsschüler». Einige davon 223 sind als Stab-Bücher im gleichen Verlag erschienen. Zwei grössere Novellensammlungen gab er bei Francke heraus: 1918 «Bernbiet» und 1932 «Schweizer daheim und draussen». Im letzten Band befindet sich «Theterli am Wendelsee», entstanden 1924, vor «Ring i der Chetti» eine Beschwörung der Zeit und Welt um Bubenberg, wie es später das Schauspiel «Der Heimat einen ganzen Mann» noch einmal war. Der Bau der bernischen Kraftwerke gab den Anstoss zu einem grösseren Roman, dessen Schauplatz auch die Grimsel mit ihren gewaltigen Stauseebauten hätte sein sollen; ausgeführt wurde aber 1920 bloss eine Darstellung der Mühleberganlage unter dem Titel «Von grosser Arbeit»; die Maler Carlo von Courten und Rudolf Münger illustrierten das in Novellenform den Bau schildernde Buch. Ein Ferienaufenthalt in Adelboden endlich regte 1921 die Erzählung «Simeon und Eisi» an, die mit ihren religiösen Problemen «ein gut Stück Selbstbekenntnis» ist, wie Tavel in einer Notiz vermerkt.
Man wird dem hochdeutsch geschriebenen Werk des Dichters dann am besten gerecht, wenn man seine Herkunft aus den gleichen Quellen betrachtet, denen die berndeutschen Schöpfungen entströmt sind. Denn ihr Wesen ist ein und dasselbe. Alle diese Erzählungen, 224 auch die beiden Romane, hätten ebensogut berndeutsch geschrieben sein können, ohne etwas von ihrer Eigenart einzubüssen. Ja, ist es nicht so, dass wir durch ihr hochdeutsches Lautbild Tavels urtümlichen Tonfall zu hören vermeinen, sein Berndeutsch, aus dem sich dieses Schriftdeutsch Satz für Satz genährt hat? Und dass wir es wie ein Versagen des künstlerischen Gestaltungswillens dort empfinden, wo der berndeutsche Untergrund verlassen wird?
Rudolf von Tavel war sich selber wohl der Stärke bewusst, auf die er sich verlassen durfte. Er kannte seinen Weg wie seine Um- und Abwege; er hatte sie im Lauf der Jahre und aus der Erfahrungen Fülle kennen gelernt. Als Dr. Alexander Francke, der bekanntlich eine breitästige Bergtanne zum Verlagssignet gewählt und als Briefkopf einen lustigen Buchfinken hatte zeichnen lassen, seinen 70. Geburtstag feierte, schenkte ihm Tavel eine Skizze, die man wohl als ein Stück Lebensgeschichte des Dichters bezeichnen darf und die rückschauend über die wichtigste Entscheidung in seiner künstlerischen Laufbahn noch einmal Auskunft gibt über jenen «glücklichen Einfall», der ihn sein ureigenstes Gebiet entdecken liess:
225 Wie der Buechfink und d'Bärgtanne mir der Wäg gwise hei
Wenn me numen ei Wäg weiss, so het me sech hald usbsunne. Aber gar mänge kennt zwe oder no meh Wäge, wo alli zletscht a ds glych Zil füehre, und es verwärweiset mänge ds halb Läbe, gäb er sech uf d'Strümpf macht, und de ma-n-er nümme gcho mit dene paar Jahr, wo-n-ihm no blybe. Und anderi wei's geng nid gloube, wenn me ne seit: das da isch dy Wäg. Si gange lieber en andere, wo-n-es se dunkt, er verheissi ne meh. Di Schlimmschte gange geng da, wo der gross Huufe geit, und meine, si chömen am wytischte, und de sy si de mängisch ganz verwunderet, dass si im Huufen undergangen und hindedry nume niemer nüt vo ne wott gmerkt ha.
He nu! I bi emel uf myr Walz o einisch i ds Wärweise cho. I d'Härzstadt vom Bärnervolk hätt i möge. Und die isch dahinde, ganz z'hinderscht i de Bärgen obe, wo me nid so liecht zuechechunnt. Zerscht isch es no ring gange, schier äbeswägs, und wil me geng no d'Schneebärge het gseh übere Wald und über d'Hublen uus luege, het me nid wohl chönne lätz gah.
226 Bi no jung gsi und ha gsunge, was mer so under em blaue Himmel z'Sinn cho isch. Aber nah-ti-nah sy di schöne Schneechappen und d'Silberfirschte hinder em Wald verschwunde, und me het müesse luege, dass me nid us der Richtung chunnt. Uf nere schöne stille Bärgmatte het sech der Wäg gablet. Ds Fahrsträssli isch graduus gange, ungfähr dem Bach nah. Aber e Fuesswäg het rächts abboge, chly holperig und verwahrloset. Fuesswäge sy gwöhnlech chürzer und füehren ehnder a ds Zil; aber mi weiss nid, was si eim öppe beizen a Stotzigi, a Sumpf, Chräche, Risete, Bachbett, ja mängisch gange si under Wasserfälle düre, über schwindligi Fluehbänder, Gletscherspält und Chrinele, wo Steine drinn chöme cho der dürab z'schiesse. Wär weiss!
Zmitts uf der Weid, a der Wäggable, steit e währschafte rot und schwarz agstrichene Wägwyser, obe dran zwe Arme. Der eint het ufe Fahrwäg dütet, und druffe het's gheisse: Hochdütsch. Der ander Arm het gäge ds Fuesswägli zeigt: Bärndütsch.
Ja, jitz, was han i mit däm gwüsst? Eigetlech het's mi meh uf Fuesswäge zoge; aber sones Fahrsträssli het o öppis für sech. Me trifft meh Lüt a. Es geit dür Dörfer, und gwöhnlech findt me gueti Wirtshüser und Frässbedli a de Strasse, nid z'rede vo der 227 Müglechkeit, dass men öppe no a mene Fuehrwärk cha hinden ufsitze, wenn me nümme sött wyter möge.
I bi einschtwyle chly über di Weid gloffe bis zu mene Fündlig, wo zwüsche schönen Ysehuetstuden und Silberdischtle glägen isch. Dert bin i druuf gsässen und ha gstudiert, was i söll. Nid wyt dervo isch en alti Bärgtanne gstande, schön g'aschtet bis a Boden abe und voll Zäpfe, wo ds Harz wie guldigi Hungtropfe dranne glänzt het.
Uf eis mal chäderet öppis näbe mir uf mym Stei, und wo-n-i luege, fäcklet da-n-e Buechfink umenandere, gümperlet, stellt sys Chöpfli schreg, luegt mi bald mit dem rächte, bald mit dem linggen Öugli a, wetzt der Schnabel am Fündling und seit: «Was witt?»
«He, wenn's di wunder nimmt», sägen i, «i dänke drüber nache, wele Wag dass i söll näh.»
«Dyne», seit der Fink.
«Myne?»
«Wele sünsch?»
«Ja, wenn i jitz erscht no wüsst, weles mynen isch.»
«Du bisch mir eine, du! Chunnt da ufen und weiss nid emal, wo düre dass er wott.»
Mit däm isch my chlyne Fründ dervo gstobe. Uf en oberschte Zwisel vo der Tanne, wo sech 228 schön zmitts zwüsche Mönch und Jungfrou i d'Sunnen ufegreckt het.
«Los jitz! Los jitz!» het er pfiffe.
I sitzen uf mym Stei, der Chopf i de Händ und d'Ellbögen uf de Chneu und lose.
Jitz faht's hübscheli afah sühnen und suusen i der Tanne. Und du isch es Ruusche druus worde, wie wenn me vo ganz wytem e Wasserfall ghört, kei Harfe chönnt's schöner. Bald het's tönt wie-n-es Chörli vo Chinder, bald wienen alti Mannsstimm. Und nah-ti-nah het's Sinn und Wort übercho.
«Also, du möchtisch zum Bärnervolk und weisch der Wäg nid? Was suechsch du eigetlech dert?»
«Was i sueche? Ungfähr das, was eine suecht, wenn er a nere Felswand oder dem Wald öppis zuerüeft.»
«Aha, es Echo.»
«Ja, nume git der Wald alles ume, was men ihm zuerüeft, und i möcht, dass ds Volk da oben antworteti, was na sym Sinn isch. Härz zu Härz! Das wär so, was mir gfiel.»
«Guet, so fah du numen a. Gang uf em chürzischte Wäg, uf em Fuesswäg!»
«Das wär mir scho aständig, aber i förchte, si achte sech desse nume gar nid, wenn eine da so chunnt uf em Wägli, wo der Joggeli sy Bränte treit. Si hei ehnder es Oug uf e 229 Fahrwäg. Uf mene gfäcklete Schümmel sött me cho z'ryten und uf nere guldige Harfe spile. Da würde si luegen und lose.»
«He ja, oder grad mit nere glänzige Blächmusik und nere tolle Pouke, gäll! Dass si us allne Gässleni chämte cho z'springen und "Bravo" brüelete, gäb si nume wüsste, für was. Nei, gang du nume z'Fuess!»
«Däm Bravo früeg i nüt dernah. Aber weisch, es git halt Sache, wo me nume mit der Bassgyge cha säge, so gross und fyrlech.»
«Das bildisch du dir y. Grad di allergröschten und tiefschte Sache cha men am dütlechschte säge, wenn me redt, wie eim der Schnabel gwachsen isch. Git's e höcheri Höchi, e tieferen Abgrund als ds Härz vo menen Einsame? Git's e blauere Himmel als der Himmel, wo-n-es eifalts Härz dry ufe luegt? Git's e vollere Ton als der gsund Härzschlag?
Was bruuchsch du ne guldigi Harfe, für was e gfäcklete Schümmel? Gang wie du bisch, nimm ds Härz uf d'Zunge, und red, wie si rede: bärndütsch. Und du wirsch gseh, dass der grad di Beschte losen und Bscheid gäbe. Das raten i dir, di uralti Tanne, wo mit tuused und aber tuused Nadle lost und weiss, was ds Läben isch uf de Bärge. Folg mer nume, und du wirsch di nid greuig wärde!»
230 Und i ha nere gfolget und bi der Fuesswäg gange, ha ds Härz uf d'Zunge gnoh und gredt wie d'Bärner rede, und i gloube, si heige mi verstande.
Der Buechfink isch geng mit mer gfloge vo Tanne zu Tanne bis i d'Härzstadt vom Bärnervolk und het derzue pfiffe: «Jä gäll, so geit's! wenn me der alte Tanne folget.»
Ja, ja, Dank heigisch, Buechfink!